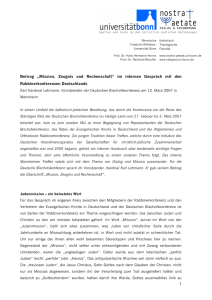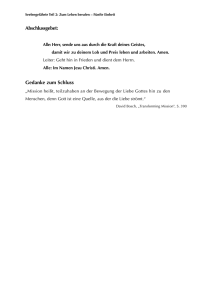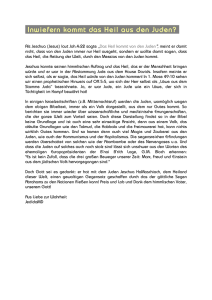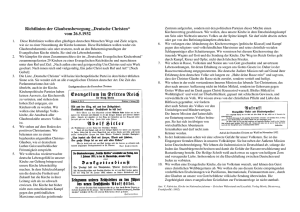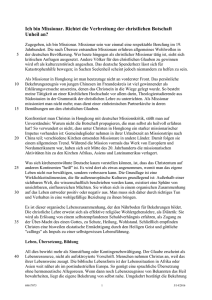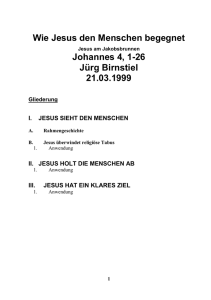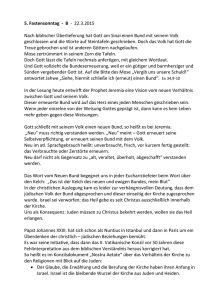II Zum Missionsbegriff - 29. Deutscher Evangelischer Kirchentag 2001
Werbung
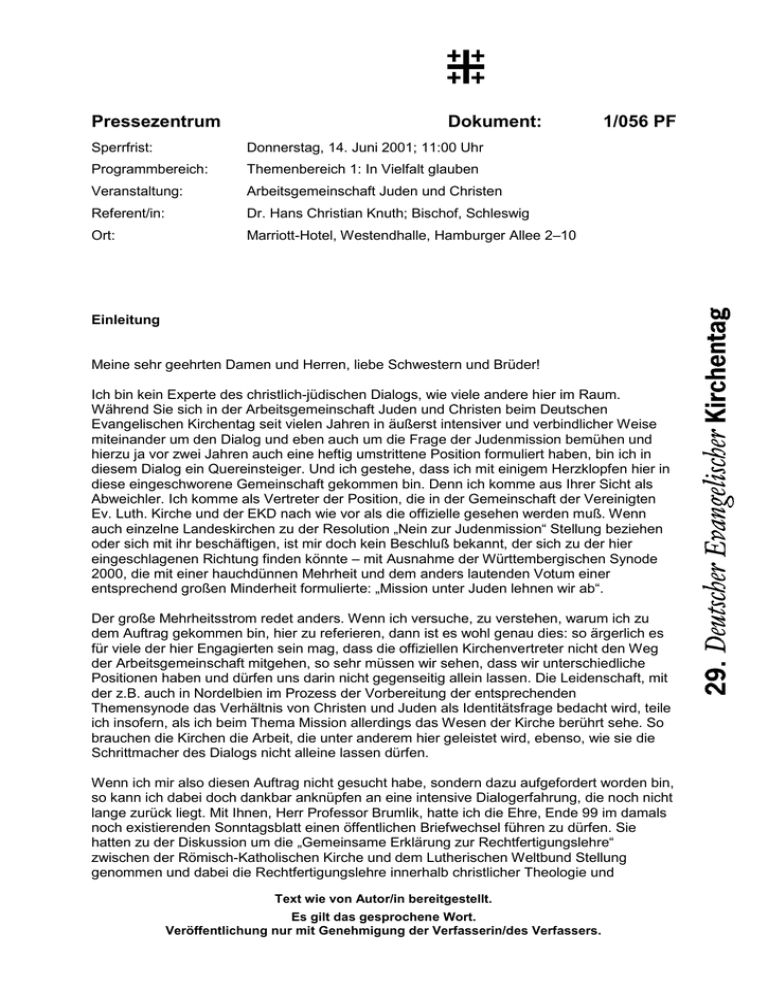
Pressezentrum Dokument: Sperrfrist: Donnerstag, 14. Juni 2001; 11:00 Uhr Programmbereich: Themenbereich 1: In Vielfalt glauben Veranstaltung: Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen Referent/in: Dr. Hans Christian Knuth; Bischof, Schleswig Ort: Marriott-Hotel, Westendhalle, Hamburger Allee 2–10 1/056 PF Einleitung Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! Ich bin kein Experte des christlich-jüdischen Dialogs, wie viele andere hier im Raum. Während Sie sich in der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag seit vielen Jahren in äußerst intensiver und verbindlicher Weise miteinander um den Dialog und eben auch um die Frage der Judenmission bemühen und hierzu ja vor zwei Jahren auch eine heftig umstrittene Position formuliert haben, bin ich in diesem Dialog ein Quereinsteiger. Und ich gestehe, dass ich mit einigem Herzklopfen hier in diese eingeschworene Gemeinschaft gekommen bin. Denn ich komme aus Ihrer Sicht als Abweichler. Ich komme als Vertreter der Position, die in der Gemeinschaft der Vereinigten Ev. Luth. Kirche und der EKD nach wie vor als die offizielle gesehen werden muß. Wenn auch einzelne Landeskirchen zu der Resolution „Nein zur Judenmission“ Stellung beziehen oder sich mit ihr beschäftigen, ist mir doch kein Beschluß bekannt, der sich zu der hier eingeschlagenen Richtung finden könnte – mit Ausnahme der Württembergischen Synode 2000, die mit einer hauchdünnen Mehrheit und dem anders lautenden Votum einer entsprechend großen Minderheit formulierte: „Mission unter Juden lehnen wir ab“. Der große Mehrheitsstrom redet anders. Wenn ich versuche, zu verstehen, warum ich zu dem Auftrag gekommen bin, hier zu referieren, dann ist es wohl genau dies: so ärgerlich es für viele der hier Engagierten sein mag, dass die offiziellen Kirchenvertreter nicht den Weg der Arbeitsgemeinschaft mitgehen, so sehr müssen wir sehen, dass wir unterschiedliche Positionen haben und dürfen uns darin nicht gegenseitig allein lassen. Die Leidenschaft, mit der z.B. auch in Nordelbien im Prozess der Vorbereitung der entsprechenden Themensynode das Verhältnis von Christen und Juden als Identitätsfrage bedacht wird, teile ich insofern, als ich beim Thema Mission allerdings das Wesen der Kirche berührt sehe. So brauchen die Kirchen die Arbeit, die unter anderem hier geleistet wird, ebenso, wie sie die Schrittmacher des Dialogs nicht alleine lassen dürfen. Wenn ich mir also diesen Auftrag nicht gesucht habe, sondern dazu aufgefordert worden bin, so kann ich dabei doch dankbar anknüpfen an eine intensive Dialogerfahrung, die noch nicht lange zurück liegt. Mit Ihnen, Herr Professor Brumlik, hatte ich die Ehre, Ende 99 im damals noch existierenden Sonntagsblatt einen öffentlichen Briefwechsel führen zu dürfen. Sie hatten zu der Diskussion um die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und dem Lutherischen Weltbund Stellung genommen und dabei die Rechtfertigungslehre innerhalb christlicher Theologie und Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers. 2 Frömmigkeit als Ausdruck christlichen Antijudaismus identifiziert. Ich habe versucht zu erklären, warum gerade die Rechtfertigungslehre als Herzstück christlicher Theologie und christlichen Glaubens jedem christlichen Triumphalismus entgegensteht und von mancher unheilvollen antijudaistischen Auslegungstradition unterschieden werden muß. Dabei waren schnell auch über die Rechtfertigungslehre hinaus Fragen der Christologie und der Trinitätslehre grundlegend wichtig. Der Diskurs war nach meinem Empfinden sehr lebhaft, vor allem aber, bei aller Kontroverse, von gegenseitiger Hochschätzung geprägt. Dafür bin ich dankbar, und ich will auch heute alles daran setzen, dass das so bleibt. Denn nur so sind nach meinem Erleben Verletzungen aushaltbar, die nicht vermeidbar zu sein scheinen angesichts der furchtbaren Geschichte christlichen Antijudaismus und der Mißverständnisse, die dieser Geschichte zu Grunde liegen, sowie angesichts einer Missionsgeschichte der Kirchen, die im Blick auf manche Abschnitte und Konzepte zu Scham und Schuldeingeständnis nötigt. Sie, Herr Professor Brumlik, äußerten die Hoffnung, „dass unser Dialog nicht abbrechen möge“. Diese Hoffnung teile ich, und so bin ich bei aller Grösse der Aufgabe dankbar, hierher eingeladen worden zu sein. Der Auftrag hat darüber hinaus sicher noch einen weiteren Aspekt. Sie alle wissen ja, dass die Resolution „Nein zur Judenmission“ dieser Arbeitsgemeinschaft nicht die einzige während des Kirchentages in Stuttgart zum Thema war. Sie wurde beantwortet durch eine Resolution der „Werkstatt des württembergischen Pietismus“, die im wesentlichen von Bischof i.R. Theo Sorg formuliert war und aufgrund der neutestamentlichen Grundlinie der Mission lediglich besondere Fragestellungen bezüglich des Christuszeugnisses von Deutschen zu Lebzeiten der Holocaustgeneration zulassen wollte, nicht aber einen grundsätzlichen Verzicht auf die Universalität des Christusereignisses im Blick auf Israel. Es wäre schön, wenn wir hier einen Schritt weiterkämen. Dazu will ich einen Beitrag zu leisten versuchen. I. Der Kontext Der Horizont, in dem wir uns bewegen, ist der der schon erwähnten Resolutionen von 1999. Die der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen hatte das programmatische „Nein zur Judenmission“ schon im Titel. Vorgeschaltet war eine Formulierung, die das besondere Verhältnis von Juden und Christen irgendwo zwischen Ökumene und interreligiösem Dialog als „innerbiblischen Dialog“ kennzeichnete unter Bezug auf die tatsächlich singuläre Verbindung zwischen uns, nämlich die Heilige Schrift der Juden, die unser Altes Testament ist. Das „Nein zur Judenmission“ war begründet durch die theologische Grundüberzeugung von der Treue Gottes zum Volk Israel, von der abgeleitet wurde, das Christusereignis habe keine Heilsbedeutung für die Juden. Teilt man diese Überzeugung, ergibt sich als Konsequenz logisch der Widerspruch gegen alle Missionsbemühungen von Christen gegenüber Juden. Der Missionsbefehl weise Christen demnach an alle Völker der Welt mit Ausnahme der Juden. Der breite Traditionsstrom christlichen Antijudaismus bis hin zu Pogromen mache die Verkündigung der Kirche für viele Menschen unglaubwürdig (dies übrigens als ein Satz, der ja weit über die Frage der Judenmission hinaus Bedeutung hat). Schließlich wird Bezug genommen auf die Empfindlichkeit des jüdisch-christlichen Dialogs, der durch als Bedrohung empfundene Judenmission nicht gefährdet werden dürfe. Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers. 3 Die Resolution der „Werkstatt des württembergischen Pietismus“ antwortet mit Verweis auf die Israel – Bezogenheit des Christusgeschehens nach neutestamentlichem Befund und widerspricht damit der ersten These der Resolution der Arbeitsgruppe von der Bedeutungslosigkeit Christi für die Juden. Zwar wird auch hier auf das besondere Verhältnis von Juden und Christen rekurriert und gefolgert, „dass das Christuszeugnis in Israel eine andere Qualität hat als die Mission unter Heiden“. Und auch die sich aus der deutschen Geschichte ergebenden besonderen Schwierigkeiten eines deutschen „christlichen Zeugnisses an Israel“ werden benannt. Festgehalten wird aber, „dass Jesus, der Sohn Gottes, zuerst für Israel gekommen“ sei, „dass er auch für Israel am Kreuz gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden“ sei. So sei Jesus „der Heiland der Völker und der Messias Israels“. Als weiteren Text aus der Fülle der Verlautbarungen, den wir mindestens berücksichtigen müssen (und damit komme ich von den Expertenvoten zu den kirchlichen Stellungnahmen), nenne ich die Studie der EKD „Christen und Juden III“, die ein eigenes ausführliches Kapitel der Frage der Judenmission widmet. Ausgangspunkt ist hier die biblische Erkenntnis: „Christlicher Glaube ist seinem Wesen nach missionarisch. (...) Verzicht auf öffentliches Zeugnis wäre gleichbedeutend mit einer Zurücknahme der universalen Dimension christlichen Glaubens.“ (S. 49). Aus der weitgehenden Vergeblichkeit der Judenmission zu biblischer Zeit und deren Interpretation durch Paulus als Teil des Heilsplanes Gottes für alle Völker sowie dem Respekt gegenüber dem so erkannten Gotteswillen, den wir neu von den frühen Zeugen zu lernen hätten, wird dann allerdings geschlossen, dass die Rettung Israels und der Christenheit am Ende nicht unbedingt als Krönung der christlichen Missionsbemühungen zu betrachten seien. Vielmehr wird hier auf die neu entdeckte Gewißheit von der bleibenden Erwählung Israels verwiesen und gefolgert: „Unbeschadet der grundsätzlichen Universalität des christlichen Zeugnisses ist die Notwendigkeit besonderer christlicher missionarischer Zuwendung zu den Juden heute kritisch in Frage zu stellen.“ (S. 55). Die Studie hält also fest, dass das christliche Zeugnis allen Menschen gilt. Sie hält besondere Bemühungen unter Juden mit dem Ziel der Konversion zum Christentum nicht für die Aufgabe der Kirche und stellt fest, dass es sie in den Mitgliedskirchen der EKD nicht gibt. Dies allerdings wird, anders als in der Resolution der Arbeitsgemeinschaft, nicht damit begründet, dass das Evangelium die Juden prinzipiell nichts angehe, sondern damit, dass das christliche Zeugnis heute aufgrund historischer (also nicht theologischer) Argumente in Form der geschwisterlichen Begegnung zu erfolgen habe. II Zum Missionsbegriff Damit sind wir bei einer entscheidenden Weichenstellung: beim Missionsbegriff. Denn einerseits ist organisierte Judenmission im Rahmen der EKD allenfalls eine Randerscheinung, jedenfalls kein Thema landeskirchlicher Missionswerke. Andererseits scheint mir das in der Diskussion kritisierte Missionsverständnis ganz von den Aktivitäten eben dieser Randgruppen geprägt zu sein. Deren Missionsverständnis muss aber als ein in der missionstheologischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte längst überwundenes betrachtet werden, und zwar nicht nur im Blick auf die Judenmission, sondern im Blick auf die Mission der Kirche ganz allgemein. Die Missionsvorstellungen des 19. Jahrhunderts, an die nach der Katastrophe des 2. Weltkrieges in Auseinandersetzung und Abgrenzung noch einmal angeknüpft werden musste, waren geprägt von der Idee der Mission als Ausdehnung der christlich-westlichen Welt mit ihren Werten, Lebensformen und religiösen Vorstellungen. Der Vorrang und die Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers. 4 Überlegenheit der abendländischen Zivilisation gegenüber anderen Kulturen waren fraglos. Das Fremde sollte durch die Mission zu seinem eigenen Wohl auf das Eigene hin assimiliert werden. Der Neuansatz der 60er Jahre läßt sich nur im Zusammenhang der Krise verstehen, in die dieses Verständnis durch vielerlei Umbrüche geraten ist: das Ende der kolonial geprägten westlich-abendländischen Missionsbewegung zusammen mit der Vorstellung einer Stufenfolge höherer und niedriger Kulturen, die Verselbständigung der „jungen Kirchen“ in der Phase der Entkolonialisierung und deren Forderung nach Anerkennung kultureller Eigenständigkeit nicht-westlicher Völker, das Wachsen des Zerstörunspotentials globaler, technischer Zivilisation als erschreckend dominantem „Kulturexport“ der einst so hochgeschätzten westlichen Welt. Das bedeutete die Trennung der christlichen abendländischen Synthese zwischen Mission und Zivilisation. Es war eine Glaubwürdigkeitskrise als Folge der verheerenden Wirkungen des 2. Weltkrieges und des wachsenden Zweifels an der Überlegenheit und moralischen Integrität des westlichen Christentums. In dieser Situation kam es zu einer christologisch – universalen Ausrichtung der Mission und zu ihrer Verankerung in der Lehre von der Sendung Gottes („Missio Dei“) statt in der Mission der Kirche. In diesem Konzept des christologischen Universalismus ist es Gott, der Mission betreibt, nicht in erster Linie der Mensch. Der legt Zeugnis ab im Dialog mit anderen, läßt sie an seiner Glaubenserfahrung teilhaben, wird so Werkzeug der Mission Gottes und überläßt aber die Wirkungen als Zielbestimmung seines Handelns dem Heiligen Geist. Nicht von der Missionstätigkeit der Christen wird Bekehrung erwartet, sondern vom Wirken des Heiligen Geistes. Damit entfiel das Ziel einer (Rück-) Eroberung der säkularen Welt oder des Rückzugs aus der Welt, sondern „Solidarität mit der Welt sollte die Grundform missionarischer Präsenz werden“ (Werner S. 146). Nicht die Rettung einzelner Seelen vor der Verdammnis war Grundziel, sondern Gottes Frieden für die Welt. In dem Begriff der „säkularen Welt“ lag jedoch auch ein Problem: wieder waren westliche Vorstellungen maßgeblich für die globale Missionstheologie. Die Konfrontation des Südens mit der Industrialisierung und den dadurch augelösten sozialen Problemen machte die Missionsbewegung der 70er Jahre zum Sprachrohr der Opfer dieser Phänomene. Dies war die Stunde der Befreiungstheologie. Die Qualifikation der Armen als Subjekte und primäre Adressaten der Missio Dei, die „Option für die Armen“, sozialethische und politische Formen der Befreiung waren Dreh- und Angelpunkt des Missionsauftrages. Die Bedeutung der Armen wurde christologisch mit der bei ihnen zu erfahrenden Gottespräsenz gedeutet, da Gott als Leidender bei den Leidenden zu finden sei. Der Widerspruch zwischen den westlichen Werten und dem Evangelium stand im Vordergrund. Auch ein kirchenkritisches Element enthält das Konzept der „Missio Dei“: Als Instrument der Mission Gottes wird die Kirche auf ein funktionalistisches Verständnis reduziert und gilt selbst nicht als Bezugsgröße missionarischen Handelns. Die Kontextualität der Kirche, also die radikale Bezogenheit auf das Umfeld der Mission statt auf die Institution, war das Programm. (Das hat sich in den 70er Jahren noch einmal verändert. Es stellte sich heraus, dass die Sendung an die Welt nicht gänzlich auf Kosten der Sammlung gedacht werden kann. Gerade um der Sendungsfähigkeit willen braucht die missionarische Kirche nach innen den Ort der Vergewisserung und neuen Ausrichtung.) Als in den 80er Jahren Mission und westliche Kultur immer weiter auseinandertraten, wechselte die Perspektive. Der Gott an der Seite der Armen wurde zum Ausgangspunkt der Kritik westlicher Missionskonzeptionen. Dies markiert den Übergang vom modernen zum postmodernen Horizont missionstheologischen Nachdenkens. Und angesichts der bleibenden Präsenz anderer Religionen und ihrer wachsenden Bedeutung für das Zusammenleben in den bisher christlichen Kulturen und der kleiner werdenden globalisierten Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers. 5 Welt gerät die Frage nach dem Wahrheits- und Offenbarungsgehalt anderer Religionen ins Blickfeld. Mission wird verstanden als „Einladung zur Konvivenz“ (Sundermeier). Evangelische Identität wird beschrieben als exzentrisch, weil sie ihren Grund nicht in sich selbst, sondern außer ihr selbst hat, als relational, weil sie ihre Eigentlichkeit durch den anderen in der Begegnung gewinnt, indem sie ganz beim anderen ist, sowie als eschatologisch, denn sie ist auf das Reich Gottes orientiert und im Werden. Mission im multikulturellen Kontext bedeutet dann, sich vom Heiligen Geist in die Vielfalt hineinnehmen zu lassen, so wie Gott zu Pfingsten half, die vielen Sprachen zu verstehen. Dies erfordert Konvivenz. Und im Zusammenleben laden wir dann ein, so wie wir eingeladen werden. Es würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen, hier nun differenziert auswerten zu wollen und Stellung zu beziehen im Sinne einer „Theologie der Religionen“. Wenn heute über Judenmission gesprochen wird, soviel ist ja doch deutlich geworden, kann es jedenfalls nicht mehr um die Muster von damals gehen. Natürlich ist trotz allem im Blick auf die Mission ein Unterschied zu machen zwischen Israel und den (anderen) Völkern. Da hat die rheinische Synode 1980 schon zu Recht formuliert, „dass die Kirche ihr Zeugnis dem jüdischen Volk gegenüber nicht wie ihre Mission an die Völkerwelt wahrnehmen kann.“ III. Judenmission? Dennoch lautet meine Grundthese: niemandem auf der Welt dürfen wir Christen das Christuszeugnis verweigern. Das wäre eine neue Form der Ausgrenzung und widerspricht allem, was die Bekenntnissynode in Barmen erkannt und bekannt hat. Die Universalität der Heilsbotschaft, die im grundlegenden Osterzeugnis enthalten ist, gilt im gesamten Neuen Testament uneingeschränkt und schließt vielfach ausdrücklich das Volk Jesu Christi, das Bundesvolk Gottes, die Juden, ein. Ja, mehr noch, sie haben eine heilsgeschichtlich begründete Sonderstellung als diejenigen, denen dieses eben als Bundesvolk zuerst und vor allen anderen von Gott offenbart wurde (z.B. für viele andere Stellen Rö 1,16). Die historische Tatsache, dass das überwältigende Mehrheitsjudentum diese Offenbarung nicht als solche rezipiert hat, schlägt sich als tiefe Krise der ersten Christen freilich schon im Neuen Testament nieder. Am prominentesten diskutiert Paulus dieses Phänomen in den Kapiteln 9-11 des Römerbriefes, ein Text, der hier in der Arbeitsgemeinschaft ja schon vielfach interpretiert worden ist. Ich muß hier für mich zumindest zwei Eckpunkte der Interpretation festhalten, mit denen ich mich, das weiß ich, von manchen Schrittmachern der Resolution des letzten Kirchentages unterscheide: zum einen hebt die Entscheidung zur und die heilsgeschichtliche Motivierung der vorrangigen Heidenmission des Paulus dieses Prae Israels im Blick auf die Christusoffenbarung gerade nicht auf. Es ist stattdessen die grundlegende Figur, die die Hereinnahme der Heiden in das Heil in Christus zeitlich vor den Juden (Rö 11, 11f) überhaupt denkbar macht. Zweitens besingt Paulus die Frage des endzeitlichen Heils Israels zumindest als Geheimnis Gottes (Rö 11,33ff) und legt also keinen Verzicht auf das Christuszeugnis gegenüber Juden auch nur nahe (vgl. stattdessen Rö 11,13f). Er würde stattdessen sogar nach Rö 9,3ff Fluch und Trennung von Christus in Kauf nehmen, wenn er dadurch für Israel den Weg zu Christus öffnen könnte. Sehr wohl begründet das Prae Israels Paulus’ Aufruf zu Bescheidenheit, Achtung, ja Ehrfurcht vor den Juden (Ölbaumgleichnis). Die Treue Gottes zu seinem Volk, die bleibende Gültigkeit der Verheißungen, die Gnadengaben Gottes stelle ich damit nicht in Frage. Allerdings bin ich aufgrund der Universalität des Christusereignisses der Meinung, dass auch sie durch dieses Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers. 6 Christusereignis erfüllt werden (bitte: nicht im Sinne einer Erledigung!). Deswegen schrieb ich im Sonntagsblatt, dass Gott nach Ostern nicht mehr der sei, der er vorher war. Denn Ostern ist die Selbstoffenbarung Gottes, des Gottes, der der Vater Jesu Christi ist, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Gottes des Bundes. Dies alles nun im Sinne des oben skizzierten postmodernen Missionsverständnisses ins Gespräch mit Juden einzubringen, hat besondere Probleme, vor denen niemand die Augen verschließen kann. Aber ich möchte hier unterscheiden zwischen historischen Aspekten und theologischen. Zu den historischen gehört zweifellos die Tatsache, dass die jüngere deutsche Geschichte der Verbrechen an den Juden jede Verständigung über christliche Glaubensinhalte schier unmöglich macht. Wie soll aus dem Mund eines Deutschen von Liebe, Vergebung, Rechtfertigung aus Glauben, Gemeinschaft in Christus, Parteilichkeit für das Leben usw. die Rede sein gegenüber einem Juden, von dem nicht erwartet werden kann, das Geschehene nicht in Verbindung zu bringen mit dem Gesagten. Und angesichts des breiten und langen Traditionsstroms christlichen Antijudaismus ist das Zeugnis eines Deutschen auch ein Problem des Zeugnisses eines Christen. Denn das Kreuz, das zentrale Symbol unseres Glaubens, ist den Juden das Zeichen intoleranter, arroganter und oft genug auch mörderischer Verfolgung geworden. Als Leitender Bischof der VELKD und dem lutherischen Erbe zutiefst verpflichtet ist es mir hier auch ein besonderes Anliegen, mit allem Nachdruck die entsetzlichen judenfeindlichen Ausfälle des alten Luther zurückweisen. Ich möchte vielmehr an die Tradition der liebevollen Zuwendung und Wertschätzung in der Schrift des jungen Luthers „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“ anknüpfen (WA 53). (Die bisher genannten historischen Aspekte haben eine theologische Implikation insofern, als durch die theologische Figur der Kirche als des „Leibes Christi“, des „Christus praesens“, Christus selbst korrumpiert erscheint durch die Taten der Christen. Ich persönlich wollte die Verirrungen der Kirche am ehesten als Wunden am Leib Christi interpretieren. Die theologische Brisanz des Zusammenhangs ist jedoch deutlich.) Ein weiterer historischer Aspekt ist die Tatsache, das Konvivenz in Deutschland unter Juden und Christen ein zartes und hochempfindliches Pflänzchen ist. Wieder durch den deutschen Vernichtungsversuch ist es ja garnicht einfach und schon überhaupt nicht selbstverständlich, als Christ in diesem Land mit Juden im Gespräch sein zu können. Dies unter anderem macht den ungeheuren Wert dieser Arbeitsgemeinschaft beim DEKT aus, und hier und darüber hinaus bin ich allen Juden zutiefst dankbar, die sich über alle Gräben hinweg auf das Gespräch einlassen. Vor der Grösse, die hieraus spricht, verneige ich mich. In diesem Zusammenhang ist mir wichtig zu sagen, dass ich mich in aller Form von den Methoden distanziere, mit denen einige Christen versuchen, vor allem osteuropäische Juden abzuwerben ohne Rücksicht, ja unter Ausnutzung ihrer schwierigen Lage und häufigen religiösen Unsicherheit. Dass dies bei unseren jüdischen Mitbürgern und in den Gemeinden als massive Bedrohung wahrgenommen wird, kann niemanden verwundern. Es wären mehr historische Aspekte anzufügen. Sie rechtfertigen ein Moratorium, zumindest deutscher Bemühungen unter Juden. Hier über Zeiträume zu reden wäre schamlos – von Gott erhoffen wir uns Versöhnung und Wege zueinander, in seine Geduld demütig sich einzuüben ist das Gebot der Stunde. Aus theologischer Sicht und grundsätzlich kann man die Einladung aus der Konvivenz heraus nicht verabschieden. (Vielleicht ist die ausdrückliche verbindliche Gesprächsgemeinschaft wie hier in der Arbeitsgemeinschaft, ja gar nicht der geeignete Ort, sich innerchristlich über die Frage der Mission zu vergewissern. Denn, in zugegeben schwieriger Verallgemeinerung: von welcher von uns unterschiedenen Religion erwarten wir Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers. 7 uns eigentlich Zustimmung in der Frage christlicher Mission?) In diesem wertschätzenden und dialogoffenen postmodernen Missionsverständnis der „Missio Dei“ ist die Wahrheit angemessen eine Frage göttlicher Selbstoffenbarung, was alle Gesprächspartner bei aller Leidenschaft hindert, sich übereinander zu erheben. Aber die gemeinsame Entzifferung der Welt unter Einbringung dessen, was Christen als Gottesoffenbarung glauben, ist Auftrag unseres Gottes. Zumal man auch in Erinnerung rufen muss, dass eine andere missiontheologische Entdeckung des 19. Jahrhunderts sehr wohl bis heute Gültigkeit hat: nämlich die Mission als „innere Mission“ mit der Zielrichtung auf uns selbst und ohne allen Dünkel kultureller Überlegenheit. Hier kann ich zurückkehren zum Anfang und noch einmal an den Briefwechsel mit Professor Brumlik erinnern. Zu dem, was dort stattfand, stehe ich. Ich bin dankbar, dass der schriftliche Dialog hier nun mündlich fortgesetzt wird. Literaturhinweise: „Ja zur Partnerschaft und zum innerbiblischen Dialog. Nein zur Judenmission“, Resolution der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, in: DEKT 1999 Dokumente, Konrad v. Bonin und Anne Gidion (Hgg), Gütersloh 1999, S. 539f. Resolution der Werkstatt des württembergischen Pietismus, in: DEKT 1999 Dokumente, s.o., S. 540f. Christen und Juden III, Schritte der Erneuerung im Verhältnis zum Judentum, Eine Studie der EKD, im Auftrag des Rates der EKD herausgeg. vom Kirchenamt der EKD, Gütersloh 2000. Werner, Dietrich: „Mission für das Leben – Mission im Kontext, Ernst Lange Institut für ökumenische Studien, Rothenburg 1993, Ss. 144-151. Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers.