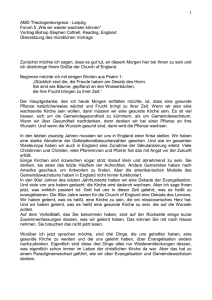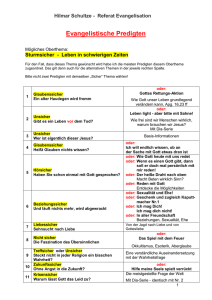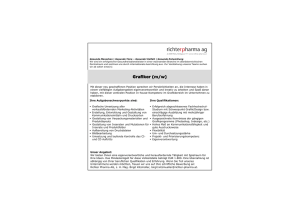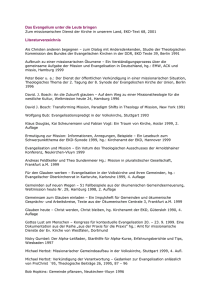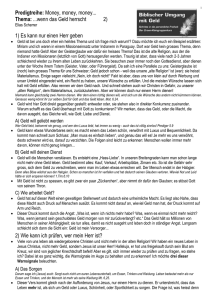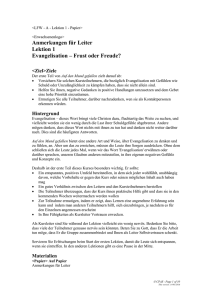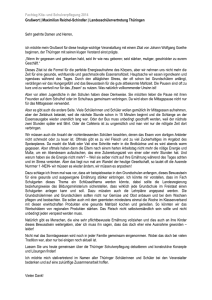Frühling im kirchlichen Leben
Werbung
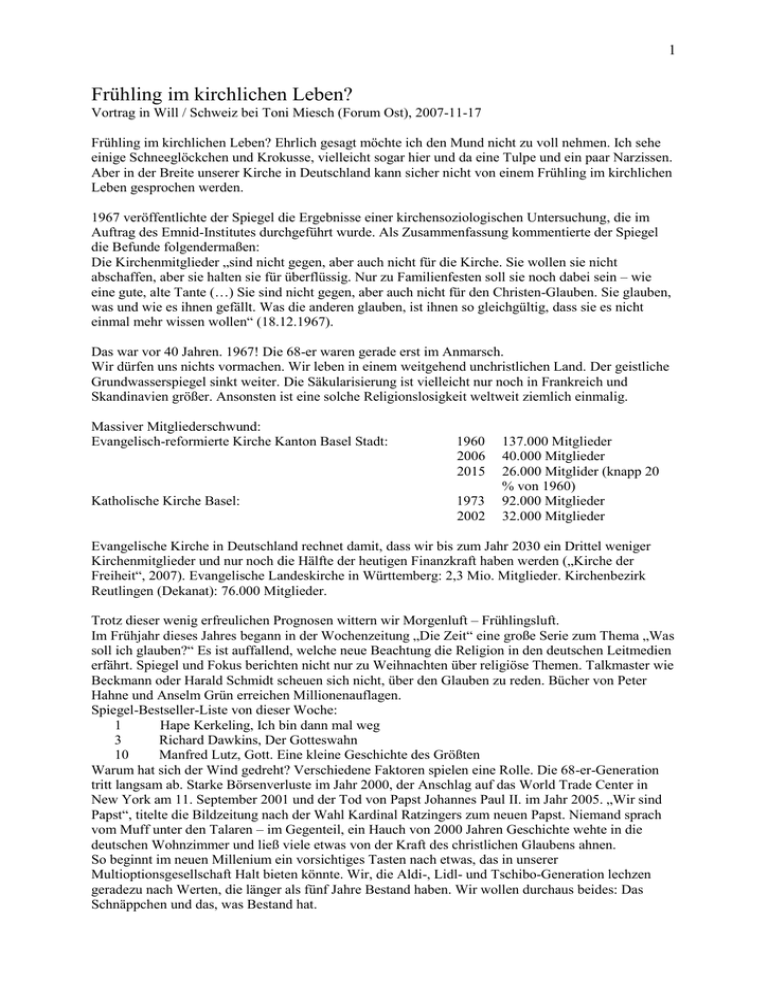
1 Frühling im kirchlichen Leben? Vortrag in Will / Schweiz bei Toni Miesch (Forum Ost), 2007-11-17 Frühling im kirchlichen Leben? Ehrlich gesagt möchte ich den Mund nicht zu voll nehmen. Ich sehe einige Schneeglöckchen und Krokusse, vielleicht sogar hier und da eine Tulpe und ein paar Narzissen. Aber in der Breite unserer Kirche in Deutschland kann sicher nicht von einem Frühling im kirchlichen Leben gesprochen werden. 1967 veröffentlichte der Spiegel die Ergebnisse einer kirchensoziologischen Untersuchung, die im Auftrag des Emnid-Institutes durchgeführt wurde. Als Zusammenfassung kommentierte der Spiegel die Befunde folgendermaßen: Die Kirchenmitglieder „sind nicht gegen, aber auch nicht für die Kirche. Sie wollen sie nicht abschaffen, aber sie halten sie für überflüssig. Nur zu Familienfesten soll sie noch dabei sein – wie eine gute, alte Tante (…) Sie sind nicht gegen, aber auch nicht für den Christen-Glauben. Sie glauben, was und wie es ihnen gefällt. Was die anderen glauben, ist ihnen so gleichgültig, dass sie es nicht einmal mehr wissen wollen“ (18.12.1967). Das war vor 40 Jahren. 1967! Die 68-er waren gerade erst im Anmarsch. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir leben in einem weitgehend unchristlichen Land. Der geistliche Grundwasserspiegel sinkt weiter. Die Säkularisierung ist vielleicht nur noch in Frankreich und Skandinavien größer. Ansonsten ist eine solche Religionslosigkeit weltweit ziemlich einmalig. Massiver Mitgliederschwund: Evangelisch-reformierte Kirche Kanton Basel Stadt: Katholische Kirche Basel: 1960 2006 2015 1973 2002 137.000 Mitglieder 40.000 Mitglieder 26.000 Mitglider (knapp 20 % von 1960) 92.000 Mitglieder 32.000 Mitglieder Evangelische Kirche in Deutschland rechnet damit, dass wir bis zum Jahr 2030 ein Drittel weniger Kirchenmitglieder und nur noch die Hälfte der heutigen Finanzkraft haben werden („Kirche der Freiheit“, 2007). Evangelische Landeskirche in Württemberg: 2,3 Mio. Mitglieder. Kirchenbezirk Reutlingen (Dekanat): 76.000 Mitglieder. Trotz dieser wenig erfreulichen Prognosen wittern wir Morgenluft – Frühlingsluft. Im Frühjahr dieses Jahres begann in der Wochenzeitung „Die Zeit“ eine große Serie zum Thema „Was soll ich glauben?“ Es ist auffallend, welche neue Beachtung die Religion in den deutschen Leitmedien erfährt. Spiegel und Fokus berichten nicht nur zu Weihnachten über religiöse Themen. Talkmaster wie Beckmann oder Harald Schmidt scheuen sich nicht, über den Glauben zu reden. Bücher von Peter Hahne und Anselm Grün erreichen Millionenauflagen. Spiegel-Bestseller-Liste von dieser Woche: 1 Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg 3 Richard Dawkins, Der Gotteswahn 10 Manfred Lutz, Gott. Eine kleine Geschichte des Größten Warum hat sich der Wind gedreht? Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Die 68-er-Generation tritt langsam ab. Starke Börsenverluste im Jahr 2000, der Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 und der Tod von Papst Johannes Paul II. im Jahr 2005. „Wir sind Papst“, titelte die Bildzeitung nach der Wahl Kardinal Ratzingers zum neuen Papst. Niemand sprach vom Muff unter den Talaren – im Gegenteil, ein Hauch von 2000 Jahren Geschichte wehte in die deutschen Wohnzimmer und ließ viele etwas von der Kraft des christlichen Glaubens ahnen. So beginnt im neuen Millenium ein vorsichtiges Tasten nach etwas, das in unserer Multioptionsgesellschaft Halt bieten könnte. Wir, die Aldi-, Lidl- und Tschibo-Generation lechzen geradezu nach Werten, die länger als fünf Jahre Bestand haben. Wir wollen durchaus beides: Das Schnäppchen und das, was Bestand hat. 2 „Ist unsere christliche Kultur erkaltet?“, fragt Stephan Kulle in seinem Buch „Warum wir wieder glauben wollen… Unser christliches Abendland scheint vor etwas zu stehen, das man verschiedenartig einschätzen kann. Es reicht von Erkaltung oder Desinteresse bis hin zu Verwirrung oder Wertesuche… Eines ist mir klar geworden: Jemand, der in seinem Religions- und Weltanschauungs-Mix aufgeht, mag auf diese Weise gut leben. Jedoch lebt er allein, denn er wird kaum jemanden finden, der einen deckungsgleichen Mix an Gedanken und Empfindungen hat. Vielleicht ist es menschlicher und einfacher in einer religiösen oder sinnstiftenden Gemeinschaft zu leben, auch wenn der Einzelne nicht mehr so autonom ist.“ Zitat: IV. Mitgliedschaftsstudie der EDK, S. 116 Eva: als Kind hat mich das fasziniert, wenn ich da gestanden habe und [...] eine Riesengruppe alle dasselbe gesagt haben, äh und, also so ah ihren Glauben bekannt haben, das heißt, äh, die, ich hob ja geglaubt, dass die das, was sie da sagen, auch wirklich glauben. Und da hab ich gedacht, das glauben die alle. Und die sagen das alles zusammen, und irgendwann sagst du das auch. [...] Ich habe nie an die Jung frauengeburt geglaubt. Ich hab immer schon als Kind gewusst, das kann nicht sein. Jungfrauen kriegen keine Kinder [...] das muss, muss 'n schönes Märchen sein oder so. Aber weil dieses äh Märchen allen gehört,.. das fand ich schön. Also ist egal, äh äh, das muss man ja, manche glauben, dass das Märchen Wahrheit ist, andere sagen, das ist 'n schönes Märchen, äh, und andere sagen, nee, das ist, hat äh äh 'n tieferen Sinn, das hat 'ne Bedeutung. Das gibt so, aber alle, allen gehört dieses Märchen. Alte, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es gehört ihnen, sie gehören zusammen, Lisa: Und da spielt die Rolle, eine Rolle mit, Eva: Ja. Lisa: Eva, du bist mittendrin in einer Gemeinschaft Eva: Ja. Jaja, so. Lisa: Und das ist so im selben Rhythmus, dieselben Laute, Eva: Ja. Jaja. Lisa: und du gehörst da mit rein, das ist ja 'n Stück, als wenn du so ein Molekül bis in einem, in einer Gemeinschaft. Da ist Geborgenheit. Zeit-Interview von Bernd Ulrich über den christlichen Glauben mit „einer Reihe von Geistlichen“. Am Ende seines gescheiten Artikels schreibt Bernd Ulrich: „Noch einmal zurück zu unseren geistlichen Gesprächspartnern. Sie lassen einen schon staunen. So frei und offen wie mit ihnen lässt sich außerhalb des engsten Familien und Freundeskreises kaum über den Tod, die Liebe und den Sinn reden. Dabei wirken sie selten durch ihr Amt gehemmt, eher von ernster Gelassenheit geprägt. Und sie reden nicht wie Therapeuten über diese Fragen, sondern als Leute, die es selber betrifft. Was vor 2000 Jahren begann, es glüht noch immer“ (Die Zeit, 8.2.2007). Danach sehnen sich die Menschen. Nach der Glut. Nach der Wärme. Nach Menschen, die für ihre Überzeugung einstehen. Nach einer Gemeinschaft, in der etwas von der Liebe Gottes spürbar wird. Davon ein „Molekül“ sein. An dieser Stelle möchte ich zum Blick über den eigenen Kirchturmhorizont einladen. Genauer gesagt nach England in die Anglikanische Kirche. Die standen und stehen vor den gleichen Problemen wie wir in Deutschland oder in der Schweiz. Das ist der Vorteil. Die Engländer haben eine ähnliche volkskirchliche Situation wie wir. Darum sind die Verhältnisse vergleichbarer als mit den USA (Willow Creek oder Saddleback). Callum Brown („The Death of Christian Britain. Understanding Seculariszation 1800-2001“, London 2001): „Britian is showing the world how religion as we have known it can die.“ Auch in England war es so, dass der Rückgang an finanziellen Ressourcen das Umdenken in den Köpfen beschleunigt, wenn nicht überhaupt erst bewirkt hat. Im Februar waren Bischof John Finney und Dekanin Felicity Lawson von der anglikanischen Kirche in Bernhausen (Württemberg). John Finney sagt: „Gott sprach zu uns in der Sprache, die auch die Bischöfe verstehen, in der Sprache des Geldes.“ 3 Diese Sprache versteht man auch in Stuttgart oder in Karlsruhe, in Basel, Zürich, Aarau und St. Gallen. Wie reagieren wir darauf? In meiner Stadt Reutlingen reagierte die „Kirchenleitung“ damit, dass zwei neue Gremien geschaffen wurden: a) Die Struktur- und Sparkommission b) Die Arbeitsgruppe Raumkonzeption Beide Gremien sind – ohne Zweifel – wichtig. Wenn aber die Kirche allein auf eine strukturelle Neuordnung setzt, dann verkennt sie die Situation. Wir haben doch in erster Linie ein spirituelles, ein geistliches Problem. Wie habt Benedikt von Nursia formuliert: Ora et labora. Darum der Blick nach England. Gordon Bates, Bischof von Whitby, sagte schon 1998: “Die Kirche muss ihre missionarische Verantwortung erkennen. Wir leben in einer Gesellschaft, die – ganz gleich ob in der Stadt oder auf dem Land – schon in der zweiten oder gar dritten Generation wieder aus Heiden besteht; und wir können nicht einfach weiter von der Annahme ausgehen, dass es reicht, die Menschen an ihren lange verschütteten Glauben zu erinnern, um sie zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Bei vielen Menschen ist nicht einmal ein Rest von christlichem Glauben vorhanden. Er ist nicht etwa verschüttet, er ist nicht existent. Wir müssen also in den meisten Fällen ganz von vorne anfangen und befinden uns vor einer kritischen Phase missionarischer Herausforderung.“ 1999 hat das übrigens auch Professor Eberhard Jüngel aus Tübingen erkannt und auf einer EKDSynode formuliert: „Wenn die Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würden Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestimmen.“ Im Prinzip ist die Krankheit erkannt. Aber die Mittel sind bei uns noch nicht gefunden. Sie bekommen bei uns die Arznei noch nicht in den Läden. Drei Schritte erkennen wir bei den Engländern: 1.) Sie versuchen herauszubekommen, wie Menschen zum Glauben kommen 2.) Sie gehen den Weg der persönlichen Evangelisation durch Glaubenskurse 3.) Sie bringen eine hohe Bereitschaft zum Wagnis hinsichtlich kirchlicher Organisationsformen mit 1.) Die Frage danach, wie Menschen zum Glauben kommen Während deutsche Untersuchungen sich eher darauf beschränken, den „religiösen Aggregatzustand“ (Herbst) festzustellen und nach der Verbundenheit mit der Kirche zu fragen, hat John Finney 1992 eine Untersuchung vorgelegt, die konkret danach fragt, wie es dazu kommt, dass (erwachsene) Menschen zum Glauben kommen: „Finding Faith Today“. Die Engländer sagen: „Evangelisation braucht eine Basis, die mehr auf Fakten beruht als auf Fanatsie.“ In kleinen Gemeinden kommen Menschen eher zum Glauben als in großen In sozial schwachen Gebieten kommt es zu mehr Bekehrungen (Konversionen) als in wohlhabenden Wichtig ist die familiäre Sozialisation und die Erfahrungen in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit Beziehungen sind viel wichtiger als Veranstaltungen und evangelistische Events (belonging before believing) Ein Drittel spricht von einer Bekehrung als einem Ereignis, zwei Drittel sagen, dass ihr Weg zum Glauben eine jahrelange, begleitete spirituelle Reise gewesen sei. Wir sind jetzt dabei, mit Hilfe des Insituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald eine ähnliche deutsche Forschungsarbeit in Angriff zu nehmen (Württemberg: Heinzpeter Hempelmann, früher Liebenzeller Mission). Projekt „Wachsende Kirche“ in Württemberg. 4 Bob Jackson, Hope for the Church (2002) Bob Jackson war nach einer Karriere als Wirtschaftsberater der Regierung 20 Jahre lang im Gemeindedeinst und seither Forschungsbeuftragter für Springboard, die Evangelisationsinitiative der Erzbischöfe von Caterbury und York. Neben der nüchternen Beschreibung des gravierenden Niedergangs in der Anglikanischen Kirche stellt er fest, dass 20 Prozent der Gemeinden in den vergangenen zehn Jahren nicht geschrunpft, sondern gewachsen sind. Er sagt: Es gibt bessere und darum auch schlechtere gemeindliche, pastorale Strategien. Er vergleicht die Situation mit einem Loch im Eimer. Man wird nicht den ganzen Eimer reparieren, sondern das Loch suchen und es schließen. Oder: Eine Warenhauskette verliert immer mehr Kunden. Was wird sie tun? Sie wird erforschen, welche Manager, Läden, Warenangebote, Verkaufs- und Werbestrategien, Servicekultur usw. mit diesem Verlust in Verbindung gebracht werden können und welche nicht. Und sie wird ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Nur so kann auch die Kette als ganze überleben. In der Kirche aber, so vermerkt er selbstkritisch, gehen wir mit dem „Loch im Eimer“ anders um. Manche sagen: „Da ist gar kein Loch!“ Andere meinen: „Naja, es tropft ein bisschen, aber der Eimer sieht immer noch gut aus.“ Einige sagen: „Es tropft zwar, aber auf lange Sicht ist noch genug Wasser im Eimer – bis ich in Ruhestand gehe.“ Wiederum andere meinen: „Man kann einfach überhaupt nichts dagegen tun, wenn postmoderne Eimer Wasser verlieren.“ Die Engländer sprechen von „best-practice“-Beispielen. Wo gibt es Wachstum? Wo kommen Menschen zum Glauben? Und wo nicht? Kongress Wachsende Kirche Robert Warren: The Healthy Churches´ Handbook (2004) Auch von ihm wurden Gemeinden untersucht, die ein signifikantes Wachstum zeigten. Es waren sehr unterschiedliche Gemeinden: Es ist nicht das spezielle Umfeld, oder die bestimmt Größe der Kirche, nicht eine besondere Frömmigkeitstradition, oder ein Leitungsstil, der es wahrscheinlicher machen würde, dass eine Gemeinde wächst. Trotzdem fand Warren sieben Merkmale gesunder Gemeinden: 1. Gesunde Gemeinden sind vom Glauben begeistert (energised) – nicht nur schauen, dass die Dinge laufen, oder dass wir überleben Die Feier im Gottesdienst und die Feier der Sakramente bewegen die Menschen, Gottes Liebe zu erfahren Motivation: Energie kommt von dem Verlangen, Gott zu dienen und auch einander zu dienen In Verbindung mit der Heiligen Schrift: auf kreative Weise, die etwas mit dem alltäglichen Leben zu tun hat (Hauskreise!) Den Glauben an Jesus Christus pflegen / weitergeben: Helfen, dass andere wachsen im Glauben und ihren Glauben teilen. 2. Gesunde Gemeinden sind eher nach außen als nach innen orientiert. Der Blick nach draußen – mit dem Anliegen, den Menschen nicht nur mit einem kirchlichen Fokus zu begegnen (Missionsopfer) 3. Gesunde Gemeinden suchen herauszufinden, was Gott möchte – auf der Tagesordnung stehen nicht nur unsere Lieblingsthemen 4. Gesunde Gemeinden nehmen die Kosten und den Aufwand für die Veränderungen und für das Wachstum in Blick. Krisen werden als Herausforderungen angenommen. 5. Gesunde Gemeinden bilden eine Gemeinschaft – sie funktionieren nicht wie ein Club oder eine religiöse Organisation Beziehungen werden gepflegt, sodass die Einzelnen spüren, sie sind Teil einer Gemeinschaft des Glaubens (oft in Hauskreisen) mit der Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen. Leiterschaft: Ordinierte und Nicht-Ordinierte arbeiten als Team zusammen, um angemessene Formen für eine gesunde Kirche zu entwickeln. Allgemeines Priestertum (lay ministry): die unterschiedlichen (Geistes-)Gaben, die Erfahrungen und Glaubenswege von allen werden geschätzt und zum Ausdruck gebracht in und außerhalb der Kirche. 6. Gesunde Gemeinden schaffen Raum für andere (sie sagen das nicht nur) 5 Willkommen heißen Kinder und Jugendliche Fragende und Zweifelnde Verschiedenheit wird als Stärke gesehen und wird angestrebt (Unterschiedlichkeit in sozialer, etnischer, intellektueller, körperlicher, altersmäßiger Hinsicht.) 7. Gesunde Gemeinden beschränken sich auf weniges – aber das machen sie sehr gut Kultur ist wichtiger als Struktur. Wir müssen an unserer Kultur arbeiten – nicht nur an Strukturen (Pfarrplan; Katholische Kirche: Seelsorgeeinheiten; Pastoralräume). Herbst: Bei der Kultur einer Gemeinde geht es vor allem um gemeinsame Werte, Haltungen, tief in der DNS der Gemeinde verankerte Überzeugungen, so etwas wie ein emotionales Grundmuster der Gemeinde. Firmen haben so etwas, Familien haben so etwas, Fakultäten haben so etwas, aber eben auch Gemeinden. Man spürt es, wenn man in die Gemeinde kommt. Man merkt einen bestimmten Geist. Vielleicht kann man auch vom Charakter einer Gemeinde sprechen. Der Charakter einer Gemeinde, das ist die Art des Umgangs miteinander, aber auch mit dem Fremden und dem Gast. E ist auch die Art, wie wir uns geben, wenn wir beten. Der Charakter einer Gemeinde, das ist das Ensemble der Werte, die bei uns gelten. Beispiel: Kinderecke mit Pampers-Höschenwindeln für jedes Kleinkind („ihr seid uns willkommen“) Einspielung CD Hüsch 2.) Die persönliche Evangelisation durch Glaubenskurse In der Anglikanischen Kirche wurde sehr viel intensiver als in Deutschland das Modell der befristeten evangelistischen Glaubenskurse propagiert und auch fast flächendeckend eingeführt. Allein am Alphakurs haben im „United Kingdom“ bisher rund zwei Millionen Menschen teilgenommen. 7.000 Alphakurse laufen derzeit in England. In der Schweiz sind es immerhin 700 (Alphalive), in Deutschland liegen wir bei 1.300 Alphakursen. Viele Ehrenamtliche sind bereit, zu eine solchen Veranstaltungsreihe einzuladen, zu dekorieren, zu kochen, in Kleingruppen über den eigenen Glauben zu reden. Der Alphakurs ist eine großartige Herausforderung, seinen eigenen Glauben zu formulieren. Dieser „evangelistic turn“ kann kaum überschätzt werden (ermutigende Erfahrungen als AlphaBerater). John Finney (Emerging Evangelism, London 2004) sagt: „In 1985 evangelism for most people still meant the big meeting, the important speaker, the exhausting (and expensive) effort by the church. By 2000 evangelism in the United Kingdom meant the small group, the ordinary member of the congregation, the continuous work of the church.” Neben Alpha: Emmaus-Kurs; Christ werden – Christ bleiben; Religionsunterricht für Erwachsene / Stufen des Lebens. Man spricht von persönlicher oder permanenter Evangelisation. Exkurs: Persönliche Evangelisation oder Veranstaltungsevangelisation? Als Pfarrer und Evangelist der württembergischen Zeltkirche muss ich hier ein Veto einlegen. [idea-Spektrum, April 2007:] Engagierte, am Gemeindewachstum interessierte Christen setzen heute fast ausschließlich auf die sogenannte permanente Evangelisation: Glaubenskurse, Kleingruppen, Weitersagen der Guten Nachricht im Alltag und im Rahmen gewachsener Beziehungen. Großevangelisationen scheinen aus der Mode zu kommen. Dabei kommt es auf den richtigen Mix an. Der „Event“ und der Hauskreis müssen Hand in Hand gehen. Der große, öffentliche Auftritt braucht die Bodenhaftung der permanenten Evangelisation. Aber ohne den Mut, das Evangelium auch auf den „Marktplatz“ zu bringen, verlieren wir Christen an Weite und gesellschaftsprägender Kraft. Das mediterane Frühlingswetter macht es mir leicht, eine Lanze für die Zeltmission zu brechen. Während manche unken, nach gut hundert Jahren hätte sich die Evangelisation in einem Zelt überlebt, spricht die Zeit eine andere Sprache. Zeltveranstaltungen sind weltweit im Kommen. Ob beim Sommerfest des Bundespräsidenten, beim CHIO in Aachen, oder beim EU-Gipfel in Athen – überall werden attraktive Zelte aufgebaut. Auf der Wiesn in München sitzen Menschen unterschiedlicher Couleur nebeneinander im Zelt. Die Menschen schätzen Zelte als Orte der lockeren Kommunikation. 6 In unseren modernen, in der Regel transparenten Evangelisationszelten knüpfen wir am Lebensgefühl und an den Denkmustern unserer Gäste an. Wir holen sie ab, nehmen sie ernst und versuchen, ein Stück Weges mit ihnen zu gehen. Wo es zur Begegnung mit dem heiligen Gott kommt, entsteht immer eine Mischung aus Fascinosum und Tremendum (Zittern). Wir treiben die Gäste aber nicht in die Enge, sondern laden ein zur Freiheit eines Christenmenschen. Es sind vermutlich weniger theologische Gründe, die heute manche Gemeinden vor einer großen Evangelisation zurückschrecken lassen. Viele fühlen sich ausgelastet, überlastet, oder verwechseln ein lebhaftes Gemeindeleben mit geistlicher Lebendigkeit. Wo ist die Leidenschaft geblieben, Fernstehende mit dem Evangelium zu erreichen? „Zeltwochen“ haben nicht nur eine große Öffentlichkeitswirkung, sondern auch eine enorme Mobilisierungskraft. In einem Ort hat sich das Team der Kinderbibelwoche durch die Evangelisation verdoppelt. Anderswo war der Bürgermeister so begeistert, dass er fünf Männer vom Bauhof für den Zeltabbau zur Verfügung stellte. Die positiven Kontakte, die zu den Kommunen und örtlichen Vereinen entstehen, sind in ihrer Langzeitwirkung nicht zu unterschätzen. Bei den heutigen Zeltevangelisationen gehen wir in der Regel auf die örtlichen Vereine zu und bitten sie um Mitarbeit. Die Feuerwehr schneidet einen Unfallwagen auf und wir sprechen über die Grenzen des Lebens. Oder wir organisieren mit dem Roten Kreuz eine Blutspendeaktion und reden dann über die versöhnende Kraft des Blutes Jesu. In einem Schwarzwald-Dorf feierten wir den Abschluss-Abend in Form einer Thomas-Messe. Unser Programm wird nicht „eingeflogen“, sondern vor Ort gemeinsam erarbeitet. Ich wünsche mir, dass viele Gemeinden die Zeltmission als moderne und flexible Form der Evangelisation wieder neu entdecken. 3.) Die Bereitschaft zum Wagnis hinsichtlich kirchlicher Organisationsformen Die Engländer sprechen von einer „Mischwirtschaft“ aus Ortskirchengemeinden und Netzwerkgemeinden, die innerhalb eines größeren Gebietes, also vielleicht eines Dekanates, partnerschaftlich mit anderen zusammenarbeiten. „Die Anglikanische Kirche von England will Kirche für die ganze Nation sein. Dies soll nicht die Bedeutung einer etablierten Kirche als Institution bestätigen, sondern ihren missionarischen Auftrag betonen.“ Das parochiale System kann verglichen werden mit einem großen Schweizerkäse. Nach außen hin wirkt er wie eine solige, einheitliche Masse, bei genauerem Hinsehen aber zeigen sich eine Reihe von Löchern, sozusagen „käsefeien Zonen“. „Wenn wir anglikanisch im eigentlichen Sinn sein wollen, müssen wir uns danach sehnen, tief im Gemeinwesen verwurzeltzu sein und für alle, die hier leben, offen und zugänglich zu sein.“ 40 Prozent unkirchliche Menschen („un-churched“). Davon 20 Prozent „offene Kirchenferne“ und 20 Prozent „verschlossene Kirchenferne“ (Untersuchung von 1996). Manche Menschen beschreiben Kirche als „ein fremdartiges, kostspieliges Gebäude, in dem ich mich völlig fremd und hilflos fühle, und das, was noch schlimmer ist, von Menschen benutzt wird, mit denen ich sowieso nichts zu tun haben möchte“ (George Lings, Living Proof, 1999). „Die große Mehrheit der englischen Gesellschaft ist nicht ´unser Volk´. In ihrer eigenen biographischen Erinnerung sind sie es nie gewesen noch wollen sie es sein. Tatsache ist, dass die meisten in England lebenden Menschen die Kirche in ihrer aktuellen Ausprägung nebensächlich, undurchsichtig, verwirrend oder unwichtig finden.“ „Mission-shaped Church“ (deutsch: Mission bringt Gemeinde in Form), London 2004 Was fällt auf? - Die Unterstützung von „oben“ (z.B. Erzbischof Williams von Canterbury, Bischof Graham Gray) Neue Formen werden gefördert, nicht nur geduldet. Herbst: „Entschlossenheit in der Führung und Leitung der Kirche“ Das bedeutet, dass die neuen Formen anerkannt und in das kirchliche Ganze integriert werden (Finanzen, Wahlrecht, kirchliche Abgaben usw.) <-> württembergische Erfahrungen. - Die Kreativität und Pluralität („trial und error“). Mut zu missionarischer Vielfalt. - Freiheit im Umgang mit Strukturen. <-> Bei uns gibt es v.a. auch unter den liberalen Theologen einen Strukturkonservatismus. Finney: „In typisch anglikanischer Manier versuchen wir, die Dinge durch unsere Definitionen nicht allzu deutlich 7 festzulegen. Wir lassen immer Raum für Weiterentwicklungen. Natürlich zahlen wir dafür einen Preis: Unsicherheit.“ - Ehrlichkeit: „Nicht alles, was in der Aufbruchstimmung des Gemeindepflanzungsprozesses Anfang der 1990er Jahre entstand, hat überlebt. Gründe für ein Scheitern waren unter anderem schlechte Planung, Probleme in der Gemeindeleitung, ausschließlich nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, Nichtbeachtung kultureller Bedingungen, in Teilzeit arbeitende Gemeindeleiter und fehlende finanzielle Mittel. Schätzungen besagen, dass 90 Prozent der anglikanischen Gemeindepflanzungen weiterhin Bestand haben. Das ist eine Zahl, die sich positiv abhebt von einigen anderen Denominationen.“ Neue Ausdrucksformen gemeindlichen Lebens (fresh expressions of church – bemerke die sprachliche Kreativität; www.freshexpressions.org.uk): - Alternative Gottesdienstgemeinden - Basisgemeinden - Cafékirchen - Zellgemeinden - Gemeinden, die aus Initiativen zur Gemeinwesenarbeit entstehen (S. 120123) - Differenzierte Gottesdienstgemeinden und Wochentagsgemeinden - Netzwerkorientierte Gemeinden - Schulgemeinden oder –gemeinschaften - Kirche für Suchende - Traditionelle Gemeindepflanzungen - Traditionelle Gemeinde – alte Formen neu entdecken - Jugendgemeinden Zukunftswerkstatt für die Christuskirche in Reutlingen Rowan Williams, seit 2002 Erzbischof von Canterbury: Wenn „Kirche“ dort Gestalt bekommt, wo Menschen dem auferstandenen Jesus begegnen und ihr Leben darauf ausrichten, diese Begegnung in der Begegnung miteinander fortzuführen und zu vertiefen, dann gibt es theologisch gesehen genügend Raum für eine Vielfalt in Rhythmus und Stil. Voraussetzung ist allerdings, dass wir diesen auferstandenen Christus im Herzen jeder Ausdrucksform gemeinsamen christlichen Lebens identifizieren können und er Raum bekommt. Meinem Eindruck nach sind uns die Engländer zehn bis 20 Jahre in der Entwicklung voraus. Sie starren nicht nur auf das Geld und die Strukturen, sie sind schon mindestens zwei Schritte weiter: Sie versuchen herauszubekommen, wie Menschen zum Glauben kommen. Sie gehen den Weg der persönlichen Evangelisation durch Glaubenskurse. Sie bringen eine hohe Bereitschaft zum Wagnis hinsichtlich kirchlicher Organisationsformen mit.