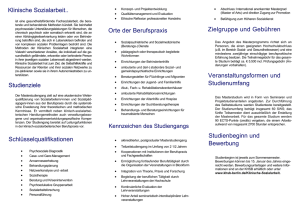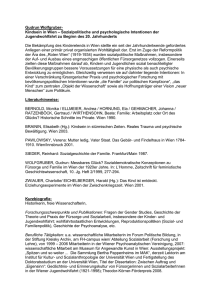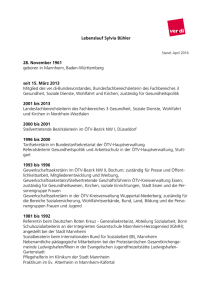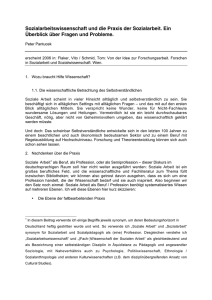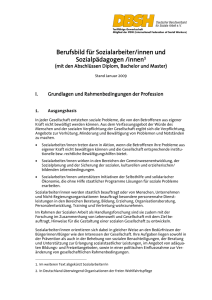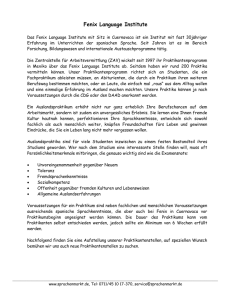Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit
Werbung

Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit Leittext des Modul 1 März 2006 Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit Neuer Wein in alten Schläuchen oder Anpassung an veränderte Notwendigkeiten? Leittext für das inhaltliche Verständnis von „Qualität“ für die Entwicklungspartnerschaft „Donau EQUAL – Quality in Inclusion“ Zwischenbericht Tom Schmid, Projektleiter Gertraud Pantucek, Projektleiterin-Stv. Hubert Kickinger Sonja Lengauer Martina Meusburger Lucie Prochazkova Andrea Rogy Margareta Veitschegger www.donau-quality.at Ziel der EQUAL EntwicklungspartnerInnenschaft „DONAU – QUALITY IN INCLUSION“ ist, Qualitätskriterien für den Bereich Sozialarbeit zu erarbeiten, um Grundlagen für Ausschreibungen nach dem Prinzip „BestbieterInnen" zu erstellen. Gesamtkoordination und finanzielle Verantwortung: DONAU - QUALITY IN INCLUSION wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit Leittext März 2006 Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG ........................................................................................................................................ 1 2 QUALITÄTSDISKUSSION IN DER SOZIALARBEIT – EIN EINSTEIG ............................................. 2 2.1 GAB ES BISHER KEINE QUALITÄT IN DER SOZIALARBEIT? ............................................................................ 2 2.2 ENTWICKLUNGEN IN DER SOZIALARBEIT ..................................................................................................... 3 2.2.1 Entwicklungen und neue Paradigmen ..................................................................................................... 4 2.2.2 Professionalisierung der Sozialarbeit und Geschichte der Sozialarbeitsausbildung .............................. 6 2.2.3 Aktuelle Berufspolitik zum Thema Qualität in der Sozialarbeit/ Sozialen Arbeit .................................... 7 2.3 QUALITÄT IST NICHT AUTOMATISCH „GUTE“ QUALITÄT .............................................................................. 8 2.3.1 Qualitätsdefinition................................................................................................................................... 8 2.3.2 „Gute Qualität“ – Der Zustand und das, was von ihm erwartet wird .................................................... 9 2.3.3 Zur Problematik des KundInnenbegriffes ............................................................................................. 12 3 GESCHICHTE DER QUALITÄTSSICHERUNG ALS AUSDRUCK VON INDUSTRIALISIERUNG UND MASSENFERTIGUNG ...................................................................................................................... 21 3.1 DIE ENTSTEHUNG DER ARBEITSTEILIGEN INDUSTRIE – NOTWENDIGKEITEN DER QUALITÄTSSICHERUNG .. 21 3.1.1 Wissenschaftliche Betriebsführung – Taylor und Ford ......................................................................... 21 4 3.1.2 Postfordismus und die Qualitätsdiskussion ........................................................................................... 26 3.1.3 Zusammenfassend ................................................................................................................................. 26 3.1.4 „Qualität“ in einer mcdonaldisierten Welt ........................................................................................... 27 DIE ENTWICKLUNG DES QUALITÄTSMANAGEMENTS ............................................................... 30 4.1 DAS „INGENIEURMODELL“ – ISO ............................................................................................................... 32 4.1.1 Beginn von ISO ..................................................................................................................................... 33 4.1.2 Inhalt von ISO ....................................................................................................................................... 33 4.1.3 Beispiele der Anwendung aus der Literatur zum Sozialbereich ............................................................ 35 4.2 DAS „DIENSTLEISTUNGSMODELL“ – TOTAL QUALITY MANAGEMENT UND SEINE ABLEITUNGEN .............. 35 4.2.1 Beispiel zu einem Verfahren aus der Literatur zum Sozialbereich ........................................................ 38 4.3 DIE EUROPÄISCHE ANTWORT: EFQM ........................................................................................................ 38 4.3.1 Beispiel aus dem Sozialbereich ............................................................................................................. 41 4.4 AFQM – DAS ÖSTERREICHISCHE MODELL ................................................................................................. 41 4.5 EUROPEAN QUALITY AWARD – EIN RESUMEE............................................................................................ 41 4.5.1 Vergleich der ISO 9000 und EQA ......................................................................................................... 42 4.6 DIE „ANDEREN“ MODELLE DER QUALITÄTSSICHERUNG ............................................................................ 43 4.6.1 Balanced Scorecard .............................................................................................................................. 43 4.6.2 Benchmarking ....................................................................................................................................... 46 4.6.3 Die japanischen Modelle des Qualitätsmanagements ........................................................................... 48 4.6.4 Weitere Ansätze im Überblick ............................................................................................................... 50 4.6.5 Qualitätsmanagement in Integrationsfachdiensten, deutsches Modell ................................................. 53 4.7 4.8 QUALITÄT ALS GESETZLICHE VORGABE IM SOZIALEN ............................................................................... 57 EXKURS: QUALITÄTSSICHERUNG IN DER GESUNDHEITSÖKONOMIE ........................................................... 57 Leittext März 2006 Seite 3 5 SOZIALPOLITIK UND DIE GESELLSCHAFTLICHE STELLUNG VON SOZIALARBEIT – VERSUCH EINER VERORTUNG .............................................................................................................. 60 5.1 DIE VERÄNDERTE STELLUNG DER SOZIALARBEIT IM „WOHLFAHRTSDREIECK“ ......................................... 60 5.1.1 Ausgangspunkt: Die Verschiebungen in der Wettbewerbsgesellschaft ................................................. 60 5.1.2 Die Prinzipien des Sozialstaates als Rahmen von Sozialarbeit ............................................................. 61 5.1.3 Sozialstaat im Umbruch ........................................................................................................................ 68 5.1.4 Das „Wohlfahrtsdreieck“ – Die Verortung intermediärer Sozialpolitik ............................................... 70 5.1.5 Die drei Ebenen solidarischer Unterstützung ....................................................................................... 74 5.2 DER „DRITTE SEKTOR“ .............................................................................................................................. 78 5.2.1 Unser Verständnis vom „Dritten Sektor“ ............................................................................................. 78 5.2.2 Arbeit mit Mission ................................................................................................................................. 79 5.2.3 Der „Dritte Sektor“ in der Vergabewelt ............................................................................................... 81 5.2.4 Widersprüchlichkeiten im Qualitätsdiskurs des Dritten Sektors ........................................................... 83 5.3 DER GERECHTIGKEITSDISKURS – DAS „POLITISCHE“ IN DER SOZIALARBEIT .............................................. 90 5.4 DAS „POLITISCHE“ IN DER SOZIALARBEIT .................................................................................................. 90 5.5 SOZIALARBEIT IM SPANNUNGSVERHÄLTNIS VON EINZELFALLHILFE UND GEMEINWESENARBEIT .............. 94 5.5.1 Aufgaben in der Gemeinwesenarbeit .................................................................................................... 94 5.5.2 5.6 Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit ................................. 95 DIE „ERFOLGREICH SCHEITERNDE“ INSTITUTION UND IHRE STELLUNG IM QUALITÄTSDISKURS – DER KOMPLEXE KUNDINNENBEZUG ............................................................................................................................... 97 6 QUALITÄT IN DER SOZIALARBEIT ................................................................................................ 99 6.1 DAS EFFIZIENZ-EFFEKTIVITÄTSPROBLEM IM „DRITTEN SEKTOR“ ............................................................. 99 6.2 DIE DREI BEREICHE DER QUALITÄT: QUALITÄT DER DIENSTLEISTUNG, QUALITÄT DER ARBEIT UND QUALITÄT DER LEITUNG ....................................................................................................................................... 102 6.2.1 Qualität der Dienstleistungen ............................................................................................................. 102 6.2.2 Qualität der Arbeit .............................................................................................................................. 102 6.3 GENDER IN DEN MAINSTREAM BRINGEN – EIN QUALITÄTSINSTRUMENT? ................................................ 104 6.3.1 Definition von Gender Mainstreaming ................................................................................................ 104 6.3.2 7 Aufgaben und Ziele der Gleichstellungsstrategie GM ........................................................................ 106 DIE QUALITÄTSDEBATTE IN DER SOZIALARBEIT – WEGE UND IRRWEGE .......................... 108 7.1 DIE LEGIMITATIONSKRISE IN DER SOZIALARBEIT:.................................................................................... 108 7.1.1 Beginn der Qualitätsdiskussion in der Sozialarbeit und Reaktionen .................................................. 108 7.1.2 Sozialarbeit und ihr Umgang mit der Legimitationskrise ................................................................... 110 7.2 „SOZIALMANAGEMENT“ ALS NEUE SOZIALARBEITSSTRATEGIE................................................................ 110 7.3 NEW PUBLIC MANAGEMENT UND DIE QUALITÄTSSICHERUNG DER ÖFFENTLICH ERBRACHTEN SOZIALARBEIT ....................................................................................................................................................... 111 7.4 DER NUTZEN DER QUALITÄTSDEBATTE IN DER SOZIALARBEIT ................................................................ 114 8 STANDARDISIERUNG ALS DOKUMENTATION VON QUALITÄT .............................................. 116 8.1 8.2 8.3 FACHGESETZ ............................................................................................................................................ 116 BERUFSGESETZ......................................................................................................................................... 117 SELBSTBINDUNG DURCH EINTRAG IN EINE LISTE ..................................................................................... 117 Leittext März 2006 Seite 4 8.4 STAATLICHES GÜTESIEGEL ...................................................................................................................... 118 8.5 ISO-ZERTIFIZIERUNG ............................................................................................................................... 118 8.6 TQM-ZERTIFIKATE + QUALITÄTS-PREIS ................................................................................................. 118 8.7 (NEUE) ZERTIFIZIERUNGSSTRATEGIEN + GÜTESIEGEL ............................................................................. 118 8.7.1 Zertifizierung und Gütesiegel aus Sicht der Sozialarbeit .................................................................... 118 8.7.2 8.8 Ausgewählte Beispiele zu Zertifizierung/Gütesiegel ........................................................................... 120 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR UNSERE DEBATTE ....................................................................................... 122 9 RÜCKBINDUNG: VON DEN STANDARDISIERUNGSSYSTEMEN ZUR QUALITÄTSBESTIMMUNG .................................................................................................................... 124 9.1 GEMEINSAME ZIELE-SYSTEME ALS GRUNDLAGE VON QUALITÄTSENTWICKLUNG ................................... 124 9.2 DIE „BESONDERE QUALITÄT DES SOZIALEN“ ........................................................................................... 124 9.2.1 Qualitätsdimensionen – was gibt es? .................................................................................................. 124 9.3 EBENEN QUALITÄTSGESICHERTER SOZIALARBEIT .................................................................................... 128 9.3.1 Lebensweltorientierte Qualitätsentwicklung ....................................................................................... 128 9.3.2 9.4 10 Qualitätsbausteine und ihre Wechselwirkung ..................................................................................... 129 SPEZIFIKA PERSONENBEZOGENER DIENSTLEISTUNGEN ............................................................................ 131 DIE AKUTE PROBLEMSTELLUNG: VERGABERECHT 2002/2006 ............................................. 135 10.1 GRUNDLAGEN .......................................................................................................................................... 135 10.2 GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN ........................................................................................... 136 10.3 DIE STRUKTUR DES VERGABERECHTES IN ÖSTERREICH ........................................................................... 136 10.4 DAS VERGABEVERFAHREN....................................................................................................................... 137 10.4.1 Ablauf .................................................................................................................................................. 137 10.4.2 Gesamt oder Teilvergabe .................................................................................................................... 138 10.4.3 Vergleichbarkeit der Angebote ............................................................................................................ 138 10.4.4 Prüfung der Angebote ......................................................................................................................... 139 10.4.5 Das Zuschlagsverfahren ...................................................................................................................... 139 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 STRAFBESTIMMUNGEN ............................................................................................................................. 140 VERGABE-GLOSSAR ................................................................................................................................. 140 VERGABERECHT 2006 .............................................................................................................................. 141 VERGABERECHT UND QUALITÄT .............................................................................................................. 142 VERGABERECHT ALS CHANCE .................................................................................................................. 143 11 PROBLEM(-BEWUSSTSEIN) UND STRATEGIE: FORMULIERUNG QUALITÄTSGESICHERTER VERGABERICHTLINIEN ......................................................................................................................... 144 11.1 11.2 11.3 11.4 DER WEG: QUALITÄTSSICHERUNG DURCH VERGABE .............................................................................. 144 BESTEHENDE AUSSCHREIBUNGSRICHTLINIEN IM ÜBERBLICK .................................................................. 144 PROBLEME IM VERGABEVERFAHREN ....................................................................................................... 144 INSTRUMENTE UND STRATEGIEN DER QUALITÄTSSICHERUNG ................................................................. 146 12 DIE UMSETZUNG DER QUALITÄTSSICHERUNGSSTRATEGIEN IM UNTERRICHT ................ 148 13 SCHLUSSFOLGERUNGEN ............................................................................................................ 149 13.1 13.2 14 ZUSAMMENFASSENDER ÜBERBLICK ......................................................................................................... 149 WEITERE ARBEIT DER ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT „DONAU – QUALITY IN INCLUSION“ ................ 151 VERWENDETE LITERATUR ........................................................................................................... 153 Leittext März 2006 Seite 5 15 ANHANG .......................................................................................................................................... 171 15.1 ANHANG 1 ................................................................................................................................................ 171 15.1.1 Literaturzitate zu: Qualitäten der Beziehungsdienstleistung Sozialarbeit .......................................... 171 15.1.2 Anhang 2 – Die Ansätze des Qualitätsmanagements und ihre wichtigsten Literaturquellen .............. 177 15.2 ANHANG 3 ................................................................................................................................................ 180 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Die pädagogische Qualität einer Einrichtung der Elementarerziehung ......................................... 18 Abb. 2: Die Entwicklung der Bedeutung von Qualität ................................................................................ 31 Abb. 3: Das TQM „Gebäude“...................................................................................................................... 37 Abb. 4: EFQM-Excellence-Model ............................................................................................................... 40 Abb. 5: Balanced Scorecard ....................................................................................................................... 45 Abb. 6: Zehn Schritte des Benchmarking-Prozesses ................................................................................. 47 Abb. 7: Systematik der Qualitätstechniken gegliedert nach dem PDCA-Circle von Deming ..................... 52 Abb. 8: Sozialstaat und Lebenslauf ............................................................................................................ 63 Abb. 9: Sozialpolitische Handlungsfelder im Wohlfahrtsdreieck ................................................................ 71 Abb. 10: Politische Zuweisung im Wohlfahrtsdreieck ................................................................................ 73 Abb. 11: Widerspruchsdreieck ................................................................................................................... 84 Abb. 12: Sozialarbeit im Qualitätsdiskurs ................................................................................................... 89 Abb. 13: Sozialpolitisches Umfeld der Qualitätsdebatte in der Sozialen Arbeit ....................................... 109 Abb. 14: Qualitätsbausteine und ihre Wechselwirkung ............................................................................ 129 Abb. 15: Besonderheiten der Beziehungsdienstleistungen ...................................................................... 132 Leittext März 2006 Seite 6 1 Einleitung Der hier vorgelegte „Leittext“ ist ein erstes Ergebnis der Arbeit des Moduls 1 der Entwicklungspartnerschaft „Donau. – Quality in Inclusion“ und soll das Thema Qualität als Grundlage so aufbereiten, dass damit im Gesamtprojekt weiter gearbeitet werden kann. Dieser Leittext erfüllt zwei Aufgaben: Darstellung der Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit und Herausarbeiten ihrer Probleme Darstellung der Probleme rund um das Qualitätsthema, die sich aus dem neuen Vergaberecht ergeben. Mit diesem Text wird eine Grundlage geschaffen, auf der in den „angewandten“ Modulen 2-5 Qualität, Qualitätsbestimmung und ihre Bewertung bearbeitet werden, um sie wieder in die theoretische Reflexion im Modul 1 einfließen zu lassen. Dieser Text versteht sich als work in progress und wird die Basis für den Beratungsleitfaden und die Unterlagen für die Lehre bilden. Als untersuchungsleitende Hypothese liegt diesem Text (und damit der gesamten Modularbeit) die Überlegung zu Grunde, dass sich Sozialarbeit der Strategien der Qualitätssicherung bedienen kann, um im Rahmen zunehmender öffentlicher Beauftragung durch Vergabe dem „BilligstbieterInnenprinzip“ ein „BestbieterInnenprinzip“ entgegen zu setzen. Diese qualitätssichernden Strategien im Zusammenhang mit Vergabe werden in dieser Entwicklungspartnerschaft im Trialog zwischen dem Dritten Sektor, der Sozialwissenschaft und den beauftragenden öffentlichen Stellen entwickelt. Diese trialogische Form der Strategieentwicklung ist als innovativ zu bezeichnen. In den letzten Jahren sind zum Thema Leistungs- und Qualitätsbeurteilungen einige grundlegende Arbeiten erschienen (vgl. auch Bibliografie), dennoch kann das Thema „Qualitätsmanagement in der Sozialarbeit“ noch lange nicht als umfassend beforscht bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für Österreich. Wien und St. Pölten im März 2006 Leittext März 2006 Seite 1 2 Qualitätsdiskussion in der Sozialarbeit – ein Einsteig 2.1 Gab es bisher keine Qualität in der Sozialarbeit? Diese Frage ist natürlich polemisch, denn Sozialarbeit hat sich um die Sicherung ihrer Ergebnisse bemüht, solange sie Sozialarbeit ist. Müller (1988a:18f) weist darauf hin, dass die Arbeit an den Methoden, also an der Qualität der Sozialarbeit so alt ist wie die Profession selbst, wobei er deutlich macht, dass die Gleichstellung von „Qualität“ und „guter Sozialarbeit“ von Anfang an irreführend war und dass Sozialarbeit immer sowohl eine helfende als auch eine gesellschaftsstabilisierende Funktion hatte: „Demgegenüber gebe ich zu bedenken, dass an der Wiege der so genannten Methoden der Sozialarbeit nicht die VerBeruflichung und Professionalisierung einer bis dahin spontanen mit-menschlichen Hilfstätigkeit stand, sondern ihr Gegenteil: die Funktion der Trennung zuwischen ‚guten’ und ‚schlechten’ der Hilfe Bedürftigen, die Substitution spontaner Barmherzigkeit durch die professionelle Entscheidung, wer im Interesse der Herstellung der Persönlichkeitsstruktur des (damals) modernen Lohnarbeiters Hilfe erhält und wem sie verweigert werden muss.“ (Müller, ebenda). Aber die Qualitätsfrage wurde in den verschiedenen Epochen unterschiedlich gestellt. Meinhold (2003:130) weist auf die verschiedenen Schwerpunktsetzungen des sozialarbeiterischen Diskurses in den letzten 40 Jahren hin, die wiederum mit unterschiedlichen Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung und hier wiederum vor allem mit den Entwicklungen in der Sozialpolitik korrespondieren: „Der Politjargon der frühen 70er Jahre ist längst vergessen; und selbst die darauf folgenden therapeutischen Begriffe und Gefühlswörter haben weitgehend ausgedient; sie sind einer Art ‚Yuppie-Sprachstil’ gewichen. Tatsächlich aber hat jeder neue Sprachstil nicht nur als ‚Mode’ gewirkt, sondern ist von tief greifenden Veränderungen begleitet gewesen; diese Veränderungen betrafen das berufliche Selbstverständnis, die methodischen Handlungsorientierungen, die Arbeitsschwerpunkte und die bevorzugte Klientel.“ Heute stehen wir vor einer Situation, die gern als „Knappheit der Öffentlichen Kassen“ und als „Sparzwang“ beschrieben wird. Obwohl ein Rückgang der Sozialhaushalte des Staates empirisch nicht festzumachen ist, steigen einerseits die zur Verfügung gestellten Öffentlichen Mittel deutlich langsamer als der Bedarf und die wachsenden Möglichkeiten gesellschaftlicher Sozialpolitik, andererseits findet eine politische Um- Orientierung von öffentlichen hin zu privaten und gemeinwirtschaftlichen Leistungen statt (vgl. z.B. Kaufmann, 1997, Scheil-Adlung, 2001). Dies führt zu einer Ökonomisierung der Sprache in der Sozialarbeit und zwar sowohl bei der öffentlich erbrachten Sozialarbeit (z.B. durch Verwaltungsreformen und New Public Management in Sozialämtern) als auch bei der durch den Dritten Sektor erbrachten sozialen Dienstleistungen (z.B. Bedeutungszuwachs von „Sozialmanagement“). Meinhold (2003:131) dazu: „Die betriebswirtschaftliche Sprache erinnert die Fachkräfte daran, dass soziale Dienstleistungen nicht nur erbracht, sondern auch finanziert werden müssen. Unter der erweiterten Perspektive werden sich die Fachkräfte nicht mehr primär und ausschließlich für den Klienten-Kunden verantwortlich Leittext März 2006 Seite 2 fühlen, sondern Verantwortung für ‚das Ganze’ übernehmen müssen, d.h. für die Lebensfähigkeit ihrer Einrichtungen und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze.“ Wieweit diese Entwicklung für einen – vorerst einmal anzunehmenden – Paradigmenwechsel in der Sozialarbeit verantwortlich ist, sollen die folgenden Überlegungen klären. 2.2 Entwicklungen in der Sozialarbeit Sozialarbeit hat in ihrer Geschichte schon viele Entwicklungen erlebt. Allein der Wandel von der „FürsorgerIn“ zur „SozialarbeiterIn“ war ein weiter Weg. Um den Einstieg in die 70er, 80er, 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bis heute zu erleichtern, wird dazu ein kurzer Abriss der drei „klassischen Methoden“ der Sozialarbeit, die den Diskurs (in) der Sozialarbeit wesentlich geprägt haben, dargestellt. Bei den drei so genannten „klassischen Methoden“ handelt es sich um: Einzelfallhilfe, auch Individualhilfe, Social Casework, Fallarbeit genannt (soziale) Gruppenarbeit, auch Gruppenpädagogik, später Gruppentherapie Gemeinwesenarbeit oder Stadtteilarbeit, Regionalentwicklung, Dorferneuerung, SOZIALRAUM-Arbeit, community organisation, community development Die Einzelfallhilfe wurde von Mary Richmond in den USA in ihrem Buch „Social Diagnosis“ 1917 vorgestellt (vgl. Meinhold 2002:509). Alice Salomon brachte diese Methode durch Auslandsaufenthalte in den USA von 1923 bis 1924 nach Deutschland und publizierte sie in ihrem Buch „Soziale Diagnose“ (vgl. Schilling 2005:227f). Vorerst wurde dieser Methode keine besondere Beachtung geschenkt. Schilling weist darauf hin, dass die praktische Anwendung erst in den 50er Jahren erfolgte. Auch C.W. Müller bestätigt, dass der Aufbau der Methode Einzelfallhilfe in Deutschland ab 1945 unter anderem durch Herta Kraus, zu erkennen ist (vgl. Müller, 1997:73ff). Ebenso sieht Meinhold die Anfänge dieser Methode auch in den 50er Jahren, beginnend mit 1945, betont aber auch, dass erst in den 70er Jahren vermehrt damit gearbeitet wurde, nachdem sie Erweiterungen und Ergänzungen erfahren hatte (vgl. Meinhold, 2002:512f). Im Blickfeld der Einzelfallhilfe steht das Individuum, wobei die „Umwelt“ nicht außer Acht gelassen werden kann. Die soziale Gruppenarbeit kam ebenfalls aus den USA nach Deutschland und bezog sich vorerst auf Jugendliche. Hier war das Thema „Erziehung“ im Vordergrund. 1947 startete Austauschprogramm und Müller meint zum Import der Sozialarbeits-Methoden aus den USA: „Wenn immer wieder gesagt und geschrieben wird, die amerikanischen Besatzungstruppen hätten uns nach dem Zusammenbruch nationalsozialistischer Jugend- und Sozialarbeit die klassischen Methoden dieser Arbeit nach Deutschland gebracht, so sollte künftig diese Aussage korrigiert werden. Nicht sie haben sie uns gebracht, sondern wir haben sie uns geholt. Mit Hilfe eines großzügigen Austausch-Programms, dessen Reichweite und Wirkung bisher nur im Einzelfall individuell erfahren, aber nicht wirklich öffentlich bekannt und benannt gewesen ist. Leittext März 2006 Seite 3 Das Austausch-Programm der Amerikaner war von vornherein als Zweibahnstraße angelegt worden. Deutsche Multiplikatoren fuhren in die USA und einige europäische Länder, amerikanische Experten kamen für jeweils bis zu drei Monaten nach Deutschland“ (Müller, 1997:47). Eine der ExpertInnen in diesem Austauschprogramm – genannt „visiting experts programm“ – war Gisela Konopka, die als Professorin für social group work Fortbildungsveranstaltungen anbot (vgl. Müller 1997:48f). Eine wichtige Perspektive in der Gruppenarbeit sind die Beziehungen einzelner Individuen zueinander. Die hauptsächliche Aufgabe der Gruppenarbeit ist die Reflexion der Beziehungen zueinander. Die Gemeinwesenarbeit wurde genauso wie die zwei vorhergehenden Methoden als Methode aus den USA in den 50er Jahren übernommen. Müller meint, dass dieser Begriff für die Fachöffentlichkeit Deutschlands erst 1956 oder spätestens 1962 nach den Internationalen Konferenzen für Sozialarbeit ein Begriff wurde (vgl. Müller, 1997:100ff). Gemeinwesenarbeit steht in Verbindung mit der Settlement-Bewegung und hat das Gemeinwesen im Blickfeld. Damit kann unter Mitwirkung der BewohnerInnen eine regionale Weiterentwicklung erzielt werden. In Österreich wurde bereits 1901 in Wien der Verein „Settlement“ gegründet, dies führte jedoch zu keinem Aufbau einer gemeinwesenorientierten Sozialarbeit. Neben dem Aufbau und der Übernahme der „Amerikanischen Methoden“ wurde parallel dazu an ihnen auch Kritik formuliert (vgl. Müller 1997 und Schilling 2005). Zwei dieser Methoden – Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit – werden im Kapitel 4.4. noch näher ausgeführt. Bereits vor der Übernahme der drei beschriebenen „klassischen Methoden“ der Sozialarbeit aus den USA war in Österreich eine erste Professionalisierung von Sozialarbeit erkennbar. So spricht z.B. Melinz von einer „Modernisierung des Fürsorgebereichs und 1. Blütezeit beruflicher Sozialarbeit“ (Melinz, 2000:26) in den 20er Jahren. (Zur Entwicklung der Sozialarbeit in Österreich: siehe Anhang 1: Tabelle Melinz) 2.2.1 Entwicklungen und neue Paradigmen „Sozialarbeit im heutigen Sinn hat sich – so die allgemeine Auffassung – erst in den 60er/70er Jahren infolge eines Imports ausländischer Theorie bzw. eines Re-Imports im Zuge des Nationalsozialismus abgerissener Diskurse konstituiert.“ (Wolfgruber 2005:1, Hervorhebungen im Original). Die 70er Jahre zeigen ein Bild der Kritik und Veränderung der Gesellschaft. Soziale Probleme sollten durch Politik und Gesellschaftsveränderung gelöst werden. So wurden KlientInnen zu AdressatInnen politischer Programme – die, „… – so die Annahme – allen Grund (hatten), Mitstreiter der gesellschaftlichen Veränderung zu sein.“ (Bader, 1999:17). In dieser Zeit entstanden viele Selbsthilfebewegungen, (totale) Institutionen (z.B. Psychiatrie) wurden geöffnet und Kinder/Jugendliche von StudentInnenbewegungen aus Heimen ‚befreit’. Gemeinwesenarbeit war die Hoffnung dieser Tage, und wurde – genauso wie Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit – aus den eigenen Reihen stark kritisiert. Leittext März 2006 Seite 4 Spätestens Anfang der 80er Jahre zeigte sich, dass KlientInnen „sich nicht mobilisieren ließen und offensichtlich andere Interessen hatten bzw. ihre Betroffenheit nicht umstandslos in gesellschaftsverändernde Aktivitäten übersetzten. Die Erfahrung, wie schwierig es ist, gesellschaftliche Veränderungen zu bewerkstelligen, führte zur Auflösung dieses politisch motivierten Konzeptes“ (Bader, 1999:17). Prägend für die Soziale Arbeit in den 80er Jahre waren Methoden aus der Psychotherapie und der Gruppendynamik. Supervision und Selbstreflexion traten in den Vordergrund. C. W. Müller spricht von drei professionellen Entwicklungen, die sich in den 80er Jahren etablierten (vgl. Müller 1997:206 ff): Professionalisierung der Gesprächsführung durch C.R. Rogers (Personenzentrierter Ansatz) und theoretische Fundierung von Kommunikation durch Paul Watzlawick u.a. Systemische Beratung (statt sozialer Einzelfallhilfe) Organisationsentwicklung/Sozialmanagement Zum Sozialmanagement führt C.W. Müller aus: „Seit den 70er Jahren werden Profis in öffentlichen und privaten Einrichtungen Sozialer Arbeit dazu gedrängt, über die organisatorischen Voraussetzungen, Nebenwirkungen und Wirkungsgrenzen ihrer Institutionen nachzudenken und alternative Organisationsformen zu entwerfen. In kommunalen Ämtern wird der mögliche Gegensatz zwischen Zentralisierungstendenzen im Rathaus und bürgernaher Dezentralisierung im Stadtteil diskutiert (…). Die Wohlfahrtsverbände nehmen Fragen der Organisationserneuerung und Organisationsentwicklung in ihr Fortbildungsprogramm auf (…), weil sie über Fragen einer „optimalen Betriebsgröße“ nachdenken müssen oder über das spannungsreiche Verhältnis zwischen in ein Ehrenamt gewählten Vorständen und ihren professionellen Geschäftsführern – zwischen sozialstaatlich flächendeckender Versorgung einerseits und marktwirtschaftlich an Teilmärkten orientierter geldwerter Dienstleistungen (…) andererseits. Die Tendenz zur Privatisierung sozialstaatlicher Leistungen in Gestalt von betroffenennahen Selbsthilfegruppen und deren lokalen Organisationen produziert seit Ende der 80er Jahre einen neuen Typ von Nachfrage nach Methoden von Projektmanagement, Sozialmanagement und der Weiterentwicklung bestehender Strukturen in Richtung auf neue Aufgaben (Organisations-Entwicklung).“ (Müller 1997:212) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der in den 80er Jahren eingeschlagene Weg Richtung „ICH“ sich als zu „idealistisch“ darstellte. Die in der Sozialarbeit Beschäftigten entwickeln seit den 90er Jahren „(…) Sozialmanagement-Konzepte (…), die Bezug nehmen auf eine veränderte gesellschaftliche (ökonomische) Situation, diese zum Ausgangspunkt der Überlegungen zu machen und gleichzeitig den „subjektiven Faktor“ (- „MENSCH“ Anm. d. Verf.) in den Mittelpunkt zu stellen.“ (Bader 1999:18). Bei ihr sind ökonomische Fragen das wichtigste Motiv für die Entwicklung von Management-Konzepten und nicht fachliche oder ethische Beweggründe. Wichtige Annahmen für die Sozialarbeit im Heute sind: Legimitationsdruck/Rechtfertigungsdruck (Druck des ökonomischen Primates) Leittext März 2006 Seite 5 Ökonomischer Diskurs um QUALITÄT: Gegenwärtige Standardisierung und „Messbarmachung“ der Leistungen Führungsebene gibt Druck an MitarbeiterInnenebene ab und gefährdet somit die Qualität von Beziehungsarbeit Gefahr, dass die Auswahl der Klientel auf „leichte“, „einfache“ KlientInnen fällt, mit „schweren“ KlientInnen kann nicht so viel Erfolg im Sinne von „guten Vermittlungszahlen“ erzielt werden – dadurch nimmt aber Beziehungsaspekt/-arbeit ab! Es kann nicht die Qualität der Beziehungsarbeit gemessen werden, sondern nur die Qualität der Arbeit bzw. einzelne Erfolge der KlientInnen Ansatz der Lebensweltorientierung: KlientIn, du bist (quasi) ExpertIn deiner Lebenslage selbst – Empowerment – „Hilfe zur Selbsthilfe“ Herausforderung: Konstante Themen waren und sind: Rechtliche Rahmenbedingungen (gesetzlicher Auftrag etc.) Doppeltes – und Mehrfaches Mandat Koppelung von Sozialpolitik und Sozialarbeit Ehrenamtliches/berufliche Engagement in der Sozialarbeit 2.2.2 Professionalisierung der Sozialarbeitsausbildung Sozialarbeit und Geschichte der Profession bedeutet laut Fremdwörterduden nicht mehr als Beruf oder Gewerbe. Dem gegenüber meint aber Heiner dazu einleitend: „Nicht jeder Beruf kann beanspruchen zu den Professionen gezählt zu werden. Professionen sind gehobene Berufe mit akademischer Ausbildung, besserer Bezahlung und größerer Entscheidungsfreiheit in der Ausübung der beruflichen Tätigkeiten.“ (Heiner 2004:15) Weiter zu diskutieren wäre insbesondere, was die Voraussetzungen dafür sind, dass sich eine Berufsgruppe als Profession verstehen darf? Wesentliche Marksteine der Professionalisierung der Sozialarbeit in Österreich in den letzten Jahren lassen sich in drei Bereichen markant erkennen: Leittext März 2006 Seite 6 2001: die ersten Studiengänge Sozialarbeit auf einer Fachhochschule werden ins Leben gerufen ein Berufsgesetz der SozialarbeiterInnen auf Bundesebene ist in Ausarbeitung1 Sozialarbeitsforschung an Fachhochschulen „Soziale Arbeit ist nicht nur irgendeine Profession. Sie lebt von der Faszination, die von Menschen ausgeht. Sie lebt von der Freude am Komplizierten und Komplexen, am nicht völlig durch Analyse Erfassbaren und durch Konzepte Bewältigbaren. Soziale Arbeit ist Kommunikationskunst und Organisationskunst, allerdings nie l’art pour l’art. Dazu ist ihr Gegenstand, die Bewältigung menschlicher sozialer Probleme, zu ernst und ihr Handeln zu erfolgreich“ (Pantucek 1998:11). „Die unvollkommene Professionalisierung der Sozialarbeit im deutschen Sprachraum zeigt sich unter anderem darin, daß es bisher noch nicht zu einer innerhalb der Profession weitgehend anerkannten Formulierung ethischer Grundprinzipien und zu einer Kodifizierung der Klientenrechte kam. Es gibt noch keinen „Code of ethics“ wie z.B. in den USA, der einerseits eine Leitlinie für berufsbezogene ethische Entscheidungen, andererseits die Festlegung von Standards zum Schutz der Klienten, und zum Dritten eine Abgrenzung gegenüber Zumutungen von Auftraggebern darstellt. Neben dem besonders detailliert ausgearbeiteten US-amerikanischen Kodex gibt es auch andere Kodizes, die allerdings etwas weniger klarer formuliert sind (Großbritannien, Israel, Code of Ethics der International Federation of Social Work)“ (Pantucek 1998:276 f). 2.2.3 Aktuelle Berufspolitik zum Thema Qualität in der Sozialarbeit/ Sozialen Arbeit Die Berufsverbände der SozialarbeiterInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz betonen bei ihrer Beschäftigung mit dem Thema „Qualität in der Sozialarbeit/Sozialen Arbeit“ unterschiedliche Ebenen bzw. Dimensionen. Der Österreichische Berufsverband (ÖBDS) der SozialarbeiterInnen hat 2002 eine Bundestagung mit dem Titel „Qualitäts-ver-Lust“ durchgeführt. Im Anschluss an diese Tagung wurde ein Positionspapier zu „Qualität in der Sozialarbeit“ entwickelt (http://www.sozialarbeit.at/qual.htm, 16.01.2006). Die Qualitätskriterien in diesem Papier beziehen sich ausschließlich auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisdimension. Vom Deutscher Berufsverband (DBSH) wurde auf der Homepage eine Diskussion zu den Qualitätskriterien gestartet. Auf dieser Homepage findet sich ein „Qualitätskriterien Grundraster“ (http://www.dbsh.de/Qualit_tskriterien.pdf, 27.11.2005) der 2005 erstellt wurde. In diesem wird folgende Einteilung vorgenommen: Kontext-, Kompetenz- und „Klientenebene“/Klientenbezug. Zusätzlich lässt sich mittels eines „Raster(s) zur 1 Quelle: www.sozialarbeit.at/be-06.htm, 14.12.2005 Leittext März 2006 Seite 7 Selbstbewertung von Qualität in der Sozialen Arbeit“ (Quelle: http://www.dbsh.de/Qualiselbst.pdf, 27.11.2005) die Anwendbarkeit der Kriterien überprüfen. Der ehemalige Schweizer Berufsverband der Sozialen Arbeit SBS/ASPAS bezog sich auf seiner Homepage auf einen Beitrag von Daniel Iseli, mit dem Titel: „Qualität: die entscheidende Frage für die Soziale Arbeit?“ (http://www.sozialaktuell.ch/de/p11003083.html, 29.11.2005). In diesem Text wird auf fünf Dimensionen verwiesen: Strategische Rahmenbedingungen Fachlichkeit Management Anspruchsgruppen Mitarbeitenden Zu ergänzen ist hier, dass sich der Schweizer Berufsverband zu Beginn 2006 neu konstituiert hat. Unter der Bezeichnung AvenirSocial vertritt er die „Professionellen der Ausbildung in Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Soziokultureller Animation, Kindererziehung und Arbeitsagogik auf Ebene Höhere Fachschule, Fachhochschule und Universität in der Schweiz.“ (http://www.sozialaktuell.ch/de/p42000177.html, 16.01.2006) und ist unter der Homepage http://www.avenirsocial.ch/home.cfm erreichbar. 2.3 Qualität ist nicht automatisch „gute“ Qualität 2.3.1 Qualitätsdefinition Qualität ist ein nicht skalierter, nicht gerichteter Begriff und bezeichnet „nur“ einen Zustand, sagt aber apriori nichts über dessen Wertung aus. Der Herkunftsduden (1963:541) sagt dazu: „Qualität (w) ‚Beschaffenheit; Güte; Wert; Klangfarbe (eines Selbstlautes)’: Im 16. Jahrhundert aus lat. qualitas ‚Beschaffenheit, Verhältnis, Eigenschaft’ entlehnt, das von lat. qualis ‚wie beschaffen’ abgeleitet ist. Dazu das Adjektiv qualitativ, der Beschaffenheit, dem Wert nach’ (19. Jh. aus gleichbed. mlat. qualitativus)“. Es geht daher nicht nur um die Bestimmung von Qualität, sondern auch um ihre Skalierung, also um die Bestimmung „guter“ Qualität. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass auch das Erkennen von „Qualität“ als „Zustand“ wertvolle Informationen über den jeweiligen Gegenstand oder die jeweilige Dienstleistung liefert, Es ist allerdings zu beachten, dass die umgangssprachliche Gleichstellung von „Qualität“ und „guter Qualität“ eine begrifflich klare Entwicklung der Analyse und Strategieentwicklung von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung behindert bzw. verunmöglicht. Die Frage nach der Leitdifferenz zwischen Qualität und „guter“ Qualität muss daher sein: Was sind die Unterschiede, die gute Qualität von Qualität unterscheiden? In der Sprache der Betriebswirtschaft wird Qualität daher wie folgt definiert: „Qualität ist allgemein formuliert die Gesamtheit von Eigenschaften bzw. Merkmalen eines Produktes (Güter, Dienstleistungen, das Ergebnis eines Prozesses) und des zugehörigen Prozesses, Leittext März 2006 Seite 8 bezogen auf deren Eignung zur Erfüllung vorgegebener Anforderungen bzw. Erwartungen. Qualität ist somit relativ, d.h. abhängig vom jeweiligen Kunden, vom Nutzer, vom Markt und vom Wissensstand“. (Patzak/Rattay 1998:23) oder platter formuliert: „Qualität ist, was der Kunde wünscht“ (ebenda). Es ist daher notwendig, in Analyse sowie in Beschreibung genau zwischen Zustandsbeschreibungen und Wertungen zu unterscheiden, eine Verschleifung von Beschreibung und Wertung (etwa in dem man den neutralen Begriff „Qualität“ ständig wertend im Sinne „guter Qualität“ verwendet) schafft jene Unschärfen, aus denen heraus es nicht möglich ist, trennscharf die Unterschiede, die Qualität von guter Qualität unterscheiden, zu erkennen. Wertungen sind nie interessensfrei, es gilt daher auch, die den Werten unterlegten Interessen zu erkennen. Daraus ergibt sich ein analytischer Dreischritt: Zustand Interessen und ihre Normenbasierung (Werte) Wertungen Aus der Synthese der so aufbereiteten Untersuchungsgegenstände kann der real vorgefundene Zustand mit einem ideal gewünschten Zustand (der ebenfalls durch diesen Dreischritt bestimmt wird, wobei hier die eigenen Interessen bzw. die Interessen der eigenen Zielgruppen im Vordergrund stehen) verglichen werden. Die Differenzen, die in diesem Vergleich zutage treten, können dann die Grundlage für Handlungsempfehlungen auf dem Weg von Qualität zu guter Qualität bilden. In weiterer Folge wird daher immer von „guter“ Qualität die Rede sein, wenn dieser Begriff wertend gemeint ist, ist er beschreibend gemeint, steht hier nur „Qualität“. 2.3.2 „Gute Qualität“ – Der Zustand und das, was von ihm erwartet wird Verständnis von „guter“ Qualität einer Dienstleistung kann aus der Übereinstimmung zwischen den Erwartungen an diese Dienstleistung und der tatsächlich erbrachten Dienstleistung gewonnen werden. Dabei sind die Besonderheiten zu beachten, die sich aus der Tatsache ergeben, dass es sich in dieser Diskussion fast ausschließlich um persönliche Dienstleistungen handelt, deren Herstellung sich wesentlich von der Herstellung von Waren unterscheidet: „Produktion und Konsumtion der Leistung fallen zusammen (uno-actu-Prinzip); personenbezogene Dienstleistungen sind nicht speicherbar, stellen auch kein ‚Produkt’ im materiellen Sinn, sondern stets einen Prozess dar. Die Qualität der Dienstleistung hängt deshalb in hohem Maße von der Interaktion zwischen ‚Leistungsanbieter’ und ‚Kunde’ ab. Das Ergebnis der Leistung ist damit im hohen Maße bedingt durch die Kooperationsfähigkeit und Kooperationswilligkeit des Adressaten der Dienstleistung; der Konsument ist nicht nur ‚Nachfrager’, sondern gleichzeitig Teil des Produktionsprozesses der Leistung“ (Reis 2003:271). Die LeistungsbezieherInnen sind also gleichzeitig Ko-ProduzentInnen der Leistung, ein Aspekt, der im Qualitätsdiskurs berücksichtigt werden muss. „Das bedeutet, dass das ‚persönliche’ Verhältnis zwischen Produzent und Kunde elementarer Bestandteil der Leistung und vor allem der Qualität der Leistung ist. Damit sind personenbezogene Leittext März 2006 Seite 9 Dienstleistungen ‚heterogene’ Produkte, d.h. in ihrer Qualität schlecht vergleich- und kalkulierbar“ (Reis 2003:272). Dadurch unterscheiden sich soziale Dienstleistungen auch von anderen persönlichen Dienstleistungen: Durch die Notwendigkeit eines hohen Ausmaßes von Mitwirkung der LeistungsempfängerInnen. Während der/die KundIn der Dienstleistung „Frisör“ nur den Kopf hin- und stillhalten muss, muss er/sie als KundIn der Dienstleistung „Sozialarbeit“ den eigenen Kopf (die eigenen Gedanken) verwenden. Denn die „Besonderheit Sozialer Hilfen besteht gerade darin, dass der finale Erfolg (das ‚Produkt’) nur in der Interaktion zwischen den direkt Beteiligten entsteht. Dieser Ko-Produktionsprozess setzt grundlegend den/die SachbearbeiterIn und den/die betroffene/n BürgerIn als handelnde Subjekte voraus. (…) Dies ist mit betriebswirtschaftlichen Begrifflichkeiten nicht adäquat zu fassen. Es handelt sich nicht um eine ‚Simultanität der Erstellung und des Konsums’. Hilfe zur Selbsthilfe kann man nicht konsumieren, auch nicht simultan erstellen, sondern nur kooperativ erarbeiten..“ (Jung 2003:396). Das relativiert natürlich auch die Möglichkeiten, die EmpfängerInnen von Hilfe zur Selbsthilfe als „KundInnen“ im üblichen betriebswirtschaftlichen Sinn zu verwenden. In der Qualitätsdefinition geht es um zwei Problembereiche, nämlich (1) um Fachliche Standards und (2) um Erwartungen und ihre Kriterien. Der Zusammenhang kann in einer kleinen Grafik wie folgt dargestellt werden: Ergebnis der Dienstleistung Kriterien der Beurteilung von Qualität Fachliche Standards Maßnahmen zur Q-Sicherung Diese Qualitätsentwicklung einem gesellschaftlichen verschiedenen, zum Teil AkteurInnen. Dies führt zur weiter unten). steht jedoch immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Normalisierungsauftrag an die Sozialarbeit sowie den normenbasierten Interessen der im Prozess beteiligten Debatte um das „Doppelte Mandat“ in der Sozialarbeit (siehe Meinhold (2003:135f) definiert bei einer Sammlung von möglichen Ergebnissen, die durch die Arbeit eines sozialen Dienstes zu beeinflussen sind, vier unterschiedliche Typen von Ergebnissen: Ergebnisse, die sich unmittelbar aus der Existenz eines sozialen Dienstes ergeben Ergebnisse, die sich aus der Co-Produktion der SozialarbeiterInnen und KlientInnen bzw. aus dem Erreichen von Zielen erschließen lassen Ergebnisse, die für den Kostenträger und andere Institutionen erbracht werden Ergebnisse, an deren Erreichen längerfristig mitgewirkt wird (Gesellschaft) Leittext März 2006 Seite 10 Kosten – Nutzen – Debatte Die Qualitätsdebatte steht immer auch in einem Spannungsverhältnis, da sich zwischen den „Kosten“ und dem „Nutzen“ der Qualitätssicherung (Qualitätsentwicklung) einer Maßnahme aufspannt. Bei den (zusätzlichen) Kosten stellt sich immer die Frage: Wer trägt die Kosten? Dabei ist zu beachten, dass nur ein Teil der Kosten als Preise erscheinen und daher bezifferbar sind. Ein Teil der Kosten entsteht indirekt bzw. wird im geldfreien Raum, getragen. Zum Beispiel wären die realen Kosten ehrenamtlicher Intervention oder der ehrenamtlichen Leitung eines Vereines nur dann auszuweisen und als Teil der Kosten des Qualitätsentwicklungsprozesses zu benennen, wenn berechnet würde, was dieser ehrenamtlich erbrachte Teil der Maßnahme zu Marktpreisen wert wäre. Auch jene Tätigkeiten, die die KlientInnen oder ihre Angehörigen selbst erbringen, wären als Kosten zu berücksichtigen, sie erscheinen aber nicht als Preise. Wir müssen daher unterscheiden zwischen den externalisierten Kosten, die Geldgeber, Öffentliche Hand, KlientInnen, Träger etc. tragen und den internalisierten Kosten, die KlientInnen, Beschäftigte, Umwelten tragen, ohne sie über Preise realisieren bzw. beziffern können. Die Gesamtkosten von qualitätssichernden oder qualitätsentwickelnden Maßnahmen sind in der Sozialarbeit daher in der Regel deutlich größer als die in Preisen ausgewiesenen Kosten. Es würde sich daher lohnen, in der politischen bzw. öffentlichen Debatte um die „Hohen Kosten“ der Öffentlichen hand in der Qualitätsentwicklung auf den großen Anteil der internalisierten Kosten zu verweisen, um damit deutlich zu machen, dass die „knapper werdenden öffentlichen Mittel“ nur einen Teil der gesamten Kosten ausmachen. Auch die Kostenreduktionen erscheinen internalisiert und externalisiert, d.h. schaffen u. U. sogar gesellschaftliche Mehrkosten (insbesondere wenn Folgekosten entstehen, die durch rechtzeitige Intervention verhindert oder reduziert hätten werden können). Daher muss auch die derzeit laufende „Professionalisierungsdebatte“ unter dem Qualitätsaspekt kritisch betrachtet werden: Wie wirkt die angestrebte Kostenreduktion unter dem Blickwinkel der Qualitätsentwicklung (z.B. Verehrenamtlichung)? Der Nutzen sozialer Arbeit bzw. sozialer Dienstleistungen ist unterschiedlich und unterscheidbar von den Kosten dieser Dienstleistungen zu diskutieren. Dabei ist herauszuarbeiten, was jeweils „Nutzen“ ist und wer den „Nutzen“ an der jeweiligen Intervention hat. Auch beim Nutzen gibt es internalisierten und externalisierten Nutzen bzw. die Erfüllung offener und versteckter Ziele. So hat den Nutzen (allerdings einen jeweils unterschiedlichen und unterscheidbaren Nutzen) einer Wohnungslosenhilfe-Maßnahme sowohl der wohnungslose Mensch, wenn ihm/ihr geholfen wird, wiederum Wohnraum zu erlangen als auch die lokale Politik, wenn ihr gelungen ist, dass obdachlose Menschen nicht mehr so stark im öffentlichen Raum auffallen. Daher ist auch der Nutzen (und damit die Bewertung des Nutzens in der Qualitätsdebatte) anhand den weiter oben genannten vier Ergebnisebenen der Sozialarbeit zu entwickeln (vgl. Meinhold, 2003:135f). Leittext März 2006 Seite 11 Ergebnisse, die sich unmittelbar aus der Existenz eines sozialen Dienstes ergeben lösender und präventiver Nutzen Ergebnisse, die sich aus der Co-Produktion der SozialarbeiterInnen und KlientInnen bzw. aus dem Erreichen von Zielen erschließen lassen Nutzen für KlientInnen (Veränderung der Lebenslage) und SozialarbeiterInnen (Erfüllung von Zielen) Ergebnisse, die für den Kostenträger und andere Institutionen erbracht werden offene (z.B. Erfüllen eines sozialpolitischen Zieles) und verdeckte (z.B. Verschwinden von Problemlagen) Nutzen der (öffentlichen) Einrichtungen Ergebnisse, an deren Erreichen längerfristig mitgewirkt wird (Gesellschaft) Stabilisierung bzw. Veränderung sozialer Situationen als gesellschaftlicher Nutzen. Zu unterscheiden ist zwischen Nutzen und Nutzung. Zu beachten ist hier der Widerspruch von Nutzen und Nutzenerscheinung. Der Nutzen hat, wie gerade gezeigt wurde, mehr Dimensionen als mit einer rein quantitativ geschärften Brille erscheint. Die Nutzung hat immer vor allem die Nutzendimension der Person, die diese Leistung nutzt, die jeweils anderen Dimensionen des Nutzens werden von der/dem NutzerIn (bewusst oder unbewusst) ausgeblendet. Aber auch in dieser Betrachtungsweise darf die „Nutzung“ nicht auf die Nutzung durch den/die KlientIn reduziert werden, auch der politische Erfolg einer Maßnahme bedeutet eine Nutzung, in diesem Fall eben von der Körperschaft, die den politischen Nutzen davon hat. Es ist in der Qualitätsdebatte daher zu fragen: Welche Instanz sieht welchen Nutzen (welche Qualität von Nutzen und/oder welche Menge von Nutzen)? Dabei muss zwischen individuellem Nutzen und gesellschaftlichem Nutzen differenziert werden. Bezogen auf die Sozialarbeit heißt die leitende Frage in diesem Zusammenhang: Was ist die KERNaufgabe? Aber auch: Kann Sozialarbeit in ihrem doppelten Mandat auf “Kernaufgaben“ reduziert werden und wenn ja, was verliert sie dann? 2.3.3 Zur Problematik des KundInnenbegriffes 2.3.3.1 KlientInnen als KundInnen des New Public Managements? Mit dem Einzug neuer Managementmethoden in der öffentlichen Verwaltung (Stichwort: New Public Management) werden KientInnen – zumindest ihrer Begrifflichkeit nach – zu KundInnen umgebildet. Begründet wird dies mit einem Mehr an betriebswirtschaftlichem Denken, an Wettbewerb und an Qualität. „Nur dann wenn man die Adressaten sozialer Arbeit als Kunden betrachtet und sie auch über eine entsprechende Marktmacht und Wahlfreiheit verfügen, können sie sich als Subjekt wirksam gegen die Gefahr ‚normativer Verführung’, also dem bewussten oder unbewussten Versuch der wertmäßigen Lenkung durch den Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter wehren“ (Effinger 1993, zitiert bei Schaarschuch 2003:152). Die Generalthese ist, dass die Orientierung einer sozialen Dienstleistung (vorrangig der Behörde, aber auch von intermediären AnbieterInnen) am Begriff des „Kunden“ das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach diesen Dienstleistungen optimieren würde, welches eine Steigerung von Effektivität und Effizienz der angebotenen Dienstleistungen brächte. Dabei orientiert man sich an einem Verständnis von Qualitätsmanagement, das die „Zufriedenheit der KundInnen“ als oberstes (oder Leittext März 2006 Seite 12 einziges) Kriterium der Messung von Qualität der angebotenen Dienstleistung versteht. Meinold (2003:138) beschreibt den dazu passenden umfassenden KundInnenbegriff: „Alle Qualitätsarbeiten sollen darauf hinauslaufen, den potentiellen Kunden zufrieden zu stellen. ‚Kunden’ sind in der Sprache der Qualitätssicherungsliteratur alle Personen und Institutionen, die sich über die Qualität einer Dienstleistung ein Urteil bilden und die Akzeptanz der Dienstleistung fördern oder beeinträchtigen können (…). Diese ‚Kunden’ sind somit nicht allein ‚externe’ Kunden, wie Klienten im engeren Sinne; desgleichen sind die ‚Mediatoren’ (die Vermittler einer Dienstleistung) Kunden, ebenso die Zuwendungsgeber und Kostenträger. Des Weiteren sind die ‚internen’ Kunden zu beachten; das sind die Mitarbeiter einer Einrichtung, die in irgendeiner Weise mit der Dienstleistung befasst sind.“ Die Komplexität des „KundInnen“-Begriffes erfordert jedoch ein komplexes Herangehen, das die komplexe Funktion, die die Sozialwirtschaft in der Gesellschaft hat, die sich in unterschiedlichen, durch einzelne Individuen genauso wie durch unterschiedliche politisch und gesetzlich kodifizierte Aufträge niederschlägt berücksichtigen muss und daher die Relationen zu den unterschiedlichen Interessen, denen die Sozialwirtschaft gegenüber steht, reflektieren muss. „Die naive Ineinssetzung des Leistungsadressaten mit dem Kunden unterschlägt die Komplexität der öffentlichen Domäne und öffentlicher Handlungssysteme, so z.B. Phänomene des Zwangs, der Vermittlung, der Rationierung und der Gemeinwohlorientierung. Diese sind integrale Bestandteile öffentlicher Handlungssysteme, werden jedoch vom Konzept der Kunden-Anbieter-Beziehung nicht erfasst“ (Naschold, zitiert bei Reis 2003:267f). Die neue KundInnenorientierung, vor allem, wenn sie im genannten Sinn komplex begriffen wird, stößt in der sozialarbeiterischen Debatte nicht nur auf Ablehnung. Denn sie kann auch als Weiterentwicklung der Konzepte der Lebensweltorientierung und der Subjektorientierung der Sozialarbeit verstanden werden. „Im Zentrum dieser Ansätze stehen die alltäglichen, lebensweltlichen Bedingungs- und Deutungskontexte sowie die Respektierung bzw. Anerkennung der subjektiven Perspektiven der Adressaten. An diese auch auf professioneller Ebene verbreitete fachliche Orientierung an den lebensweltlichen Bezügen der Subjekte lagert sich nun diese neue, im Rahmen einer Strategie zur Modernisierung der öffentlichen Dienste gestellte Forderung nach einer Dienstleistungsorientierung, nach einer Orientierung an den Wünschen der so genannten ‚Kunden’ an. Der Dienstleistungs- wie auch der Kundenbegriff verheißt dabei eine neue Qualität im Verhältnis von Professionellen und Klienten. Und zwar eine neue Qualität, die sich in einem egalitären, respektvollen Verhältnis der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu ihren Adressaten ausdrückt; die die subjektiven Präferenzen der Klienten ernst nimmt und nicht länger paternalistisch überformt; eine neue Qualität, die nicht zuletzt eine Gleichwertigkeit mit dem privaten Sektor, also ein Bewusstsein der eigenen Modernität signalisiert“ (Schaarschuch 2003:153) 2.3.3.2 „KundInnen“ im Doppelten Mandat? In der sozialarbeiterischen Wirklichkeit muss dieser KundInnenbegriff unmittelbar aus dem Doppelten Mandat der Sozialarbeit abgeleitet werden. Einerseits ist sozialarbeiterische Intervention von der Mitwirkung und Mitwirkungsbereitschaft der KlientInnnen abhängig, Leittext März 2006 Seite 13 denn die durch Sozialarbeit zu bewirkende (bessere) Strukturierung von Lebensbedingungen und Lebensumständen kann nicht „für“ den/die KlientIn gemacht werden, sondern nur von ihr/ihm. Sozialarbeit leistet jene professionellen Hilfestellungen, die ihre EmpfängerInnen benötigen, um sein/ihr Leben produktiv und in Richtung auf bessere Lebensumstände hin zu verändern. Voraussetzung für den Erfolg dieser sozialen Dienstleistung ist daher das Vorhandensein einer entsprechenden Nachfrage nach Veränderungen der mit dieser Person verknüpften Zustände. Für die zu erbringende soziale Dienstleistung gilt daher: „Im Erbringungsprozess ist die Tätigkeit des Dienstleistenden auf die Veränderung des Zustandes, auf die Produktion des Subjekts bezogen, d.h. sie geht in die Veränderung des Subjekts ein, ohne sie selbst vollziehen zu können. Diese kann nur das Subjekt selbst hervorbringen.“ (Schaarschuch 2003:156). In dieser Sichtweise kann das begünstigte Subjekt der sozialen Dienstleistung durchaus als KundIn angesprochen werden, denn er oder sie fragt nach jenen unterstützenden Dienstleistungen nach, die er oder sie benötigt, um die eigene Lebenssituation produktiv zu verändern. Doch das Doppelte Mandat der Sozialarbeit hat immer auch eine andere Seite. Sozialarbeit hat immer (auch) die Aufgabe, bestehende gesellschaftliche Verhältnisse zu reproduzieren, eine bestehende (oder gewünschte) Ordnung aufrecht zu erhalten (oder wieder herzustellen) (vgl. z.B. Sachße/Tennstädt 1986). In dieser Funktion ist der Mandatsgeber (Auftraggeber) der Sozialarbeit immateriell „die Gesellschaft“ (besser: die herrschenden Strukturen der Gesellschaft), materiell ausgedrückt in expliziten oder impliziten Aufträgen gesellschaftlicher Institutionen, in der Regel auch2 jener Institutionen, die soziale Arbeit bezahlen. So gesehen ist nicht der/die KlientIn der/die KundIn von Sozialer Arbeit, Kunde ist hier vielmehr jene Institution (sind jene Institutionen), die Sozialarbeit mit der Herstellung oder Wiederherstellung bestimmter gesellschaftlicher Zustände beauftragen. Dieser Auftrag kann jedoch (meist gegenläufig zu den Aufträgen gesellschaftlich dominierender Strukturen) auch von den SozialarbeiterInnen selbst und jenen Institutionen, in denen (für die) sie tätig sind, kommen. Dort wo Sozialarbeit im Bereich der Öffentlichen Hand selbst erbracht wird (beispielsweise im Jugend- oder Sozialamt) kann das durchaus auch zu Strukturen „subversiver“ Tätigkeit3 in der Institution selbst führen, bei Sozialarbeit, die im Dritten Sektor erbracht wird, ist dies „Arbeit mit Mission“. Jedenfalls haben die Leistungen der Sozialwirtschaft immer sowohl das Interesse der Einzelnen wie das (artikulierte) Interesse der Allgemeinheit zu beachten. Daher geht es „gerade nicht darum, jedem ‚Kunden’ nach seinem artikulierten Bedürfnis Sozialhilfe auszuzahlen, sondern immer wieder die widersprüchliche Anforderung zu bewältigen, individuelle Bedarfe zu definieren und entsprechende Leistungen zu erbringen und dabei gleichzeitig das ‚Allgemeinwohl’, das sich im Nachrangigkeitsprinzip Ausdruck verleiht, im Auge zu haben. Dies gelingt nur durch das Aufstellen und Wahren von gerechten und legitimen Regeln. Aus diesem Grund kann diese Aufgabe nicht in einer Organisationsform 2 Nicht nur, denn auch indirekte gesellschaftliche Institutionen wie Medien oder Kirchen können in ihren Wirkungen faktisch Aufträge an Sozialarbeit formulieren. 3 Subversiv in jenem Sinne, als die (impliziten oder expliziten) Ziele der Behörde nach Minimierung des Aufwandes durch professionelle Arbeit (z.B. guter KlientInnenberatung) unterlaufen werden können. Leittext März 2006 Seite 14 erfüllt werden, die den individuellen Empfänger der Dienstleistungen allein in den Mittelpunkt stellt.“ (Reis 2003:268). 2.3.3.3 „KundInnen“ und mehr…. Von Sozialarbeit begünstigte Personen sind daher in dem Sinn auch KundInnen, aber nicht nur, sie sind auch KlientInnen, in dem Sinne als sie Arbeitsgegenstand subjektbezogener gesellschaftlicher Gestaltung sind. Dies ist auch in der Begrifflichkeit erkennbar: Während das Wort „Kunde“ den Begriff „kundig“ beinhaltet, also Wissen um die eigenen Bedürfnisse und die Mittel zu ihrer Erfüllung (und den Willen zur Gestaltung) beinhaltet, steckt im Wort „Klient“ der „Schutzbefohlene“ drinnen, also jener Person, für die Sozialarbeit (daher früher auch „Fürsorge“ genannt) tätig wird. Dieses Doppelte Mandat der Sozialarbeit führt daher zu einem doppelten Zustand ihrer Zielpersonen, gleichzeitig aktiv („kundig“) wie auch passiv („schutzbefohlen“) zu sein. Um die Vereinseitigung dieses dialektischen Zustandes durch die Nutzung eines der beiden Begriffe zu verhindern, hat sich mancherorts4 in der Sozialarbeit daher mittlerweile der Begriff „user“ für die Zielpersonen Sozialer Arbeit herausgebildet. Begünstigte von Dienstleistungen Sozialer Arbeit, insbesondere, wenn diese öffentlich (mit-) finanziert werden, sind neben ihrem KundInnenstatus immer auch BürgerInnen, die soziale Staatsbürgerrechte in Anspruch nehmen, auch wenn auf Grund ihrer prekären Lebensverhältnisse ihre staatsbürgerlichen Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten5 oft zur Gänze oder zumindest teilweise suspendiert sind. Diese Doppelgesichtigkeit von Sozialarbeit und ihres Verhältnisses zu ihren Zielgruppenpersonen, die sowohl KundInnen wie auch KlientInnen sind, verhindert aber die einfache Unterwerfung von Sozialarbeit als sozialer Dienstleistung unter die marktliche Ökonomisierung. Sie ist vielmehr immer gleichzeitig prinzipiell marktfähige Dienstleistung und gesellschaftspolitisch motivierter Akt der Gestaltung sozialer und politischer Wirklichkeit. Es muss daher berücksichtigt werden, dass überall dort, wo (vor allem im Zuge des New Public Management) mit marktlichen Begriffen und Strategien (wie „KundInnen“ oder „KundInnenzufriedenheit“) gearbeitet wird, durchaus der Aspekt sozialer Arbeit als prinzipiell marktfähiger Dienstleistung behandelt wird, gleichzeitig aber der andere Aspekt der Gestaltung sozialer Wirklichkeit dabei aber verloren geht. Mit anderen Worten: Die Verwendung des „KundInnenbegriffs“ in der Sozialarbeit und insbesondere als Instrument der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Angeboten der Sozialarbeit kann partiell Sinn machen – etwa um ein Angebot oder eine Angebotsstruktur zu verbessern – muss aber scheitern, wenn er den Anspruch erhebt, den gesamten Umfang der (hier erbrachten) Sozialarbeit in der Dimension ihres Doppelten Mandates erklären und damit gestalten zu wollen. Zielführende Strategien der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Sozialarbeit, so unsere These, können sich daher auch des KundInnenbegriffes und der damit verbundenen Implikationen (z.B. der Messung von KundInnenzufriedenheit) bedienen, dürfen ihn aber nicht verallgemeinern und müssen darauf Wert legen, dass hiermit nur ein 4 Zum Beispiel in der Sozialarbeit Sloweniens So sind beispielsweise obdachlose StaatsbürgerInnen kraft fehlenden Meldezettels (damit kein Eintrag in die WählerInnenevidenz) faktisch vom staatsbürgerlichen Wahlrecht ausgeschlossen, obwohl ihnen formal ihre staatsbürgerlichen Rechte nicht aberkannt wurden. 5 Leittext März 2006 Seite 15 Teil der Sozialarbeit begriffen wird und deswegen nur ein Teil ihrer Qualität angesprochen werden kann. 2.3.3.4 Anforderungen an professionelle Strategien In Hinblick auf die professionellen Strategien von Sozialarbeit ergeben sich dadurch höchst anspruchsvolle Bedingungen: „In einem großen Teil aller Interaktionen müssen die hier als Produzenten verstandenen Nutzer Sozialer Arbeit erst mithilfe der Tätigkeit der professionellen Ko-Produzenten in die Lage versetzt werden, ihre Nachfrage zu aktualisieren, zu formulieren und schließlich steuernd auf den Dienstleistungsprozess einzuwirken. Auf der anderen Seite muss der professionelle Ko-Produzent das Subjekt als potenziell produktives zum einen theoretisch unterstellen, zum anderen aktiv mitproduzieren, und schließlich seine eigene Tätigkeit der Logik der Selbsterzeugung der Subjekte dienstleistend nachzuordnen“ (Schaarschuch 2003:158). Doch die Begrifflichkeit der KundInnen von Sozialarbeit birgt noch ein anderes Moment. Denn der KundInnenstatus setzt prinzipiell voraus, dass diese durch individuelle Kauf- und Wahlentscheidungen auf der Basis ihrer persönlichen Präferenzen Einfluss auf die Anbieterseite ausüben können, und zwar auf Menge, Qualität und Preis des jeweiligen Angebots. Hier gelten die klassischen Marktgesetze, nach dem Menge und Preis durch ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage erzielt werden und nur durch dieses. Dies setzt jedoch einen Markt von sozialarbeiterischen Angeboten voraus und die Tatsache, dass sozialarbeiterische Angebote (prinzipiell und praktisch) marktfähig sind. Dies ist zwar noch nicht der Fall, aber offensichtlich Zukunftsvision, zumindest wenn es nach der EUKommission geht. Die prinzipielle Unterordnung auch sozialarbeiterische Leistungen unter das Vergaberecht bei der öffentlichen Beauftragung, die Umstellung vom Sachleistungs- auf ein Geldleistungsprinzip (der Förderung von Einrichtungen auf ein Individualförderungsprinzip) und die vorgesehene Dienstleistungsrichtlinie der EUKommission (Bolkesteinrichtlinie) schaffen Voraussetzungen, dass ein Markt sozialarbeiterischer Leistungen entsteht. Die Umstellung der KlientInnen zu KundInnen ist so gesehen nur ein Vorgriff auf diese Entwicklung. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gewinnt unter diesen Rahmenbedingungen eine besondere Bedeutung. Denn die gewünschte hohe Qualität ist – im Gegensatz zur Meinung der neoklassischen Ökonomie – kein automatisches Ergebnis des Wirkens von Marktkräften, insbesondere dann nicht, wenn auf Nachfrageseite ein relativ hoher Bedarf einem relativ knappen Portfolio gegenüber steht. KundInnen haben immer die Option, zwischen hoher Qualität und niedrigem Preis zu wählen. Gesellschaftliche Entwicklungen abseits der „klassischen“ Marktlogik unterstützen diese (mcdonaldisierte; vgl. Ritzer 1997) Orientierung auf das „Große“ und „Billige“ im Gegensatz zum „Guten“ (siehe weiter unten ausführlicher). Auf Grund des Doppelten Mandats der Sozialarbeit beinhalten ihre professionellen Strategien durchaus das Potential der Überwindung dieser einfachen Marktlogik sozialer Dienstleistungen: Durch die Strategie des Empowerments ihrer KlientInnen/KundInnen. „Der Ausgangspunkt dieses Konzepts von Empowerment ist, dass die Machtverhältnisse in den Einrichtungen der Sozialarbeit unhintergehbar sind Gleichwohl müssen die Professionellen Leittext März 2006 Seite 16 ein Interesse an der Veränderung der Macht-Asymmetrien hin zu größerer Symmetrie haben. Die Begründung hierfür ist nicht in einer professionellen Ethik zu finden oder in Forderungen nach Mitmenschlichkeit und Solidarität. Vielmehr muss es den Professionellen aus dem Interesse an einer möglichst hohen ‚Gebrauchswerthaltigkeit’ ihrer Arbeit, d.h. Angemessenheit in Hinblick auf die Befriedigung von Bedürfnissen seiner Nutzer heraus, daran gelegen sein, die Macht-Asymmetrie zu verringern, damit die Nutzer ihren Einfluss auf die Dienstleistungserbringung geltend machen können. Empowerment zielt somit auf die Relativierung – nicht aber die Außerkraftsetzung, die nicht realistisch ist – der MachtAsymmetrie aus dem Interesse der Professionellen an einer hohen Gebrauchswerthaltigkeit, und damit Qualität, seiner Arbeit. Die Begründung erfolgt somit zunächst nicht in politischer oder ethischer Hinsicht.“ (Schaarschuch 2003:162). Im Gegensatz zu einer moralisierenden Argumentation (vgl. z.B. Speck 1999) hilft diese Sichtweise tatsächlich, das marktorientierte System an den Hebeln seiner eigenen Logik so zu gestalten, dass es den Qualitätsansprüchen unter dem Primat des Doppelten Mandats der Sozialarbeit gerecht werden kann. Dazu ist aber die Entwicklung von Empowermentstrategien, die die Gestaltung echter Mitwirkungsrechte der UserInnen beinhalten, in den einzelnen Einrichtungen notwendig. Demokratisierung deckt in diesem Zusammenhang das doppelte Interesse der Sozialarbeit ab, einerseits optimiert Empowerment die Stellung der UserInnen als KundInnen und steigert somit Effizienz und Effektivität sozialer Arbeit, andererseits erfüllt es die grundlegenden (politischen) Ansprüche einer umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft, die auch vor den marginalisierten StaatsbürgerInnen (und Fremden) nicht halt macht. 2.3.3.5 KundInnenzufriedenheit – Möglichkeiten und Grenzen einer Strategie des Qualitätsmanagements Grundsätzlich haben all diese „KundInnen“ Erwartungen an die Dienstleistung und möchten diese erfüllt wissen. Diese Erwartungen können stark widersprüchlich sein. Es liegt an den DienstleistungsanbieterInnen den verschiedenen Ansprüchen nachzukommen (Doppeltes Mandat – Hilfe Kontrolle). Es liegt auch an den DienstleistungsanbieterInnen die Entscheidung zu treffen, ob und wenn wie sie „KundInnenbindung“ erzeugen wollen/können. „KundInnenbindung“ würde heißen: Die Erwartungen der/des „KundIn“ konnte erfüllt – ja sogar übertroffen – werden und daher verspricht sich der Installateur-, Friseur-, Autowerkstätten-, Restaurantbetrieb (etc.), dass genau diese/r Kunde/in wieder kommen wird, um die Dienstleistung erneut in Anspruch zu nehmen und sie auch weiter zu empfehlen. Was macht nun aber das Besondere bei sozialen Dienstleistungen aus? Um einen Eindruck zu bekommen, wie unterschiedlich die „Blickwinkel“ auf eine pädagogische Einrichtung und die damit zusammenhängenden Erwartungen aussehen können, folgende Abbildung: Qualität aus unterschiedlichen Perspektiven Leittext März 2006 Seite 17 Abb. 1: Die pädagogische Qualität einer Einrichtung der Elementarerziehung6 Diese Perspektiven wären sogar noch zu erweitern, da in der obigen Grafik die Sicht des Trägers auf die Einrichtung fehlt. Trägerorganisationen (z.B.: Caritas) stellen eigene „Anforderungen“ an die Einrichtung bzw. hat die Ideologie des Trägers Einfluss auf die Einrichtung. Ein Vorschlag wäre hier in das „Dach“ der Darstellung die OBEN-INNENPERSPEKTIVE einzufügen, in der die „Träger-MitarbeiterInnen-Beziehung“ aber auch die „Träger-Einrichtungs-Perspektive“ erfasst werden kann. Möglichkeiten und Grenzen Sich mit den Erwartungen der UserInnen/KlientInnen auseinander zu setzen, ermöglicht den Einrichtungen der Sozialarbeit den Blickwinkel zu schärfen, indem die vorher definierten „KundInnengruppen“ nach ihren Erwartungen befragt werden. Es entsteht dabei ein eigenes Bild über die Erwartungen an die jeweilige Dienstleistung und somit können diese besser erfüllt werden (Qualität als „Erfüllung von Erwartungen“). Im Bereich der sozialen Dienstleistungen stellt sich grundsätzlich die Frage, ob an einer Bindung der UserInnen/KlientInnen an eine Einrichtung gearbeitet werden soll. Für soziale Dienstleistungen, die auch Beziehungsdienstleistungen genannt werden, ist vor allem der Aufbau einer Beziehung wichtig, die dann als Grundlage der Arbeit gilt. Besonders wichtig ist das im niederschwelligen Bereich der Sozialarbeit (Streetwork, Wärmestuben etc.). Die Arbeitsbeziehungen haben das EMPOWERMENT der KlientInnen zum Ziel, also „Hilfe zur Selbsthilfe“. Es ist meist sinnvoller, Handlungsanleitungen zu geben und die Selbstbefähigung zu fördern. Aufgaben sollen daher so wenig wie möglich für die UserInnen 6 Kron angelehnt an L. Katz, 1996 (Kron 2001:116) Leittext März 2006 Seite 18 erledigt werden, sondern höchstens mit ihnen gemeinsam (z.B.: ausfüllen eines Formulars, Amtswege, Telefonate, Schuldenregulierung etc.). Die KundInnenbindung in der Pflichtklientschaft stellt eine Schwierigkeit dar: Kommen die UserInnen/KlientInnen nicht freiwillig (z.B. in der Bewährungshilfe/ Sachwalterschaft auf richterliche Anordnung), so fehlt ihnen oft die Motivation an diesem Beziehungsaufbau mitzuwirken. Oft wollen die UserInnen zu diesem Zeitpunkt „keine Einmischung von Außen“ und in diesem Zusammenhang stellt sich die Sinnhaftigkeit einer „KundInnen-Zufriedenheits-Befragung“ bzw. muss eine solche speziell gestaltet werden. Eine andere grundsätzliche Frage ist jene nach der Veränderungsbereitschaft: Wann verändert ein Mensch eher etwas an seiner Situation? Wenn er/sie zufrieden ist – oder wenn er/sie unzufrieden ist? Sozialarbeit bezieht sich üblicherweise auf die Unzufriedenheit der UserInnen/Klientinnen und bedarf der Bereitschaft daran etwas ändern zu wollen. Wenn die Veränderungsbereitschaft nicht gegeben ist, sind UserInnen/KlientInnen am meisten zufrieden, wenn sie in Ruhe gelassen und mit ihrer Situation nicht konfrontiert werden (CoProduktion). Ebenfalls zu beachten ist, dass UserInnen ihre Zufriedenheit aus ihrer Perspektive beschreiben. Fallweise treffen SozialarbeiterInnen ihre Entscheidungen auf einer fachlichen Ebene, die für UserInnen schwer verständlich sein kann (z.B.: Maßnahmen, wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist). Unterscheidung Klientel von Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit Der KundInnenbegriff in der Gemeinwesenarbeit ist ein anderer wie in der Einzelfallhilfe. Wie kann hier Zufriedenheit gemessen werden? Beispiel zu KundInnenzufriedenheit Scharitzer/Sinkovics (1997) beschreiben eine Erhebung der KundInnenzufriedenheit bei Krankentransporten beim Roten Kreuz: Das Management ging davon aus, dass KundInnenzufriedenheit als zentraler Faktor der Dienstleistungsqualität gesehen wird. In dieser Erhebung gingen sie der Frage nach, wie diese KundInnenzufriedenheit erhöht werden kann, und weiter: „Über eine derartige Leistungssteigerung verspricht sich das Management der Bezirksstelle Korneuburg eine Erhöhung des strategischen Konkurrenzvorteils, insbesondere gegenüber aufkeimenden Konkurrenzanbietern im Transportdienstleistungsgewerbe.“ (Scharitzer/ Sinkovics 1997:224). Mittels eines standardisierten Fragebogens wurden die PatientInnen auf dem Transportweg zu ihrer Zufriedenheit interviewt. Die Ergebnisse waren dürftig und so wich man auf einen flexibleren Umgang mit dem Erhebungsinstrument (Telefonate zu einem spätern Zeitpunkt, Einbezug der PflegerInnen etc.) aus. So konnten 145 Interviews ausgewertet werden. Das spannende Ergebnis war, dass nur knapp ein Drittel (31%) der Krankentransporte von den PatientInnen bestellt wurde. Dies hatte zur Folge, dass die PatientInnen „(…) im Sinne eines Bindungsversuches von KundInnen an die RK Bezirksstelle (als) zweitrangig“ (Scharitzer/ Sinkovics 1997:240) bezeichnet wurden. Ein weiteres Ergebnis der Erhebung war, dass die Leittext März 2006 Seite 19 MitarbeiterInnen von Krankenhäusern häufig Erstkontakt zwischen PatientInnen und RK herstellen und somit als erstrangige KundInnen gelten können. Die Erhebung der KundInnenzufriedenheit ergab: Die allgemeine Zufriedenheit (94% der Befragten fühlten sich sehr gut bis gut versorgt, 80% sicher transportiert) ist hoch. 2.3.3.6 Fazit für die weitere Arbeit Ein erstes Fazit kann hier gezogen werden: Neu ist weniger die Arbeit am Qualitätsthema als die Form, in der die Qualitätsergebnisse systematisiert und präsentiert werden. Nicht die Anforderungen, Qualität in die Sozialarbeit zu bringen, ist das Neue, mit dem wir konfrontiert werden, sondern die Rahmenbedingungen, unter dem dies zu geschehen hat. Eine zunehmende Ökonomisierung vieler Bereiche des Sozialen, wechselseitig bedingt durch die relative Verknappung öffentlicher und privater Mittel bei steigenden Aufgaben und andererseits der an einem liberalen Markt- und Weltverständnis orientierten öffentlichen Beauftragung durch Vergabe (anstatt der bisher üblichen, oft „freihändig“ vergebenen Förderungen), stellt die Sozialarbeit vor die Herausforderung, die Qualität ihrer Arbeit nach Kosten-Nutzen-Kalkülen skaliert darzustellen, ohne das Spezifische ihrer Qualität als Beziehungsarbeit, deren Erfolg die Mitwirkung der Zielpersonen erfordert, aus dem Auge zu verlieren. Diese neue Herausforderung erfordert die Entwicklung sowohl eines Verständnisses der (letztendlich betriebswirtschaftlich motivierten) Qualitätssicherung und eines Verstehens der Rolle des Sozialen und der sozialarbeiterischen Interventionen in unserer Gesellschaft. Einem theoretischen Verständnis und damit der Möglichkeit, praktische Fragen in diesem Zusammenhang wissensbasiert(er) zu formulieren, dienen die folgenden Ausführungen. Leittext März 2006 Seite 20 3 Geschichte der Qualitätssicherung als Ausdruck von Industrialisierung und Massenfertigung 3.1 Die Entstehung der arbeitsteiligen Notwendigkeiten der Qualitätssicherung Industrie – 3.1.1 Wissenschaftliche Betriebsführung – Taylor und Ford Qualitätssicherung und Qualitätszertifikation ist eine Strategie der großen arbeitsteiligen Industrie, folglich ist ihre Geschichte nicht von der Geschichte der großen Industrie zu trennen. In der Ablösung von manufakterieller Produktion entstand ein neues Zeitalter der industriellen hocharbeitsteiligen Massenfertigung, oft fordistisches Zeitalter (vgl. z.B. Hirsch 1990; Hirsch 2002; Hirsch/Roth 1986; aber auch Lüscher 1985)7 genannt. Diese Entwicklung ist untrennbar mit folgenden zwei Personen verbunden: Frederick Winslow Taylor und Henry Ford (vgl. z.B. Taylor 1919; Ford 1926; Hughes 1991; Flick 2001; Scherrer 1992). Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) war der Begründer der Wissenschaftlichen Betriebsführung (Scientific Management). „Taylors Leitkonzept war es, ein Produktionskonzept zu entwerfen, dass die Arbeitskraft von Menschen und Maschinen umfasste und so leistungsfähig sein sollte wie eine perfekt konstruierte und gut geölte Maschine. Er hat gesagt: ‚Früher stand der Mensch an erster Stelle; in der Zukunft muss das System den Vorrang haben“ (Hughes 1991:194). Kern des Systems war die Einrichtung eigener Büros für die Arbeitsvorbereitung, die Festlegung von konkreten Arbeitsaufträgen und Arbeitstakten, bei denen nicht nur die Tätigkeit, sondern auch die dafür vorgesehene Zeit festgelegt waren, die Kontrolle der Arbeitsleistung durch die Stoppuhr und die Einführung des leistungsbezogenen Verdienstes (Akkordlohn). Ziel war die Nutzung aller Effizienzspielräume für die (industrielle) Produktion. Später wurde dieses System, rasch Taylorismus genannt, auch auf Verwaltungstätigkeiten und – in Grenzen – auf den Dienstleistungsbereich (z.B. in der Systemgastronomie, vgl. Ritzer, 1997) ausgedehnt. Mit diesem System nahm Taylor den Arbeitenden die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten und Werkzeuge nach eigenem Gutdünken einzusetzen, langsames Arbeiten wurde durch Lohnabzug bestraft, immer schnelleres Arbeiten durch das Hinaufsetzen der Akkordeinheiten erzwungen. Der Kern der „wissenschaftlichen Betriebsführung“ war ein umfassendes Zeitmanagement auf jedem Arbeitsplatz, es wurde von den Beschäftigten und Gewerkschaften unterlaufen (z.B. durch langsameres Arbeiten vor der Stoppuhr, um niedrigere Akkordsätze zu erzwingen) und durch gewerkschaftliche Aktionen bekämpft. Henry Ford (1863 – 1947) gilt als der Begründer der industriellen Massenfertigung, des Fließbandes und eines gehobenen Masseneinkommens zur Stabilisierung der Nachfrage. 7 Der Begriff des „Fordismus“ ist bereits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts geprägt worden und zwar unabhängig voneinander von „links“ (Antonio Gramsci in den Quaderni del Carcere) und von „rechts“ (Friedrich von Gottl-Ottilienfeld im Buch „Rationalisierung“ 1927) (vgl. Lüscher 1985:29). Politikwirksam ist er erst in den siebziger und achtziger Jahren geworden. Leittext März 2006 Seite 21 Der nach ihm benannter „Fordismus“ lässt sich durch „vier Merkmale charakterisieren, die zunächst für seinen eigenen Anwendungsbereich, die Produktionsorganisation in Riesenbetrieben, im weiteren aber auch für gesamtgesellschaftlich ablaufende Prozesse gelten: (I) fortschreitende ingenieur- und sozialwissenschaftliche Feingliederung menschlicher Tätigkeiten; (II) Kontinuierung aller produktiven und reproduktiven Abläufe; (III) Rückkoppelung von (Massen-) Güterproduktion und (Massen-) Güterkonsum; (IV) Steuerung dieser Rückkoppelung über die eine Stellgröße Lohn“ (Lüscher 1985:29). Ford hatte also Taylors Ideen weiterentwickelt und sie durch die Einführung der Massenfließfertigung standardisierter Produkte quasi auf seinen Höhepunkt gebracht, er hatte ihn aber durch die Berücksichtigung der Beschäftigten nicht nur als ProduzentInnen, sondern auch als KonsumentInnen in einer wesentlichen Dimension überwunden – in jener wirtschafts- und sozialpolitischen Dimension, die einige Jahre später durch J.M. Keynes in die Volkswirtschaft eingeführt wurde: die Verbindung von Massenproduktion und Massenkaufkraft als Motor für betriebliche und wirtschaftliche Entwicklung (vgl. z.B. Blanchard/Illing 2004; Hallwirth 1998; Rothschild 2004; Senf 2004). Die durch die „wissenschaftliche Betriebsführung“ unterstützte industrielle Massenfertigung zwängte die Produktion und die produzierenden Menschen in ein enges Korsett entfremdeter, monotoner Tätigkeit, die einerseits immenses Rationalisierungspotential freilegte, andererseits Normung der Einzelteile und Sicherung von Qualität notwendig machte. Von der Doppelgesichtigkeit der „Förderung“ von Menschen als KonsumentInnen einerseits und der Zerlegung der Arbeitstakte und der damit einhergehenden Reduktion menschlichen Produzententums auf einzelne (körperliche) Funktionen kann das folgende, etwas längere Zitat aus der Biografie Henry Fords deutlich machen: „Im allgemeinen besteht die etwas großzügige Ansicht, alle zu körperlicher Arbeit Unfähige der Gesellschaft zur Last zu legen und durch öffentliche Wohltätigkeit zu ernähren. Es gibt allerdings Fälle, wie z.B. bei Idioten, in denen die öffentliche Wohltätigkeit meines Wissens nach nicht zu umgehen ist; das sind jedoch Ausnahmen und es sind uns bei der Mannigfaltigkeit der Verrichtungen, die es in unserem Unternehmen zu tun gibt, gelungen, fast jeden durch eine nutzbringende Tätigkeit eine Existenz zu schaffen. Der Blinde oder Krüppel kann, wenn man ihn an den richtigen Platz stellt, genau das Gleiche leisten und den gleichen Lohn erhalten, wie der völlig gesunde Mensch. Wir geben den Krüppeln zwar nicht den Vorzug, aber wir haben gezeigt, dass sie sich den vollen Lohn verdienen können. Es würde allen unseren Versuchen direkt zuwiderlaufen, wollten wir Leute um ihrer Gebrechen willen anstellen, ihnen einen geringeren Lohn geben und uns mit einer geringeren Produktion begnügen. (…) Man neigt nur allzu sehr zu der Meinung, dass Vollbesitz der Kräfte Grundbedingung zur Höchstleistung bei jeder Art von Tätigkeit ist. Um die tatsächlichen Verhältnisse genau zu bestimmen, ließ ich die verschiedenen Verrichtungen in Bezug auf die erforderliche Arbeitsleistung bis ins einzelne klassifizieren – ob die körperliche Arbeit leicht, mittelmäßig oder schwer sei, ob nass oder trocken, und wenn nass, mit welcher Art von Flüssigkeit verknüpft; ob sauber oder schmutzig, in der Nähe eines Ofens Hochofens, in guter oder schlechter Luft; ob zweihändig oder einhändig; stehend oder sitzend, lärmend oder leise; bei natürlichem oder künstlichem Licht; ob sie Ansprüche an Genauigkeit stellte, die Stundenzahl der zu behandelnden Teile, das Gewicht des gehandhabten Materials, die dafür Leittext März 2006 Seite 22 erforderlichen Anstrengungen seitens des Arbeiters. Es stellte sich heraus, dass es zurzeit 7882 verschiedene Arten von Verrichtungen in der Fabrik gab. Von diesen waren 949 als Schwerarbeit bezeichnet, die absolut gesunden, kräftigen Männer erforderte; 3338 erforderte Männer von normal entwickelter Körperkraft. Die übrigen 3595 Verrichtungen erforderten keinerlei körperliche Anstrengung, sie hätten von den schmächtigsten, schwächsten Männern, ja mit gleichem Erfolg auch von Frauen oder älteren Kindern geleistet werden können. Diese leichten Arbeiten wurden wieder unter sich klassifiziert, um feststellen zu können, welche den vollen Gebrauch der Glieder und Sinne beanspruchten, und wir stellten fest, dass 670 Arbeiten sich von Beinlosen, 2637 von Einbeinigen, 2 von Armlosen, 715 von Einarmigen, 10 von Blinden verrichten ließen. Von 7882 verschiedenen Tätigkeiten erforderten 4034 wohl eine gewisse, doch nicht die volle Körperkraft. Folglich ist die voll entwickelte Industrie imstande, vollbezahlte Arbeit für eine größere Anzahl tauglicher Arbeiter zu liefern, als im Durchschnitt einer menschlichen Gesellschaft zu finden sind. Die Analyse der Tätigkeiten in einem anderen Industriezweig oder Betrieb als dem unsrigen mag zwar ein ganz anderes Verhältnis ergeben, trotzdem bin ich überzeugt, dass es, wenn die Arbeit nur genügend eingeteilt ist – und zwar bis zum höchsten Grad der Volkswirtschaftlichkeit – keinen Mangel an Arbeitsgelegenheit für die physisch Benachteiligten gibt, die ihnen gegen volle Arbeitsleistung auch einen vollen Arbeitslohn abwirft. Volkswirtschaftlich bedeutet es den höchsten Grad von Verschwendung, die körperlich Minderwertigen der Allgemeinheit zur Last zu legen, sie nebensächliche Arbeiten wie Korbflechterei oder irgendeine andere unrentable handarbeit lernen zu lassen, nicht um ihnen dadurch den Lebensunterhalt zu verschaffen, sondern lediglich, um sie vor Trübsinn zu bewahren“ (Ford 1926:124ff). Vor allem im Deutschen Reich wurden bereits in der Zwischenkriegszeit die wissenschaftliche Betriebsführung und die Fordsche Fließfertigung relativ rasch institutionalisiert. Mit der Einführung des Fließbandes entstanden auch hier im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts weit reichende Veränderungen der betrieblichen Arbeitsorganisation. Die damit einhergehenden organisatorischen Veränderungen standen im Deutschen Reich unter dem Titel „Rationalisierung“, anders als in den USA hatte der Staat einen hohen Anteil an der Vereinheitlichung, Normierung und Qualitätssicherung. Im Zeitraum weniger Jahre entstanden im Deutschen Reich 600 private Vereinigungen, 85 staatliche Einrichtungen und 67 staatliche Prüf- und Forschungsstellen, die sich der „Rationalisierung“, vor allem also der Normung, widmeten (vgl. Hinrichs/Peter 1976:29). Wie in den USA war die Folge der wissenschaftlichen Theorien und Methoden der Betriebsführung, der Fließbandfertigung und der Normung eine Freisetzung eines unheimlichen Rationalisierungspotenzials – mit negativen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Bereits 1917 entstand aus Normierungstätigkeiten der Deutschen Industrie und militärischer Dienststellen der „Normierungsausschuss der Deutschen Industrie“, aus dem 1926 der „Deutsche Normungsausschuss“ (DNA) hervorging (vgl. Hinrichs/Peter 1976:52). Mit der hier in den folgenden Jahren geschaffenen „Deutschen Industrienorm“ (DIN) wurde eine weit über die deutsche Reichsgrenze wirkende Normung und Vereinheitlichung industrieller Produktion Leittext März 2006 Seite 23 geschaffen. Die DIN-Normung dehnte sich auf nahezu alle Bereiche technischer Fertigung im weitesten Sinne (von industriellen Bauteilen bis zum Schreibmaschinenpapier8) aus und schuf eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung technischer Qualitätssicherungssysteme. Diese, dem Geist der „Rationalisierung“ verpflichtete Philosophie fand ihre Fortführung und Weiterentwicklung in der Umstellung der deutschen Industrieproduktion auf kriegswirtschaftliche Ziele nach 1933. Aber auch nach dem zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Wiederaufbaues und des „Wirtschaftswunders“ wurde diese Strategie der „Rationalisierung“ durch „wissenschaftliche Betriebsführung“, Fließfertigung und Massenproduktion sowie Normierung und Qualitätssicherung weitergeführt, im Zuge der Europäischen Integration wurden die Strategien der Normierung und ihrer Qualitätssicherung in den sechziger und siebziger Jahren zunehmend europäisiert. Höhepunkt dieser europäischen Normierung“ sind die zahlreichen Normierungsmaßnahmen am Verordnungswege durch die Europäische Kommission im Zuge der Umsetzung der Maastricht-Verträge („Vier Freiheiten“), denn ein gemeinsamer Europäischer Markt erfordert in großem Maße vereinheitlicht genormte Produkte. Anschließend an Taylor und Ford entwickelte sich in den USA eine umfassende Diskussion um Qualitätssicherung (vgl. Zollondz 2002:70ff). Walter A. Shewhard (1881 – 1967) steht mit seiner Control Chart für Prozessoptimierung der Qualitätskontrolle und einer Reduktion des Prüfpersonals. Mittlerweile ist die Qualitätsregelkarte zu einem Standardelement des modernen Qualitätsmanagements geworden und kann sowohl als internes Instrument der Qualitätspolitik einer Organisation als auch ein Führungsinstrument sein (Zollondz 2002:73). Mit Walter E. Deming (1900 – 1993) wurden in den 30er Jahren in den USA die Verfahren der Qualitätskontrolle auf Bereiche außerhalb der Produktion übertragen, zum Beispiel in die Landwirtschaft. Nach dem zweiten Weltkrieg trug Deming einen wesentlichen Beitrag zur Vermittlung des US-amerikanischen Qualitätsmanagements in die japanische Wirtschaft bei. Deming brachte den KundInnenbezug in das Qualitätsmanagement ein und trug somit wesentlich zur Überwindung des tayloristischen Produktionssystems bei. Josef Moses Juran, in der k.u.k.-Monarchie (1904) geboren und nach den USA ausgewandert, übersiedelte in den 50er Jahren nach Japan, wo er mit seiner, ebenfalls stark auf die Bedürfnisse der KundInnen gerichtete Orientierung des Qualitätsmanagements die Grundlagen für die Entwicklung der TQM-Philosophie entwickelte. „Während vorher in Japan Qualität mehr direkt auf den Produktionsprozess bezogen wurde, also technisch orientiert war, vermochte Juran das Qualitätsmanagement als Managementphilosophie – bezogen auf den Kunden – zu definieren. Alle Prozesse wurden unter Einbeziehung der Mitarbeiter u.a. realisiert“ (Zollondz 2002:85f). Jurans Leitsatz war: „Qualität lässt sich nicht delegieren.“ (Zollondz 2002:85). Als weiterer Mitbegründer des TQM-Systems ist Armand Vallin Feigenbaum (geb. 1920) zu nennen, der mit seinem Total Quality Control (TQC) System in den USA einen Meilenstein der Entwicklung des Qualitätsmanagements gesetzt hat. Es sind drei wesentliche Prinzipien zu nennen: 8 Auch die uns gebräuchlichen Papierformate wie z.B. DIN A4 gehen auf diese Industrienormierung zurück. Leittext März 2006 Seite 24 Qualität wird durch die Erwartung des Verbrauchers wesentlich bestimmt Jede/r MitarbeiterIn ist wesentlich für Qualität mitverantwortlich und zwar von der Basis bis zum obersten Management Qualität wird von allen Funktionen gemacht (nach Zollondz 2002:100) Aus diesen Prinzipien leitet Feigenbaum fünf Qualitätsgrundsätze ab: „Qualität ist keine technische Funktion, sondern ein systematischer, kundenorientierter Prozess, der im ganzen Unternehmen – unter Einbeziehung der Unterlieferanten – total und rigoros umgesetzt werden muss; Qualität ist das, was der Kunde darunter versteht – und nicht das, was ein Ingenieur oder Händler darunter versteht –, und es ist ein ständig größer werdender Anspruch; Qualität und Kosten sind eine Summe, keine Differenz – Partner, nicht Gegner –, und der beste Weg, um Produkte und angebotene Dienstleistungen schneller und billiger zu produzieren, ist, sie besser zu machen; Es muss bedacht werden, dass sich für Qualität – eigentlich die Aufgabe von jedem im Unternehmen – niemand zuständig fühlt, wenn nicht dieser Prozess zur Unternehmensqualität korrekt strukturiert wird, damit sowohl die Qualitätsarbeit des einzelnen als auch die Qualitätsteamarbeit zwischen den Abteilungen Unterstützung findet. Qualität muss organisiert werden; Dies alles geschieht, wenn das Unternehmen ein klares, kundenorientiertes TQCSystem in der gesamten Organisation eingeführt hat, mit effektiv strukturierten qualitätsbezogenen Prozessen, die die Mitarbeiter verstehen, von denen sie überzeugt sind und an denen sie teilhaben.“ (Zollondz 2002: 101f, Hervorhebung vom Autor) Als eigentlicher Vater des TQM muss Phillip B. Crosby (1926 – 2001) genannt werden. Er gilt weltweit als der bekannteste der neueren QualitätsmanagerInnen. Die Grundsätze seines Qualitätsprogramms fasste er in vier Punkten („The Absolutes of Quality Management“) zusammen: „(1) Quality has to be defined as conformance to requirements, not as goodness or elegance; (2) The system for causing quality is prevention, not appraisal; (3) The performance standard must be Zero Defects, not ‘that’s close enough’; (4) The measurement of quality is the Price of Nonconformance, not indices” (Zollondz 2002:127, Hervorhebungen beim Autor). Qualitätsmanagement ist seiner Meinung nach als eine Denkweise zu begreifen, nach der Führungskräfte ihre Aufgabe weniger in der Lösung technischer Probleme sehen sollen, sondern sich mit der Einführung von Vorbeugungsmaßnahmen zu befassen haben. Wesentlich ist ein Zusammenwirken von KundInnen, LieferantInnen, Management und MitarbeiterInnen in gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Anerkennung. Leittext März 2006 Seite 25 3.1.2 Postfordismus und die Qualitätsdiskussion In Europa9 hat der Höhepunkt der Vereinheitlichung und Normierung des Systems von Taylor und Ford in der Zwischenkriegszeit gleichzeitig das Ende der am Fließbandprinzip beruhenden Massenfertigung begleitet. Mit dem Ende des „Fordistischen Zeitalters“ ging das Ende der klassischen industriellen Produktionsweise einher. Die Ersetzung der Fließbänder durch Industrieroboter bei gleichzeitiger Verteuerung der Lagerhaltung und damit des „Produzierens auf Halde“ durch Absatzrückgänge nach dem „ersten Erdölschock“ 1975 und der Verteuerung gebundenen Kapitals durch die Hochzinspolitik ab 1981 ermöglichten neue Produktionsweisen und machten sie auch erforderlich. Gleichzeitig dehnten sich „industrielle“ Fertigungsmethoden (Normierung, Systematisierung, Arbeitsteiligkeit) mit dem Siegeszug der elektronischen Informationsverarbeitung in weite Bereiche des Dienstleistungssektors aus (vgl. z.B. Öst. Akademie der Wissenschaften 1981; Briefs, 1984; Brödner 1986; Fleissner 1987; Bischof/Detje 1989; Hirsch 2002). Diese neuen, „postfordistischen“ Entwicklungen machten einerseits Normierungen und damit technisch orientierte Qualitätssicherung auch im Dienstleistungsbereich möglich, andererseits erforderten sie deutliche Strategieänderungen in der industriellen Fertigung. Qualitätsmanagement wurde zu einer umfassenden Strategie für Produktion und Dienstleistung. Zollondz (2002:131) bezeichnet den Kreis um die Deutsche Zeitschrift „QZ – Qualität und Zuverlässigkeit“ zumindest in Deutschland als gegenwärtigen Kern der scientific community des Qualitätsmanagements. „Als Experten des Qualitätsmanagements (Qualitätsexperten) werden diejenigen Fachleute und -wissenschafter bezeichnet, die in den Mittelpunkt ihres beruflichen Lebens die Befassung mit dem Thema Qualität gestellt haben und nachvollziehbar entsprechend gewirkt haben. Wesentliches Kriterium der Einordnung war die augenscheinliche Einschätzung in der Fachliteratur“ (Zollondz 2002:131, Hervorhebung durch den Autor). 3.1.3 Zusammenfassend Die Qualitätssicherung ist ein „Kind“ der Industriellen Revolution und der Massenproduktion mittels Fließband und unmittelbar mit der Entwicklung von Vereinheitlichung und Normung verbunden. Mit dem Ende des „Fordistischen Zeitalters“ verschiebt sich der Schwerpunkt der Qualitätssicherung und bezieht zunehmend auch Dienstleistungen mit ein. Von einer rein technisch (auf das „Zusammenpassen der Dinge“) orientierten Strategie wird Qualitätssicherung zunehmend (auch) zu einer Strategie der verbesserten Positionierung auf Absatzmärkten, zu einem Wettbewerbsinstrument. Bevor wir uns aber dem Qualitätsmanagement und seiner Entwicklung widmen, ist es wichtig, in einem „Seitenschritt“ die Veränderungen, die das Qualitätsverständnis auf Absatzmärkten der Massenproduktion und -Dienstleistungen durch ein Phänomen vorgenommen hat, das wir – angelehnt an Ritzer (1993) – „McDonaldisierung“ bezeichnen wollen. 9 Und zwar sowohl in der EU als auch im EWR. Leittext März 2006 Seite 26 3.1.4 „Qualität“ in einer mcdonaldisierten Welt McDonalds`s, die weltweit expandierende Fast-food-Restaurantkette, kann als exemplarisch für die Produktions- und Wirtschaftsform, als Ausdruck einer Lebenshaltung gelten. Motor hinter der vom amerikanischen Soziologen Georg Ritzer bezeichneter „McDonaldisierung“ ist die Rationalisierung. McDonaldisierung ist nach den Feststellungen von Ritzer „ein zentraler Trend der modernen Wohlstandsgesellschaft mit zum Teil irrationalen Konsequenzen, etwa der, dass der Kunde, ohne es zu merken, einen Teil der früher von anderen geleisteten Arbeit selbst übernimmt.“ (Ritzer 1993, Deckblatt) Für den Erfolg von McDonald`s sind im Allgemeinen vier grundlegende Elemente verantwortlich, die so genannten vier Elemente der McDonaldisierung: Effizienz, Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit, Kontrolle (Ritzer 1993:27-30). McDonald`s bietet Effizienz. Das heißt, dass McDonald`s-System die optimale Methode hat, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen (Ritzer 1993:27). In diesem Falle bedeutet es vom Zustand des Hungers zum Zustand der Sättigung zu gelangen. Ähnliches Vorgehen ist auch in anderen Bereichen zu finden. In einer schnell lebenden Gesellschaft ist es notwendig, dass Hunger bzw. viele andere Bedürfnisse schnell (effizient) gestillt bzw. erfüllt werden. McDonald`s bietet Essen und Service, die sich leicht quantifizieren und berechnen lassen (Ritzer 1993:28). Den Menschen wird ein Gefühl vermittelt, dass sie beim McDonald`s für ihr Geld mehr Essen bekommen. Dazu tragen die Bezeichnungen wie „Big Mac“ oder „Große Pommes Frites“ bei. Quantität wird mit Qualität gleichgesetzt: „Viel“ muss auch „gut“ bedeuten. Berechnet wird auch die Zeit, mit der man rechnen muss, bis man zum Essen kommt. Viele Menschen betrachten das Essen beim McDonald`s (und hier auch die Variante McDrive) zeitgünstiger als Zubereitung eines eigenen Essens zu Hause. McDonald`s bietet Vorhersehbarkeit (Ritzer 1993:29). In allen Filialen (auf der ganzen Welt) bekommt man dasselbe Angebot, dieselben Produkte, die auf dieselbe Weise zubereitet wurden und die gleich schmecken. Man muss also mit keinen unerwarteten und unangenehmen Überraschungen rechnen. McDonald´s bietet bzw. übt über die Menschen Kontrolle aus. Menschliche Arbeitskraft wird durch nicht menschliche Technologie ersetzt. In Fast-food-Restaurants wird begrenzte Zahl von Tätigkeiten in genau vorgeschriebener Weise ausgeführt. Dies gilt sowohl für Angestellte (kontrolliert z.B. auch durch den Einsatz von Maschinen) als auch für KundInnen (auch wenn indirekt). „Begrenzte Speisekarte, wenig Auswahlmöglichkeiten und unbequeme Stühle veranlassen den Kunden genau das zu tun, was die Firma wünscht: schnell zu essen und dann wieder zu gehen“ (Ritzer 1993:30). Schon vor der Gründung von McDonald`s gab es eine Reihe von Entwicklungen, die die Entstehung sowie das weitere Vorgehen beeinflussten. Von allen so genannten Vorläufern sollten zumindest Max Weber und seine Theorien über den Begriff der Bürokratie und Henry Ford und sein Fließband kurz vorgestellt werden (der Beitrag von F. W. Taylor, der ebenfalls zu den Vorläufern zählen würde und seiner wissenschaftlichen Betriebsführung wurde bereits weiter oben ausgeführt, vgl. Kap. 3.1.1). Leittext März 2006 Seite 27 Der deutsche Soziologe Max Weber (1864 – 1920) definierte Rationalität mit ganz ähnlichen Begriffen, wie sie für die Beschreibung der Fast-food-Restaurants verwendet werden. Das heutige Phänomen der „McDonaldisierung“ ist eigentlich eine Erweiterung von Webers Theorie der Rationalisierung. Für ihn war die Bürokratie das Musterbeispiel für die formale Rationalisierung, deren vier Grundelemente er dort verwirklicht sah: Bürokratie ist die effizienteste Struktur zur Handhabung einer großen Zahl von Aufgaben, die viel Papierkrieg erfordern. Kein anderes System kann so eine gewaltige Arbeitsmenge so effizient bewältigen wie die Bürokratie. Wegen ihrer eingefahrenen Regeln und Bestimmungen arbeitet Bürokratie mit einem hohen Maß an Vorhersehbarkeit (die Beamten wissen mit großer Sicherheit, wann, was, von wem, wie etc). Eine Bürokratie versucht, so viele Dinge wie möglich zu quantifizieren (Berechenbarkeit). Die Leistungen werden auf eine Reihe quantitativ erfassbarer Aufgaben reduziert. Nicht zuletzt spielt auch in der Bürokratie die Kontrolle eine wichtige Rolle. Kontrolle der Beschäftigten, die sich an bestimmte Regeln, Vorschriften und Strukturen halten müssen, sowie „Kontrolle“ der KundInnen, die ihre Dienstleistungen auf bestimmte, von der Organisation festgelegte, Weise erhalten. Bürokratie ist nach Weber ein entmenschlichender Ort, ob man dort arbeitet oder die jeweiligen Dienstleistungen in Anspruch nimmt (Ritzer 1993:45-47). Neben den genannten Prinzipien der Bürokratie und der wissenschaftlichen Betriebsführung trug auch das Fließband zur Entstehung der McDonaldisierung bei. Allgemein wird seine Erfindung Henry Ford (vgl. Kap. 3.1.1) zugeschrieben. Das Fließband war ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Rationalisierung der Produktion (in diesem Fall Autoproduktion), auch hier sind die vier Grundelemente der formalen Rationalität deutlich zu sehen. Viele hoch spezialisierte, ungelernte Arbeiter an ein laufendes Förderband zu stellen ist weitaus effizienter, als wenn mehrere gelernte Handwerker in einem Raum ein Auto zusammenbauen. Die Tätigkeit jedes einzelnen Arbeiters am Band ist höchst vorhersagbar und alle Endprodukte sind identisch. Das Fließband erlaubt die Quantifizierung vieler Elemente und ermöglicht die Herstellung der größtmöglichen Zahl von Autos. Auch die Kontrolle wird ausgeübt: die erwarteten Arbeiten müssen in dem Augenblick getan werden, wo sie notwendig sind (Ritzer 1993:53). Das Fließband kann zwar als entmenschlichendes Arbeitsumfeld bezeichnet werden. Die Menschen müssen nur eine begrenzte Zahl einfacher Tätigkeiten immer wieder ausführen, sie haben keine Möglichkeit, ihre menschlichen Fähigkeiten und Begabungen zu verwirklichen (Ritzer 1993:54). Das Ziel wurde aber damals (nach seiner Erfindung) erreicht: die Produktivität nahm zu, die Kosten sanken und der Umsatz und die Gewinne verbesserten sich. Das Fließband verbreitete sich, nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Japaner die amerikanische Fließbandtechnik, passten sie ihren Bedingungen an und ergänzten sie. Als ein Beispiel für alle kann hier vor allem das japanische System des „gerade rechtzeitig“ genannt werden (Ritzer 1993:105). Hier geht es darum, dass kein Material gelagert wird wie es im amerikanischen System der Fall war, sondern dass es genau dann zur Verfügung gestellt wird, wann es gebraucht wird (Senkung der Lagerungskosten u. ä., vgl. Kap. 4.6.3). Leittext März 2006 Seite 28 Die Elemente der McDonaldisierung bzw. der formalen Rationalisierung sind aber nicht nur im technischen und produktiven Bereich zu sehen. Hier das Bildungswesen (und die Elemente Effizienz und Quantifizierung), um nur ein Beispiel aus den anderen Bereichen zu zeigen. Ein Ausdruck des Strebens nach mehr Effizienz im Ausbildungssystem ist die Form der Überprüfung der Kenntnisse. Hier können beispielsweise die Multiple-Choice-Tests genannt werden. Von individuellen mündlichen Prüfungen aller Studierenden gelangten die ProfessorInnen zu Tests, die vom Computer nicht nur gestaltet (Zusammenstellung der Fragen), sondern auch ausgewertet werden können (Ritzer 1993:99). Quantitativ erfassbare Größen spielen im Bildungssystem ebenfalls eine Rolle. Im gesamten Ausbildungssystem geht es vorwiegend um Noten und Notendurchschnitte, der Qualität des Erlernten und der erzieherischen Erfahrung schenkt man dagegen weit weniger Aufmerksamkeit (Ritzer 1993:127). Alle Erfahrungen von Schulen lassen sich in einer einzigen Zahl zusammenfassen. Die entscheidet über die Aufnahme in die nächste Schulstufe, an die Universität, in die Arbeit. Diese Quantifizierung ist heutzutage in den meisten Bereichen zu finden: akademischer Bereich (Zahl der Publizierungen), Gesundheitswesen (Zahl der Behandlungen), Sport (Leistungen werden mit Punkten beurteilt) etc. Auch hier wird der Qualität der Leistungen wesentlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt (wenn überhaupt). Leittext März 2006 Seite 29 4 Die Entwicklung des Qualitätsmanagements Ursprünglich war das Qualitätsmanagement produkt- und prozessbezogen; es galt in einer arbeitsteiligen, auf Massenfertigung orientierten Welt abzusichern, dass Vorprodukte in immer gleicher Qualität geliefert und den Ansprüchen der Weiterverwendung passend gemacht werden. Ausgangspunkt war die – schon in der Zwischenkriegszeit entwickelten (vgl. z.B. Hinrichs/Peter 1976) – Industrienormen, zum Beispiel die Deutsche Industrienorm DIN und ihre verschiedenen Abwandlungen. Zentrale Erkenntnis dieser Qualitätsentwicklung war, „dass Qualität nicht in Produkte ‚hineinkontrolliert’ werden kann, sondern ‚hineinkonstruiert’ und ‚hineinproduziert’ werden muss“ (Brauner/Kühme 1997:4). Die Philosophie der ersten großen Qualitätsmanagementstrategie (ISO 9000) und die von ihr abgeleiteten Konzepte waren daher auch eine Philosophie der geregelten und dokumentierten Absicherung und Zertifizierung von bestimmten Qualitätsmanagementstrategien eines Betriebes. Nicht das Produkt wird also genau genommen qualitätsgesichert, sondern seine Erstellung. Von uns wird ISO daher als „Ingenieurmodell“ bezeichnet. Ein ISO-Zertifikat setzt VertragspartnerInnen und KundInnen in Kenntnis, dass in diesem Betrieb mit qualitätsgesicherten Produktions- und Dienstleistungsstrukturen gearbeitet wird, zu erwarten ist daher ein Produkt bzw. eine Dienstleistung von immer gleich bleibender Qualität, das/die zu fixen Terminen verlässlich erbracht wird – in einem immer stärker werdenden Wettbewerb um Technik, Preis, Leistung, Qualität und Termintreue ein wichtiger Marktvorteil. Im Gegensatz zu ISO-Strategien, bei denen die Prozessdokumentation im Zentrum steht, stellen TQM-Strategien die KundInnen und ihre Zufriedenheit in den Mittelpunkt ihrer Qualitätsbemühungen. Qualität ist demnach „das Übereinstimmen mit (oder Übertreffen von) kundenseitig gesetzten Erwartungen. Diese Erwartungen des Kunden beziehen sich auf gewünschte Leistungscharakteristika sowie auf Fehlerfreiheit in der Zeit der Nutzung, die Zuverlässigkeit“ (Patzak/Rattay 1998:23). Die Zufriedenheit der KundInnen wird daher in TQM-Strategien regelmäßig erfasst und ausgewertet – problematisch für eine unreflektierte Übernahme in Organisationen des Dritten Sektors, wo es ja nicht immer klar ist, wer denn hier die KundInnen sind (die GeldgeberInnen, die KlientInnen, die anderen sozialen Organisationen, die Gesellschaft...?). Ausgehend vom TQM-Grundmodell hat die EFQM, eine europäische Stiftung namhafter Industrieunternehmen, in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission, in den 90er Jahren das Modell weiter in Richtung Europäisches Referenzmodell (EFQM) der Qualitätssicherung entwickelt. Dieses Modell baut auf dem Zusammenwirken von neun Kriterien auf, welche in Befähiger und Ergebnisse unterteilt werden. Es ist ein Top-down-Modell in dem Sinne, dass es davon ausgeht, der Ausgangspunkt für alle QM-Aktivitäten sei eine nachhaltige und überzeugende Führung der obersten Leitung. Über eine TQM-orientierte Politik und Strategie sowie die Einbeziehung aller MitarbeiterInnen, PartnerInnen und Ressourcen wirkt die Unternehmensführung bis in die Gestaltung der Prozesse. Dieses Zusammenspiel der hier Leittext März 2006 Seite 30 „Befähiger“ Genannten wird dann am Markt in Ergebnisse umgesetzt. Das Modell macht deutlich, dass der langfristige Geschäftserfolg entscheidend von der Zufriedenheit der KundInnen und der MitarbeiterInnen sowie der Anerkennung des Unternehmens in seinem Umfeld bezogen auf seine gesellschaftliche Verantwortung abhängt (vgl. Radtke/Wilmes 2002:17f). Man kann daher Patzak und Rattay folgend ein Phasenmodell der Entwicklung der Bedeutung von Qualität und ihrer Sicherung in Unternehmen erstellen (vgl. Patzak/Rattay 1998:26). Vernetzter, informations- und umweltorientierter Markt Dienstleistungsmarkt - serviceorientiert Verdrängungsmarkt Verbrauchermarkt Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage Erste einfache Qualitätsanforderungen Wettbewerb unter den Lieferanten, statistische Verfahren, systematische Gestaltung des Produktionsprozesses, zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme Produktqualität wird selbstverständlich, komplexeres Produktverständnis (Wareninformation, Service, Verhalten) Kundenorientierung, zertifizierte QM-Systeme, TQM als Managementansatz Vernetzung KundInnen – Lieferantinnen nimmt zu Gemeinsame Problemlösungen Servicequalität wird wichtiger, Umwelt und Gesellschaft wird durch bessere Information bedeutend. TQM mit gezieltem Umwelt- und Informationsmanagement Total Quality Management ISO 9000 Qualitätssicherung Qualitätskontroll e PHASE I PHASE II PHASE III PHASE IV PHASE V 1960 1970 1980 1990 2000 Abb. 2: Die Entwicklung der Bedeutung von Qualität Für die Entwicklung des Verständnisses von Qualitätsmanagement ist es notwendig, einige zentrale Begriffe im Qualitätswesen zu definieren (wir folgen hier Patzak/Rattay 1998:24ff). Qualitätskriterien sind jene Merkmale eines Objektsystems (konkret oder abstrakt), für die von den Bezugspersonen Zielwerte angegeben oder emotional erwartet werden. Leittext März 2006 Seite 31 KundIn ist in diesem strukturellen Blick jede Einheit stromabwärts vom betrachteten Prozess, jede nächstfolgende organisatorische Stelle. Als KundIn ist somit der/die EndnutzerIn sowie jede/r im Prozess Tätige (interne KundInnen) anzusehen. Qualitätsmanagement: Alle Tätigkeiten der Gesamtführungsaufgabe, welche die Qualitätspolitik, Ziele und Verantwortungen festlegen sowie diese durch Mittel wie Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems verwirklichen. Qualitätssicherung: Sämtliche geplanten und systematischen Tätigkeiten, die innerhalb des Qualitätsmanagementsystems verwirklicht sind und so dargelegt werden, dass Vertrauen dazu entsteht, dass das geschaffene Produkt die Qualitätsanforderungen erfüllen wird. Ein funktionierendes QS-System ist Voraussetzung für das QM. Unter Qualitätsüberwachung („Qualitätskontrolle“) versteht man die ständige Beobachtung und Verifizierung des Zustandes einer Einheit sowie Analysen von Aufzeichnungen, um sicher zu gehen, dass festgelegte Forderungen erfüllt werden. 4.1 Das „Ingenieurmodell“ – ISO Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000ff (Qualitätsnorm) stellt einen wesentlichen Schritt zur Qualitätsorientierung in Unternehmen dar. „Es schafft Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Leistungserstellung durch die Festlegung der Aufbau- und Ablauforganisation (Prozesse) und durch die Systematisierung der Dokumentation. Die Organisation wird dadurch effizienter, da Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter und Führungskräfte festgelegt werden. Mit Hilfe von Schulungen werden die Mitarbeiter über die Norm und über die Qualitätsorientierung informiert. So entsteht ein hohes Bewusstsein für Qualität im Unternehmen. Ein Qualitätsmanagement-System nach ISO 9001 umfasst dabei 20 Elemente. Deren transparente Erfüllung wird durch entsprechende Qualitätsdokumente und durch das entsprechende Handeln aller Mitarbeiter sichergestellt. Die Mitarbeiter und Führungskräfte werden von dafür autorisierten Zertifizierungsstellen auf die Einhaltung der selbst entwickelten Qualitätsdokumente hin überprüft. Bei Erfüllung der entsprechenden Kriterien wird das ISO 9001-Zertifikat ausgestellt. Damit bekundet das zertifizierte Unternehmen den QualitätsmanagementStandard“ (Patzak/Rattay 1998:27). In der Denkstruktur von ISO wird auch Qualität klar definiert und normiert und zwar (im Beispiel der ÖNORM) als „die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“ (ÖNORM EN ISO 8402:12). Ergebnis dieser Zertifizierung ist der durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle ausgestellte Nachweis (ISO-Zertifikat), der belegt, dass die Organisation qualitätsgesicherte Verfahren verwendet. Die Zertifizierung nach ISO erbringt daher lediglich einen Nachweis über die Qualitätsfähigkeit des zertifizierten Unternehmens, nicht aber über konkrete Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Kernstück dabei ist das Qualitätssicherungshandbuch der Organisation, das nach den Grundlagen von ISO erstellt werden muss. Weitere Elemente sind der Qualitätssicherungsplan, das Leittext März 2006 Seite 32 Qualitätssicherungsverfahren, die Qualitätsaufzeichnungen und das Qualitätsaudit (= eine „systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob die qualitätsbezogenen Tätigkeiten und die damit zusammen hängenden Ergebnisse den geplanten Anforderungen entsprechen und ob diese Anforderungen wirkungsvoll verwirklicht und geeignet sind, die Ziele zu erreichen.“ ISO 8492:35) 4.1.1 Beginn von ISO Internationale Standardisierung beginnt in ersten Schritten auf dem Gebiet der Elektrotechnik durch die Gründung der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) im Jahr 1906. Am 23.Februar 1947, nach einer Unterbrechung der Entwicklung internationaler Standardisierung durch den Zweiten Weltkrieg, wird die neue Organisation ISO mit dem Ziel, Industrienormen zu vereinheitlichen und weltweite Koordinierung dieser durchzuführen, gegründet. ISO steht für International Organization for Standardization, gleichzeitig ist „ISO eine Ableitung aus dem griechischen Wort isos und bedeutet soviel wie gleich oder übereinstimmend und steht heute für einheitlich oder standardisiert“ (Majer 1999: 406). Die 96 an ISO teilnehmenden Länder werden durch die jeweiligen nationalen Normungsinstitute (z.B. Deutschland-DIN, Österreich-Österreichisches Normungsinstitut) vertreten, wobei von jedem Land nur eine Körperschaft akzeptiert wird. Gemeinsam mit 500 internationalen Organisationen nehmen sie die diversen Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung von Standardsystemen und Normen wahr (Gumpp/Wallisch 1995:26ff). 4.1.2 Inhalt von ISO Die ISO-9000-Reihe besteht aus folgenden fünf Normen für die vier Hauptbranchen Hardware, Software, verarbeitungstechnische Materialien und Dienstleistungsindustrie: „ISO 9000: Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsnormen – Leitfaden zur Auswahl und Anwendung ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme – Modell zur Qualitätssicherung/ QM-Darlegung in Design, Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung ISO 9002: Qualitätsmanagementsysteme – Modell zur Qualitätssicherung/ QM-Darlegung in Produktion, Montage und Wartung ISO 9003: Qualitätsmanagementsysteme – Modell zur Qualitätssicherung/ QM-Darlegung bei der Endprüfung ISO 9004: Qualitätsmanagement und Elemente eines Qualitätsmanagementsystems – Teil 1: Leitfaden“ (Gumpp/Wallisch 1995:48) Diese Normen wurden mit folgender Absicht und folgendem Ziel entwickelt: Vereinfachung der Darlegung verschiedener, in den industrialisierten Ländern existierender, Qualitätssicherungsnormen und -forderungen und somit die Vereinfachung des nationalen und internationalen Handels Leittext März 2006 Seite 33 Anwendbarkeit der Normen für Vertragsvereinbarungen Vertragsparteien im Hinblick auf Qualitätssicherungsforderungen zwischen zwei (vgl. Gumpp/Wallisch 1995:49) Anwendbar sind die ISO-9000-Normen, die grundsätzlich freiwillig sind, ohne Erklärungsbedarf von der Industrie für die Entwicklung/Fertigung und den Bereich der verfahrenstechnischen Produkte. Für weitere Bereiche wurden zusätzliche Normenteile entwickelt: Dienstleistungssektor (Versicherungen, Banken, Krankenhäuser, Hotels und Restaurants) – ISO 9004-2 (Titel: „Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementelemente – Teil 2: Leitfaden für Dienstleistungen“) zur Klärung von Anwendung und Gebrauch der QM-Darlegungsmodelle ISO 9001 bis ISO 9003 im Dienstleistungsbereich. Softwareindustrie – ISO 9000-3 (Titel: „Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungsnormen – Leitfaden für die Anwendung von ISO 9001 auf die Entwicklung, Lieferung und Wartung von Software“) Industriezweig der verfahrenstechnischen Produkte – ISO 9004-3 „Qualitätssicherungssystem – Leitfaden für verfahrenstechnische Produkte“) (Titel: Kritik an ISO wird in Bezug auf verschiedene Bereiche geübt. So dient schon das Ziel von Qualitätsmanagementsystemen als Kritikpunkt. „Die ISO-9000-Normen wurden im Sinne von Zielsetzungen verfasst, die durch ein Qualitätsmanagementsystem in einer Organisation oder einem Unternehmen erreicht werden sollen. Die Normen beschreiben nicht, wie diese Ziele erreicht werden, sie überlassen diese Aufgabe den jeweiligen Organisationen oder Unternehmen. Anders ausgedrückt: Der Weg zum Ziel wird nicht vorgeschrieben“ (Gumpp/Wallisch 1995:51). Anders formuliert bedeutet dies, dass nur das Endergebnis bewertet, zertifiziert wird und die Mittel und Wege, die zu diesem Ergebnis geführt haben, völlig ohne Bedeutung sind. Damit könnten wenig qualitative genauso wie qualitative Bemühungen zu demselben Ergebnis führen. Des Weiteren wird im Zusammenhang mit der Überprüfung durch das Auditorenteam der zu zertifizierenden Firma geschrieben Folgendes angemerkt: „Die Auditierung [Überprüfung der qualitätssichernden Elemente durch ein Team; Anmerkung der Verfasserin] bietet die Chance, eine Momentaufnahme der Qualitätsfähigkeit einer Organisation zu bekommen.“ (Knorr/Halfar 2000:111) Somit wird über eine Zertifizierung durch ISO ein Moment, ein statischer Zustand bewertet, ohne darauf folgende, und auch zuvor liegende Zustände, beziehungsweise Entwicklungen zwischen diesen mit einzubeziehen. Dieselben Autoren formulieren weiters kritisch: „QM-Systeme, die in umfangreichen QMHandbüchern dokumentiert werden, lassen die Frage aufkommen, ob die intendierten Absichten eines Qualitätsmanagements tatsächlich auch erreicht werden. Der Verdacht liegt nahe, dass Auditoren ein Unternehmen vornehmlich nach der ´Papierform´ beurteilen, d.h. nach Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgelegten Dokumente zum QM-System. Leittext März 2006 Seite 34 Präventives Qualitätsmanagement oder Qualitätsverbesserung lebt aber von Mitgestaltung und Innovationsfähigkeit aller Mitarbeiter […]“ (Knorr/Halfar 2000:112). der Zusammenfassend muss über die Eignung und Reichweite von ISO festgehalten werden: ISO ist eine Strategie der Zertifizierung als Dokumentation von Qualitätssicherungsmaßnahmen, ISO zertifiziert daher nicht die Qualität der geleisteten Arbeit, sondern nur die regelgerechte Dokumentation der Qualitätssicherung. Matul und Scharitzer (1997:406) formulieren eine – insbesondere aus der Sicht der konkurrierenden TQM-Strategie gewonnene – Kritik an der ISO-Strategie: „Sie ist zu statisch und auf die Ist-Situation bezogen Es fehlt der proaktive Gedanke, die Motivation zur kontinuierlichen Verbesserung Qualitäten der Führung (z.B. Führungsverhalten, Politik und Strategie) und Miteinbeziehung der Mitarbeiter kommen nicht oder kaum zum Ausdruck Es fehlen betriebswirtschaftliche Erfolgskriterien Geschäftsergebnisse wie Profitabilität) Nicht zuletzt gibt es immer wieder Verständigungsprobleme, vor allem bei der Anwendung der ISO 9000 bei Dienstleistungsunternehmen, da die Normenfamilie ihre Herkunft nicht verleugnen kann und eher ‚industrielastig’ entwickelt wurde.“ (Umsatz, Marktanteile oder 4.1.3 Beispiele der Anwendung aus der Literatur zum Sozialbereich Stiftung Attl – Deutschland (vgl. Baur/Herrmann 2004:169ff): In der Stiftung Attl wird seit einiger Zeit die ISO-Norm 9001:2000 verwendet, welche sich aus Sicht der AutorInnen für die Qualitätssicherung bewährt. Allgemeiner Sozialdienst Offenbach - Deutschland (vgl. Christa 2000:174ff): Ein weiteres Beispiel, die öffentliche Verwaltung (Magistrat der Stadtverwaltung), die als erste deutsche Kommunalverwaltung im Jahre 1998 eine erfolgreiche Zertifizierung abgeschlossen hat. 4.2 Das „Dienstleistungsmodell“ – Total Quality Management und seine Ableitungen „Das Konzept des TQM ist ein Ansatz zur Hebung des Qualitätsbewusstseins in einem systemorientierten, das ganze Unternehmen umfassenden Sinn. Allen Einzelmethoden und Einzelgesichtspunkten der Qualitätssicherung ist darin ihr jeweiliger Platz zugeordnet. TQM ist jedoch mehr, es ist eine Unternehmensphilosophie bzw. Unternehmenskultur (Total Quality Culture). Totales Qualitätsmanagement ist eine auf der Mitwirkung aller Mitglieder beruhende Führungsmethode einer Organisation, die Qualität in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenstellung der Kunden auf langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitglieder der Organisation und der Gesellschaft abzielt“ (Patzak/Rattay 1998:27). Bei TQM geht es nicht um die Vorgabe operativer Qualitätsmaßstäbe, sondern um eine Führungsphilosophie, die Qualitätspolitik und damit ein kundInnenorientiertes unternehmensweit-ganzheitliches Qualitätsverständnis in den Mittelpunkt stellt und damit Leittext März 2006 Seite 35 langfristig intern und extern positive Wirkungen auf den Organisationserfolg haben soll. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen für sich den Qualitätsbegriff operationalisieren und damit für die jeweiligen Zwecke anwendbar machen muss. Diese Qualitätsmanagementstrategie ist sowohl für Produktions- als auch für Dienstleistungsorganisationen anwendbar und besteht vor allem aus folgenden Kriterien: Qualität orientiert sich an den KundInnen. Qualität wird mit MitarbeiterInnen aller Bereiche und Ebenen erzielt. Qualität umfasst mehrere Dimensionen, die durch Kriterien operationalisiert werden müssen. Qualität ist kein Ziel, sondern ein Prozess, der nie zu Ende ist. Qualität bezieht sich nicht nur auf Produkte, sondern auch auf Dienstleistungen. Qualität setzt aktives Handeln voraus und muss erarbeitet werden. (vgl. Matul/Scharitzer 1997:391f) Betrachtet man die oben genannten Kriterien, so lässt sich feststellen, dass das TQM Konzept über die Ziele des klassischen Qualitätsmanagements, wie zum Beispiel die Senkung der Fehlerquote im Fertigungsprozess, hinausgeht, auch wenn im TQM nach Frehr (1994:32) keine „revolutionären oder bisher gänzlich unbekannten Elemente enthalten sind.“ Frehr stellt fest, dass selbst unter Fachleuten die Unterschiede zwischen Begriffen, wie Total Quality Management (TQM), Total Quality Control (TQC), Company-wide Quality Control (CWQC), Company-wide Quality Improvement (CWQI) etc. umstritten sind. Er schlägt vor nur den Ausdruck des Total Quality Managaments zu verwenden, da dieser die unverzichtbare Führungsrolle des Managements anspricht, ohne die eine erfolgsversprechende Verbesserung der Qualität eines Unternehmens nicht möglich ist (Frehr 1994:31 in Masing). Seghezzi (2003:254) weist auf die Wichtigkeit der „weichen“ Faktoren Kultur, Stil, gemeinsame Werte und Qualitätsbewusstsein für die MitarbeiterInnen hin, stellt aber auch fest, dass diese für den Erfolg des Konzepts nicht ausreichen. „Der motivierte und qualifizierte Mitarbeiter muss auch gut strukturierte, funktionierende Prozesse und Abläufe vorfinden, die von der Struktur und den Systemen des Unternehmens getragen werden, die auf einer klaren und Politik und Strategie basieren und für welche genügend Ressourcen vorhanden sind.“ Frehr (1994:35) stellt ein TQM-Gebäude (siehe Abb. 3) dar, das auf vier Elementen aufbaut: Managementverpflichtung und Vorbildfunktion Qualitätssicherungssystem Qualitätswerkzeuge TQM Bausteine Er meint, dass erst das richtige Zusammenwirken aller vier Elemente in allen Teilen des Unternehmens ein wirkungsvolles TQM ergibt. Leittext März 2006 Seite 36 Management-Verpflichtung Mittel und Kapazitäten Qualitätspolitik Aus- und Weiterbildung Vorbild FMEA…Fehlermöglichkeiten- und Einflussanalyse SPC…Statistische Prozessregelung Reviews Qualitätsverbesserungs- Teams QM-System TQM Serie ISO 9000 Kundenforderungen Bausteine Zertifizierung QM-Werkzeuge FMEA SPC Taguchi Fehlleistungskosten Abb. 3: Das TQM „Gebäude“10 Als wesentliche Bausteine des TQM nennt Frehr: Führen mit Zielen Kundenorientierung des gesamten Unternehmens Interne und externe Kunden-Lieferantenbeziehungen Null-Fehlerprogramme Arbeit in Prozessen Kontinuierliche Verbesserungen mit Messgrößen (Kaizen) Einbeziehung aller Mitarbeiter Kontinuierliche Schulung und Weiterbildung Regelmäßige Managementaudits Der Effekt liegt nun in der systematischen, miteinander verknüpften und auf das Ziel der unternehmensweiten Qualitätsverbesserung gerichteten Anwendung dieser Methoden (Frehr 1994:37). Wie aus dieser Abbildung ersichtlich, machen TQM-Konzepte „vom Gedankengut der einseitig orientierten Konzepte der Qualitätssicherung und Qualitätslenkung und den Systemen nach ISO 9001 vollen Gebrauch. Dieser umfassende Charakter von TQMKonzepten wurde verschiedentlich nicht verstanden. Vielmehr wurde in der Vergangenheit 10 nach Frehr (In Masing 1994:36) Leittext März 2006 Seite 37 oftmals von einem Gegensatz zwischen ISO 9001 und TQM gesprochen. Dass kein Gegensatz besteht, sondern die nach ISO 9001 aufgebauten Systeme Teil eines TQMKonzeptes sein können, beweisen die Erfahrungen und Vorgehensweisen zahlreicher Firmen, auch in Europa.“ Seghezzi (2003:252) hält aber auch fest, dass Total Quality Management über den Aufgabenbereich der Bewirtschaftung der Qualität, wie er beispielsweise durch ISO 9001 vorgegebnen wird, deutlich hinausgeht. Befürworter des TQM begrüßen den Einfluss einer von Humanfaktoren geprägten verhaltensorienterten Denkweise in diesem Konzept, im Gegensatz zu einer „vornehmlich an tayloristischen Elementen der arbeitsteiligen Gestaltung des Leistungsprozesses ausgerichteten Dimension des Qualitätsmanagements“, z.B.: Zertifizierung (Lechner/Egger/Schauer 2003:410). 4.2.1 Beispiel zu einem Verfahren aus der Literatur zum Sozialbereich „Wege zur Qualität“ (vgl. Herrmannstorfer 2004:217ff): Dieses Verfahren wurde in der Schweiz entwickelt und wird vor allem im deutschsprachigen Raum in anthroposophischen Einrichtungen eingesetzt. Qualitäts-Check (PQ-Sys plus) – Deutschland (vgl. Wanke 2003:131ff): Dieses Instrument wurde von der Paritätischen Qualitätsgesellschaft mbH in Zusammenarbeit mit einer Unternehmensberatungs-Firma entwickelt, hat zum Ziel kleinere und mittlere Organisationen und orientiert sich am TQM-Ansatz (EFQM). 4.3 Die Europäische Antwort: EFQM Anfang der 90er Jahre kam das Wissen um die Erfolge der Anwendung von amerikanischen Qualitätsmanagementsystemen (wie z.B. Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA) schließlich auch nach Europa, wo daraufhin beschlossen wurde, eine ähnliche Institution mit dem „European Quality Award“ (EQA) zu schaffen. Das führte 1988 zur Gründung der EFQM, der European Foundation for Quality Management, in der sich eine Reihe unterschiedlicher Unternehmen zusammenfanden und den European Quality Award ins Leben riefen (Kirstein, 2000)11. Diese europäische Stiftung stellt sich die Aufgabe, das Management europäischer Unternehmen bei der Beschleunigung und Steigerung des Prozesses zu unterstützen, durch den Qualität zu einer entscheidenden Einflussgröße für das Erreichen eines weltweiten Wettbewerbsvorteils wird. Des Weiteren verfolgt sie das Ziel, alle Bereiche der Europäischen Gemeinschaft dazu zu ermuntern und dabei zu unterstützen, an QualitätsverbesserungsMaßnahmen mitzuwirken und eine qualitätsbezogene Organisationskultur zu fördern. Zur Erreichung dieser Zielsetzung vergibt die EFQM jährlich Europäische Qualitätspreise (EQA)12. Beim EQA handelt es sich um eine Qualitätsauszeichnung, deren Grundlage das 11 Kirstein, Henning: http://www.deming.de/efqm/modellgrund-1.html am 09.09.2005 Der EQA folgt der Tradition des japanischen und amerikanischen Qualitätspreises (Deming Application Price, Malcom Baldridge National Quality Award-MBNQA) 12 Leittext März 2006 Seite 38 EFQM Modell bildet (siehe auch http://www.efqm.org/). Dieses Modell kann einerseits als Messkonzept zur Auswahl von Unternehmen, die sich um den Europäischen Qualitätspreis bewerben, dienen, andererseits kann es völlig unabhängig von Fragen des Qualitätswettbewerbs zur Erfassung und Weiterentwicklung der Qualität von Unternehmen und damit des Unternehmens insgesamt verwendet werden (Selbstbewertung) (Eckardstein/Simsa 2000). Das EFQM-Modell erfährt eine ständige Verbesserung, ist nie statisch, sondern wird dem Wandel der Umgebung angepasst. Das Grundmodell ist jedoch seit seiner Gründung unverändert geblieben. Es basiert auf den drei fundamentalen Säulen von TQM – nämlich die gleichzeitige Betrachtung von Menschen, Prozessen und Ergebnissen (Kirstein, 2000). In der Praxis heißt es dann: KundInnenorientierung MitarbeiterInnenorientierung Ergebnisorientierung Durch eine anhaltende Einbindung aller MitarbeiterInnen und die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse sollen bessere Ergebnisse erreicht werden. Das führt zu dem Gesamtaufbau des Modells mit seinen neun Kriterien, die den Komplettumfang des Modells ergeben. Führung, MitarbeiterInnenorientierung, Politik & Strategie und Ressourcen liefern den strukturellen und humanen Input, der über Prozesse transformiert wird, um so zu einem Ergebnis zu kommen, bei dem wesentliche Stakeholder einbezogen sind, hier in Form von MitarbeiterInnenzufriedenheit, KundInnenzufriedenheit, Gesellschaftlicher Verantwortung/ Image und Geschäftsergebnissen gewichtet. Innovation und Lernen sind als Systembegriffe auf alle Kategorien des Modells anzuwenden, damit steht die Organisation in einem ständigen Innovations- und Lernprozess, der als kontinuierlicher Verbesserungsprozess zu bewerten ist (Zollondz 2003:284). Das ursprüngliche EFQM-Modell mit der Unterbezeichnung Modell für Business Excellence wurde 1999 mit dem Erscheinen des neuen EFQM-Modells, mit der Bezeichnung EFQM Excellence Modell, zurückgezogen. Die Grundstruktur (Hauptkategorien und Prozentzahlen) des ersten EFQM-Modells ist auch in dieser neuen Fassung unverändert geblieben. Hinzugekommen sind die neuen Kategorien Innovation und Lernen, die im Regelkreiszusammenhang mit Befähiger und Ergebnisse zu sehen sind. Die Kategorie Ressourcen wurde um den Begriff Partnerschaft erweitert (siehe folgende Abbildung). Leittext März 2006 Seite 39 Befähiger (enablers) 50% Ergebnisse (results) 50% Mitarbeiter Mitarbeiterbezogene Ergebnisse 9% 9% Führung Politik und Strategie Prozesse 10% 8% 14% Kundenbezogene Ergebnisse 20% Wichtige Ergebnisse der Organisation 15% Partnerschaften & Ressourcen 9% Gesellschaftsbe zogene Ergebnisse 6% Innovation und Lernen Abb. 4: EFQM-Excellence-Model13 Eine genauere Beschreibung des Modells inkl. Unterkriterien ist bei Zollondz 2003:285ff zu finden. Kritik an diesem Modell betrifft die „im vorhinein festgeschriebene und auch theoretisch nicht weiter begründete Gewichtverteilung zwischen den beiden Qualitätsdimensionen Ergebnisse und Befähiger (…). Nicht näher erläuterte Plausibilitätserwägungen bzw. Konventionen haben zu dieser Gewichtung geführt, sodass sie letztlich als willkürlich zu bezeichnen ist“ (Eckardstein/Simsa 2000). Problematisch scheint jedoch die Wechselwirkung von EFQM (insbesondere seinem 4. Kriterium – Vernetzung) und dem Vergaberecht zu sein, sieht doch das 4. Kriterium von EFQM die Vernetzung der „SpielerInnen“ am Markt als eines der neun Qualitätskriterien vor, während das Vergaberecht davon ausgeht, dass Anbieter an jenem Markt, auf dem die Öffentliche Hand Nachfragerin ist, voneinander unabhängig agieren sollen und „BieterInnenabsprachen“ verboten sind und sogar unter Strafandrohung stehen. Ohne dass es derzeit noch ausjudizierte Beispiele gibt, besteht nun der Verdacht, dass qualitätssichernde Netzwerke von Organisationen, die sich um öffentliche Aufträge bemühen, von diesen als „verbotene BieterInnenabsprache“ qualifiziert werden und – zumindest – aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden könnten. Damit würde jedoch die qualitätssichernde Strategie der Vernetzung von Drittsektororganisationen diese 13 nach Zollondz 2002:382 Leittext März 2006 Seite 40 aus dem Vergabeverfahren ausschließen, was jene marktorientierten Organisationen, die im selben Marktsegment tätig sind, sich aber an keinen (qualitätsschaffenden) Netzwerken des Dritten Sektors (der Sozialwirtschaft) beteiligen, automatisch im Vergabewettbewerb begünstigen würde. Wir meinen, dieser Frage ist auch im Zuge der Qualitätssicherung nach EFQM zukünftig höheres Augenmerk zu schenken. 4.3.1 Beispiel aus dem Sozialbereich IQMP-Reha – Deutschland (Hansmeier/Spyra/Müller-Fahrnow 2004:240ff): Dieses Modell basiert auf dem EFQM-Modell und beschäftigt sich mit der Qualitätssicherung im Gesundheitsbereich (Reha). 4.4 AFQM – das österreichische Modell Eine spezifische österreichische Anpassung der Europäischen Qualitätssicherungsstrategie EFQM ist die von der Frey-Akademie Österreich in Dornbirn (siehe www.freyakademie.ch) entwickelte nationale Version AFQM und ihre entsprechenden Branchenversionen. „1998 haben deshalb sieben österreichische EZA-Organisationen14 – darunter die drei Vorläuferorganisationen und weitere drei Trägerorganisationen von HORIZONT3000 – damit begonnen, ein gemeinsames EZA-taugliches Instrument zu entwickeln. Mit Hilfe der Frey Akademie in Dornbirn wurde ein auf das Europäische Qualitätsmodell EFQM aufbauendes Verfahren (QAP) in den Organisationen erprobt und auf ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst. Im Oktober 2000 haben die Mitglieder der Entwicklungsgruppe eine Branchenversion des EFQM-Modells für Organisationen der EZA vorgelegt und eine Vereinbarung über deren Anwendung und Weitergabe unterzeichnet. Den beteiligten Organisationen steht damit erstmals ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse angepasstes, aber dennoch umfassendes und international anerkanntes Werkzeug zur Verfügung. Richtig eingesetzt stellt es sicher, dass die Qualität ihrer Arbeit systematisch und regelmäßig belegt und permanent nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht wird. Eine Lizenzvereinbarung mit der Frey-Akademie erlaubt es den Mitgliedern der Entwicklungsgruppe, das Modell auch an andere EZA-Organisationen im deutschen Sprachraum weiterzugeben. Obwohl dies für die bisher beteiligten Organisationen nicht im Vordergrund steht, macht das Modell auch den Vergleich untereinander (Benchmarking) und die Erlangung eines Zertifikats von der European Foundation for Quality Management (EFQM) in Brüssel möglich.“ (http://www.horizont3000.at/s_efqm_txt.html#link1, Zugriff Jänner 2006) 4.5 European Quality Award – ein Resumee Unter dem Sammelnamen EQA werden die eben dargestellten Europäischen Qualitätssicherungsmodelle (EFQM, AFQM…) geführt. Wie das AFQM eine österreichische Spezialität darstellt, wurde das Europäische Qualitätssicherungsmodell auch in anderen 14 Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit Leittext März 2006 Seite 41 Staaten weiter entwickelt. Adaptionen bestehen für verschiedene Bereiche und Branchen (siehe z.B. www.freyakademie.ch, für Branchenversionen v.a.: www.horizont3000.at ). Nunmehr ist es möglich, im Vergleich der ISO-Schule und der EQA-Schule zwei unterschiedliche Qualitätssicherungsstrategien zu vergleichen. 4.5.1 Vergleich der ISO 9000 und EQA15 Es ist grundsätzlich nicht ganz möglich, einen 1:1 – Vergleich der beiden Systeme herzustellen, d.h. das Vorhandensein einzelner Elemente und Kriterien in dem einen oder anderen Modell zu ermitteln und zu bewerten. Der grundsätzliche Ansatz zur Vorgehensweise ist zu verschieden: Bemühen um umfangreiche Beschreibung eines Systems in Form einer Norm auf der einen Seite und Beschreibung eines Denkansatzes und einer Verhaltensweise im Unternehmen unterstützt durch geeignete Methoden auf der anderen Seite. Dennoch kann man versuchen, wenigstens prinzipiell, beide Modelle miteinander zu vergleichen. Am höchsten ist der Grad der Übereinstimmung auf dem Gebiet der Prozesse. Prozesse spielen in beiden Modellen eine große Rolle und es ist anerkannt, dass Prozesse definiert und beschrieben sein müssen. Das Hauptgewicht wird jedoch unterschiedlich gelegt. Bei ISO 9000 ist es möglich, mit einer guten Prozessbeschreibung ein Zertifikat zu erhalten, ein wesentliches Element – nämlich die Ergebnisse – werden jedoch in die Bewertung nicht einbezogen. Dies ist anders bei European Quality Award (EQA), der die Bewertung von Prozessen nur dann als erfolgreich ansieht, wenn sie durch entsprechende Ergebnisse belegt sind. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den Betrachtungsweisen von ISO 9000 und TQM liegt in der Definition der Prozesse. Obwohl Prozesse einen umfangreichen Anteil am Gesamtumfang der Norm ISO 9000 ff ausmachen, werden im Wesentlichen operative Prozesse beschrieben. Operative Prozesse sind der Grundbaustein aller Arbeitsabläufe. Aber auch sie werden durch übergeordnete Prozesse, die mit Geschäftsprozessen bezeichnet werden, gesteuert, so dass operative Prozesse weitgehend von der Gestaltung der Geschäftsprozesse abhängig sind. Ebenfalls das Vorgehen der Bewertung bei beiden Ansätzen ist verschieden. Während es – wie oben schon angeführt – für die ISO 9000 ausreichend ist, Prozesse zu dokumentieren und deren Funktion nachzuweisen, sind die Anforderungen an das Prozessdenken nach dem EQA völlig anders geartet. Neben den Prozessen, die auch hier selbstverständlich zugrunde liegen, wird vielmehr danach gefragt, wie Prozesse systematisch ermittelt werden, wie diese Systematik aufgebaut ist, wie Prozesse verbessert werden, welche Kriterien dabei angesetzt werden. Während im ersten Fall also das Vorhandensein von Prozessen („was?“) erfragt wird, wird beim EQA zusätzlich nach der Vorgehensweise („wie?“) gefragt. Die Diskussion, welcher Ansatz für ein Unternehmen am günstigsten ist, wird auf vielen Ebenen geführt. Bei beiden können Argumente dafür oder dagegen angeführt werden. Es stellt sich also heraus, dass nicht ein „Entweder/Oder“, sondern ein „Sowohl/Als auch“ 15 Zusammengestellt nach Gerd F. Kamiske (http://www.deming.de/iso9000/iso_tqm.html am 09.09.2005) Leittext März 2006 Seite 42 sinnvoll ist. Unternehmen, die noch kein ausgeprägtes Qualitätsmanagementsystem besitzen, finden in der ISO-Norm eine gute Anleitung. In den Normen werden wesentliche Aspekte eines Managements beschrieben, sie müssen jedoch durch ergänzende Methodik und Vorgehensweise praktisch umgesetzt werden können. Deshalb wird ein ganzheitliches Modell gefordert: Um zu Marktführerschaft unter heutigen Weltmarktbedingungen zu gelangen, sind beide Bestandteile erforderlich und müssen miteinander kombiniert werden: die Wirkung methodischer Ausrichtung wird entscheidend verstärkt durch die Kombination mit der entsprechenden Grundphilosophie. Sie bietet erfolgreiche Strategien auf der Grundlage des Umfassenden Qualitätsmanagements zur Erzielung exzellenter Geschäftsergebnisse. Das Modell EFQM bietet dabei einen praktikablen Rahmen, der einerseits eine gute Methodik in der Anwendung der Norm ISO 9000 beinhaltet, auf der anderen Seite auf einem gesund fundierten Denkansatz im Sinne eines umfassenden Qualitätsmanagement ausgerichtet ist. 4.6 Die „anderen“ Modelle der Qualitätssicherung 4.6.1 Balanced Scorecard Das Managementkonzept „Balanced Scorecard“ stellt sich als ein sehr umfassendes Konzept dar. Entwickelt wurde sie, die Balanced Scorecard (als Folge einer 1989/1990 durchgeführten Studie) von zweien der MitarbeiterInnen der Studie, David P. Norton und Robert S. Kaplan. Die Balanced Scorecard sollte, im Gegensatz zu vorhergehenden Konzepten des Performance Managements, nicht nur monetäre Größen der Vergangenheit betrachten, sondern „ein ganzheitliches Modell, das strategische und operative Anforderungen durch eine ausgewogene Berücksichtigung von finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen integriert“ sein (Schedl 2002:15). Die wichtigsten Merkmale der Balanced Scorecard, die ein Kommunikations-, Informations-, und Lernsystem darstellt, sind: Betrachtung des Unternehmens aus den vier Perspektiven (finanzwirtschaftliche Perspektive, KundInnenperspektive, interne Prozessperspektive, Lern- und Entwicklungsperspektive) „Eine Balanced Scorecard stellt ein System voneinander unabhängiger Zielsetzungen, Messgrößen, Zielwerte und Aktionen dar, die aus der Strategie abgeleitet werden. In ihrer Gesamtheit beschreiben sie die Unternehmensstrategie und die zu ihrer Erreichung notwendigen Maßnahmen. Die Balanced Scorecard ist somit als Instrument zur Theorieimplementierung zu verstehen“ (Horstmann 1999 in: Schedl 2002:15f) Bei der Entwicklung einer Balanced Scorecard ist auf eine Mischung aus Spät- und Frühindikatoren zu achten, wobei Spätindikatoren zumeist die traditionellen Kennzahlen wie Rentabilität, Marktanteil, KundInnenzufriedenheit oder MitarbeiterInnenqualifikation sind, während unter Frühindindikatoren besondere Elemente der spezifischen Leittext März 2006 Seite 43 Unternehmensstrategie verstanden werden. Auch der Unterschied zwischen strategischen und diagnostischen Kennzahlen verdient besondere Aufmerksamkeit. Diagnostische Kennzahlen überwachen hierbei, ob das Unternehmen unter Kontrolle ist und signalisieren das Eintreten ungewöhnlicher Ereignisse, wohingegen „strategische Kennzahlen eine Strategie definieren, die auf exzellente Wettbewerbsfähigkeit abzielt“ und daher vor allem verwendet werden sollten (vgl. Schedl 2002:6). 4.6.1.1 Die Perspektiven Finanzielle Perspektive Festlegung finanzieller Zielgrößen; Definition anhand welcher Kennzahlen finanzielle Situationen gemessen und überwacht werden sollen; KundInnenperspektive Definition von bei den KundInnen zu erreichenden Zielen, damit sich finanzieller Erfolg einstellt und die Strategie erfolgreich umgesetzt wird. Interne Geschäftsprozesse Beleuchtet den Prozess der Leistungserstellung; Definition von Zielgrößen und Messbarkeit dieser anhand operabler Kennzahlen, die die Qualität des Wertschöpfungsprozesses betreffen und als Voraussetzung für den bei den KundInnen angestrebten Erfolg dienen; Kernfrage: „Durch welche internen Geschäftsprozesse müssen wir uns auszeichnen, um Anteilseigner und Kunden zu befriedigen?“ (Scherer/Alt 2002:14) Lernen und Entwicklung Dynamisiert den Leistungserstellungsprozess; Definition von Zielen und Kennzahlen, die Voraussetzungen markieren, damit die Organisation jede Chance zur Verbesserung (der internen Prozesse) nutzt (vgl. Scherer/alt 2002:14) Vision und Strategie sind zuständig für den Zusammenhang der vier Perspektiven zueinander. Leittext März 2006 Seite 44 Abb. 5: Balanced Scorecard 4.6.1.2 Die Balanced Scorecard im Non-Profit-Bereich Bei der Anwendung der Balanced Scorecard im Non-Profit-Bereich bzw. auch in der öffentlichen Verwaltung bedarf es einer spezifischen Anpassung und Modifikation der vier Perspektiven in Bezug auf die jeweilige Anwendungssituation. Dabei ist vor allem die Veränderung zweier Perspektiven notwendig: Perspektive „Wirtschaftlichkeit und Gesetzmäßigkeit“ statt Finanzperspektive „Hier geht es um die Randbedingungen der Politik, mit denen gleichsam die Restriktionen der öffentlichen Leistungserstellung markiert werden“ (Scherer/Alt 2002:18). Des Weiteren lautet hier die Kernfrage: „Welche wirtschaftlichen und rechtlichen Restriktionen müssen wir einhalten, um unseren gesetzlichen/ politischen Auftrag zu erfüllen?“ (ebenda) Perspektive „Gemeinwohlorientierung/ Bürgerperspektive“ statt Kundenperspektive Hier werden die Leistungen der Verwaltung gegenüber den BürgerInnen aus der Perspektive der LeistungsempfängerInnen definiert. Die Kernfrage lautet: „Welche Ziele müssen wir für/ bei unsere(n) Bürgern erreichen, um unsere politische Vision zu verwirklichen?“ (ebenda) Die Perspektiven „interne Verwaltungsprozesse“ sowie „Lernen und Entwicklung“ müssen wie in der idealtypischen Balanced Scorecard beachtet werden (vgl. Scherer/Alt 2002:18). Leittext März 2006 Seite 45 Bei der Anwendung der Balanced Scorecard ergeben sich folgende Problembereiche: Gegebene Politik wird vorausgesetzt Formelle versus informelle Planung Bevorzugung einer Top-Down-Perspektive Bürokratisierung der Organisation Prüfung der Ziel-Mittel-Ketten Koppelung der Zielgrößen an Anreizsystemen Verknüpfung der Anreizproblematik Quantifizierungsproblem Einführung der Balanced Scorecard stellt kein weiteres Steuerungsinstrument dar, sondern soll einen komplexen Organisationsentwicklungsprozess in Gang setzen (Scherer/Alt 2002:21f) mit einem Operationalisierungs-/ 4.6.2 Benchmarking Das Qualitätsmanagement wird von einer Reihe ergänzender, alternativer und/oder konkurrierender Managementkonzepte begleitet. Eines dieser Konzepte ist das Benchmarking. Das Wort „Benchmark“ geht ursprünglich auf die Marke oder Kerbe in der Werkbank (bench) zurück, die dem Handwerker dazu diente, die Größe eines Werkstücks oder die Länge eines Stück Stoffs zu messen. Nach dem Oxford Advanced Learner’s Dictionary ist Benchmark heute im übertragenen Sinn allgemein „a standard against which other things can be measured, assessed“ (Fromm in: Masing 1994:121). Benchmarking, in der heutigen Form, ist erstmals Ende der 70er Jahre von einem amerikanischen Elektronik-Konzern (Rank Xerox) eingesetzt worden, der aufgrund japanischer Mitbewerber seine Schwächen identifizieren und zu diesem Zweck seine eigenen Wertschöpfungsaktivitäten mit denen seiner Wettbewerber vergleichen wollte. Die Beschreibungen dessen, was Benchmarking heute bedeutet, sind vielfältig. R. Camp (1989) definiert es als die „Suche nach besten Praktiken, die zu überlegener Leistung führen“ (Camp zit. in: Seghezzi 2003:344). David T. Kearns, CEO der Xerox Corporation, versteht darunter „…the continous process of measuring products, services, and practices against the toughest competitors or those companies recognised as industry leaders” (Kearns zit in: Meyer 1996:6). Nach Meyer (1996:7) ist Benchmarking: Die Suche nach „Best Practice“ in der Industrie, wodurch relativ zur Konkurrenz eine überlegene Leistung erzielt werden soll Ein Zielsetzungsprozess Nicht nur die Festsetzung von Zielgrößen (Benchmarks) sondern es zeigt auch den richtigen Weg dorthin (Benchmarking), basierend auf den Erfahrungen anderer, verknüpft mit eigener Kreativität und unternehmensspezifischer Adaption. Leittext März 2006 Seite 46 Beim Benchmarking handelt es sich um einen Lernvorgang, bei dem eine Unternehmung durch die Analyse und den Vergleich mit anderen Firmen jene Praktiken zu verstehen, entwickeln und implementieren versucht, mit denen KundInnenbefriedigung und Geschäftserfolg/Umsatz maximiert werden können. Als Benchmarks werden quantifizierte Leistungsmaße bezeichnet, die sich aus den „Best Practices“ ergeben. Sie werden zum Standard oder zur Referenz, an denen sich das benchmarkende Unternehmen misst. (Seghezzi 2003:344). Man kann grob unterscheiden: Benchmarking von Prozessen – Hier werden Abläufe, Organisationen, Programme und Strategien analysiert und mit den eigenen verglichen. Benchmarking von „Performance“ Parametern – Hier werden Prozesskennzahlen, Performance Measurements als Richtgrößen übernommen. Zum Benchmarking-Prozess gibt es in der Literatur eine Reihe von Vorschlägen, die sich in der Anzahl der Schritte und der Anzahl der Phasen unterscheiden, laut Fromm (Fromm in Masing 1994:122) im Grundgedanken aber übereinstimmen. Seghezzi (2003:345f) gliedert diesen Prozess in zehn Schritte. „Sie bilden die Phasen der Planung, Analyse, der Integration und der Maßnahmen und stellen eine weitere Anwendung des Deming-Kreises mit Planen, Untersuchen, Prüfen und handeln dar“ (vgl. Decker 1997:512f). 1. Benchmarking-Gegenstand identifizieren PLANUNG 2. Benchmarking Partner identifizieren 3. Datenerhebungsmethode festlegen/Daten erheben ANALYSE 4. Aktuelles Defizit bestimmen 5. Künftige Leistung planen INTEGRATION 6. Ergebnisse kommunizieren, Akzeptanz gewinnen 7. Funktionelle Ziele festlegen MASSNAHMEN 8. Maßnahmenplan entwickeln 9. Plan umsetzen und Fortschritte prüfen 10. Benchmarks rekalibrieren Abb. 6: Zehn Schritte des Benchmarking-Prozesses In Abhängigkeit vom Partner, der für den Vergleich gewählt wird, unterscheidet man in (vgl. Seghezzi 2003:346): Internes Benchmarking: Beim internen Benchmarking Unternehmensbereiche oder Tochtergesellschaften verglichen Wettbewerbs-Benchmarking: Hier werden Vergleiche mit direkten Wettbewerbern auf der Basis von Produkten Funktionen oder Prozessen angestellt Leittext März 2006 werden interne Seite 47 Funktionales Benchmarking: Das funktionale Benchmarking vergleicht ähnliche Funktionen oder Prozesse innerhalb der eigenen Branche Generisches Benchmarking: Best-in-class Benchmarking vergleicht ähnliche Funktionen oder Prozesse mit dem Weltbesten, egal, welcher Branche dieser angehört. Zusammenfassend ist Benchmarking ein dynamischer Prozess zur Bewertung gegebener Geschäftsprozesse sowie zur Ableitung von Zielsetzungen zur Prozessverbesserung. Im Sozialbereich ist Benchmarking jedoch nur unter Beachtung des spezifischen Kontextes sinnvoll. Decker (Decker 1997:519) weist in Bezug der Vergleichbarkeit im Sozialbereich auf Folgendes hin: „…die Leistungsprozesse in Sozialbetrieben können oft nicht wie in der freien Wirtschaft nur nach Kosten oder/und Mengen optimiert werden. Die Rentabilität besitzt nicht dieselbe Bedeutung, da eine Mindestversorgung gewährleistet werden muss. Kosten können oft nicht berücksichtigt werden.“ Im Sozialbereich setzt sich in den letzten Jahren Benchmarking zunehmend als Strategie von Fördergebern durch, die daran interessiert sind, durch Vergleich der Leistungen und/oder der Kosten Informationen für die künftige Vertragsgestaltung/Förderung zu bekommen. 4.6.3 Die japanischen Modelle des Qualitätsmanagements Qualitätsmanagement, so wird oft behauptet, sei ein Reimport ursprünglich westlicher Konzepte nach Japan und dann nach einigen Bearbeitungen wieder nach Westen (Zollondz 2002:137). Diese Auffassung ist aber nicht ganz korrekt. Die Japaner haben grundsätzlich nicht alles kritiklos übernommen, sondern die ihnen präsentierten Ideen genommen und auf ihre Verhältnisse angepasst. Als Beispiel kann das Konzept TQM genannt werden, dass aus den USA stammt. „Den Japanern ist diese im Westen weit bekannte Spielart des Qualitätsmanagements unbekannt. Das führende japanische Managementbuch … erwähnt mit keinem Wort den Begriff Total Quality Management oder TQM“ (Yamashiro 1997. In: Zollondz 2002:138). An dieser Stelle sollten in Kürze einige japanische Persönlichkeiten genannt werden, die ihren Beitrag zur Qualitätsdiskussion in Japan geleistet haben. Taichi Ohno (1912 – 1990) ist in die Geschichte des Qualitätsmanagements als legendärer Vater des Toyota Production System (TPS) eingegangen (Zollondz 2002:92). Dies ist kein Beratungs- sondern ein „hauseigenes“ Produktaktivitätssystem, das mit Ford-System (auch erst später zum „Fordismus“ generalisiert) verglichen werden kann. Ohno entwickelte in den 50er Jahren unter anderem das Just-in-Time-Konzept: „Just-in-time production means producing only what is needed, only in the amounts needed, and only when needed” (Zollondz 2002:93ff). Dieses Konzept wurde als erstes bei Toyota eingeführt, wo darauf folgend weitgehend ohne Lagerbestände und ohne Nacharbeiten in Fließfertigung produziert wurde. Ziel dieses Vorgehens war die Beseitigung von jeglicher Verschwendung und damit (wenn nach dem Aufdecken dagegen gesteuert wurde bzw. wird) die Verbesserung. Leittext März 2006 Seite 48 Ein weiterer japanischer Qualitätsexperte Kaoru Ishikawa (1915 – 1989) beschäftigte sich mit der Entwicklung von Gruppenarbeitskonzepten. Er entwickelte das Qualitätszirkel („quality circle“) und viele Qualitätstechniken. Ishikawa hat auf den Arbeiten von A. V. Feigenbaums16 aufgebaut. Feigenbaums Hinweis, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin für Qualität verantwortlich sind („Quality is everybody`s job“), prägt das heutige Qualitätsmanagement (Zollondz 2002:102). Genichi Taguchi (geb. 1924) zählt heute zu den wichtigsten Forschern auf dem Gebiet der statistischen Versuchsplanung. Er versucht, die Sprache der Statistik in die Sprache des Managements zu übersetzen (Zollondz 2002:108). Er trug wesentlich dazu bei, dass sich die klassische statistische Versuchsplanung, die er entscheidend weiterentwickelte und umsetzte, auch außerhalb von Japan verbreitete. Des Weiteren befasst sich Taguchi mit dem ökonomischen Verlust und dem Begriff Qualität. Seine Definition von Qualität lautet: „Die Qualität eines Produktes ist der kleinste Verlust, den ein Produkt nach seiner Auslieferung verursachen kann“ (Zollondz 2002:110). Der entsteht, wenn die Erwartungen der KundInnen nicht erfüllt wurden und bei der Nutzung schädliche Nebeneffekte entstehen. Mit dem Begriff Qualität im weiteren Sinne setzt sich auch Masaaki Imai (geb. 1930) auseinander. Er sagt, dass das Management dafür verantwortlich ist und dass schlechte Qualität ein Zeichen von schlechtem Management ist (Imai 1992. In: Zollondz 2002:225ff). Imai befasste sich mit dem so genannten kontinuierlichen Verbesserungsmanagement (KVM) und betonte die Notwendigkeit der laufenden Verbesserungen, an denen die MitarbeiterInnen sowie Führungskräfte beteiligt sind und die ohne Motivation, Engagement, Bewusstsein für Verbesserungen und entsprechendes Handeln nicht zu erreichen sind. Imais Konzept (Kaizen-Ansatz) prägte wie kein anderes sowohl die ISO 9000 als auch das TQM (Zollondz 2002:226). Kaizen17 ist das übergeordnete Konzept, das die meisten typisch japanischen Führungspraktiken wie z.B. Total Quality Control oder firmenumfassende Qualitätssicherung, Qualitätszirkel und die Art der Arbeitsbeziehungen zusammenfasst. Zum Schluss sollte noch der Name Yoji Akao (geb. 1928) genannt werden. Er führte 1966 zusammen mit Shigera Mizuno das Konzept das Quality Function Deployment (QFD) als Methode für den Entwurf von Produkten ein, das sich in den 90er Jahre auch in Europa durchsetzte (Zollondz 2002:115). Dieser Ansatz, der nicht nur auf industrielle Unternehmen beschränkt ist und von jedem Unternehmen jeweils angepasst werden muss, wird in den westlichen Ländern als Qualitätstechnik, in Japan als Unternehmensphilosophie betrachtet. Die japanischen Ansätze bestimmen meistens nicht nur das Arbeitsleben, sondern sie sind auch Teil des Soziallebens und des Leben zu Hause. Die unterschiedliche Einstellung der westlichen und japanischen Unternehmen beschreibt sehr deutlich Rois (Rois 1999. In: Zollondz 2002:241): Während es in westlichen Unternehmen mithilfe von Kaizen vor allem um Verbesserung und Veränderung der Prozesse geht, charakterisiert das japanische Kaizen die „stete Verbesserung des für die Leistungserstellung arbeitenden Menschen, vom 16 Armand Vallin Feigenbaum (geb. 1920 in USA) – einer der ersten, der den heutigen TQM-Ansatz begründet hat. Der Begriff TQC (Total Quality Control) ist Feigenbaum zurückzuführen. 17 1986 veröffentlichte Imai sein Buch “Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success”, das mittlerweile in 14 Sprachen übersetzt wurde. Leittext März 2006 Seite 49 Topmanager bis hin zum Arbeiter unter der Prämisse des funktionsübergreifenden Zusammenarbeitens.“ 4.6.4 Weitere Ansätze im Überblick Viele Managementansätze gelten an sich als eigenständige Systeme, können aber in den Bezugsrahmen eines Qualitätsmanagements eingefügt werden.18 Zollondz (2002:317) nennt in diesem Zusammenhang neben der Balanced Scorecard und dem Benchmarking folgende Ansätze: Beschwerdemanagement Kernkompetenz-Management Leadership Lean Production/Lean Management Qualitätszirkel Reengineering Six Sigma Organisationskultur Wissensmanagement Einige dieser Ansätze werden nun etwas ausführlicher dargestellt. 4.6.4.1 Qualitätszirkel „Ein Qualitätszirkel ist eine zielorientierte arbeitende Gruppe von Mitarbeitern, die ihr eigenes arbeitsspezifisches Wissen und ihre Erfahrungen freiwillig einbringen, um Themen der eigenen Arbeit zu besprechen und durch selbstentwickelte Lösungen Produkt- und Arbeitsqualität verbessern zu helfen, sowie zu ihrer Selbstverwirklichung und Arbeitszufriedenheit beizutragen“(Masing 1994:1075). Des Weiteren meint Masing, dass es eine Reihe weiterer Bezeichnungen wie Problemlösungsgruppen, Kleingruppen, Qualitätsgruppen o.ä. gibt, aber alle gleiche Grundelemente und standardisierte Formen haben. Ein Qualitätszirkel besteht in der Regel aus einer Gruppe von vier bis acht MitarbeiterInnen. Auch wenn Arbeitsweise und Arbeitsmittel oft bekannte Elemente der Gruppenarbeit sind, ersetzen Q-Zirkel nicht andere Formen der Gruppenarbeit, sondern sind ein zusätzliches Angebot teamorientierter Arbeitsformen (Masing 1994:1076f). 4.6.4.2 Qualitätstechnik Für die praktische Anwendung des Qualitätsmanagements gibt es eine Reihe von Werkzeugen und Methoden, die unter dem Oberbegriff Qualitätstechnik zusammengefasst werden. Hierunter fallen auch Techniken aus anderen Fachgebieten, wie zum Beispiel der 18 So lässt sich zum Beispiel die Balanced Scorecard als eigenständiger Managementansatz begreifen, dem man Elemente des Qualitätsmanagements unterordnen kann. Andersherum lässt sich aber auch aus der Sicht des Qualitätsmanagements die Balanced Scorecard integrieren, also einem QM-Konzept unterordnen. Leittext März 2006 Seite 50 Psychologie, der Mathematik und Statistik, der Kostenrechnung etc. Zollondz (2002:318) spricht aus diesem Grund von Qualitätstechniken im engeren Sinn, die direkt auf die Planung, Realisierung (Lenkung), Analyse und Verbesserung der Qualität oder des Qualitätsmanagements bezogene Techniken sind. Neben den „klassischen“ Qualitätstechniken, wie z.B.: Ischikawa’s Ursache-Wirkungsdiagramm, nennt Zollondz (2002:319) folgende Qualitätstechniken im engeren Sinn: QFD: Qualitätsfunktionen-Darstellung (Quality Function Deployment) FMEA: Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (Failure Mode and Effects Analysis) SPR/SPC: Statistische Prozessregelung (Statistical Process Control) DoE: Statistische Versuchsplanung (Design of Experiments) Q7: Sieben Qualitätswerkzeuge (Seven QC Tools) M7: Sieben Managementwerkzeuge (Seven New Tools) „…Neben diesen Qualitätstechniken im engeren Sinne werden Brainstorming, DelphiMethode, Morphologischer Kasten, Synektik und viele andere Hilfstechniken im weiteren Sinne bezeichnet. Daneben gibt es eher als organisatorische Maßnahmen zu verstehende Einrichtungen wie Qualitätszirkel, Audit oder vorbeugende Instandhaltung etc.“ (Theden 2001:1005 in Zollondz 2002:320). Des Weiteren gibt Zollondz (2002:321) einen Überblick über Qualitätstechniken für/aus dem den Dienstleistungsbereich: Vignetten Technik (Design/Entwicklung/Prävention/Qualitätsmerkmale) Blueprinting (Prozessdarstellung) Sequentielle Ereignis Methode (Ermittlung der Qualitätsmerkmale) ServQual (Qualitätsmessung) Beschwerdemanagement (Beschwerden) FRAP – Frequenz Relevanz Analyse von Problemen FMEA (Prävention und Verbesserung) Gerhard Linß (2001:119ff in Zollondz 2002:319) bezieht „die“ Qualitätstechniken auf die Phasen des Deming’schen PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act). Dieser Systematisierungsvorschlag ist in der folgenden Abbildung nachempfunden. Leittext März 2006 Seite 51 Qualitätsplanung Qualitätsverbesserung Audit; Benchmarking; FMEAFehlermöglichkeits- und -einflussanalyse; Ursache-Wirkungs-Diagramm [ISHIKAWADiagramm]; DoE-Design of Experiments [Statistische Versuchsplanung]; Six-SigmaMethode; Kaizen/KVP- Kontinuierliche Verbesserung; Qualitätszirkel; BVWBetriebliches Vorschlagswesen; Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse; Acht-DMethode C - CHECK Qualitätsprüfung (Analyse) MSA-Analyse von Messsystemen [Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung]; Maschinenfähigkeitsuntersuchung; und Elementare Qualitätstechniken QFD-Quality Function [House of Quality]; Lastenheft/Pflichenheft; A - ACT APQP-Produkt-Qualitätsvorausplanung und Control Plan; Prüfplanung; Prüfmittelauswahl Kreativitätstechniken: Affinitätsdiagramm Brainstorming Brainwriting Methode 635 Metaplantechnik Mindmapping Netzplantechnik; Visualisierungstechniken: Fehlersammelliste Histogramm Radarbild Paretodiagramm Korrelationsdiagramm, Flussdiagramm Flussdiagramm; Checkliste; Balanced Scorecard Prozess- Lieferantenbewertung; Reklamationswesen D - DO P - PLAN Qualitätsrealisierung (-lenkung) VDA 4-Sicherung der Qualität vor Serieneinsatz; PPAPProduktionsteilfreigabe nach QS 9000; Klassifizierung von Prüfungen; Prüfmittelverwaltung und -überwachung; SPC-Statistische Prozessregelung/ Control Cards-Qualitätsregelkarten; Annahmestichprobenprüfung/AQL-Werte; Fehlermanagement; Poka Yoke; Jidoka; Anson; Drei Mu: Muda, Mura, Muri; Fünf S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke Abb. 7: Systematik der Qualitätstechniken gegliedert nach dem PDCA-Circle von Deming 4.6.4.3 Wissensmanagement Bereits als Frederick Taylor (vgl. 3.1.1) sein „Scientific Management“ veröffentlichte, wurde deutlich, dass es sich bei arbeitsteilig produzierenden Organisationen immer um wissensbasierte Systeme handelt, in denen das individuelle Wissen der MitarbeiterInnen, das kollektive Wissen einzelner Arbeitsgruppen und das organisationale Wissen, das aus dem Zusammenwirken aller Beteiligten beispielsweise auf kultureller und sozialer Ebene entsteht, die Produktivität der gesamten Organisation stark beeinflusst. So wie Taylor zunächst den Arbeitsablauf optimieren wollte, um so die Arbeitsproduktivität und den Arbeitsertrag des gesamten Betriebes zu erhöhen, „so muss die neue Organisation individuelle und kollektive Wissensbestände integrieren, um damit eine effektive Informationsverarbeitung zu sichern und schlussendlich die Wissensproduktivität des gesamten Unternehmens zu erhöhen. Es gilt Wissen in wirtschaftlichen Nutzen, in Wert, zu Leittext März 2006 Deployment Seite 52 verwandeln. Wissensmanagement hat sich diese Aufgabe zum Ziel gesetzt“ (Güldenberg/Mayerhofer/Steyrer 1999:593). Wissen ist eine, wenn nicht die entscheidende Unternehmensressource zur Sicherung der Überlebensfähigkeit eines Unternehmens. Wohlgemuth (1991:140 in Eckardstein/Kasper/Mayrhofer 1999:593) spricht von einer ständigen Wissens- und Know-how-Erosion und weist auf die besondere Rolle des Menschen mit seiner Fähigkeit zu lernen und zu lehren hin, damit die Unternehmung dieser Erosion nicht zum Opfer fällt. Laut Güldenberg (1999:528) versteht man unter Wissen die Gesamtheit aller Endprodukte von Lernprozessen (…). Er bezieht sich auf einen organisationalen Regelkreis der die Funktion eines ganzheitlichen und damit unternehmensübergreifend verstandenen Wissensmanagements definiert und identifiziert dabei vier wesentliche Bereiche: Wissensgenerierung Wissensspeicherung Wissenstransfer Wissensanwendung Neben den betriebswirtschaftlichen Ansätzen (siehe oben) zum Thema Wissensmanagement (vgl. beispielsweise Nonaka, Pautzke, Albrecht, Willke, Pawlowsky) gibt es auch innerhalb der Volkswirtschaftslehre Bestrebungen, die Bedeutung der Ressource Wissen hervorzuheben (vgl. beispielsweise Hayek, Machlup). Um eine Weiterentwicklung handelt es sich beim Ansatz des Systemischen Wissensmanagements (vgl. z.B. Wilke 2001, Wilke 2004). Ausgangspunkt ist die an der Systemtheorie orientierte Unterscheidung zwischen Daten, Information und Wissen: Daten sind beobachtungsabhängige, also qua Beobachtung konstruierte (codierte) Bausteine von Kommunikation Aus Daten wird Information, wenn sie bei EmpfängerInnen in einen Kontext von Relevanzen eingebaut werden; eine Information is a difference which makes a difference Aus Information wird Wissen durch Einbindung in bedeutsame Erfahrungsmuster Informationsaustausch zwischen Systemen ist unmöglich, es werden immer Daten ausgetauscht, Information entsteht durch Kommunikation bei den EmpfängerInnen und wird dort, wenn es in bestehende Erfahrungsmuster eingebaut wird, zu Wissen (vgl. Wilke 2001:8ff). Für die Qualitätsentwicklung bedeutet der „systemische Blick“ die Erkenntnis, dass nicht Daten relevant sind, sondern der Umbau von Daten über Informationen zu Wissen. „To make your organization perform, you’ll have to build systems that support knowledge – not data“ (Wilke 2001:8). 4.6.5 Qualitätsmanagement in Integrationsfachdiensten, deutsches Modell In Deutschland wurde vor einigen Jahren (2000) das „Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement“ (MuQ) für Integrationsfachdienste (IFD) entwickelt und erprobt. Die Leittext März 2006 Seite 53 Ergebnisse dieses Projektes leisten einen wichtigen Beitrag zur Diskussion um das Thema „Qualitätssicherung“ in sozialen Arbeitsfeldern. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Konzept Qualitätsmanagement ist gerade im Bereich der Integrationsbegleitung besonders relevant, da nach der Novellierung des Schwerstbehindertengesetzes (2000) und der damit verbundenen flächendeckenden Einrichtung von IFD in Deutschland die Diskussion um Quantitäten eine Reflexion und Bestimmung fachlicher Qualitätskriterien der Arbeit zu verdrängen scheint. Es sei jedoch daran erinnert, so Bungart, dass eine effektive Begleitung und Vermittlung von Arbeitssuchenden immer nur das Ergebnis von Fachlichkeit und Professionalität sein können – und nicht umgekehrt (Bungart, 2001). In Bezug auf die Diskussionen um Leistungsfähigkeit, Kosteneinsparungen und ihre praktische Auswirkungen ist eine weitere ausführliche Beschäftigung mit der Qualitätssicherung und -entwicklung in dem sozialen Bereich notwendig. Erhöhte Qualität muss nicht immer mit steigenden Kosten verbunden sein und umgekehrt erhöhte Kosten müssen nicht unbedingt bessere Qualität bedeuten. Mittlerweile gibt es im sozialen Bereich verschiedene Qualitätsmanagementmodelle, z.B. in der Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendhilfe aber auch in der Behindertenhilfe (QUOFHI – Qualitätssicherung Offener Hilfen für Menschen mit Behinderung etc.). Bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in sozialen Dienstleistungseinrichtungen müssen einige Besonderheiten berücksichtigt werden (vgl. Bobzien u.a., 1996). Dazu gehören unter anderem: Soziale Arbeit ist durch prozessorientierte Vorgehensweisen charakterisiert, die zwar eher Flexibilisierung statt Standardisierung einzelner Arbeitsabläufe verlangen, aber dennoch Formulierung von Qualitätsmerkmalen in einzelnen Arbeitsbereichen zulassen. Soziale Dienstleistungen sind im Wesentlichen immateriell, d.h. die Bewertungsmaßstäbe sind komplex und nicht nur für NutzerInnen schwer zu handhaben. Die Beziehungsstruktur zwischen NutzerInnen und MitarbeiterInnen ist ungleich vielschichtiger. So sind die NutzerInnen für die Qualität der Dienstleistungen bis zu einem gewissen Maß mitverantwortlich. 4.6.5.1 Zum Konzept MuQ Die Integrationsfachdienste in Deutschland sind Teil des Regelangebotes von Hilfen zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Verschiedene Untersuchungen zur Arbeit von IFD verdeutlichten im Laufe der Zeit, dass die Bearbeitung von Aufgaben durch die Fachdienste in den einzelnen Standorten durchaus unterschiedlich gewichtet und ausgestaltet wird. Daraus ergab sich, dass Kriterien für eine differenzierte Beurteilung der Qualität der verschiedenen Unterstützungsangebote erforderlich sind und dass eine ausschließliche Orientierung an Betreuungs- und Vermittlungszahlen nicht ausreichen kann. Vor diesem Hintergrund entstand das Forschungs- und Modellprojekt „Qualitätssicherung und -entwicklung in Integrationsfachdiensten“ (Laufzeit 1998-2000). Das Ziel dieses Projektes war die Entwicklung und Erprobung eines Qualitätsmanagementsystems für Leittext März 2006 Seite 54 Integrationsfachdienste. Es wurden die so genannten „Arbeitsstandards“ erstellt, die eine konkrete Beschreibung der Leistungen und Vorgehensweise eines IFD sowie Verfahren zur Überprüfung ihrer Qualität beinhalten. Um tatsächlich zu einer Verbesserung der Qualität der Arbeit von IFD beitragen zu können, muss ein Qualitätsmanagementsystem bestimmten Anforderungen genügen. Nachfolgende Punkte lehnen zum Teil an eine Aufstellung von Gütekriterien für Verfahren der Qualitätssicherung in der sozialen Rehabilitation behinderter Menschen an (Schwarte/Oberste-Ufer, 1997:79ff.): Inhaltliche und methodische Fokussierung Hinreichende Operationalisierung der Aussagen Multiperspektivischer Ansatz Mehrdimensionalität Eignung zur Selbstevaluation Eignung als Steuerinstrument Kontinuität der Anwendung Flexible Anwendbarkeit (Bungart u.a., 2000:31ff.) Der Begriff umfassendes QM („Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement“) deutet an, dass das Modell in der Tradition so genannter Total-Quality-Management Ansätze (TQM) steht (vgl. Zink, 1995). QM bezieht sich hiernach nicht nur auf die Überprüfung der Arbeitsergebnisse (Ergebnisqualität), sondern betrifft die gesamte Arbeit des IFD. Es werden sowohl die Arbeitsprozesse (Prozessqualität) und die dahinter stehenden Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen (Strukturqualität) mit in den Blick genommen, als auch nach Möglichkeit die Interessen aller am Integrationsprozess beteiligten Gruppen berücksichtigt. Ein umfassendes QM-System kann zudem in seiner Gesamtheit nur verwirklicht werden, wenn sowohl die Leitungs- bzw. Trägerebene als auch die MitarbeiterInnen eines Fachdienstes das Vorgehen unterstützen und an der Verwirklichung mitarbeiten (Bungart u.a., 2000:34). Das „Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement (MuQ) für Integrationsfachdienste“ besteht aus mehreren Elementen: „Basismodule“ „Arbeitsstandardmodule“ „Rahmenmodule“ „Audit, externe Beratung und Evaluation“. Es ist zwar möglich, nur einzelne Module zu realisieren, allerdings ginge dadurch der innere Zusammenhang des Ansatzes verloren (ausführlicher siehe Bungart u.a., 2000). Der neu entwickelte Qualitätsmanagementansatz MuQ ist vor allem als einrichtungsinternes Konzept kontinuierlicher Qualitätsverbesserung und der Selbstevaluation zu verstehen. Der Schwerpunkt liegt dabei sowohl in den entwickelten Formulierungen von Zielen als auch in der Verbesserung einer prozessorientierten Arbeitsweise. Die Ausgangsfrage bei der Leittext März 2006 Seite 55 Konzeptionierung eines Qualitätsmanagementsystems lautet: Wie können – unter Beachtung der verschiedenen Interessen der Beteiligten – die finanziellen und personellen Ressourcen so eingesetzt werden, dass die Aufgaben, die der sozialen Dienstleistung gestellt sind, effizient erfüllt werden (Bungart, 2001)? 4.6.5.2 MuQ im Vergleich zu anderen Qualitätsmanagementsystemen Abschließend sollte das QM-System MuQ mit anderen Qualitätsmanagementsystemen kurz verglichen werden. Aufgrund ihrer Bedeutung und Verbreitung wählten die Autoren das EFQM-Modell und die DIN EN ISO 900119 (Bungart, 2000:78ff.). Sowie für EFQM ist auch für MuQ die enge Verbindung zwischen den Prozessen und den erzielten Ergebnissen dieser Prozesse besonders wichtig. Die Bewertung der in den Arbeitsstandards niedergelegten Prozessbeschreibungen ist bei MuQ ebenfalls von den über die Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung erfassten Arbeitsergebnissen abhängig. Des Weiteren ist beiden Systemen die Betonung der TQM-Prinzipien (Kunden-, Mitarbeiter-, Prozessorientierung etc.) gemeinsam. Die Implementierung von MuQ in einem Fachdienst ist daher mit einer Ausrichtung am EFQM-Modell kompatibel und erfüllt wesentliche Inhalte der EFQM-Kriterien (Bungart u.a., 2000:81). Eine vollständige Anwendung des EFQM-Modells würde jedoch laut Meinung der Autoren eine weitere fachdienstspezifische Ausdifferenzierung und Umsetzung von einzelnen Unterkriterien des Modells erfordern. Der Schwerpunkt der Norm DIN EN ISO 9001 liegt in der Definition von allgemeinen Anforderungen an Regelungen im Rahmen eines QM-Systems. Eine Zertifizierung nach dieser Norm prüft also die Qualitätsfähigkeit einer Organisation, nicht aber die tatsächliche Qualität der Produkte (vgl. auch Kap. 4.5.1 Vergleich ISO 9000 und EQA). Das QM-System MuQ beinhaltet ebenfalls formale Empfehlungen für den Aufbau eines QMSystems (z.B. Arbeitsstandards, Auditverfahren). Im Gegensatz zu DIN EN ISO 9001 werden aber auch konkrete Arbeitshilfen für die individuelle Ausgestaltung dieser Anforderungen gegeben (z.B. Leifragen). Das Ziel von MuQ ist die Festlegung und fortlaufende Überprüfung fachlich-inhaltlicher Kriterien für die Arbeit eines Dienstes. Zudem weist MuQ eine deutlich stärkere Orientierung an den Prinzipien des TQM auf (z.B. Selbstevaluation und Mitarbeiterorientierung). Grundsätzlich kann gesagt werden, dass durch die Arbeit mit MuQ zentrale Elemente der DIN Norm abgedeckt sind bzw. Vorarbeiten geleistet wurden. Die fachdienstspezifische schriftlichen Formulierung von Verhaltensregelungen und die Definition von Zuständigkeiten müssten in der Regel aber noch präziser werden (Bungart u.a., 2000:84). Für MuQ sowie für andere Qualitätsmanagementsysteme ist besonders wichtig, dass sie nicht starr bleiben, sondern dass sowohl die Arbeit (Organisation), die durch sie bewertet wird, als auch die Systeme kontinuierlich entwickelt und verbessert werden. 19 Die Abkürzungen stehen für Deutsche Industrie Norm (DE), Europäische Norm (EN), International Organization for Standardization (ISO). Leittext März 2006 Seite 56 4.7 Qualität als gesetzliche Vorgabe im Sozialen Die sozialen Einrichtungen Deutschlands wurden und werden seit den 90er Jahren von Reformstrategien der Sozialpolitik begleitet. Durch Gesetze wurden Vorgaben für den Umgang mit Qualität und deren Nachweis in sozialen Einrichtungen gesetzt. Grundsätzlich geht es dabei um folgende Gesetze: Gesundheitsreformgesetz (GRG) Krankenversicherungsrecht (SGB V) Arbeitsförderungsrecht (SGB III) Bundessozialhilfegesetz (BSHG) Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) In diesen Gesetzen wird „Qualität“ wie folgt vorausgesetzt (vgl. dazu Regus 2001, Merchel 2004, Burnmeister 2004 und Hansmeier/Spyra/Müller-Fahrnov 2004): Gesundheitsreformgesetz (GRG): Krankenversicherungsrecht (SGB V): Qualitätssicherung Arbeitsförderungsrecht (SGB III): Qualitätsprüfung Bundessozialhilfegesetz (BSHG): Leistungsvereinbarung (Leistungsstandards auf der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität), Vergütungsvereinbarung, Prüfungsvereinbarung. Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung. Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI): Qualitätssicherung, Weiterentwicklung der Qualität, Qualitätsanalysen, Qualitätsmanagement, Prüfung der Qualität, Umgang mit Qualitätsmängel. Kinderund Jugendhilfegesetz (KJHG): Leistungsvereinbarung, Entgeltvereinbarung. Qualitätsentwicklungsvereinbarung, Diese vollständige Aufzählung aus Deutschland zeigt, dass soziale Einrichtungen, die in einem dieser Bereiche tätig sind, zur Beschäftigung mit dem Thema Qualität verpflichtet wurden. In weiterer Folge wird zu diskutieren sein: Wie sieht die Gesetzeslandschaft in Österreich aus? Wird hier die Beschäftigung mit einem Qualitätssicherungssystem auch vorgeschrieben? 4.8 Exkurs: Qualitätssicherung in der Gesundheitsökonomie Das Gesundheitswesen verlangt seit je her eine besondere Berücksichtigung von Qualität, weil Qualitätsfehler sehr rasch zu Beeinträchtigungen der Gesundheit oder zum Tod von PatientInnen führen können. So war die Entdeckung der Ursachen des Kindbettfiebers in unhygienischen Maßnahmen der Geburtsstationen und der dadurch möglichen bakteriellen Leittext März 2006 Seite 57 Infektionen durch Ignaz Semmelweis und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen (Sterilität von Räumen, Geräten und Personal) ein wesentlicher Meilenstein des medizinischen Gesundheitsmanagements. In den letzten Jahrzehnten ist die Sicherung medizinischer Qualität zu einem wesentlichen Auftragsfeld der Gesundheitsökonomie geworden. Im Folgenden sollen zwei Strategien der Gesundheitsökonomie zur Sicherung medizinischer Qualität kurz dargestellt werden. Evidence Based Medicine: Evidenzbasierte Medizin meint, dass ein Behandlungs- oder Diagnoseverfahren und ein Medikament erst dann als qualitätsgesichert gilt und verwendet werden darf, wenn es sich im klinischen Test bewährt hat, seine Wirkung also evident geworden ist bzw. (klinisch) evident geworden ist, dass sie unerwünschte Nebenwirkungen in tollerablen Grenzen halten. Hier handelt es sich um ein Modell der Gewährleistung von Prozess- und Ergebnisqualität. QALY: Ein anderes Modell, das sich mit der subjektiven Bestimmung von Qualität beschäftigt, ist das Modell der QALY. Unter einer Qualitätssicherung durch QALYs versteht man die durch eine medizinische Intervention gewonnenen qualitätsangepassten Lebensjahren. „Der dahinter liegende Gedanke ist, dass ein Jahr mit Behinderung oder Krankheit nicht so viel zählt wie ein in Gesundheit verbrachtes. Ein gesundes Jahr zählt meistens 1 und je weniger gesund, desto stärker geht der Wert gegen Null (tot).Manche lassen auch noch negative Werte zu (schlimmer als tot),aber die Interpretation solcher Werte ist fragwürdig. Mit diesem Faktor werden nun Lebensjahre in Krankheit oder mit Behinderung gewichtet, um zu QALYs zu kommen.“ (Journal für Gesundheitsökonomie 2003:22). Die Ermittlung der QALYs erfolgt in der Regel durch Fragebögen, mit Hilfe derer der subjektive Gesundheitszustand der PatientInnen eingeschätzt wird. Durch den Vergleich der Einschätzung vor und nach der medizinischen Intervention kann der Gewinn von QALYs und damit eine Steigerung von Lebensqualität ermittelt werden. Ausgangspunkt ist das theoretische Konzept, nach dem die Lebensqualität die subjektive Wahrnehmung einer Person über die Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertesystemen, in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen. Lebensqualität wird nach diesem Konzept beeinflusst durch die körperliche Gesundheit, den psychischen Zustand, den Grad der Unabhängigkeit, die sozialen Beziehungen sowie durch ökologische Umweltmerkmale (nach WHO-QOL-Group, 1994). Diese Qualitätsdefinition folgt dem umfassenden Gesundheitsbegriff der WHO, demnach Gesundheit aus physischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden besteht. Dies wird als qualitätssichernde bzw. qualitätsentwickelnde Maßnahme in Gesundheitswesen verstanden und auch als Bewertungskriterium für die unterschiedliche Qualität alternativer Handlungen (Interventionen) verwendet („One of the most useful aspects of QALYs ist hat they allow the value for money provided by different interventions to be measured in a common unit cost per QALY.“ Malek 2001:2), ist aber in der medizinökonomischen Literatur nicht unumstritten (vgl. z.B. Journal für Gesundheitsökonomie 2003). Der Ansatz der QALYs wurde in den Neunziger Jahren in Großbritannien von einer Europäiischen Arbeitsgruppe (EuroQol) in den letzten Jahren weiterentwickelt, um ein Leittext März 2006 Seite 58 standardisiertes Messsystem für QALYs zu erhalten, das System EQ-5D. „EQ-5D is a standardised instrument for use as a measure of health outcome. Applicable to a wide range of health conditions and treatments, it provides a simple descriptive profile and a single index value for health status. EQ-5D was originally designed to complement other instruments but is now increasingly used as a ‘standard alone’ measure.” (EuroQol 5D o.J.). Bei EQ-5D handelt es sich um einen dreiseitigen Fragebogen, bei dem auf der ersten Seite der Gesundheitszustand nach fünf Kriterien (Beweglichkeit/Mobilität, Selbständigkeit, allgemeine Tätigkeiten, Schmerzen/körperliche Beschwerden, Angst/Niedergeschlagenheit) jeweils in einem dreistufigen Fragenraster erhoben werden, auf der zweiten Seite ist der „allgemeine Gesundheitszustand“ in einer analogen Skala von Null bis Einhundert anzukreuzen und auf der dritten Seite werden einige demografische Daten erhoben. In der Auswertung dieses Fragebogens wird eine Indexzahl des momentanen subjektiven Gesundheitszustandes gewonnen, die Basis für die Bestimmung der jeweiligen QALYs ist. Die Berechnung der QALYs kann folgender Tabelle entnommen werden: Beschreibung Bewertung Zeitkomponente Angaben zu Items und Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität Einstufung des Gesundheitszustandes in einem von 0 bis 1 standardisierten Index Multiplikation des Index mit der Dauer des Gesundheitszustandes z.B. die fünf Fragen des EuroQol 5D z.B. visuelle Analogskala (VAS), Methode der zeitlichen Abwägung, Standardtheorie z.B. 0,5*2 Jahre ergeben 1 QALY (Aus Leidl 2005:5) Während es sich bei evidence based medicine um ein objektives Qualitätsentwicklungsinstrument handelt, das auf den Ergebnissen (klinischer) Studien aufbaut und die Qualität von Interventionen (Behandlungen, Medikationen) auf Basis gewonnener und (natur) wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse beschreibt, orientieren sich die QALY-Konzepte an einem subjektiven Gesundheitsbegriff. Obwohl gerade EQ 5D als zusätzliches Informationsinstrument für die Begründung von Entscheidungen über alternative Behandlungsmethoden entwickelt worden war, hat es sich offensichtlich mittlerweile bereits als „standard alone“ Maßnahme zur Qualitätsbewertung alternativer Interventionen etabliert. Es wäre interessant, auch vor dem Hintergrund der gesamten in diesem Kapitel diskutierten Qualitätsmessungs- und Entwicklungsgeschichte, zu diskutieren, welche Vor- und Nachteile dieses Konzept der „objektivierten“ Messung subjektiver Qualitätsempfindungen als Grundlage von medizinische Entscheidungen bietet. In gewissem Sinn wird hier die Hauptverantwortung (unter der Voraussetzung EQ 5D wird korrekt angewandt) für eine qualitätsbasierte Entscheidung dem/der „KundIn“, also dem Patienten oder der Patientin auferlegt. Leittext März 2006 Seite 59 5 Sozialpolitik und die gesellschaftliche Stellung von Sozialarbeit – Versuch einer Verortung 5.1 Die veränderte Stellung „Wohlfahrtsdreieck“ der Sozialarbeit im 5.1.1 Ausgangspunkt: Die Verschiebungen in der Wettbewerbsgesellschaft Auf Grund des Subsidiaritätsprinzips der Sozialpolitik waren seit je her viele Aufgaben der sozialen Absicherung den Trägern der Freien Wohlfahrt zugewiesen, und zwar sowohl den großen Organisationen wie Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Hilfswerk, Lebenshilfe und anderen als auch zahlreichen kleinen Trägern, wobei die Grenze zwischen Fremdhilfe und Selbsthilfe hier sehr oft schwimmend war (und ist). Diese Entwicklung erfolgte in den westmitteleuropäischen Ländern ziemlich vergleichbar, wiewohl es einige landesspezifische Besonderheiten zu beachten gilt. (Zur Geschichte der Freien Wohlfahrt in Österreich, insbesondere in Wien, vgl. Anastasiadis et. al. 2003). Diese Organisationen, die zunehmend unter dem Begriff Sozialwirtschaft20 subsumiert werden, verlangen, ohne die allgemeinen Prinzipien des Managements und der Betriebswirtschaftslehre zu verlassen, die Beachtung einiger Besonderheiten. Insbesondere die Finanzierung der Sozialwirtschaft weist einige Besonderheiten gegenüber der Erwerbswirtschaft, aber auch gegenüber den budgetpragmatischen Prinzipien der Öffentlichen Hand aus: Während die Öffentliche Hand von der Budgetpragmatik und die Privatwirtschaft vom bilateralen Verhältnis zwischen AnbieterInnen und NachfragerInnen (Gleichgewichtspreise auf einem Markt) geprägt ist, agiert die Sozialwirtschaft demgegenüber üblicherweise in einem ökonomischen Dreiecksverhältnis. Zwischen LeistungserbringerInnen und LeistungsempfängerInnen ist in der Regel ein (öffentlicher) Kostenträger geschaltet, der den LeistungserbringerInnen den Preis für die erbrachte Leistungen auf Grundlage sozialgesetzlicher Bestimmungen rückerstattet (in Form von Tagsätzen oder einer Grundsubvention oder einer Mischform zwischen beiden). Die traditionelle Beauftragungs- und Finanzierungsform der Sozialwirtschaft besteht also in der Förderung. Die Veränderungen seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts haben diese traditionelle Beauftragungs- und Finanzierungsform unter Druck gebracht. Schubert (2005:10f) betont in diesem Zusammenhang vier – mehr oder weniger zusammen wirkende – Entwicklungstrends: 20 Unter Sozialwirtschaft verstehen wir jenen Teil des Dritten Sektors (Definition dazu siehe weiter unten), der sich im Sozialbereich bewegt (andere Teile des Dritten Sektors wären z.B. der Sport- oder der Kulturbereich). Andere Definitionen verwenden den Begriff „Sozialwirtschaft“ breiter und beziehen auch soziale Dienstleistungen des Staates oder des marktorientierten Sektors mit ein; bei einer zu weiten Verwendung des Begriffes Sozialwirtschaft besteht jedoch die Gefahr, die Besonderheiten der Produktion sozialer Dienstleistungen im Dritten Sektor zu wenig zu beachten. Wir neigen daher dazu, für den breiteren Begriff eher das Wort „Sozialpolitik“ zu verwenden (vgl. auch Anastasiadis et.al., 2003). Zum Begriff Sozialwirtschaft wird aktuell auch im thematischen Netzwerk 3b – das sich aus den 5 EQUAL-EP´s zusammensetzt – gearbeitet und wird es dazu noch weitere Ergebnisse geben. Leittext März 2006 Seite 60 Der quantitative und qualitative Bedeutungszuwachs der Sozialwirtschaft führte dazu, dass hier attraktive Märkte entstehen (entstanden sind), die auch für marktwirtschaftliche Betriebe zunehmend attraktiv werden. Es bildet sich ein spezifisches Wohlfahrts-Mix heraus (vgl. Evers 19990, Evers/Wintersberger, 1990). Die Verwaltungsreform in Gemeinden und Ländern im Rahmen des New Public Management (vgl. Naschold/Jann/Reichert 1999, Naschold 1995, Maelike1998, Klimecki/Müller, 1999) führt zu einer „Rückorientierung“ der Gebietskörperschaften auf ihr jeweiliges Kerngeschäft als öffentliche Verwaltung. Die Organisation und Durchführung sozialer Dienstleistungen wird zunehmend eine Frage der Beauftragung externer Erbringer. „Da die Kriterien der Vergabe im neuen Modell nicht mehr von den klassischen Maximen des Subsidiaritätsprinzips – gesellschaftlicher Vielfalt und weltanschaulicher Pluralität – bestimmt werden, sondern von ökonomischen Prinzipien, verliert die traditionelle Vorstellung der Träger der Freien Wohlfahrtspflege an Bedeutung und kommerzielle Anbieter werden aufgewertet“ (Schubert 2005:11). Im Wettbewerbsrecht der EU gilt der funktionale Unternehmensbegriff, bei dem es weder auf die Zuordnung zum öffentlichen oder privaten Sektor noch auf die Rechtsform ankommt, sondern ausschließlich darauf, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Eindeutig nicht wirtschaftlich sind in diesem Verständnis die hoheitsstaatlichen Aufgaben der Gebietskörperschaften, die nationalen Bildungssysteme und karitative Tätigkeiten. Nur wenn die Tätigkeiten (Dienstleistungen) der Sozialwirtschaft nicht wirtschaftlicher Art sind, fallen sie nicht unter das Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht der Union. Aus diesem Wettbewerbsaspekt kommt die Sozialwirtschaft zunehmend unter Druck. Auch die Bestrebungen einer internationalen Liberalisierung der Dienstleistungen (GATS, Bolkestein-Richtlinie etc.) schaffen eine neue Deregulierungsdynamik, die die Sozialwirtschaft und ihre Angebote unter Druck setzt und weiter setzen wird. Als ein wesentlicher Kern der neuen Rahmenbedingungen, unter denen die Sozialwirtschaft ihre sozialen Dienstleistungen zu erbringen hat, hat sich immer mehr die öffentliche Beauftragung mittels Ausschreibungen herausgestellt. Diese Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie ein Fortbestehen der Sozialwirtschaft als „Arbeit mit Mission“ (Anastasiadis 2003) ermöglicht, gilt daher unsere Überlegung, wobei die Strategie der „Vergabe durch Qualität“ hier im Vordergrund stehen soll. Bevor wir aber mit dem Qualitätsdiskurs weiter fortfahren, soll nunmehr die Stellung der Sozialwirtschaft im Konzert der öffentlichen Sozialpolitik und ihrer Aufgaben näher analysiert werden. 5.1.2 Die Prinzipien des Sozialstaates als Rahmen von Sozialarbeit Sozialarbeit in mitteleuropäischen Gesellschaften kann nicht begriffen werden, ohne die Funktion des Sozialstaates zu definieren, denn Sozialarbeit arbeitet in der Regel im Auftrag oder in Ergänzung des öffentlichen, durch Staat und private Wohlfahrtsträger vermittelten Gefüges, das wir Sozialstaat nennen (vgl. z.B. Kaufmann 2003). Leittext März 2006 Seite 61 5.1.2.1 Das „Taktgeber-Modell“ Dieser Sozialstaat ist in besonderem Maße ein „Taktgeber des Lebenslaufes“ (Leibfried/Leisering 1995:7): Durch ein ausgebautes öffentliches Bildungswesen gibt er Starthilfen in der Arbeitsgesellschaft, stellt Weichen und eröffnet Lebenschancen. Durch ein umfassendes Alterssicherungssystem und die umfassende Pflegesicherung schafft er Erwartungssicherheit in der letzten Lebensspanne, allerdings umso besser, je näher die eigene Biografie an die „Normbiografie“ der regelmäßigen Erwerbsarbeit bzw. eheliche Anbindung an diese herankommt. Dadurch fungiert der Sozialstaat immer auch als Träger und Rekonstrukteur einer normativen biografischen Ordnung. Und schließlich sieht der Sozialstaat für jene möglichen Wechselfälle des Lebens wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Armut besondere Risikosicherungen in der Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung und (residual) in der Sozialhilfe vor. Das bedeutet: „Der Sozialstaat definiert Lebensphasen, steuert Lebenswege und verbürgt biografische Kontinuität“ (Leibfried/Leisering 1995:7). Die wesentliche Grundlage des so beschriebenen und – zumindest in einem in bismarckscher Tradition stehenden – auch so strukturierten Sozialstaatsmodells ist die lineare „Normalerwerbsbiografie“, die eine lebenslang homogene Beschäftigung in einem Vollzeit-Erwerbsmodell voraussetzt. Wie weiter unten zu zeigen sein wird, bezieht sich dieses Bild und die damit beschriebenen sozialpolitischen Ansätze in der Realität vor allem auf das Modell der männlichen Erwerbsbiografie (Breadwinner-Modell), das vom Mann als Haupterwerbsnehmer und der Frau als Dazuverdienerin ausgeht. Diese in diesem Modell beschriebenen Zusammenhänge können in Anlehnung an Leibfried und Leisering (Leibfried/Leisering 1995:7) als Funktionsmodell von Sozialstaat und Lebenslauf dargestellt werden: Alterssicherung Bildung Strukturierung Steuerung und Strukturierung Erwartungs- Pflege Strukturierung sicherheit Chance Kindheit, Jugend Vorsorge Erwachsenenalter Alter Drohende Armut „normaler“ Lebenslauf Verstetigung Risikointervention (Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit) 2. subsidiäre Ebene (Sozial- und Behindertenhilfe, der Länder, Jugendwohlfahrt etc.) Leittext März 2006 Seite 62 Abb. 8: Sozialstaat und Lebenslauf Die vier Ebenen sozialstaatlicher Intervention sind stark an je spezifische Lebensphasen gebunden (vgl. Leibfried/Leisering, 1995:24ff).21 Bildung: Sie ist eine grundlegende sozialstaatliche Intervention zur Schaffung lebensgestaltender Möglichkeitsräume (Vorselektion für den Arbeitsmarkt), sie ist ursprünglich an das Kinder- und Jugendalter gebunden, schließt auch Jugendarbeit i.w.S. als Risikointervention ein und wird durch familienpolitische Interventionen gestützt. Ebenfalls Chancenräume schafft aber auch die Erwachsenenbildung i.w.S., die den Anforderungen einer zunehmend an lebenslangem Lernen orientierten gesellschaft folgend, die strukturierende Aufgabe des Bildungssystems bis in höhere Altersgruppen fortzieht. . Risikointervention: Staatliche Interventionen vom Typ „soziale Risikobearbeitung“ (Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Armut), der vor allem in der mittleren Lebensphase (Erwerbs- und Familienphase) eine besondere Bedeutung zukommt. Alterssicherung: Staatliche Intervention mit dem Effekt der Verstetigung eines lebensdurchschnittlich erreichten Einkommens- und Statusniveaus, die historisch im 20. Jahrhundert die grundlegende Voraussetzung für die Herausbildung des Alters als eigenständigen dritten Lebensabschnittes war. Das Prinzip der „Teilhabeäquivalenz“ schafft im Gegensatz zu den versicherungsmathematischen Prinzipien einer kapitalgedeckten Altersvorsorge keine absolute Äquivalenz von Beiträgen und Leistungsansprüchen, sondern garantiert eine Verlängerung der jeweils relativen (lebensdurchschnittlichen) eigenen oder über Hinterbliebenenleistungen „abgeleiteten“ Position in der Lohn- und Gehaltshierarchie in den Ruhestand hinein. Dies wird durch die Umlagefinanzierung möglich. Pflegesicherung: Die jüngste Form staatlicher Intervention, die durch eine Kombination von Geld- und Sachleistungen das Pflegerisiko22 sozial bewältigbar macht, wirkt überwiegend im höchsten Alter und schafft eine materielle Grundlage für die Entstehung eines eigenen „vierten“ Lebensabschnittes23. Kritik am Taktgeber-Modell Wie bereits ausgeführt geht dieses Modell implizit von der Definition des „Normalen Lebenslaufes“ als (männlichen) Lebenslauf in Erwerbstätigkeit aus und spiegelt daher die unterschiedlichen Lebenslagen – und die damit verbundenen unterschiedlichen sozialpolitischen Interventionsbedürfnisse – von Frauen nur ungenügend wieder. Es ließe sich aber an vielen Beispielen zeigen, dass es sich dabei weniger um einen Fehler des darstellenden Modells handelt als um ein systemimmanentes Merkmal des Sozialstaates bismarckscher Prägung, der in seiner erwerbszentrierten Zuerkennung von Leistungen tatsächlich von einer „Normalerwerbsbiografie“ ausgeht und individuelle Abweichungen 21 Kritisch anzumerken ist, dass dieses Modell auch seine Schwächen hat, es ist in gewissem Sinn ahistorisch und es erfasst die Genderdimension des Sozialstaatsproblems nicht, siehe dazu weiter unten. 22 Das verbreitete Pflegerisiko wurde paradoxerweise durch den Fortschritt der Medizin und die damit einhergehende längere Überlebbarkeit von chronisch-degenerativen Schädigungen bzw. Behinderungen wesentlich mitgeschaffen. 23 Obwohl das Pflegerisiko prinzipiell altersunabhängig ist, kommt die Pflegesicherung zu etwa 80% hochbetagten Menschen zugute; siehe Badelt et.al., 1997 Leittext März 2006 Seite 63 durch Minderleistungen sanktioniert, was in einigen Leistungsbereichen, insbesondere im Pensionssystem, wo zwei systematische Abweichungen weiblicher Erwerbsbiografien von der „Normalbiografie“ (niedriger Verdienst, kürzere Erwerbszeiten) multipliziert werden, zu einer genderspezifischen Schere in den Leistungsbezügen führt, die deutlich größer ist als die Schere in den Aktivbezügen. Nicht mehr adäquat abgebildet ist im Taktgeber-Modell die Tatsache, das Bildung schon längst nicht mehr nur den Beginn des Erwerbslebens strukturiert, also seine WeichenstellerFunktion nicht nur am Lebensanfang einnimmt, sondern dass „lebenslanges Lernen“ bereits zu einer Regelanforderung bei der Strukturierung der Erwerbsbiografie geworden ist. Vor allem in Zeiten von Einbrüchen der Erwerbsbiografie, insbesondere bei längerer Arbeitslosigkeit sind Bildungsmaßnahmen durchaus als lebensstrukturierende Maßnahmen anzusehen. 5.1.2.2 Das De-Kommodifizierungsmodell Diese prägende Rolle des Sozialstaates bei der Entstehung und Veränderung des modernen Lebenslaufes ist an der jeweiligen Mächtigkeit seiner de-kommodifizierenden Wirkung zu operationalisieren. Unter De-Kommodifizierung (abgeleitet von commodity, die Ware) wird nach Esping-Anderson (Esping-Anderson 1998) die Bereitstellung alternativer, nichtmarktfähiger Mittel der Wohlfahrtsproduktion verstanden. Je höher der Grad der DeKommodifizierung durch Sozialleistungen, desto größer ist die Unabhängigkeit des einzelnen Individuums (insbesondere in Notlagen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Alter) gegenüber den Zwängen des Marktes. Anders gesagt: „De-Kommodifizierung stärkt den Arbeiter und schwächt die absolute Macht des Arbeitgebers. Eben deshalb haben sich letztere immer gegen De-Kommodifizierung gesträubt.“ (Esping-Anderson 1998:37). Dieses Modell orientiert sich an der Schaffung von drei unterschiedlichen „Freiheitsgraden“ zur Überwindung „kapitalistischer“ Abhängigkeiten im Erwerbssystem. Kritik am De-Kommodifizierungs-Modell Auch diesem Modell muss kritisch entgegen gehalten werden, dass es nicht gendersensibel ist, denn es übersieht, dass weibliche Lebenszusammenhänge in bedeutendem Ausmaß in nicht einmal noch kommodifizierten Tätigkeiten stattfinden. Sowohl die Reproduktionsarbeit als auch (was insbesondere für Sozialarbeit relevant ist) Arbeit für das Gemeinwesen (Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliche Arbeit), aber vielerorts auch illegale oder halblegale Arbeit (z.B. die von ausländischen Frauen erbrachte und nur mit einem Taschengeld entlohnte 24-Stunden-Betreuung – siehe Prochazkova/Schmid, 2005) wird (fast ausschließlich) von Frauen in einem Status, der durchaus als noch nicht einmal kommodifiziert zu beschreiben ist, durchgeführt. Aus unserer Sicht falsch verstandene DeKommodifizierung (etwa über ein Basislohnmodell) könnte durchaus dazu führen, dass weitere Tätigkeiten in den vorkommodifizierten Raum verlegt werden (so zeigt zum Beispiel das niederländische Sozialmodell zwar eine relativ hohe Grundsicherung aber die höchste Teilzeitquote von Frauen in der gesamten EU und gleichzeitig einen hohen Anteil ehrenamtlicher (Sozial-) Arbeit durch Frauen). Leittext März 2006 Seite 64 Weiters wird dem Modell von Esping-Anderson auch vorgeworfen, es sei bei der Klassifizierung der europäischen Sozialstaaten in die von ihm entworfenen drei Gruppen nicht in der Lage, historische Veränderungen in den Sozialstaatsregimen zu erkennen und adäquat abzubilden (ausführlicher zu dieser Kritik siehe in Lessenich/Ostner, 1998). 5.1.2.3 Flexicurity – ein Gendermodell In feministischen Analysen zur Arbeit im 3. Sektor (vgl. Andruschow u.a. 2001) werden emanzipatorische Arbeits- und Lebensmodelle untersucht. Grundsätzlich wird hier der Begriff „Arbeit“ neu gewertet und nicht nur als „Erwerbsarbeit“ gefasst. Bedeutsam sind dabei Ansprüche auf Ganzheitlichkeit (Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arbeits- und Lebenssphären), Gleichheit und Subjektivität und die Vorstellung dies in „lokalen Partnerschaften“ zu verwirklichen. In eine Neubestimmung und -bewertung von Arbeit sind jedenfalls die Familien- und "Care"-Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, politische und kulturelle Arbeit einzubeziehen. Die dabei angewandte feministische Systemkritik beschäftigt sich mit der Dominanz der warenförmigen, profitorientierten Produktion von Mitteln über die unmittelbare Reproduktion des Lebens und mit der Frage, wie eine ausgeglichene/gleiche Teilnahme von Frauen an Erwerbsarbeit und eine ausgeglichene/gleiche Teilnahme von Männern an Reproduktionsarbeiten erreicht werden kann. Zusätzlich sind auch noch Freiräume für soziale, kulturelle, ökologische Aktivitäten etc. zu schaffen. Ein konkreter Vorschlag von Heide Mertens dazu lautet: "jeder und jede hat bei einer drastisch reduzierten Erwerbarbeit auf vier, höchstens sechs Stunden am Tag auch Zeit für Versorgungsarbeit und politische Arbeit" (2001:160). Mechthild Jansen formuliert als Ziel ein „Halbe-Halbe beim Trio: Arbeit, Zeit, Geld“ und Ingrid Kurz-Scherf postuliert ein Fünfeck von Ökologie-Ökonomie-Soziales-Kultur-Demokratie. Uta Meier beschreibt als Vision eine „Ökonomie des Erhaltens/Unterhaltens“. Allgemein ist die Verbindung von privaten Lebensformen und dem Arbeitsmarkt eine „Schlüsselfrage“ von feministischen Analysen. Ute Klammer hat dazu ein Modell der "Flexicurity": ausgearbeitet, das eine Kombination aus „security“ und „flexibility“ darstellt. Diese Forderung nach einer Verbindung von Sicherheit und Flexibilität gilt im Übrigen nicht nur für Frauen, da auch für Männer die bisherigen Normarbeitsplätze schwinden und "Patchworkbiographien" zur Regel werden. Bausteine für „Flexicurity“ (vgl. Klammer 2001): 1.Der Zugang geringfügig erwerbstätiger Personen zu den sozialen Sicherungssystemen (Einbeziehung von geringfügig Beschäftigten und von WerkvertragsnehmerInnen in die Sozialversicherungspflicht). 2. Eine allgemeine Mindestsicherung. Bisher hat kein europäisches Land ein Basiseinkommen, sondern alle beziehen sich auf "Bedürftigkeitsprüfungen", die meist mit Staatsbürgerschaft und mit Wohnort verknüpft sind. (Subsidiär: nach Arbeit, Unterhalt, Vermögen). 3. Eine Individualisierung von Ansprüchen. Bisher erfolgt häufig eine Verknüpfung mit dem Familienstand und einer besonderen Betonung der Ehe. Leittext März 2006 Seite 65 4. Eine Sicherung bei Arbeitsmarktübergängen und eine Aktivierungspolitik. a) Zwischen den fünf typischen Übergängen – reduzierte Arbeit – Vollzeit – Privathaushalt ("Care-Debatte“) – Ruhestand und Ausbildung/Weiterbildung – sind "Brückenbildungen" erforderlich. b) Aktivierung von Langzeitarbeitslosen: hier werden „Schonjobs“ mit Lohnzuschüssen und Jobs in den Bereichen Umweltschutz, Kultur, Gesundheit und Pflege vorgeschlagen. "Flexicurity" ist als eine gesamtgesellschaftliche Strategie zu verstehen und anzulegen. Die aktuelle Ausgangslage dazu: "Eine Flexibilisierung, die für einen großen Teil der Bevölkerung mit neuen Risiken und neuen Phasen des Unterstützungsbedarfs verbunden ist, kann nur dann sozial abgefedert und unterstützt werden, wenn die Bereitschaft zur gesellschaftlichen Solidarität und Umverteilung über die Sozialsysteme (wieder) gestärkt werden kann." (Klammer 2001:265). Die von Esping-Andersen (1990) erstellte Typisierung von sozialer Sicherung in Europa – liberaler, konservativ-koporatistischer und sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat – wird hier noch um einen vierten Typ erweitert, den „mediterran/rudimentären Wohlfahrtsstaat“ mit einem geringem Sozialtransfer und einer primären Zuständigkeit der Familie für die Sozialversorgung. Neben einer guten Gesundheitsvorsorge gibt es keine/kaum Sicherung gegen Arbeitslosigkeit, Alter und/oder sonstige Bedürftigkeit (vgl. Klammer 2001). 5.1.2.4 Privatisierungsorientierte Sozialstaats-Modell Auch sozialpolitische Ansätze, die dem neoliberalen oder neokonservativen Denken verpflichtet sind (und diese bilden heute den Mainstream), betrachten de-kommodifizierende Wirkungen nicht als das Ziel der Sozialpolitik, sondern als unerwünschte, störende und daher zu vermeidende oder zu verhindernde (Neben-)Wirkung des Sozialstaates. DeKommodifizierende Wohlfahrtsstaaten sind erst jüngeren Datums und haben ihre Entfaltung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine „minimalistische Definition derselben müsste enthalten, dass ihre Bürger ungehindert und ohne drohenden Verlust des Arbeitsplatzes, ihres Einkommens oder überhaupt ihres Wohlergehens ihr Arbeitsverhältnis verlassen können, wann immer sie selbst dies aus gesundheitlichen, familiären oder altersbedingten Gründen oder auch solchen der Weiterbildung für notwendig erachten; sprich: wenn sie dies für geboten halten, um in angemessener Weise an der sozialen Gemeinschaft teilhaben zu können“ (Esping-Anderson, 1998:38). Wenn man die Funktion entwickelter Sozialstaaten über ihre de-kommodifizierende Wirkung definiert, wird deutlich, wieso eine Reduktion de-kommodifizierender Wirkungen im Zentrum konservativer und neoliberaler Sozialpolitik steht. Ziel ist dabei, die Arbeitskraft warenähnlicher und somit „marktfähiger“, also in der Tendenz billiger zu machen. Leittext März 2006 Seite 66 Kritik an diesem Sozialstaatsmodell Der Sozialstaat ist aber nicht nur aus der Sicht der (mehr oder weniger) beschränkten Marktfähigkeit der Arbeitskraft zu definieren, sondern auch von seiner strukturellen und seiner Angebotsseite her. Nach der von Karl Mannheim (vgl. z.B. Mannheim 1980) getroffenen Unterscheidung zwischen „substanzieller“ und „funktioneller“ Rationalität fördert der auf die Befriedigung abstrakter, verrechtlichter Bedarfe gerichtete Sozialstaat jene funktionelle Rationalität, die ihre Zwecke nicht in sich findet, sondern sich nach den vorhandenen (sozialstaatlichen) Angeboten richtet. Leistungen werden nicht (nur) in Anspruch genommen, weil eine Notlage besteht, sondern (auch) weil die vorhandenen und verrechtlichten Angebote (finanzielle) Vorteile bringen. Dies ist nicht negativ zu bewerten, wenn damit die Schlussfolgerung zu verbinden ist, dass gerade dieser Zusammenhang den größeren Zusammenhalt des Solidarsystems schafft: Beitragsleistungen stehen in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu beanspruchbaren (beanspruchten) Leistungen; die Solidargemeinschaft wird durch (fast) alle Glieder der Gesellschaft gebildet, was erst ein hohes allgemeines Leistungsniveau bei niedriger durchschnittlicher Beitragsbelastung ermöglicht. Diese Schlussfolgerung ist für jede „Treffsicherheits-Diskussion“, deren (verdecktes) Ziel nicht die Zerschlagung der Solidargemeinschaft ist, wesentlich zu beachten. 5.1.2.5 Das Modell des österreichischen Sozialstaates Der österreichische Sozialstaat orientiert in einem umfassenden, verrechtlichten und tief gestaffelten kausalen System mit finalen Elementen (z.B. Pflegesicherung) auf die Absicherung jener Risken, die typischerweise in Zusammenhang mit dem Erwerbsleben (des Familienerhalters) entstehen (Alterssicherung, Ausbildung) oder entstehen können (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Behinderung). Er basiert auf einem gesetzlich und korporatistisch regulierten Arbeitsmarkt. „Arbeitsmarktferne“ Risken (Armut, Wohnungslosigkeit, soziale Folgen von Suchterkrankungen oder Haftentlassung) werden demgegenüber subsidiär auf einer zweiten (wesentlich den Bundesländern überlassenen) Regelungsebene unter Mitwirkung von Wohlfahrtsverbänden behandelt. Der Problemlösungsmächtigkeit von Familie und Nahraum kommt – ungeachtet ihrer veränderten gesellschaftlichen Stellung – nach wie vor eine große Bedeutung zu; die Riskenabsicherung über den Markt ist demgegenüber in Österreich gering entwickelt. Historisch ruht der Sozialstaat auf mehreren Säulen: Eine stark von den Gemeinden (und den Ländern) getragene subsidiäre und auf die Familienselbsthilfe orientierte Grundsicherung (aus der dann die moderne Sozialhilfe wie die sozialen Dienste entstanden sind) ist die älteste Säule, parallel dazu sind im 19. Jahrhundert die kollektiven genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Selbsthilfeeinrichtungen (Solidarkassen) entstanden. Als dritte Säule ist im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Sozialversicherungsstaat bismarckscher Prägung begründet worden. Dieser wurde jedoch erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts umfassend ausgebaut. Heute schützt der Sozialstaat nahezu die gesamte Bevölkerung (als Selbst- oder Mitversicherte) in der gesetzlichen Arbeitsunfall-, Kranken- und Pensionsversicherung. Allerdings sind diese Leittext März 2006 Seite 67 Sicherungssysteme berufsständisch aufgebaut und verfügen über unterschiedlich hoch entwickelte Sicherungsleistungen. Ebenfalls unterschiedlich aufgebaut sind die Sicherungsleistungen bzw. die Strukturen der Daseinsvorsorge auf Länder- und Gemeindeebene. In den letzten drei Jahrzehnten wurde der Sozialstaat durch zusätzliche bedarfsorientierte Leistungen der Pflegesicherung und der Familienunterstützung (monetärer und nichtmonetärer Natur) ergänzt. Auch das Bildungssystem ist breit ausgebaut, aber nur bedingt horizontal durchlässig24. Betriebliche und über den Markt vermittelte private Leistungen haben demgegenüber eine geringe Tradition, ihre Bedeutung nimmt jedoch gegenwärtig (zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung) deutlich zu. Die Diskussion über die Wechselwirkungen zwischen der Entwicklung des österreichischen Sozialstaates und der Sozialarbeit in Österreich wird im Rahmen dieses Textes noch zu führen sein. 5.1.3 Sozialstaat im Umbruch Die europäischen Sozialstaaten befinden sich gegenwärtig in einer doppelten Umbruchsituation, einerseits gekennzeichnet durch immer stärker werdende innere Strukturdifferenzen (vgl. z.B. Bieling 2000), andererseits geprägt durch die schwächer werdende Finanzierungsbasis in Folge der EU-weiten Budgetkonsolidierungen. Innere Strukturdifferenzen: Die Entstrukturisierung von Lebensphasen und die Pluralisierung von Lebensstilen führt zu neuen horizontalen, überwiegend kulturell und durch Lebensweisen bestimmte Ungleichheitsdimensionen, welche die bestehenden wesentlich von der je unterschiedlichen Stellung im Erwerbsprozess gebildeten Ungleichheitslagen (an denen sich sowohl Sozialstaaten des Bismarck- wie des Beveridge-Typs orientieren) überlagern und in manchen Bereichen bereits ersetzen. So entstehen neue Risken, die nur zum Teil anerkannt (und damit sozial abgesichert) sind, z.B. Wohnungslosigkeit oder Überschuldung von Privathaushalten. Die eigentliche Brisanz dieser Risken erwächst daraus, dass sie zwar klassische Armutsrisken sind, aber keineswegs mehr auf traditionelle „Randgruppen“ beschränkt werden können, sondern in alle gesellschaftliche Gruppen und soziale Schichten diffundieren. Diese Risken sind nicht mehr allein durch klassische, auf die Einzelfallarbeit orientierte Sozialarbeit zu bearbeiten, sondern verlangen eine umfassende gesellschaftliche Lösung. Diese ist in den genannten Problemfeldern in unterschiedlichem Ausmaß bereits eingeleitet. Einheitliche „Patentlösungen“ wie das wirtschaftsliberale Modell einer einheitlichen Grundsicherung25 sind jedoch – zumindest in einem Sozialstaatsregime bismarckscher Prägung – unzureichend. Die Sicherung einer minimalen Gesellschaftsteilhabe in diesen (und anderen) „neuen“ gesellschaftlichen Problemfeldern erfordert vielmehr die Schaffung und Abstimmung von „maßgeschneiderten“ Mindestsicherungen und Leistungsangeboten26 in verschiedenen Lebensbereichen. 24 insbesondere durch die differenzierende Sekundarstufe Hier sind Ansätze bedarfsorientierter Mindestsicherung ausdrücklich nicht gemeint. 26 z.B. der privaten Schuldenregulierung oder der Delogierungsprävention 25 Leittext März 2006 Seite 68 Die zunehmende De-Institutionalisierung des Lebenslaufes korrespondiert jedoch mit einem Sozialstaat, der sich immer noch schwerpunktmäßig auf einen (über den Normalarbeitstag des Familienerhalters institutionalisierten) „Normal-Lebenslauf“ bezieht. Dieser Sozialstaat kommt jedoch durch die gegenwärtigen kollektiven biografischen Entwicklungen unter Druck - Berufsanfänger gelten als „zu alt“, PensionswerberInnen hingegen als „zu jung“. Aus diesen inneren Strukturdifferenzen des Sozialstaates ergeben sich mehrere Diskurszusammenhänge, die jedoch hier nicht weiter ausgeführt werden können. Diskurs um Krise und Zukunft der Erwerbsarbeit Kommunitaristischer Gemeinschaft Diskurs um das Erkennen der Mechanismen und Dynamiken des sozialen und soziologischen Umbruches Diskurs um das Verhältnis von Industriegesellschaft und nachindustrieller Gesellschaft bzw. um „Fordismus“ und „Post-Fordismus“. Diskurs um das Verhältnis von Gesellschaft und Durch die „Ent-Normalisierung“27 der Lebensläufe stimmt die traditionelle verrechtlichte Programmatik sozialer Sicherungssysteme heute zunehmend weniger mit der Entwicklung realer Lebensverläufe überein. Auf der einen Seite kann das als (vorübergehende oder verfestigte) Ausgrenzung, auf der anderen jedoch auch als (relative) Überversorgung erlebt werden. Geschwächte Finanzbasis: Der heute in allen EU-Staaten vorherrschende Druck auf den Sozialstaat, der sich durch eine verengte Finanzierungsbasis ergibt, hat mehrere Ursachen: Veränderte Funktionsweisen der Wirtschaft (z.B. durch einen Rückgang der durchschnittlichen Wachstumsraten aber auch der Inflation in den letzten beiden Jahrzehnten), der Arbeitsmärkte (wachsende Arbeitslosigkeit bei zunehmender Beschäftigung und Verfestigung segmentierter Teilarbeitsmärkte) sowie der Geldmärkte (verstärkte Bedeutung der Börsen) und die Auswirkungen der wissenschaftlich-technischen Revolution einerseits, der Globalisierung (zu einer differenzierten Globalisierungssicht siehe etwa Sallmutter 1998) wie der EU Konvergenzpolitik (Wirtschafts- und Währungsunion) auf der anderen Seite führen in den letzten beiden Jahrzehnten zu einer zunehmenden Dominanz der Staatsschulden-Debatte auf alle wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen. Aus Sicht der Sozialpolitik wird diese Entwicklung durch die verstärkte Deregulierung und Dezentralisierung der Arbeitsmärkte und die Einflüsse wachsender Lohnflexibilität auf die Beitragsentwicklung der Sozialversicherungen verschärft. Verstärkt wird der Druck durch eine Erwartungsdebatte bezüglich der in den kommenden drei Jahrzehnten zu erwartenden zusätzlichen demografischen Auswirkungen auf die Leistungsmächtigkeit der Sozialversicherung und des Sozialstaates. Aus der geschwächten Finanzierungsbasis des Sozialstaates ergeben sich wiederum folgende Diskursfelder: 27 Allerdings ist heute kaum mehr bestimmbar, was denn „normal“ sei Leittext März 2006 Seite 69 Diskurs über die Treffsicherheit von Sozialleistungen Diskurs über den Wechsel von kausalen zu (nicht mehr erwerbsbezogenen) finalen Sozialleistungen Diskurs über eine Reduktion der Versorgungsniveaus Diskurs über eine zunehmende Riskenprivatisierung vor dem Hintergrund eines (durchschnittlich) gewachsenen Wohlstandsniveaus wie einer (zumindest postulierten) zunehmenden Staatsverdrossenheit Diskurs über den Umstieg von der umlagefinanzierten Sozialversicherung zu einer kapitalgedeckten börsenfinanzierten Privatversicherung Diskurs über die Bedeutung der Wohlstandssicherung und -entwicklung Standortsicherung für die zukünftige Eine Frage rückt dabei immer mehr in den Mittelpunkt der sich an der geschwächten Finanzbasis des Sozialstaates orientierenden gesellschaftlichen Diskussion: Wird die umfassende Sozialstaatlichkeit (Sicherheit, Produktivität, sozialer Frieden) als Standortvorteil im Wettbewerb der Märkte abgelöst werden durch eine Reduktion „sozialer“ Kosten als Wettbewerbsvorteil? Nach den Vorstellungen der EU-Kommission und einiger nationalen Regierungen sollen die nunmehr auf Grund seiner geschwächten Finanzbasis vom Sozialstaat nicht mehr (im notwendigen Ausmaß) zu erbringenden Leistungen zunehmend vom Dritten Sektor, der so genannten Sozialwirtschaft erbracht werden. 5.1.4 Das „Wohlfahrtsdreieck“ – Die Verortung intermediärer Sozialpolitik Komplexe Sozialstaaten am Ende des 20. Jahrhunderts können auch als „Wohlfahrtsgesellschaften“ bezeichnet werden. In ihr vernetzen sich Leistungen, die auf verschiedenen Ebenen und durch verschiedene Träger erbracht werden. Für die Darstellung des Wechselverhältnisses von Staat, Markt und Eigenarbeit sowie die Bedeutung der unterschiedlichen Positionen im dazwischen liegenden intermediären Raum hat sich international der Begriff des „Wohlfahrtsdreiecks“ eingebürgert (vgl. z.B. Evers 1990; Evers/Ostner/Wiesenthal 1989; Evers/Wintersberger 1990; Kaufmann 1987). 5.1.4.1 Das Modell als Erklärung von Sozialer Aktivität im intermediären Raum Dieses Modell des Wohlfahrtsdreiecks will versuchen, „(a) einige Dimensionen festzulegen, innerhalb derer sich so etwas wie strukturelle Charakteristiken der organisierenden Größen von Markt, Staat und Haushalt/Gemeinschaft beschreiben lassen (b) freie Träger und Organisationen zu diskutieren, die diese bei Markt, Staat und Haushalt/Gemeinschaft jeweils dominierenden Prinzipien und Merkmale in sich verschränken“ (Evers 1990:195). Diese Sphäre sozialer Initiativen innerhalb des Wohlfahrtsdreiecks wird als intermediärer Raum bezeichnet. Leittext März 2006 Seite 70 STAAT X Sozialversicherung X Genossenschaft Steuerbegünstigte Zusatzpension X X Freie Kindergruppe X Gesundheitsprävention X Selbsthilfegruppe MARKT EIGENARBEIT Abb. 9: Sozialpolitische Handlungsfelder im Wohlfahrtsdreieck Sozialpolitik findet an den drei Eckpunkten des Wohlfahrtsdreiecks statt, aber auch an den Linien oder im intermediären Feld zwischen den Eckpunkten. Einige Beispiele sollen dies illustrieren. So findet sich zum Beispiel eine steuerbegünstigte private Zusatzpension auf der Verbindungslinie zwischen Markt und Staat, denn sie wird von Versicherungsunternehmen am Markt angeboten, aber durch Steuererleichterungen vom Staat unterstützt. Präventive Gesundheitsprogramme, etwa eine Schutzimpfung oder eine Vorsorgeuntersuchung, finden sich auf der Linie zwischen Staat und Eigenarbeit, denn hier setzt der Erfolg neben dem staatlichen Angebot die aktive Beteiligung der Begünstigten voraus. Sozialpolitische Handlungsfelder finden sich heute nicht nur an den Eckpunkten und Verbindungslinien zwischen Staat, Markt und Eigenarbeit, sondern zunehmend auch in der Fläche dieses Wohlfahrtsdreiecks, die hier als intermediärer Raum bezeichnet wird. Große Wohlfahrtsträger wie das Rote Kreuz treten am Markt der SpenderInnen und der LeistungskäuferInnen (z.B. Krankentransport) auf, sind aber auch auf staatliche Förderungen und in mehr oder weniger hohem Ausmaß auf private ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Eine Wohnbaugenossenschaft wiederum ist eine am Markt auftretende Eigenorganisation der GenossenschaftlerInnen, die aber (etwa bei Wohnbaugenossenschaften) auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Auch die gesetzliche Sozialversicherung, die staatlich reglementiert und finanziert wird, deren Geschäftsführung in Selbstverwaltung durch die VertreterInnen der Versicherten erfolgt und die auch als MarktanbieterInnen (etwa bei Rehabilitationsleistungen) auftritt, befindet sich genau genommen im intermediären Raum. Aber den eigentlichen Inhalt (die „Fläche“) des intermediären Raumes bieten jene Sozialinitiativen, Selbsthilfegruppen und Sozialprojekte, die als lebendiger und innovativer Kern der Sozialwirtschaft gelten. Selbsthilfegruppen (oder wie in unserem Bild freie Kindergruppen) werden stark von Eigenarbeit getragen, bekommen oft staatliche Leittext März 2006 Seite 71 Subventionen (etwa durch eine von der aktiven Arbeitsmarktpolitik finanzierte Stelle), verkaufen ihre Leistungen aber fallweise auch über den Markt an Interessierte, die nicht selbst aktiv mitwirken wollen. Diese intermediären Einrichtungen sind in der Regel über den Zeitverlauf relativ instabil. So kann eine autonome Kindergruppe, die auf eine AMSgeförderte Hilfskraft zurückgreifen kann und freie Kinderplätze auch an andere Eltern vergibt, wieder verschwinden, wenn die Kinder der ursprünglichen InitiatorInnen aus dem Kindergruppenalter herausgewachsen sind. Ihre Arbeit kann aber auch von anderen Eltern übernommen werden. Ebenso ist denkbar, dass die ursprünglichen InitiatorenInnen die Gruppe als Privatkindergarten weiterführen. Genauso vorstellbar ist jedoch, dass die Gemeinde diese Gruppe in ihre Obhut nimmt und diese innovative Pädagogik in ihr Regelinstrumentarium übernimmt. Andererseits kann die Kindergruppe nach dem Auslaufen staatlicher Subventionen aber auch wiederum zu einer rein auf Eigenarbeit und eigenes Geld aufgebauten Initiative der betroffenen Eltern werden. So kann sich die Einrichtung aus dem intermediären Raum durchaus wieder zu den Eckpunkten dieses Wohlfahrtsdreiecks bewegen, es beschreibt daher immer nur Momentaufnahmen, nicht aber historische Bewegungen. Viele Wege sind offen, hohe Dynamik ist gesichert. Die Organisationen des intermediären Raumes sind gerade wegen ihrer zeitlichen (und finanziellen) Instabilität aber oft Träger von Kritik und damit von sozialpolitischen Innovationen. Sie sind kritisch dem Staat gegenüber, weil sie dem von der Öffentlichen Hand angebotenen Modell (z.B. dem Gemeindekindergarten) ein eigenes pädagogisches Modell gegenüber stellen, aber auch, weil sie die geringen finanziellen Aufwendungen des Staates für Kinderbetreuung kritisieren. Sie sind kritisch gegenüber dem Markt, weil sie rein marktwirtschaftliche Vermittlung alternativer (pädagogischer) Konzepte ablehnen und sie sind kritisch gegenüber der Familienarbeit, weil sie der Überzeugung sind, dass gesellschaftlich wichtige Arbeit auch von der Gesellschaft zumindest mitfinanziert werden muss. Aus dieser dreifach kritischen Ausgangslage ergibt sich auch das besondere Innovationspotential der Einrichtungen („Projekte“) des intermediären Raumes. 5.1.4.2 Das Modell als Erklärung politischer Zuordnung von Sozialpolitik Das Wohlfahrtsdreieck eignet sich jedoch nicht nur als Erklärungsinstrument für vielfältige soziale Initiativen im intermediären Raum. Es kann auch als Modell zum besseren Verständnis der Verbindung sozialpolitischer Aktivitäten und ideologischer Bindung der AkteurInnen dienen. Denn es lassen sich die klassischen sozialpolitischen Wohlfahrtskonzepte und Ideologien (liberal, christlich-sozial, sozialdemokratisch /sozialistisch) bei einiger Vereinfachung im Wohlfahrtsdreieck verorten. So wird eine (freilich vereinfachte) ideologische Zuweisung sozialdemokratischer bzw. sozialistischer Ansätze genauso wie liberaler Wohlfahrtstheorien und den Grundlagen der christlichen Soziallehre zu den jeweiligen Polen ihres Ansatzes, dem Staat, dem Markt und der Eigenarbeit bzw. der Familie möglich. Diese vereinfachte Sichtweise hilft, die klassischen Wohlfahrtstheorien politisch zu verorten. Leittext März 2006 Seite 72 STAAT = Sozialistisch EIGENARBEIT = christlichsozial MARKT = liberal Abb. 10: Politische Zuweisung im Wohlfahrtsdreieck Diese vereinfachte Sichtweise hilft, die klassischen Wohlfahrtstheorien politisch zu verorten: Sozialistische Wohlfahrtstheorien Liberale Wohlfahrtstheorien Sozialismus Sozialdemokratie Kommunismus Wirtschaftsliberale kirchliche Soziallehre rechte Liberale katholische Sozialakademie Reagonomics christliche Volksparteien "Protestantische Ethik" nach Max Weber Gesellschaftshilfe über den Staat Sozialpolitik von "oben" Verantwortung des Staates Gesellschaftshilfe über den Markt Sozialpolitik von "innen" Selbstverantwortung der Individuen Wettbewerb der LeistungserbringerInnen Leistungskauf Verteilung über persönlichen Erfolg Gesellschaftshilfe durch Verzicht Sozialpolitik von "unten" – Subsidiarität – die jeweils kleinste Einheit soll helfen Familienbezug Freiwilligkeitsprinzip Verteilung über persönliche Opfer Selbsthilfe im Kollektiv = Genossenschaft Selbsthilfe durch wirtschaftlichen Erfolg Selbsthilfe in den kleinen Netzwerken Erwerbsbezogene Verteilungspolitik Sozialpolitik Äquivalententausch Politik der großen Einheiten Sachleistungsprinzip Verteilung über Erwerbsarbeit Leittext März 2006 Christlichsoziale Wohlfahrtstheorien als Armutspolitik Seite 73 Spätestens mit der Verlagerung sozialpolitischer Aktivitäten in den „intermediären Raum“ (in die „Fläche“ des Wohlfahrtsdreiecks) verliert diese klassische „politische“ Zuweisung von Sozialpolitik und ihren Ansätzen viel von ihrer Erklärungsmächtigkeit. Zumindest die Aktivitäten im intermediären Raum sind nach diesem Modell (und oft nach unserer klassischen politischen Lesart) nicht mehr eindeutig (partei-)politisch zuzuordnen. Allerdings eignet sich dieses Bild nicht, den „Dritten Sektor“ abzubilden, den Evers (1990:194) beschreibt als „Nicht Sektor, sondern intermediärer Bereich – Soziale Träger und Projekte als organisatorische Vermittler heterogener Ziele, Motive und Arbeitsformen.“. Es ist ein Abbild, welches die Innovationskraft im Sozialstaatsmodell deutlich machen kann, aber nichts über die Organisationsform und die verschiedene Arbeitsweise in den jeweiligen Teilen aussagt. So können intermediäre Arbeiten durchaus in Selbsthilfeform erfolgen, aber auch in Form einer Drittsektororganisation; Drittsektororganisationen (z.B. eine Wohnbaugenossenschaft) können sich wiederum auch auf der Linie zwischen „Staat“ und „Markt“ befinden. Die Abgrenzung zwischen den beiden Bildern wird deutlich, wenn wir unsere Begrifflichkeit vom Dritten Sektor entwickelt haben. Davor ist es jedoch noch notwendig, die drei Ebenen der sozialen Intervention (informell, intermediär, institutionell) einzuführen. 5.1.4.3 Sozialarbeit im Wohlfahrtsdreieck Sozialarbeit findet sich heute nach wie vor im staatlichen Bereich (also im Pol „Staat“ in unserem Wohlfahrtsdreieck), insbesondere bei Ländern und Kommunen, aber auch bei Sozialversicherungsträgern. Aber sie findet sich in immer größer werdendem Ausmaß auch in der „Fläche“ des Wohlfahrtsdreiecks, also im intermediären Raum und in geringem (aber wachsenden) Ausmaß auch am Pol „Markt“ des Wohlfahrtsdreiecks. Der bedeutendste, und zwar nicht nur mengenmäßig, sondern auch von seiner Innovationskraft her gesehen, Anteil der Sozialarbeit findet sich im intermediären Raum, erbracht, sowohl von großen (traditionellen wie neuen) Wohlfahrtsträgern wie auch von kleinen Organisationen. 5.1.5 Die drei Ebenen solidarischer Unterstützung Von einem anderen Blickwinkel betrachtet können soziale Unterstützungsnetze in drei Stufen verstanden werden (vgl. Hovorka et.al 1996:29ff): Informelle oder primäre Netzwerke – sie sind gering und ohne umfassende formale Festlegungen organisiert. Neben dem Haushalt als der kleinsten überindividuellen Unterstützungseinheit sind dies die Familie und in größerer Distanz FreundInnen, NachbarInnen und ArbeitskollegInnen. Intermediäre oder sekundäre Netzwerke – sie sind mehr oder weniger organisierte Vereinigungen, die in Selbsthilfe, freiwilliger Laienhilfe/ehrenamtliche Hilfe und/oder durch formell Beschäftigte in Einrichtungen der freien Wohlfahrt Hilfe und Unterstützung anbieten. Formelle Einrichtungen (Institutionen) oder gesellschaftlich (staatlich) organisiert, Leittext März 2006 tertiäre es Netzwerke handelt – sie sich sind um Seite 74 Unterstützungseinrichtungen auf gesetzlicher Basis (Trägerschaft durch den Bund, die Sozialversicherungsträger, die Länder oder Gemeinden) oder um über den Markt organisierte LeistungserbringerInnen mit einer relativ bürokratisch-strukturierten Organisationsform (z.B. Privatversicherungen). Auf allen drei Ebenen findet soziale Unterstützung statt, die jedoch oft nur unzureichend aufeinander abgestimmt ist bzw. die Abstimmung der verschiedenen Angebote durch den/die HilfeempfängerIn (oder seine/ihre) Familie selbst einfordert. 5.1.5.1 Die primäre (informelle) Ebene Hier gilt es vor allem, einem Missverständnis vorzubeugen – Der Anstieg von Anforderungen und Erwartungen an die Familie sei vor allem quantitativ, nicht qualitativ. Denn qualitativ waren Familien immer der Raum, wo Menschen in Krankheit und Not Zuwendung und Fürsorge erhalten haben, entweder im Haushalt oder während stationärer Pflege in Spital oder Heim. Neu ist jedoch der Umfang dieser Anforderungen. Immer mehr Personen erlangen ein immer höheres Alter, aber leben deutlich länger mit ihren Krankheiten, damit auch mit ihrem Bedarf an Fürsorglichkeit. Gleichzeitig wünscht die Mehrheit der Menschen, so lange es geht zu Hause gepflegt zu werden oder Angehörige zu pflegen. Um zu klären, ob und wie weit Familien heute in der Lage sind, diese Aufgabe auch zu bewältigen, ist es nötig, den Familienbegriff zu differenzieren (vgl. Schmid 1997:3ff) und drei Formen der Begrifflichkeit von Familie zu unterscheiden: Die Haushaltsfamilie als die „Kernfamilie“ im klassischen Sinn. Sie besteht aus den im gleichen Haushalt zusammenlebenden Angehörigen; hier leben in der Regel zwei, seltener drei Generationen zusammen; mit steigendem Anteil alter Menschen und einer zunehmenden Zahl von Menschen, die (noch) kinderlos zusammenleben, nimmt aber auch die Zahl von Haushaltsfamilien zu, in denen nur eine Generation lebt. Abgrenzungsprobleme erwachsen bereits dort, wo mehrere Generationen zwar in einem Haus, aber in verschiedenen Haushalten leben. Die Rechtsfamilie als die Gruppe jener Menschen, die in einem durch das Familienrecht definierten Verwandtschaftsverhältnis mit den daraus abgeleiteten Fürsorglichkeitspflichten stehen. Die Rechtsfamilie ist im Gegensatz zu den anderen beiden Gruppen durch rechtliche und biologische Verhältnisse definiert, nicht aber durch Beziehung. Die Beziehungsfamilie schließlich als jene Gruppe von verwandten und einander sonst nahe stehenden Personen, die unabhängig von der räumlichen Nähe ihrer Lebensverhältnisse durch vielfache und in der Regel stabile Bande der Beziehung, der Zuneigung und der Freundschaft verbunden sind. Aber es hieße, „Fürsorglichkeit“ der Familien insgesamt zu idealisieren und zu verklären, wenn nicht hinzu zugefügt würde: Heute und nach wie vor wird der überwiegende Teil der Fürsorglichkeitsarbeit durch Frauen erbracht. Dies gilt für die Kindererziehung, für einen Großteil der Beziehungsarbeit in den Familien, für den überwiegenden Teil der Leittext März 2006 Seite 75 Haushaltsarbeit, aber eben auch für Pflege und Sorge für Andere: fast 80% der Betreuungspersonen von PflegegeldbezieherInnen sind Frauen, etwa ein Drittel älter als 60 Jahre (vgl. z.B. Badelt et.al. 1997:109ff). 5.1.5.2 Die sekundäre (intermediäre) Ebene Damit Familien ihren – weit gehend selbst gestellten – Fürsorglichkeitsaufgaben gerecht werden können, bedürfen sie vielfältiger Unterstützung. Hier kommt der Hilfe aus dem intermediären Raum (aus dem „Inneren“ des oben beschriebenen „Wohlfahrtsdreiecks“) große Bedeutung zu – einerseits zur Abdeckung von Hilfe und Fürsorglichkeit an jene Personen, die sonst keine Hilfe erhalten und andererseits zur Unterstützung und Entlastung der familiären Unterstützungsstrukturen. Familienentlastende intermediäre Einrichtungen nehmen einen zentralen Raum ein, wenn es darum geht, familiäre Hilfsstrukturen zu erhalten und zu stabilisieren. Strukturen im intermediären Raum sind so umfangreich wie vielfältig. Die Bandbreite erstreckt sich von Selbsthilfegruppen über kleine, lokal organisierte Vereine bis zu den großen Wohlfahrtsträgern, den landesweit organisierten Beratungsstellen und den Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialsprengel. Ihre Aufgaben liegen in subsidiärer Hilfe, Familienentlastung, Beratung, Mobilisierung, Betreuung, etc. Ohne intermediäre Einrichtungen und den vielen Menschen, die hier hauptberuflich oder ehrenamtlich in Hilfe und ihrer Organisation tätig sind, wäre der heutige Wohlfahrtsstaat nicht zu denken. Sie sind aber gleichzeitig Ort experimenteller Sozialpolitik. Hier wird erst ausprobiert und entwickelt, was in einigen Jahren zum Regelinstrumentarium öffentlicher Sozialpolitik werden könnte. Die AnbieterInnen intermediärer Leistungen im Sozialbereich lassen sich nach ihrer Angebotsstruktur in vier Bereiche gliedern: Einrichtungen mit einem breiten Angebot, das verschiedene Bedürfnisse alter und pflegebedürftiger Personen und ihrer Familien abzudecken versuchen. Ambulante soziale Dienste, die auf Dienstleistung im Bereich der Hauskrankenpflege und/oder der offenen Altenhilfe spezialisiert sind. Einrichtungen, die vorwiegend Veranstaltungen und Beratungen, aber Haushaltshilfen auf ehrenamtlicher Basis anbieten. Dazu gehören Selbsthilfegruppen. Soziale Dienste mit SeniorInnenreisen etc). spezifischen Einzelangeboten auch auch (Essenszustellungen, Selbsthilfe und Freiwilligenarbeit bilden einen wesentlichen Bestandteil der Hilfe und Unterstützung im intermediären Raum. Ohne die vielfältig organisierte ehrenamtliche Mitarbeit in den Trägern der intermediären sozialen Dienste kann das hohe Niveau der Hilfe für pflegebedürftigen Menschen und deren Familien kaum aufrechterhalten werden. Aber so vielfältig intermediäre Einrichtungen auch sind, so unbefriedigend kann die Tatsache sein, dass Fürsorglichkeitsstrukturen auf sie angewiesen sind. Denn intermediäre Einrichtungen sind in der Regel nicht flächendeckend und verfügen nur über ein eingeschränktes Leistungsangebot. Ihre Träger sind, sowohl örtlich wie von der Qualität und Qualifikation der Leittext März 2006 Seite 76 Leistungen, auf die Aktivitätsbereitschaft und Aktivitätsmöglichkeit der Menschen vor Ort angewiesen. Dadurch ergeben sich zwangsweise regionale Disparitäten in der Versorgung. 5.1.5.3 Die tertiäre (staatliche) Ebene Tragfähige Fürsorglichkeit im familiären Nahraum kann nur aufrechterhalten werden, wenn der Staat, und zwar sowohl Bund, Land und Gemeinden wie die gesetzlichen Sozialversicherungen ihren Aufgaben nachkommen. Diese bestehen vor allem in der Existenzsicherung, dem Schutz vor den Risken des Alters, der Krankheit und der Arbeitslosigkeit, aber auch der Regulierung sozialer Verhältnisse und der umfassenden Qualitätssicherung. Um die Fürsorglichkeitsfunktion der Familien und der intermediären Einrichtungen aufrechterhalten und entwickeln zu können, sind daher einige Rahmenbedingungen staatlicher Sozialpolitik unverzichtbar. Zu nennen wären insbesondere: Familienentlastende Dienste: Auf Grund der grundsätzlichen Bedeutungsverschiebung von der Haushaltsfamilie zur Beziehungsfamilie ist tragfähige Fürsorglichkeit auf stabile familienentlastende Dienste angewiesen, von der Unterstützung bei der Kinderbetreuung bis zur Altenpflege. Die heute oft gesetzte starre Alternative „nicht unterstützte Familienpflege oder Pflegeheim“ muss durch einen Fächer differenzierter und flexibler familienunterstützender und familienentlastender Dienste abgelöst werden. Dazu gehören Möglichkeiten der Kurzzeitpflege genauso wie soziale Dienste, die von Bedarf und Zeit flexibel sind, aber auch Angebote an Beratung, Supervision, psychologischer wie spiritueller Betreuung. All diese Angebote müssen von Preis, Erscheinungsweise und Kultur so gestaltet sein, dass sie von den Betroffenen und ihren Familien wirklich angenommen werden. Vernetzung: Notwendig ist nicht eine staatliche Gestaltung und Durchführung aller Hilfsangebote, unumgänglich ist jedoch eine öffentlich gesteuerte Vernetzung der Hilfe- und Fürsorglichkeitsstrukturen des informellen privaten Raums mit den Angeboten der intermediären wie der öffentlichen Strukturen (vgl. Hummel 1991). Notwendig für diese Vernetzung ist eine tragfähige Struktur der Information und Kommunikation. Sozial- und Gesundheitssprengel können diese Strukturen bilden, sind aber auf eine öffentliche, planende, strukturierende und regulierende SozialhilfeRaumordnungspolitik angewiesen. Diese muss unabhängig von ihrer formalen Gestaltung den inhaltlichen Anforderungen einer koordinierten und flächendeckenden Sozialpolitik gerecht werden. Demokratisierung: Menschen sind heute wie je bereit, ihren sozialen Verpflichtungen nachzukommen. Und sie beweisen es tagtäglich in vielfältigster Form. Aber sie erheben immer stärker den Anspruch, bei der lokalen und überregionalen Gestaltung der Hilfeleistungen mitzuwirken. Es empfiehlt sich daher, die lokalen Netzwerkstrukturen, etwa die Gesundheits- und Sozialsprengel, in geeigneter Form für die Mitgestaltung durch die Betroffenen weiter zu öffnen. Leittext März 2006 Seite 77 Absicherung: Schließlich können sich familiäre und intermediäre Fürsorglichkeitsstrukturen nur dann wirkungsvoll entfalten, wenn die notwendigen materiellen Absicherungen und staatlichen Regulierungen vorhanden sind. 5.2 Der „Dritte Sektor“ Die terminologische Festlegung „Dritter Sektor“ als Oberbegriff für alle Organisationen, die nicht dem privatwirtschaftlichen (erster Sektor) oder dem öffentlichen (zweiten) Sektor zuzuordnen sind, findet sich in der sozialwissenschaftlichen Literatur schon lange (vgl. Seibel 1990:181), zumindest aber seit den siebziger Jahren. In die breitere öffentliche Diskussion ist dieser Begriff spätestens seit den neunziger Jahren gekommen, als die EU-Kommission den Dritten Sektor als „die“ Arbeitsmarktreserve erkannt zu haben glaubte (vgl. z.B. Ciriec 2000). Dennoch ist der Dritte Sektor begrifflich noch nicht in wünschenswerter Klarheit von den beiden anderen Sektoren abgegrenzt. Insbesondere das Johns-Hopkins-Projekt (vgl. z.B. Schauer et.al. 1997; Anheier et.al. 1998; Salomon/Anheier 1999; Prüller/Zimmer 2001), welches in der internationalen Debatte relativ einflussreich auftritt, setzt den Dritten Sektor mit der Non-Profit-Welt gleich. Demgegenüber argumentieren Andere (z.B. Birkhölzer 2000; Anastasiadis et.al. 2003) mit einem deutlich differenzierteren Dritt-Sektor-Ansatz. 5.2.1 Unser28 Verständnis vom „Dritten Sektor“ In Abgrenzung zum Johns-Hopkins-Projekt kann eine Organisation nach folgenden Kriterien dem Dritten Sektor zugeordnet werden: 28 29 Das für den „Dritten Sektor“ zu enge Kriterium „nicht-gewinnorientiert“ wurde durch „nicht-gewinnmaximierend“ ersetzt. Allfällige Überschüsse müssen nicht in jedem Fall zur Gänze für den Unternehmenszweck verwendet werden, wie dies der NPOAnsatz fordert, sondern können auch an Mitglieder ausgeschüttet werden (kollektive Aneignung), wie dies etwa in Genossenschaften üblich ist. Die vom Johns Hopkins Projekt vorgeschlagene Beschränkung des Dritten Sektors auf den Non Profit Bereich würde wesentliche, für die Entwicklung sowie für das Verständnis des Sektors wichtige Organisationsformen wie etwa die Genossenschaften29 per Definitionen ausschließen. Ein weiteres Zugehörigkeitskriterium ist die „Nichtstaatlichkeit“, wodurch jene Organisationen nicht dem „Dritten Sektor“ angehören, die unabhängig von ihrer Organisationsform der Überprüfung des Rechnungshofes oder einer entsprechenden Einrichtung einer Gebietskörperschaft unterliegen. Das Prinzip der „Selbstverwaltung“ erfordert die juristische und organisatorische Eigenständigkeit von Organisationen des „Dritten Sektors“. Einer Organisation des „Dritten Sektors“ muss es beispielsweise möglich sein, sich selbst aufzulösen. Orientiert an Ergebnissen des EQUAL-Projektes der ersten Runde „Der Dritte Sektor in Wien“, vgl. Anastasiadis et.al. 2003 Die zum Beispiel in Italien (aber auch in Frankreich) den Dritten Sektor weit wesentlicher prägen als die Vereine Leittext März 2006 Seite 78 Die „Freiwilligkeit der Mitgliedschaft“ ist ein weiteres wesentliches Merkmal von „Dritt-Sektor“-Organisationen, die diesen Sektor von Körperschaften Öffentlichen Rechtes abgrenzt. Gleichwohl müssen Organisationen des Dritten Sektors keine Mitglieder aufweisen. Letztlich müssen Organisationen des „Dritten Sektors“ eine „institutionelle Realität“ aufweisen können, d.h. als juridische Personen existieren. Dazu zählen Organisationsformen wie Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Vereine, Stiftungen, Fonds etc. Die „Sozialwirtschaft“ ist in unserer Begrifflichkeit jener Teil des Dritten Sektors, der im Bereich des Sozialen, der Sozialpolitik und der Sozialarbeit tätig ist. Andere Bereiche des Dritten Sektors sind zum Beispiel der Sportbereich oder der Kulturbereich. Prinzipiell sind viele der Aussagen, die wir über den Dritten Sektor tätigen, für den gesamten Sektor gültig, aber auf Grund unserer Fokussierung auf Sozialarbeit und Sozialpolitik sind unsere Aussagen vor allem für diesen Bereich gültig und können möglicherweise im Sport- oder Kulturbereich des Dritten Sektors nur abgewandelt (modifiziert) zutreffen. 5.2.2 Arbeit mit Mission Das wesentliche Charakteristikum, welches den Dritten Sektor als Feld von informeller und formeller Arbeit von den beiden anderen Sektoren unterscheidet, ist, dass hier, wir30 haben es in Anlehnung an Seibel (2002) griffig auf den Punkt gebracht, „Arbeit mit Mission“ geleistet wird. Unter „Mission“ wird der innere Auftrag der handelnden Personen verstanden, also die Verfolgung von Zielen, die über das reine Erwerbsziel (wie es etwa für marktorientierte Organisationen typisch ist) hinausgeht. Das Verständnis der „Arbeit mit Mission“ in unserem Gebrauch unterscheidet sich also vom alltagssprachlichen Verständnis des Begriffes „Mission“, der stark mit Begriffen wie „Überzeugung“ oder „Bekehrung“ konnotiert wird. Aus Gesprächen mit den AkteurInnen des „Dritten Sektors“ in Wien31 (vgl. Anastasiadis et.al. 2003) wurde deutlich, dass Arbeit hier nicht zuletzt aufgrund des „Gemeinnützigkeitswertes“ als „sinnstiftend“ erlebt wird: „Da ist sicherlich Idealismus ein großes Motiv für etwas zu arbeiten, wo man glaubt, damit was bewegen zu können und wo nicht nur der Profit im Vordergrund steht, sondern auch die persönliche Verwirklichung“ (22:1732). Die Identifikation mit dem Tun, mit der Sache und der Organisation ist ein wesentliches Motiv, um im Dritten Sektor zu arbeiten. Damit verbunden ist auch eine höhere Bereitschaft der MitarbeiterInnen, insbesondere der Bezahlten, zugunsten der Erhaltung der innerbetrieblichen Solidarität, wie der Einrichtung insgesamt, auf in anderen Beschäftigungsbereichen selbstverständliche Standards zu verzichten. Dadurch verschwimmen die Grenzen zur ehrenamtlichen Tätigkeit. 30 Siehe Anastasiadis et.al. 2003 Im Zuge des EQUAL-Projektes der ersten Antragsrunde „Der Dritte Sektor in Wien“ 32 Diese Ziffern beziehen sich auf die im Zuge des genannten EQUAL-Projektes geführte Interviews, die erste Ziffer bezeichnet die fortlaufende Interviewnummer, die zweite die Seite des Transkripts; siehe auch Anastasiadis et.al. 2003 31 Leittext März 2006 Seite 79 Der Begriff „Mission“ macht diese Engagementbereitschaft im Kontext ökonomischer Handlungen deutlich. Seibel stellt fest, dass jede „Dritt-Sektor“-Organisation in einem Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und Mission steht. Im Glauben einer besonderen Zweckbestimmung zu folgen, werden kollektiv im Organisationskontext Ressourcen mobilisiert und gemäß dem ökonomischen Prinzip eingesetzt: „Entweder es wird mit einem Minimum von Mitteln ein festgesetztes Ergebnis erreicht, oder ein bestmögliches Ergebnis wird mit den verfügbar gegebenen Mitteln erreicht“ (Seibel 2002:15). Es lässt sich vermuten, dass diese Dimension der Arbeit im „Dritten Sektor“ eine wesentlich Stütze ist, die das Überleben vieler Organisationen und Initiativen ermöglicht. MitarbeiterInnen im „Dritten Sektor“ investieren in selbst finanzierte und selbst organisierte Zusatzausbildungen und nutzen diese Tätigkeit zur Persönlichkeitsentwicklung. AkteurInnen verzichten zudem oft auf arbeitsrechtlich geregelte Grundsätze, beispielsweise auf Entgelte für Überstunden oder konsumieren sie nur über Zeitausgleich (vgl. Anastasiadis et.al. 2003). In besonderen Fällen kommt es sogar zu Lohnverzichten, Privatkapitalinvestitionen und zur Aufnahme von Privatdarlehen der MitarbeiterInnen für die Organisation. Viele MitarbeiterInnen zeigen die Bereitschaft, aufgrund schlechter Arbeitsplatzressourcen gewisse Tätigkeiten in der Freizeit unter Einbringung privater Mittel zu verrichten. MitarbeiterInnen, deren Arbeitszeiten nicht abgegolten werden, leisten Innovationsbeiträge. Sie übernehmen Zusatzleistungen, die nicht zu ihrem Aufgabenbereich zählen, einfach weil kein/e andere/r da ist, der diese Arbeiten erledigt. Diese durchwegs als prekär zu bezeichnenden Überschreitungen fügen sich in so genannte „gentleman agreements“ (oder besser noch „gentlewomen agreements“) Neben schriftlichen Verträgen sind informelle Absprachen zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen im „Dritten Sektor“ gängig. Arbeitsrechtliche Spielräume eröffnen Möglichkeiten für individuelle Arrangements an der Nahtstelle zwischen voll entlohnter und (teilweise) unentgeltlicher Arbeit. Im Dritten Sektor ist offensichtlich aus einer Improvisationsnotwendigkeit eine Improvisationstugend erwachsen. Man stützt sich auf vorhandene Entgelt-Schemata und adaptiert diese für die eigenen Zwecke, auch wenn sie nicht immer für die tatsächlich ausgeübte Leistung passend sind. Ein weiteres zentrales Kennzeichen für die Qualität der Arbeit im „Dritten Sektor“ sind die flachen Hierarchien und ein weit gehender basisdemokratischer Umgang beziehungsweise die Nähe oder Zugehörigkeit zum „Pionier“/zur „Pionierin“ der Organisation (nach Glasl/Lievegoed 1993). Diese Merkmale zählen bei einigen befragten Organisationen in Wien zum internen Organisationsleitbild. Sie stehen für eigenverantwortliches Handeln, für Freiräume in der Durchführung, für soziale Kompetenz, aber auch für das Verschwimmen der Zuständigkeiten, der Aufgabenbereiche, für langwierige Entscheidungsprozesse, die schließlich in einem Kompromiss aufgehen. Im Arbeiten im Dritten Sektor versinnbildlicht sich das alternative Arbeitsverständnis: „Das ist nicht wie bei einem normalen Arbeitsplatz“ (25:7); „Wir arbeiten alle zusammen. Es ist ein gemeinsames Miteinander“ (26:9). Deutlich wird, dass aus einer eigentlich rechtlichen Beziehung eine emotionale erwächst, oder wie es Behrens nennt „das Angestelltenverhältnis wird als Beziehung oder Partnerschaft deklariert“ (2003:137), wobei die Emotionalität zu einem weiteren Mal ressourcenbildend respektive kompensierend wirkt. Leittext März 2006 Seite 80 Im ArbeitgeberInnen-ArbeitnehmerInnen-Gefüge des Dritten Sektors zeigen sich gegenseitige Abhängigkeiten, die sich insbesondere in der finanziellen Labilität der Organisationen gründen. Sind die MitarbeiterInnen hinsichtlich dieser doppelten Emotionalität: a) ihrer individuellen Liebe zur Sache, die im Dritten Sektor durch b) den kollektiven Rahmen gestützt wird – als besonders gefährdet zu bezeichnen oder bilden diese Charakteristika eine Stärke des Dritten Sektors ab, mit der es gelingt, zahlreiche Angebote aufrecht zu erhalten? Auch wenn diese Frage hier nicht beantwortet werden kann, lässt sich in diesem Zusammenhang durchwegs von einer „gefährlichen Stärke“ sprechen, die in dieser spezifischen „Arbeit mit Mission“ des Dritten Sektors begründet ist. Dieses Verhältnis ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung besonderer Strategien zur Absicherung und Entwicklung der Qualität der Arbeit im Dritten Sektor. Ob nun der Dritte Sektor ein Hoffnungsfeld für den Arbeitsmarkt der kommenden Jahrzehnte sein wird oder nicht, hängt ganz wesentlich von den Rahmenbedingungen und Ressourcen ab, innerhalb derer er sich entwickeln kann. Hier kann einerseits ein neues Feld pauperisierter, vor-kommodifizierter Arbeit entstehen, wobei das „Arbeiten mit Mission“ durchaus zur Falle für jene werden kann, die diese „Arbeit mit Mission“ auch dann ausführen wollen (subjektiv oft: müssen), wenn die dazu nötigen Ressourcen (Entlohnung, Arbeitsbedingungen etc.) nicht zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite bietet dieses „Arbeiten mit Mission“, also eine Arbeitsleistung, die nicht nur Tauschwert, sondern auch konkrete Gebrauchswerte produziert, die Möglichkeit neue Tätigkeitsfelder zu entwickeln, in denen weniger Entfremdung, mehr Mitbestimmung und ein Mehr an „nützlichen“ Produkten und Dienstleistungen besteht als im Sektor des Marktes und des Staates. Das allerdings quasi zum Nulltarif zu erhalten ist eine Illusion. Denn der Dritte Sektor ist nicht „billiger“, er ist anders. Markt Staat Dritter Sektor 5.2.3 Der „Dritte Sektor“ in der Vergabewelt Gerade die aktuelle Umstellung öffentlicher Beauftragung von der Förderpolitik zum Vergabewesen birgt für den Dritten Sektor große Chancen. Nikolaus Dimmel bezeichnet zwar in seiner Studie (2004) zur Vergabepraxis in Österreich die Vorgangsweise der öffentlichen Hand (Bundesländer und Landesverwaltungen) bezüglich Ausschreibungen als bisher sehr abwehrend. Es werden vielmehr eher Gründe für „Nichtausschreibungen“ dargelegt: soziale Dienste fallen nicht unter das Bundesvergaberecht, langfristige Verträge ersetzen die Ausschreibung, Förderungen beziehen sich ausschließlich auf Individual- oder Leittext März 2006 Seite 81 Subjektförderung etc. Bemerkenswert ist für ihn eine gewisse „Arkanpolitik“ der Bundesländer, wodurch Aussagen über die Vergabepraxis im Bereich sozialer Dienste nur schwer möglich sind. Auffallend ist für ihn auch eine mögliche Anwendung gegenüber „renitenten“ DienstleisterInnen. Die bisher eher zögerliche Anwendung mittels Vergabe hat eine große Ausnahme: „Das AMS hat als einziger Akteur im Feld der sozialen Dienste und Einrichtungen seine Förderpraxis gänzlich auf die Logik des BVergG umgestellt.“ (2004:9) Zu den Chancen für Dritt-Sektor-Organisationen durch Beauftragung durch Vergabe lässt sich sagen, dass sie dadurch aus der Kameralistik und dem von den Gesetzen der Budgetpragmatik bestimmten queren Logiken (keine überjährige Finanzierung, keine „Überförderung“, Verbot von Rücklagen, etc.) befreit wären und so von abhängigen „FörderempfängerInnen“ zu gleichwertigen VertragspartnerInnen würden. Allerdings besteht eine große Gefahr in einer öffentlichen Beauftragung durch das Vergaberecht dann, wenn diese nur auf den Mengen- und Preisaspekt achtet, nicht aber auf den Qualitätsaspekt. Denn im Wettkampf um Mengen und Preise kann der Dritte Sektor mit marktorientierten, zum Teil transnational operierenden und economics of scale optimal nutzenden, aber „Arbeit ohne Mission“ verkaufenden Betrieben nicht mithalten – oder nur, wenn er zwar nicht auf seine „Arbeit mit Mission“ verzichtet, aber deutlich „unterpreisig“ ins Rennen geht - und damit wiederum prekäre Beschäftigungsverhältnisse fördert oder festschreibt. Öffentliche Beauftragung, die den Dritten Sektor als Feld der „Arbeit mit Mission“, also als gesellschaftlich verantwortliches zivilgesellschaftliches Betätigungsfeld erhalten und ausbauen will, muss daher jene, im Vergaberecht durchaus möglichen und vom Europäischen Parlament auch (erst jüngst in einer Entschließung im Dezember 2003) geforderten auf Qualität basierende öffentliche Beauftragung entwickeln, die den Besonderheiten und Vorzügen des Dritten Sektors entgegen kommt. Vergaberichtlinien, die die spezifischen qualitätsbezogenen Leistungen, die „Arbeit mit Mission“ besser erbringen kann als „Arbeit ohne Mission“ stärker berücksichtigen als den Preis oder die Menge, müssen ausgebildet und in die gesamte öffentliche Beauftragung implementiert werden – trialogisch mit VertreterInnen des Dritten Sektors und der Sozialwissenschaft (Sozialarbeitswissenschaft). Dann, und wie wir meinen: nur dann, kann der Dritte Sektor nicht nur seinem Anspruch gerecht werden, gesellschaftlich verantwortliche Leistungen, also „Arbeit mit Mission“ zu erbringen, sondern auch eine attraktive Antwort auf die Krise am Arbeitsmarkt werden. Angesichts vorhandener Umbruchsituationen im öffentlichen Bereich, wie sie im Umschwenken von der Förder- zur Vergabepolitik symptomatisch werden (könnte), stellen sich nicht nur ideelle, sondern zudem auch materielle Herausforderungen an den Dritten Sektor in Wien, wobei die Förderung eines „autonomen“ Selbstbildes im Sinne eines SocialProfit-Unternehmens – wie es im Dritt-Sektor-Ansatz konstituiert ist – unterstützend sein kann (vgl. dazu Anastasiadis et a.l., 2003). Diesbezüglich bedarf es allerdings noch eines weiträumig angelegten Diskurses, um diese vorhandenen Potenziale zu kommunizieren. An dieser Stelle möchten wir auch auf die Heterogenität des Dritten Sektors verweisen. Gerade bei Entwicklungs- und Umsetzungsvorhaben zur Aufwertung und Stärkung des Dritten Sektors sind die jeweils unterschiedlichen organisationsinternen Hintergründen zu Leittext März 2006 Seite 82 berücksichtigen, denn seine Vielfalt ist eine Stärke, die es zu erhalten und zu unterstützen gilt – um ihn als „Beschäftigungsmotor der Zukunft“ nutzen zu können, ohne die Verarmung der hier Beschäftigten zu begünstigen. Daher ist die Identität des Dritten Sektors (also das wirtschaftliche Handeln, um ideelle Ziele zu erreichen) zu wahren und keine Vermarktlichung zu forcieren. Um ethisch begründete Diskurse für marktliche Verhältnisse realisierbar zu machen, bedarf es zusätzlich einer Vernetzungsstrategie zwischen Organisationen sowohl aus dem Ersten, dem Zweiten und dem „Dritten Sektor“ (vgl. Essl 2003). Nur so kann das implizite Potenzial des „Dritten Sektors“ entfaltet werden, können Beschäftigungs- und Leistungsreserven lukriert werden, die von Mitgliedern, MitarbeiterInnen und BürgerInnen als sinn- und qualitätsvolle Angebote erlebt und in Anspruch genommen werden können. 5.2.4 Widersprüchlichkeiten im Qualitätsdiskurs des Dritten Sektors Korrespondierend mit den Widerspruchsflächen, die sich aus dem „Doppelten Mandat“ der Sozialarbeit ergeben, finden sich im Qualitätsdiskurs der Sozialwirtschaft, insbesondere wenn sozialarbeiterische oder sozialpädagogische Themen im Vordergrund stehen, eine spezifische Form von Ambivalenzen, und zwar der Widersprüche im Normalisierungsdiskurs. Grob gesagt geht es darum, dass überall dort, wo „Normalisierung“ als Einfügen in vorherrschende gesellschaftliche Normen und „Integration“ als Anpassung in bestehende Zustände verstanden wird, im Gegenzug der Feuser’sche Diktus „Es ist normal, verschieden zu sein“ (Feuser, zitiert bei Humphreys/Müller 1996:68) bzw. der Anspruch an Integration, auch das „Recht auf Anderssein“ (Hovorka 2000:304) einzuschließen, lebendig wird. Es entsteht also das Widerspruchsfeld zwischen Normalisierung als Strategie und Selbstbestimmung und Mitbestimmung der Betroffenen. Für den Qualitätsdiskurs ist es wichtig, diese Widersprüchlichkeit, dieses Spannungsverhältnis zu erkennen, auch wenn nicht immer klare, „richtige“ Antworten erkennbar sind. Es geht um die Vermittlung zwischen: Einem als objektiven, von der Wissenschaft und Profession ermittelten „Wohl der Betroffenen“, dem selbst bestimmten Interesse derer, für die gearbeitet wird und dem Qualitätsdiskurs, der sich auf Prozess wie Ergebnis, also auf die Qualität der Leistungen, die Qualität der Arbeit der für die Erbringung dieser Leistungen Beschäftigten und der Qualität der jeweiligen Leitung bezieht. Diese Widersprüchlichkeit lässt sich in folgendem „Widerspruchsdreieck“ darstellen: Leittext März 2006 Seite 83 Wohl der Betroffenen objektives Wohl fremdbestimmt Selbstbestimmt nichts für uns ohne uns es ist normal, verschieden zu sein Qualität 1 2 3 der Leistungen der Arbeit der Leitung Abb. 11: Widerspruchsdreieck Gerade wo „Arbeit mit Mission“ im Spiel ist, also im „Dritten Sektor“ kommt es häufig zu Konflikten zwischen der in der „Mission“ vorhandenen Fremdbestimmung des Wohles der Zielpersonen, ihrer eigenen Selbstbestimmung und der dreifachen Arbeitsqualität. Dies ist z.B. im Diskurs über die „totale Institution“ (vgl. Goffman 1973, Basaglia 1971, Schmid 2005) zu verfolgen. Dies soll nun ausführlicher dargestellt werden. 5.2.4.1 Exkurs: Die Totale Institution – Qualität im Spannungsfeld Eine besondere Rolle im sozialarbeiterischen und sozialpolitischen Diskurs ist der „Totalen Institution“ zugeordnet, also jener Zwangseinrichtung oder mit Zwang ausgestatteten Maßnahme, die einer dialogischen Entwicklung des Veränderungsprozesses durch interventionsgebene und interventionsempfangende Person keine Chance lässt. Die Theorie der Totalen Institution soll hier dargestellt werden, da wir es in vielen sozialen Einrichtungen auch heute noch mit, zumindest teilweise Totalen Institutionen zu tun haben und diese Seite der Sozialeinrichtungen auch für den Qualitätsdiskurs relevant ist. „Durch die sonderpädagogisch begründete Absonderung leben Behinderte und Nichtbehinderte gerade im Abschnitt der frühkindlichen Sozialisation in eigenen Welten. Sie gehen in verschiedene Schulen. In ihrer ‚Normalität’ kommt das jeweils andere nicht vor“ (Gerhardt 1990, zitiert bei Lingenauber 2003:21). Aus Sicht derer, die diese Ausgrenzung betreiben und befürworten, wird sie nicht unter dem Blickwinkel der verletzten demokratischen Rechte der Ausgegrenzten gesehen, sondern als (vermeintlich) „Gutes“ für die von ihnen betreuten Menschen. Denn „für behinderte Menschen werde gerade durch Aussonderung das ‚Menschenmöglichste’ und ‚Beste’ getan. Was insofern sogar richtig ist, weil und insofern HelferInnen sich als humanitäre Anwälte der Isolierten bestimmen und sich zusprechen, deren Bedürfnisse ungeprüft selbst festlegen zu dürfen“ (Reichmann-Rohr, 1999:34). Hilfe wird hier als Hilfe durch die Institution definiert, einer Institution, die sich als Teil der (Sonder-)Pädagogik und der Medizin begreift. Gesellschaftliche Probleme, nämlich die Probleme, die sich aus dem Erleben des Ausgegrenzt-Werdens ergeben, werden dadurch Leittext März 2006 Seite 84 pädagogisiert und medizinalisiert: Gesellschaftliche Probleme der Ausgrenzung werden auf individuelle Probleme der Ausgegrenzten reduziert, der Kampf gegen gesellschaftliche Ausgrenzung wird so zum individualisierten Ringen um (etwas weniger) Ausgrenzung im Einzelfall. Was bleibt ist die Fremdbestimmtheit der Betroffenen. Fremd bestimmte, also von den Institutionen sozialer Politik und Kontrolle entwickelte, Strukturen der ambulanten Unterstützung können jedoch die Chronifizierung der Abhängigkeit gegenüber der chronischen Abhängigkeit in der Totalen Institution (Anstalt, Heim) nicht aufheben, nur mildern. „Das Problem der Chronifizierung in den die Anstalt kennzeichnenden Formen der typisierten und irreversiblen Langzeitunterbringung kann durch die Praxis der Kurzzeitbehandlung und damit eines raschen turnover der Dienste vermieden oder doch reduziert werden. Die Irreversibilität lebt als solche für eine begrenzte Gruppe von Personen fort (Alte und erheblich Behinderte) und die Chronifizierung im Sinne einer ständigen Abhängigkeit von den Diensten breitet sich in Form von deren wiederholter und periodischer Inanspruchnahme aus. Auf diese Weise bildet sich im Umfeld der Dienste ein Bereich einer ’sanften Chronifizierung’, in der die Beziehung zum sozialen Umfeld über eine prekäre und partielle Arbeitstätigkeit und ein eigenes Sozialisationsfeld aufrecht erhalten bleiben, die beide über die Inanspruchnahme des Dienstes gestützt und kontrolliert werden“ (Basaglia/Giannichedda, 1980:34). Die Totale Institution wird somit per se zum Hemmnis für Integration in die Gesellschaft, verunmöglicht jede „Normalisierungsstrategie“, denn wenn „der Aufenthalt der Insassen lange andauert, kann das eintreten, was ‚Diskulturation’ genannt wurde – d.h. ein VerlernProzess, der den Betreffenden zeitweilig unfähig macht, mit bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt fertig zu werden, wenn und falls er hinaus gelangt.“ (Goffman, 1973:24). Spätestens an diesem Punkt betont die Totale Institution (ihr Stab), wie wichtig der weitere („beschützende“) Aufenthalt des Insassen in der Totalen Institution ist – wohl zu seinem Schutz und Besten. So reproduziert sich die Totale Institution selbst, in dem sie beständig ihre – scheinbare - Notwendigkeit reproduziert. Dabei spielt die Konstruktion von Wirklichkeit durch Sprache eine bedeutende Rolle. „Wesentlich beteiligt an der Dynamik des Behinderungsprozesses ist die Benennung, Bezeichnung, Etikettierung (‚Labeling’) behinderter Menschen nach ihrer jeweiligen Normabweichung (z.B. ‚der Blinde’), mit der eine defizitorientierte, reduzierende Wahrnehmung ihrer Individualität und entsprechende Attribuierung einhergehen. Die Normativität dieses Eingriffes, der zunächst bloß deskriptiv segregierend erscheint, wird in ihrer vollen Bedeutung erst transparent, wenn auch ihre pragmatisch-imperativen Bedeutungsanteile beleuchtet werden, also die mit der Attribuierung der jeweiligen Normabweichung einhergehenden oder erzeugten Bewertung, Emotionen, Verhaltensweisen und ihre Auswirkungen auf das Leben behinderter Menschen im Spannungsfeld zwischen Integration und Ausgrenzung“ (Humphreys/Müller, 1996:63). Das bisher gesagte lässt folgende These als zulässigen Ansatz erscheinen: Wenn man denen, in deren Interesse die Institution zu handeln vorgibt, eine Stimme gibt zur (Mit)Entscheidung über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, dann findet die Totale Institution keinen institutionellen Halt mehr. Denn „die Arbeit der bekannten Sondereinrichtungen Leittext März 2006 Seite 85 geschieht auf normativer Basis. In Sonderschulen, -wohneinrichtungen, -werkstätten usw. wird eine nach ‚besonderen’ Normen hergestellte Umwelt angeboten, die den Bedürfnissen der behinderten Benutzer angepasst sein soll. Solche ‚’Sonderumwelten’ versuchen, die Probleme des Umgangs mit der ‚normalen’ Umwelt zu vermeiden, in dem sie z.B. physisch angepasst sind, über Fachwissen verfügen und einen Schutz vor den negativen Reaktionen der ‚Normalen’ anbieten. Manche Schutzbedürftigen schätzen diese Eigenschaften. Andere dagegen fühlen sich durch solche Sondereinrichtungen ausgegrenzt und entwertet, vor allem, wenn sie für andere, nicht behinderungsbezogene, von nichtbehinderten Menschen bestimmte Sozialnormen gelten sollen (z.B. Sex-Verbot für HeimbewohnerInnen, niedrige Löhne für WerkstattmitarbeiterInnen). Der Meinungskonflikt über Sondereinrichtungen bezieht sich also auf Normen – sowohl auf Normprioritäten als auch auf die Anwendung sozialer Normen“ (Humphreys/Müller, 1996:67) 5.2.4.2 Integration und Normalisierung als Antwort auf die Totale Institution Was in der Totalen Institution bleibt, ist die Einpassungsstrategie an Stelle von Integration und die Unterwerfung der Insassen unter fremde Expertise. Hilfe kommt nach wie vor von „oben“ und von „außen“, nicht aber aus den Wünschen und dem Verlangen der betroffenen Menschen – unabhängig vom Willen der handelnden (helfenden) Personen muss dieser funktionelle Zusammenhang im Zentrum stehen, wenn von den segregierenden Einrichtungen der Behindertenhilfe die Rede ist. „Die Umwertung der separativen Rehabilitation von einer zu begründenden Ausnahme zur selbstverständlichen Regel lässt die Gefahr erkennen, die in jeder institutionellen Aussonderung von Diskriminierten liegt. Sie fördert die Vorstellung, es gebe vollwertige und minderwertige Menschen; diese Vorstellung aber engt die Definition des Menschlichen ein.“ (Schönberger, 1999:85, Hervorhebungen im Original). Nimmt man jedoch die umfassende, nicht aussondernde Definition des Menschlichen ernst, ergibt sich als ethische Konsequenz die Überwindung der segregierenden Einrichtungen und eine Integrationspolitik, die sich an einer „Normalität“ orientiert, in der es normal ist, anders zu sein. Das bedeutet eine Kritik an jenem alten sonderpädagogischen „Normalitätsbegriff“, der unter „Normalisierung“ die Anpassung abweichender Verhalten oder Zustände an eine – wie auch immer definierte – gesellschaftliche Norm versteht. „Ich meine also, das Bewusstsein davon, was unter uns ‚normal’ ist, ist der eigentliche Grund für die Ausgrenzung der Behinderten. (…) Wir müssen also unser Bewusstsein von der ‚Normalität’ ändern. Der Begriff muss so ausgeweitet werden, dass er künftig auch die Behinderten als normale Menschen mit umfasst“ (Bärsch, 1988, zitiert bei Lingenauber, 2003:22). Wenn aber als „normal“ nur mehr verstanden wird, dass es normal ist, verschieden zu sein, kann Integration funktionieren und dann werden auch Totale Institutionen nicht mehr notwendig sein. Denn „Sonderinstitutionen und –Maßnahmen jeglicher Art sind, entgegen der Behauptungen mancher Befürworter, keine Vorstufen der Integration. Nur die Integration als solche ist Integration; daher ist Integration vollinhaltlich die Negierung der Sonderinstitutionen bzw. -maßnahmen.“ (Jeff Bernard, 1989, zitiert bei Österwitz, 1996:199) Die „’Einkreisung’ helfende Absichten und Handlungen durch Funktionen und Strukturen Leittext März 2006 Seite 86 ausgrenzender Einrichtungen bringt ein Regelwerk hervor, dass maßgeblich in Herrschaftsausübung besteht, wie feinsinnig und hilfsbereit sich diese immer auch darstellen mag.“ (Reichmann-Rohr, 1999:34) Dieser Integrationsansatz erfordert sowohl eine Arbeit mit der KlientIn mit den Elementen Pädagogischer Ansatz, Problemlösung, Empowerment als auch eine Arbeit im Gemeinwesen mit den Elementen Definition von relevanten Umwelten, Empowerment dieser Umwelten und Veränderung von Rahmenbedingungen, wo dies nötig ist. Dieser Integrationsansatz ist ein gesellschaftspolitischer Ansatz mit einem Gemeinwesen- und Veränderungsbezug. Das bedeutet, Integration in dem hier entwickelten Verständnis ist politisch (aber nicht zwangsweise parteipolitisch). Sie erfordert permanente Auseinandersetzung mit dem „Doppelten Mandat“ der Sozialarbeit. Auch die Auseinandersetzung um Integration und ihre Durchsetzung als gesellschaftliche Strategie kann nur im gesellschaftlichen Raum geführt werden und benötigt ein diskursives Klima. Sie muss KlientInnen, Angehörige, Gesellschaft und Sozialarbeit gemeinsam fokussieren und in diesen Diskurs einbeziehen und erfordert Ressourcen wie Supervision, Reflexion und Coaching. Unverzichtbare Prinzipien so verstandener Integration sind in dieser Sicht: Integration ist unteilbar, bezieht sich also auf alle Defizite und Ausgrenzungsmomente; Integration kann sich daher nicht „aussuchen“, wen sie integrieren will und wen nicht. Integration ist diskursorientiert, sie entwickelt sich im wechselseitigen, respektvollen Dialog der Beteiligten. Integration ist KlientInnenfokussiert, sie stellt die wahrgenommenen oder wahrnehmbaren Interessen in das Zentrum ihres Handelns und nicht ohne KlientInnenbezug entwickelte Expertisen Nichtbetroffener. Integration ist ganzheitlich und spricht alle Probleme an, die gesellschaftlicher Inklusion entgegenstehen. Integration respektiert die ExpertInnenschaft der KlientInnen und nimmt ihre Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie die von ihnen entwickelten Lösungsansätze. Integration beinhaltet das „Recht auf Anderssein“ als unverzichtbaren Bestandteil ihrer Strategie und orientiert daher nicht auf Assimilation, sondern auf Überwindung der Ausgrenzungen der „abweichenden Mehrheit“ nach Basaglia. Das schließt eine Professionalisierung der Durchsetzungsstrategien mit ein, dabei ist eine Überwindung rein betriebswirtschaftlicher Ansätze nötig (neben dem heute dominierenden Effizienzprinzip müssen Kriterien der Effektivität und qualitative Erfolgskriterien gleichwertig werden). Ein gesellschaftspolitischer Focus ist Grundlage der Entwicklung von Integrationsstrategien. Die Entwicklung von Integrations-Strategien erfordert professionelle Ethik, sie darf aber nicht auf der Moral der AkteurInnen aufbauen, sondern auf ihren Interessen. Die Subjekte der Veränderung sind von diesen selbst zu definieren, es gibt keine (etwa gar zu instrumentalisierenden) Objekte der Veränderungen. Die subjektiven Interessen Leittext März 2006 Seite 87 der Beteiligten sind daher zu respektieren, auch wenn sie dem von „oben“ entwickelten Professionalitätsverständnis entgegenstehen. Interessenskonflikte sind deutlich zu machen. Dieser Integrationsansatz, zuerst gelebt in der italienischen gemeindenahen Psychiatrie der siebziger Jahre kann bezeichnet werden als „Rückgabe ihrer Widersprüche an die Gemeinschaft“ (vgl. Simons, 1980:16). Integration erfordert die Anerkennung der Unterschiede, die unterscheiden, und sie verlangt Unterscheidung – eine Unterscheidung allerdings, die nicht ausgrenzend, sondern inklusiv ist. Denn „’jeder Mensch ist einzigartig und unverwechselbar. Daher ist es normal, verschieden zu sein’. ‚Vom Recht auf Anderssein’ ist mit den Disziplinen zu sprechen, um jene andere Sichtweise einzuleiten, die die Vorrangigkeit des defektologisch-defizitären von Menschsein aufgegeben hat.“ (Krebs, 1996:53). Daraus ergibt sich als Alternative zur Totalen Institution ein tatsächlich gelebtes Recht des/der Betroffenen auf eine seinen/ihren Bedürfnissen angemessenen Versorgung, also Wahlfreiheit für die Betroffenen und Zur-Verfügung-Stellung jener Infrastruktur, die diese Wahlfreiheit einlösbar macht als Aufgabe an die politische Verwaltung. Selbstbestimmbares Leben erfordert genauso die notwendigen öffentlichen Leistungen, etwa um eine persönliche Assistenz im erforderlichen Ausmaß tatsächlich auch zahlen zu können, wie es ein umfassendes Netz zivilgesellschaftlicher Institutionen, wie etwa Selbsthilfe-Initiativen, Peer Counselling und Peer Support sowie allgemein Einrichtungen des „Dritten Sektors“ nötig hat. Das Problem und die Grenze des hier entwickelten und in Abgrenzung von der Totalen Institution verstandenen Integrationsbegriffes liegt daher im System Gesellschaft selbst, nämlich darin, wie weit die Gesellschaft und ihre Politik zu gehen bereit ist, welche Ressourcen sie dieser Integration zur Verfügung stellen möchte – Ressourcen, die dann anderen gesellschaftlichen Zielen nicht mehr zur Verfügung stehen. In dem hier etwas ausführlicher33 dargestellten Spannungsverhältnis um die Totale Institution (die über den engen Wirkungskreis in Psychiatrie und Behindertenbetreuung hinaus durchaus als Metapher für viele Bereiche der Sozialarbeit gelten kann) geht es auch um das Spannungsverhältnis jener, die innerhalb der Totalen Institution ihre Qualität entfalten und jenen, deren Qualitätsanspruch sich in Abgrenzung, oft Konfrontation mit der Totalen Institution entwickelt. Allerdings wäre es zu einfach, der Totalen Institution immer nur schlechte Qualität und dem selbst bestimmten Leben immer nur gute Qualität zuzuweisen. Denn das Doppelte Mandat der Sozialarbeit erfordert, in dem Spannungsverhältnis von „innen“ und „außen“ immer beiden Seiten, dem „Innen“ oder der KlientInnenwelt genauso wie den Erfordernissen und Anforderungen des „Außen“, also der vielfältigen Umwelten in je spezifischer Weise gerecht zu werden. 33 Die Länge ist u.E. dadurch gerechtfertigt, dass es sich bei der Frage um die „Totale Institution“ um einen Kerndiskurs der Sozialarbeit handelt Leittext März 2006 Seite 88 5.2.4.3 Die drei Kontexte der Sozialarbeit im Qualitätsdiskurs Der Diskurs um Qualität in der Sozialen Arbeit muss jedoch noch um eine Dimension erweitert werden, um die der „Wirtschaftlichkeit“, die auch immer Ergebnis unterschiedlicher Interessen ist. Somit steht Qualität im Diskurs mit drei Anforderungen: Wirtschaftskontext Therapiekontext KundIn Qualität Doppeltes Mandat Politik Zwangskontext Abb. 12: Sozialarbeit im Qualitätsdiskurs Zwischen dem Wirtschaftskontext (finanzielle Rahmenbedingungen, Input-Output-Verhältnis, Effizienz) und dem Therapiekontext (Fachlichkeit der Hilfe, Professionalität) stehen die KundInnen, was aber nicht automatisch (nur) die Zielpersonen der Sozialarbeit einschließen muss; KundInnen der Sozialarbeit sind, wie noch zu zeigen sein wird, auch jene öffentlichen und privaten Stellen, die Sozialarbeit beauftragen, in einem metaphorischen Sinn ist natürlich auch die Gesellschaft und die Sozialarbeitsprofession Kundin der Sozialarbeit. Zwischen dem Wirtschaftskontext und dem Zwangskontext (dem Kontext der Totalen Institution, der aber auch ein Fachlichkeitskontext sein kann) steht die Politik, die als Regulierungsinstrument entscheidet, in welchem Ausmaß, mit welchen Instrumenten und mit welchen Zielrichtungen Sozialarbeit tätig sein soll bzw. kann (Kontextbildung durch Gesetze, Anreize und Mittelzuweisungen). Zwischen dem Spannungsverhältnis, das durch den Therapiekontext und den Zwangskontext aufgespannt wird, steht schließlich das Doppelte Mandat der Sozialarbeit als professionelles Umgehen mit zwei – oft diametral entgegen gesetzten – Aufgabenfeldern bzw. Anforderungsbereichen. Der Qualitätsdiskurs in der Sozialarbeit, will er verwertbare Ergebnisse in Richtung Verbesserung von Qualität Sozialer Arbeit erbringen, muss daher die drei Leittext März 2006 Seite 89 Kontextbeziehungen: KundInnen, Politik und Doppeltes Mandat im Auge behalten und auf deren je spezifische Anforderungen adäquat reagieren. 5.3 Der Gerechtigkeitsdiskurs – das „Politische“ in der Sozialarbeit 5.4 Das „Politische“ in der Sozialarbeit Die Frage nach dem „politischen Mandat der Sozialarbeit34“ wird immer wieder (etwa bei Merten 2001) kontrovers diskutiert. „Hat Sozialarbeit in der Risikogesellschaft ein politisches Mandat und wenn ja, wer mandatiert sie?“, lautet hier die Leitfrage des Diskurses. Diese Fragestellung geht weit über die zeitgeistige Verortung des Neoliberalismus hinaus. Der Position von der fehlenden besonderen Verantwortung des Wissenschaftlers und der allgemeinen gesellschaftlichen (also letztendlich: politischen) Verantwortung Aller für die Geschicke des Zusammenlebens wird die These gegenüber gestellt, wer ein allgemeines politisches Mandat der Sozialarbeit leugne, mache sich bereits zum Handlanger des neoliberalen Zeitgeistes (vgl. Schneider 2001:28). Es geht in dieser Debatte um den Stellenwert politischer Mandatierung in einer demokratischen Gesellschaft. Mandate sind Handlungsvollmachten, die Frage ist, ob diese von einer bzw. an eine Profession verliehen sind oder ob politische Mandatierung das Ergebnis allgemeiner politischer Protzesse und (letztendlich) demokratischer Wahlen ist. Die besondere Stellung der Sozialarbeit am der Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und ihrer Opfer35 erfordert eine präzisere Beantwortung dieser Frage als im allgemeinen Diskurs um politische Verantwortung „der Wissenschaft“. Soziale Arbeit steht seit ihrer Entwicklung zur Profession und Disziplin in einem Spannungsverhältnis zwischen individueller Hilfe und kollektiver Gestaltung oder wie Mimi Abramovitz (zitiert bei Sünker 2001:73) schreibt: „Since its origins at the turn of the century, social work has strived to maximize human development, self-determination, and social justice and to minimize the conditions the conditions that limit these possibilities. At the same time, the profession faced strong pressures to promote individual adjustment and to protect the status quo. The tension between containment and change cannot be avoided because it flows from social work’s structural role as mediator of individual and systemic needs that often conflict.” Wenn Sozialarbeit als Vermittlungsinstanz zwischen Individuum und Gesellschaft verstanden wird, so gilt: „Die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse ist gleichwohl ein unverzichtbarer Bestandteil der Selbstreflexion Sozialer Arbeit, mit dem sich ihre gesellschaftlichen Perspektiven allererst begründen lassen.“ (Schaarschuch 2000:165) Die Frage ist, ob sich aus dieser Selbstreflexion ihrer gesellschaftlichen Perspektiven ein allgemein verbindliches 34 Die folgenden Überlegungen folgen vor allem Schmid 2004 in einem systemischen Gesellschaftsbild können marginalisierte Menschen durchaus, wenn auch etwas vereinfachend, als „Opfer“ gesellschaftlicher Prozesse verstanden werden. 35 Leittext März 2006 Seite 90 politisches Mandat der Sozialarbeit als Profession und Disziplin im Sinne einer „Einmischungsstrategie“ ableiten lässt, wie dies immer wieder eingefordert wird (vgl. z.B. Krusche/Krüger 2001). „Zur Debatte dieser Frage ist es notwendig, die beiden Ebenen Sozialer Arbeit, ihr professioneller Auftrag und das politische Mandat, analytisch zu trennen. Unter dem professionellen Auftrag sozialer Arbeit verstehe ich vorerst einen (kompetent wahrgenommenen) Beitrag, um KlientInnen (a) zu ihren Rechten zu verhelfen und (b) KlientInnen zu befähigen, ihre Rechte selbständig wahrnehmen und durchsetzen zu können. Als politisches Mandat der Sozialen Arbeit kann daher vorerst verstanden werden, zu erkennen, welche KlientInnenrechte die ‚richtigen’ sind.“ (Schmid 2004:243). Voraussetzung für ein so verstandenes „politisches Mandat“ der Sozialarbeit ist die Schaffung (größerer) Unabhängigkeiten ihrer UserInnen in ihren Lebenszusammenhängen, um soziale Teilhabe (und das ist die materielle Bedingung der Stabilisierung und Gewährleistung und Gleichheit und Freiheit) zu schaffen, zu vergrößern oder abzusichern. Das Ziel, die UserInnen sozialer Arbeit zu befähigen, ihre Interessen (besser) selbst durchzusetzen, ist von der Idee gestützt, eine verbesserte subjektive Artikulationsfähigkeit verbessere jedenfalls die objektive Situation bzw. die Durchsetzungsfähigkeit der objektiven Interessen der KlientInnen. Für „politisch mandatierte“ BetreuerInnen dieser UserInnen ergibt sich jedoch ein Dilemma: Wenn sie UserInnen befähigen, ihre Rechte selbständig wahrnehmen und durchsetzen zu können, bestärken sie diese unter Umständen gleichzeitig darin, „objektiv falsche“ Ziele und Interessen36 durchsetzen zu können. Die Alternative wäre, KlientInnen in ihren Zielen und Wünschen nicht zu respektieren, da sie die „falschen“ sind. Doch ist es das Recht der Sozialarbeit im Einzelfall, also kontextgebunden, festzulegen, was „richtige“ Ziele sind und was nicht? Die Situation der UserInnen schlägt sich – wie könnte es auch anders sein – aber auch auf Situation und Position der betreuenden SozialarbeiterInnen durch, denn zum Beispiel „die Perspektivlosigkeit der Situation der AsylbewerberInnen in unserem Land bedingt die Perspektivlosigkeit der in diesem Bereich Tätigen, die, solange sie nicht auf den Begriff gebracht wird, dazu führt, dass viele von ihnen resignieren, d.h. im Wesentlichen nur noch mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt sind, die reale Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ihrer Arbeit verdrängen und jeden, der diese benennt, als Angreifer erleben. Konsequenzen sind die Individualisierung und Naturalisierung der Probleme, die deren Bagatellisierung einschließen. Die Unfähigkeit, über ihre Situation zu reden, besteht also nicht nur bei den Flüchtlingen, sondern auch bei den MitarbeiterInnen solcher Flüchtlingswohnheimen. Eine wesentliche Ursache hierfür liegt offensichtlich in der objektiven Überforderung, die dadurch gegeben ist, dass sie Hilfe unter Bedingungen leisten sollen, die auf die Abschreckung der Flüchtlinge zielen und somit die Hilfe weitgehend überflüssig machen.“ (Osterkamp 1990:151). Hier wird das Problem angesprochen, dass die subjektiv nicht immer (leicht) zu bewältigende Lösung des Konfliktes mehrerer widersprüchlicher Aufträge an die Soziale Arbeit, die Einlösung ihres politischen Anspruches 36 Zum Beispiel durch den Wunsch, weiter oder wieder in „falschen“ Lebensverhältnissen leben zu wollen Leittext März 2006 Seite 91 (so er überhaupt gegeben ist), erschweren bis verunmöglichen. Wenn die UserInnen sozialer Arbeit also dank ihrer Unsicherheit, was die „objektiv richtige“ Richtung ihres Auftrags angeht, als Mandatsgeber der Sozialen Arbeit ausscheiden, stellt sich die Frage: Von wem wurde dieses Mandat der Sozialarbeit dann erteilt? An wen wurde es erteilt? Mit welchem Inhalt wurde es erteilt? Wer genau ist mit jener „Sozialarbeit“ gemeint, die das politische Mandat ausfüllen sollen? Und wie sieht dieses Mandat inhaltlich aus? Die Kernfrage des Politischen in der Sozialarbeit scheint zu sein, welcher Imperativ formuliert wird. Auf Grundlage der Diskussion über das Politische in der Sozialarbeit sind drei unterschiedliche Imperative vorstellbar: „Verändere die Gesellschaft!“ (als Auftrag der Sozialen Arbeit an die KlientInnen) oder (als Auftrag der KlientInnen an die Sozialarbeit): „versetze Deine Mandanten in die Lage, die Gesellschaft zu verändern!“ beziehungsweise als (gesellschaftlicher?) Auftrag an die Sozialarbeit: „Verändere die Gesellschaft!“ Doch dieses scheinbare Problem der Wahl des „Imperativs der Sozialarbeit“ verdeckt die dahinter liegende Frage: In welche Richtung sollte die Gesellschaft denn verändert werden, wenn es ein „politisches Mandat“ gibt? Und: Wer weiß (bestimmt) das? Selbst wenn Politik als interessensgeleitetes Handeln außer Streit gestellt ist, wäre zu klären, um welche Interessen es geht. Und da bleibt das eigentliche Problem unbeantwortet, ja vielleicht sogar unbeantwortbar: Erzeugen objektive Interessen (so es diese überhaupt gibt) die „richtige“ subjektive Politik? Die Diskussion um das Politische Mandat der Sozialarbeit scheint diese Frage bloß von der Ebene der KlientInnen auf die der Sozialen Arbeit zu verschieben, denn wenn die KlientInnen die Fähigkeit nicht haben, ihre „richtigen“ Interessen „richtig“ in politisches Handeln zu transformieren, muss das dann wohl die Soziale Arbeit für sie übernehmen? Wer aber ist dann der Mandatsgeber? Dies scheint auch eine zentrale, aber oft übersehene Fragestellung für die Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit zu sein. Das eigentliche Problem der These von der Selbstmandatierung der Sozialarbeit durch die Sozialarbeit kann in folgender Frage zusammengefasst werden: Wenn Sozialarbeit dieses „richtige“ Bewusstsein (einzig) hat, welche Rolle ist dann der Politik zugedacht, den gewählten VolksvertreterInnen? Und welche Rolle ist der Verwaltung zugedacht, etwa den Sozialämtern? Haben sich politische RollenträgerInnen und VerwaltungsbeamtInnen dem „richtigen“ politischen Bewusstsein der Sozialarbeit zu beugen? Wenn die Kernfrage dieser Debatte also lautet: Wer gibt der Sozialen Arbeit welches politische Mandat? und die Antwort darauf die der Selbstmandatierung ist, stellen sich noch weitere Fragen: Ist Soziale Arbeit die einzige (soziale) Profession, die sich selbst mandatiert? Wer garantiert dann, dass dieses Mandat das „richtige“ ist? Und gibt es ein „objektiv richtiges“ (selbst gegebenes) politisches Mandat überhaupt? Und wie bereitet die Ausbildung zur Sozialarbeit auf diese Fragen vor? „Letztendlich liegt der These von der „Selbstmandatierung der Sozialen Arbeit“ ein ziemlich elitäres, wenn nicht gar autoritäres Gesellschaftsbild zugrunde, mit dem soziale Integration und gesellschaftlicher Ausgleich aber schwerlich umzusetzen wären. Wenn die Frage nach der Selbstmandatierung jedoch verworfen wird, kehrt unsere Debatte zu den Problemen des professionellen Auftrages Sozialer Arbeit zurück.“ (Schmid 2004:249). So wäre an der Stelle des Gedankens der selbstmandatierung der Sozialarbeit durch sich selbst der Gedanke eines professionellen Auftrages der Sozialarbeit zu denken. Aber auch die Umsetzung des Leittext März 2006 Seite 92 professionellen Auftrages der Sozialen Arbeit ist eine politische – hier geht es vor allem um die Verteilung bzw. Reverteilung von Ressourcen: Für die UserInnen und ihre Bezugssysteme, für die Soziale Arbeit selbst und für jene Lebensverhältnisse, die das Entstehen bzw. Fortbestehen der Situationen, die Bedürfnisse nach Sozialarbeit schaffen, erschweren und verunmöglichen. Kampf um Ressourcen oder um „Qualität“ als Element des professionellen Auftrages ist politisch, aber nicht unbedingt gesellschaftsverändernd. Abhängig vom jeweils gewählten Ansatz kann auch erfolgreiche Auseinandersetzung um ein Mehr an Ressourcen bzw. ein Mehr an Qualität für die jeweiligen Bezugsgruppen (Stakeholder) der Sozialarbeit letztendlich auf die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse stabilisierend wirken. Umgekehrt, der Kampf um gesellschaftliche Ressourcen als Teil eines politischen Mandats sozialer Arbeit verstanden, hat sicher einen gesellschaftspolitischen Fokus. Aber er muss nicht unbedingt realpolitisch wirksam werden37. In der Erfüllung des professionellen Auftrages der Sozialarbeit stellt sich also beständig die Aufgabe, als eigentliches Ziel der Sozialarbeit die Stabilisierung ihrer NutzerInnen und/oder ihre gesellschaftliche Integration auszumachen, wobei der eigentliche Diskurs einer zwischen dem „und“ und dem „oder“ ist, also darüber, ob zwischen der Stabilisierung von Lebenslagen und der Integration durch Sozialarbeit ein unterschiedmachender Unterschied ist oder ob sie Beides vom Gleichen sind. Soziale Arbeit sieht sich mit einer Fülle unterschiedlicher impliziter und expliziter Aufträge konfrontiert, die einander überlagern und verstärken, aber auch widersprechen können, denn Soziale Arbeit ist nicht nur mit vielen Aufträgen, sondern auch mit zahlreichen Auftraggebern konfrontiert. Offensichtlich eignet sich jedoch keine/r davon so wirklich zum Mandatsgeber eines „politischen Mandats“ der Sozialen Arbeit. Aus diesem Blickwinkel führt ein Anspruch einer Selbstmandatierung Sozialer Arbeit letztendlich zu einer Privatisierung des Politischen, denn hier wird ein politisch auf gesellschaftlicher Ebene zu lösendes Problem als ein (privates) politisches Problem der Profession und ihrer einzelnen AkteurInnen privatisiert. Allerdings kann professionelles Herangehen an Probleme Sozialer Arbeit sehr oft eine Umdefinierung des Stabilisierungsauftrages in einen Integrationsauftrag erforderlich machen. Soziale Arbeit ist kontextgebunden und muss sich in verschiedenen Zusammenhängen bewegen und bewähren: in politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, geografischen und historischen und zwar doppelt - einerseits in der eigenen Berufsausübung und andererseits in der Ausübung der (auftragsbezogenen) Mandatschaft für ihre Zielgruppen. Soziale Arbeit ist daher, auch wenn sie als Profession und Disziplin kein „politisches Mandat“ mit sich trägt, mitnichten eine „unpolitische“ Profession und Disziplin. Aber diese Analyse darf nicht zum Fehlschluss verleiten, Soziale Arbeit sei an sich wertneutral und gesellschaftlich unabhängig in dem Sinn, dass sie über eine „richtige“ Methode verfüge, die für jeden Zweck gleich gut einsetzbar sei. Aber erst die Qualitätsdiskussion in der Sozialarbeit schafft jenen Standpunkt, von dem aus die „blinden Flecken“ der Debatte um den politischen Auftrag der Sozialarbeit erkannt und möglicherweise auch überwunden werden können. 37 siehe auch unsere Diskussionen zum „doppelten Mandat“ der Sozialarbeit in diesem Text Leittext März 2006 Seite 93 Sozialarbeit ist daher letztendlich politisch in ihren Ansätzen wie Auswirkungen, „because it deals either with consciousness or the allocation of resources, Because it is not possible to avoid politics in this respect, it is far better to address these issues explicitly than to pretend that they do not exist.” (Abramovitz, zitiert bei Sünker 2001:74). Diese politische Funktion gilt es zu erkennen, um daraus die eigene (politische) Position als SozialarbeiterIn bestimmen zu können – nicht aber, um ein “politisches Mandat” der Sozialarbeit abzuleiten. 5.5 Sozialarbeit im Spannungsverhältnis von Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit Aufgabe von Gemeinwesenarbeit ist Interventionen im Sozialraum zu initiieren und zu gestalten; sie wird mittlerweile auch als „Sozialraumorientierung“ beschrieben und als Arbeitsprinzip für Soziale Arbeit interpretiert (und weniger als klassische 3. Methode). Historisch finden sich unterschiedliche Stränge und Schwerpunktsetzungen von Gemeinwesenarbeit, z.B. eine wohlfahrtsstaatliche Ausrichtung, eine integrative, eine aggressive oder eine aktivierende (vgl. Hinte und Karas 1989). Seit Beginn der 90er Jahre werden Gemeinwesen mit Blick auf „Netzwerke“ betrachtet – Familien- und Freundeskreise, Netzwerke der Einrichtungen und ProfessionistInnen – und an einem Einbezug und einer Weiterentwicklung gearbeitet. Wichtige Prinzipien in der Gemeinwesenarbeit sind die partizipative Ausrichtung und dass von konkreten sozialen Problemen und Bedürfnissen auszugehen ist. Ziele sind u.a., möglichst viele Ressourcen zu mobilisieren und Bewusstseinsbildung zu erreichen. Gemeinwesenarbeit lässt sich als kollektiven "Problemlösungs-Erfindungsprozess" unter gesellschaftlich erschwerten, teilweise behindernden Bedingungen bezeichnen (StaubBernasconi, 1990). 5.5.1 Aufgaben in der Gemeinwesenarbeit Unterstützung von BürgerInnen und BürgerInnen-Initiativen Aktivierung/Mobilisierung und Förderung der Teilhabe und Partizipation Integration bzw. Wiedereingliederung insbesondere von benachteiligten Gruppen Förderung der Selbstorganisation und Selbstverwaltung Verbesserung der Lebensqualität im Gemeinwesen Unterstützung von Empowermentprozessen (Selbstermächtigung) Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit, Hörbar-machen der unterschiedlichen Anliegen Mitgestaltung und Unterstützung bei Umsetzung und Durchsetzung gesellschaftlicher Vorhaben Analyse der Ist-Situation im Gebiet und der AnsprechpartnerInnen Erarbeitung eines Problemaufrisses, (Projekt)Beschreibung Entwicklung von Lösungsmodellen und Innovationen Unterstützung bei der Strukturierung eines Projektes, Projektentwicklungsberatung Leittext März 2006 Seite 94 5.5.2 Unterschiede und Gemeinwesenarbeit Einzelfallhilfe Gemeinsamkeiten bei Gemeinsamkeiten Einzelfallhilfe und GWA fallspezifisch Fallunspezifisch Finanzierungsstruktur: Defizitfinanzierung Viele AkteurInnen Interventionsebenen und Bewusste Entscheidung wer im KlientInnensystem Empowerment und Ressourcenorientierung Integration Konfliktminderung Individuelles Handeln Kollektives Handeln Erhöhung der individuellen Handlungsfähigkeit Erhöhung der Partizipationsmöglichkeiten und Teilhabe Diese Tabelle orientiert sich an einem Skriptum von Marianne Rössler GWA ist die zusammenfassende Bezeichnung verschiedener, professioneller Sozialarbeit und anderer sozialer und planerischer Berufe Arbeitsformen GWA befasst sich mit als "problematisch" definierten, territorial-kategorial und/oder funktional , abgrenzbaren Bevölkerungsgruppen ausgehend von Problem-Betroffenen Bevölkerungsgruppen und deren Lösungspotentialen bezieht sich GWA auf einen geographisch-ökologisch abgrenzbaren Raum GWA ist ein Arbeitsprinzip sozialer Arbeit GWA leistet im Rahmen kommunaler, regionaler, und eventuell bezirksbezogener Sozialpolitik spezifische Ersatz-, Vorbereitungs- und Durchführungsfunktion Gerade die knapper werdenden Mittel für Sozialausgaben bringen für das Prinzip Gemeinwesenarbeit gewisse Chancen, da Hilfe und Entwicklung möglichst viele Menschen möglichst komprimiert und günstig erreichen soll. Marianne Rössler fasst dies z.B. derart zusammen: „Somit findet Gemeinwesenarbeit im Spannungsfeld zwischen Leittext März 2006 Seite 95 Leistungsanforderungen und Leistungsunwilligkeit des Staates statt. Dies ist mit ein Grund, warum Gemeinwesenarbeit und Partizipationsmodelle immer wichtiger werden und zunehmend - auch für bislang nicht erfasste Themen und Bereiche – und unter Einbeziehung unterschiedlichster AkteurInnen“ (2005:4). Peter Pantucek beschreibt das Verhältnis von Individualhilfe und Gemeinwesenarbeit derart: „Das scheinbare Gegensatzpaar von Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit hat engere Verbindungen, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Während sich Gemeinwesenarbeit dem Alltag von der Seite eines Ortes, dem Gemeinwesen, Grätzel, Stadtteil, Dorf, nähert, geht Individualhilfe (den einzelnen Menschen und sein Umfeld betreffend, Anm. des Verf.), vor allem in der Rekonstruktionsarbeit, verändernd in die Zusammenhänge des Gemeinwesens hinein.“ (Pantucek, 1998:270f). Die zwei genannten Methoden der Sozialarbeit (Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit), die ganz unterschiedliche Ausgangspunkte haben, treffen dort aufeinander, „wo sie auch gestaltend eingreifen“ und beeinflussen sich gegenseitig. Einzelfallhilfe => Gemeinwesenarbeit Gemeinwesenarbeit => Einzelfallhilfe Rekonstruktionsarbeit, Gestaltung des Alltags im Gemeinwesen Gemeinwesenarbeit kann Bedingungen des Lebensumfeldes verbessern und Für KlientInnen der Ressourcen mobilisieren Einzelfallhilfe Und weiter: „Oder, wie es Margarita Edler (1997, 54) formuliert: Die Einzelfallhilfe ist eine notwenige, jedoch keine hinreichende Bedingung für Gemeinwesenarbeit – und umgekehrt.“ (Pantucek, 1998:271). SozialarbeiterInnen die sich im Feld der Einzelfallhilfe betätigen gewinnen Informationen über „Detailaspekte des Gemeinwesens“ (Lokale Machtstrukturen, Netzwerke, Lebensräume etc. und können damit zu einer Verbesserung der strukturellen Alltagsbedingungen beitragen – und dies auch als Teil der „lebensweltorientierten Einzelfallstrategie“. Mit diesem Wissen können SozialarbeiterInnen „…Beiträge liefern, die im Rahmen von sozialpolitischen Einmischungsstrategien den zivilgesellschaftlichen Diskurs im Interesse von Personengruppen beeinflussen, die der Unterstützung bedürfen. Ziel dieser Strategie wäre es, den Alltag eines Gemeinwesens so umzugestalten, daß bestimmte Problemstellungen nicht mehr mit Strategien professioneller Individualhilfe bearbeitet werden müssen, sondern die nötigen Ressourcen bereits zum selbstverständlich vorhandenen Ressourcenrepertoire des Gemeinwesens mit alltäglicher Erreichbarkeit gehören“ (Pantucek, 1998:271). Gleichzeitig können aber auch KlientInnen der Einzelfallhilfe auch in der Gemeinwesenarbeit mitwirken z.B. an Tauschbörsen, Nachbarschaftshilfezentren etc. oder aber auch von der Einzelfallhilfe dorthin überwiesen werden. Leittext März 2006 Seite 96 5.6 Die „erfolgreich scheiternde“ Institution und ihre Stellung im Qualitätsdiskurs – der komplexe KundInnenbezug Organisationen des Dritten Sektors verfolgen oft eigenartige Steuerungs- und Kontrollwege, die sich dem Urteil marktwirtschaftlich geschulter Betriebswirtschaft mehr oder weniger entziehen. Das bedeutet nicht nur, dass marktwirtschaftlich entstandene Instrumente der Betriebswirtschaft und Qualitätssicherung in der Regel nicht ohne entsprechende Adaptionen in Organisationen des Dritten Sektors implementiert werden können, wie am Beispiel der „KundInnenzufriedenheit“ bereits an anderer Stelle in dieser Arbeit gezeigt wurde. Es bedeutet auch, dass Organisationen im Dritten Sektor manchmal (gemessen an den Kriterien der Marktökonomie) „versagen“ und trotzdem „überleben“. Seibel (1992:15) meint dazu: „Die hier zur Diskussion gestellte These lautet, dass Organisationen oder Arrangements von Organisationen im ‚Dritten Sektor’ zwischen Markt und Staat nicht trotz, sondern wegen ihres Versagens gegenüber den Maßstäben norm- und zweckrationaler Kontrolle überleben“ (Hervorhebung vom Autor). Dies hat mehrere Gründe, die ihre Wurzeln alle in der Tatsache haben, dass Organisationen im Dritten Sektor, wie gezeigt wurde, nicht nach der Logik G P G’, wobei G’ > G ist folgen, sondern es um die Maximierung von Zuständen (Z’ > Z)38 geht, die nicht oder nur bedingt in Geld auszudrücken sind. Wenn Organisationen ihr Ziel beispielsweise in der Veränderung sozialer Ziele haben, können „betriebswirtschaftlich unvernünftige“ Entscheidungen durchaus Sinn machen, indem die Mehrkosten (z.B. durch fair gehandelte Waren) durch ehrenamtliches Engagement oder durch Preise, die sich nicht am Markt orientieren, sondern einen „ideologischen Zuschlag“ einfordern, getragen werden. Auch Drittsektororganisationen im politischen Umfeld bzw. im Politischen Nahefeld können durchaus „ökonomisch unvernünftig“ handeln, wenn die dadurch entstehenden Mehrkosten politisch abgedeckt werden, indem zum Beispiel zur Schaffung höherer Qualität Leistungen angeboten werden, die weit über vergleichsweise Angebote am Markt hinausgehen (z.B. Unterbringung von obdachlosen Menschen in Einbettzimmern eines Wohnheimes, während sonst überall am Markt Vier- oder Mehrbettzimmer üblich sind). Schließlich gehören auch Organisationen, die ihr Ziel in ihrem Überflüssig-Werden sehen, zu den „erfolgreich scheiternden“ Organisationen. Dazu gehören zum Beispiel Gewaltschutzeinrichtungen oder Frauenhäuser, deren Ziel im Verschwinden von (familiärer) Gewalt und damit dem verschwinden ihrer Notwendigkeit liegen. Dabei handelt es sich nicht immer um ein utopisches Ziel, denn oft führt bereits die Existenz einer entsprechenden Einrichtung dazu, dass sich bedrohte Menschen weniger gefallen lassen und sich weniger abhängig fühlen, denn es gibt ja die Schutzeinrichtung. „Die betreffenden Organisationen“, so Seibel (1992:16) „“’überleben’ also in einer durch Norm- und Zweckrationalität geprägten Umwelt, obwohl sie sich gegenüber den Anforderungen nur bedingt responsiv verhalten. Sie ermöglichen die Stabilisierung von Steuerungs- und Kontrollversagen ohne selbst merklich an Stabilität einzubüßen.“ Seibel 38 Dazu ausführlicher im nächsten Kapitel Leittext März 2006 Seite 97 meint, dieses „partielle Organisationsversagen“ hat seinen speziellen Zweck in einer Gesellschaft, die durch partielles versagen des Marktes und des Staates in ihren Grundfunktionen (halbwegs gerechter) Güterallokation und der politischen Stabilisierung geprägt ist. „Ein Dritter Sektor bietet die institutionelle Chance, kumulatives Markt- und Staatsversagen zu kompensieren, allerdings nicht durch komperative Vorteile nach den Maßstäben der Norm- und Zweckrationalität, sondern durch deren relative Suspendierung. Kumulatives Marktund Staatsversagen wird kompensiert durch das ‚Selbststeuerungsversagen’ im Dritten Sektor“ (Seibel 1992:19), denn „die Stabilisierung von organisatorischem Dilettantismus in einem institutionellen Reservat, einem ‚Dritten’ Sektor, hält partielle Aufhebungen norm- und zweckrationaler Organisationskulturen und Handlungsorientierungen disponibel für Situationen, in denen diese Norm- und Zweckrationalität dominierende ‚Codesysteme’ (S.N. Eisenstadt) der modernen Organisationskultur in ihrer Leistungsfähigkeit überfordert sind.“ (Seibel, 1992:18f) Für den Qualitätsdiskurs bedeutet dies, dass man dem Qualitätsstreben und der Qualitätssicherung von Organisationen des Dritten Sektors nur dann gerecht werden kann, wenn man ihr „erfolgreiches Scheitern“ aus dem Blickwinkel der Markt- aber auch der Staatslogik als qualitätsgenerierenden und nicht als qualitätshemmenden oder qualitätsgefährdenden Aspekt berücksichtigen kann und will. Leittext März 2006 Seite 98 6 Qualität in der Sozialarbeit 6.1 Das Effizienz-Effektivitätsproblem im „Dritten Sektor“ Wettbewerb und damit Probleme des Qualitätsmanagements stellen sich für NonprofitOrganisationen auf zwei Ebenen dar: „Die Herausforderung ist einerseits kundenseitig zu sehen. Durch vermehrte Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Anbietern werden Kunden anspruchsvoller, mobiler und kritischer und stellen dadurch höhere Anforderungen an die Leistungen einer NPO. Andererseits verschärft sich der Wettbewerb beschaffungsseitig, wenn die Vergabe knapper Ressourcen (Förderungen, Spenden, Kostenübernahmen, Subventionen etc.) unter zunehmendem Legitimationsdruck erfolgt.“ (Matul/Scharitzer 1997:387). Qualitätsmanagement in der Sozialwirtschaft muss daher in zwei Richtungen erfolgen: Richtung AbnehmerInnen der Leistungen und Richtung AuftraggeberInnen/ZahlerInnen. Dadurch können durchaus Widersprüche entstehen, die dem Doppelten Mandat der Sozialarbeit entsprechen. Qualitätsmanagement ist in marktorientierten Betrieben ein Instrument, den Erfolg des Betriebes zu verbessern. In marktorientierten Betrieben kann der Organisationserfolg relativ einfach gemessen werden, wobei wir folgende Formel verwenden: G P G’ wobei gilt: G’ > G G = Geld, P = Prozess (Produktion oder Dienstleistung) Die Messung des Erfolges der Organisation, und zwar sowohl des Ergebnisses wie der Effektivität und der Effizienz39, ist relativ einfach, denn sie erfolgt längs einer eindimensional skalierten Einheit: des Geldes: Je größer der Abstand von G’ und G ist, desto erfolgreicher ist die Organisation. Für den Nonprofit Sektor ergibt sich allerdings das Problem, dass es keine dem in Geld ausgedrückten Gewinnziel entsprechende, einfachen und einheitlichen Regeln für Erfolgsmessung gibt. (vgl. Matul/Scharitzer 1997:388). Wiederum in einer Formel ausgedrückt ergibt sich: Z I Z’ wobei gilt: Z’ > Z Z = Zustand, I = Intervention (sozialarbeiterische Dienstleistung) Der Abstand von Z’ und Z lässt sich nicht in einer linearen numerischen Größe ausdrücken, da es sich bei Z um keine quantitative, sondern eine qualitative Größe handelt, die nur indirekt (durch Quantifizierung einiger Indikatoren) numerisch ausgedrückt werden kann. Das bedeutet allerdings auch, dass hier die drei Erfolgsfaktoren Ergebnis, Effektivität und Effizienz auseinander fallen, ja oft sogar widersprüchlich werden. Beim Ergebnis handelt sich um jenen Ergebnis-Zustand, der dem ursprünglich gewünschten bzw. geplanten Zustand möglichst ähnlich sein soll. Das Ausmaß der Erreichung dieses Ergebnisses kann 39 Effektivität beschreibt die qualitative Seite, die Effekte der Handlung, Effizienz beschreibt die quantitative Seite eines möglichst guten Zahlenverhältnisses zwischen (niedrigem) Ressourceneinsatz und (hohem) Output. In der Marktökonomie fallen Effizienz und Effektivität in der Regel zusammen. Leittext März 2006 Seite 99 durch verschiedene Indikatoren auch quantitativ ausgedrückt werden; dabei darf aber nicht vergessen werden, dass dieses quantitative Maß für die Erreichung des Ergebnisses nur ein Näherungswert für die Beschreibung eines qualitativen Zustandes ist. Die Effektivität der Intervention kann auch nur qualitativ beschrieben werden, nämlich anhand der gewünschten (bzw. unerwünschten) Effekte der Intervention, z.B. die nachhaltige Veränderung der Lebenssituation von Zielgruppenpersonen. Nur die Effizienz der Intervention kann numerisch (in der Regel im Messinstrument der Marktökonomie, dem Geld, aber auch in anderen Messbegriffen wie zum Beispiel dem Zeitaufwand oder dem Verbrauch anderer quantitativ messbarer Ressourcen) ausgedrückt werden. Ziel der Effizienz ist es, das gewünschte Ergebnis mit dem möglichst geringen Input bzw. mit einem gegebenen Input das höchstmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Unterscheidung von Effizienz und Effektivität Sozialer Arbeit lässt sich mit Heiko Kleve wie folgt ins Bild bringen: „’Effizienz’ bezieht sich auf die Frage, in welchem Verhältnis der Nutzen der Beratung zum Beratungsaufwand steht. Während der Aufwand relativ eindeutig messbar ist, und zwar anhand des eingesetzten Personals und der benötigten Zeit, kurz: anhand der Kosten, so ist die Bewertung des Nutzens nicht so klar. Ob KlientInnen und KundInnen hinsichtlich des Beratungsnutzens ähnliche Perspektiven entwickeln, ist keineswegs selbstverständlich. Jedenfalls bringt das Konzept der Effizienz wirtschaftliche Kriterien ins Spiel. Denn das ökonomische Ziel besteht darin, bei so wenig Aufwand (sprich: Finanzmittel) wie möglich, so viel Nutzen wie möglich zu erreichen. ‚Effektivität’ bezieht sich auf die Frage, in welchem Verhältnis die tatsächlich erreichten, die beobachtbaren Ergebnisse der Beratung zu den vereinbarten Zielen stehen. Effektiv ist eine Beratung also dann, wenn sich deren Ergebnisse mit den vereinbarten Zielen decken. Aber ob, wie und wann Ziele erreicht wurden, bringt freilich wieder systemrelevante, kontext- und beobachterabhängige Bewertungen in den Blick.“ (Kleve 2005:50). Die Tatsache, dass in der Nonprofit Ökonomie nur einer der drei Zielzustände, nämlich die Effizienz einfach numerisch zu messen ist, die anderen beiden (Ergebnis und Effektivität) jedoch nicht oder nur indirekt (über Indikatoren) quantitativ darstellbar sind, es sich bei dem numerischen Messinstrument der Effizienzbestimmung gleichzeitig in der Regel um die Rechengröße Geld handelt, führt in einer sich immer stärker ökonomisierenden Gesellschaft zunehmend dazu, dass die Ergebnisse von Nonprofit Organisationen immer mehr bzw. fast ausschließlich nur mehr über ihre Effizienz bzw. die Nutzung der Effizienzsteigerungen gemessen werden. Zu beachten ist aber, dass eine zu stark beanspruchte Orientierung auf Effizienzsteigerung sich negativ auf die Effekte der Organisation auswirken kann. Ein Beispiel: Die Effizienzsteigerung einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme wird daran gemessen, wie viele Vermittlungsergebnisse es bei gegebenem Personaleinsatz gibt. Um diese Effizienz zu steigern (bzw. weil die Organisation nur weiter beauftragt/gefördert wird, wenn sie gewisse Vermittlungszahlen erreicht), neigen Organisationen dann dazu, vor allem jene Personen aus der Zielgruppe aufzunehmen, bei denen das Vermittlungsziel leicht zu erreichen scheint. Der Effekt: Schwer zu vermittelnde Personen haben eine abnehmende Chance auf einen Platz in der Einrichtung - Die Effektivität der Einrichtung, nämlich vor allem Leittext März 2006 Seite 100 jene Menschen zu betreuen, die ohne die Einrichtung die geringsten Integrationschancen haben, schwindet. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, mit Matul und Scharitzer (1997:388) festzuhalten: „Den Qualitätsbegriff inhaltlich zu interpretieren bedeutet daher auch, Rücksicht darauf zu nehmen, aus welcher Sichtweise die jeweilige Qualitätsbeurteilung vorgenommen wird.“. Die Ansatzpunkte der Qualitätsbeurteilung und somit zum Qualitätsmanagement in der Sozialwirtschaft müssen daher auf drei miteinander verflochtenen Ebenen identifiziert werden: „den fachlichen Grundlagen der Arbeit in NPOs und deren Umsetzung in die Praxis den organisatorischen Strukturen und Abläufen innerhalb der Einrichtungen den politischen, gesamtwirtschaftlichen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die jeweilige NPO agiert“ (Matul/Scharitzer 1997:389). Diese drei Kriterien bzw. ihre Optimierung stehen durchaus miteinander in Widerspruch. Erfolgreiches Qualitätsmanagement ist daher immer auch ein Management dieser Widersprüche, und zwar umso erfolgreicher, je besser hier eine Optimierung gelingt. Dazu sind professionelle Strategien des Qualitätsmanagements zu nutzen, wobei jeweils zu überprüfen ist, wie weit sich die im Rahmen der Marktökonomie entwickelten Instrumente tatsächlich für den Dritten Sektor eignen. Da sich Organisationen der Sozialwirtschaft gemäß dem Doppelten Mandat der Sozialarbeit immer in einem doppelten Spannungsverhältnis zwischen den Interessen von UserInnen und von (öffentlichen) AuftraggeberInnen bewegen und insbesondere die beauftragenden (öffentlichen) Stellen von der Qualität der angebotenen Leistung zu überzeugen sind, sind neben der Entwicklung von Qualitätsmanagementstrategien zur Optimierung der Ablauforganisation der jeweiligen Einrichtung immer auch Strategien zur Bewertung von Qualitätszuständen nötig (dazu weiter unten mehr). Um allen drei eben dargestellten Ebenen gerecht werden zu können, bedarf es in der betroffenen Organisation zumindest das Zusammenwirken von drei korrespondierenden Perspektiven: „Es braucht das Know-how der jeweils betroffenen Fachdisziplinen (z.B. Ausbildung, Pflege, Kultur, Sport etc.), darüber hinaus sind betriebswirtschaftliche Ansätze und Methoden notwendig, um aus organisatorischer und betriebsbezogener Sicht eine möglichst gute Produzenten-Konsumenten-Beziehung herzustellen. Schließlich sind volkswirtschaftliche Kenntnisse Voraussetzung, um die Qualität des gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Systems insgesamt im Auge zu behalten“ (Matul/Scharitzer 1997:38940). Dabei macht es durchaus Sinn, bei der Analyse der Qualität bzw. des Qualitätsmanagements von Dienstleistungen eine Unterteilung in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität vorzunehmen. Die Strukturqualität beschreibt den (internen und externen) Kontext, innerhalb dessen die Leistung erbracht wird, also zum Beispiel sozialpolitische und kulturelle Rahmenbedingungen im jeweiligen Gesellschaftssegment, aber auch Einflüsse, die sich aus Geschichte und Mythen der leistungserbringenden Organisation selbst ergeben. Die 40 Hervorhebungen durch uns Leittext März 2006 Seite 101 Prozessqualität beschreibt die Abläufe, innerhalb derer die jeweilige Dienstleistung erbracht wird, wobei zwischen technischer (z.B. Qualität der Apparate) und funktionaler (in welcher Form wird die Leistung erbracht, z.B., welchen Anteil spielt Empathie bei der Erbringung einer Dienstleistung) Qualität zu unterscheiden ist. Die Ergebnisqualität beschreibt den Output gemessen an den angestrebten Zielen und ist die am schwersten zu operationalisierende Qualitätsdimension, da sie nur auf qualitativen Merkmalen aufbaut. Auch die Nachhaltigkeit der jeweiligen Intervention (Dienstleistung) ist ein Element der Ergebnisqualität. Zu dieser Dimension findet man bei Braun folgendes Zitat: „Bei der Ergebnisqualität lassen sich Standards für das prozessuale Ergebnis (Output) nur in Grenzen angeben: Fähigkeit zur Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten, Rückkehr eines Jugendlichen in die Familie, Behebung der Inkontinenz bei einem bettlägerigen alten Menschen. Dies sagt jedoch nicht notwendigerweise etwas über die Folgequalität (Outcome) aus. Und die Folgequalität hängt ja wiederum von Persönlichkeitseigenschaften, Lebensgeschichte und Verhalten des Klienten ab.“ (Braun 2004:39f). 6.2 Die drei Bereiche der Qualität: Qualität der Dienstleistung, Qualität der Arbeit und Qualität der Leitung 6.2.1 Qualität der Dienstleistungen Diese Zusammenfassung wird nach der Debatte mit den anderen Modulen der Partnerschaft zusammenfassend ausgeführt. 6.2.2 Qualität der Arbeit Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft Schlüssel nicht nur zur Gewinnung von Einkommen, sondern ebenfalls zur gesellschaftlichen Teilhabe (vgl. z.B. Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1982, Gorz 2000). Ausschluss von der Erwerbsarbeit bedeutet in der Regel auch Verminderung oder Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe. Allerdings geht es mit den globalen Veränderungen auf den Arbeitsmärkten längst nicht mehr um die einfache Polarisierung „Erwerbsarbeit – Nicht Erwerbsarbeit“, sondern auch um die Qualität jener Arbeitsplätze, die angeboten werden. Die These dabei ist, dass nur ein Mindestmaß an qualitativen Kriterien eines Erwerbsarbeitsplatzes auch dessen Funktion der Integration (Inklusion) in die Gesellschaft ermöglicht. „Insbesondere in Anbetracht der FlexibilisierungsAtypisierungs- und Prekärisierungstendenzen wäre es unzureichend und irreführend, lediglich die Pole ‚erwerbslos bzw. erwerbstätig’ zu betrachten, um zu beurteilen, wer ‚drinnen’ und wer ‚draußen’ ist. Erst die Inblicknahme qualitativer Aspekte ermöglicht Aussagen darüber, ob und inwiefern Erwerbsarbeit ihre sozialintegrative Kraft entfaltet“ (Satilmis 2005:273). Gerade in Zeiten verschärfter Arbeitslosigkeit werden Anforderungen um Qualität der Arbeit, sei es der betriebliche Gesundheitsschutz, höhere Verdienste, Aus- und Weiterbildungsansprüche, betriebliche Mitbestimmung, aber auch Forderungen nach Geschlechtergleichstellung und ökologischer Nachhaltigkeit, vorrangig als „Gefährdung des Leittext März 2006 Seite 102 Standortes“ eingestuft. Satilmis (2005:266) nennt diesen Prozess eine „Verklärung der Erwerbsarbeit“ nach der lapidar formulierten Devise „(fast) jeder Arbeitsplatz ist besser als keiner“. Mit der Angst um den Verlust (oder die Nichterhaltung) des Arbeitsplatzes kann im gegenwärtigen makropolitischen Klima fast jede Debatte um Qualität der Arbeit auf das Abstellgleis geschoben werden. Dieses Phänomen ist am gesamten Arbeitsmarkt zu beobachten, verschärft wird es freilich im Dritten Sektor, diesem Gemenge von vollberuflicher, prekärer und ehrenamtlicher Arbeit. Mit dem Bestreben der „Arbeit mit Mission“ werden in der Sozialwirtschaft (aber auch in anderen Branchen des Dritten Sektors) oft Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen akzeptiert, die dieselben Personen keinem ihrer KlientInnen zumuten würden. Qualität der Arbeit im Dritten Sektor muss sich daher gleichzeitig mit zwei Phänomenen auseinandersetzen, einerseits mit den Folgen der „Verklärung der Erwerbsarbeit“, andererseits mit denen der „Arbeit mit Mission“ auf die Qualität der Arbeitsplätze im Dritten Sektor. Dabei werden viele Bereiche anzusprechen sein. „Die Frage der Qualität der Arbeit umfasst schließlich sehr verschiedene Dimensionen der Arbeits- und Lebensbedingungen. Es geht dabei um Aspekte der sozialen Absicherung, des existenzsichernden Einkommens, des Gesundheitsschutzes, der Aus- und Weiterbildung, wie auch um Arbeitszeiten und um die Vereinbarkeit von unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsphären. Der Arbeitsprozess und der -inhalt sind ebenso angesprochen wie Fragen der Arbeitszufriedenheit und der gesellschaftlichen Anerkennung. Wichtige Indikatoren für Qualität ergeben sich zudem aus den Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung und der Beteiligung, der Frage, ob Tätigkeiten qualifikationsentsprechend sind und Planungssicherheiten bzw. Zukunftsperspektiven bieten. Die Frage nach der Qualität der Arbeit ist eng verwoben mit der Forderung und dem Anspruch nach gleichberechtigten Lebens- und Teilhabechancen und verweist somit auf die soziale Frage.“ (Satilmis 2005:267). Gerade in Anbetracht der Entdeckung des Dritten Sektors als ‚Beschäftigungsmarkt der Zukunft’ ist es daher nicht nur aktuell, sondern auch notwendig, gemeinsame Überlegungen zur Verbesserung der Qualität der Arbeit im Dritten Sektor anzustelleni41. Da die Qualität der Arbeit stets im Zusammenhang mit den strukturellen Bedingungen zu sehen ist, wurden in den Entwicklungen beide Aspekte gleichermaßen berücksichtigt: Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse und der Erwerbsperspektive unter Berücksichtigung von gender-, tätigkeits- und engagementspezifischen Grundsätzen Stabilisierung der finanziellen Handlungsspielräume der Organisationen unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verortung des Dritten Sektors zwischen Markt, Staat und Eigenarbeit Angesichts der intermediären Stellung des Dritten Sektors wurde uns bald bewusst, dass es nur möglich ist, diesen Entwicklungspfad im Gefolge eines Dialoges zu beschreiten, denn der Dritte Sektor ist in seiner gesellschaftlich gewachsenen Rolle 41 Der folgende Text ist dem Handbuch Dritter Sektor der Entwicklungspartnerschaft „Der Dritte Sektor in Wien“ der ersten Antragsrunde entnommen; wir geben ihn hier wieder, weil wir meinen, dass er die anzusprechenden Probleme der Qualität der Arbeit im Dritten Sektor klar beschreibt. Leittext März 2006 Seite 103 nicht nur Dienstleistungserbringer, sondern v.a. immer auch Dialogpartner. Da das Finden von individuellen Lösungen ein Charakteristikum und wesentliches Potenzial des Dritten Sektors ist, sind diese Erfahrungswerte für eine gemeinsame Strategieentwicklung von erheblicher Relevanz. An dieses Potenzial anzuschließen, war und ist uns wichtig – nicht zuletzt, um der Gefahr vorzubeugen, dass der Dritte Sektor als bester Ausweg aus der Krise des Wohlfahrtsstaates und der Arbeitsgesellschaft instrumentalisiert wird. In einem Dialog zwischen Verantwortlichen aus den Organisationen, Interessensvertretungen und ExpertInnen aus den Feldern des Arbeitsrechts und der Finanzierung wurden Entwicklungsperspektiven formuliert, die eine Argumentationsgrundlage für die Verbesserung der Qualität der Arbeit im Dritten Sektor darstellen. Anzusprechende Probleme im Zusammenhang mit einer Qualitätsentwicklung der Arbeit im Dritten Sektor sind vor allem: Ehrenamtliche Arbeit (Mindestformen des Schutzes für Ehrenamtliche und als Schutz der Beschäftigten vor „Dumping“ durch Ehrenamtliche) Vertragsformen der Arbeit (vor allem die „Neuen“ Vertragsformen wie Werkvertrag und dienstnehmerInnenähnliche Beschäftigung, aber auch alle Formen prekärer Arbeitsverträge) Arbeitszeiten (Lage und Länge der Arbeitszeit, Durchrechnungszeiträume) Entgelt (Grundentgelt und Zulagen, Entgelte für Mehrarbeit) Sonstige Begleitmaßnahmen (z.B. Supervision) Einige dieser Bereiche sind bereits in einigen Kollektivverträgen im Dritten Sektor angesprochen (und teilweise auch bereits befriedigend gelöst) worden, etwa im so genannten BAGS-Kollektivvertrag im Gesundheits- und Sozialbereich. Eine weiterführende Diskussion fand etwa auch im EQUAL-Projekt der ersten Antragsrunde „Musterkollektivvertrag“ statt und wurde auch publiziert (vgl. Leibetseder et.al. 2005). 6.3 Gender in den Qualitätsinstrument? Mainstream bringen – ein 6.3.1 Definition von Gender Mainstreaming Gender Mainstreaming (GM) als Strategie mit dem Ziel Gleichstellung zu erreichen, ist ursprünglich im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit geprägt worden, als die ökonomische Rolle der Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu einem Thema der Entwicklungspolitik geworden ist. Es wurde bei der Weltfrauenkonferenz in Nairobi (1985) in die Debatte eingeführt und kam 10 Jahre später bei der Weltfrauenkonferenz von Beijing (1995) zu einem globalen Durchbruch. Als geeignete Strategie zur Erreichung von Gleichstellung fand GM in den neunziger Jahren Eingang in die Politik der EG und EU, aufbauend auf die seit Ende der siebziger Jahre (mit dem Art. 119 EGV zur Gleichheit der Entgelte und zahlreichen darauf aufbauenden EUGH-Urteilen) entwickelte Europäische Leittext März 2006 Seite 104 Gleichstellungspolitik. Das Konzept Gender Mainstreaming wird seit 1996 von der EU explizit aufgegriffen und findet in beschäftigungspolitischen Leitsätzen und Programmen (ausgehend vom Gipfel von Luxemburg 1997) Eingang. Im Amsterdamer Vertrag von 1999 hat sich die Union schließlich zur Beseitigung von Ungleichheiten und zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen verpflichtet (Art. 3 Abs. 2 EG-Vertrag). Zur Erzielung der vollen Gleichstellung ermächtigt der Art. 141 Abs. 4 EGV die Mitgliedsstaaten ausdrücklich auch zu Maßnahmen der positiven Diskriminierung, wenn dadurch das Gleichstellungsziel besser erreicht werden kann (vgl. Stiegler, 2002). Dementsprechend haben sich die Mitgliedstaaten politisch und rechtlich verpflichtet, die Strategie des Gender Mainstreaming in alle politischen Konzepte und Handlungen einfließen zu lassen, die österreichische Bundesregierung etwa in einem Ministerratsbeschluss im Sommer 2000. Dieses Gleichstellungsprinzip wird im Verwaltungshandeln zunehmend wirksam, so sind etwa vielfach öffentliche Aufträge und Förderungen bereits an den Nachweis der begünstigten bzw. beauftragten Organisation gebunden, Gender Mainstreaming umzusetzen und über eine Gleichstellungsorientierung zu verfügen. Gender Mainstreaming ist eine Gleichstellungsstrategie, die sich nicht (allein) auf Personen bezieht, sondern auf die Systeme und Zusammenhänge, in denen sie leben und wirken. Sie spricht Frauen und Männer gleichermaßen an. In den Worten der EU-Kommission (EU 1996) heißt es: „Die Förderung der Gleichstellung ist nämlich nicht einfach der Versuch, statistische Priorität zu erreichen: Da es darum geht, eine dauerhafte Weiterentwicklung der Elternrollen, der Familienstrukturen, der institutionellen Praxis, der Formen der Arbeitsorganisation und der Zeiteinteilung usw. zu fördern, betrifft die Chancengleichheit nicht allein die Frauen, die Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Selbständigkeit, sondern auch die Männer und die Gesellschaft insgesamt, für die sie ein Fortschrittsfaktor und ein Unterpfand für Demokratie und Pluralismus sein kann.“ So verstanden bedeutet Gender Mainstreaming einen Schritt in Richtung Demokratisierung und Modernisierung der Gesellschaft. Gender Mainstreaming ist eine durchgängig einzusetzende („top down“) Strategie zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen. Unter Gleichstellung ist dabei zu verstehen, dass Frauen und Männer in allen Bereichen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens gleichermaßen präsent, berechtigt und beteiligt sind. Gender Mainstreaming ist ein aktives Konzept, das das Gleichstellungsthema in alle Politikbereiche verankert und erfordert, dass auf allen Entscheidungs- und Handlungsebenen so lange Maßnahmen gegen Diskriminierung und zum Ausgleich von Benachteiligungen gesetzt werden, bis Chancengleichheit der Geschlechter hergestellt ist. Somit ist Gleichstellungspolitik auf europäischer und damit auch auf nationalstaatlicher Ebene zur Querschnittsmaterie geworden, insbesondere in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, zunehmend aber auch in anderen Feldern der Politik und Wirtschaft. Der Europarat hat Gender Mainstreaming 1998 wie folgt definiert: „Gender Mainstreaming ist die (Re-) Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung politischer Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle an politischen Entscheidungen beteiligten AkteurInnen einzubeziehen“ (Naylon/Weber 2000:6) Diese Gleichstellungsstrategie hat Leittext März 2006 Seite 105 mittlerweile eine Fülle von spezifischen Instrumenten entwickelt, von denen das bekannteste die „4-R-Methode“ ist, die auf Basis eines skandinavischen Modells von der Schweizer Juristin Zita Küng entwickelt wurde und auf den 4 Elementen: Repräsentation, Ressourcen, Recht und Realia beruht, wobei die drei Elemente Repräsentation, Ressourcen und Recht quantitativer Natur sind und das Element Realia (Normen und Wertvorstellungen) qualitativ zu bewerten ist (vgl. Naylon/Weber 2000). Im Gegensatz zu früheren Gleichstellungspolitiken orientiert sich die komplexe Strategie Gender Mainstreaming nicht nur an der numerischen Gleichstellung von Frauen und Männern, sondern setzt sich auch mit den Zusammenhängen struktureller Ungleichheiten (verstanden als dynamische Wechselwirkung zwischen zustands- und handlungsbezogener Gleichheit) auseinander. Das Neue am Ansatz Gender Mainstreaming gegenüber früheren Ansätzen ist die Erkenntnis, dass die hier angestrebte Gleichstellung der (sozialen) Geschlechter nur zu erreichen ist, wenn auch die Männer ein Interesse an Gleichstellung entwickeln, d.h. ein Verständnis dafür, dass nicht andere, nur die Frauen, gemeint sind, sondern auch ihre eigene Berufs- und Alltagspraxis. Gender Mainstreaming fokussiert als Gleichstellungsstrategie daher die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern. Die Komplexität der Gleichstellungsstrategie Gender Mainstreaming birgt allerdings auch die Gefahr ihres Missbrauches in sich, insbesondere dadurch, dass eine formelhafte (und daher politisch-symbolische) Entwicklung von „Gender Mainstreaming-Aktivitäten“ gesetzt werden kann, um vom Gleichstellungsziel tatsächlich abzulenken. Dies tritt vor allem dort auf, wenn eine Organisation sich zwar zu Gender Mainstreaming „bekennt“, aber über keine Gleichstellungsziele verfügt. Insbesondere Gender Mainstreaming-Strategien, die sich in einer Tradition und Denklinie mit den US-amerikanischen Konzepten des Diversity Managements sehen, bergen die Gefahr, keine eigentliche Gleichstellung der sozialen Geschlechter zu verfolgen. Es ist daher zu beachten, dass Gender Mainstreaming eine Strategie meint und nicht den Inhalt der Politik (vgl. auch Schunter-Kleemann 2001). 6.3.2 Aufgaben und Ziele der Gleichstellungsstrategie GM Gender Mainstreaming ist eine Strategie, um Gleichstellung von Frauen und Männern in der Öffentlichkeit, in Politik und Verwaltung zu erreichen. Diese Strategie sollte in allen Bereichen eines politischen Systems oder einer Organisation verankert werden (Querschnittsmaterie). Bei allen Entscheidungen ist eine geschlechterbezogene Sichtweise zu berücksichtigen, die Wirkungen auf Frauen, Männer und Mann-Frau-Verhältnisse sind zu überlegen (vgl. Schörghuber/Rosenbichler 2005:83). Gender Mainstreaming ist Strategie und nicht Politik, sie kann daher Gleichstellungspolitik nicht ersetzen, sondern ist ein Instrument, um Gleichstellung in Organisationen und (politischen) Strukturen durchzusetzen. Leittext März 2006 Seite 106 Die Verankerung von Gender Gleichstellungsstrategie erfordert: Mainstreaming als Querschnittsmaterie und Das Vorhandenseins von Gleichstellungszielen, am besten im Leitbild der Organisation (Gleichstellungsstrategie) Die Verankerung der Gleichstellungsstrategie von der Spitze der Organisation herunter in alle Teilbereiche (top-down-Strategie) Die Schaffung von Verantwortungsbereichen in der operativen Führung der Organisation (kein Abschieben der Verankerung an eine „Gender-Stabsstelle“) Definition abrechenbarer Gleichstellungsziele der Organisation Strukturierung der einzelnen Schritte der Gleichstellung Gender-Berichterstattung (Aufbereitung aller statistischen Nachweise Organisation auch nach der Genderdimension, Gender-Budgeting) Orientierung an hierarchischer Gleichstellung, nicht an numerischer Gleichstellung Erreichen und Evaluierung tatsächlicher Veränderungen in Richtung Gleichstellung der Das bedeutet, dass in einer Organisation bzw. in einem Projekt nicht nur Gleichstellungsziele zu entwickeln (bzw. zu formulieren) sind, sondern dass alle Prozesse, Strukturen und Ergebnisse in Hinblick auf deren Wirkungen auf Frauen, Männer und insbesondere auf FrauMann-Beziehungsverhältnisse überprüft werden müssen (Schörghuber/Rosenbichler 2005:88). Gender Mainstreaming bedeutet also nicht, „neue Methoden oder grundlegende Vorgangsweisen zu erfinden, sondern es ist auch mit den vorhandenen Instrumenten effektiv und nutzbringend durchzuführen. Diese stammen – logisch weitergedacht – aus den Bereichen der Qualitätsentwicklung und Organisationsentwicklung“ (Schörghuber/Rosenbichler 2005:91). Ob Gleichstellung „beobachtet“ und festgestellt werden kann oder nicht, hängt davon ab, wie hingesehen wird: mit welchen Vorannahmen (Wertvorstellungen, individuelles und gesellschaftliches Umfeld); vor dem Hintergrund welcher Erfahrungen (Sozialisation als Frauen und Männer, in bestimmten Geschlechterverhältnissen aufgewachsen); mit welchen Hilfsmitteln (Statistiken, Strukturanalysen, Analyse von Mythen und Normen...); mit welchen heimlichen oder offenen Zielen (vgl. Schörghuber/Rosenbichler 2005:85f) Werden diese Kriterien nicht (ausreichend) in der eigenen Gleichstellungspolitik berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass Gender Mainstreaming keine tatsächliche Querschnittsmaterie zur Erreichung des Gleichstellungsziels geworden ist, sondern mehr oder weniger eine formale Handlung geblieben ist, um den Vergabe- oder Förderkriterien genüge zu tun. Leittext März 2006 Seite 107 7 Die Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit – Wege und Irrwege 7.1 Die Legimitationskrise in der Sozialarbeit: 7.1.1 Beginn der Qualitätsdiskussion in der Sozialarbeit und Reaktionen Ökonomisches Denken und Handeln ist in der Sozialarbeit nicht neu. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gab es TheoretikerInnen in der Sozialarbeit, die gleichzeitig auch ÖkonomInnen waren: Alice Salomon (geb. 1872), Christian Jaspar Klumker (geb. 1868) oder Ilse Arlt (geb. 1876) (vgl. dazu Mühlhausen 2004:14f). Vor und während dem 2. Weltkrieg wurde die Sozialarbeit weitgehend für die nationalsozialistische Ideologie funktionalisiert. Der Wiederaufbau nach dem Krieg stellte vorerst an die Qualität keine hohen Ansprüche. Durch den weiteren wirtschaftlichen Aufschwung wurde viel Geld der öffentlichen Hand in soziale Einrichtungen investiert (vgl. Speck 2004:15). Beginn der Qualitätsdebatte (in Deutschland?) Ein Anfang der heute geführten Qualitätsdiskussion liegt in der so genannten „Legimitationskrise“. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts kommt es in drei Bereichen zu wichtigen Veränderungen für die Sozialarbeit. Sozialpolitik: Den öffentlichen Kassen ging es finanziell nicht mehr so gut. Als Auslöser dafür nennt Speck die vermehrte Arbeitslosigkeit (die er auf die globalen ökonomischen Veränderungen und den damit zusammenhängenden gesteigerten Wettbewerb zurückführt) und das Vorhandensein immer älterer Menschen (vgl. Speck 1999:15f). Die Verwaltungsmodernisierung und -reform hält Einzug in die Sozialarbeit und neue Finanzierungsmodelle für Soziale Dienste werden ausgearbeitet. Mittels Leistungsverträgen (vgl. Meinhold/Matul 2003:31) und konsequenter Dezentralisierung (vgl. Obermair 2004:242) werden die Angebote der öffentlichen Träger (genauso wie andere Dienstleistungen) als Produkte definiert und müssen Qualitätskriterien erfüllen (vgl. Meinhold 1996:88). Es werden zunehmend Fragen zur Effektivität und Effizienz sozialer Dienstleistungen gestellt (KostenträgerInnen, KlientInnen, Öffentlichkeit) wie auch zur Qualität der Arbeit bzw. der Dienstleistung. Die MitarbeiterInnen stehen vor neuen Aufgaben: Bewertung fachlicher Arbeit, Behebung arbeitsspezifischer Mängel und Erfüllung der Forderung nach verbesserter Legimitation durch Nachweis von „Wirksamkeit“ (vgl. Merchel 2004:15). Weiters bezieht sich die Qualitätsdiskussion „(…) immer mehr auf die Frage nach dem Nutzen der Arbeit für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen und auf Fragen bezüglich der konkreten Ergebnisse der Sozialen Arbeit“ (Meinhold/Matul 2003:47). Gesetzliche (Neu-)Bestimmungen: Leistungsverträge, aber auch die Ausschreibung sozialer Leistungen (und das erfolgte „Auslagern“ aus staatlichen Einrichtungen) gehen auf eine Änderung des Gesundheitsstrukturgesetzes zurück. Diese stellen laut Meinhold/Matul Leittext März 2006 Seite 108 Vorläufer zur Qualitätsdebatte dar (vgl. Meinhold/Matul 2003:31). Auch in anderen Gesetzen kam es zu essentiellen Änderungen. (vgl. Kapitel 3.8). Betriebswirtschaftliche Einflüsse: Die Lösung der Qualitätsdebatte wird im Denken und Handeln der Betriebswirtschaft gesucht und die sozialen Einrichtungen werden zunehmend gezwungen „(…) ein neues unternehmerisches Selbstverständnis zu entwickeln“ (Moos 2004:192). Die Argumentationslinie beruht auf dem „(…) alten Vorwurf, dass überall, wo Institutionen von öffentlichen Geldern leben, Unprofessionalität, beamteneigene Initiativlosigkeit und Etatdenken letzten Endes zur Mittelverschwendung führen“ (Herrmannstorfer 2004:217). Keupp meint hierzu: „Neu in der Suche nach Qualität ist die betriebswirtschaftliche Managementperspektive. Sie ist angesichts knapper werdender Mittel für öffentliche Angelegenheiten zu einer notwendigen Dimension geworden, aber sie darf nicht der Hegemonie bei der Festlegung von Qualitätsstandards erliegen. Diese brauchen nach wie vor eine inhaltlich-fachliche Begründung, die heute von der Idee einer aktiven Bürgergesellschaft geprägt sein sollte. Im Spannungsfeld von Zivilgesellschaftlichen und Effizienzkriterien muss der Qualitätsdiskurs entfaltet werden“ (Keupp 2004:326). Diese Darstellung von Merchel (2005:15) greift wichtiges auf: Abb. 13: Sozialpolitisches Umfeld der Qualitätsdebatte in der Sozialen Arbeit Leittext März 2006 Seite 109 7.1.2 Sozialarbeit und ihr Umgang mit der Legimitationskrise Die Sozialarbeit reagierte auf diese Anforderungen vorerst recht hilflos, „(…) hat die Qualitätsdebatte quasi verschlafen und kann aus dieser Defensivposition heraus kaum aktiv in das Geschehen eingreifen.“ (Depner/Trube in Neue Praxis, 2001:230) „Ein entscheidender Grund dafür ist die unvollständige Professionalisierung Sozialer Arbeit.“ (Mühlhausen 2004:84). Meinhold und Matul meinen hierzu: „Aufgrund der Einsparungsdiskussion werden in den letzten Jahren in zunehmendem Maße betriebswirtschaftliche Konzepte auf das Handlungsfeld Sozialer Arbeit übertragen. Mit der vermehrten Ökonomisierung der Sozialen Arbeit wurden bei den MitarbeiterInnen berechtigte Befürchtungen geäußert, dass Wertigkeiten und methodische Ansätze der KlientInnenarbeit zu kurz kommen können und Effizienzüberlegungen geopfert werden müssen. Lange Zeit war daher die Betriebswirtschaftslehre fast ein Feindbild bzw. ein Gegenpol zu fachlich guter KlientInnenarbeit. Struktur-, Ergebnis- und Kostenorientierung würden geradezu gute fachliche Arbeit verhindern. Zur Zeit ist eine klare Gegenbewegung zu erkennen. Insbesondere in den Kreisen der Führungskräfte ist eine Art ‚Management- und Qualitätseuphorie’ festzustellen, die die rasche Übernahme von Qualitätsinstrumenten und Qualitätsmodellen aus dem gewinnorientierten Bereich fordert. Manchmal entsteht der Eindruck, dass das, was lange Zeit nicht gemacht wurde, jetzt umso rascher nachgeholt werden soll. Für dieses ‚Nachholen’ werden vor allem betriebswirtschaftliche Instrumente heran gezogen. Dies führt häufig zu einer Überforderung der MitarbeiterInnen, die sich in unterschiedlichen Formen von Widerstand äußern kann: Der instrumentell-betriebliche Steuerungszugang habe nichts mit der unmittelbaren Arbeit der ausführenden Fachkräfte vor Ort zu tun und sei daher nicht praxisrelevant. Solange nicht auch auf der ausführenden Ebene der Fachkräfte die Anschlussfähigkeit von betrieblichen Instrumenten sichergestellt wird, werden Qualitätsmanagementansätze abgehoben und nicht greifbar bleiben“ (Meinhold/Matul 2003:47). 7.2 „Sozialmanagement“ als neue Sozialarbeitsstrategie Die Auseinandersetzung um die Entwicklung von „Sozialmanagementansätzen“ als Professionalisierungs- und Qualitätsentwicklungsstrategie in der Sozialarbeit wird noch ausführlicher diskutiert und dargestellt werden. Leittext März 2006 Seite 110 7.3 New Public Management und die Qualitätssicherung der öffentlich erbrachten Sozialarbeit In der Schnittstelle von marktwirtschaftlichen Organisationen und Trägern der öffentlichen Hand angesiedelt ist für die Sozialwirtschaft nicht nur die an die Marktökonomie angelehnte „Betriebswirtschaftlichung“ relevant, sondern auch die Veränderungen im Bereich der Öffentlichen Hand, zusammenzufassen in dem Begriff „New Public Management“. Das Ziel ist klar: eine bessere Nutzung der vorhandenen, gemessen an den (wachsenden) Aufgaben immer knapper werdenden öffentlichen Mittel, vor allem für die lokalen Gebietskörperschaften. „Dabei geht es um die Steigerung der Effektivität und Effizienz der kommunalen Leistungen bei gleich bleibenden und steigenden Aufgaben sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, ohne das verausgabte Finanzvolumen zu erhöhen. Ausdruck dieser Strategie, die sich weltweit vollzieht, ist das New Public Management“ (Schaarschuch 2003:151). Diese Entwicklung findet vor dem Hintergrund einer Liberalisierung des öffentlichen Sektors statt, gekennzeichnet durch Eindringen einer betriebswirtschaftlichen Rationalität auch in der öffentlichen Verwaltung, verbunden mit einer Rückbesinnung auf das „Kerngeschäft“ politischer Verwaltungen, die Erfüllung hoheitsstaatlicher Aufgaben. Die Organisation und Durchführung aller anderen Aufgaben wird zunehmend öffentlich vergeben, und zwar – und das ist das absolut Neue zumindest im Bereich der Sozialwirtschaft – nicht mehr den klassischen Prinzipien der Subsidiarität folgend, sondern nach wettbewerblichen Kriterien42 der Vergabe. Hier verliert die traditionelle Vorrangstellung der Sozialwirtschaft an Bedeutung und sie wird – quasi durch die „unsichtbare Hand des Marktes“ geleitet – den kommerziellen AnbieterInnen gleich gestellt (vgl. Schubert 2005:11). Diese Verwaltungsreform bezieht sich auf alle drei Ebenen der Staatlichkeit (vgl. Reis 2003:263): das Grundverständnis von Staat und Gesellschaft die Organisationsform der Erfüllung öffentlicher Aufgaben die unmittelbare Handlungsebene im Verhältnis von BürgerInnen und Verwaltung. Diese umfassende Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung und ihrer „Bürokratie“ (im Sinne Max Webers, Weber 1972:551ff) kann tatsächlich als Paradigmenwechsel bezeichnet werden. Sie ist zu charakterisieren durch: „die Ablösung der Regelsteuerung durch Elemente der Ergebnissteuerung (management by objectives und management by results), um die starren Formen bürokratischen Handelns durch die Erschließung der Produktivitätsreserve ‚Eigeninitiative’ zu überwinden; 42 Nach dem funktionalen Unternehmensbegriff der EU ist nicht mehr auf die Rechtsform der AnbieterInnen oder ihrer Zuordnung zu einem der drei Sektoren zu achten, sondern ausschließlich darauf, ob hoheitsstaatliche oder wirtschaftliche Ziele verfolgt werden. Leittext März 2006 Seite 111 das Zusammenführen bisher zersplitterter Arbeitsbereiche und die Einführung von teilautonomen Arbeitsgruppen und Teamarbeit, um diese Intention auch organisationsstrukturell zu verankern (‚dezentrale Ressourcenverantwortung’); die Übernahme von Managementinstrumenten und Führungsprinzipien aus der Privatwirtschaft; die einer ‚Marktrhetorik’ (König 1995) folgende Entwicklung von Wettbewerbsinstrumenten und -surrogaten, mit denen Kostenbewusstsein und Flexibilität der Leistungserbringung gesteigert werden sollen; die Überprüfung der ‚Leistungstiefe’ der öffentlichen Verwaltung“ (Reis 2003:261f), also die weitgehende Reduzierung der Aufgaben der Gebietskörperschaften auf ihr „Kerngeschäft“, die hoheitsstaatliche Verwaltung. Dieser Paradigmenwechsel im Handeln der Öffentlichen Hand ist nicht nur auf ihre verengten Finanzierungsspielräume zurückzuführen, sondern ist in der Veränderung des Denkens über Staat und Wirtschaft ab den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts („neokonservative Revolution“) zu begründen. Der Ansatz von Public Management kann wie folgt beschrieben werden: „Im Kern geht es dabei um die Verknüpfung der Einführung von Management- und Organisationselementen in der Privatwirtschaft mit der partiellen Neudefinition öffentlicher Aufgaben und Aufgabenwahrnehmung“ (Reis 2003:260). Dabei ist die Öffentliche Hand – vor allem in Hinblick auf das hier diskutierte Qualitätsthema – in drei Dimensionen relevant: Öffentliche Hand als Aufsichtsbehörde für Sozialarbeit (Qualitätssicherung) Öffentliche Hand als Hauptgeldgeber (durch Vergabe oder Förderung) Öffentliche Hand als Träger von Sozialarbeit (Sozialarbeit im zweiten Sektor, z.B. im Jugendamt) Insbesondere im Zusammenhang mit der Qualitätsdebatte muss aber die bedeutende Funktion des Rechtsanspruches (und damit von Rechtssicherheit) als Besonderheit (hoheitsstaatlicher) Öffentlicher Dienstleistungen beachtet werden. Gerade diese Verrechtlichung schafft Möglichkeiten der Durchsetzung von Qualität. Es wäre daher im Zuge der Verwaltungsreform darauf zu achten, dass diese nicht zu einer Zunahme der Verlagerungen von Aufgaben der Öffentlichen Hand (insbesondere in der Daseinsvorsorge) aus dem Bereich der hoheitsstaatlichen Leistungen (mit Rechtsanspruch) zu privatwirtschaftlichen Leistungen (ohne Anspruch der Betroffenen, auf Grundlage des Vertragsrechtes) kommt. In diesem Zusammenhang kommt jeder Kritik an der Bürokratie, die (offen oder verdeckt) für die Verlagerungen von Öffentlichen Aufgaben aus dem rechtsgesicherten hoheitsstaatlichen Bereich in einen „unbürokratischen“ privatrechtlichen Bereich verantwortlich ist, besondere Bedeutung zu. Diese Kritik der „bürokratischen“ Verwaltung und ihrer Dienstleistungen wird oft darin zusammengefasst, dass KonsumentInnen und KostenträgerInnen der Dienstleistungen nicht identisch sind, „was grundsätzlich die Gefahr in sich birgt, dass wegen der mangelnden Budgetrestriktion des Nachfragers einer Leistung die Nachfrage ‚grenzenlos’ ist und der Kostenträger für Leistungen bezahlt, in deren Genuss er nicht selbst kommt und von deren Leittext März 2006 Seite 112 Qualität er nicht direkt betroffen ist. Nicht-schlüssige Tauschbeziehungen können deshalb – werden nicht entsprechende vorbeugende Arrangements getroffen – in zu teuren, schlechten Leistungen resultieren“ (Reis 2003:266). Im Gegensatz zu Dienstleistungsangeboten am Markt führt eine hohe Nachfrage nach (sozialen) Dienstleistungen der öffentlichen Hand nicht zu hohen Erlösen und damit zu einem (möglichen) Ressourcenzuwachs, sondern im Gegenteil zu sinkenden spezifischen Ressourcen (Ressourcen pro Leistungseinheit) und damit zum Druck auf den (öffentlich-rechtlichen) Leistungszahler, die Leistungserbringung zu rationalisieren, einzuschränken oder ganz einzustellen. Damit entsteht ein für die öffentliche Beauftragung der Sozialwirtschaft typischer Konflikt: eine Erhöhung des Umsatzes durch steigende Nachfrage wirkt sich nicht in einen steigenden (nachfrageverknappenden) Preis, sondern in steigenden Druck seitens der GeldgeberInnen aus, die Angebote zu reduzieren (bzw. nicht entsprechend der Nachfrage auszuweiten). Das geht in der Regel auf Kosten der Qualität der erbrachten Leistung. Wenn es sich um Leistungen handelt, auf die ein Rechtsanspruch seitens der LeistungsempfängerInnen vorhanden ist (hoheitsstaatliche Aufgaben, die an die Sozialwirtschaft delegiert werden43), entsteht durch diesen Druck auf die LeistungserbringerInnen ein ernster Konflikt, für deren Lösung es keine marktwirtschaftlichen Rezepte gibt. Diese Konflikte müssen im politischen Raum ausgetragen werden (und werden es auch). Dieser Zusammenhang begrenzt die Reichweite „kundInnenorientierter“ Strategien der Öffentlichen Hand auch im New Public Management, und zwar überall dort wo der Zugang von LeistungsbezieherInnen zu den entsprechenden Leistungen nicht – wie in der Marktwirtschaft üblich – durch die Grenze ihrer kaufkräftigen Nachfrage beschränkt wird, sondern wo ein – wie auch immer formulierter – Rechtsanspruch auf diese Dienstleistung besteht. Die Restriktion muss durch politisch normierte (und daher prinzipiell dem politischen Diskurs offen stehende) Zugangsbarrieren in den entsprechenden Leistungsgesetzen geregelt werden (z.B. durch extensive Bestimmungen gegen „Missbrauch“ bzw. „TrittbrettfahrerInnen“). Der „KundInnenbegriff“ ist daher auch im New Public Management, sofern man nicht gänzlich vom Prinzip des Rechtsanspruches auf bestimmte Dienstleistungen und damit die prinzipielle Gleichheit der Versorgungsbedürftigen vor dem Recht abgehen will, deutlich beschränkt. „Umstritten ist allerdings, ob die inhaltlichen Konzepte, die im Begriff ‚Public Management’ bereits terminologisch zusammen geführt werden, überhaupt miteinander kompatibel sind oder ob die sarkastische Bemerkung Walace Sayres zutrifft: ‚Öffentliches und privates Management gleichen sich fundamental in allen unbedeutenden Aspekten’ “ (Reis 2003:260f). Die Erbringung personenbezogener sozialer Dienstleistungen wird immer innerhalb des Dreieckes aus Bedürfnissen (LeistungsadressatInnen), Ressourcen (den Budgets der öffentlichen Kostenstellen) und der Politik (der Entscheidungen des Gesetzgebers bzw. der Verwaltung) entschieden. Zu fragen ist, wie in diesem öffentlichen Diskursraum die Qualität der Dienstleistungen gesichert werden kann. Uns scheint, dass diese Qualitätssicherung ebenfalls nur im öffentlichen (politischen) Diskurs, im Trialog von LeistungsanbieterInnen der 43 Beispielsweise wenn die Unterbringung in einer Notschlafstelle, auf die nach dem entsprechenden Sozialhilfegesetz Rechtsanspruch besteht, an eine Organisation der Sozialwirtschaft delegiert wird. Leittext März 2006 Seite 113 Sozialwirtschaft und „ihren“ LeistungsbezieherInnen, den VertreterInnen der Öffentlichen Hand und der Wissenschaft erfolgen kann. Die verbindende Klammer der Qualitätssicherung im New Public Management bildet „neben den Leistungsgesetzen, die Festlegungen über Art und Maß von Geld-, Sach- und Dienstleistungen enthalten, fachliche Diskurse, in deren Kontext Aussagen getroffen werden über wissenschaftliche und/oder sozialethische Grundlagen von Leistungen. Auf diese Diskurse beziehen sich sowohl die Leistungsanbieter wie auch die politischen Entscheider, die sich nur begrenzt über fachliche Argumente hinwegsetzen können, ohne ihre Legitimation aufs Spiel zu setzen“ (Reis 2003:267). 7.4 Der Nutzen der Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit Wenn es um den Nutzen der Qualitätsdebatte für die Sozialarbeit bzw. für den sozialarbeiterischen Diskurs geht, muss berücksichtigt werden, dass Sozialarbeit in der Regel keine lineare Orientierung im Sinne von Ursache Wirkung hat, sondern in komplexen Kontextbeziehungen steht. Es gilt daher zu bestimmen, welche Bezugsgruppen Nutzen von Sozialarbeit (bzw. von sozialarbeiterischen Leistungen) haben (können), um unterschiedliche, oft widersprüchliche Sinnbeziehungen zur Qualitätsdebatte hinterlegen zu können. Unbedingt zu betrachten sind folgende Bezugsgruppen der Sozialarbeit: AuftraggeberInnen: In der Regel staatliche Stellen („Fördergeber“), aber auch private Organisationen Aufsichtsbehörde: jene staatlichen Stellen, denen die Aufsicht Qualitätssicherung von Sozial- und Gesundheitsdiensten unterliegen GeldgeberInnen: Hier handelt es sich um öffentliche und private GeldgeberInnen, aber auch „KundInnen“, die Entgelte leisten („Eigenmittel“) Vereine – Träger – Vorstände: Die Trägerorganisationen der Sozial- und Gesundheitsleistungen verfolgen als Organisationen des Dritten Sektors spezielle materielle und ideelle Ziele („Arbeit mit Mission“) Öffentlichkeit: Auch die Öffentlichkeit, insbesondere die öffentliche Meinung hat gewisse Erwartungshaltungen an die Träger von Sozialarbeit und deren Qualität KlientInnen: Die Erwartungen der KlientInnen (NutzerInnen) an Sozialarbeit sind entsprechend ihrem „doppelten Mandat“ komplex, sie erhalten sowohl „Hilfe“ als auch „Unterdrückung“, dementsprechend verfügen sie auch über einen „doppelten Qualitätsbegriff“ deren Angehörige: Auch die Erwartungen der Angehörigen können, dem „doppelten Mandat“ folgend, komplex sein und Elemente der Hilfe wie der Einpassung („Normalisierung“) beinhalten andere Träger/Organisationen/KollegInnen: Insbesondere Organisationen, die in der sozialarbeiterischen Leistungskette vor- oder nachgelagert sind, haben bestimmte Leittext März 2006 bzw. die Seite 114 Erwartungen und Anforderungen an die betreffende Organisation, um ihre eigene Arbeit zu optimieren bzw. ihr den optimalen Rahmen zu geben die Profession/Disziplin: Die Profession und die (entstehende) akademische Disziplin erwarten von den einzelnen Einrichtungen und ihrer Tätigkeit insbesondere Professionalität und ein state-of-the-art-Agieren „ich“ selbst: In den komplexen Gefügen der Erwartung(en) an Sozialarbeit gehen die eigenen Ansprüche und Erwartungshaltungen der in der Sozialarbeit Tätigen oft unter; die Qualität der Arbeit in Einrichtungen der Sozialarbeit bildet daher eine wichtige Dimension des Qualitätsdiskurses. Nur ein umfassendes „Stakeholder-Konzept der Sozialarbeit“ ist in der Lage, die komplexen Wirkungsverhältnisse zu erfassen und als Grundlage für die unterschiedlichen Bezugs- und Schnittstellen der einzelnen Stakeholdergruppen zur Qualitätsdebatte zu erkennen. Dabei ist vor allem zu beachten, dass die AuftraggeberInnen der Sozialarbeit oft nicht ihre NutznießerInnen sind, Auftrag und Nutzen von Sozialarbeit wird mit ihrer zunehmenden Vermarktlichung vermutlich sogar noch weiter auseinander fallen. „Auf die Programmformel Hilfe kann Soziale Arbeit nicht verzichten, sie gerät aber zunehmend unter den Druck nachzuweisen, dass solche Hilfen effektiv und effizient im Sinne ökonomischer Vorgaben erbracht werden. In dem Maße, wie sozialstaatliche Gewährleistungen reduziert werden, gerät Soziale Arbeit in Anhängigkeit vom zahlungsfähigen Kunden, die definieren, was in ihrer Sicht das Problem und seine Lösung ist. Diese Kunden sind aber in der Regel nicht die Adressaten Sozialer Arbeit. Hilfe wird dann zu einem Mittel der Problemlösung neben anderen. Soziale Arbeit und Polizei gelten etwa zunehmend als ergänzende Mittel zur Lösung kommunaler Ordnungsund Sicherheitsprobleme. D.h.: Nicht die Problemdefinitionen der Adressaten, sondern die der Kunden bestimmen, was der Anlass und der Zweck der Hilfe ist“ (Scherr 2005:23). Leittext März 2006 Seite 115 8 Standardisierung als Dokumentation von Qualität Durch eine Standardisierung, deren verschiedene Möglichkeiten weiter unten beleuchtet werden, wird die von der Organisation selbst behauptete „Qualität“ extern legitimiert und damit in den Status einer höheren Objektivität erhoben. Eine Organisation erhält von einer Institution (also einer selbst schon „qualitätsgesicherten“ Organisation) einen Titel. „Nur eine Institution (der Titel einer Körperschaft, die über den Rechtstitel verfügt, Titel zu verleihen) kann jemandem seinen Titel verleihen. Diese Institution kann zweifellos durch Personen, ja durch eine einzige Person verkörpert werden, doch wird diese Verkörperung ihrerseits von irgendeiner Institution oder Konstitution garantiert. Dass der verliehene (oder verweigerte) Titel von einer institutionellen Körperschaft verliehen (oder verweigert) wird, bedeutet, dass die Obhut über die Titel wie auch ihre Garantie eben dem zukommt, was an Institutionen bereits den Titel innehat.“ (Derrida 2003:21)44 Die von einer Organisation erreichte (oder behauptete) Qualität kann erst dann marktwirksam gemacht werden, wenn der Markt (das entsprechende Marktsegment) bereit ist, diesen Qualitätszustand anzuerkennen. In Betrieben des Marktsektors wird diese Anerkenntnis in der Regel über das Kaufverhalten durchgesetzt, wiewohl auch hier eine externe Qualitätszertifikation ein Marktvorteil sein kann. Bei Organisationen des Dritten Sektors (der Sozialwirtschaft), die sich in der Regel auf einem sehr viel komplizierteren Markt befinden, wo oft NutzerInnen, AuftraggeberInnen und ZahlerInnen auseinander fallen, ist eine externe Anerkennung des erreichten (oder – noch – nicht erreichten) Qualitätszustandes in den letzten Jahren immer unverzichtbarer geworden. „Qualität, die nicht messbar gemacht werden kann, ist als Gestaltungs- und Steuerungsinstrument für NPOs nicht von großem Nutzen. Deshalb ist bei der Implementierung des Qualitätsmanagementgedankens eine operationale Formulierung der Qualitätsdimensionen und damit verbundener relevanter Merkmalsausprägungen einzufordern. Operationalisierung bedeutet, dass die NPO angehalten ist, bezüglich jeder der genannten Anspruchsgruppen Qualitätsziele und -anweisungen in der Form zu formulieren, dass die Qualitätserfordernisse intersubjektiv eindeutig kommuniziert werden können, von den Zielen Maßnahmen für die Umsetzung abgeleitet werden können, die Zielerreichung messbar und damit kontrollierbar gemacht werden kann.“ (Matul/Scharitzer 1997:401) Es gibt nun verschiedene Strategien der Standardisierung und Qualitätssicherung in sozialen Dienstleistungen; die wichtigsten sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. 8.1 Fachgesetz Qualitätsstandards und der Auftrag zur Weiterentwicklung von Qualität könnte zum Beispiel in einem Fachgesetz niedergeschrieben werden. Als Beispiel könnte das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) genannt werden, wo die Qualität der Pflegeleistungen 44 Hervorhebung im Original Leittext März 2006 Seite 116 genauso festgelegt sind wie die Normen, welche/r VertreterIn aus welchem Gesundheitsberuf welche Leistungen erbringen kann und welche nicht (z.B. das Verabreichen von Infusionen etc.). Auch die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards ist ein Gesetzesauftrag nach dem GuKG). Die Qualitätssicherung wäre allerdings auch durch das Gewerberecht möglich, vgl. auch §1299 ABGB 8.2 Berufsgesetz Qualitätssicherung kann auch durch ein Berufsgesetz erfolgen wie zum Beispiel das „PsychologInnengesetz“ den Berufsstand der Psychologinnen und Psychologen gesetzlich regelt und eine Mindestqualität bei der Berufsausübung durch Festlegung des berechtigten Personenkreises sichert. Auch das derzeit in Begutachtung stehende Berufsgesetz der SozialarbeiterInnen kann eine gesetzliche Basis für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Sozialarbeit sein/werden. Im Entwurf zum Sozialarbeiterinnengesetz des Berufsverbandes soll geregelt werden Berufsbezeichnung und Berufspflichten Berufsberechtigung und Qualifikationsnachweis Berufsausübung Ausbildung und Weiterbildung Österreichisches Sozialarbeitsgremium Aus- und Fortbildungsausschuss Berufungs- und Disziplinarkommission Strafbestimmungen Übergangsbestimmungen (nach dem Entwurf des ÖBDS vom November 2005) 8.3 Selbstbindung durch Eintrag in eine Liste An die Stelle einer gesetzlichen Regelung kann auch eine Selbstbildung an gewisse Qualitätsstandards durch einen Dachverband und/oder eine Berechtigungsliste erfolgen (wie z.B. bei den SupervisorInnen). Hier wird der jeweilige Qualitätsstandard durch den Dachverband/das Gremium, das die Liste verwaltet, festgelegt und laufend garantiert, durch die Aufnahme und Streichung der einzelnen auf der Liste befindlichen Personen durch den Dachverband bzw. das Gremium erfolgt eine laufende (begleitende) Qualitätssicherung der Befähigung/Kompetenz der einzelnen Berufsausübenden. Diese Variante kann gewählt werden, wenn eine gesetzliche Regelung nicht zu erwarten bzw. nicht wünschenswert erscheint. Leittext März 2006 Seite 117 Die Qualitätssicherung bzw. Qualitätsentwicklung erfolgt nicht bereits durch den (kontrollierten) Eintrag in die Liste, sondern dadurch, dass sich die AnwenderInnen bewusst entscheiden, in ihrem Wirkungskreis nur mehr Personen einzusetzen, die sich auf dieser Liste befinden. Es handelt sich also um eine Qualitätssicherung auf dem Markt. 8.4 Staatliches Gütesiegel Auch die Verleihung eines staatlichen Gütesiegels kann eine taugliche Qualitätsmanagementstrategie sein, die insbesondere dort anzuwenden ist, wo eine staatliche Regulierung durch Fach- oder Berufsgesetz nicht zu erwarten oder nicht wünschenswert ist, wo es aber Bereitschaft des Staates (Bund, Land, Gemeinde) gibt, durch eine staatliche Auszeichnung qualitätssichernd aktiv zu werden. Auch dieses Qualitätsmanagementmodell ist ein marktorientiertes Modell, denn es kommt auf die Kundinnen und Kunden (auf die Abnehmer der jeweiligen Dienstleistung) an, ob und in welchem Ausmaß Organisationen mit diesem Gütesiegel bevorzugt werden bzw. in welchem Ausmaß mit dieser Strategie nicht qualitätsgesicherte Organisationen vom Markt verdrängt werden können. 8.5 ISO-Zertifizierung Auch eine Ablaufzertifizierung durch ISO oder ein ähnliches Zertifizierungsinstrument kann sich als qualitätssichernde Strategie eignen, allerdings wird diese Qualitätsmaßnahme vor allem dort anzuwenden sein, wo es sich um (auch) produzierende Organisationen handelt, etwa um sozialökonomische Betriebe oder um geschützte Werkstätten, die neben der sozialen Aufgabe auch eine Marktaufgabe erfüllen (müssen) und auf diese Markt vergleichbare (oder die selben) Qualitätsmanagementstrategien anwenden müssen wie ihre MitbieterInnen. 8.6 TQM-Zertifikate + Qualitäts-Preis Die hier gewählten Zertifizierungen relativieren bereits den Namen „Zertifikat“, es ist hier von „Qualitätspreisen“ die Rede. Die Bewertungsstrategien unterscheiden sich in den einzelnen Systemen (TQM, EFQM, AFQM…). 8.7 (Neue) Zertifizierungsstrategien + Gütesiegel 8.7.1 Zertifizierung und Gütesiegel aus Sicht der Sozialarbeit Dies ist ein umstrittenes Thema. DIN EN ISO und EFQM machen es vor – also muss dies auch für den Sozialbereich gelten – oder etwa doch nicht? Speck spricht von der „Zertifizierungsfalle“ und meint damit: Leittext März 2006 Seite 118 „Eine Zertifizierung ist an sich lediglich ein Beleg dafür, daß hier bestimmte Standards und Arbeitsabläufe zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen worden sind, und daß die gemessenen Daten bestimmte Normen entsprechen. Der Beleg geht aus bestimmten Dokumenten hervor. – Deren Erstellung beansprucht im übrigen einen beachtlichen Teil der Arbeitszeit (bis zu 20%?), geht als für die eigentliche soziale Tätigkeit verloren. Das Entscheidende unter dem Aspekt von sozialer Qualität aber ist eine Verschiebung der Akzente, die im allgemeinen unbeachtet bleiben: Das Normhafte, das Meßbare, das Zertifizierbare wird maßgebend, während das Unberechenbare und unvergleichlich und unaustauschbar Eigene, als Menschlichkeit und Eigenverantwortlichkeit des Anderen in den Hintergrund treten und an Bedeutung einbüßen. Damit wird eigentlich diejenige Qualität eher verhindert, von der gesagt werden muß, daß sie für die Beteiligten bedeutungsvoll ist, nämlich diejenige, die auf der Persönlichkeit beruht, deren freie Entfaltung durch das Grundgesetz garantiert ist. Eigenmotivierung und Zertifizierung sind kaum miteinander vereinbar (Krönes 1998, 85.)“ (Speck 1999:158f). Bei Merchel liest man, dass in der Fachliteratur folgendes Urteil zugespitzt formuliert wurde: „„Zertifizierung mögen bestenfalls unschädlich sein – sie sind aber mindestens überflüssig!“ (Gerull 2000, S. 2-126)“ (Merchel 2004:179). Merchel macht weiters darauf aufmerksam: „Es lohnt sich daher, die Zertifizierungsbefürworter und deren Motive noch einmal genauer zu betrachten, ihre Interessen und deren Realisierbarkeit zu bewerten sowie die fachlichen und fachpolitischen Perspektiven und Folgen, die mit einer stärkeren Ausbreitung von Zertifizierung in der Sozialen Arbeit verbunden sind, zu diskutieren“ (Merchel 2004:180). Zu den Motiven der ZertifizierungsbefürworterInnen vergleiche Merchel 2004:184-188. Im Kapitel „Qualitätsentwicklung versus Zertifizierung“ stellt er folgende These auf: „… dass eine sich ausbreitende Zertifizierungspraxis der Qualitätspolitik der Sozialen Arbeit insofern Schaden zufügen würde, weil der prozessbezogene und dialogorientierte Entwicklungsgedanke, der dem Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit angemessen ist, durch das der Zertifizierung zugrunde liegende Konzept konterkariert würde.“ (Merchel 2004:188). Er begründet diese These mit vier Argumenten: „1. Durch Zertifizierung wird der Glaube an ein interessensunabhängiges Qualitätskonstrukt gefördert, was letztlich zu dem Effekt führt, dass eine „dialogische Qualitätskultur“, auf die die Soziale Arbeit angewiesen ist, nicht entsteht oder untergraben wird. (…) 2. Auch innerhalb der Einrichtungen besteht die Gefahr, dass das „Produkt Zertifikat“ zum zentralen Bezugspunkt für die Mitarbeiter wird. (…) 3. Insbesondere bei den Zertifizierungen nach DIN ISO 9000 ff., aber nicht nur bei diesen Formen der Zertifizierung wird ein großer Aufwand betrieben zum Zwecke der Formalisierung, der in Spannung steht zur Individualität des Handelns in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. (…) 4. Zertifizierungen sind stärker auf die Perspektiven der Kontrolle ausgerichtet und stehen in Spannung zum Interesse, über Formen des Qualitätsmanagements Lernen in Organisationen anzuregen. (…)“ (vgl. Merchel 2004:189ff). Leittext März 2006 Seite 119 Zusammenfassend meint Merchel: „Nach den dargelegten Argumenten dürfte deutlich geworden sein, dass Zertifizierungen keine angemessene Perspektive für da Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit darstellen, zum einen weil sie die mit diesen Verfahren verbundenen Erwartungen nicht einlösen können, und zum anderen, weil Zertifizierungen in ihrer Verfahrenslogik in deutlicher Spannung stehen zu den speziellen, für das Qualitätsmanagement relevanten Gegebenheiten in der Sozialen Arbeit. Dies gilt für den Ansatz der Zertifizierung generell, nicht nur für die ISO-Zertifizierungen. Formen der prozessorientierten Qualitätsentwicklung sind allemal für die Soziale Arbeit Erfolg versprechender als aufwendige und in ihrem Wert zweifelhafte Zertifizierungen. In diesem Sinne stellt in der Sozialen Arbeit die Qualitätsentwicklung die Alternative zur Zertifizierung dar.“ (Merchel 2004:191f). Trotz dieser ablehnenden Haltung findet sich in Deutschland eine unüberschaubare Vielzahl von verschiedensten Modellen, von denen hier nur ein kleiner Auszug dargestellt wird (vgl. Merchel 2004:181ff): Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat eine eigene Zertifizierung Paritätischer Wohlfahrtsverband mit „Initiative Qualität“ und der gegründeten „Paritätischen Gesellschaft für Qualität mbH“ hat das „Paritätische Gütesiegel“ (PQSys) entwickelt Evangelische Kirche gründete das „Diakonische Institut für Forschung und Qualitätsmanagement“, welches u.a. die Aufgabe hat „…Gütesiegel zu konzipieren und die Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes in Zertifizierungsfragen zu beraten“ Caritas Verband: Zertifizierungsgesellschaft gründet „proCum Cert GmbH“ vorerst für den Krankenhausbereich 8.7.2 Ausgewählte Beispiele zu Zertifizierung/Gütesiegel Im Folgenden werden nun ein paar ausgewählte Verfahren und ihre Zertifizierung dargestellt. 8.7.2.1 2Q-System „Bei dem 2Q-System handelt es sich um ein in der Schweiz entwickeltes Verfahren für Qualitätsmanagement. Die Abkürzung 2Q steht für Qualität und Qualifizierung. Das erste Q umfasst die Qualität der Arbeit: Es beinhaltet Entwicklung, Steigerung und Sicherung von Qualität. Das zweite Q bedeutet die Qualifizierung der MitarbeiterInnen: Auf der Basis einer Kombination von Führung und Selbstführung verbessern die MitarbeiterInnen ihr berufliches Können und entwickeln sich sowohl fachlich als auch persönlich weiter.“ Der Schweizer Arbeitswissenschaftler Prof. Dr. Karl Frey von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich entwickelte das System Anfang der 90er-Jahre. 2Q entstand ursprünglich im Regierungsauftrag, mit dem Ziel, die Leistungen von MitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes zu verbessern. Leittext März 2006 Seite 120 Grundlage des 2Q-Systems bilden wissenschaftliche Erkenntnisse zur optimalen Arbeitsorganisation, über Bedingungsfaktoren für hohe Arbeitsleistung und zur Mitarbeiterführung. Diese Wissenschaftsbasierung unterscheidet das 2Q-System von vielen anderen Qualitätsmanagementsystemen. Das Konzept wird durch die Frey Akademie in Zürich, die auch in Deutschland und Österreich Niederlassungen besitzt, vermarktet. Neben dem 2Q vertreibt die Frey Akademie noch ein weiters Qualitätssystem, das QAP – Qualität als Prozess-, welches sich am Qualitätssystem der European Foundation for Quality Management (EFQM) orientiert.“ (Büker 2003:75). Und zur Zertifizierung: „Ein Unternehmen, welches 2Q eingeführt hat, kann sich auch zertifizieren lassen. Unabhängige, externe Auditoren prüfen und beurteilen das Qualitätssystem nach vorgegebenen Kriterien. (…) Das 2Q-Zertifikat für „Qualität der Arbeit und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ wird durch die 2Q-Corporation vergeben und ist zwei Jahre gültig. Präsident der 2Q-Corporation ist der Urherber der 2QMethode, Professor Dr. Karl Frey.“ (Büker 2003:80). 8.7.2.2 Berufsregister als Gütesiegel der Sozialen Arbeit (Deutschland) Ein weiteres Modell beschäftigt sich auf eine ganz spezifische Art mit Zertifizierung. Dieses Berufsregister orientierte sich am Niederländischen Modell (vgl. Jost 2004:18f, Jost 2004: 21f, Vos 2004:115f) und registriert Tätige in der Sozialen Arbeit, wie: SozialabeiterInnen, SozialpädagogInnen, HeilpädagogInnen, SozialwirtInnen, aber auch ErziehungswissenschaftlerInnen (vgl. http://www.berufsregister.de/ausuebende.php (Stand 13.04.2005) eingesehen am 24.02.2006). Die registrierten Personen können eine Zertifizierung für 5 Jahre erhalten, wenn sie die vorausgesetzten Kriterien erfüllen (vgl. ebd.). Eine weitere Schiene dieses Berufsregisters ist die Zertifizierung von Fortbildungs- oder Weiterbildungseinrichtungen (vgl. http://www.berufsregister.de/wbeinrichtungen.php, eingesehen am 24.02.2006). Weitere Texte dazu unter http://www.berufsregister.de/woher.php (24.03.2006): Grundlegendes zum BSA - http://www.berufsregister.de/grundlegend.php Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsunlust http://www.berufsregister.de/qualitaet.php Nutzen des BSA - http://www.berufsregister.de/nutzen.php Geschichte des BSA und Internationaler Vergleich http://www.berufsregister.de/geschichte.php Qualität Sichern – Vertrauen stärken - http://www.berufsregister.de/vertrauen.php Berufsregister f.S.A. – Zertifizierungen http://www.berufsregister.de/zertifizierungen.php Leittext März 2006 Seite 121 8.7.2.3 „Sozialgütesiegel“ – Gütesiegel für Soziale Integrationsunternehmen: Dieses Gütesiegel entspringt der Arbeit eines EQUAL-Projekts (durchgeführt vom SÖBVerband Steiermark) und ist speziell für „SIUs“ (Soziale Integrationsunternehmen) konzipiert worden. In Österreich werden hier vor allem folgende Unternehmen angesprochen: Sozial-Ökonomische Betriebe (SÖB) Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) Beschäftigungsgesellschaften (BG) „Das Gütesiegel ist für Unternehmen und Organisationen gedacht, die soziale und berufliche Integration von Menschen als vorrangiges Ziel definieren“ (http://www.soeb.at/0307/_pdf/lf_v07_web.pdf, Jänner 05 – Leitfaden für Soziale Integrationsunternehmen Seite 6). Weitere Informationen (eingesehen am 14.12.2005): Allgemeine Information - http://www.soeb.at/0307/_pdf/sgs_v15_web.pdf, Jänner 05 Jahresbericht 2003 - http://www.soeb.at/0307/_pdf/jahresbericht03.pdf, April 2004 Jahresbericht 2002 - http://www.soeb.at/0307/_pdf/jahresbericht02.pdf, Kriterienkatalog zum Gütesiegel für Soziale Integrationsunternehmen http://www.soeb.at/0307/_pdf/lf_v07_web.pdf, Jänner 05 Leitfaden für Soziale Integrationsunternehmen http://www.soeb.at/0307/_pdf/lf_v07_web.pdf, Jänner 05 8.7.2.4 QSI Im Qualitätshandbuch QSI – das ebenfalls in einem EQUAL-Projekt entwickelt wurde – finden sich Standards für Ausbildungen im Integrationsbereich und zur Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt.).Weitere Informationen in: QSI (Hrsg.) (2004): Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit – Erkenntnisse und Empfehlungen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft QSI (Qualitätshandbuch). Wien 8.8 Schlussfolgerungen für unsere Debatte Für die weitere Qualitätsdebatte der EQUAL-Partnerschaft „Donau – Quality in Inclusion“ wird es nun darum gehen, einerseits konkrete Aufträge und Anforderungen an die Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsstrategien der einzelnen Bereiche sozialer Arbeit zu formulieren und danach gemeinsam zu entscheiden (zu erarbeiten), welche Qualitätssicherungsstrategie sich für welche Aufgabe am besten eignet bzw. am realistischsten durchgesetzt werden kann. Dabei wird jeweils zu diskutieren sein, ob Qualitätsmanagement unbedingt mit einem Zertifikat erfolgen soll oder ob jeweils eine andere Strategien sinnvoll(er) wäre. Leittext März 2006 Seite 122 Entscheidend für den Erfolg der Entwicklungspartnerschaft wird sein, ob wir in der Lage sein werden, trialogisch eine Zertifizierungsstrategie oder etwas vergleichbar Gutes bzw. Anderes zu erarbeiten, die von den öffentlichen beauftragten Stellen als Grundlage für ein auf Qualität ausgerichtetes Vergabeverfahren im Rahmen des Vergaberechtes verwendet werden kann und dann auch verwendet wird. Dazu bietet der hier vorgelegte „Basistext“ eine Diskussionsgrundlage für die weitere Arbeit in den Modulen und der gesamten Partnerschaft. Leittext März 2006 Seite 123 9 Rückbindung: Von den Standardisierungssystemen zur Qualitätsbestimmung 9.1 Gemeinsame Ziele-Systeme Qualitätsentwicklung als Grundlage von Die Entwicklung von Qualitätsstandards und ihre Zertifizierung erfordert ein gemeinsames Zielesystem und zwar nicht nur auf der Ebene von deklamatorischen Grundsatzzielen 45, sondern auf der konkret operationalisierbaren Ebene abrechenbarer Zielsetzungen. „Ziele müssen messbar gemacht werden, um erkennen zu können, ob und was verändert wurde. Gleichzeitig sind Aussagen darüber erforderlich, welche quantitativen (z.B. Bearbeitungszeiten) und qualitativen Standards (z.B. Grad des Selbsthilfepotenziales) dabei erreicht werden sollen“ (Jung 2003:401). Diese Ziele erfordern den Trialog zwischen der beauftragenden Öffentlichen Stelle, der durchführenden Organisation (und gegebenenfalls der von ihr betreuten/erreichten Personen) und der begleitenden Sozialarbeitswissenschaft, der (im besten Fall) zu einem gemeinsamen Committment über Ergebnisziele führt. Auf Grundlage dieser gemeinsam festgelegten Ziele kann ein adäquates Qualitätsmanagement aufgebaut werden. Dabei geht es darum, fachliche Standards und sozialpolitische Ziele als Grundlage und Elemente eines Qualitätsmanagements im trialogischen Diskurs zwischen den Einrichtungen der Sozialarbeit, der Sozialarbeitswissenschaft und den beauftragenden öffentlichen Stellen zu vermitteln. 9.2 Die „besondere Qualität des Sozialen“ Die Qualitätsdimensionen in der Sozialarbeit können als Zwischenergebnis unserer bisherigen Arbeit bereits recht umfassend dargestellt werden, wobei von einem hohen Komplexitätsgrad des Qualitätsprozesses und von vielen Kontextbezügen im Wirkungsfeld der Sozialarbeit und ihrer relevanten Umwelten ausgegangen werden muss. 9.2.1 Qualitätsdimensionen – was gibt es? Als Ausgangspunkt dienten die drei Dimensionen Struktur – Prozess – Ergebnis, aufbauen auf Donabedian 1982. Hier werden die Erweiterungen der Fachliteratur zusammen getragen und zu einem Bild verarbeitet. Das Modell von Donabedian beschreibt mit den Dimensionen folgendes: 45 Müller-Schöll und Priebke (1992:46ff) unterscheiden drei Ebenen von Zielen (1) Grundsatzziele, (2) Rahmenziele, (3) Ergebnisziele, wobei nur die Ergebnisziele (und die darauf allenfalls aufbauenden Handlungsziele) konkret abrechenbare Ziele im Sinne einer Erfolgs- und Ergebniskontrolle sein können Leittext März 2006 Seite 124 Struktur: objektive Rahmenbedingungen: Ausstattung, die materiellen und personalen Ressourcen usw. (Personalschlüssel, Qualifikationen…), die technische Ausstattung Prozess: Aktivitäten zwischen Leistungserbringer- Leistungsempfänger und impliziert die Art und Weise wie Leistungen erbracht werden (Aufnahmeverfahren…) Ergebnis: Gesamtresultat der Dienstleistung => Nutzen des Kunden und Veränderung des Kunden z.B.: Gesundheitszustand, Verhalten… (vgl. dazu Merchel 2004:39/ Mülhausen 2004:31) Diese drei Dimensionen wurden erweitert durch: Spiegel, Hiltrud v., mit Konzeptqualität: „Und seitdem die berühmte Trias Ergebnis-, Prozess- und Strukurqualität von Donabedian für die Soziale Arbeit um die Dimension der Konzeptqualität ergänzt wurde (v.Spielgel 1998), ist auch die Auseinandersetzung mit den Zielen und Wertvorstellungen der zu untersuchenden Projekte oder Einrichtungen wahrscheinlicher geworden.“ (Heiner, Maja 2004:132). Spiegel unterscheidet vier Perspektiven: Konzeptionelle Perspektive (Innovation): Konzeptionelle Ziele in Handlungen umsetzen und Überprüfung von Zielannäherung – Bewertungskriterien Angemessenheit und Effektivität Prozessperspektive (Aufklärung) Strukturelle Perspektive (Qualifizierung) Ergebnisperspektive (Kontrolle) (vgl. dazu Spiegel 1998:353f). Eine andere Dimension: Normqualität: „„Diese Dimensionen (gemeint sind die drei Dimensionen von Donabedian, Anm. d. Verfassers) wurden um eine weitere Ebene – genannt Normqualität – ergänzt, mit der die inhaltliche und sozialpolitische Angemessenheit der in Frage stehenden Qualitätskonzepte erfasst und bewertet werden sollte.“ Boeßenecker/Vilian/Biebricher/Buckley/Markert 2003:8) Die Überlegungen zu dieser Erweiterung gehen zurück auf Heiner (vgl. Heiner, Maja 1996: 210-230). Frank Luschei und Archim Trube sehen die drei Ebenen von Donabedian folgendermaßen: Strukturqualität sind Rahmenbedingungen, z.B. Raum, Zeit, Ort Prozessqualität ist Verlauf, z.B. Bildung von Selbstbewusstsein, Entdeckung eigener Kompetenz Produktqualität (Ergebnisse) sind z.B. Integration in den Arbeitsmarkt, Entschuldung, Beschaffung von Wohnraum (vlg. Luschei/Trube 2001:196ff) Leittext März 2006 Vertrauen, Entstehung von Seite 125 und sie schlagen weiters vor, die Prozessqualität um die Procederequalität zu erweitern (vgl. Luschei/Trube 2001:196): Es „(…) gilt (…) eine vierte Dimension in die Qualitätsbewertung mit einzubeziehen, und zwar die Verfahrensweisen (Methoden, Techniken), d.h. das Procedere, wie Leitungen erbracht werden. Hier kann unabhängig vom Ergebnis (Produkt) und Verlauf (Prozess) beurteilt werden, ob die Arbeitsweise (wenigstens) dem Stand der Kunst, d.h. den fachlichen Standards („state of art“), entsprach oder aber nicht.“ (Luschei/Trube 2001:197) Weiters fallen noch folgende Begrifflichkeiten in Zusammenhang mit den Dimensionen von Qualität: Dienstleistungsqualität/Beziehungsqualität (vgl. Baur, Uta/ Herrmann, Gerhard 2004:174) Orientierungsqualität (vgl. Speck 1999:177, geht zurück auf Brunner, Ewald Johannes 1998:8-15) Lebensqualität (Speck 1999:178) Planungsqualität (aus Knorr/Halfar 2000:80) Programmqualität (Sheehan/Snyder/Sheehan: 114-131) Führungsqualität 2003:132) Servicequalität (Meinhold/Matul 2003:39ff) (Verantwortung der Entscheidungsträger (vg. Wanke, H.J. Um diese Vielfalt von Begriffen etwas einordnen zu können folgende Abbildung: Leittext März 2006 Seite 126 Dienstleistungsqualität/ Programmqualität KONZEPT - DIMENSION NORM - DIMENSION STRUKTUR oder POTENTIAL - DIMENSION umfasst: Überprüfung der konzeptionellen Ziele in der Umsetzung in umfasst: inhaltliche und Handlungen und Grad sozialpolitische der Zielerreichung Angemessenheit: WERTE umfasst: objekt. Rahmenbedingungen: Ausstattung, materielle und personale Ressourcen (Personalschlüssel, Qualifikationen…), technische Ausstattung Planungsqualität Führungsqualität Lebensqualität PROZESS - PROCEDERE - DIMENSION DIMENSION ERGEBNIS - DIMENSION umfasst: Verlauf z.B.: Bildung von Vertrauen, Entstehung von Selbstbewusstsein, Entdeckung eigener Kompetenz… umfasst: Instrumente z.B.: Diagnoseverfahren, Techniken der Gesprächsführung, Methoden des Casemanagements…. umfasst: Gesamtresultat der Dienstleistung => Nutzen für den KundInnenen und Veränderung des KundInnen z.B.: Gesundheitszustand, Verhalten… Beziehungsqualität => Schlüsselbegriff, Produktqualität: wenn es um KundInnenorientierung geht. messbar ist z.B.: Integration in den Arbeitsmarkt, Entschuldung, Beschaffung von Wohnraum… Orientierungsqualität => gemeinsame Interessen + Reflexion über gemeinsame Basis ("Reflexionskultur") Unterscheidung: OUTCOME OUTPUT Servicequalität Der Zusammenhang von Output und Outcome wird von Müller (1997:218f) wie folgt dargestellt: „Wenn wir sorgfältig und nach den Regeln der Kunst arbeiten, dann können wir Leittext März 2006 Seite 127 ziemlich genau sagen, was wir machen und was wir gemacht haben (output), aber wir haben wenig zuverlässiges Wissen über das, was wir bewirken (outcome). Das ist ein Strukturproblem von Dienstleistungen. Und es ist ein besonderes Problem von personenbezogenen Dienstleistungen in der Sozialen Arbeit. Darum haben wir unsere Schwierigkeiten mit dem betriebswirtschaftlichen Dienstleistungsbegriff. Er ist im wesentlichen an Dienstleistungen orientiert, die wie Ware behandelt, als gekauft und in Anspruch genommen werden können. Nehmen wir den Kundendienst eines Markenkühlschrankes. Wenn das Ding kaputt ist, kann man den Kundendienst anrufen. Er schickt einen Techniker, der sieht und analysiert den Schaden, ersetzt kaputte Teile, berechnet Material- und Lohnkosten (es sei denn, wir befinden uns noch in der Garantiephase) und hinterlässt uns erleichtert. Seine Dienstleistungen lassen sich unschwer und output-orientierte standardisieren.“ 9.3 Ebenen qualitätsgesicherter Sozialarbeit Es gilt nun, jene Dimensionen zu bestimmen, die für „gute“ (also: qualitätsgesicherte) Sozialarbeit nötig sind. Diese Bestimmung wird wesentlich von den Erfahrungen/Ergebnissen der anderen Module der Entwicklungspartnerschaft abhängen und soll in den kommenden Monaten in einem gemeinsamen Dialog entwickelt werden. Hier können nur erste Anregungen entwickelt werden. 9.3.1 Lebensweltorientierte Qualitätsentwicklung Speck (1999:127) definiert eine „lebenswertorientierte Qualitätsentwicklung“ als Kern sinnvoller Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit: „Diese wird sich auf eine entsprechende Integration fachlicher und institutioneller Qualität im Sinne von Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit zugleich beziehen müssen (…) Es bleibt komplex, d.h. unberechenbar, auch wenn gelernt werden muss, dass das Unberechenbare nicht gleichbedeutend ist mit Verzicht auf Rechenschaftslegung“ (Speck 1999:127). Als Bestandteile für die Entwicklung eines Leitbildes für „soziale Qualität“ nennt Speck (1999:130) vor allem folgende sechs Werte: Menschlichkeit Autonomie Professionalität Kooperativität Organisationale Funktionabilität Wirtschaftlichkeit Diese sechs Werte, jedenfalls noch zu ergänzen um die Werte Inklusion Gleichstellung Leittext März 2006 Seite 128 stehen miteinander in enger Wechselwirkung, sind aber im jeweiligen Kontext zu betrachten und auszuformulieren. Diese Vernetzung kann, angelehnt an Speck (1999:143), aber ergänzt um die zwei oben genannten Werte wie folgt dargestellt werden: 9.3.2 Qualitätsbausteine und ihre Wechselwirkung Menschlichkeit Inklusion Kooperativit ä Wirtschaftlichkeit Autonomie Gleichstellung Professionalität Organisationale Funktionabilität Abb. 14: Qualitätsbausteine und ihre Wechselwirkung Dieses Bild hat – wie jedes Schema – seine Erklärungsgrenzen, es soll aber deutlich machen, dass es sich bei qualitätsorientierten Leitbildern um keine „Strukturen“, sondern um „Prozesse“ handelt, denn aus der gegenseitigen Wechselwirkung der acht dargestellten Faktoren entstehen unterschiedliche und oft widersprüchliche und daher in der praktischen Anwendung immer wieder flüchtige, weil sich verändernde Gesamtaussagen – was aber erhalten bleibt ist ein Prozess, der wesentlich von den acht hier dargestellten Pfeilern getragen wird (werden sollte). Wichtig ist aber, und hier setzt unsere Kritik an Speck (1999) ein, dass sowohl die Entwicklung von Qualitätsleitbildern wie ihre Bewertung von der Analyse und Bewertung von Interessen und nicht von Moral getragen sein sollte. Qualitätsgesicherte soziale Strukturen und Organisationen funktionieren dann „gut“, wenn sie im Einklang mit den Interessen (und das schließt eine klare Analyse ihrer Widersprüche mit ein) den handelnden und beteiligten Personen stehen. Organisationen, die nur dann „gut“ funktionieren, wenn die agierenden Personen „gut“ sind, sind – zumindest – suboptimal konfiguriert (vgl. Schmid 2004). Gerade für die Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit wäre es wichtig, den Blick von der moralischen Debatte hin zur Professionalisierungsdebatte zu wenden, wobei unter „Ent-Moralisierung“ der Sozialarbeit kein Verzicht auf Ethik zu verstehen ist, aber die Aufgabe jener Moralvorstellung, die da meint, Sozialarbeit wäre per se berufen, das Gute zu fördern und das Schlechte zu bannen (vgl. Schmid 2004). Die Leittext März 2006 Seite 129 Effekte, die Sozialarbeit und ihr Qualitätsdiskurs von einem systemtheoretischen Blickwinkel gewinnen könnten, wären zweierlei, erstens „ein cooling-out im Blick auf die Moral, die das System nachgerade parasitär besetzt und – aus meiner Sicht – weitgehend lähmt. Der andere, damit zusammen hängende Effekt wäre vermutlich, dass mit dem Wegpumpen von Moral (und das leistet die Systemtheorie vorzüglich) der Weg frei würde für eine Professionalisierung, aus der – neben einer minimalen Ethik – insbesondere resultieren könnte, dass man endlich dazu übergeht, festzulegen, was man können muss (!), wenn man diesen Job machen will.“ (Fuchs 2005:13) Bei der Entwicklung qualitativ hoch stehender Sozialarbeit bietet der Rückgriff auf Methoden aus der Betriebswirtschaftslehre Möglichkeiten, die aber nur dann zu Chancen werden, wenn sie kritisch, das heißt reflektiert genutzt werden (können): „Soziale Arbeit ist dadurch angehalten, dass sie das, was sie tut, an den tatsächlichen Ergebnissen misst, die sie bewirkt – und nicht an den ehrenvollen und moralischen Intentionen ihrer Akteure. Sie muss sich im Zuge der Ökonomisierung fragen lassen, wie sie die öffentlich bereit gestellten Mittel einsetzt, welche Methoden sie nutzt, was sie damit erreicht und schließlich, ob das, was sie erreicht, nicht auch effektiver und effizienter erreicht werden könnte. Andererseits sind betriebswirtschaftliche Kategorien in der Sozialen Arbeit problematisch, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. So ist z.B. die Idee, dass man Ziele planen kann, um diese dann methodisch in Ergebnisse zu verwandeln, für nichttriviale Prozesse, wie wie sie in der Sozialen Arbeit ablaufen, nicht passend. In der Sozialen Arbeit haben wir es mit Abläufen zu tun, die chaotisch, eigendynamisch, in ihren Entwicklungen unvorhersehbar sind. Daher greifen klassische ökonomische Kriterien, die von planbarer Effizienz und Effektivität ausgehen, zu kurz und werden der Sozialen Arbeit nicht gerecht. In diesem Zusammenhang scheint es wichtig, die betriebswirtschaftlichen Kriterien nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern sie so umzuarbeiten, dass sie der Sozialen Arbeit angemessen sind.“ (Kleve 2005:51) Bei den hier zur Diskussion stehenden Leistungen der Sozialwirtschaft handelt es sich vor allem um personenbezogene Dienstleistungen, deren Erfolg wesentlich von der Mitwirkung der LeistungsempfängerInnen abhängt, deren Qualität also zu einem nicht unbeträchtlichen Teil durch die Beziehungsqualität der LeistungserbringerInnen abhängt. Für die Festmachung der Qualität dieser Dienstleistungen ist also ein komplexes Qualifikationsprofil erforderlich, dass aus den drei Bestandteilen Können – Wissen – Haltung besteht (vgl. QSI, 2004). Für die Sicherung der Qualität der persönlichen Dienstleistungen ist ein spezifisches Herangehen im Qualitätsmanagement erforderlich. „Ist die Quantität und Qualität der Leistungserbringung aber derart rückgebunden an die Person dessen, der die Leistung erbringt und sind Kontrollen zwar prinzipiell möglich, aber systematisch unterkomplex (sie beziehen sich beispielsweise auf bereits selektive Produkte wie Akten, Fallberichte o.ä.), so ist es gerechtfertigt, soziale Arbeit, die als personenbezogene Dienstleistung erbracht wird, organisationstheoretisch analog zu hoch qualifizierten Dienstleistungsarbeiten zu analysieren. Und für diese gilt (…), dass die Koordination der Arbeit, d.h. ihre Einbindung in den Kontext der Organisation, vorwiegend über Vertrauensbeziehungen erfolgt.“ (Reis 2003: Leittext März 2006 Seite 130 273). Dies erfordert eine Einschränkung der Kontrollierbarkeit dieser Beziehungsarbeit, was auch in der gewählten Qualitätszertifizierung zu beachten ist und unter Umständen komplexe und wahrscheinlich nicht konfliktfreie Situationen schaffen wird. Reis stellt zwei Anforderungen für die Entwicklung von Qualitätssicherungsregimes, die den Anforderungen der Sozialwirtschaft als Produzentin personenbezogener Dienstleistungen mit einem zusätzlichen „versteckten“ Auftrag („Arbeit mit Mission“) zur Diskussion: „Überall dort, wo die Steuerung durch formale Anweisungen und Vorgaben versagt (und dies dürfte für weite Teile der Produktion personenbezogener Dienstleistungen zutreffen), muss auf Formen konsensorientierter Steuerung, beispielsweise durch Zielvereinbarungen, zurückgegriffen werden. Dabei ist der Begriff ‚Vereinbarung’ ernst zu nehmen, denn in dem unwegsamen Gelände personenbezogener Dienstleistungen, in dem Wirkungen und damit Zielrealisierungen nur schwer feststellbar sind, sind die Vorgesetzten auf die Offenheit, Motivation und Kooperationsbereitschaft ihrer MitarbeiterInnen angewiesen und können Ziele nicht einfach ‚vorgeben’, es sei denn mit einem solchen Abstraktionsgrad, dass ihre Realisierung immer schon nachgewiesen werden kann. Die Steuerung durch Zielvereinbarungen birgt die Gefahr in sich, dass die Organisation in ein Gewirr von Einzelsystemen und Einzelvereinbarungen zerfällt und die Identität und Kontinuität der Gesamtorganisation aus dem Blickfeld gerät. (…) Hier haben Bestrebungen des Aufbaues einer ‚Unternehmenskultur’, sei es in Form einer nach außen getragenen ‚Corporate Identity’ oder – bescheidener – eines internen Leitbildes oder der institutionellen Förderung informeller Sozialbeziehungen ihren systematischen Stellenwert.“ (Reis 2003:279f). 9.4 Spezifika personenbezogener Dienstleistungen Dieses Kapitel beginnt mit der Definition von Begriffen: Dienstleistung: „Beabsichtigtes immaterielles Produkt, erbracht durch Tätigkeiten, von denen mindestens eine notwendigerweise an der Schnittstelle zwischen Lieferant und Kunde ausgeführt wird“ (Zollondz 2001:159). Und weiter: „Typischerweise kann man eine Dienstleistung nicht vorab erbringen und ‚auf Lager legen’ – vielmehr kann sie nur zu gewissen Zeiten erbracht werden, beispielsweise das Haarschneiden nur dann, wenn der Kunde beim Frisör ist“ (Zollondz 2001:59). Bei den von uns erfassten Dienstleistungsbegriff geht es vor allem um die Prozessorientierung und darum, dass der Kunde aktiv mitwirken muss um die Dienstleistung erst möglich zu machen (viel zitiertes uno-actu-Prinzip: zusammenfallen von Produktion und Konsumtion). Die Tätigkeit der SozialarbeiterInnen lässt sich am besten mit dem Begriff „Beziehungsdienstleistung“ beschreiben und hat einige „Besonderheiten“ aufzuweisen: Sie ist zurückzuführen auf Donabedians Vorschlag der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität: Leittext März 2006 Seite 131 beschreibt STRUKTUR objekt. Rahmenbedingungen ist abhängig von Potentiale MitarbeiterInnen Potentiale UserInnen PROZESS Aktivitäten S.A. <=> UserInnen ERGEBNIS Gesamtresultat Potentiale Einrichtung/Anbieter Kommunikationsfähigkeit UserInnen als und KoKooperationsfähigkeit d. Einflüsse ProduzentInnen UserInnen Umwelt "KundInnenzufriedenheit" DYNAMIK UNO-ACTU-Prinzip Output Was sagen Zahlen über eine Einrichtung: Ergebnisse/ „Belegung“ Kennzahlen Folgequalität, Nachhaltigkeit, Outcome Hilfe zur Selbsthilfe Wie ist das messbar? Abb. 15: Besonderheiten der Beziehungsdienstleistungen Die Beschreibung der Dimensionen: Struktur: objektive Rahmenbedingungen: Ausstattung, die materiellen und personalen Ressourcen usw. (Personalschlüssel, Qualifikationen…), die technische Ausstattung Prozess: Aktivitäten zwischen Leistungserbringer- Leistungsempfänger und impliziert die Art und Weise wie Leistungen erbracht werden (Aufnahmeverfahren…) Ergebnis: Gesamtresultat der Dienstleistung => Nutzen des Kunden und Veränderung des Kunden z.B.: Gesundheitszustand, Verhalten… Leittext März 2006 Seite 132 Der Bereich der Beziehungsdienstleistungen ist abhängig von: Struktur: Potentialen/Ressourcen des Anbieters (Räumlichkeiten…) und auch von Potentialen/Ressourcen der MitarbeiterInnen (Ausbildung…) – wie auch der Potentiale/Ressourcen der KlientInnen (Pflichtklientschaft vers. Freiwilligkeit) Prozess: Dynamik, von nicht kontrollierbaren Einflüssen von Außenwelt Produktion von Dienstleistung und Konsumtion fallen zusammen (Uno-actu-prinzip) UserInnen als Ko-Produzenten (Beziehungsqualität) Bewertung der UserInnen der Servicequalität (vgl. Meinhold/ Matul 2003:39f) o Annehmlichkeiten des tangiblen Umfelds (Äußeres Erscheinungsbild des Dienstleistungsortes, Ausstattung, Erscheinungsbild des Personals) o Zuverlässigkeit (Fähigkeit des Dienstleistungsunternehmens, die versprochenen Leistungen au dem anvisierten Niveau erfüllen zu können) o Reaktionsfähigkeit (Fähigkeit des Dienstleistungsanbieters, auf den speziellen Bedarf und die Wünsche der Kunden einzugehen. Betrifft Bereitschaft als auch Schnelligkeit) o Leistungskompetenz (Fähigkeit des Anbieters zur Dienstleistung: Wissen, Höflichkeit, Vertrauenswürdigkeit der MitarbeiterInnen) o Einfühlungsvermögen (Bereitschaft + Fähigkeit d. Unternehmens auf indiv. Wünsche der UserInnen einzugehen) diese Bewertung stößt aber in der Sozialarbeit auf Grenzen: Sozialarbeit setzt unter anderem auch Handlungen, die z.B. zum Schutze eines Kindes beitragen und die den fachlichen Kontext zugrunde liegen, in die die UserInnen möglicherweise keinen Zugang haben. Die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der UserInnen spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Ergebnisqualität folgt aus Strukturqualität und Prozessqualität, hängt mit den letztgenannten jedoch nicht linear zusammen, d.h. sie sind jedoch wichtige Rahmenbedingungen (Standards dort setzen)! Unterschied Output/ Outcome: Output = Standards für prozessuale Outcome = Folgequalität Ergebnisse „Kennzahlen“, Quoten Was sagen Einrichtung? diese Hilfe zur Selbsthilfe Zahlen über Wie ist das messbar? Der entscheidende Unterschied zwischen Dienstleistung(-sproduktion) und einer Beziehungsdienstleistung liegt darin, dass Handlungen mit und am Menschen nicht beliebig Leittext März 2006 Seite 133 wiederholt werden und vor allem nicht rückgängig gemacht werden können bzw. können die nicht „gelungen Dinge“ nicht einfach aus der „Produktion“ ausgesondert werden. Das heißt auch, dass Beziehungsdienstleistungen mit und am Menschen arbeiten und nicht für den Menschen! Weiters stellen sich in diesem Kapitel Fragen nach der „Legimitationskrise“: wann und wie hat die Qualitätsdiskussion in der Sozialarbeit Einzug gehalten? Wie sind SozialarbeiterInnen damals damit umgegangen? Und was sind die Qualitäten der jeweiligen sozialen Beziehungsdienstleistung? In unserem Projekt: in der Sozialraumarbeit, bei der Fremdunterbringung von Kindern, bei der Erstellung von fachlichen Standards und in der Wohnungslosenberatung? Leittext März 2006 Seite 134 10 Die akute Problemstellung: Vergaberecht 2002/2006 10.1 Grundlagen 46 Der Staat (Bund, Länder, Gemeinden) aber auch andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen (wie etwa Sozialversicherungsträger oder Universitäten) benötigen zur Besorgung ihrer öffentlichen Aufgaben in großem Ausmaß marktmäßig angebotene Sachgüter und Leistungen. Sie decken diesen Bedarf prinzipiell nicht durch Eigenleistungen oder durch zwangsweise Beschaffung (z.B. Enteignung). Im Regelfall beschaffen sie sich die Güter und Leistungen wie Private, indem sie am Markt nachfragend auftreten und mit anbietenden Unternehmen privatrechtliche Verträge über die Erbringung der Leistung (Kaufvertrag, Mietvertrag, Leasingvertrag, Werkvertrag usw.) abschließen. Diese öffentliche Beauftragung kann prinzipiell auf zweierlei Wegen zustande kommen Durch Förderungen Durch Vergabe Die Möglichkeit zur öffentlichen Beauftragung durch Förderungen ist jedoch mittlerweile durch entsprechende EU-Bestimmungen relativ beschränkt und gilt im Prinzip nur mehr für jene Bereiche, in denen durch EU-Förderrichtlinien entsprechende Ausnahmen geschaffen wurden (z.B. für die Behindertenpolitik). In allen anderen Bereichen öffentlicher Beschaffung bzw. Beauftragung ist prinzipiell das Vergaberecht anzuwenden. Die Verträge im Vergabeverfahren kommen in der Regel durch Aufforderung zur Anbotstellung (Ausschreibung), Angebote (Offerte) und Zuschlag (Angebotsannahme) zustande. Das entspricht dem klassischen Weg eines privatrechtlichen Vertragsabschlusses, ALLERDINGS unterliegen öffentliche Aufträge – im Unterschied zu privaten Vertragsabschlüssen - den Bestimmungen des Vergaberechtes47. Für die spezielle rechtliche Regelung der Vergabe öffentlicher Aufträge gibt es mehrere Gründe: Der Gesetzgeber will einen Ausgleich des Markt- und Machtungleichgewichtes zwischen dem meist monopol- oder oligopolartig agierenden öffentlichen Auftraggeber und dem Auftragnehmer, der sich in einer Konkurrenzsituation befindet, schaffen. In vielen Bereichen ist die Öffentliche Hand der einzige oder ein sehr großer Nachfrager, der den jeweiligen Markt ohne entsprechende Wettbewerbsregelungen (die im Vergaberecht formuliert sind) stark dominieren könnte. Öffentliches Quasimonopol besteht zum Beispiel im Eisenbahnwesen, im Straßenbau, aber auch bei verschiedenen Bauvorhaben der Gebietskörperschaften. Daher soll die Leistungsbeschreibung des Beschaffungswunsches (Ausschreibung) sowie die Beurteilung des Wettbewerbsergebnisses (Zuschlag) nach so weit wie möglich objektiven, nachvollziehbaren Kriterien erfolgen. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass 46 die folgende Darstellung folgt Raschauer(1998) und Korinek ausnahmsweise weiter außerhalb des Vergaberechtes gefördert werden darf in jenen Bereichen, die von den EU Förderrichtlinien ausdrücklich genannt werden (z.B. Behindertenwesen) 47 Leittext März 2006 Seite 135 der organisierte Parallelwettbewerb der Bieter eine wettbewerbsstimulierende Wirkung hat und tendenziell eine wirtschaftliche, sparsame und zweckmäßige Beschaffung gewährleistet. Das (öffentlich-rechtliche) Vergabeverfahren endet mit der Entscheidung über den Zuschlag. Dieser ist gleichzeitig die privatrechtlich relevante Angebotsannahme und begründet das (privatrechtliche) Auftragsverhältnis. 10.2 Gemeinschaftsrechtliche Grundlagen Da in Österreich das EG-Vergaberecht gilt, herrscht für alle Vergaben (auch unter den Schwellenwerten) ein Diskriminierungsverbot innerhalb des gesamten EWR. Nach der Rechtsprechung des EuGH verbieten der Schutz der Grundfreiheiten sowie das Diskriminierungsverbot jede Art von Präferenzierung, etwa nationaler Produkte oder Unternehmungen, aber auch Regionalpräferenzierungen. Daneben gibt es Richtlinien über das Verfahren der Auftragsvergabe in bestimmten Bereichen. Österreich ist verpflichtet, für alle von den Richtlinien erfassten Vergaben (so auch für „öffentliche Dienstleistungsaufträge“) oberhalb der Schwellenwerte eine gesetzliche Regelung des Vergabeverfahrens zu schaffen. Dies wurde erstmals in Gesetzesform mit dem Erlass des Bundesvergabegesetzes im Jahr 1993 – bereits in Vorbereitung auf den EU-Beitritt Österreichs - getan. Davor gab es in Österreich ebenfalls rechtliche Vorschriften über das bei der öffentlichen Auftragsvergabe einzuhaltende Verfahren. Die vergebenden Stellen orientierten sich inhaltlich weitgehend an der ÖNORM A 2050 aus 1957. 10.3 Die Struktur des Vergaberechtes in Österreich In Österreich gab es bis 2002 ein Bundesvergabegesetz (BVergG) und neun Landesvergabegesetze. Daneben gab es einen gesetzlich nicht geregelten Bereich für Vergaben unter den Schwellenwerten. In diesem Bereich gelten allerdings andere Regeln über das von den Vergabestellen einzuhaltende Verfahren: diese bestehen teilweise aus selbstbindenden Verwaltungsverordnungen, teilweise aus aufsichtsbehördlichen Anordnungen. Diese unklare Rechtslage wurde 2002 durch das Bundesvergabegesetz (BVergG 2002) ersetzt. Dieses Gesetz wurde 2005 umfassend novelliert, das neue Bundesvergaberecht trat am 1. Februar 2006 in Kraft, mit zum Teil langen Übergangsfristen im so genannten „nicht prioritären Bereich“. Näheres zu den Änderungen siehe weiter unten. Das Bundesvergabegesetz gilt v.a. für entgeltliche Lieferaufträge, Bauaufträge und sonstige Dienstleistungsaufträge, sofern sie durch öffentliche Auftraggeber im Bundesbereich vergeben werden. Unterhalb gewisser Schwellenwerten (in der Regel 60.000 – 80.000 €, wobei ein „Teilungsverbot“ gilt, das heißt, inhaltlich zusammengehörige Teile eines Auftrages dürfen nicht zum Zweck der Umgehung der Schwellenwerte geteilt werden) kann auch direkt vergeben werden, auch hier müssen einige Anbieter zur Legung eines Anbotes eingeladen werden. Prinzipiell ist in der öffentlichen Beauftragung jedes Mal zumindest ein Leittext März 2006 Seite 136 Vergleichspreis zu eruieren, das BVergG gilt also für alle öffentlichen Aufträge, für die nicht die Förderrichtlinie der EU anzuwenden ist. Aufträge mit einem Wert von mehr als 137.000 bzw. 211.000 € (Oberschwellenwert) müssen prinzipiell offen ausgeschrieben werden, wobei auch hier das Teilungsverbot gilt. Im Unterschwellenbereich können auch nicht offene Verfahren und Verhandlungsverfahren angewandt werden. Die europaweite Ausschreibung erfolgt zwingend für alle Ausschreibungen, deren Lieferwert 137.000 bzw. 211.000 € (bei Bauaufträgen 5,2 Millionen €) übersteigt und ist an komplexe Formalvorschriften gebunden und dauert in der Regel sechs Monate oder länger. Europaweite Ausschreibungen haben im Amtsblatt der EU veröffentlicht zu werden, österreichweite Ausschreibungen (mit Ausnahme der beschränkten Vergabe unterhalb des Schwellenwertes und der Direktvergabe) haben jedenfalls im Amtsblatt der ausschreibenden Gebietskörperschaft zu erfolgen. Eine elektronische Ausschreibeplattform findet man unter www.auftrag.at 10.4 Das Vergabeverfahren 10.4.1 Ablauf Das Vergabeverfahren ist mehrstufig. Es beginnt mit der Einladung zur Erstellung von Angeboten, die nur dann zulässig ist, wenn die konkrete Absicht einer tatsächlichen Vergabe besteht (Unzulässigkeit der Ausschreibung zur bloßen Informationsgewinnung). Aufgrund der Ausschreibung legen sodann die interessierten Bieter Angebote, die von der vergebenden Stelle entgegenzunehmen und zu prüfen sind und auf deren Grundlage die Vergabeentscheidung zu treffen ist. Grundsätzlich stehen den vergebenden Stellen drei verschiedene Wege zur Verfügung, um jenes Unternehmen zu finden, dem der Auftrag erteilt werden soll: das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren. Bei der Wahl der Vergabeart ist der Auftraggeber nicht frei. Grundsätzlich muss ein offenes Verfahren stattfinden. Ein nicht offenes Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren ist nur zulässig, wenn der Auftrag die Schwellenwerte nicht übersteigt, weil dann ein unverhältnismäßiger Aufwand im Vergleich zum Wert der Leistung bestünde. Eine öffentliche Ausschreibung muss bekannt gemacht werden (in Amtsblättern, Tageszeitungen, in der Wiener Zeitung, im „Amtlichen Lieferungsanzeiger“.). Im mehrstufigen Verfahren wird in einer ersten offenen Ausschreibung nach geeigneten Anbietern gesucht; die so ermittelten InteressentInnen erhalten erst die tatsächlichen Ausschreibungsunterlagen und werden in einer zweiten Stufe zur Legung eines entsprechenden Anbotes eingeladen. Mehrstufige Verfahren können sowohl oberhalb wie auch unterhalb der Schwellenwerte durchgeführt werden. Bei beschränkten Vergaben (unterhalb des Schwellenwertes) kann die Beauftragung auch über einen AuftragnehmerInnenkataster erfolgen, wobei die vergebende Gebietskörperschaft zu gewährleisten hat, dass alle interessierten (geeigneten) Anbieter die Leittext März 2006 Seite 137 Möglichkeit der Aufnahme in den Kataster haben, eine willkürliche Ausschließung (etwa aus geografischen Gründen oder aus Qualitätsgründen) ist nicht zulässig; ein Ausschluss aus dem Kataster ist prinzipiell nur für anbietende Betriebe zulässig, die sich in früheren Beauftragungen als unzuverlässig erwiesen haben. Alle im Kataster enthaltenen Betriebe müssen die gleiche Chance zur Einladung zu einer Anbotslegung erhalten, die vergebende Gebietskörperschaft hat daher dafür Sorge zu tragen, dass die Ziehung der zur Anbotslegung eingeladenen Betriebe aus dem Kataster nach einem Zufallsprinzip erfolgt. Nach übereinstimmender Rechtsmeinung ist selbst der Ausschluss von Betrieben, die gegen geltende Arbeits- und Sozialrechtsbestimmungen verstoßen haben, aus dem Vergabeverfahren (bzw. ihre Nichtaufnahme in den Kataster) nicht zulässig. 10.4.2 Gesamt oder Teilvergabe Zusammengehörige Leistungen sind grundsätzlich ungeteilt zu vergeben. Leistungen verschiedener Zweige der Wirtschaft können auch getrennt vergeben werden. Jedenfalls unzulässig ist ein Zuschlag in Teilen einer ausgeschriebenen Gesamtleistung oder die Teilung von Leistungen um Schwellenwerte zu umgehen. 10.4.3 Vergleichbarkeit der Angebote Entscheidende Bedeutung kommt im Vergabeverfahren der Ausschreibung, insbesondere der Qualität der an die Interessenten ausgegebenen Leistungsverzeichnisse, zu. Das BVergG bestimmt daher, dass die Ausschreibungsunterlagen so auszuarbeiten sind, dass die Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt ist und die Preise bzw. die Entscheidungskriterien ohne umfangreiche Vorarbeiten und ohne Übernahme nicht kalkulierter Risken von den Bietern ermittelt werden können. Die Leistungsbeschreibung muss eindeutig, vollständig und neutral sein, darf also nicht so abgefasst werden, dass sie bestimmten Bietern von vornherein Wettbewerbsvorteile bietet. In der Ausschreibung ist darüber hinaus anzuführen, welche Kriterien für die Wahl des Angebotes ausschlaggebend sein werden. Auch die Angebots- und Zuschlagsfristen sind anzuführen. Die vergebende Stelle kann durch die Formulierung ihrer Ausschreibung bzw. durch die Erlassung entsprechender Vergaberichtlinien entscheiden, ob nur über den Preis (Billigstbieterprinzip) oder auch über qualitative Merkmale (Bestbieterprinzip) vergeben wird. Kommt das Bestbieterprinzip zur Anwendung, ist in der Ausschreibung (und in den Vergaberichtlinien) festzulegen, welche Kriterien zur Bewertung der Qualität herangezogen werden und wie viel Punkte man durch das Erfüllen der einzelnen Kriterien erwerben kann; dabei ist auch der Preis mit einem Punktewert zu versehen, aus dem zu erkennen ist, um wie viel Punkte jemand weniger erhält, der/die vom Billigstpreis abweicht. Es gibt beim Bestbieterverfahren zwei Arten von Entscheidungskriterien Ausschlusskriterien Zuschlagskriterien Leittext März 2006 Seite 138 Erfüllt das Anbot eines oder mehrere Ausschlusskriterien nicht, ist das Anbot ohne weitere Prüfung auszuscheiden. Ausschlusskriterien müssen in engem Zusammenhang mit dem Auftrag stehen. Zuschlagskriterien bestimmen, um wie viel Punkte das jeweilige Anbot bei Einhaltung (Erfüllung) des Kriteriums erhaltet. Ein Ausschluss bzw. ein Punkteabzug auf Grund geografischer Entfernung o.Ä. ist nicht möglich, so dass eine Gebietskörperschaft weder durch Ausschluss- noch durch Zuschlagskriterien erreichen kann, dass nur Betriebe aus dem eigenen geografischen Wirkungsfeld (z.B. aus der ausschreibenden Gemeinde) zum Zug kommen. Damit soll Markttransparenz erreicht werden. Enthält die Ausschreibung keine Kriterien für eine Entscheidung (einen Zuschlag) nach dem Bestbieterprinzip, ist auf jeden Fall das Billigstbieterprinzip anzuwenden, das bedeutet, wenn eine Ausschreibung keine Qualitätskriterien enthält, ist auf jeden Fall dem billigsten Anbot der Zuschlag zu erteilen. Eine fehlerhafte Ausschreibung kann zur (gänzlichen oder teilweisen) Aufhebung durch das Bundesvergabeamt führen, aber auch zivilrechtliche Auswirkungen auf den Leistungsvertrag haben. 10.4.4 Prüfung der Angebote Die Angebote werden durch eine Kommission geöffnet und auf ihre Übereinstimmung mit den Ausschreibungsunterlagen, auf ihre rechnerische Richtigkeit und Preisangemessenheit sowie (insbesondere beim offenen Verfahren) auf die Qualifikation der Bieter hin überprüft. Während des offenen oder nicht offenen Verfahrens darf mit Bietern über eine Angebotsänderung nicht verhandelt werden (Verhandlungsverbot). Im Verhandlungsverfahren darf hingegen mit den BieterInnen auch nach der Öffnung der Kuverts über das Anbot verhandelt werden, es ist jedoch zu gewährleisten, dass alle Anbieter dieselben Informationen und Nachbesserungsmöglichkeiten erhalten. 10.4.5 Das Zuschlagsverfahren Das Zuschlagsverfahren ist zweistufig. In einem ersten Schritt sind jene Angebote auszuscheiden, die einen im BVergG aufgezählten Mängel aufweisen (z.B. verspätet eingebrachte Anbote, fehlerhafte oder unvollständige Anbote, Vorliegen eines Ausschlusskriteriums u.ä.). Der Zuschlag ist dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot gemäß den in der Ausschreibung festgelegten Kriterien zu erteilen (Bestbieterprinzip). Enthält die Ausschreibung keine näheren Festlegungen über Kriterien des Zuschlages, erfolgt dieser allein nach dem niedrigsten Preis (Billigstbieterprinzip). Mit dem Zuschlag – genauer gesagt mit der Verständigung vom Zuschlag – kommt der Leistungsvertrag zustande; das Vergabeverfahren ist damit beendet. Vom Abschluss des Vergabeverfahrens sind alle Bieter zu verständigen. Alle Bieter haben das Recht zu erfahren, wer den Zuschlag erhalten hat und zu welchem Preis. Leittext März 2006 Seite 139 10.5 Strafbestimmungen An das Vergabegesetz sind sowohl die öffentlichen Auftraggeber (Schadenersatzleistungen bei Verstößen gegen das Vergaberecht, als Geschädigter kann sich jeder unterlegene Bieter bezeichnen) als auch die Bieter (z.B. verbotene Bieterabsprache) gebunden und unterliegen bei Verstößen den entsprechenden Sanktionen, die teilweise sogar von Zivilgerichten (z.B. bei Bieterabsprache).verhängt werden. 10.6 Vergabe-Glossar Bestbieterprinzip Der Zuschlag ist dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot gemäß den in der Ausschreibung festgelegten Kriterien zu erteilen. Modifiziertes Billigstbieterprinzip Enthält die Ausschreibung keine näheren Festlegungen über Kriterien des Zuschlages, erfolgt dieser allein nach dem niedrigsten Preis Nicht offenes Verfahren Hier wird eine beschränkte Anzahl von Unternehmen durch die Vergabestelle schriftlich zur Angebotsabgabe eingeladen (ist nur unterhalb des Schwellenwertes von 60.000 bzw. 80.000 € zulässig). Offenes Verfahren Die vergebende Stelle wendet sich an eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen, die sie durch öffentliche Bekanntmachung auffordert, sich „Ausschreibungsunterlagen“ zu besorgen und Angebote zu legen. Öffentliche Aufträge Sind privatrechtliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern und Unternehmungen, in denen diese sich verpflichten, eine bestimmte Leistung gegen Entgelt zu erbringen. Schwellenwerte Definieren den Typus der Ausschreibung (beschränkte Ausschreibung bis 60.000 bzw. 80.000 € voraussichtlichen Auftragswert, europaweite Ausschreibungen ab einem Auftragswert von 137.000 bzw. 2110.000 €, bei Bauaufträgen ab 5,278 Millionen €). Verhandlungsverbot Während des offenen oder nicht offenen Verfahrens darf mit Bietern über eine Angebotsänderung nicht verhandelt werden. Verhandlungsverfahren Hier wird direkt mit den anbietenden Unternehmen über den Vertragsinhalt verhandelt. Alle Anbieter müssen ständig über alle Verhandlungsinhalte informiert werden, um keinem Anbieter aus dem Verhandlungsverfahren einen unberechtigten Vorteil erwachsen zu lassen. Auch in diesem Verfahren müssen mehrere Angebote eingeholt werden. Leittext März 2006 Seite 140 10.7 Vergaberecht 2006 Das neue Vergabe-Richtlinienpaket der EU ist seit 1. Februar 2006 in Österreich umzusetzen. Der österreichische Gesetzgeber hat die Gelegenheit wahrgenommen ein völlig neues BVergG zu beschließen, das sowohl inhaltliche als auch logistische Neuerungen beinhaltet. So wurden beispielsweise die „Verweisketten“ deutlich reduziert, was allerdings insgesamt eine größere Anzahl an Paragrafen mit sich brachte. Die Systematik des Gesetzes folgt verstärkt dem Ablauf eines Vergabeverfahrens, neue Instrumentarien zur Beschaffung wie Rahmenvereinbarungen und wettbewerblicher Dialog wurden aufgenommen. Gleichzeitig wird das Rechtsschutzverfahren vereinfacht und beschleunigt. Die Bundes-Vergabekontrollkommission, die als Schlichtungsstelle in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hatte, wurde aufgelöst. Änderungen gab es vor allem in den Bereichen: Schwellenwerte Verfahrensarten Sektorenbereich Eine legistische Kuriosität mit unter größeren Auswirkungen ist die Tatsache, dass für nicht prioritäre Dienstleistungen bis zum 31.12.2006 das Bundesvergabegesetz 2002 an zu wenden ist. Die Schwellenwerte im Unterschwellenbereich: nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung (3 Bieter) Bauaufträge < 120.000 € < 80.000 € Lieferaufträge < 80.000 € < 60.000 € Dienstleistungsaufträge < 80.000 € < 60.000 € Geistige Dienstleistung Mit 1 Bieter bei unverhältnismäßig hohem Aufwand des Vergabe-verfahrens (bei Auftragswert: < 77.000 € ) Leittext März 2006 Seite 141 Die Schwellenwerte im Oberschwellenbereich: Im klassischen Bereich (vgl.§ 12) Schwellenwert Lieferaufträge 211.000 EUR bei AG gemäß Anhang V BVergG Zentrale öffentlicher Auftraggeber 137.000 EUR Dienstleistungsaufträge 211.000 EUR Bei AG gemäß Anhang V BVergG Zentrale öffentliche Auftraggeber 137.000 EUR Wettbewerbe 211.000 EUR Bei AG gemäß Anhang V BVergG (Zentrale öffentliche Auftraggeber 137.000 EUR Bauaufträge 5.278.000 EUR (zum neuen Vergaberecht vgl. Kropik/Mille/Sachs 2006) 10.8 Vergaberecht und Qualität Prinzipiell kann durch öffentliche Beauftragung durch Vergabe wie gesagt auf zweierlei Art erfolgen, nach dem Billigstbieterprinzip und nach dem Bestbieterprinzip. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Vergabe wird prinzipiell nur möglich sein, wenn das Bestbieterprinzip angewandt wird und entsprechende qualitätsorieniterte Ausschluss- und Zuschlagskriterien entwickelt werden. Für die Qualitätsentwicklung öffentlich beauftragter Sozialarbeit wird es daher jetzt notwendig sein, die entsprechenden Vergabekriterien im Trialog mit den vergebenden Stellen und der Wissenschaft zu entwickeln. Dazu soll der hier vorgelegte Leittext Qualität eine Grundlage bieten. Kriterien qualitätsgesicherter Sozialarbeit sollten hier in zwei Dimensionen entwickelt werden: Ausschlusskriterien: Welche Kriterien gualitätsgesicherter Sozialarbeit eignen sich bei welcher Art von Auftrag (abhängig von Zielsetzung, Auftragsvolumen und Handlungsfeld) als Ausschlusskriterium? Das bedeutet, es müssen Kriterien sachlich begründet und in engem Zusammenhang mit dem Auftragsziel stehend entwickelt werden, deren Vorliegen eine Mindestbedingung für die Auftragserteilung sind. Zuschlagskriterien: Welche (prinzipiell skalierbaren) Kriterien qualitätsgesicherter Sozialarbeit eignen sich bei welcher Art von Auftrag (wiederum kontextabhängig), durch Punkteabzug bzw. Punktezuschlag die Chance der Auftragserteilung zu erhöhen. Auch Zuschlagskriterien dürfen nicht willkürlich entwickelt werden, sondern müssen in einem inhaltlichen Bezug zum Auftrag stehen. Klar ist jedoch, dass im Vergabeverfahren Qualitätselemente, deren Vorhandensein durch Zuschlagskriterien abgesichert werden soll, durch bessere Anbote (höhere Punktezahl) bei anderen Zuschlagskriterien oder durch einen niedrigeren preis – weitgehend – umgangen werden können. Zuschlagskriterien eignen sich daher nicht so optimal wie Ausschlusskriterien für die Qualitätssicherung Leittext März 2006 Seite 142 (Qualitätsentwicklung) im Vergabeverfahren, Ausschlusskriterien sind jedoch schwieriger zu begründen, da hier ein besonders enger Zusammenhang zum Auftragsgegenstand vorliegen muss, um das Vergabeverfahren nicht durch die Kritik der Willkürlichkeit zu gefährden. 10.9 Vergaberecht als Chance Prinzipiell kann die öffentliche Beauftragung durch Vergabe gegenüber der alten Förderpraxis als Fortschritt in Richtung Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung verstanden werden, denn im alten (budgetpragmatischen) Förderwesen war der Willkür bezüglich Auftragsinhalt und Auftragspreis keine Grenze gesetzt. Eine Untersuchung geförderter Vorhaben der Sozialarbeit nach Leistungsumfang und Leistungspreisen würde wahrscheinlich ergeben, dass hier kaum ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Auftragsqualität, Auftragsziel und Geldvolumen besteht (auch nicht im Wirkungsbereich einund derselben Behöre), Förderaufträge folgen immer auch historischen Gewohnheiten und politischen Randbedingungen. Außerdem unterliegen Organisationen, die durch Bundesoder Landesstellen bzw. durch Gemeinden gefördert werden, immer auch den Auflagen der Kameralistik (Budgetpragmatik), so dürfen Mittel, die für „Personal“ gewidmet werden, nicht für „Investitionen“ verwendet werden, Einnahmen von dritter Seite vermindern in der Regel die Fördersumme (um „Überförderung“ zu vermeiden) und es dürfen in der Regel keine überjährigen Förderguthaben entstehen (was zum Beispiel Rücklagenbildung bei der entsprechenden Organisation erschwert oder verunmöglicht). Die Entwicklung und Sicherung von Qualität in der Sozialarbeit unterliegt in der „Förderwelt“ zumindest gleich hohen, wenn nicht höheren Barrieren wie in der „Vergabewelt“ (vgl. dazu beispielsweise Mayrhofer/Pallas/Schmid 2005). Die neuen Chancen, die das Vergaberecht der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Sozialarbeit prinzipiell ermöglicht, müssen aber erst (trialogisch) entwickelt und abgesichert werden. Dazu mehr im folgenden Kapitel. Leittext März 2006 Seite 143 11 Problem(-bewusstsein) und Strategie: qualitätsgesicherter Vergaberichtlinien Formulierung 11.1 Der Weg: Qualitätssicherung durch Vergabe Das Vergaberecht eignet sich dazu, im Zuge der Öffentlichen Beauftragung durch Vergabe Qualität sozialer Dienstleistungen zu sichern, wenn die entsprechende Bereitschaft vorhanden ist, nach dem BestbieterInnenprinzip und nicht nach dem Prinzip des billigsten Angebotes vorzugehen. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung entsprechender Entscheidungskriterien bereits in der Ausschreibung, entweder durch eine allgemeine Vergaberichtlinie, der jede Ausschreibung folgt oder in Vergabekriterien, die in jeder Ausschreibung neu formuliert werden. 11.2 Bestehende Ausschreibungsrichtlinien im Überblick In den kommenden Monaten werden die vorhandenen Vergaberichtlinien öffentlicher Stellen, so weit sie uns erreichbar sind, im Modul 1 ausgewertet und analysiert. Danach kann diskutiert werden, ob und wie weit bestehende Vergaberichtlinien zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Sozialbereich geeignet sind. 11.3 Probleme im Vergabeverfahren Allerdings stellen sich in Vergabeverfahren drei wesentliche Probleme, deren Lösung eine Voraussetzung für Qualitätssicherung im Vergabeverfahren ist. 11.3.1.1 Enge Gestaltungskriterien Das Vergaberecht sieht, wie weiter oben ausgeführt wurde, prinzipiell zwei Möglichkeiten, im BestbieterInnenverfahren einzugreifen: Durch Ausschlusskriterien und durch Zuschlagskriterien. Ausschlusskriterien ermöglichen, BieterInnen, die gewissen Merkmalsausprägungen (das können durchaus Qualitätskriterien sein) nicht genüge tun bzw. die sich im Anbot nicht wieder finden, vom weiteren Verfahren auszuschließen. Mit diesem „harten“ Instrument können grundlegende qualitätssichernde Maßnahmen (wie etwa eine Inklusionsorientierung oder die Erfüllung der österreichischen Gesetze inkl. z.B. des Frauenförderungsrechtes) eingefordert werden. Allerdings müssen die Ausschlusskriterien in einem engen Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehen, nicht jedes aus Sicht der Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit wünschenswerte Kriterium eignet sich im bestehenden Vergaberecht daher als Ausschlusskriterium. Außerdem werden Ausschlusskriterien in der Regel so „grob“/allgemein formuliert sein, dass ihre nominale Erfüllung nicht wirklich Aufschluss auf die tatsächliche Befolgung der dahinter liegenden qualitätssichernden Strategien ermöglicht. Leittext März 2006 Seite 144 Zuschlagskriterien erlauben, neben dem Preis auch Qualität durch Punktezuschlag zu „belohnen“, das bedeutet, dass AnbieterInnen, die mehr Punkte bei den Zuschlagskriterien erwerben, auch einen höheren Preis verlangen können, ohne sich aus dem Wettbewerb zu nehmen. Allerdings können in umgekehrter Weise die Zuschlagskriterien durch einen deutlich niedrigeren Preis umgangen werden, d.h., niedrig(st)er Preis kann im Endeffekt wiederum die Qualität verdrängen. Denn der Preis muss immer ein wesentliches Kriterium der Vergabe (mindestens 40% der Zuschlagskriterien) bilden. Allerdings kann der Öffentliche Auftraggeber bereits durch die Beschreibung der Eckdaten der gewünschten Dienstleistung Rahmenbedingungen für die Qualität des Angebots schaffen. So können bestimmte qualitätssichernde Kriterien (z.B. Betreuungsschlüssel oder Qualifikationsanforderungen der AnbieterInnen) bereits als Leistungsbeschreibung in den Ausschreibungstext aufgenommen werden. Dadurch wird ein bereits engerer Rahmen für die Verwendung von Ausschluss- oder Zuschlagskriterien geschaffen. Allerdings erfordert dies den Willen der ausschreibenden Stelle, bereits im Vergabeverfahren sehr regulierend einzugreifen, was dem (in letzter Konsequenz wirtschaftsliberalen) Ziel des Vergaberechtes nicht völlig entspricht. 11.3.1.2 Wissensungleichgewicht Das zweite Problem besteht darin, dass die vergebenden Stellen in manchen Bereichen der Vergabe von Dienstleistungen im Sozial- und Gesundheitsbereich über Qualität weniger wissen als die (potentiellen) AuftragnehmerInnen. Das gilt insbesondere für die Vergabe jener Beratungsdienstleistungen, für deren Bewertung auf Seite der vergebenden Stellen zuerst eine Beratung (oft durch eines der auf diesem Markt agierenden Beratungsunternehmen) konsumiert werden musste. Hier ist der AnbieterInnenmarkt in der Lage, durch geeignete Information der NachfragerInnen die Grundlagen für die Kriterien zur Qualität(-smessung) selbst zu schaffen. In diesem Fall spricht man von einem AnbieterInnenzentrierten Markt. So sind beispielsweise in vielen öffentlichen Einrichtungen, die Trainings und Beratungen für Gender Mainstreaming ausschreiben, die entscheidenden Personen (die die Vergabe formulieren und die Anbote bewerten) selber ExpertInnen im Bereich Gender Mainstreaming und wurden daher auch auf demselben Markt ausgebildet. Vergabemärkte mit einer starken Angebotsmacht erfordern daher qualitätssichernde Maßnahmen (auch) auf Seite der AnbieterInnen (z.B. über Zertifizierungen) 11.3.1.3 Verbotene BieterInnenabsprache Netzwerke von anbietenden Organisationen, die sich gerade im Bereich der sozialen Dienstleistungen gebildet haben und in früheren Jahrzehnten durch FördergeberInnen (insbesondere durch das AMS) sogar gefördert worden sind, können nunmehr im Vergabeverfahren als verbotene BieterInnenabsprache angesehen werden. Dies könnte insbesondere dort eintreten, wo sich Netzwerke darauf einigen, in Hinblick auf eine gewünschte und nicht zu unterschreitende Qualitätsgrenze, Mindestnormen zu formulieren, unter denen „nicht geboten wird“: Spätestens sobald sich alle oder der relevante Teil der Leittext März 2006 Seite 145 AnbieterInnen auf diesem Markt an solche (qualitätssichernde) Absprachen halten, könnte der Tatbestand der verbotenen BieterInnenabsprache erfüllt sein – ein Tatbestand allerdings, der nicht als Verwaltungsübertretung, sondern als Straftatbestand gewertet wird und entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Mit diesem Punkt müssen sich sozialpolitische Netzwerke in Zukunft auseinander setzen. 11.4 Instrumente und Strategien der Qualitätssicherung Die weiter vorne beschriebenen möglichen Instrumente der Qualitätssicherung in der Sozialarbeit könnten nun unter den Gesichtspunkten der Leistungsbeschreibung sowie der Zuschlags- und Ausschlusskriterien diskutiert werden. Die dabei entstehende Matrix kann mit Ergebnissen aus einzelnen Bereichen der Sozialarbeit bzw. der Auftragsvergabe in sozialpolitischen Handlungsfeldern gefüllt werden. Dieser Diskurs sollte in den kommenden Monaten in den Modulen 2 – 5 der Entwicklungspartnerschaft durchgeführt werden, um eine „Donau-Qualitäts-Matrix“ erhalten zu können. Ausschlusskriterium Zuschlagskriterium Leistungsbeschreibung Fachgesetz Berufsgesetz Selbstbindung durch Eintrag in eine Liste bzw. Dachverband Staatliches Gütesiegel ISO-Zertifizierung Neuere Zertifizierungen und Standardisierungen Sonstiges Dabei sollte immer der Blick sowohl auf die Qualität der Dienstleistung, aber auch auf die Qualität der Arbeit und auf die Qualität der Leitungen in den einzelnen Auftragsvergaben gelegt werden. Dadurch könnte sich jene mehrdimensionale Betrachtungsweise ergeben, die eine Grundlage für Sicherung und Weiterentwicklung von Qualität sein könnte. Letztendlich geht es um die Entwicklung von Strategien, um öffentliche beauftragende Stellen zu einem gemeinsamen Qualitätsdiskurs gewinnen, einem Diskurs über Vor- und Nachteile der Qualitätssicherung, um Nachhaltigkeit und um die wichtigen gesellschaftlichen Leittext März 2006 Seite 146 Funktionen der jeweiligen sozial- oder gesundheitspolitischen Dienstleistungen. Hier steht die Handlungslogik von Sozialarbeit in einem Spannungsverhältnis mit der Verwaltungs- und Vergabelogik der öffentlichen Stellen. Wichtige Fragen für diesen Qualitätsdiskurs könnten sein: Wer tritt in meinem Handlungsfeld als öffentliche/r Auftraggeber/in (Gebietskörperschaften, für sie handelnde und/oder durch sie beherrschte ausgegliederte RechtsträgerInnen, öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie z.B. SozialversicherungsträgerInnen) auf? Wie könnten Kriterien für potentielle Ausschreibungen in meinem Verantwortungsbereich formuliert sein, um Qualität messbar und angreifbar zu machen? Und zwar als Leistungsbeschreibung, als Zuschlagskriterien und als Ausschlusskriterien. Welche Voraussetzungen muss qualitativ anspruchsvolle Sozialarbeit in meinem Arbeitsbereich/Verantwortungsbereich mitbringen (Personalausstattung, Raumsituation, etc.)? Leittext März 2006 Seite 147 12 Die Umsetzung der Qualitätssicherungsstrategien im Unterricht Die Umsetzung der Qualitätsdebatte und ihrer Ergebnisse in den Unterricht an Fachhochschulstudiengängen der Sozialarbeit bleibt den weiteren Monaten der Entwicklungspartnerschaft überlassen. Leittext März 2006 Seite 148 13 Schlussfolgerungen 13.1 Zusammenfassender Überblick Der Aufbau dieses Textes folgt folgender Struktur: 1. Einleitung 2. Qualitätsdiskussion in der Sozialarbeit Ein Einstieg 4. Sozialarbeit und ihre gesellschaftliche Stellung 3. Geschichte der Qualitätssicherung als Ausdruck von Industrialisierung und Massenfertigung 7. Zertifikate als Dokumentation von Qualität 5. Qualität in der Sozialarbeit 6. Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit – Wege und Irrwege 8. Rückbindung: Von den Zertifizierungssystemen zur Qualitätsbestimmung 9. Vergaberecht 2006 10. Problem(bewußtsein) und Strategie: Formulierung qualitätsgesicherter Vergaberichtlinien 11. Umsetzung im Unterricht 12. Schlussfolgerungen für die EP Leittext März 2006 Seite 149 In diesem Text wurden qualitätsorientierte Sozialpolitik und Sozialarbeit sowie die aktuellen Anforderungen aus dem Bereich Vergaberecht und öffentliche Beauftragung betrachtet. Aus den bisherigen Ergebnissen lässt sich folgern: Qualität als Unterscheidungskriterium, das Unterschiede erkennen lässt, die unterscheiden, erfordert Skalierung. Am leichtesten ist Skalierung dort möglich, wo es ausschließlich um quantitative Größen geht; bei Märkten erfüllt Geld diese Anforderung, nämlich eine rein quantitative Größe ohne jeden qualitativen Effekt zu haben. Viele „Märkte“, also Räume des Austausches von Produkten und Dienstleistungen, erfüllen diese Anforderung nicht, insbesondere (aber nicht nur48) im Sozialbereich. Wo mit anderen Medien als Geld, also mit Medien, die auch (oder ausschließlich) eine qualitative Ausdehnung und eine geringe oder keine quantitative Dimension haben, Leistungen erbracht werden, muss über andere Instrumente als einer quantitativen Reihung nach den linearen Kriterien „mehr“ und „weniger“ gereiht werden, um dem Skalierungsgebot der Qualitätsdebatte gerecht zu werden. Folgende mögliche Skalierungsinstrumente haben wir für Dienstleistungen der Sozialarbeit benannt und wollen sie nun zur Diskussion stellen: - Fachgesetze - Berufsgesetze - Selbstbindung durch Eintrag in eine Liste / Dachverband - Staatliches Gütesiegel - ISO-Zertifizierung (Prozesszertifikate) - TQM-Zertifizierungen (Netzwerkzertifikate wie EFQM, AFQM) - Weitere hier noch nicht genannte Instrumente?? Nicht jede der genannten Strategien eignet sich in jedem Handlungsfeld der Sozialarbeit gleichermaßen als Instrument der Skalierung von Qualität einer überwiegend qualitativ ausgerichteten Dienstleistung, nicht jedes Instrument ist in jedem Handlungsfeld der Sozialarbeit gleichermaßen (politisch) durchzusetzen. Daher sollte es in der weiteren Diskussion darum gehen, vorerst beispielhaft herauszuarbeiten, welche der hier vorgestellten Strategien sich in welchem Handlungsfeld besonders eignet, Qualität im öffentlichen Beauftragungsprozess von Sozialarbeit zu entwickeln und zu sichern bzw. ob sich im konkreten Arbeitsfeld noch weitere Instrumente gefunden werden können. Wesentlich ist die Sicherung und Entwicklung dreier Qualitäten: 48 Qualität der Dienstleistungen aus der Perspektive ihrer NutzerInnen (und deren Angehörigen) Qualität der Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft/Sozialarbeit Qualität der Leitungen und Leitungsprozesse in der Sozialwirtschaft/Sozialarbeit es sei etwa an den nicht kommerziellen Sektor der Kultur oder des Sportes erinnert Leittext März 2006 Seite 150 Die Lissabon-Strategie, das „Europäische Wirtschafts- und Sozialmodell“ zum erfolgreichsten Modell in der Welt zu machen, erfordert auch, den Qualitätsdiskurs in der Sozialarbeit nach diesen oben genannten Aspekten weiter zu entwickeln. Das schließt neben der Leistungs- und Leitungsdimension deutlich auch die arbeitsmarktpolitische Dimension der Beschäftigung in der Sozialwirtschaft ein. Zugegeben eine unübliche Blickrichtung in einer primär wirtschaftsliberalen Gedankenwelt, in der „das Soziale“ (in dieser Lesart oder als „das Gute“ verstanden) häufig mit dem ehrenamtlichen und unbezahlten Engagement „guter Menschen“ konnotiert und nur residual (wenn überhaupt) als Arbeitsmarktsegment gesehen wird. Wenn man sich also die Frage stellt, ob es sich bei der Qualitätsdebatte im Sozialbereich um alten Wein in neuen Schläuchen handelt oder um eine Anpassung des Sozialarbeitsdiskurses an veränderte Bedingungen des speziellen Austauschraumes („Marktes“) des Sozialen, so kommen wir in der bisherigen Debatte des Qualitätsthemas im Sozialbereich zum Schluss, dass die Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit keineswegs bloß eine neue Strategie der Verschleierung alter Herrschaftsverhältnisse ist, sondern ein notwendiges Instrument, um im Trialog der öffentlichen beauftragenden Stellen (letztendlich der Politik), der anbietenden Organisationen und ihren MitarbeiterInnen (und ihren NutzerInnen) und der Sozialarbeitswissenschaft die nutzenstiftenden Elemente und Eigenschaften der (öffentlich beauftragten) Sozialarbeit zu stabilisieren bzw. zu erhöhen. Dies scheint uns auch vor dem Hintergrund liberaler Wirtschafts- und Verteilungspolitik möglich und dazu sind Strategien der Qualitätssicherung im öffentlichen Beauftragungsprozess von Sozialarbeit zu entwickeln. 13.2 Weitere Arbeit der Entwicklungspartnerschaft „Donau – Quality in Inclusion“ Wir verstehen diesen Text nicht als „Antwort“ auf die Leitfragen der Entwicklungspartnerschaft, sondern als verdichtete Fragestellung, die im Diskurs der Module in praktischen Erprobungsfeldern bearbeitet und mit strategischen PartnerInnenorganisationen, vergebenden Stellen und Organisationen der Sozialwirtschaft weiter entwickelt werden soll. Daraus aktuell entstandene Fragen an die Module 2-5 sind: Wie stehen sie (in ihrem Arbeitsfeld) zum Qualitätsdiskurs, wie er hier entwickelt wurde? Was ist der je spezifische Kontext? Welche Erfahrungen gibt es in der Bestimmung von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung? Was ist dafür förderlich, was ist hemmend? Was sind die (modulbezogenen) Bedürfnisse im Qualitätsdiskurs? Leittext März 2006 Seite 151 Schließlich wäre noch die „Nachhaltigkeitsfrage“ zu stellen und zu diskutieren: Was bleibt nach dem Ende von EQUAL von unserem Qualitätsdiskurs übrig und wieso? Wien und St. Pölten im März 2006 Leittext März 2006 Seite 152 14 Verwendete Literatur Anastasiadis, Maria / Essl, Günter / Riesenfelder, Andreas / Schmid, Tom / Wetzel, Petra (2003): Der Dritte Sektor in Wien – Zukunftsmarkt der Beschäftigung? Wien (Studie im Rahmen des EQUAL-Projekts der ersten Antragsrunde: „Der 3. Sektor in Wien“) Anastasiadis, Maria (2004): Die Zukunft der Arbeit und ihr Ende? Analyse der Diagnose „Der Dritte Sektor, unsere letzte, größte Hoffnung“ aus „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft“ von Jeremy Rifkin in Hinblick auf transatlantische Übertragbarkeiten der gemeinten Vision. Graz. (Dissertation) Andruschow, Katrin (Hrsg.) (2001): Ganze Arbeit. Feministische Spurensuche in der NonProfit-Ökonomie. Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, Berlin Anheier, Helmut K. (1997): Hoffnungsträger Dritter Sektor? Die wirtschafts- und sozialpolitische Bedeutung des Non-Profit-Bereichs. Baltimore/Berlin. Anheier, Helmut K. / Priller, Eckhard / Seibel, Wolfgang / Zimmer, Annette (Hrsg.) (1998): Der Dritte Sektor in Deutschland. Organisationen zwischen Staat und Markt im gesellschaftlichen Wandel. Berlin. Antoni, Conny Herbert (1990): Qualitätszirkel als Modell partizipativer Gruppenarbeit. Analyse der Möglichkeiten und Grenzen aus der Sicht betroffener Mitarbeiter. Bern – Stuttgart – Toronto Arcidonna, (2000): Mainstreaming Recipes, Medium-Term Community Action Programme on Equal Opportunities for Women and Men (1996-2000), Palermo Badelt, Christoph (Hrsg.) (1997): Handbuch der Nonprofit Organisation. Strukturen und Management. Stuttgart Badelt, Christoph / Holzmann-Jenkins, Andrea / Matul, Christian / Österle, August (1997): Analyse der Auswirkungen des Pflegevorsorgesystems. Wien Badelt, Christoph / Österle, August (2001a): Grundzüge Sozialökonomische Grundlagen. Allgemeiner Teil. Wien (2. Auflage) der Sozialpolitik. Badelt, Christoph / Österle, August (2001b): Grundzüge der Sozialpolitik. Sozialpolitik in Österreich. Spezieller Teil. Wien (2. Auflage) Bader, Cornelia (1999): Sozialmanagement – Anspruch eines Konzepts und seine Wirklichkeit in Non-Profit-Organisationen, Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag Basaglia, Franco (Hrsg.) (1971): Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Ein Experiment der psychiatrischen Klinik in Görz. Frankfurt/Main Basaglia, Franco / Basaglia Ongaro, Franca (1972): Die abweichende Mehrheit. Die Ideologie der totalen sozialen Kontrolle. Frankfurt/Main Basaglia, Franco / Giannichedda, Maria Grazia (1980): Die Transformation der Psychiatrie, In: Simons, Thomas (Hrsg.): Absage an die Anstalt. Programm und Realität der demokratischen Psychiatrie in Italien. Frankfurt/Main – New York. S. 23 - 42 Leittext März 2006 Seite 153 Baur, Uta / Herrmann, Gerhard (2004 ): Qualitätsmanagement in Wohn- und Werkstätten der Behindertenhilfe. In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, München – Basel, 2. Auflage, Seiten 169180 Beblo, Miriam / Krell, Gertraude / Schneider, Katrin / Soete, Birgit (Hrsg.) (1999): Ökonomie und Geschlecht. Volks- und betriebswirtschaftliche Analysen mit der Kategorie Geschlecht, München – Mering Beck Ulrich (1986): Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main Beck, Ulrich (Hrsg.) (1997): Kinder der Freiheit. Frankfurt/Main Beck-Gernsheim, Elisabeth, (1980): Das halbierte Leben. Männerwelt Beruf, Frauenwelt Familie, Frankfurt/Main Behing, Ute / Sauer, Birgit (2005): Was bewirkt Gender Mainstreaming? Evaluierung durch Policy-Analysen. Frankfurt/Main. New York Behrens, Roger (2003): Wissen als Design. Anmerkungen zum fortschreitenden Zerfall des Individuums am Ende der Arbeitsgesellschaft. In: Meschnig, Alexander / Stuhr, Mathias (Hrsg.): Arbeit als Lebensstil, Frankfurt/Main. S.133-147 Benhabib, Seyla / Butler, Judith / Cornell, Drucilla / Fraser, Nancy, (1995): Der Streit um die Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart, Frankfurt/Main Betzelt, Sigrid / Bauer, Rudolph (2000): Nonprofitorganisationen als Arbeitgeber. Opladen. Bieling, Hans-Jürgen (2000): Dynamiken sozialer Gesellschaftstheorien und Zeitdiagnosen. Münster Spaltung und Ausgrenzung. Birkhölzer, Karl (2000): Das Dritte System als innovative Kraft: Versuch einer Funktionsbestimmung. In: Widersprüche, Zeitschrift für sozialistische Politik, Bielefeld, S. 71 – 88 Bischof, Joachim / Detje, Richard (1989): Massengesellschaft und Individualität. Krise des „Fordismus“ und die Krise der Linken. Hamburg Blanchard, Olivier / Illing, Gerhard (2004): Makroökonomie, München Bobzien, Monika / Stark, Wolfgang / Straus, Florian (1996): Qualitätsmanagement, Alling Boeßenecker, Karl-Heinz/ Vilain, Michael/ Biebrichter, Martin/ Buckley, Andrea/ Markert, Andreas (Hrsg.) (2003): Qualitätskonzept in der Sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis, Beltz Verlag, Weinheim Bothfeld, Silke / Gronbach, Sigrid / Riedmüller, Barbara (Hrsg.) (2002): Gender Mainstreaming – eine Innovation in der Gleichstellungspolitik. Zwischenberichte aus der politischen Praxis. Frankfurt/Main – New York Brauer, Jörg-Peter (2000): DIN EN ISO 9000:2000ff umsetzen. München – Wien Brauner, Jörg-Peter / Kühme, Ernst Ulrich (1997): DIN EN ISO 9000 – 9004 umsetzen. München – Wien Breitenfeld, Michael / Edlinger, Astrid / Pock, Ralf (2002): BVergG. Bundesvergabegesetz 2002. Wien - Graz Leittext März 2006 Seite 154 Briefs, Ulrich (1984): Informationstechnologien und Zukunft der Arbeit. Mikroelektronik und Computertechnik. Köln Brödner, Peter (1986): Fabrik 2000. Alternative Entwicklungspfade in die Zukunft der Fabrik. Berlin (West) Brunner, Ewald Johannes (1998): Soziale Einrichtungen im Härtetest – Vom Nutzen und Nachteil von Evaluation und Qualitätssicherung für soziale Organisationen. In: Brunner. Ewald Johannes/ Bauer, Petra/ Volkmar, Susanne (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten. Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg i. Br. S 8-15 Buchinger, Birgit / Gschwandtner, Ulli (1998): Goldmarie. Eine Fachtagung zu Lohn, Qualifikation und Geschlecht. Tagungsdokumentation. Hrsg.: BMAGS Frauengrundsatzabteilung, Wien Budäus, Dietrich / Conrad, Peter / Schreyögg, Georg (Hrsg.) (1998): New Public management. Berlin – New York Buchinger, Regina, (1998): Frauenspezifische Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt und die Antwort der österreichischen Arbeitsmarktpolitik, in: Sauer, Birgit/ Kreisky, Eva, Geschlecht und Eigensinn. Feministische Recherchen in der Politikwissenschaft, Wien, S. 101-114 Bundesvergabeamt (Hrsg.) (2003): Standpunkte zum Vergaberecht. Materielles Recht und Verfahrensrecht. Wien Bungart, Jörg / Supe, Volker / Willems, Peter (2000): Handbuch zum Qualitätsmanagement in Integrationsfachdiensten. Ergebnisse eines Modellprojektes. Münster Bungart, Jörg (2001): Qualitätsmanagement in sozialen Arbeitsfeldern. In: BAG UB impulse, Nr.19, S. 14-20 Burmeister, Jürgen (2004): Rechtliche Grundlagen für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. In: Knorr, Friedhelm/ Halfar, Bernd (Hrsg.) (2000): QualitätsManagement in der Sozialarbeit - Für Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Sozialverwaltungen, Freie Wohlfahrtsverbände, Fachverlag Walhalla, Regensburg Büker, Christa (2003): Das 2Q-System- In: Boeßenecker, Karl-Heinz/ Vilian, Michael/ Biebricher, Martin (2003): Qualitätskonzept in der Sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis, Betlz Verlag, Weinheim Ciriec (2000): The enterprises and organizations of the third system. A strategic challenge for employment. Liege. Christa, Harald (2000): Praxisbeispiele für Qualitätsmanagement. In: Knorr, Friedhelm/ Halfar, Bernd (Hrsg.) (2000): Qualitäts-Management in der Sozialarbeit – Für Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Sozialverwaltungen, Freie Wohlfahrtsverbände, Fachverlag Walhalla, Regensburg Decker, Franz (1997): Das große Handbuch: Management für soziale Institutionen. Landsberg am Lech Leittext März 2006 Seite 155 Depner, Wolf /Trube, Archim (2001): Der Wandel der Gesellschaft und die Qualitätsdebatte im Sozialsektor. In Neue Praxis, Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 31. Jahrgang 2001, Heft 3, S. 217-237, Neuwied Derrida, Jacques (2003): Privileg. Vom Recht auf Philosophie I. Wien Dimmel, Nikolaus (2004): Zur Praxis der Vergabe von Dienstleistungen im Rahmen der österreichischen Sozialwirtschaft. Kriterienkatalog für ein good practice-Modell der Strukturierung von Vergabeverfahren. Anhaltspunkte für eine inhaltlich-sachliche Bestimmung der einzugehenden Vertragsverhältnisse. Vorläufiger Endbericht 2004. Dimmel, Nikolaus (2005): Perspektiven der Sozialwirtschaft 2005 – 2015. Vergaberecht – Leistungsverträge – Sozialplanung. Wien Donabedian, Avedis (1982): The Criteria and Standards of Quality – Explorations in Quality, Assessment and Monitoring, Volume II, Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan Duden (1963): Das Herkunftswörterbuch – Eine Etymologie der deutschen Sprache. Mannheim – Wien – Zürich Duden (2001): Das Fremdwörterduden, 7., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Duden Band 5, Dudenverlag, Mannheim Eckardstein, Dudo v. / Kasper, Helmuth / Mayrhofer, Wolfgang (Hrsg.) (2005): Management: Theorien-Führung-Veränderung. Stuttgart Eckardstein, Dudo v. / Simsa, Ruth (2000): Erfolgsmessung und -steuerung in NPOs – Der stakeholder-orientierte Prozess der Erfolgsbestimmung. In: Unterlage zur Tagung des NPOInstituts der WU: Nutzen und Schaden von Erfolgsmessung für NPOs. Wien Ehrenberg, John (1999): Civil Society. The critical history of an idea. New York – London Esping-Anderson, Gösta (1990): The three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge Esping-Anderson, Gösta (1998): Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Zur Politischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates. In: Lessenich, Stephan / Ostner, Ilona: Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive. Frankfurt/Main – New York, S. 19 - 58 Esping-Anderson, Gösta (2000): Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford, GB Essl, Günter (2003): Qualitätsmanagement im Dritten Sektor in Wien, unveröffentlichter Zwischenbericht zur Studie ‚Der Dritte Sektor in Wien: Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung eines beschäftigungsintensiven Wirtschaftsbereiches’. Wien. Europäische Kommission (Hrsg.) (1996): Mitteilungen der Kommission über die Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft, Brüssel Europäische Kommission (Hrsg.) (1998a): Handbuch Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Europäischen Union, Brüssel Europäische Kommission (Hrsg.) (1998b): Chancengleichheit für Frauen und Männer. Texte aus dem Gemeinschaftsrecht, Brüssel Leittext März 2006 Seite 156 EuroQol 5D (ohne Jahr): EQ 5D, gefunden in www.euroqol.org/web/ im Jänner 2006 Evers, Adalbert / Ostner, Ilona / Wiesenthal, Helmut (1989): Arbeit und Engagement im intermediären Bereich. Zum Verhältnis von Beschäftigung und Selbstorganisation in der lokalen Sozialpolitik. Augsburg Evers, Adalbert (1990): Im intermediären Bereich – Soziale Träger und Projekte zwischen Haushalt, Staat und Markt. In: Journal für Sozialforschung 2/90, S. 189 – 210 Evers, Adalbert / Wintersberger, Helmut (1990): Shifts in the Welfare Mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare policies. Frankfurt/Main – Boulder, Colorado Evers, Adalbert / Haverinen, Rita / Leichsenring, Kai / Wistow, Gerald (eds.) (1997): Developing Quality in Personal Social Services. Concepts, Cases and Comments. Aldershot – Brookfield USA – Singapore – Sydney Fasching, Harald / Lange, Reinhard (Hrsg.) (2005): sozial managen. Grundlagen und Positionen des Sozialmanagements zwischen Bewahren und radikalem Verändern. Bern Stuttgart - Wien Feyerer, Ewald (2000): Eine gemeinsame Schule benötigt eine gemeinsame LehrerInnen(aus)bildung. In: Hans, Maren / Ginnold, Antje (Hrsg.): Integration von Menschen mit Behinderungen – Entwicklung in Europa. Neuwied – Kriftel – Berlin, S. 248 269 Fleissner, Peter (Hrsg.) (1987): Technologie und Arbeitswelt in Österreich. Trends bis zur Jahrtausendwende. Wien (4 Bände) Flick, Reiner (2001): Von Ford lernen? Automobilbau und Modernisierung in Deutschland bis 1933. Köln – Weimar – Wien Foucault, Michel (1976): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt/Main Ford, Henry (1926): Mein Leben und Werk. Leipzig Frehr, Hans-Ulrich (1994): Total Quality Management. In Masing, Walter (Hrsg.): Handbuch Qualitätsmanagement, München/Wien Fuchs, Peter (2005): Soziale Arbeit – System, Funktion, Profession. In: Krebs, Marcel / Uecker, Horst D. (Hrsg.): Beobachtungen der Sozialen Arbeit. Heidelberg, S. 13 - 18 Fuxjäger, Renate / Rosenbichler, Ursula / Schörghuber, Karl (2004): Gender Mainstreaming in Förderstellen und in der regionalen Programmplanung. Grundlagen – praktische Umsetzung – Reflexion. Wien – Eisenstadt Ganßmann, Heiner (2000): Politische Ökonomie des Sozialstaates. Münster Gast, Günther F. (2002): Das österreichische vergaberecht. Europarechtliche Vorgaben – Verfahren – Rechtsschutz. Wien Geiger, Walter / Kotte, Willi (2005): Handbuch Qualität. Grundlagen und Elemente des Qualitätsmanagements: Systeme – Perspektiven. Wiesbaden Gerull, P. (2000): Hand- und Werkbuch Soziales Qualitätsmanagement. Konzepte und Erfahrungen. Herausgegeben vom Evangelischen Erziehungsberband EREV e.V. Hannover Leittext März 2006 Seite 157 Gietl, Gerhard / Lobinger, Werner (2003): Qualitätsaudit. München - Wien Glasl, Friedrich / Lievegoed Bernhard (1993): Dynamische Unternehmensentwicklung. Wie Pionierbetriebe und Bürokratien zu schlanken Unternehmen werden. Bern/Stuttgart. Godenzi, Alberto / Dackweiler, Regina / König, Ilse (2000): „Man hat nur ein Leben.“ Reaktionen von Männern in Organisationen auf Gleichstellungsinitiativen, Wien Goffman, Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt/Main Gorz, Andre (1983): Abschied vom Proletariat. Reinbeck Gorz, Andre (1984): Wege ins Paradies. Berlin Gorz, Andre (2000): Arbeit zwischen Misere und Utopie. Frankfurt/Main Grünberger, Herbert (2003): Praxisratgeber für Vereine mit Vereinsgesetz 2002. Wien Güldenberg, Stefan (1999): Wissensmanagement. In: Eckardstein, Dudo v. / Kasper, Helmuth / Mayrhofer, Wolfgang (Hrsg.): Management: Theorien - Führung - Veränderung, Stuttgart S. 521 - 545 Güldenberg, Stefan / Mayerhofer, Helene / Steyrer, Johannes (1999): Zur Bedeutung von Wissen. In: Eckardstein / Kasper / Mayrhofer (Hrsg.): Management: Theorien – Führung Veränderung, Stuttgart S. 589 - 596 Gumpp, Gunther B. / Wallisch, Franz (1995): ISO 9000 entschlüsselt. Landsberg am Lech Hallwirth, Volker (1998): Und Keynes hatte doch recht. Eine neue Politik für Vollbeschäftigung. Frankfurt/Main – New York Hamson, Ned / Zuckerman, Amy (2002): Managing Quality. Oxford (UK) Haug, Frigga (2003): Lernverhältnisse. Selbstbewegungen und Selbstblockierungen. Hamburg Hansmeier, Thomas/ Spyra, Karla/ Müller-Fahrnow Werner (2004): Rehasystemorientierte und klinikbezogene Qualitäsmanagementansätze. In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel, 2. Auflage, Seiten 229 – 241 Heiner, Maja (2004): Professionalität in der Sozialen Arbeit – Theoretische Konzepte, Modelle und empirische Perspektiven, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart Heiner, Maja (1996): Ziel und kriterienbezogenes Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit. In: Merchel, Joachim/ Schrapper, Christian (Hrsg.): Neue Steuerung, Votum Verlag Münster Herrmannstorfer, Udo (2004): „Wege zur Qualität“ – Ein in anthroposophisch orientierten Einrichtungen der Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz entwickelter Arbeitsansatz. In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel, 2. Auflage, Seiten 217 – 228 Hinrichs, Peter (1981): Um die Seele des Arbeiters. Arbeitspsychologie, Industrie- und Betriebssoziologie in Deutschland. Köln Leittext März 2006 Seite 158 Hinrichs, Peter / Peter, Lothar (1976): Industrieller Friede? Arbeitswissenschaft und Rationalisierung in der Weimarer Republik. Köln Hirsch, Joachim (1990): Kapitalismus ohne Alternative? Hamburg Hirsch, Joachim (2002): Herrschaft, Hegemonie und politische Alternative. Hamburg Horstmann W. (Instrument) (1999): Der Balanced Scorecard- Ansatz als Instrument der Umsetzung von Unternehmensstrategien. In: Controlling, 4/5, S. 193-199Hovorka Hans unter Mitarbeit von Bauer Ingrid / Schmid Tom (1996): Familienpolitische Begleitstudie zum Pflegegeldgesetz. Wien-Klagenfurt Hovorka, Hans (2000): Gemeindenahe schulübergreifende Integration(spädagogik): Eine bildungs- und sozialpolitische Herausforderung. In: Hovorka, Hans / Sigot, Marion (Hrsg.): Integration(spädagogik) am Prüfstand. Menschen mit Behinderungen außerhalb von Schule. Innsbruck – Wien München. S. 297 – 320 Hughes, Thomas P. (1991): Die Erfindung Amerikas. Der technologische Aufstieg der USA seit 1870. München Humphreys, Anne / Müller Kurt (1996): Norm und Normabweichung. In: Zwierlein, Eduard (Hrsg.): Handbuch Integration und Ausgrenzung, Neuwied – Kriftel – Berlin, S. 56 - 70 Hummel, Konrad (1991): Freiheit statt Fürsorge – Vernetzung als Instrument zur Reform kommunaler Altenhilfe. Hannover Illich, Ivan (1995): Entschulung der Gesellschaft. Eine Streitschrift. München Illich, Ivan (1998): Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik. München Jahoda, Marie / Lazarsfeld, Paul / Zeisel, Hans (1982): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch. Frankfurt/Main Jost, Wolfgang/ Böllinger, Martin (Hrsg.) (2004): Qualität schafft Vertrauen – Das Berufsregister als Gütesiegel der Sozialen Arbeit, Herausgegeben von Berufsregister für Soziale Arbeit e.V. Freiburg i. Br., BSA-Reader 1/2004), VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin Journal für Gesundheitsökonomie (2003): Gesundheitsbezogene Lebensqualität und QALY’s. Wien, Heft 1/2003, S. 22 - 23 Jung, Raimund (2003): Soziale Hilfe als Dienstleistung. In: Olk, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Soziale Arbeit als Dienstleistung. Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München, S. 388 - 404 Kamiske, Gerd F. (2000): Der Weg zur Spitze. München Kamiske, Gerd F./ Brauer, Jörg-Peter (2003): Qualitätsmanagement von A bis Z. Erläuterungen moderner Begriffe des Qualitätsmanagements. München – Wien Katz, L (1996): Qualität der Früherziehung in Betreuungseinrichtungen: Fünf Perspektiven. In: Tietze, W. (Hrsg.) (1996):Früherziehung. Neuwied u.a., S 226-239 Kaufmann, Franz-Xaver (1987): Staat, intermediäre Instanzen und Selbsthilfe. München Kaufmann, Franz-Xaver (1997): Herausforderungen des Sozialstaates. Frankfurt/Main Leittext März 2006 Seite 159 Kaufmann, Franz-Xaver (2003): Varianten des Wohlfahrtsstaates. Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich. Frankfurt/Main Keupp, Heiner: Die Suche nach der Qualität Sozialer Arbeit im Spannungsfeld von Markt, Staat und Bürgergesellschaft, In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel - 2. Auflage, Seiten 326 – 340 Klammer, Ute (2001): „Flexicurity“ als zukünftige Leitidee sozialer Sicherung in Europa – Eine Antwort (nicht nur) auf die neue Vielfalt weiblicher Erwerbs- und Lebenszusammenhänge. In: Andruschow, Katrin (Hrsg.) (2001): Ganze Arbeit. Feministische Spurensuche in der Non-Profit-Ökonomie. Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, Berlin, S 241-265. Kleve, Heiko (2005): Sozialwissenschaft, Systemtheorie und Postmoderne. In: Krebs, Marcel / Uecker, Horst D. (Hrsg.): Beobachtungen der Sozialen Arbeit. Heidelberg, S. 47 52 Klimecki, Rüdiger / Müller, Werner R. (Hrsg.) (1999): Verwaltung im Aufbruch. Modernisierung als Lernprozess. Zürich Klockhohn, C. (1951): Values and Value-Orientations in the Theory of Action. In: Parsons, T, Shils, E.A. (Hrsg.) Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 388-433 Knorr, Friedhelm / Halfar, Bernd (2000): Qualitätsmanagement in der Sozialarbeit. Für Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Sozialverwaltungen, Freie Wohlfahrtsverbände. Regensburg König, Klaus (1995): „Neue“ Verwaltung oder Verwaltungsmodernisierung: Verwaltungspolitik in den Neunziger Jahren. In: Die Öffentliche Verwaltung 9, Stuttgart. S. 349 - 358 Königswieser, Roswita / Lutz, Christan (1992): Das Systemisch Evolutionäre Management. Gelassenheit – Zukunftsarbeit – Problemdiagnose – Projektmanagement – Unternehmenskultur. Wien Korinek, Karl (RZ 701 – 752 ): Krebs Heinz (1996): Gesundheit – Krankheit – Behinderung. Kritische Anfragen an das gängige Normalitätskonzept. In: Zwierlein, Eduard (Hrsg.): Handbuch Integration und Ausgrenzung, Neuwied – Kriftel – Berlin, S. 39 – 55 Kreisky, Eva / Sauer, Birgit (1998): Geschlecht und Eigensinn, Feministische Recherchen in der Politikwissenschaft, Wien Kreuter, Marshall W. / Lezin, Nicole A. / Kreuter, Mathew W. / Green, Lawrence E. (1998): Community Health Promotion. Ideas that work. A Field-Book for Practitioners. Boston Kromrey, Helmut (2000): Die Bewertung von Humandienstleistungen. Fallstricke bei der Implementations- und Wirkungsforschung sowie methodische Alternativen. In: MüllerKohlenberg, Hildegard/ Münsterman, Klaus (Hrsg.) (2000): Qualität von Leittext März 2006 Seite 160 Humandienstleistungen - Evaluation und Qualitätsmanagement in Sozialer Arbeit und Gesundheitswesen, Leske + Budirch Verlag, Opladen, S. 19 – 58 Kromery, H./ Ollmannn, R. (1985): Handlungsorientierungen und gebaute Umwelt. Zur subjektiven Bedeutung objektiver Indikatoren. In: Informationen zur Raumentwicklung, H.5, S. 393-406 Kron, Maria (2001): Zur Qualität der Qualitätssicherung: Die Validität der Qualitätssicherung und ihrer Instrumente – Definitionskompetenzen und Verfahrenssicherheit In: Schädler, Johannes/ Schwarte, Norbert /Trube, Archim (Hrsg): Der Stand der Kunst – Qualitätsmanagement Sozialer Dienste – Von grundsätzlichen Überlegungen zu praktischen Ansätzen eines fach- und adressatenorientierten Instrumentensets, Votum Verlag Münster, S. 112-128 Krönes, Gerhard: Paradigmen der Qualitätssicherung in sozialen Einrichtungen. In: Brunner, Ewald Johannes/ Bauer, Petra/ Volkmar, Susanne (Hrsg.) (1998): Soziale Einrichtungen bewerten. Theorie und Praxis der Qualitätssicherung, Freiburg i.Br., S. 69-86 Kropik, Andreas / Mille, Annemarie / Sachs, Michael (2003): Das Vergaberecht in Österreich. Wien Kropik, Andreas / Mille, Annemarie / Sachs, Michael (2006): Das Vergaberecht in Österreich. Aktuell: Das neue Bundesvergabegesetz 2006. Wien Kusche, Christoph / Krüger, Rolf (2001): Sozialarbeit muss sich endlich zu ihrem politischen Mandat bekennen. In: Merten, Roland (Hrsg.), Hat Sozialarbeitein politisches Mandat – Positionen zu einem strittigen Thema, Opladen, S.15 – 25 Lachhammer, Johann (1999): Patient als Mittelpunkt eines TQM-Systems? – Der Ansatz des Total Value Managements. IN: Sänger, V. (Hrsg.): Chirurgie im Spannungsfeld von Ökonomie und Humanität – Patient oder Profit im Mittelpunkt? Barth, Heidelberg, 53-58 Lachhammer, Johann (2004): Total-Value-Management Mittelpunkt einer Qualitätsoffensive in sozialen Einrichtungen, In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel - 2. Auflage, Seiten 181 – 191 Lechner Karl / Egger Anton / Schauer Reinbert (2004): Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Wien Leibetseder, Bettina / Lindner, BNerthold / Lion-Schwammeis, Birgit / Löschnigg, Günther / Phillip, Thomas / Resch, Reinhard / Schmid, Tom / Stelzer-Orthofer, Christine (2005): Diskriminierungsfreier Musterkollektivvertrag für den österreichischen Gesundheitsund Sozialbereich. Wien. Leibfried, Stephan / Leisering, Lutz (1995): Zeit der Armut. Frankfurt/Main Leichsenring, Kai / Stadler, Michael (1999): Persönliche soziale Dienstleistungen und Qualität der Arbeitsbedingungen. Österreichischer Länderbericht im Rahmen einer internationalen Studie für die European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin). Wien Leittext März 2006 Seite 161 Leidl, Reiner (2005): Ökonomische Evaluation und Gesundheitspolitik: Entscheidungen bei „schwierigen“ Kosten-Effektivitätsrelationen, Referatsunterlage vom 25. Hochschulkurs aus Gesundheitsökonomik in Seefeld/Tirol Leitner, Andrea / Wroblewski Angela (2000): Chancengleichheit und Gender Mainstreaming: Ergebnisse der begleitenden Evaluierung des österreichischen NAP, IHS Reihe Soziologie Nr. 41, Wien Lessenich, Stephan / Ostner, Ilona (1998): Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive. Frankfurt/Main – New York Lietz, J.H. (1994): Von der Zweck-Gemeinschaft zur Sinn-Gemeinschaft. In: Kamiske, G.F. (Hrsg.): Die Hohe Schule des Total Quality Managements, Springer, Berlin, 111Lingenauber, Sabine (2003): Integration, Normalität und Behinderung. Eine normalismustheoretische Analyse der Werke /1970 – 2000) von Hans Eberwein und Georg Feuser. Opladen Luschei, Frank/ Trube, Archim (2001): Der Stand der Kunst – Zur frage sozialpolitischer und fachlicher Standards des Qualitätsmanagements für Angebote der Beschäftigungsförderung. In: Schädler, Johannes/ Schwarte, Norbert/ Trube, Archim (Hrsg.) (2001): Der Stand der Kunst – Qualitätsmanagement Sozialer Dienste – Von grundsätzlichen Überlegungen zu praktischen Ansätzen eines fach- und adressatenorientierten Instrumentensets, Votum Verlag, Münster Lüscher, Rudolf (1985): Henry und die Krümelmonster. Tübingen Majer, Christian (1999): ISO 9000-Zertifizierung. In: Eckardstein / Kasper / Mayrhofer (Hrsg.): Management: Theorien - Führung - Veränderung. Stuttgart S. 405-420 Maelike, Berd (Hrsg.) (1994): Beratung und Entwicklung sozialer Organisationen. BadenBaden Maelike, Bernd (Hrsg.) (1998): Freie Wohlfahrtspflege im Übergang zum 21. Jahrhundert. Baden-Baden Malek Mo (2001): Implementing QAlYs. Gefunden in www.evidence-based-medicine.co.uk im Jänner 2006 Mannheim, Karl (1980): Strukturen des Denkens, Frankfurt/Main Margalit, Avishai (1999): Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Frankfurt/Main Masing, Walter (Hrsg.) (1994): Handbuch Qualitätsmanagement. München – Wien Matul, Christian / Scharitzer, Dieter (1997): Qualität der Leistungen in NPOs. In: Badelt, Christoph (Hrsg.): Handbuch der Nonprofit Organisation. Strukturen und Management. Stuttgart, S. 387 - 412 Mayrhofer, Marlene / Pallas, Bettina / Schmid, Tom (2005): Alternative Finanzierungsmodelle im Bereich der fremd- und Zwischenfinanzierung. Best Practices und Handlungsoptionen für die Kärntner Sozialwirtschaft. Projektbericht. Wien – Klagenfurt/Celovec Meinhold, Marianne (1996): Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement Sozialarbeit - Einführung und Arbeitshilfen, Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgau in der Leittext März 2006 Seite 162 Meinhold, Marianne (1998): Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Freiburg/Breisgau Meinhold, Marianne (2002): Über Einzelfallhilfe und Case Management. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch, Oplanden. S 509-521 Meinhold, Marianne (2003): Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit – Plädoyer für einen eigenen Weg. In: Olk, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Soziale Arbeit als Dienstleistung. Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München, S. 130 – 149 Meinhold, Marianne/ Matul, Christian (2003): Qualitätsmanagement aus der Sicht von Sozialarbeit und Ökonomie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden Melinz, Gerhard (2000): Der Wohlfahrtsmix und „bürgerschaftliches Engagement“ – Eine historische Skizze. In: Roessler, Marianne/ Schnee, Renate/ Spitzy, Christine/ Stoik, Christioph (Hrsg.) (2000): Gemeinwesenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement – Eine Abgrenzung, Wien Merchel, Joachim (Hrsg.) (1998): Qualität in der Jugendhilfe. Votum, Münster Merchel, Joachim (2004): Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit – Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Juventa Verlag Weinheim und München, 2. Auflage Merten, Roland (Hrsg.) (2001): Hat Sozialarbeitein politisches Mandat – Positionen zu einem strittigen Thema, Opladen Mertens, Heide (2001): Unbezahlte Arbeit als Ausgangspunkt für einen neuen Arbeitsbegriff und Grundlage der Entstehung lokaler Ökonomie. In: Andruschow, Katrin (Hrsg.) (2001): Ganze Arbeit. Feministische Spurensuche in der Non-Profit-Ökonomie. Hans-BöcklerStiftung, Düsseldorf, Berlin, S 159-177. Meyer, Jürgen (Hrsg.) (1996): Benchmarking: Spitzenleistungen durch Lernen von den Besten. Stuttgart Moos, Gabriele (2004): Balanced Scorecard – ein geeignetes Führungsinstrument für soziale Einrichtungen? In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel, 2.Auflage S. 192-202 Mülhausen, Susanne (2004): Qualität in der Sozialen Arbeit – Pflicht oder Chance? Tectum Verlag Marburg Müller, C. Wolfgang (1988a): Wie helfen zum Beruf wurde. Methodengeschichte der Sozialarbeit 1883 – 1945. Weinheim – Basel Band 1. Eine Müller, C. Wolfgang (1988b): Wie helfen zum Beruf wurde. Methodengeschichte der Sozialarbeit 1945 – 1985. Weinheim – Basel Band 2. Eine Müller, C. Wolfgang (1997): Wie helfen zum Beruf wurde – Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1945 – 1995, Band 2., 3.Auflage, Weinheim - Basel Müller, Siegfried / Sünker, Heinz / Olk, Thomas / Böllert, Karin (Hrsg.) (2000): Soziale Arbeit. Gesellschaftliche Bedingungen und gesellschaftliche Perspektiven. Neuwied – Kriftel Leittext März 2006 Seite 163 Müller-Schöll, Albrecht / Priebke, Manfred (1992): Sozialmanagement. Zur Förderung systematischen Entscheidens, Planens, Organisierens, Führens und Kontrollierens in Gruppen. Neuwied – Kriftel - Berlin Naegele, Gerhard (1993): Standards in der kommunalen Altenplanung – Die Zeit der „einfachen Antworten“ ist vorbei. In: Kühnert, Sabine / Naegele, Gerhard (Hrsg.): Perspektiven moderner Altenpolitik und Altenarbeit. Hannover Nagl-Docekal, Herta / Pauer-Studer, Herlinde (Hrsg.) (1996): Politische Theorie – Differenz und Lebensqualität, Frankfurt/Main Naschold, Frieder (1995): Ergebnissteuerung, Wettbewerb, Entwicklungspfade des öffentlichen Sektors in Österreich. Berlin Qualitätspolitik. Naschold, Frieder / Jann, Werner / Reichard, Christoph (1999): Innovation, Effektivität, Nachhaltigkeit. Internationale Erfahrungen zentralstaatlicher Verwaltungsreform. Berlin Naylon, Isabel / Weber, Friederike (2000): Gender Mainstreaming als Ansatz einer Politik der Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Wien Obermair, Wolfgang (2004): „Führung durch Zielvereinbarung“ in sozialen Organisationen. In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel, 2.Auflage S. 242-251 Olk, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.) (2003): Soziale Arbeit als Dienstleistung. Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München Osterkamp, Ute (1990): Intersubjektivität und Parteinahme: Probleme subjektwissenschaftlicher Forschung. In: Gekeler, Gert / Wetzel, Konstanze (Hrsg.), Subjektivität und Politik, Marburg/Lahn Österreichische Akademie der Wissenschaften (1981): Mikroelektronik. Anwendung, Verbreitung und Auswirkungen am Beispiel Österreichs. Wien Österwitz, Ingolf (1996): Das Konzept Selbstbestimmt Leben – eine neue Perspektive in der Rehabilitation? In: Zwierlein, Eduard (Hrsg.): Handbuch Integration und Ausgrenzung, Neuwied – Kriftel – Berlin, S. 196 – 206 Pantucek, Peter (1998): Lebensweltorientierte Individualhilfe – Eine Einführung für soziale Berufe, Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgau Patzak, Gerold / Rattay, Günter (1998): Projektmanagement. Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. Wien Peterander, Franz: Neue Technologien und Qualitätsentwicklung in sozialen Einrichtungen, In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel - 2. Auflage, S. 311–325 Peterander, Franz / Speck, Otto (Hrsg.) (1999): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München – Basel Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, München – Basel, 2. Auflage Peters, Tom/ Austin, Nancy (1993): Leistung aus Leidenschaft, Über Management und Führung, Hamburg Leittext März 2006 Seite 164 Preißner, Andreas (2003): Balanced Scorecard anwenden. München - Wien Priller, Eckhard / Zimmer, Annette (Hrsg.) (2001): Der Dritte Sektor international. Mehr Markt – weniger Staat. Berlin. Prochazkova, Lucie / Schmid, Tom (2005): Pflege im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Beschäftigung. Wien (Forschungsbericht) QSI (Hrsg.) (2004): Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit – Erkenntnisse und Empfehlungen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft QSI (Qualitätshandbuch). Wien Radtke, Phillip / Wilmes, Dirk (2002): European Quality Award. Praktische Tipps zur Anwendung des EFQM-Modells. München-Wien Raschauer (1998) Grundriss des österreichischen Wirtschatfsrechtes. Wien Reamer, Frederic G. (1999): Social Work Values And Ethics. New York Reichmann-Rohr, Erwin (1999): Formen der Ausgrenzung in historischer Sicht. In: Eberwein, Hans (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim – Basel, S. 33 - 39 Regus, Michael (2001): Qualitätssicherung im Kontext wettbewerbsorientierter Gesundheitspolitik. In: Schädler, Johannes/ Schwarte, Norbert/ Trube, Archim (Hrsg): Der Stand der Kunst – Qualitätsmanagement Sozialer Dienste – Von grundsätzlichen Überlegungen zu praktischen Ansätzen eines fach- und adressatenorientierten Instrumentensets, Votum Verlag, Münster, S. 68-96 Reis, Claus (2003): MitarbeiterInnen in Sozial- und Jugendämtern – Innovationsbremse bei der Einführung von „Public Managenet“ in der Sozialverwaltung?. In: Olk, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Soziale Arbeit als Dienstleistung. Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München, S. 260 – 283 Ritzer, George (1993): Die McDonaldisierung der Gesellschaft. Frankfurt/Main Ritzer, George (1997): Die McDonaldisierung der Gesellschaft. Frankfurt/Main Rosenberger, Sieglinde Katharina (2001): Stellungnahme zur Studie Gender Mainstreaming in der Wiener Arbeitsmarktpolitik, Wien Rosenberger, Sieglinde / Talos, Emmerich (Hrsg.) (2003): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspektiven. Wien Rothschild, Kurt W. (2004): Die politischen Visionen großer Ökonomen. Bern – Göttingen Sachße, Christoph / Tennstedt, Disziplinierung. Frankfurt/Main Florian (1986): Soziale Sicherheit und soziale Sallmutter, Hans (Hrsg.) (1998): Wieviel Globalisierung verträgt unser Land? Zwänge und Alternativen, Wien Salomon, Lester M. (2001): Der Dritte Sektor im internationalen Vergleich – zusammenfassende Ergebnisse des Johns Hopkins Comparative Project. In: Priller / Zimmer (Hrsg.): Der Dritte Sektor international. Mehr Markt – weniger Staat? Hrsg. vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Berlin, S. 29-56. Leittext März 2006 Seite 165 Salomon, Lester M. / Anheier, Helmut K. (Hrsg.) (1999): Der Dritte Sektor. Aktuelle internationale Trends. The Johns Hopkins Comperative Nonprofit Sector Project, Phase II. Gütersloh. Satilmis, Ayla (2005): Qualitätsstandards in Zeiten andauernder Massenerwerbslosigkeit: Luxus oder Notwendigkeit? Reflexionen zur Bedeutung von qualitativen Anforderungen an Arbeit. In: Lepperhof, Julia / Satilmis, Ayla / Scheele, Alexandra (Hrsg.): Geschlechterpolitische Beiträge zur Qualität von Arbeit. Made in Europa. Münster Schaarschuch, Andreas (2003): Die Privilegierung des Nutzers. Zur theoretischen Begründung sozialer Dienstleistung. In: Olk, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrg.): Soziale Arbeit als Dienstleistung. Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München, S. 150 – 169 Scharitzer, Dieter/ Sinkovics, Rudolf (1997): Österreichisches Rotes Kreuz, Bezirksstelle Korneuburg: Erhebung der KundInnenzufriedenheit bei Krankentransporten In: Buber, Renate/ Meyer, Michael (Hrsg.): Fallstudien zum Nonprofit Management – praktische BWL für Vereine und Sozialeinrichtungen, Schäfer Poeschl-Verlag, Stuttgart S. 220-243 Schauer, Reinbert / Anheier, Helmut K. / Blümle, Ernst Bernd (Hrg.) (1997): Der NonprofitSektor im Aufwind – zur wachsenden Bedeutung von Nonprofit-Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene. Linz. Schaarschuch, Andreas (2000): Gesellschaftliche Perspektiven sozialer Dienstleistungen; in: Müller, Siegfried / Sünker, Heinz / Olk, Thomas / Böllert, Karin (Hrsg.), Soziale Arbeit – gesellschaftliche Bedingungen und professionelle Perspektiven, Neuwied/Kriftel, S. 165 – 177 Schaarschuch, Andreas (2003): Die Privilegierung des Nutzers. Zur theoretischen Begründung sozialer Dienstleistung. In: Olk, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Soziale Arbeit als Dienstleistung. Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München, S. 150 – 169 Schedl Christoph (2002): Die Balanced Scorecard. Ein Leitfaden für die erfolgreiche Entwicklung und Implementierung. Wien Scherr, Albert (2005): Funktion und Code der Sozialen Arbeit. In Krebs, Marcel / Uecker, Horst D. (Hrsg.): Beobachtungen der Sozialen Arbeit. Heidelberg, S. 19 - 24 Scherer, Andreas Georg (Hrsg.) (2002): Balanced Scorecard in Verwaltung und Non-ProfitOrganisationen, Stuttgart (verfügbar UBWW Inst-272, 1090-UE) Scherrer, Christoph (1992): Im Banne des Fordismus. Die Auto- und Stahlindustrie der USA im internationalen Konkurrenzkampf. Berlin Schilling, Johannes (2005): Soziale Arbeit – Geschichte-Theorie-Profession, 2. Auflage, Erst Reinhardt Verlag München Schmid, Tom (1997): „Der Krebs, die Community und ich“ – Die Umwelt als Betreuungsressource – Möglichkeiten und Grenzen. In: Schießling Gabi (Hrsg.): Ich, der Krebs und Ihr – Kongressband. Innsbruck Schmid, Tom (1998): Solidarität aus sozialwissenschaftlicher Sicht. In Soziale Sicherheit 4/98, Wien, S. 292 – 299 Leittext März 2006 Seite 166 Schmid, Tom (2000): Zwischen Einkommensersatz und Armutsvermeidung – die doppelte Aufgabe gesellschaftlicher Sozialpolitik. In: Sallmutter, Hans (Hrsg.), Mut zum Träumen – Bestandsaufnahme und Perspektiven des Wohlfahrtsstaates, Wien, S. 39 - 58 Schmid, Tom (2004): Eulen nach Athen tragen. Oder: Gibt es eine besondere politische Verantwortung der Sozialarbeit? In: Knapp, Gerald (Hrsg.): Soziale Arbeit und Gesellschaft. Entwicklungen und Perspektiven in Österreich. Klagenfurt/Celovec, S. 241 – 262 Schmid, Tom (2004): Eulen nach Athen tragen oder: Gibt es eine besondere politische Verantwortung der Sozialarbeit? In: Knapp, Gerald (Hrsg.): Soziale Arbeit und Gesellschaft. Entwicklungen und Perspektiven in Österreich. Klagenfurt/Celovec – Ljubljana – Wien, S. 241 - 262 Schmid, Tom (2005): Integrace nebo segregace? In: Bartonova Miroslava / Pipekova, Jarmila / Vitkova, Marie (ed.): Integrace handicapovanych na trh prace v mezinarodni dimenzi, Brno, S. 102 – 113 Scheil-Adlung, Xenia (2001): Gestaltung der sozialen Sicherheit: Die Rolle der Privatisierung. Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt/Main – New York – Oxford – Wien Schneider, Volker (2001): Sozialarbeit zwischen Politik und professionellem Auftrag: Hat sie ein politisches Mandat? In: Merten, Roland (Hrsg.), Hat Sozialarbeitein politisches Mandat – Positionen zu einem strittigen Thema, Opladen, S. 27 – 40 Schönberger, Franz (1999): Die Integration Behinderter als moralische Maxime. In: Eberwein, Hans (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim – Basel, S. 80 - 87 Schörghuber, Karl / Rosenbichler, Ursula (2005): Gender Mainstreaming in sozialwirtschaftlichen Organisationen. In: Fasching, Harald / Lange, Reingard (Hrsg.): sozial managen. Grundlagen und Positionen des Sozialmanagements zwischen Bewahren und radikalem Verändern. Bern – Stuttgart – Wien. S. 83 – 106 Schubert, Herbert (Hrsg.) (2005): Sozialmanagement. Zwischen wirtschaftlichen und fachlichen Zielen. Wiesbaden Schunter-Kleemann, Susanne (2001): Gender Mainstreaming - Neoliberale Horizonte eines neuen Gleichstellungs-Konzepts. In: Kurswechsel 3/01, S. 15 - 25 Schwarte, Norbert / Oberste-Ufer, Ralf (1997): Qualitätssicherung und -entwicklung in der sozialen Rehabilitation Behinderter: Anforderungen an Prüfverfahren und Instrumente. In: Schubert, Hans-Joachim / Zink, Klaus, J. (Hrsg.): Qualitätsmanagement in sozialen Dienstleistungsunternehmen. Berlin, 56 – 83 Seghezzi, Hans Dieter (2003): Integriertes Qualitätsmanagement. München – Wien Seibel, Wolfgang (1990): Gibt es einen Dritten Sektor? Ein Forschungsüberblick. In: Journal für Sozialforschung 2/90, S. 181 - 188 Seibel, Wolfgang (1992): Funktionaler Dilettantismus. Erfolgreich Organisationen im „Dritten Sektor“ zwischen Markt und Staat. Baden-Baden scheiternde Seibel, Wolfgang (2002): Das Spannungsfeld zwischen Mission und Ökonomie, 5. NPOForschungscolloquium. Linz. Leittext März 2006 Seite 167 Senf, Bernd (2004): Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der Krise. München Sheehan, Heather / Snyser, Scott / Sheehan, Robert (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen in den USA. In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, München – Basel, 2. Auflage Seiten 114131 Simons, Thomas (1980): Modell Italien? In: Simons, Thomas (Hrsg.): Absage an die Anstalt. Programm und Realität der demokratischen Psychiatrie in Italien. Frankfurt/Main – New York, S. 9 – 22 Soiland, Tove (2005): Kritische Anmerkungen zum Machtbegriff in der Gender-Theorie auf dem Hintergrund von Michel Foucaults Gouvernementalitätsanalyse. In. Widersprüche Heft 95. Bielefeld. S. 7-25 Speck, Otto (1999): Die Ökonomisierung sozialer Qualität. Zur Qualitätsdiskussion in Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit. München – Basel Speck, Otto (2003): System Heilpädagogik – eine ökologisch-reflexive Grundlegung. 5. Aufl., München/Basel Speck, Otto (2004): Marktgesteuerte Qualität – eine neue Sozialphilosophie? In: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, München - Basel, 2.Auflage, S. 15-30 Spiegel, v. Hiltrud (1998): Selbstevaluation – Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung „von unten“. In: Merchel, Joachim (Hrsg.): Qualität in der Jugendhilfe. Münster Seiten 251– 371 Steinhauser, Werner (1992): Geschichte der Sozialarbeiterausbildung. Wien Stiegler, Barbara (2002): Wie Gender in den Mainstream kommt. Konzepte, Argumente und Praxisbeispiele zur EU-Strategie des Gender Mainstreaming. In: Bothfeld, Silke / Gronbach, Sigrid / Riedmüller, Barbara (Hrsg.): Gender Mainstreaming – eine Innovation in der Gleichstellungspolitik. Zwischenberichte aus der politischen Praxis. Frankfurt/Main – New York Strümpl, Charlotte / Pleschberger, Sabine (1999): Effizienter und verstärkter Einsatz von Freiwilligen in den Gesundheits- und Sozialdiensten des Roten Kreuzes. Wien Strunk, Andreas (Hrsg.) (1996): Dienstleistungscontrolling. Innovationssteuerung im Sozial- und Gesundheitssystem. Baden-Baden Strategien zur Sünker, Heinz (2001): Soziale Arbeit und Gesellschaftspolitik – Politisches Mandat als konstitutives Moment moderner Sozialarbeit. In: Merten, Roland (Hrsg.), Hat soziale Arbeit ein politisches Mandat? Positionen zu einem strittigen Thema, Opladen, S. 71 - 86 Svensson, Hans / Scherman, Karl-Gustav (Hrsg.) (1998): Die Zukunft der sozialen Sicherheit. Stockholmer Konferenz 29. Juni – 1. Juli 1998; Stockholm Taylor, Frederick Winslow (1919): Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung. München – Berlin Leittext März 2006 Seite 168 Tegethoff, H.G. (1995): Schlankheitskur für die Jugendhilfe nach dem Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). In: Neue Praxis 2, 132-150 Transition from School to Work (Hrsg.) (2005): Qualitätsstandards für einen guten Übergang Schule – Beruf. Ergebnisse der transnationalen Partnerschaft zwischen den Entwicklungspartnerschaften INTequal (Österreich), Open Doors und Keine Behinderung trotz Behinderung (Deutschland) Empowerment door transitie (Niederlande) und Integrative Guidance (Tschechien). Wien Vos, Hetty (2004): Das Berufsregister in den Niederlanden. In: Jost, Wolfgang/ Böllinger, Martin (Hrsg.) (2004): Qualität schafft Vertrauen – Das Berufsregister als Gütesiegel der Sozialen Arbeit, Herausgegeben von Berufsregister für Soziale Arbeit e.V.. Freiburg i. Br., BSA-Reader 1/2004), VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin Wanke, Hans-Jürgen (2003): Qualitäts-Check. In: Boeßenecker, Karl-Heinz/ Vilian, Michael/ Biebricher, Martin (2003): Qualitätskonzept in der Sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis, Beltz Verlag, Weinheim Weber, Max (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen Wendt, Wolf Rainer (Hrsg.) (1995): Soziale Arbeit im Wandel ihres Selbstverständnisses. Beruf und Identität. Freiburg/Breisgau Wendt, Wolf Rainer (2002): Sozialwirtschaftslehre. Grundlagen und Perspektiven. BadenBaden Wendt, Wolf Rainer (2003): Sozialwirtschaft – eine Systematik. Baden-Baden Wilk, Reynold M. (1990): Henry Ford and Grass-roots America. A fascinating account of the Model-T aera. University of Michigan Wilke, Helmut (2001): Systemisches Wissensmanagement. Stuttgart Wilke, Helmut (2004): Einführung in das systemische Wissensmanagement. Heidelberg Wilken, Udo (Hrsg.) (2000): Soziale Arbeit zwischen Ethik und Ökonomie. Freiburg/Breisgau Wolfgruber, Gudrun: http://www.sozialearbeit.at/veranstaltung.php?documentation=true&detail=1, weiter in PDF: VortragWolfgruber301105, 16.01.2006) Zeitschrift Widersprüche (20059): Genders neue Kleider? Postfeminismus, Neoliberalismus und die Macht. Heft 95. Bielefeld Dekonstruktivustischer Zentrum für Soziale Innovation / Sozialökonomische Forschungsstelle (2001): Gender Mainstreaming in der Wiener Arbeitsmarktpolitik. Forschungsprojekt im Auftrag des AMS Wien. Wien Zink, Klaus, J. (1995): TQM als integratives Managementkonzept. Das Europäische Qualitätsmodell und seine Umsetzung. München, Wien Zollondz, Hans-Dieter (Hrsg.) (2001): Lexikon Qualitätsmanagement – Handbuch des Modernen Managements auf dr Basis des Qualitätsmanagements, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München; Wien Leittext März 2006 Seite 169 Zollondz, Hans-Dieter (2002): Grundlagen Qualitätsmanagement, München Internetquellen: http://www.sozialarbeit.at/qual.htm (16.01.2006) http://www.dbsh.de/Qualit_tskriterien.pdf (erstellt am 17.05.2005, eingesehen 27.11.2005) http://www.dbsh.de/Qualiselbst.pdf (erstellt 17.05.2005, eingesehen 27.11.2005) http://www.sozialaktuell.ch/de/p11003083.html (eingesehen am 29.11.2005), http://www.sozialaktuell.ch/de/p42000177.html (eingesehen am 16.01.2006), http://www.avenirsocial.ch/home.cfm Leittext März 2006 Seite 170 15 Anhang 15.1 Anhang 1 15.1.1 Literaturzitate zu: Qualitäten der Beziehungsdienstleistung Sozialarbeit Lachhammer, Johann (2004): Total-Value-Management – Mittelpunkt einer Qualitätsoffensive in sozialen Einrichtungen, In: Peterander, Franz/Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel - 2. Auflage, Seiten 181 – 191: S 183: „Die Qualität einer sozialen Einrichtung umfasst alle relevanten Eigenschaften und Eignungen des Gesamtsystems, die geeignet sind, die vorgegebenen operativen und kurzfristigen sowie strategischen und langfristigen Ziele zu erreichen.“ S 184 (Lachhammer 1999): „1. Die Qualität sozialer Einrichtungen kann nicht nur aus der Innensicht definiert werden. Aufgrund der 1:n-Beziehung ist auch die Außensicht mit einzubeziehen. 2. Qualität hängt von der Dynamik der sozialen Einrichtung sowie von den Veränderungen in den Umweltbeziehungen ab. Sie ist damit relativ sowie mehrdimensional und spiegelt sich in bestimmten Qualitäts- und Zielniveaus wider. 3. Das Qualitätsniveau ist das Ergebnis eines Abgleichs zwischen Qualitätsanforderungen, Kosten und Nutzen. Dabei ist die Wirtschaftlichkeit die Rahmenbedingung, aber nicht das Ziel. 4. Aufgrund der unterschiedlichen Zielvorstellungen zwischen Organisationsmitglieder (soziale Einrichtung) und Organisationsteilnehmer (Umwelt) kann die Grundlage eines von beiden Seiten akzeptierten Qualitätsniveaus nur sein: ein Wertekonsens innerhalb der 1:n-Beziehung. Dieser Wertekonsens findet seinen Ausdruck in einem wertebasierten Zielsystem. Qualität wird damit zum Ausdruck einer Sinngemeinschaft auf der Grundlage von Anspruchsniveaus (Lietz 1994). 5. Ohne ein fundiertes Wertesystem gäbe es überhaupt keine stabile Richtschnur für die Ziele und Handlungen der Sinngemeinschaft. Werte sind deshalb Leitlinien bei der Wahl zwischen Handlungsalternativen, sie sind "Konzeptionen des Wünschenswerten“ (Klockhohn 1951).Jeder machtbezogene Versuch, von innen oder außen auf die Sinnesgemeinschaft und ihre Wertebasis einzuwirken, führt unweigerlich zu einem Konflikt“ Leittext März 2006 Seite 171 Zusätzliche Literatur: Klockhohn, C. (1951): Values and Value-Orientations in the Theory of Action. In: Parsons, T, Shils, E.A. (Hrsg.) Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 388433 Lachhammer, J. (1999): Patient als Mittelpunkt eines TQM-Systems? – Der Ansatz des Total Value Managements. IN: Sänger, V. (Hrsg.): Chirurgie im Spannungsfeld von Ökonomie und Humanität – Patient oder Profit im Mittelpunkt? Barth, Heidelberg, 53-58 Lietz J.H. (1994): Von der Zweck-Gemeinschaft zur Sinn-Gemeinschaft. In: Kamiske, G.F. (Hrsg.): Die Hohe Schule des Total Quality Managements, Springer, Berlin, 111-130 Peterander, Franz: Neue Technologien und Qualitätsentwicklung in sozialen Einrichtungen, In: Peterander, Franz/Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel - 2. Auflage, Seiten 311 – 325 S 313: "Die inhaltliche Arbeit der Fachleute in sozialen Einrichtungen beruht häufig auf ihren persönlichen Erfahrungen, Alltagstheorien und ihrer Intuition. Diese subjektiven Erfahrungen leisten zwar einen wesentlichen Beitrag bei der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen bzw. bei der individuellen Förderung von Kindern, doch stellen sie nur einen wichtigen Aspekt des therapeutischpflegerischen fachlichen Handelns dar. Wertvolle Informationen werden auf diese Weise nicht oder nicht in erforderlichen Umfang genutzt oder gehen verloren, und eher subjektive Bewertungen bestimmen Ziele und Inhalte des fachlichen Handelns. In dieser Situation tun sich nicht nur junge und berufsunerfahrene Fachleute schwer, sonder sie entspricht auch nicht einer professionellen und rational begründbaren Fachlichkeit (Speck 2003)." Zusätzliche Literatur: Speck, O. (2003): System Heilpädagogik – eine ökologisch-reflexive Grundlegung. 5. Aufl. Ernst Reinhardt, München/Basel Keupp, Heiner: Die Suche nach der Qualität Sozialer Arbeit im Spannungsfeld von Markt, Staat und Bürgergesellschaft, In: Peterander, Franz/Speck, Otto (Hrsg.) (2004): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Ernst Reinhardt Verlag München Basel - 2. Auflage, Seiten 326 – 340 S 332: „Joachim Merchel führt dazu aus: „Qualität ist ein Konstrukt, das außerhalb gesellschaftlicher und persönlicher Normen, Werte, Ziele und Erwartungen nicht denkbar ist. Grundlage jeder Leittext März 2006 Seite 172 Qualitätsdefinition in der Sozialen Arbeit ist deren ethische und normative Ausrichtung"(1998, 27). Nichts gegen die "Optimierung von Verfahrensabläufen", aber macht das die Qualität guter Praxis aus? Ebenso wenig, wie man menschliche Beziehungen "begradigen" kann, lassen sich Beziehungen zwischen Helferinnen und Klientinnen gradlinig-strategisch durchrationalisieren. Sind es nicht gerade die Umwege, die Ambivalenzen, die "Kunst des Indirekten", das Ermöglichen von Langsamkeit gegenüber dem gesellschaftlichen Druck auf eine zügige und standardisierte Lösung?" Zusätzliche Literatur: Merchel, J. (Hrsg.) (1998): Qualität in der Jugendhilfe. Votum, Münster Meinhold, Marianne (1996): Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialarbeit Einführung und Arbeitshilfen, Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgau S 24: "Jenseits der erwähnten verschiedenen Kunden und der geforderten Kundenfreundlichkeit ist noch zu bedenken, daß nicht nur der "Konsument" sozialer Dienstleistungen, sondern "die Gemeinschaft aller Bürger (Kunde ist), die ein Recht an der Einhaltung von gerechten und legitimierten Regeln hat" (Tegethoff 1995, 142). Diese Perspektive rechtfertigt nicht, daß beispielsweise Behörden unfreundlich mit Sozialhilfeempfängern umgehen. Doch der Einwand von Hans Georg Tegethoff erinnert daran, daß eine eindimensionale Foccusierung auf KlientenErwartungen nicht automatisch ein Indikator für gute Qualität sein muß. Für die Mitarbeiterinnen im sozialen Bereich ergeben sich aus dieser Perspektivenerweiterung im Einzelfall nicht unbedingt eindeutige Verhaltensregeln, zumindest aber Anlässe zur Reflexion.“ Zusätzliche Literatur: Tegethoff, H.G. (1995): Schlankheitskur für die Jugendhilfe nach dem Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). In: Neue Praxis 2, 132-150 Mülhausen, Susanne (2004): Qualität in der Sozialen Arbeit - Pflicht oder Chance? Tectum Verlag, Marburg S 20 f: "Die Facetten von Qualität in der Sozialen Arbeit beschreibt folgendes Zitat sehr treffend. "Qualität bedeutet nämlich vor allem Dingen Fürsorge, Menschen, Passion, Konsequenz, Augenkontakt, und intuitives Reagieren. Qualität ist keine Technik, und sei die Technik auch noch so gut (Peters/ Austin 1993, 131). Laut Speck lassen sich aufgrund eines ökonomisch bestimmten Qualitätsinteresses folgende Begriffe von Qualität im sozialen Bereich unterscheiden: Leittext März 2006 Seite 173 (a) betriebwirtschaftliche Qualität, welche auf optimale wirtschaftliche Effizienz einer Institution gerichtet ist. Sie ist erforderlich, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben, (b) Spitzenqualität, welche konkurrenzfähige Höchstleistungen intendiert. Weniger Qualifizierte bleiben nachgeordnet. Somit kommt der Spitzenqualität keine Leitfunktion im Sinne soziale Qualität zu, da sie die sozial Benachteiligten nachordnet, (c) Mindest- oder Restqualität, ist zu verstehen als eine Qualitätsstufe, die unter dem Druck ökonomischer Bedingungen entstehen kann. Dies betrifft diejenigen, die am wenigsten oder gar nicht zur Erhöhung oder Erhaltung des Sozialproduktes beitragen können, und die keine wirkliche Qualität im Sinne menschenwürdiger Lebensqualität, sondern lediglich ein Minimum zum Überleben. Aufgrund unzulänglicher rechtlicher Regelungen kann es vorkommen, dass dieses Überlebensminimum noch als legimitierbare Mindestqualität ausgelegt wird (vgl. Speck, 1999, 128-129). "Mit Sozialer Qualität ist ein Wertekomplex gemeint, der sich auf das Individuum als Person, begabt mit unverlierbarer Menschenwürde, und zugleich auf seine Zugehörigkeit (Inklusion) zu anderen in einer ihm und dem Gemeinwohl förderlichen Weise bezieht. Eine spezifische Ausprägung und Funktion erhält diese Qualität unter dem Aspekt drohender Ausgrenzung (Exklusionen), wie z.B. im Falle ökonomischer Benachteiligungen oder vorliegender funktioneller Beeinträchtigungen (Behinderungen)" (Speck 1999, 129). Dieses Zitat weist auf die Eigenheit "sozialer Qualität" hin, die Qualität in der Sozialen Arbeit von Qualität in der industriellen Produktion unterscheidet. Qualität in sozialen Einrichtungen und soziale Dienstleistungen lässt sich durch verschiedene Bestimmungsgröße als Teilwerte charakterisieren: Menschlichkeit, Autonomie, Professionalität, Kooperativität, Organisationale Funktionalität, Wirtschaftlichkeit (vlg. Speck, 1999, 130)"“ Zusätzliche Literatur: Peters, Tom/Austin, Nancy (1993): Leistung aus Leidenschaft, Über Management und Führung, Hamburg Speck, Otto (1999): Die Ökonomisierung sozialer Qualität, Zur Qualitätsdiskussion in Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit, München, Basel Leittext März 2006 Seite 174 Kromrey, Helmut (2000): Die Bewertung von Humandienstleistungen. Fallstricke bei der Implementations- und Wirkungsforschung sowie methodische Alternativen. In: Müller-Kohlenberg, Hildegard/Münsterman, Klaus (Hrsg.) (2000): Qualität von Humandienstleistungen - Evaluation und Qualitätsmanagement in Sozialer Arbeit und Gesundheitswesen, Leske + Budirch Verlag, Opladen Seiten 19 - 58, S 52 f: "Somit gehört es zu den ersten Aufgaben der Evaluation, die qualitätsrelevanten Dimensionen des Dienstleistungsangebotes zu bestimmen und zu deren Beurteilung Qualitätsindikatoren zu begründen und zu operationalisieren - eine Aufgabe, mit der sich die Sozialwissenschaft im Rahmen der Sozialindikatorenbewegung seit Jahrzehnten befasst. Hierbei wird die Evaluation gleich zu Beginn mit einem zentralen theoretischen und methodischen Problem konfrontiert, der Unbestimmtheit des Begriffs "Qualität". Je nachdem, auf welchen Aspekt der Dienstleistungserbringung sich der Blick richtet und aus welcher Perspektive der Sachverhalt betrachtet wird, kann Qualität etwas sehr Unterschiedliches Bedeuten. Eine Durchsicht verschiedener Versuche der Annäherung an diese Thematik erweist sehr schnell, dass "Qualität" keine Eigenschaft eines Sachverhalts (z.B. einer Dienstleistung ) ist, sonder ein mehrdimensionales Konstrukt, das von außen an den Sachverhalt das eigentliche Kriterium der Qualitätsbeurteilung sein sollen, die Qualität der Dienstleistung jedoch aus unterschiedlichsten Gründen nicht an den Effekten auf die AdressatInnen abgelesen werden kann, dann erwächst daraus ein methodisches Problem, das ebenfalls schon in der Sozialindikatorenbewegung unter dem Schlagworten subjektive versus objektive Indikatoren ausgiebig diskutiert worden ist. Dann muss entweder den AdressatInnen die Rolle der EvaluatorInnen zugeschoben werden, indem per mehr oder weniger differenzierte Befragungen ihre Beurteilung der Dienstleistung erhoben wird. Oder es müssen "objektive" Qualitätsmerkmale der Dienstleistung und des Prozesses der Dienstleistungserbringung ermittelt werden, die auch "subjektive Bedeutung" haben, die also in der Tat die Wahrscheinlichkeit positiver Effekte bei den AdressatInnen begründen können (Kromery & Ollmann, 1985)". Zusätzliche Literatur: Kromery, H./Ollmannn, R. (1985): Handlungsorientierungen und gebaute Umwelt. Zur subjektiven Bedeutung objektiver Indikatoren. In: Informationen zur Raumentwicklung, H.5, S. 393-406 Boeßenecker, Karl-Heinz/Vilain, Michael/Biebrichter, Martin/Buckley, Andrea/Markert, Andreas (Hrsg.) (2003): Qualitätskonzept in der Sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis, Beltz Verlag, Weinheim Leittext März 2006 Seite 175 Aus der Einleitung zum Buch S 7: "Allerdings wird der Begriff und die mit ihm verbundenen Konzepte in der Regel nicht wertfrei benutzt: Qualität ist negatives Reizwort für die einen - verbunden mit Sorgen und Ängsten über eine fachliche Fremdbestimmung und eine fortschreitende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit mit unklaren Perspektiven für ihre Erbringer und Nutzer. Für andere dagegen ist Qualität ein wichtiger Faktor, der hilft, die eigene Arbeit langfristig als erfolgreich zu dokumentieren, ihre einrichtungs- oder trägerspezifischen Besonderheiten positiv zu akzentuieren und sich optimal zu positionieren". Leittext März 2006 Seite 176 15.1.2 Anhang 2 – Die Ansätze des Qualitätsmanagements und ihre wichtigsten Literaturquellen In der folgenden vorläufigen Tabelle werden die wesentlichen Ansätze des Qualitätsmanagements noch ein Mal dargestellt und mit den wesentlichsten Literaturquellen in Bezug gebracht. Instrumente/ Wo zu finden? Methoden DIN EN ISO 9000 ff Mechel S 561 ff, Meinhold/Matul S 122 ff, Mülhausen S 52ff, Speck S 151 ff, Knorr/Halfar 108 ff (Beispiel S174 ff), Boeßenecker S 23 ff EFQM – European Foundation of Merchel S 571ff, Meinhold/Matul S 127 ff, Mülhausen S 40 ff, Quality Management Knorr/Halfar S 113 ff, Boeßenecker S 38 ff, Vergleich: DIN EN ISO ff und EFQM Mühlhausen S 63 ff Benchmarking Merchel S 83 ff, Mühlhausen S 29, Knorr/Halfar S 129 ff (Internes + Externes, Funktionales Benchmarking) Formen der Evaluation Boeßenecker S 52 ff, Interne Evaluation (Selbstevaluation) Merchel S 96 ff, Meinhold/Matul S 130 ff, Peterander/Speck S 135 ff + 142 ff (Heiner M.), Knorr/Halfar S 94 ff Externe Evaluation (Experimentelle) Evaluation Peterander/Speck S 139 ff (Heiner M.), Mühlhausen S 29 TQM (Kainzen) Merchel 110 ff, Meinhold/Matul S 58 f + 99 f, Mühlhausen S 32 ff, Speck S 165, Knorr/Halfar S 41 f, Knorr/Halfar S 158 ff Total-Value-Management Peterander/Speck S 181 ff (Lachhammer J.) Balanced Scorecard (BSC) Meinhold/Matul S 61 f, Peterander/Speck S 192 ff (Moos G.) , Boeßenecker S 15 ff Wissensmanagement Peterander/Speck S 86 ff (Reinmann G.) „Münchner Modell“ Peterander/Speck S 203 ff (Gmür W.) „Wege zur Qualität“ Peterander/Speck S 217 ff (Herrmannstorfer U.), Speck S 170 Führung durch Zielvereinbarung Petrander/Speck S 242 ff (Obermair W.) Qualitätszirkel Merchel 164 ff, Knorr/Halfar S 99 f Qualitätsbeauftragte Merchel 159 ff, Service Assessment (Orientierung an EFQM, kurz: Serv.As) Servicequalität Meinhold/Matul S 131 ff Leittext März 2006 Seite 177 Instrumente/ Wo zu finden? Methoden Sozialplanung Meinhold/Matul S 74 ff New Public Management Meinhold/Matul S 74 ff Kontinuierlicher Verbesserungs Prozess (KVP) + Kainzen Peterander/Speck S 188 ( Lachhammer J.), Knorr/Halfar S 145 ff “Neues Führungsverhalten” Peterander/Speck S 189 (Lachhammer J.) Stakeholder Management Meinhold/Matul S 50 Nutzer- Bewertungs-fragebogen psychosozialer und psychiatrischer Einrichtungen (Manteufel/Schiebke) Speck S 173, SYLQUE - Modell Speck S 173, Boeßenecker S 152 ff LEWO – Modell (LEbensqualität WOhnen) Speck S 174, Boeßenecker 105 ff, KREIS-Verfahren Speck S 177 MAL (Münchner Analyse- und Lernsystem) Peterander/Speck S 318, Speck S 179 QFD – Quality Function Deployment - House of Quality Knorr/Halfrar S 35 f, Boeßenecker, S 59 ff MBNQA - Malcom Baldrige National Quality Award Knorr/Halfar S 114 ff Speyerer Qualitätswettbewerb für die öffentliche Verwaltung Knorr/Halfar S 124 ff Silent/Mystery Shopper Knorr/Halfar S 140 ff Citizen Charter Knorr/Halfar S 152 ff (Beispiel S - England 180 f) (CIT) Critical-Incident-Technik Knorr/Halfar S 155 ff Best Practice (aus den USA Beispiel) Knorr/Halfar s 189 ff WANJA-Instrumentarium zur Qualitätsentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Professionelle Handlungsmuster und Wirksamkeitsanalysen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) – MüllerKohlenberg/Münstermann S 249 ff, Boeßenecker S 163 ff Das „Q2-System“ (Qualität + Qualifizierung) Knorr/Halfar S 172 f, Boeßenecker S 75 ff, QAP (Qualität als Prozess) Boeßenecker S 75 Leittext März 2006 Seite 178 Instrumente/ Wo zu finden? Methoden Die „KindergartenEinschätzskala“ (KES-R) Peteraner/Speck S 271 (ab 252), Knorr/Halfar S 171 f, Boeßenecker S 85 ff Das Qualitätskonzept Kronberger Kreis Boeßenecker S 95 ff, Weitere QS Instrumente zu LEWO: AQUA-FDU, AQUANetOH, AQUA-UWO Boeßenecker S 115 Das GMB-Verfahren („HaischModell“) Knorr/Halfar S 173 f Lörracher Qualitätskonzept für die Krankenhaus-Sozialarbeit. Akutkrankenhaus Boeßenecker S 116 ff KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus Boeßenecker S 123 Qualitäts-Check (PQ-Sys plus) Boeßenecker S 130 Das Konzept Selbstbewertung des Qualitätsmanagements in der Jugendhilfe (SQ-J) Boeßenecker S 141 „Leitfaden zur Entwicklung von Qualitätsstandards für soziale Dienste Berlin“ http://www.evfh-berlin.de/evfhberlin/institute/inib/download/dateien/leitfaden-entwicklungqualitaetsstandards.pdf Perfomance + Quality Compass PQ Handbuch Von Prospect Unternehmensberatung, Research + Sollution (http://www.pro-spect.at/), www.sozial-wirtschaft.at (genaue Quelle muss ich noch finden! „lernende Organisation“ Boeßenecker S 39, Beschwerdemanagement Meinhold/Matul S42ff Qualitäts-ManagementInformationssystem (Q-MIS) Knorr/Halfar 221 ff Leittext März 2006 Seite 179 15.2 Anhang 3 Weltwirtschaftskrise und NS-Ära 1945 bis seit Mitte 70er Jahre/ 20er Jahre 30er Jahre 1938-1945 Mitte 70er-Jahre Anfang 80er Jahre Verallgemeinerung der pro-letarischen Kleinfamilie (zudem Witwenhaushalte infolge des 1. Weltkriegs) Fortsetzung des seit 1900 laufenden Trends; neue Herausforderungen für NS-Eheund Bevölkerungs-politik Kleinfamilie als Norm (inkl. Durchschnittlich 2 Kinder) Erwerbsbeteiligung der Frauen steigt; Witwen- und Waisenanteil steigt infolge des 2. Weltkriegs Neue Familienformen und Haushaltskonstellationen; Zweite Hälfte des soziale Kofiguration 19. Jahrhunderts 1900-1914 1. Weltkrieg „das ganze Haus“ im Übergang Ungleichzeitige und regional ungleiche Tendenz zu proletarischer Kleinfamilie (Ehe)-Frauen Kinder/Jugendliche kriegsbedingte Haushalts- und als konstellation Reduktion der Kinderzahlen (Geburten); Anteil der alten Menschen steigt steigende AlleinerzieherInnen-Haushalte; Single-Haushalte; Wohngemeinschaften; Pensionisten-Haushalte: privat und in Altersheimen Bildung Volksschule als Basis von Qualifikation Sozialisation SozialreformMilieus / bürgerliche und adelige Philanthropie; katholische Soziallehre; Marxismus Sozialpolitische Ideologien patriachal-paternalistische Sozialintegration; sozialprotektionistisch (für alten Mittelstand wie Bauern, Kleingewerbe, Handwerker) Politische Kräfte- Kostituierung der Arbeiter- Leittext März 2006 und Beginn Frauenstudium, Frauenbildungsexpansion (Kindergärtnerin, Erzieherin, Krankenschwester) Verallgemeinerung Bildungschancen Bürgerliche Philanthropie; spätaufklärerisch gesinnte bürgerliche Sozial-reformerInnen Bürgerliche Sozialreformer gemeinsam mit Sozialdemokratie; katholischständische Reformkonzep-tionen angesichts der Transformationskrisen Re-Katholisierung und Beginn des massendemo-kratischen Zeitalters (Allge-meines gleiches Wahlrecht für Männer + Frauen); Parlamentarische Republik; sozialpolitischer Boom 1918 – 1920 (Koalition Sozdem. + Christsozial); Unternehmer gegen „sozialen Schutt“ der „österr. Revolution“ „Autoritäre (1934 – 38); „Rotes Wien“ versus bürgerlich-konservative Regierungsdiktatur Ab 1906 Priviligierungsstrategie zugunsten des neuen Mittelstands (z.B. Pensionsversicherung für Angestellte) = politisch motivierte Spaltung der Lohnabhängigen Anfänge und Expansion von modernen der Katholische Erziehung und Moral im Bildungswesen NS-Erziehung „Volksgemeinschaft“ zur Modernisierung des Bildungssystems z.B. Akademien für Sozialarbeit Modernisierung Bildungssystems Gleichschaltung und Abschaffung der bürgerlichen Sozialreform Reedukation in der Besatzungszeit (Rolle westlichaus-ländischer Demokratieund Bildungskonzepte) Studentenbewegung; Demokratie in der Massengesellschaft; Reformära Kreisky des „Austrofaschismus“ totale Vergesellschaftungstendenz von Produktion und Reproduktion; Integration der Gewerkschaften infolge von Kriegserfordernissen; Mieterschutz als Notmaßnahme „Burgfriedenspolitik“ Re-Konfessionalisierung im Austrofaschismus; Vaterländische Front Sozialpolitik“ Sozialabbau + Sozialumbau; Ziel: Schaffung einer berufständischen Ordnung („Stände statt Klassen“) NS-Regime steigt in „Ostmark“ direkt ein, Konzepte von „Volksgemeinschaft“, soziale Integration der „guten deutschen Volksgenossen“; Ausgrenzung bis Ausmerzen der „nichtarischen“ Elemente Seite 180 Faschismus fordistische Konsumgesellschaft; Vollbeschäftigung Sozial-partnerschaft; und des Neue Soziale Bewegungen; Neue kritische arbeiterinitiativen; Sozial- (Modernisierung Demokratisierung); und Keynesianischer Wohlfahrtsstaat; Konsenspolitik; 80er: Ende des keynesianismus; Rekonstruktion uns Ausbau des Sozialstaates Deregulierung; Parlamentarische Demokratie Parlamentarische Austro- Sozialabbau und –umbau; Demokratie verhältnisse Gewerkschaftsbewegung; Liberalismus; Massenpar-teien (Sozialdemokratie, Christlich-Soziale) Regierungskoalition Bundesebene auf 1906 Pensionsgesetz 1920 Arbeitslosenversicherung moderne christlichsoziale Bewegung 1. Soziales Netz vgl. staatliche Sozialpolitikgesetze v.a. KV + UV; Beginn des Sozialversicherungsstaats Staatliche Vorsorge Fürsorge für Privatbeamte „Aussteuerung“; (-Angestellte) staatlicher beitrag Heimatgesetz / Heimatrecht 1863; Bettlerund Vagabunden-gesetze (1885) als Strategie der Armenpolizei; Heimatgesetznovelle von 1896 (wirksam 1901 ff.); Ausdifferenzierung von Armutsrisiken; Jugendfürsorgebewegung Unterhalts- Berufsvormundschaft --Jugendämter Kriegsinvaliden-, Kriegswitwenund Kriegswaisenversorgung Modernisierung des Fürsorgebereichs und 1. Blütezeit Sozialarbeit beruflicher Traditionelles reaktivrepressives Armenwesen; ehrenamtlicher Fürsorgerat (bis Ende 1950er Jahre) Freie Träger „Fürsorgebuch“; „Bettlerbekämpfung“; Naturalienunterstützung bevorzugt; Ausgabenreduktion für innovative Bereiche der Sozialarbeit; Ausbau des Sozialversicherungsstaates (Einbeziehung neuer Gruppen und ver- besserter Leistungskatalog) Ausbau des Sozialversicherungsstaates (Einbeziehung neuer Gruppen und verbesserter Leistungskatalog; Gegentendenzen seit Mitte der 80er deutlich (z.B. Verschlechterungen AlVG) staatlicher Unterhaltsbeitrag im 2. Weltkrieg Kriegsinvaliden-, Kriegswitwen- und Kriegswaisenversorgung; Opferfürsorge Fürsorge für „gute, deutsche Volksgenossen“; Ausbau und Modernisierung (= Sozialhilfe der Länder und Gemeinden); Ausgrenzung und „Vernichtung durch Arbeit“ für unangepaßte und unerwünschte Bevölkerungsgruppen Primat klassischer Armutsverwaltung; Repressive Dimensionen des Umgangs mit sozial benach-teiligten Gruppen nicht ver-schwunden („Zwangsarbeit“, Bettlerverordnungen) Ausbau und Modernisierung (=Sozialhilfe der Länder und Gemeinden); repressive Dimensionen des Umgangs mit sozial benachteiligten Gruppen nicht verschwunden („Zwangsarbeit“, Bettlerverordnungen) Abbau von Fürsorgerinnenstellen; der konfessionelle, adelige und bürgerliche Vereinsphilan-thropie Völkischer Wohlfahrtsstaat; Rüstungskurs senkt Arbeitslosigkeit neues Sozialversicherungsrecht 1935 (gegen industrielle Lohnarbeiterschaft) / 2. Soziales Netz Zahlreiche Verschlechterungen im AlVG --- Privatisierung Fürsorge-bereichen bürgerlich-philantropische Vereine als Motor der Wohlfahrtsarbeit alle engagieren sich an der „Inneren Front“ Krise der Privatwohltätigkeit, Rest kooperiert mit öffentlicher Fürsorge von Dominanz katholischer Fürsorge + Frauenvereine NS-Volkswohlfahrt (NSV); Liquidierung der klassischen freien Träger Renaissance Träger der Freien Renaissance der Freien Träger (v.a. 90er Jahre) Aus: Melinz, Gerhard (2000): Der Wohlfahrtsmix und „bürgerschaftliches Engagement“. Eine historische Skizze. In: Rössler, Marianne/Schnee, Renate/Spitzy, Christine/Stoik Christoph (Hrsg.): Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement. Wien, S. 26 - 27 Leittext März 2006 Seite 181