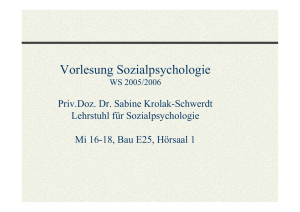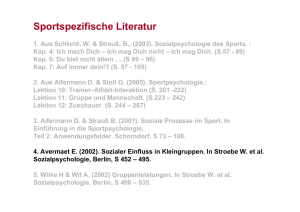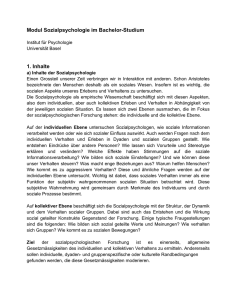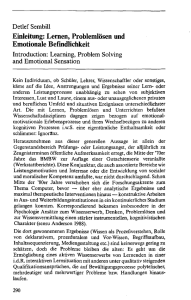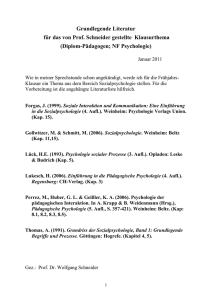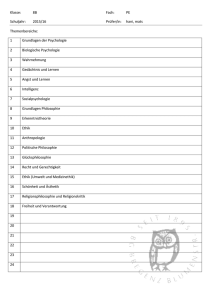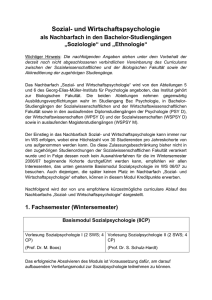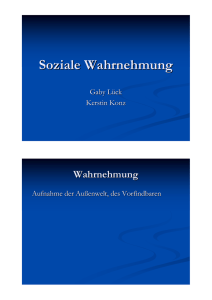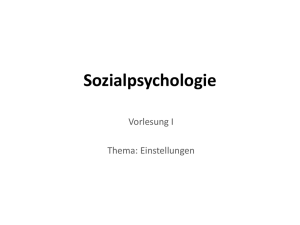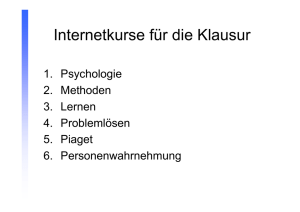Die neue Studien - Hu
Werbung

Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Stand: 16.07.2008 1 GBM_1: BASISPRAKTIKUM (1. SEM.) ................................................................................................ 2 2 GBM_9/9V: GRUNDSTUDIUM SOZIALPSYCHOLOGIE (3. UND 4. SEM.) ................................... 2 2.1 2.2 3 HWM_2 ARBEITS- UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE (5. UND 6. SEM.) ........................... 6 3.1 3.2 4 HWM_2.1 ARBEITS- UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE ........................................................................ 6 HWM_2.2 ARBEITS-, INGENIEUR- UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGISCHE INTERVENTION ...................... 6 SCHWERPUNKT ARBEITS- UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE (7. UND 8. SEM.)........... 8 4.1 4.2 4.3 4.4 5 GBM_9 BASISMODUL SOZIALPSYCHOLOGIE ............................................................................................ 2 GBM_9V BASISMODUL SOZIALPSYCHOLOGIE MIT VERTIEFUNG.............................................................. 4 SAO/BM_4 INTERAKTION UND KOMMUNIKATION IN ORGANISATIONEN – GRUNDLAGEN ....................... 8 SAO/WM_4 INTERAKTIONS- UND KOMMUNIKATIONSPROZESSE IN ORGANISATIONEN – EINZELBEREICHE 9 SAO/WM_5 WISSENSMANAGEMENT ..................................................................................................... 11 SONDERREGELUNGEN............................................................................................................................. 12 GENERELLE REGELUNGEN............................................................................................................... 13 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) 1 GBM_1: Basispraktikum (1. Sem.) An unserer Professur wird aus diesem Modul der Erwerb von Kenntnissen und praktischen Erfahrungen in Kommunikation und Kooperation in Dyaden und Gruppen mit einem hohen Anteil Selbsterfahrung vermittelt. An unserer Professur angebotene Veranstaltung Kommunikationskurs (2 SWS, 3 SP) Literatur Scholl, W. (2003). Modelle effektiver Teamarbeit – eine Synthese. In S. Stumpf & A. Thomas (Hrsg.), Teamarbeit und Teamentwicklung (S. 3-34). Göttingen: Hogrefe. Schulz von Thun, F. (1981ff, neueste Aufl.). Miteinander reden: Störungen und Klärungen. Reinbek: Rowohlt. 2 GBM_9/9V: Grundstudium Sozialpsychologie (3. und 4. Sem.) 2.1 GBM_9 Basismodul Sozialpsychologie 9 Studienpunkte Ziele Übersicht über das Gebiet der Sozialpsychologie, die wichtigsten Forschungstraditionen, Theorien, Themen und Methoden Inhalte Übersicht über das Gebiet der Sozialpsychologie, die wichtigsten Forschungstraditionen, Theorien, Themen und Methoden Einführung in grundlegende Inhalte, Auffassungen und Prinzipien der Sozialpsychologie Personenwahrnehmung - Grundzüge der sozialen Kognition Symbolischer Interaktionismus - Rollen und Identitäten / Das Selbst Die Wahrnehmung von Gruppen - Soziale Identität Einstellungen und Einstellungsänderung Einstellungen und Verhalten Verbale und nonverbale Kommunikation Austausch und Interdependenz - Freundschaft und Liebe Aggression und Konflikt Hilfe und Kooperation Gruppen, Normen und Konformität 2 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Normen, Macht und Verhalten Individuum und Gesellschaft Gruppenentwicklung, Gruppenleistung Literatur Higgins, E. T. & Kruglanski, A. W. (Eds.) (1996). Social psychology.Handbook of basic principles. New York: Guilford. Buschmeier, U. (1995). Macht und Einfluß in Organisationen. Göttingen: Cuvillier. Buss, D. M. (2004). Evolutionäre Psychologie (2. Aufl.). München: Pearson. DeLamater, J. D., & Myers, D. J. (2007). Social psychology (6th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Forsyth, D. R. (1999). Group dynamics (3rd ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Wadsworth. Higgins, E. T. & Kruglanski, A. W. (Eds.) (1996). Social psychology. Handbook of basic principles. New York: Guilford. Scholl (2007). Plädoyer für eine sozialere, interdisziplinärere und anwendbarere Sozialpsychologie. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 38, 273-284. Smith, E. R. & Mackie, D. M. (2007). Social psychology (3rd ed.). Philadelphia, PA: Psychology Press. Stroebe, W., Jonas, K. & Hewstone, M. (Hrsg.) (2002). Sozialpsychologie: Eine Einführung (4. Aufl.). Berlin: Springer. Hinzu kommt spezielle Literatur zu Einzelthemen Veranstaltungen Vorlesung Sozialpsychologie I (2 SWS im WS, 3 SP) Diskussionsforum I mit Thesenpapieren (1 SWS im WS, 2 SP) Vorlesung Sozialpsychologie II (2 SWS im SS, 3 SP) Diskussionsforum II mit Thesenpapieren (1 SWS im SS, 1 SP) Prüfungsvorleistung In beiden Diskussionsforen (I und II) jeweils Abfassung eines Thesenpapiers und Moderation einer Sitzung (unbenotet) Prüfungsleistung Im Anschluss an jede Vorlesung (Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II) wird eine je 60-minütige Klausur geschrieben. Während des Wintersemesters wird zudem eine Nachschreibeklausur für alle drei Teilklausuren der Sozialpsychologie (I, II und Vertiefung) angeboten. Diese kann nur dann wahrgenommen werden, wenn das Modul insgesamt nicht bestanden wurde oder wenn bestimmte Teilklausuren nicht mitgeschrieben wurden. Es können jeweils nur die Teile wiederholt werden, die vorher mit 5 bewertet wurden. 3 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Zur Ermittlung der Gesamtnote für das Modul GBM_9 wird die Klausur zur Sozialpsychologie I mit 5 Punkten und die der Sozialpsychologie II mit 4 Punkten gewichtet. Begründung: Es darf keine halben Studienpunkte geben und das Wintersemester (Sozialpsychologie I) ist länger als das Sommersemester (Sozialpsychologie II). Diejenigen, die pro Semester nur 2 SWS bzw. 3 SP benötigen und daher das Diskussionsforum nicht besuchen müssen, bekommen 2 Bonuspunkte bei der Klausur (von etwa 35 erreichbaren Punkten). 2.2 GBM_9V Basismodul Sozialpsychologie mit Vertiefung 12 Studienpunkte Ziele Siehe oben zusätzliche Vertiefung auf dem Gebiet der Interaktion und Kommunikation Zusätzliche Inhalte Vertiefung zu Interaktion und Kommunikation speziell zu Symbolischer Interaktionismus Interdependenztheorie Kommunikationstheorien 3 allgemeinen Koordinationsdimensionen /Dominanz und Aktivierung/Erregung Affiliation/Übereinstimmung, Macht Wichtigste zusätzliche Literatur Brauner, E. (1994). Soziale Interaktion und mentale Modelle (S. 61-82). Münster: Waxmann. Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations. Psychological Review, 99, 689-724. Foa, E. B. & Foa, U. G. (1980). Resource theory: Interpersonal behavior as exchange. In K. J. Gergen, M. S. Greenberg & R. H. Willis (eds.), Social exchange: Advances in theory and research (pp. 77-101). New York: Plenum. Heise, D. R. (1986). Modeling symbolic interaction. In S. Lindenberg, J. S. Coleman, & S. Novak (eds.), Approaches to social theory (pp.291-309). New York: Russel Sage Foundation. Higgins, E. T. (1989). Self-discrepancy theory: What patterns of self-beliefs cause people to suffer? In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 22, pp 93-136). New York: Academic Press. Kelley, H. H. (1979). Personal relationships: Their structures and processes (Kap. 13). Hillsdale: Erlbaum. MacKinnon, N. J. (1994). Symbolic interactionism as affect control. Albany: State University of New York Press. 4 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Scholl, W. (2005). Grundprobleme der Teamarbeit und ihre Bewältigung - Ein Kausalmodell. In M. Högl & H. G. Gemünden (Hrsg.), Management von Teams. Theoretische Konzepte und empirische Befunde (3. Aufl., S. 33-66). Wiesbaden: Gabler. Scholl, W. (2007). Das Janus-Gesicht der Macht. Persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen Rücksicht nehmender versus rücksichtsloser Einwirkung auf andere. In B. Simon (Hrsg.), Macht: Zwischen aktiver Gestaltung und Missbrauch (S. 27-46). Göttingen: Hogrefe. Scholl, W. (2007). Innovationen – Wie Unternehmen neues Wissen produzieren und etablieren. In H. Hof & U. Wengenroth (Hrsg.), Innovationsforschung – Ansätze, Methoden, Grenzen und Perspektiven (S. 271-300). Münster: LIT. Scholl, W. (subm). The socio-emotional basis of human interaction. Submitted paper, Humboldt-Universität zu Berlin. Wicklund, R. A. & Frey, D. (1993). Die Theorie der Selbstaufmerksamkeit. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie, Band I: Kognitive Theorien (2. Aufl., S. 155-173). Bern: Huber. Zusätzliche Veranstaltung Vorlesung mit Übung Interaktion und Kommunikation (2 SWS im SS, 3 SP) Prüfungsleistung Im Anschluss an die Vorlesung „Interaktion und Kommunikation“ wird eine 30minütige Klausur geschrieben. In die Gesamtnote für das Modul GBM_9V gehen die Noten der Klausuren mit folgenden Gewichtungen ein: Sozialpsychologie I x 5 Punkte Sozialpsychologie II x 4 Punkte Vertiefung: Interaktion und Kommunikation x 3 Punkte 4.3 Regelungen für Nebenfachstudierende Für Nebenfachstudierende gelten dieselben Regelungen wie für Sozialpsychologie I + II inklusive der Klausuren; da nur 4 SWS in der Regel anfallen, muss das Diskussionsforum nicht besucht werden, kann aber bei Interesse, wobei auch bei Besuch keine Thesenpapiere anzufertigen sind. Klausurfragen, die auch auf das Diskussionsforum Bezug nehmen, werden nicht gewertet bei Nebenfachstudierenden. Studierende, die nur einen Teilnahmeschein brauchen, wie z.B. beim Studium Generale in einigen Fächern, lassen sich am Ende des jeweiligen Vorlesungstermins den Besuch auf der Veranstaltungsübersicht abzeichnen, wobei drei fehlende Termine zulässig sind. 5 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) 3 HWM_2 Arbeits- und Organisationspsychologie (5. und 6. Sem.) 3.1 HWM_2.1 Arbeits- und Organisationspsychologie Wahlmodul 9 Studienpunkte Ziele Grundkonzepte der Arbeits- , Ingenieur- und Organisationspsychologie Inhalte Organisierte Arbeit Arbeitsteilung und Koordinierung Theorien der Organisation und des Verhaltens in Organisationen Beanspruchung, Belastung und Stress Arbeit und Persönlichkeit Funktionsteilung und Informationsaustausch in Mensch-Maschine-Systemen Strategien der Automatisierung, Informationsaufnahme und Verhaltensteuerung im Umgang mit Technik Literatur für die Organisationspsychologie Kieser, A. (Hrsg.). (2002). Organisationstheorien (5. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer. Teil V: Organisation aus Schuler, H. (Hrsg.). (2004/07). Lehrbuch der Organisationspsychologie (3./4. Aufl.). Bern: Huber. An unserer Professur angebotene Veranstaltung VL Einführung in die Organisationspsychologie Prüfungsleistung Je eine Klausur (45 min) für jede der drei Vorlesungen Laut Prüfungsordnung § 7 Absatz (3) darf die Dauer der Klausurarbeit 45 min nicht unterschreiten. In den auf das Wintersemester folgenden Semesterferien wird für jede Vorlesung je ein Klausurtermin angeboten. Zudem wird während des Sommersemesters ein Nachschreibtermin für alle drei Klausuren angeboten. 3.2 HWM_2.2 Arbeits-, ingenieur- und organisationspsychologische Intervention Wahlmodul 6 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) 3 Studienpunkte Ziele Ausgewählte Interventionsfelder der Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsychologie Inhalte Ansätze zur betrieblichen Gesundheitsförderung Benutzerorientierte Gestaltung von Bedienelementen und Anzeigen Methoden zur Verbesserung von Interaktions- und Gruppenprozessen Literatur für die Organisationspsychologie Stumpf, S. & Thomas, A. (Hrsg.). (2003). Teamarbeit und Teamentwicklung.Göttingen: Hogrefe Siehe auch Literaturangaben im Internet zu den einzelne Lehrveranstaltungen An unserer Professur derzeit angebotene Veranstaltungen SE Kommunikation als organisationale Intervention (Turß) SE im Rahmen der artop-Trainerausbildung oder von anderen Externen (z. B. Moderation und Präsentation) Prüfungsleistung Benotetes Referat + Handout oder andere benotete Leistung (Das kann z. B. eine schriftliche Ausarbeitung zu einem vorgegebenen Thema sein, wenn das SE nicht in Form von Referaten abgehalten wird.) 7 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) 4 Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie (7. und 8. Sem.) 4.1 SAO/BM_4 Interaktion und Kommunikation in Organisationen – Grundlagen Basismodul 6 Studienpunkte Ziele Vertiefung der Grundlagen von Interaktion und Kommunikation aus dem Grundstudium Sozialpsychologie als Basis für die Analyse organisationaler Prozesse Inhalte Vertiefung der Paradigmen von sozialer Informationsverarbeitung Interdependenztheorie Symbolischen Interaktionismus Basisdimensionen Affiliation (Übereinstimmung) und Dominanz (Macht / Einfluss / Führung) anhand geeigneter Themen Literatur siehe Kapitel 2.2, sowie Higgins, E. T. & Kruglanski, A. W. (Eds.). (1996). Social psychology. Handbook of basic principles. New York, London: Guilford. Kelley, H. H. (1979). Personal relationships: Their structures and processes. Hillsdale: Erlbaum. Kelley, H. H., Holmes, J. G., Kerr, N. L., Reis, H. T., Rusbult, C. L., & Van Lange, P. A. M. (2003). An atlas of interpersonal situations. Cambridge: Cambridge University Press. MacKinnon, N. J. (1994). Symbolic interactionism as affect control. Albany: State University of New York Press. Neuberger, O. (2002). Führen und führen lassen: Ansätze, Ergebnisse und Kritik der Führungsforschung (6., völl. neu bearb. u. erw. Aufl.). Stuttgart: Lucius und Lucius. Yukl, G.A. (2002). Leadership in Organizations (5th Edition.) .New Jersey: Prentice Hall. Weiteres in den Veranstaltungen Derzeit angebotene Veranstaltungen VL Interaktion und Kommunikation (Scholl) SE Führung und Zusammenarbeit (Klocke) 8 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Prüfungsleistungen Hausarbeit zur Vorlesung Theoretische Rekonstruktion eines Beispiels aus Organisationen anhand mehrerer vorgestellter Theorien 1 benotete Seminarleistung (Referat + Handout) 4.2 SAO/WM_4 Interaktions- und Kommunikationsprozesse in Organisationen – Einzelbereiche Wahlmodul 9 Studienpunkte Ziele Kenntnis spezifischer Interaktions- und Kommunikationsprobleme in Organisationen sowie von erfolgversprechenden Interventionsmaßnahmen Inhalte Kommunikation, Gruppenndynamik Mikropolitik Macht und Konflikthandhabung Entscheidungsprozesse; u. ä. Literatur Berger C. R. (2003). Message production skill in social interaction. In J. O. Greene & B. R. Burleson (Eds.), Handbook of communication and social interaction skills. (pp. 257-289). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Brodbeck, F. C., Kerschreiter, R., Mojzisch, A. & Schulz Hardt, S. (2007). Group decision making under conditions of distributed knowledge: The information asymmetries model. Academy of Management Review, 32. Forsyth, D. R. (1998). Group dynamics (3rd ed.). Pacific Grove: Brooks/Cole. Heise, D. R. (2007). Expressive order. Confirming sentiments in social actions. Berlin: Springer-Verlag. Neuberger, O. (1995). Mikropolitik. Der alltägliche Aufbau und Einsatz von Macht in Organisationen. Stuttgart: Lucius & Lucius. Pfeffer, J. (1999). Power-Management. Wie Macht in Unternehmen erfolgreich eingesetzt wird. Wien: Ueberreuter. Regnet, E. (2007). Konflikt und Kooperation. Göttingen: Hogrefe. Shapira, Z. (Ed.). (1997). Organizational decision making. New York: Cambridge University Press. Simon, B. (Hrsg.). (2007). Macht: Zwischen aktiver Gestaltung und Missbrauch. Göttingen: Hogrefe. 9 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Scholl, W. (2005). Grundprobleme der Teamarbeit und ihre Bewältigung: Ein Kausalmodell. In Gemünden & Högl (Eds.), Management von Teams (3rd ed., pp. 33-66). Wiesbaden: Gabler. Thomas, K. W. (1992). Conflict and negotiation processes in organizations. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds), Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed., pp. 651-717). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Wyer, R. S. J., & Adaval, R. (2003). Message reception skills in social communication. In J. O. Greene & B. R. Burleson (Eds.), Handbook of communication and social interaction skills. (pp. 291-355). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Weiteres in den Veranstaltungen Derzeit angebotene Veranstaltungen SE Soziale Konflikte, Theorien und Interventionsstrategien (Schulze) SE Training in Organisationen (Turß) SE Emotionen und emotionale Intelligenz in Organisationen (Turß) SE Teameffektivität bei komplexen Problemen (Klocke) SE Soziologische Ansätze in der Organisations- und Sozialpsychologie (Schröder) Prüfungsvorleistungen für Studierende, die vor dem WS 07/08 mit dem Modul begonnen haben Für 3 SE je ein Referat mit Handout, eins davon mit schriftlicher Ausarbeitung für Studierende, die ab dem WS 07/08 mit dem Modul begonnen haben keine Prüfungsleistungen für Studierende, die vor dem WS 07/08 mit dem Modul begonnen haben schriftliche Ausarbeitung (5 SP) Die schriftliche Ausarbeitung muss vor Beginn des darauf folgenden Semesters abgegeben werden, also bis zum 30.3. oder 30.9.. das bessere der beiden weiteren Referate + Handout (4 SP) für Studierende, die ab dem WS 07/08 mit dem Modul begonnen haben In einem Seminar: benotetes Referat + Handout (3 SP) In einem Seminar: benotetes Referat + Handout (2 SP) und schriftliche Ausarbeitung (2 SP) Die schriftliche Ausarbeitung muss vor Beginn des darauf folgenden Semesters abgegeben werden, also bis zum 30.3. oder 30.9.. Wenn nach drei Seminaren nicht rechtzeitig eine schriftliche Ausarbeitung vorliegt, wird für die Ausarbeitung die Note 5.0 eingetragen. 10 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Für die Eintragung der Einzelnoten in die Datenbank müssen diese für jedes Seminar aggregiert werden. Dazu wird der Mittelwert gebildet und ggf. auf die nächste Drittelnote abgerundet. Bsp.: Aus einer 1.3 im Referat und einer 1.7 in der schriftlichen Ausarbeitung ergibt sich eine 1.3 für das Seminar, die mit 4 SP gewichtet wird. In einem Seminar: benotetes Argumentationspapier zum Seminar (2 SP) In Ausnahmefällen (z.B. weil in einem Seminar alle Teilnehmer/innen für die Übernahme von Referaten benötigt werden) ist es möglich, statt eines Argumentationspapiers ein Referat zu übernehmen. Wenn eine Referatsnote statt der Note für ein Argumentationspapier eingebracht werden soll, muss dies dem Dozenten oder der Dozentin vor dem Referat mitgeteilt werden. Ansonsten wird der letzte Noteneintrag als Note für das Argumentationspapier verwendet. 4.3 SAO/WM_5 Wissensmanagement Wahlmodul 9 Studienpunkte Ziele Verständnis der wichtigsten Probleme und Lösungsansätze des Wissensmanagements in Organisationen, inkl. verwendeter Softwaresysteme, der psychologischen Aspekte und ihrer interdisziplinären Verknüpfung, aufbauend auf den entsprechenden Grundlagen der Sozial-, Arbeits-, Ingenieurs- und Organisationspsychologie. Inhalte Probleme und Lösungsansätze des Wissensmanagements Konzeptionen von Wissen in verschiedenen Lösungsansätzen soziale Produktion von Wissen und Informationspathologien Wissensmanagement und Innovation Computer Supported Cooperative work (CSCW) und Groupware-Systeme: Formen, Methoden, Einsatzgebiete, psychologische Fragestellungen. Literatur Boos M., Jonas K. & Sassenberg K. (2000). Computervermittelte Kommunikation in Organisationen. Göttingen: Hogrefe. Hauschildt, J. & Salomo, S. (2007). Innovationsmanagement (4. Auflage). München: Vahlen. Hof, H. & Wengenroth, U. (Hrsg.), Innovationsforschung – Ansätze, Methoden, Grenzen und Perspektiven. Münster: LIT. Lüthy, W., Voit, E. & Wehner, T. (Hrsg.). (2002). Wissensmanagement – Praxis. Einführung, Handlungsfelder und Fallbeispiele. Zürich: vdf, Hochschulverlag an der ETH Zürich. Mertins, K., Heisig, P. & Vorbeck, J. (Hrsg.). (2003). Knowledge Management. Best Practices in Europe (2nd ed.). Berlin: Springer. 11 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) Scholl, W. (2004). Innovation und Information. Wie in Unternehmen neues Wissen produziert wird. (Unter Mitarbeit von Lutz Hoffmann und Hans- Christof Gierschner). Göttingen: Hogrefe-Verlag. Scholl, W., König, C. & Meyer, B. (2003). Die Zukunft des Wissensmanagements: Der Faktor Mensch? Ausgewählte Ergebnisse der Delphi-Studie: "The Future of Knowledge Management". Wirtschaftspsychologie, 10, 7-13. Preece, J. (2000): Online Communities. Designing Usability, Supporting Sociability. Weiteres in den Veranstaltungen An unserer Professur derzeit angebotene Veranstaltungen VL o. SE Probleme und Lösungsansätze des Wissensmanagements (Scholl) SE Innovationsmanagement - Wie neues Wissen produziert und etabliert wird (Scholl) Prüfungsleistungen 30 min Klausur zur VL oder Suche, Kurzdarstellung und Kommentierung anhand der VL von 2 empirischen Veröffentlichungen. zu jedem SE ein benotetes Referat mit Handout 4.4 Sonderregelungen Praxisseminar AIO-Psychologie Anstelle eines beliebigen Seminars des A&0-Schwerpunktes kann ein Forschungs- & Beratungsprojekt im Rahmen des Praxisseminars AI0-Psychologie angerechnet werden. Anmeldungen zu den angebotenen Projekten sind möglich unter http://lms.huberlin.de/moodle/course/view.php?id=6044. Für Fragen kontaktieren Sie bitte Sebastian Kunert ([email protected]). Beginn, Dauer und Art des Projektes sind variabel und orientieren sich am Projektauftrag. Der Leistungsnachweis erfolgt in Form eines benoteten Projektberichtes und kann nur nach Absprache mit den Lehrstuhlinhabern für ein inhaltlich passendes Seminar in den Wahlmodulen des Schwerpunktes A&O-Psychologie angerechnet werden. Im Falle einer Anrechnung wird die im entsprechenden Modul maximal für ein Seminar mögliche Punktzahl angerechnet, also im Allgemeinen 3 SP, im Modul SAO/WM_4 4 SP (statt dem Referat + schriftliche Ausarbeitung). Begleitet wird die Arbeit in den Projekten von einer einem Reflexions-Workshop im Semester. Die Teilnahme an mindestens einer dieser Veranstaltungen ist für alle Mitglieder eines aktuell laufenden Projektes für den Erwerb des Leistungsnachweises verbindlich. 12 Die Module der Organisations- und Sozialpsychologie für die neue Prüfungsordnung (2003) 5 Generelle Regelungen In Absprache mit den Dozent/innen der Seminare ist es möglich, statt eines Referats eine Hausarbeit anzufertigen. Die Kriterien entsprechen denen der schriftlichen Ausarbeitungen eines Themas aus dem Modul SAO/WM_4 (8-12 Seiten etc.). Davon kann z.B. dann Gebrauch gemacht werden, wenn ein Seminar einen hohen Anteil an praktischen Übungen umfasst, so dass wenige Referatsthemen zur Verfügung stehen. 13