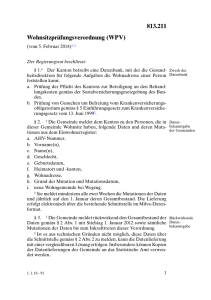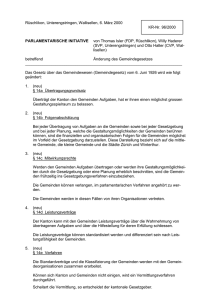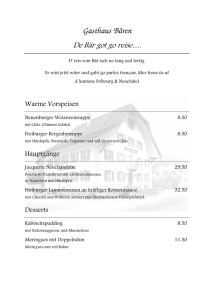Botschaft an den Grossen Rat
Werbung

Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 21. Mai 2008 Gesundheitsgesetz (GesG); Totalrevision Bericht und Entwurf 1. Beratung 08.141 -2- Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung............................................................................................................... 4 1. Ausgangslage .............................................................................................................. 6 1.1 1.2 2. Handlungsbedarf/Revisionsgründe ......................................................................... 10 2.1 2.2 3. Allgemeines ....................................................................................................... 10 2.1.1 Anpassungen an Bundesrecht (inklusive internationales Recht) ............... 10 2.1.2 Anpassungen an kantonales Recht ........................................................... 11 2.1.3 Anpassungen an gesellschaftliche Entwicklungen .................................... 13 2.1.4 Parlamentarische Vorstösse ..................................................................... 13 Zentrale Themenbereiche .................................................................................. 14 2.2.1 Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden ...................................................... 14 2.2.2 Liberalisierung der Berufszulassung ......................................................... 14 2.2.3 Massnahmen der Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz ...................... 15 2.2.4 Versorgungssicherheit .............................................................................. 17 2.2.5 Suizidhilfe ................................................................................................. 19 2.2.6 Medikamentenabgabe............................................................................... 20 Ergebnisse der Vernehmlassung und daraus resultierende Umsetzungsvorschläge 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. Geltendes Recht .................................................................................................. 6 Rahmenbedingungen der Revision ...................................................................... 7 1.2.1 Bundesrecht ................................................................................................ 7 1.2.2 Kantonales Recht ........................................................................................ 8 1.2.3 Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl)............................................ 9 1.2.4 Gesetzgeberische Tätigkeiten in anderen Kantonen ................................. 10 22 Allgemeines ....................................................................................................... 22 Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden ............................................................... 22 Liberalisierung der Berufszulassung (§§ 4–27 GesG-E) ..................................... 24 Massnahmen der Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz ............................... 25 3.4.1 Werbung im Bereich Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 1 GesG-E)................. 25 3.4.2 Verkaufsverbot von Tabakwaren an unter 16-Jährige (inklusive Automaten; § 37 Abs. 2 und 3 GesG-E) ....................................................................... 26 3.4.3 Testkäufe im Bereich Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 4 GesG-E) ............... 26 3.4.4 Abgabeverbot von alkoholischen Getränken an nicht kaufsberechtigte Jugendliche (§ 37 Abs. 5 GesG-E) ............................................................ 27 3.4.5 Passivrauchschutz (§ 38 GesG-E) ............................................................ 27 Versorgungssicherheit (§§ 39–41 GesG-E) ........................................................ 28 Suizidhilfe........................................................................................................... 28 Medikamentenabgabe (§ 45 GesG-E) ................................................................ 29 Weitere Vernehmlassungsergebnisse ................................................................ 30 Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen..................................................... 31 -3- 5. Auswirkungen ......................................................................................................... 105 5.1 5.2 5.3 6. Auf den Kanton sowie die Gemeinden ............................................................. 105 5.1.1 Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden .................................................... 105 5.1.2 Liberalisierung der Berufszulassung ....................................................... 105 5.1.3 Massnahmen der Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz .................... 107 5.1.4 Versorgungssicherheit ............................................................................ 109 5.1.5 Vollzug Heilmittel- und Betäubungsmittelwesen ...................................... 110 Auf die Wirtschaft des Kantons Aargau ............................................................ 110 Tabelle Auswirkungen (Übersicht) .................................................................... 112 Weiteres Vorgehen; Zeitplan .................................................................................. 114 A n t r a g : .......................................................................................................................... 96 -4- Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Regierungsrat unterbreitet Ihnen den Entwurf einer Totalrevision des Gesundheitsgesetzes (GesG) mit folgendem Bericht: Zusammenfassung Seit Inkraftsetzung des geltenden Gesundheitsgesetzes vom 10. November 1987 sind 20 Jahre vergangen. Zahlreiche Revisionsgründe führen dazu, dass die Durchführung einer Totalrevision heute unumgänglich ist. So ziehen zahlreiche in der Zwischenzeit neu in Kraft getretene Bundesgesetze Änderungen oder Anpassungen – hier seien insbesondere die Änderungen auf dem Gebiet der Berufszulassungen oder im Heilmittelwesen erwähnt – auf kantonaler Ebene nach sich. Ebenfalls hat sich in den vergangenen Jahren das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung markant verändert. Hier ist vor allem im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Jugendschutz im Bereich Tabak und Alkohol oder Schutz vor Passivrauchen) ein deutlicher Wandel erkennbar. Des Weiteren sind aufgrund des festgestellten Rückgangs der ärztlichen Grundversorgung sowie fehlender Grundlagen zur Koordination der ambulanten und stationären Notfallversorgung Regelungen auf Gesetzesstufe notwendig geworden. So bilden – unter anderem auch im Rahmen der Konkretisierung der Strategien der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) – folgende Themen Schwerpunkte im neuen Gesundheitsgesetz (GesG): Umsetzung der Grundsätze der Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden; Liberalisierung des Berufszulassungssystems und damit verbunden die Förderung der Eigenverantwortung der Patientin beziehungsweise des Patienten; Stärkung der Gesundheitsvorsorge sowie des Jugendschutzes durch konkrete Massnahmen im Bereich der Tabak- und Alkoholwerbung, der Tabakwaren- und Alkoholabgabe sowie des Schutzes der Bevölkerung vor dem Passivrauch; Schaffung gesetzlicher Grundlagen zwecks Koordination der ambulanten und der stationären ärztlichen Notfallversorgung sowie die konkrete Unterstützung der ambulanten ärztlichen Grundversorger. Die präsentierten Themen wurden in der Vernehmlassung unterschiedlich aufgenommen. Die Totalrevision wird grundsätzlich von allen Seiten begrüsst und als notwendig empfunden. Die vorgeschlagene Umsetzung der Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden wird von allen Parteien gutgeheissen, seitens der Gemeinden gibt es verschiedene Vorbehalte (zum Beispiel Zuständigkeit für gewisse Einrichtungen und Massnahmen der Suchthilfe, integrale Zuständigkeit der Gemeinden im Bestattungswesen ohne kantonale Vorgaben). Diesen Vorbehalten wurde weitestgehend Rechnung getragen. Im Bestattungswesen soll der Kanton gewisse gesundheitspolizeilich relevante Grundsätze für das gesamte Kantonsgebiet einheitlich regeln. Des Weiteren wird auf Wunsch der Gemeinden durch eine entsprechende Ergänzung im Gesetz dem Anliegen der Gemeinden nach einheitlichen kantonalen QualitätsVorgaben -5- im Bereich der Mütter- und Väterberatung Rechnung getragen. Die neu ins Gesundheitsgesetz aufgenommene Rechtsgrundlage für Testkäufe im Bereich Tabak und Alkohol wurde sowohl von den Parteien als auch den Gemeinden mehrheitlich gutgeheissen, sodass daran festgehalten wird. Zusätzlich erlässt der Regierungsrat hier Rahmenbedingungen auf Verordnungsstufe, um eine gewisse Einheitlichkeit und Qualität in der Durchführung zu gewährleisten. Grosse Vorbehalte wurden seitens der Berufsverbände im naturheilkundlichen Sektor gegenüber dem vorgeschlagenen Wechsel im Berufszulassungssystem und der damit verbundenen Freigabe der Naturheilkunde geäussert. Zum Teil äusserten sich auch die Parteien (CVP, Grüne, EVP) eher kritisch gegenüber dem neuen System. Insbesondere wurden fehlende Transparenz sowie die Patientensicherheit bemängelt. Unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsrückmeldungen sowie der momentan auf Bundesebene stattfindenden Entwicklungen im Bereich der Berufsausbildung in Komplementär- und Alternativmedizin, wurde die Bewilligungspflicht zur Berufsausübung ausgedehnt auf durch den Bund mittels Diplom anerkannte Berufsabschlüsse. Dass Werbeeinschränkungen beziehungsweise Werbeverbote im Bereich von Tabak und Alkohol notwendig seien, wurde von einer grossen Mehrheit der Vernehmlassenden unterstützt. Auf Skepsis beziehungsweise eher Ablehnung gestossen ist dagegen die konkrete Ausgestaltung dieser Einschränkungen beziehungsweise Verbote. Insbesondere im Bereich der Alkoholwerbeeinschränkung, wonach Alkoholwerbung nur dann erlaubt sei, wenn sie sich unmittelbar auf das Produkt und seine Eigenschaften bezieht, wurde mit den Argumenten der fehlenden Vollzugstauglichkeit insbesondere seitens der FDP und der SVP wie auch eines grossen Teils der Gemeinden abgelehnt. Auch die konkrete Ausgestaltung des Tabakwerbeverbots auf öffentlichem Grund sowie privatem Grund, der öffentlich einsehbar ist, wurde als unpraktikabel und zu unbestimmt beurteilt. Ganz generell wurde eine Gleichbehandlung der Werbeverbote für Tabakwaren und Alkohol gefordert. Das Gesundheitsgesetz trägt diesen Anliegen Rechnung und regelt neu die Tabak- und Alkoholwerbung in dem Sinne einheitlich, dass grossflächige Werbung für Tabakwaren und alkoholische Getränke wie zum Beispiel Plakat-, Kino- oder Bandenwerbung verboten wird. Das vorgeschlagene Verkaufsverbot von Tabakwaren an unter 16-Jährige (inklusive Automaten) stiess bei praktisch allen Vernehmlassenden auf grosse Zustimmung und wird deshalb unverändert beibehalten. Neu ins Gesetz aufgenommen – da im Rahmen der Vernehmlassung mehrfach gefordert (zum Beispiel EVP, Gemeinden) – wird das Abgabeverbot von alkoholischen Getränken an nicht kaufsberechtigte Jugendliche. Ziel und Zweck dieser Regelung ist es eine möglichst umfassende Prävention sicherzustellen und die in jüngster Zeit immer wieder vorkommenden Gewaltexzesse aufgrund alkoholisierter Jugendlicher einzudämmen beziehungsweise zu verhindern. -6- Beim Passivrauchschutz haben sich die SP, die CVP, die Grünen sowie die EVP hinter die Variante 1 gestellt, die FDP sowie die SVP bevorzugen die Variante 2. Eine Mehrheit der übrigen Vernehmlassenden inklusive der Gemeinden befürworten die Variante 1. Aufgrund dieses Ergebnisses sowie aufgrund der Tatsache, dass zum momentanen Zeitpunkt auf Bundesebene noch nicht definitiv absehbar ist, in welche Richtung das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen zielt, werden beide Varianten weiterverfolgt. Im Kapitel Versorgungssicherheit wurde von mehreren Seiten, so insbesondere der Aargauischen Ärzteschaft aber auch der CVP, der FDP und der Grünen, konkrete finanzielle Unterstützungen der Ärzteschaft im Bereich des Notfalldiensts etwa in Form eines entgeltlichen Leistungsauftrags gefordert. Diesem Anliegen wird im neuen Gesundheitsgesetz dahingehend Rechnung getragen, als der Kanton neu eine gesetzliche Grundlage schafft, finanzielle Mittel zur Förderung der ärztlichen Grundversorgung einsetzen zu können. Die Erteilung eines entgeltlichen Leistungsauftrags an den Aargauischen Ärzteverband steht hier im Vordergrund. Für den Bereich der Suizidhilfe wird nach wie vor die Auffassung vertreten, dass auf eine kantonale gesetzliche Regelung zu verzichten sei, auch wenn im Rahmen der Vernehmlassung die Forderung nach einer gesetzlichen Regelung aufgeworfen wurde (SVP, FDP, EVP). Es ist vor allem der Bereich des Sterbetourismus, der die Gemüter erhitzt und zu Diskussionen Anlass gibt. Gerade in diesem Bereich ist eine gesetzliche Regelung nur dann effektiv und greifend, wenn sie für die ganze Schweiz Gültigkeit hat. Kantonale Einzellösungen erfassen das eigentliche Problem nicht. In dem Sinne wird hier ganz klar eine Bundeslösung bevorzugt. Äusserst deutlich und grossmehrheitlich zustimmend ist die Vernehmlassung im Bereich der Medikamentenabgabe ausgefallen. Ablehnend äussert sich insbesondere der Aargauische Ärzteverband. Aufgrund dieser grossen Zustimmung wird an der bisherigen Regelung, wonach die Medikamentenabgabe grundsätzlich den Apotheken vorbehalten ist, festgehalten. 1. Ausgangslage 1.1 Geltendes Recht Das heute geltende Gesundheitsgesetz des Kantons Aargau stammt aus dem Jahr 1987. Es beinhaltet die zentralen organisatorischen und inhaltlichen Bestimmungen zur Regelung des Gesundheitswesens und der Gesundheitsversorgung im Kanton. So enthält es Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsfürsorge, des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsversorgung. Weiter regelt es die Organisation und Zuständigkeiten kantonaler Behörden und Instanzen, sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Berufsausübung von Medizinalpersonen sowie anderer Berufe, Organisationen und Betriebe der Gesundheitspflege (Bewilligungserteilung, Bewilligungsentzug, Rechte und Pflichten). Es enthält ferner Ausführungen zum Verkehr mit Heilmitteln, Aussagen zu den Rechten und Pflichten der Patientinnen und Patienten, organisatorische Bestimmungen zu Spitälern, -7- Krankenheimen, Heilstätten und Heilbädern sowie Regelungen zum Bestattungs- und Veterinärwesen. Das Gesundheitsgesetz (GesG) wird durch eine Reihe von Vollzugserlassen auf Dekrets- und Verordnungsstufe ergänzt (zum Beispiel Dekret über weitere bewilligungspflichtige Berufe der Gesundheitspflege; Verordnungen über die Zahnärzte, Drogerien und Apotheken; Verordnung über die öffentlichen Bäder; Verordnung über den Verkehr mit Heilmitteln; Verordnung über das Bestattungswesen, etc.) Das geltende Gesundheitsgesetz hat seit dem Inkrafttreten am 1. Mai 1988 mehrere Teilrevisionen erfahren. Diese Teilrevisionen beinhalteten im Wesentlichen folgende Themen: Ausdehnung der Bewilligungspflicht auf weitere Berufe und Organisationen der Krankenpflege, die gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) als Leistungserbringer zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen sind; Anpassungen im Rahmen des Projekts "Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden" (Kantonalisierung der Lebensmittel- und Fleischkontrolle sowie der Suchtberatung und Suchtprävention; Kommunalisierung der Pilzkontrolle sowie der Mütter- und Väterberatung); Anpassungen gewisser organisatorischer Bestimmungen als Folge des neuen Spitalgesetzes mit der Verselbstständigung der Kantonsspitäler. 1.2 Rahmenbedingungen der Revision Die Gesundheitsgesetzgebung im Kanton Aargau hat sich an den massgebenden bundesrechtlichen Vorschriften sowie den kantonalen Vorgaben in rechtlicher und strategischer Hinsicht zu orientieren. Zur letzteren gehört insbesondere die Gesundheitspolitische Gesamtplanung des Grossen Rats (GGpl) vom 13. Dezember 2005. 1.2.1 Bundesrecht Der Bund hat sich in gewissen Bereichen die Kompetenz zur Gesetzgebung vorbehalten (Art. 118 ff. und 95 Bundesverfassung, BV; SR 101). Gestützt darauf kann er Massnahmen zum Schutz der Gesundheit sowie Voraussetzungen für einen einheitlichen Wirtschaftsraum treffen. In diesen dem Bund zur Regelung vorbehaltenen Bereichen hat der Kanton eingeschränkte oder keine materielle Gesetzgebungskompetenz. Seine Möglichkeiten beschränken sich hier auf die Regelung von Zuständigkeiten, Vollzugsbestimmungen sowie organisatorischer Vorkehrungen. Konkret handelt es sich um folgende Bereiche: Umgang mit Lebensmitteln, Heilmitteln, Betäubungsmitteln, Organismen, Chemikalien und Gegenstände, welche die Gesundheit gefährden können (Art. 118 Abs. 2 lit. a BV); Vorschriften über die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Menschen und Tieren (Art. 118 Abs. 2 lit. c BV); Bestimmungen zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich (Art. 119 BV); Regelungen im Bereich der Transplantationsmedizin (Art. 119a BV) sowie der Gentechnologie im Ausserhumanbereich (Art. 120 BV); -8- Ausübung privatwirtschaftlicher Tätigkeit: Schaffung von Voraussetzungen, damit Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössischen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können (Art. 95 BV). 1.2.2 Kantonales Recht Die aargauische Kantonsverfassung (KV; SAR 110.000) beinhaltet Aussagen zur Stossrichtung im Gesundheitswesen. Sie bildet den übergeordneten rechtlichen Rahmen für die Revision des Gesundheitsgesetzes. Die Kantonsverfassung macht folgende Aussagen zum Gesundheitswesen: § 41 Gesundheitswesen 1 Der Kanton trifft im Zusammenwirken mit den Gemeinden und Privaten Vorkehren zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. 2 Er schafft Voraussetzungen für eine angemessene medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung. Er fördert die häusliche Krankenpflege. 3 Er fördert und beaufsichtigt die medizinischen Anstalten. Er kann eigene Einrichtungen schaffen. 4 Er unterstützt die Forschung sowie die Aus- und Weiterbildung des Medizinalpersonals. 5 Er überwacht und koordiniert das Medizinalwesen. 6 Er fördert Turnen und Sport. § 27 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kanton und Gemeinden gewährleisten die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Sie schützen insbesondere Leben, Freiheit, Gesundheit und Sittlichkeit. Sie wenden soziale Notstände ab. § 20 Wirtschaftsfreiheit 1 Jeder Schweizer hat das Recht auf freie Wahl und Ausübung eines Berufes und auf freie wirtschaftliche Betätigung. 2 Vorbehalten sind polizeiliche Bestimmungen, die kantonalen Regalrechte und die nach Massgabe des Bundesrechts zulässigen wirtschaftspolitischen Massnahmen. § 52 Wirtschaftspolizeiliche Vorschriften Der Kanton erlässt im Rahmen der bundesrechtlichen Vorbehalte und Ermächtigungen die Vorschriften, die eine geordnete Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeiten sicherstellen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es die gemeinsame Aufgabe von Kanton, Gemeinden und Privaten ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen steht dabei ebenso im Vordergrund. Weiter soll die Berufsausübung von Personen im Gesundheitswesen möglichst wenig eingeschränkt werden. Dabei hat eine Abwägung zwischen Wirtschaftsfreiheit und dem Schutz der Bevölkerung im Sinne der öffentlichen Ordnung und Sicherheit stattzufinden. -9- 1.2.3 Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) Die Gesundheitspolitische Gesamtplanung enthält die strategischen Ziele und Grundsätze der aargauischen Gesundheitspolitik und bildet den übergeordneten strategischen Rahmen. Sämtliche Strategien sind auf eine qualitativ gute Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung des Kantons Aargau ausgerichtet. Im Regelungsbereich des Gesundheitsgesetzes geben insbesondere folgende Strategien politische Vorgaben für die Revision: Strategie 1: Prävention und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Der Kanton ergreift Massnahmen zur Verhinderung des Auftretens respektive der Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten. Zu diesem Zweck überwacht er in Zusammenarbeit mit Dritten die übertragbaren Krankheiten im Rahmen des Vollzugs des Epidemiengesetzes. Er optimiert seine Vorkehrungen laufend und passt diese den neuen Erkenntnissen an, zum Beispiel infolge neu auftretender Krankheiten wie SARS. Der Kanton sorgt dafür, dass der breite Impfschutz der Bevölkerung aufrechterhalten respektive verbessert wird. Strategie 2: Gesundheitsförderung und allgemeine Prävention Der Kanton fördert einen eigenverantwortlichen, gesundheitsbewussten Lebensstil sowie die Gestaltung von gesundheitsfördernden Umweltbedingungen. Zur Verstärkung und Wirkungsoptimierung von Prävention und Gesundheitsförderung werden alle Bereiche des öffentlichen und privaten Sektors, welche auf diesem Gebiet aktiv sind, besser eingebunden und vernetzt. Strategie 3: Suchtprävention Der Kanton sorgt mit geeigneten Massnahmen für die Aufrechterhaltung des bisherigen quantitativen und qualitativen Niveaus in der Suchtprävention. Dazu nimmt er eine koordinierende und vernetzende Funktion wahr und sorgt dafür, dass die suchtpräventiven Massnahmen rechtzeitig auch den sich kurzfristig ändernden Verhältnissen angepasst werden. Strategie 11: Ambulante Versorgung durch niedergelassene Leistungserbringer Die ambulante Versorgung unterliegt im Kanton primär dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Der Kanton trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten und des von der Krankenversicherungsgesetzgebung ermöglichten Spielraums dazu bei, dass für die Aargauer Bevölkerung eine möglichst flächendeckende und kostengünstige ambulante Versorgung gewährleistet bleibt. Wenn Leistungen ambulant erbracht werden können, sollen diese nicht stationär angeboten werden. Strategie 12: Ambulante Versorgung durch die Spitäler Die stationären Leistungserbringer können ambulante Leistungen erbringen. Diese Leistungen haben auch künftig ihren grundsätzlich ergänzenden Charakter zur niedergelassenen Ärzteschaft und zu den übrigen privaten Leistungserbringern beizubehalten. - 10 - Strategie 13: Notfallversorgung Der Kanton sorgt für die Gewährleistung der Notfallversorgung. Der zunehmenden Beanspruchung der öffentlichen Notfallstationen mit Bagatellfällen wird mit geeigneten Massnahmen begegnet. Strategie 14: Rettungswesen Der Kanton gewährleistet eine flächendeckende, sich an anerkannte Kriterien – wie vom Interverbands für Rettungswesen (IVR) erarbeitet – anlehnende rettungsdienstliche Versorgung. Dazu wird die bisherige Struktur inklusive Einsatzleitstelle (ELS) 144 aufrechterhalten und kontinuierlich optimiert. Strategie 22: Suchtberatung und Suchttherapie Der Kanton Aargau gewährleistet im Suchtbereich eine bedarfsgerechte ambulante und stationäre Versorgung. 1.2.4 Gesetzgeberische Tätigkeiten in anderen Kantonen Der Kanton Aargau ist mit der Überarbeitung des Gesundheitsgesetzes nicht alleine. In vielen Kantonen der Schweiz laufen zurzeit Revisionsbemühungen im Gesundheitswesen oder sind bereits abgeschlossen. Dementsprechend orientiert sich der Kanton Aargau auch an den umliegenden Kantonen in Bezug auf ihre gesetzgeberischen Aktivitäten. 2. Handlungsbedarf/Revisionsgründe 2.1 Allgemeines Seit Inkraftsetzung des geltenden Gesundheitsgesetzes vom 10. November 1987 (im Folgenden: GesG-1987) sind 20 Jahre vergangen. Zahlreiche Revisionsgründe führen dazu, dass die Durchführung einer Totalrevision heute unumgänglich ist. So ist der Bund zwischenzeitlich in verschiedenen Bereichen gesetzgeberisch aktiv geworden. Auch im Kanton hat es Veränderungen im strategischen und rechtlichen Umfeld gegeben, die einen Handlungsbedarf auslösen. Weitere Gründe sind die geänderten Bedürfnisse und das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung, Erkenntnisse im Rahmen der Vollzugstätigkeit sowie parlamentarische Vorstösse, welche wichtige Inputs zur Revision des Gesundheitsgesetzes gegeben haben. Nicht zuletzt haben die technische Entwicklung und die Rechtssprechung Anlass dazu gegeben, die geltende Regelung zu überdenken. 2.1.1 Anpassungen an Bundesrecht (inklusive internationales Recht) Das öffentliche Gesundheitsrecht lag – noch unter dem Geltungsbereich der alten Bundesverfassung – vor allem im traditionellen Kompetenzbereich der Kantone. Auf der Grundlage der neuen Bundesverfassung (vgl. Art. 118–120 BV) ist der Bund in diesem Bereich vermehrt rechtssetzerisch tätig geworden. Seit der Inkraftsetzung des GesG-1987 sind folgende Bundesgesetze in Kraft getreten: Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG) vom 9. Oktober 1992 (SR 817.0); Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 (SR 832.10); - 11 - Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM) vom 6. Oktober 1995 (SR 943.02); Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) vom 18. Dezember 1998 (SR 810.11); Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21); Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 (SR 412.10); Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellenforschungsgesetz, StFG) vom 19. Dezember 2003 (SR 810.31); Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) vom 8. Oktober 2004 (SR 810.12); Bundesgesetz über Voraussetzungen und Verfahren bei Sterilisationen (Sterilisationsgesetz) vom 17. Dezember 2004 (SR 211.111.1); Transplantationsgesetz vom 8. Oktober 2004 (SR 810.21); Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) vom 23. Juni 2006 (SR 811.11). Im Weitern sind folgende Bundesgesetze in Bearbeitung oder absehbar: Bundesgesetz über die Psychologieberufe (Inkrafttreten nicht vor 2010 geplant); Humanforschungsgesetz (Inkrafttreten zurzeit noch nicht absehbar); Schweizerische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, StPO; geplantes Inkrafttreten 1. Januar 2010); Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) im Bereich des Erwachsenenschutzes, des Personen- und Kindesrechts (Inkrafttreten nicht vor 2011/2012). Die Schweiz hat im Rahmen des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (SR 0.142.112.681) verschiedene Richtlinien zur Anerkennung von Berufsqualifikationen und Diplomen übernommen. Sowohl indirekt über Anpassungen des Bundesrechts als auch direkt lösen die Abkommen mit der EU/EFTA und die entsprechenden Richtlinien auch auf kantonaler Ebene Handlungsbedarf aus. Aktuell steht die Schweiz vor der Annahme der neuen Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Richtlinie 2005/36/EG). All diese Gesetzgebungen haben direkten Einfluss auf den Regelungsbereich des Gesundheitsgesetzes, indem einerseits gewisse Regelungen des geltenden Gesundheitsgesetzes obsolet werden, andererseits zusätzliche Regelungen notwendig werden. 2.1.2 Anpassungen an kantonales Recht Nicht nur die Entwicklung im Bundesrecht, sondern auch diejenige auf kantonaler Ebene lösen einen Anpassungsbedarf aus. Verschiedene Themenbereiche, welche bislang im Gesundheitsgesetz geregelt waren, sind neu in Spezialerlassen geregelt (Spitalgesetz [SpiG] vom 25. Februar 2003; Pflegegesetz [PflG] vom 26. Juni 2007; Einführungsgesetz zum - 12 - Tierseuchengesetz [EG TSG]; Stand: [08.68] Botschaft 2. Beratung vom 12. März 2008). Diesen Schnittstellen wird beim Erlass des neuen Gesundheitsgesetzes Rechnung getragen. - 13 - Die unter Ziffer 1.2.3 aufgeführten Strategien der GGpl zeigen für verschiedene Regelungsbereiche des neuen Gesundheitsgesetzes die Stossrichtungen auf. Des Weiteren hat auch das vom Regierungsrat lancierte Projekt zur Verwirklichung einer wirtschaftspolitischen Wachstumsstrategie (WIPO) Auswirkungen auf die Regelungen des neuen Gesundheitsgesetzes (zum Beispiel im Bereich Berufszulassung/Freizügigkeit und Binnenmarktliberalisierung). 2.1.3 Anpassungen an gesellschaftliche Entwicklungen Auch im Gesundheitswesen haben die vergangenen zwei Jahrzehnte markante gesellschaftliche Entwicklungen und gesellschaftspolitischen Wandel mit sich gebracht. Diese äussern sich in vielfältiger Hinsicht. Beispiele dafür sind: Akzeptanz komplementärtherapeutischer Verfahren; Entstehung neuer Berufsbilder; Verstärktes Bewusstsein für eine gesunde Lebensführung und für Gesundheitsvorsorge; Verstärktes Bewusstsein für die Selbstbestimmungsrechte der Patientinnen und Patienten; Sensibilisierung für Anliegen des Datenschutzes; Liberalisierung und Deregulierung. Diesen und anderen Entwicklungen muss ein modernes Gesundheitsgesetz Rechnung tragen. 2.1.4 Parlamentarische Vorstösse Ausdruck dieser Entwicklungen sind auch eine Anzahl von parlamentarischen Vorstössen, welche zu verschiedenen Themenbereichen die geänderten Wertvorstellungen und den gesellschaftlichen Wandel aufzeigen. Folgende Vorstösse werden im Rahmen der vorliegenden Revision des Gesundheitsgesetzes behandelt: (99.423) Postulat Urs Leuenberger, Widen, vom 21. Dezember 1999 betreffend Schaffung rechtlicher Grundlagen im aargauischen Rettungswesen vom 21. Dezember 1999 (Überweisung am 9. Mai 2000); (03.139) Motion Liliane Studer, Wettingen, vom 20. Mai 2003 betreffend Ausweitung der Werbeeinschränkungen für Alkohol und Tabak (Überweisung als Postulat am 2. Dezember 2003); (04.168) Motion Sylvia Flückiger-Bäni, Schöftland, vom 22. Juni 2004 betreffend Sterbehilfe und Abschaffung des Sterbetourismus im Kanton Aargau*; (04.290) Motion Liliane Studer, Wettingen, vom 2. November 2004 betreffend rauchfreie öffentliche Räume zum Schutz der Bevölkerung vor Passivrauchen (Überweisung als Postulat am 8. November 2005); (06.108) Motion Sylvia Flückiger-Bäni, Schöftland, vom 13. Juni 2006 betreffend Kostenübertragung an die Sterbehilfeorganisationen*; * Der Regierungsrat erklärte sich bereit, diese beiden Motionen als Postulate entgegenzunehmen. Die Motionärin hielt an den Motionen fest. Der Grosse Rat lehnte in der Folge am 19. Oktober 2004 beziehungsweise 31. Oktober 2006 die beiden Motionen ab. - 14 - (06.109) Motion Dr. Rainer Klöti, Auenstein, vom 13. Juni 2006 betreffend Sterbehilfe im Kanton Aargau (Überweisung als Postulat am 31. Oktober 2006); (07.204) Motion Adrian Schoch, Fislisbach, vom 28. August 2007 betreffend Schaffung der gesetzlichen Grundlagen, um die Weitergabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche zu unterbinden**. ** Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat mit Datum vom 14. Mai 2008, die Motion entgegenzunehmen. Da die Motion im Zeitpunkt der Botschaft des Regierungsrats zum Gesundheitsgesetz vom 21. Mai 2008 im Grossen Rat noch nicht behandelt ist, kann deren Abschreibung erst mit der Botschaft zur 2. Beratung beantragt werden. 2.2 Zentrale Themenbereiche 2.2.1 Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden Mit dem Projekt Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden, welches zu Beginn dieses Jahrzehnts in drei Paketen (Gesetz zur Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden, GAT I–III) zahlreiche Reformen realisiert hat, wurden die Grundsätze einer zweckmässigen Aufgabenteilung implementiert. Diese Zielsetzungen und Grundsätze (vgl. §§ 1 und 2 GAT I; SAR 691.100) gelten seither als wegleitend für alle neuen Gesetzgebungsvorhaben im Kanton. Die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden im Gesundheitswesen wurde im Anwendungsbereich des Spitalgesetzes und des Pflegegesetzes konkretisiert und muss auch im Anwendungsbereich des neuen Gesundheitsgesetzes im Sinne der erwähnten Ziele und Grundsätze erfolgen. 2.2.2 Liberalisierung der Berufszulassung Das neue Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) vom 23. Juni 2006 (SR 811.11) bildet den bundesrechtlichen Rahmen für die kantonalen Regelungen der Berufszulassung der Medizinalpersonen. Es führt insbesondere dazu aus, dass der Bund für die selbstständige Berufsausübung nicht nur die Voraussetzungen der Zulassung, sondern auch die Rechte und Pflichten bei der Berufsausübung weitgehend normiert und damit die bislang im kantonalen Recht bestehenden Regelungen weitgehend obsolet macht. Das gegenwärtige Zulassungssystem ist im Bereich der anerkannten Berufe im Vollzug etabliert und weitestgehend problemlos. Dieses so genannte diplomorientierte Modell stellt ausschliesslich auf die der Schulmedizin verpflichteten Berufe ab. Schwierigkeiten bereitet jedoch die ganze Palette komplementärmedizinisch tätigen Berufe (zum Beispiel Naturheilerin/Naturheiler, Homöopathin/Homöopathen, Akupunkteurinnen/Akupunkteure) und die neu entstandenen Berufe (zum Beispiel Osteopathie). Verschiedene Kantone sind deshalb in den letzten Jahren dazu übergegangen, einzelne dieser Therapien zuzulassen und zum Teil formelle Berufsausübungsbewilligungen auszustellen. Diese Entwicklung wurde durch die Rechtssprechung und die Bundesgesetzgebung über den Binnenmarkt gefördert. - 15 - Im aargauischen Zulassungssystem sind nach geltendem Recht alle erlaubten Berufe im Gesundheitswesen in abschliessender Form aufgezählt. Mit anderen Worten sind alle diagnostischen und heilenden Tätigkeiten unabhängig von Methodik und Wirksamkeit, einem generellen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterstellt. Diese aktuell geltende Regelung kommt einem indirekten Verbot der Ausübung alternativer Heilmethoden durch Nicht-Medizinalpersonen gleich. Eine eigentliche Regelung dieser Verfahren (wer darf was anbieten, wie werben etc.) existiert im Kanton Aargau jedoch nicht. So ist denn auch nachvollziehbar, dass die effektive Durchsetzung dieses Verbots – gerade auch im Hinblick auf die Regelungen in anderen Kantonen – im Vollzug sehr schwierig ist und an Grenzen stösst. Im Kontext dieses Umfelds stellt sich die Frage nach der Rollenverteilung zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern bei der Inanspruchnahme von medizinischen Dienstleistungen. Dabei zeigt sich, dass der Staat wohl für jene medizinischen Tätigkeiten und Berufe eine gewisse Qualitätsgarantie übernehmen kann, die ein anerkanntes Ausbildungssystem durchlaufen. Den Möglichkeiten des Staats sind allerdings bei zahlreichen Tätigkeiten und Berufen insbesondere im Bereich der Komplementärmedizin, wo staatlich anerkannte Ausbildungen sehr oft nicht existieren, Grenzen gesetzt. Daraus stellt sich gleichzeitig die Frage nach dem Umfang der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten. Im Spannungsfeld zwischen Liberalisierung beziehungsweise Freizügigkeit in der Berufszulassung und Sicherstellung der Patientensicherheit durch den Staat geht es somit letztlich darum, differenzierte Lösungen für eine sinnvolle Abwägung zwischen dem zwingenden staatlichen Regelungs- und Handlungsbedarf und der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten vorzunehmen. 2.2.3 Massnahmen der Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz Das geltende Recht beschränkt sich auf allgemein gehaltene Aussagen, Massnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge zu treffen. Gestützt darauf betreibt der Kanton bereits seit Jahren eine aktive Gesundheitsförderungspolitik (zum Beispiel Schwerpunktprogramme "Betriebliche Gesundheitsförderung" und "Gesundes Körpergewicht"; Newsletter "Forum Gesundheit"; Gesundheitsförderungspreis). Allerdings fehlen konkrete gesetzliche Grundlagen für Massnahmen im Bereich Tabak- und Alkoholprävention, insbesondere auch unter dem Aspekt des Jugendschutzes, sowie im Bereich des Passivrauchens. Diese Themen haben gerade in den vergangen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das gesundheitsschädigende Potential von Tabakund übermässigem Alkoholkonsum ist unbestritten. Bund und Kantone sind deshalb daran, die Massnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge zu verstärken. Dazu gehören in erster Linie Werbeeinschränkungen beziehungsweise Werbeverbote sowie Abgabeverbote für Tabak und Alkohol, wobei hier vor allem die Jugendlichen im Fokus dieser Bestrebungen stehen (Jugendschutz). Da der Einstieg in den Tabakkonsum in der Regel im jugendlichen Alter erfolgt, geht die Stossrichtung in erster Linie dahin, mittels geeigneter Massnahmen Jugendliche vom Einstieg in den Tabakkonsum abzuhalten. Der Zusammenhang zwischen Tabakwerbung und Konsumverhalten, insbesondere bei Jugendlichen, ist durch mehrere Untersuchungen belegt. Werbung beeinflusst dabei nicht nur die Markenwahl, sondern erhöht auch die Gesamtnachfrage beziehungsweise den Konsum. Gerade Kinder und Jugendliche sind für Werbung stark empfänglich. - 16 - Aus präventiver Sicht ist es sinnvoll, nicht nur für Tabakwaren Werbeeinschränkungen zu erlassen, sondern auch für alkoholische Getränke. Alkohol ist nicht nur ein Genussmittel und alltägliches Konsumgut vieler Menschen, Alkohol ist auch Rausch- und Suchtmittel und Ursache vieler gesundheitlicher Probleme. Besorgniserregend ist vor allem die Tatsache, dass Jugendliche deutlich mehr trinken als früher und dass das Rauschtrinken von Jugendlichen (insbesondere der 15- und 16-Jährigen) deutlich zugenommen haben. Gemäss der Studie Alkohol und Gewalt im Jugendalter der Schweizerischen Fachstelle für Alkoholund andere Drogenprobleme (SFA) aus dem Jahr 2006 konsumieren rund 20 % der Jugendlichen Alkohol in problematischer Weise. Diese Gruppe zeigt auch ein deutlich erhöhtes Mass an gewalttätigem Verhalten. Die Studie macht deutlich, dass Alkoholkonsum mit Gewalt zusammenhängt. Von grosser Bedeutung ist aber auch, dass die verschiedenen Massnahmen der Gesundheitsvorsorge auch wirksam vollzogen werden. Insbesondere die Abgabeverbote im Bereich Tabak und Alkohol müssen konsequent durchgesetzt werden. Im Vordergrund stehen hier zwei Absatzkanäle, zum Einen die üblichen Verkaufsstellen von Tabak und Alkohol, zum Anderen die private Abgabe an Nicht-Kaufsberechtigte. Ein Verkaufsverbot ohne stichprobenweise Kontrolle ist wenig wirksam. Die Praxis in anderen Kantonen hat gezeigt, dass Kontrollen mittels Testkäufen durch Minderjährige am Effektivsten sind. Die (unentgeltliche) private Abgabe ist gerade unter Jugendlichen ein häufiges Vorgehen, um die bestehenden Verkaufsverbote zu umgehen. Das geltende Recht genügt nicht, um gegen solche Umgehungshandlungen wirksam vorgehen zu können. Mit der Schaffung von gesetzlichen Grundlagen zur Durchsetzung dieser Abgabeverbote und mit Werbeeinschränkungen im Bereich Tabak und Alkohol kann darauf hingewirkt werden, dass der gesundheitsschädigende Konsum von Tabak und Alkohol eingedämmt wird. Darüber hinaus kann damit ein Beitrag zur Bekämpfung der sicherheits- und ordnungspolitisch unerwünschten Nebenfolgen übermässigen Alkoholkonsums (Gewalt, Vandalismus) geleistet werden. Weiter soll mit entsprechenden Massnahmen der unbestritten gesundheitsschädigenden Wirkung des Passivrauchens wirksam begegnet werden. Der Kanton Aargau ist nicht der einzige Kanton, der sich mit der Thematik des Passivrauchens befasst. Mehrere Kantone (Appenzell Ausserrhoden, Genf, Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt) haben ein generelles Rauchverbot in öffentlichen Räumen sowie der Gastronomie bereits eingeführt. In den meisten anderen Kantonen ist das Rauchen jedoch in abgetrennten Raucherräumen erlaubt. Einzig der Kanton Genf kennt diese Ausnahme nicht. Alle übrigen Kantone, mit Ausnahme des Kantons Appenzell Innerrhoden, befinden sich in Bezug auf den Passivrauchschutz ebenfalls in gesetzgeberischen Revisionsarbeiten beziehungsweise diskutieren entsprechende Massnahmen. Auch auf Bundesebene – initiiert durch die (04.476) parlamentarische Initiative Gutzwiller vom 8. Oktober 2004 – ist man daran, den Passivrauchschutz gesamtschweizerisch zu regeln. So haben die Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit der beiden Kammern in der Folge einen Gesetzesentwurf erarbeitet. Vorgesehen war ein allgemeines Rauchverbot in geschlossenen öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Räumen (inklusive Gastronomiebetriebe), mit der Möglichkeit, geschlossene, ausreichend belüftete und besonders gekennzeichnete Raucherräume einzurichten, sofern darin keine Arbeitnehmenden beschäftigt werden. Die Stossrichtung der Vorlage entsprach den - 17 - zahlreichen aktuellen Bestrebungen in den Kantonen und den verstärkten Forderungen der Bevölkerung nach rauchfreien Arbeitsplätzen. Der Bundesrat hat am 22. August 2007 den Gesetzesentwurf zum Schutz vor Passivrauchen unterstützt. Der Nationalrat verabschiedete am 4. Oktober 2007 in der Folge eine ganze Reihe von Minderheitsanträgen, die in die von GastroSuisse vorgeschlagene Richtung gehen und der im Kanton Aargau in die Vernehmlassung gegebenen Variante 2 entsprechen. Am 4. März 2008 sprach sich der Ständerat jedoch gegen Ausnahmen aus und stimmte der ursprünglichen Version der Gesetzesvorlage zu, die keine Bewilligungen für Raucherbetriebe vorsieht. Erlaubt sollen lediglich abgetrennte Raucherräume sein, in denen ausnahmsweise Arbeitnehmende mit deren ausdrücklicher Zustimmung beschäftigt werden dürfen. Die Vorlage geht nun zurück an den Nationalrat und wird dort voraussichtlich in der Sommersession 2008 erneut behandelt. Auch im Kanton Aargau sind Aktivitäten in Bezug auf den Passivrauchschutz bekannt. Indem GastroAargau auf freiwilliger Basis die durch Gastro St. Gallen im Jahr 2005 lancierte Kampagne "rauchfrei geniessen" seinen Gastronomiebetrieben zur Umsetzung empfohlen hat, wurde im Kanton Aargau bereits ein Schritt in Richtung Passivrauchschutz in der Gastronomie unternommen. Die Forderungen interessierter Kreise gehen jedoch klar weiter. So hat die Lungenliga Aargau die Lancierung einer Initiative für den Fall angekündigt, falls die Revision des Gesundheitsgesetzes zu wenig Schutz vor dem Passivrauchen bringt. Die Hauptforderung der angekündigten Initiative ist ein Rauchverbot für geschlossene öffentliche Räume, wie in Gebäuden der öffentlichen Verwaltung, in Spitälern, Heimen, Kultur- und Sportstätten, Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsstätten und in allen Bereichen der Gastronomie. Eine Ausnahme vom generellen Rauchverbot würde für getrennte und entsprechend gekennzeichnete Räume mit ausreichender Belüftung gelten. Demgegenüber wurde im Juli 2007 eine Initiative "gegen Rauchverbote in privaten Räumen" lanciert. Die Initiative verlangt, dass in der Kantonsverfassung aufgenommen wird, dass in Räumen, welche sich im Eigentum von Privatpersonen befinden, das Rauchen nicht mehr verboten werden darf. Die durch Grossrätin Lilian Studer eingereichte (04.290) Motion vom 2. November 2004 betreffend rauchfreie öffentliche Räume zum Schutz der Bevölkerung vor Passivrauchen wurde vom Regierungsrat als Postulat mit der Verpflichtung entgegengenommen, die darin formulierten Anliegen bei der Revision des Gesundheitsgesetzes zu berücksichtigen. 2.2.4 Versorgungssicherheit Währenddem die Versorgung im stationären Bereich (Spitäler und Pflegeeinrichtungen) durch das Spitalgesetz sowie das Pflegegesetz sichergestellt ist, enthält das Gesundheitsgesetz Massnahmen, die der Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ambulanten Bereich dienen. Dazu gehören in erster Linie die generelle Beistandspflicht sowie die Notfalldienstpflicht der Medizinalpersonen, welche bereits im geltenden Recht verankert sind. Im Gegensatz zum stationären Bereich unterliegt das ambulante Angebot jedoch grundsätzlich den Mechanismen des Markts (vgl. dazu Strategie 11 der GGpl). Der Bund hat allerdings mit seiner Verordnung über die Einschränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vom 3. Juli 2002 (SR 832.103) Massnahmen getroffen, um auf die Zunahme ambulanter Leistungserbringer - 18 - steuernd einzuwirken. Diese Massnahmen sind bis zum 3. Juli 2008 befristet. Zurzeit laufen beim Bund die Diskussionen über eine allfällige Verlängerung dieser Massnahmen. - 19 - Mit den Strategien 11–14 der GGpl (vgl. Ziffer 1.2.3) wurde zum Ausdruck gebracht, dass der Kanton im Rahmen des von der Krankenversicherungsgesetzgebung ermöglichten Spielraums dazu beiträgt, dass für die Aargauer Bevölkerung eine flächendeckende und kostengünstige Versorgung gewährleistet ist (Strategie 11 GGpl); ambulante Leistungen primär durch privaten Leistungserbringer und nur ergänzend durch stationäre Leistungserbringer erbracht werden sollen (Strategie 12 GGpl); der Kanton für die Gewährleistung der Notfallversorgung sorgt und der zunehmenden Beanspruchung der öffentlichen Notfallstationen mit Bagatellfällen mit geeigneten Massnahmen begegnet (Strategie 13 GGpl); der Kanton auf der Grundlage der heutigen Strukturen eine flächendeckende rettungsdienstliche Versorgung gewährleistet (Strategie 14 GGpl). Insgesamt kann festgestellt werden, dass das ambulante Angebot im Kanton Aargau zurzeit sehr gut ist und keine eigentlichen Versorgungslücken aufweist. Andererseits gibt es wie in anderen Kantonen auch im Kanton Aargau gewisse Anzeichen dafür, dass die ärztliche Grundversorgung durch die Hausärztinnen und Hausärzte zurückgeht. So bereitet es offenbar Mühe, Nachfolger für die Übernahme einer Hausarztpraxis zu finden. Gründe dafür sind unter anderem die hohe zeitliche Beanspruchung, die Notfalldienstpflicht sowie die finanzielle Schlechterstellung gegenüber den ärztlichen Spezialdisziplinen. Gesetzliche Grundlagen zur Koordination der verschiedenen Dienste, insbesondere zwischen der ambulanten und der stationären Notfallversorgung, fehlen vollständig. 2.2.5 Suizidhilfe Seit mehreren Jahren sind die Tätigkeiten von Suizidhilfeorganisationen, insbesondere die Suizidhilfe an Personen aus dem Ausland (so genannter "Sterbetourismus"), Gegenstand gesellschaftlicher Diskussionen. Im Februar 2003 wurde einem im Kanton Aargau tätigen Arzt, der zuhanden der Sterbehilfeorganisation Dignitas Natrium-Pentobarbital (NaP) rezeptierte, die Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung eingeschränkt. Dieser Entscheid wurde vom Verwaltungsgericht im Januar 2005 vollumfänglich bestätigt. Seither wird das von Dignitas gemietete Haus in Reinach, wo insbesondere ausländische sterbewillige Personen in den Tod begleitet wurden, nicht mehr für die Suizidhilfe genutzt. Seither konzentrieren sich die Aktivitäten von Dignitas primär auf den Kanton Zürich. Behördliche Massnahmen baurechtlicher Natur (zum Beispiel Verbot zur Nutzung von Liegenschaften für die Sterbehilfe) zeigten nur bedingt Wirkung und führten dazu, dass Dignitas auf andere Möglichkeiten auszuweichen begann (zum Beispiel Suizidhilfe in Fahrzeugen). Diese Ereignisse fanden eine entsprechend grosse Aufmerksamkeit in den Medien. Nachdem der Kanton Zürich – analog dem Vorgehen im Kanton Aargau – aufsichtsrechtlich gegen die das Natrium-Pentobarbital (NaP) verschreibenden Ärzte vorgegangen ist, wurden neue Methoden der Dignitas bekannt (Suizidhilfe mit Helium), die wiederum ein entsprechendes Echo in den Medien auslösten. Auf Bundesebene besteht seit einiger Zeit eine Kontroverse zwischen dem Bundesrat, der eine gesetzliche Regelung im Bereich der Aufsicht über Sterbehilfeorganisationen ablehnt (vgl. dazu den Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 24. April 2006 "Sterbehilfe und Palliativmedizin – Handlungsbedarf für den Bund?"), und dem - 20 - Parlament, das sich bei der Behandlung von parlamentarischen Vorstössen für eine Regelung ausgesprochen hat. Aktuell sind mehrere parlamentarische Vorstösse hängig, von denen einzelne demnächst in der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats zur Behandlung kommen sollten. Inhaltlich streben diese Vorstösse eine bundesgesetzliche Regelung der Suizidhilfe an (insbesondere Aufsicht über Sterbehilfeorganisationen; Vermeidung von Suizidhilfetourismus; Änderung von Art. 115 Strafgesetzbuch [StGB], womit Suizidhilfe an Personen aus dem Ausland nicht mehr zulässig wäre). In zwei Kantonen (Aargau und Zürich) sind Standesinitiativen hängig, welche ebenfalls eine Anpassung von Art. 115 StGB (SR 311.0) im eben erwähnten Sinne fordern. Auch im Kanton Aargau führte die Aktualität des Themas zu verschiedenen parlamentarischen Vorstössen (vgl. dazu Ziffer 2.1.4). 2.2.6 Medikamentenabgabe Das traditionelle Medikamentenabgabeverbot (Selbstdispensationsverbot, SD-Verbot) im Kanton Aargau, welches früher von den beiden betroffenen Berufsverbänden (Ärzteverband und Apothekerverband) mitgetragen wurde, ist im Verlauf des letzten Jahrzehnts wieder zunehmend zum Thema geworden. Als Folge des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen ist das Interesse am Medikamentenmarkt sehr gross. Während die Apothekerinnen und Apotheker auf die konsequente Durchsetzung des SD-Verbots drängen, verlangen die Ärztinnen und Ärzte eine Liberalisierung. Hinter dem SD-Verbot steht vor allem das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines dichten Apothekennetzes, um eine niederschwellige und gute medizinischen Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten sicherzustellen. Die öffentliche Apotheke ist bezüglich Beratung und Medikamentensortiment gegenüber der ärztlichen Privatapotheke im Vorteil und nimmt aufgrund der besonderen fachlichen Ausbildung der Apothekerinnen und Apotheker eine wichtige Beratungs- und Triagefunktion wahr. Sie fungiert als erste Anlaufstelle bei Erkrankungen oder Bagatellunfällen und kann – soweit die Patientin oder der Patient nicht an die Ärztin oder den Arzt überwiesen werden muss – nicht rezeptpflichtige Medikamente abgeben, ohne dadurch die Krankenversicherung zu belasten. Zudem wird getreu dem Grundsatz "Wer rezeptiert, dispensiert nicht", die Gefahr reduziert, dass aus wirtschaftlichen Gründen der Patientin oder dem Patienten mehr abgegeben wird, als notwendig oder indiziert ist. Die Apotheken erfüllen die ihnen im Gesundheitswesen zukommenden wichtigen Funktionen nur, wenn sie regional breit gestreut und in ausreichender Zahl vorhanden sind. Die bei einer Freigabe der Medikamentenabgabe entstehende Konkurrenz zwischen Ärztinnen und Ärzten beziehungsweise Apothekerinnen und Apothekern gefährdet das Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Apotheken. Insoweit liegt die Beschränkung der Selbstdispensation im öffentlichen Interesse. Die Beibehaltung eines dichten Apothekennetzes entspringt einem legitimen – und mit der Wirtschaftsfreiheit vereinbaren – sozialpolitischen Zweck (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts vom 27. Juni 2000 i.S. F.; AGVE 2001 S. 127 ff.). Das Selbstdispensationsverbot stärkt allerdings nicht nur die öffentlichen Apotheken im Aargau, sondern gleichzeitig auch den Versandhandel durch (vor allem ausserkantonale) Apotheken (vgl. Art. 27 HMG), weil der Bedarf nach Versandhandel bei einem System, wo auch Ärztinnen und Ärzte Medikamente abgeben dürfen, aus nahe liegenden Gründen weitaus geringer ist. - 21 - Die Frage, ob das System des SD-Verbots oder das System der SD-Freigabe das wirtschaftlich günstigere sei, ist bis heute kontrovers. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Medikamentenkosten massgeblich durch gesundheitsökonomische Variablen (zum Beispiel Ärztedichte) sowie soziökonomische Faktoren (zum Beispiel Alterstruktur) beeinflusst werden. Ein blosser Vergleich der Höhe der Medikamentenkosten in Kantonen mit und ohne Selbstdispensation lässt daher keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Immerhin zeigt die neuste Studie aus dem Jahr 2004 auf, dass ein System des SD-Verbots weniger Medikamentenkosten generiert. Bei einer umfassenden ökonomischen Beurteilung reicht es zudem nicht aus, danach zu fragen, welches System für sich genommen das kostengünstigere sei. Vielmehr sind auch die mit einem allfälligen Systemwechsel (Wechsel von SD-Verbot zu SD-Freigabe) verbundenen "Folgekosten" zu berücksichtigen. Hierzu schlüssige Aussagen zu machen ist mangels Erfahrungswerten schwierig. Angesichts der Tatsache, dass das Gesundheitswesen angebotsorientiert funktioniert, ist jedoch tendenziell eine Mengenausweitung zu befürchten, wenn zu den bestehenden ca. 120 öffentlichen Apotheken auch Arztpraxen als Medikamentenverkaufsstellen ("Privatapotheken") hinzukommen würden. Zurzeit hat es im Kanton Aargau rund 800 Arztpraxen. Das KVG enthält Bestimmungen, die in Richtung der Aargauer Regelung gehen (Art. 37 KVG). Auch die Gerichte (Verwaltungsgericht, Bundesgericht) haben die Aargauer Regelung bis anhin immer klar geschützt. Ein Vergleich der Situation in den einzelnen Kantonen präsentiert sich wie folgt: SD-Verbot: SD-Freigabe: Mischsystem: Aargau; Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Tessin, Waadt, Wallis Basel-Landschaft, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Luzern, Obwalden, Nidwalden, St. Gallen, Schwyz, Thurgau, Uri, Zug Bern, Graubünden, Schaffhausen, Zürich Die santésuisse hat sich in einem Positionspapier vom Mai 2004 nicht klar für das eine oder andere System ausgesprochen. Tendenziell werden dem SD-Verbot jedoch Vorteile zugestanden. Befürwortet wird ein wettbewerblich organisiertes Gesundheitswesen, weshalb die Bevorzugung des einen oder anderen Vertriebskanals als nicht adäquat angesehen wird. Die SD-Freigabe wird nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern es wird gefordert, dass die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte an klare Auflagen geknüpft werde (Öffnungszeiten der Arztpraxen, Sortimentsbreite, Weitergabe von Vergünstigungen, Qualitätssicherung, Förderung der Generikaabgabe, Sicherstellung der Patientenwahlfreiheit). Der Bundesrat hat in einer Interpellationsbeantwortung vom 21. Mai 2003 festgehalten, der Vertriebskanal über die Apotheken (SD-Verbot) sei mit Blick auf das Ziel der Kosteneinsparung zu bevorzugen. In Europa gilt im Übrigen fast ausnahmslos das System des Selbstdispensationsverbots. Ein System, wo Ärzte Medikamente abgeben, stellt somit eine schweizerische Eigenheit dar. Ein Bericht von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Organisation für wirtschaftliche - 22 - Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr 2006 empfiehlt der Schweiz aufgrund internationaler Erfahrungen ein Verbot der Selbstdispensation. 3. Ergebnisse der Vernehmlassung und daraus resultierende Umsetzungsvorschläge 3.1 Allgemeines Die Vernehmlassungsfrist dauerte vom 14. September 2007 bis zum 14. Dezember 2007. Neben dem Vernehmlassungsbegleitbericht und dem Gesetzestext wurde ebenfalls ein Fragebogen in die Vernehmlassung gegeben, der die wichtigsten Themen aus dem Gesundheitsgesetz abbildete. Insgesamt wurden ca. 500 Adressatinnen und Adressaten angeschrieben, darunter insbesondere die Parteien, die Gemeinden, Berufsverbände im Gesundheitswesen, Organisationen und Institutionen im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Von den Parteien haben sich die CVP, die EVP, die FDP, die Grünen, die SP sowie die SVP geäussert. Von den angeschriebenen 229 Gemeinden haben sich 133 geäussert, wobei sich davon rund die Hälfte der Vernehmlassung eines Verbands (zum Beispiel Aargauischer Gemeindeschreiberverband, Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau) angeschlossen hat. Von den Berufsverbänden im Gesundheitswesen sind zahlreiche Vernehmlassungen, insbesondere zum vorgesehenen Wechsel im Berufszulassungssystem, eingegangen. Insgesamt sind mehr als 200 Vernehmlassungen eingetroffen. Zahlreiche Vorschläge und Anregungen der Vernehmlassenden wurden in der Überarbeitung berücksichtigt. 2/3 der Vernehmlassenden findet das neue Gesundheitsgesetz gut. Insbesondere die neuen Massnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge wie Alkohol- und Tabakprävention sowie Passivrauchschutz werden begrüsst. 3.2 Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden Den Vorschlägen für eine Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden wurden von allen Parteien mit vereinzelten Vorbehalten zugestimmt. Bei den Gemeinden stiessen sie dagegen mehrheitlich auf Ablehnung. Kritisiert wurden im Wesentlichen die folgenden Punkte: Aufgabe der Gemeinden zur Unterstützung des Kantons bei der Erhebung von Gesundheitsdaten; Verantwortung der Gemeinden für Einrichtungen der Überlebenshilfe, Tagesstrukturen und Arbeitsprojekte im Bereich der Suchthilfe; Verzicht auf kantonale Vorgaben für den in der Zuständigkeit der Gemeinden liegenden Bereich der Mütter- und Väterberatung; Zuständigkeit der Gemeinden zur Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige; Verzicht auf kantonale Grundzüge für das in der Zuständigkeit der Gemeinden liegende Bestattungswesen. - 23 - Im Rahmen der Überarbeitung wurde den Anliegen der Gemeinden weitgehend Rechnung getragen. Dies führte zu folgenden Anpassungen: In § 2 Abs. 3 GesG-E wurde die Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung des Kantons bei der Erhebung von Gesundheitsdaten gestrichen, nachdem in § 3 Abs. 1 lit. a GesG-E bereits eine allgemeinen Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung des Kantons beim Vollzug des Gesundheitsgesetzes verankert ist. Gestrichen wurde auch die Verantwortung der Gemeinden, für Einrichtungen der Überlebenshilfe, Tagesstrukturen und Arbeitsprojekte im Bereich der Suchthilfe zu sorgen (ehemals § 36 Abs. 3). Dies deshalb, weil davon ausgegangen werden kann, dass die Massnahmen des Sozialhilfe- und Präventionsgesetzes (SPG; SAR 851.200) auch für suchtmittelabhängige Personen eine ausreichende Grundlage bieten. Im Bereich Mütter- und Väterberatung wurde – entsprechend dem Anliegen vieler Gemeinden – eine Ergänzung ("durch qualifiziertes Fachpersonal") aufgenommen, die einen gewissen einheitlichen Qualitätsstandard der Mütter- und Väterberatung im gesamten Kanton gewährleistet (vgl. § 3 Abs. 1 lit. b). Als Gemeindeaufgabe beibehalten werden soll dagegen die Durchführung von Testkäufen im Bereich Alkohol und Tabak (§ 37 Abs. 4). Aus dem Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken (Gastgewerbegesetz [GGG]; SAR 970.100) geht hervor, dass die Gemeinden bereits heute für Testkäufe im Bereich Alkohol zuständig sind. Eine geteilte Zuständigkeit für Alkohol und Tabak erscheint nicht sinnvoll, ansonsten sich bei der Durchführung ergebende Synergien nicht genutzt werden können. Im Übrigen sind Testkäufe auch ein Mittel um den strafrechtlichen Vollzug der Verkaufsverbote (Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken an unter 16-Jährige sowie von Spirituosen an unter 18-Jährige, Verkaufsverbot von Tabakwaren an unter 16-Jährige [vgl. § 37]) durchzusetzen und stellen daher eine verwaltungspolizeiliche Aufgaben dar, die gemäss Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit vom 6. Dezember 2005 (Polizeigesetz [PolG]; SAR 531.200) und dem Dekret über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Polizeidekret; SAR 531.210) in die Zuständigkeit der Gemeinden fallen (vgl. insbesondere § 4 Abs. 1 lit. a, letztes Alinea des Polizeidekrets: "Kontrolle der gesundheitspolizeilichen Aufgaben als verwaltungspolizeiliche Aufgabe der Gemeinden"). Das neu aufgenommene Abgabeverbot alkoholischer Getränke an nicht kaufsberechtigte Jugendliche (vgl. Ziffer 3.1.3.4) sowie der Verstoss gegen das Rauchverbot (vgl. § 55) sollen im Vollzug ebenfalls den Gemeinden übertragen werden, da es sich auch bei diesen Massnahmen ausschliesslich um Aufgaben handelt, die in die Kompetenz der Polizeikräfte der Gemeinden fallen. Die übrigen Verwaltungsaufgaben im Bereich Passivrauchschutz sollen hingegen vom Kanton wahrgenommen werden. Um den Gemeinden den Vollzug des Abgabe- und Rauchverbots zu erleichtern, sollen Widerhandlungen gegen diese Verbote soweit möglich im Ordnungsbussenverfahren abgewickelt werden. Die Bussenerträge können von den Gemeinden vereinnahmt werden. Im Bereich Bestattungswesen (§ 48) wurde – ebenfalls auf Wunsch der Gemeinden – vom Grundsatz einer konsequenten Aufgabenteilung insofern abgewichen, als der Kanton gewisse gesundheitspolizeilich relevante Grundsätze des Bestattungswesens für das gesamte Kantonsgebiet einheitlich zu regeln hat. - 24 - 3.3 Liberalisierung der Berufszulassung (§§ 4–27 GesG-E) Vorgeschlagen wurde der Wechsel vom bisher geltenden diplomorientierten Modell zum so genannten tätigkeitsspezifischen Modell bei der Berufszulassung. Demnach sollen neu Tätigkeiten definiert werden, welche aus gesundheitspolizeilichen Überlegungen (so insbesondere Medizinalberufe, KVG-Berufe und Tätigkeiten mit besonderem Gefährdungspotential) eine kantonale Bewilligung benötigen. Damit verbunden war die grundsätzliche Freigabe von alternativen Heilmethoden, womit die Ausübung aller nicht der Schulmedizin verpflichteten Berufe bewilligungsfrei möglich wird. Diese Liberalisierung wurde in der Vernehmlassung unterschiedlich aufgenommen. Von den politischen Parteien haben die SVP, die FDP und die SP zustimmend, die CVP, die Grünen und die EVP ablehnend Stellung bezogen. Der Aargauische Ärzteverband hat dem Vorschlag ebenfalls zugestimmt. Ablehnung geäussert haben primär die Berufsverbände im naturheilkundlichen Sektor. Vorbehalte wurden primär in folgenden Bereichen geäussert: Patientensicherheit, Gefährdungspotential; fehlende Transparenz ohne Bewilligungs- beziehungsweise Zulassungsregelung für Patientinnen und Patienten; Entwicklungen in Ausbildung und Strukturen im Bereich der so genannten KomplementärTherapie (KT) und der so genannten AlternativMedizin (AM). Im Rahmen der Überarbeitung wurden die Anliegen geprüft und es wurde eine Anpassung vorgenommen. Viele der praktizierten alternativen Verfahren und Methoden sind in ihrer Heilwirkung weder wissenschaftlich erforscht, belegt noch erfassbar. Dies erschwert die für eine reglementierte staatliche Zulassung zu umschreibenden Voraussetzungen massiv. Ebenfalls ist die Methodenvielfalt enorm. In Anerkennung der Bedenken und Anregungen aus der Vernehmlassung wird neu die Tätigkeit im Bereich Komplementärmedizin dann einer Bewilligungspflicht unterstehen, wenn der Beruf mit einem eidgenössisch anerkannten Diplom geregelt ist. Unter Federführung des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat in den letzten Jahre eine sogenannte Koordinationskommission Komplementärtherapien und Alternativmedizin (KoKo) unter Einbezug von Vertreterinnen und Vertretern der Berufsverbände der Komplementärmedizin, der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der Swissmedic an der Schaffung von eidgenössisch anerkannten Abschlüssen in der Komplementärmedizin gearbeitet. Es entstanden dabei zwei Projekte, je eine höhere Fachprüfung für Komplementärtherapien und Alternativmedizin, welche mit einem eidgenössischen Diplom abschliessen sollen. Der Bundesrat hat Mitte 2007 die Projektarbeiten zur eidgenössischen Reglementierung und Anerkennung dieser Berufe bis zur Volksabstimmung zur Initiative "Ja zur Komplementärmedizin" sistiert. Dies in der Meinung, dass die Reglementierung der nichtärztlichen Alternativmedizin im Zusammenhang mit dem Abstimmungsergebnis der Volksinitiative beurteilt werden soll. - 25 - Mit der nun getroffenen Lösung (§ 4 Abs. 1 lit. g GesG-E) wird zukunftsgerichtet legiferiert. Bei Vorliegen eines eidgenössischen Diploms in einem Bereich der Komplementärmedizin wird der Beruf beziehungsweise die Tätigkeit wie aus den Vernehmlassungsergebnissen gewünscht einer Bewilligungspflicht unterstellt und damit gesundheitspolizeilich normiert. Dabei sind unter der Begrifflichkeit "Komplementärmedizin" – Stand Wissen zum Zeitpunkt der Gesetzeserarbeitung – insbesondere die sich aufgrund der Vorarbeiten in der KoKo abzeichnenden Berufe "Komplementärtherapie" und "Alternativmedizin" zu verstehen. Zusätzlich wird es die bewilligungsfreien Berufe und Tätigkeiten, die ausserhalb der anerkannten Wissenschaften im Rahmen von § 4 GesG-E ohne staatliche Reglementierung und Bewilligung frei tätig sein dürfen, geben. Zentral und unabdingbar notwendig bei dieser Regelung ist eine umfassende und konstante Information der Bevölkerung über das tätigkeitsspezifische System, die Zulassungen sowie die Eigenverantwortung jeder Patientin beziehungsweise jedes Patienten. Diese müssen wissen, welche Berufe bewilligungspflichtig sind und damit indirekt mit einer gewissen „staatlichen Qualitätsgarantie“ verbunden sind und welche Tätigkeiten und Berufe ohne staatliche Kontrolle frei ausgeübt werden. Ebenso unabdingbar mit dieser Regelung verbunden sind eine Stärkung der Aufsicht und ein adäquates Sanktionensystem. Diese Lösung steht auch im Einklang mit den Empfehlungen der GDK vom November 2000 und wird in anderen Kantonen zum Teil bereits seit einigen Jahren gelebt. In diesen Kantonen wird seit Einführung keine Zunahme von Gesundheitsgefährdungen etc. festgestellt. 3.4 Massnahmen der Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz 3.4.1 Werbung im Bereich Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 1 GesG-E) Die Vernehmlassungen zu den vorgeschlagenen Werbeeinschränkungen in den Bereichen Tabak (Werbeverbot auf öffentlichem Grund beziehungsweise auf privatem, einsehbarem Grund) und Alkohol (nur produktebezogene Werbung) fielen unterschiedlich aus. Eine grosse Mehrheit, so auch alle Parteien, hat sich für ein Werbeverbot für Tabakwaren ausgesprochen. Im Bereich Alkohol wurde die vorgeschlagene Werbeeinschränkung dagegen eher abgelehnt (so zum Beispiel von FDP und SVP). Von bürgerlicher Seite wurde eingebracht, dass die vorgeschlagenen Regelungen stark in die Wirtschaftsfreiheit eingreifen würden. Einige Befürworter (unter anderem SP, EVP und Grüne) forderten demgegenüber ein totales Werbeverbot sowohl im Bereich Tabak als auch für Alkohol. Vorbehalte wurden vor allem in Bezug auf die offenen Formulierungen und die daraus resultierenden grossen Entscheidungsspielräume der Verwaltungsbehörden geäussert. Es wurde auch die Vollzugstauglichkeit der vorgeschlagenen Massnahmen in Frage gestellt. Mehrere Vernehmlasser sprachen sich für eine Angleichung der Regelungen für Alkohol und Tabakwaren aus. Vereinzelt wurde im Bereich Alkohol eine Differenzierung zwischen Spirituosen und niederprozentigen alkoholischen Getränken gefordert. Mit einem neuen Vorschlag wird den in der Vernehmlassung geäusserten Bedenken Rechnung getragen. Der überarbeitete Vorschlag sieht ein Verbot für grossflächige Werbung für Tabakwaren und alkoholische Getränke wie beispielsweise Plakat-, Kino- oder Bandenwerbung vor. Dies führt zu einer einheitlichen Regelung mit grösserem Bestimmtheitsgrad und somit zu einer Vereinfachung im Vollzug. Der Forderung, nur - 26 - Spirituosen einer Werbeeinschränkung zu unterstellen, konnte nicht entsprochen werden, weil die gesundheitliche Gefährdung grundsätzlich nicht von der Herstellungsweise abhängig ist, sondern ausschliesslich von der Menge des Konsums in Relation zum Alter und zum Körpergewicht. Ziel der Werberestriktion ist es, dass Jugendliche generell nicht zum Alkoholkonsum veranlasst werden (Jugendschutz). Ein totales Werbeverbot wird hingegen als ein zu weitgehender Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit beurteilt und deshalb abgelehnt. 3.4.2 Verkaufsverbot von Tabakwaren an unter 16-Jährige (inklusive Automaten; § 37 Abs. 2 und 3 GesG-E) Der Vorschlag für ein Verkaufsverbot von Tabakwaren an Jugendliche unter 16 Jahren (inklusive Automaten) fand grossmehrheitlich Zustimmung (so auch alle Parteien). Von verschiedener Seite wurde allerdings die Forderung nach einer Erhöhung der Alterslimite auf 18 Jahren gestellt (zum Beispiel EVP). Vereinzelt wurde zudem ein generelles Verbot von Automaten verlangt. Am vorgeschlagenen Verkaufsverbot soll daher festgehalten werden. Aufgrund des klaren Vernehmlassungsresultats soll die Altersgrenze von 16 Jahren beibehalten werden. In Bezug auf den Verkauf von Tabakwaren durch Automaten wurde in der Vernehmlassung vor allem eingewendet, eine zuverlässige technische Umrüstung der Automaten sei nicht möglich, so dass nicht gewährleistet werden könne, dass Jugendliche keine Tabakwaren mehr durch Automaten beziehen würden, weshalb der Verkauf durch Automaten gänzlich zu verbieten sei. Dies widerspricht jedoch den Erfahrungen in verschiedenen anderen Kantonen. So sind in den Kantonen Graubünden, Luzern und Waadt seit diesem Jahr gleichlautende Verkaufseinschränkungen bereits in Kraft, wobei der Vollzug (Bezug nur mit Jetons) problemlos verläuft. Auch um nicht zu stark in die Wirtschaftsfreiheit einzugreifen, wird am Vernehmlassungsvorschlag festgehalten. 3.4.3 Testkäufe im Bereich Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 4 GesG-E) Der Vorschlag zur Durchführung von Testkäufen im Bereich Alkohol und Tabak fand mehrheitlich Zustimmung. Es gab hierzu vereinzelte Vorbehalte grundsätzlicher Natur (FDP, Grüne). Kritisiert wurde dabei vor allem der Einsatz von Jugendlichen und die Förderung des Denunziantentums als Folge dieser Regelung. Des Weiteren wurde auch die Forderung nach kantonalen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Testkäufen gestellt (zum Beispiel SVP). Aufgrund dieses Resultats wird sowohl an Testkäufen im Bereich Alkohol als auch im Bereich Tabak festgehalten. Um den oben erwähnten Vorbehalten Rechnung zu tragen, eine gewisse Einheitlichkeit und Qualität in der Durchführung herbeizuführen und eine möglichst grosse Gleichbehandlung der getesteten Verkaufsstellen zu gewährleisten erlässt der Regierungsrat dazu Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe. - 27 - 3.4.4 Abgabeverbot von alkoholischen Getränken an nicht kaufsberechtigte Jugendliche (§ 37 Abs. 5 GesG-E) Einzelne Vernehmlasser (zum Beispiel EVP, Gemeinden, Blaues Kreuz, Aargauische Stiftung Suchthilfe) forderten als zusätzliche Massnahme ein Verbot der Weitergabe von Alkohol und Tabakwaren an nicht kaufsberechtigte Jugendliche. Die (07.204) Motion Adrian Schoch vom 28. August 2007 betreffend Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, um die Weitergabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche zu unterbinden, zielt in die gleiche Richtung. Nach geltendem Recht ist der Verkauf von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren sowie der Verkauf von Spirituosen an unter 18-Jährige zwar verboten. Kauft eine ältere Person legal Alkohol und gibt diesen im Anschluss an nicht kaufsberechtigte Jugendliche ab, können die Bestimmungen zum Schutz der betroffenen Jugendlichen jedoch umgangen werden. Um Gewaltexzesse zu verhindern und eine möglichst umfassende Prävention zu gewährleisten, wird der Forderung nach einer gesetzlichen Regelung Rechnung getragen. Indem eine weitverbreitete Umgehungshandlung verboten wird, soll ausserdem ein konsequenter Vollzug der Verkaufsverbote herbeigeführt werden. Ziel ist es auch, die Motivation des Verkaufspersonals zu stärken, damit diese die bestehenden Verkaufsverbote tatsächlich umsetzen. Im neuen Gesundheitsgesetz soll daher die Abgabe von alkoholischen Getränken an unter 16-Jährige sowie die Abgabe von Spirituosen an unter 18-Jährige verboten werden (vgl. dazu auch die Ausführungen zur begrifflichen Definition unter Kapitel 4 zu § 37 Abs. 5). Da die Gewaltausübung insbesondere mit dem Alkoholkonsum in Zusammenhang steht, soll auf eine entsprechende Regelung im Bereich Tabak verzichtet werden. 3.4.5 Passivrauchschutz (§ 38 GesG-E) Im Kanton Aargau wurden im Bereich Passivrauchschutz zwei Varianten (1 und 2)* in die Vernehmlassung gegeben. Beide sehen ein generelles Rauchverbot in öffentlich zugänglichen Räumen vor. Eine Ausnahme vom Verbot gilt in abgetrennten, genügend belüfteten und besonders gekennzeichneten Räumen. Variante 2 sieht im Bereich Gastronomie eine weitere Ausnahme vor: Auf Bewilligung hin soll das Führen von Raucherbetrieben möglich sein, wenn eine räumliche Trennung von Raucher- und Nichtraucherräumen nicht möglich oder zumutbar ist. Mit Ausnahme der Regelung im Bereich Arbeitsschutz entspricht die in die Vernehmlassung gegebene Variante 1 grundsätzlich dem ständerätlichen Vorschlag vom 4. März 2008, die Variante 2 dem Vorschlag des Nationalrats vom 4. Oktober 2007. Von den politischen Parteien haben sich die SP, die CVP, die Grünen und die EVP für die Variante 1 ausgesprochen. Die FDP bevorzugt (aufgrund der damals im Ständerat beschlossenen Fassung) die Variante 2. Die SVP spricht sich für eine offene Lösung der Selbstverantwortung aus. Bei den Gemeinden und bei den verschiedenen Verbänden ist eine Mehrheit für die Variante 1. GastroAargau, die Aargauische Industrie- und Handelskammer und die Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau sprachen sich für Variante 2, insbesondere aber für eine gesamtschweizerische Regelung aus. - 28 - Verschärfend wurde die Forderung gestellt, dass im Interesse des Arbeitnehmerschutzes in der Gastronomie nur unbediente Raucherräume zulässig sein sollen (unter anderem SP, EVP, Lungenliga Aargau, Krebsliga Aargau, vpod aargau). Aufgrund der Vernehmlassung und angesichts der Tatsache, dass im Moment noch nicht feststeht, in welche Richtung eine Bundeslösung zielen wird, auf welchen Zeitpunkt die Inkraftsetzung einer solchen zu erwarten ist und ob einer weitergehenden kantonalen Regelung neben dem Bundesgesetz noch selbstständige Bedeutung zukommen wird, soll vorderhand an den beiden vorgeschlagenen Varianten festgehalten werden. Im Hinblick auf die 2. Beratung sollte die Stossrichtung beim Bund bekannt sein. * Die Benennung der beiden Varianten als "Variante 1" und "Variante 2" bedeutet keine Priorisierung von Variante 1. 3.5 Versorgungssicherheit (§§ 39–41 GesG-E) Das Kapitel Versorgungssicherheit für den ambulanten Bereich enthielt im Wesentlichen folgende Vorschläge: Sicherstellung des ambulanten Notfalldiensts durch eine Notfalldienstpflicht der Medizinalberufe; Organisation des ambulanten Notfalldiensts durch die Berufsverbände; Massnahmen zur Koordination zwischen dem ambulanten und stationären Notfalldienst; Koordination der sanitätsdienstlichen Transporte durch die kantonale Notrufzentrale; Massnahmen zur Förderung der ärztlichen Grundversorgung. Diese Vorschläge fanden in der Vernehmlassung eine recht breite Zustimmung. Forderungen unter anderem auch von politischen Parteien (CVP, FDP, Grüne) zielen darauf ab, die Massnahmen zur Förderung der ärztlichen Grundversorgung zu verstärken, um der sich abzeichnenden Entwicklung (Rückgang der Hausarztpraxen) wirksam begegnen zu können (gesetzliche Pflicht zum Einsatz finanzieller Mittel, so zum Beispiel entgeltlicher Leistungsauftrag an den Aargauischen Ärzteverband für die Organisation des Notfalldiensts; Übernahme von erfolglos betriebenen Honorarforderungen aus der Notfalldiensttätigkeit). Die Absichten des Regierungsrats gehen in die gleiche Richtung. Allerdings möchte der Regierungsrat keine gesetzliche Verpflichtung zum Einsatz finanzieller Mittel zur Förderung der Grundversorgung, sondern eine Kann-Formulierung, um bei allfälligen Veränderungen der Verhältnisse einen entsprechenden Handlungsspielraum zu haben. 3.6 Suizidhilfe Mit der Vernehmlassungsfassung wurde aufgrund der damaligen aktuellen Beurteilung vorgeschlagen, auf Bestimmungen zur Suizidhilfe – zumindest für den Moment – zu verzichten. Was allfällige Regelungen bezüglich Aufsicht über Suizidhilfeorganisationen betraf, wollte man die Entwicklungen auf Bundesebene abwarten. Hingegen wurde mittels Fremdänderung in der Strafprozessordnung eine Rechtsgrundlage für die Überwälzung der strafprozessualen Untersuchungskosten auf Sterbehelfende geschaffen. Auf den vorgeschlagenen Verzicht auf eine kantonale Regelung der Suizidhilfe im GesG-E reagierten drei Parteien (SVP, FDP, EVP) mit der Forderung nach einer gesetzlichen Regelung. Dies zum Teil mit dem Hinweis auf eine fehlende Bundesregelung und die Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit. Die SVP erachtete eine vernünftige und klare - 29 - Regelung als erforderlich, während die FDP eine Bewilligungspflicht für Sterbehilfeorganisationen anregte. Die EVP bevorzugte ein Verbot der Suizidhilfe. Die Bezirksamtmännerkonferenz wünscht einlässliche Vorschriften (zum Beispiel Bewilligungspflicht für Suizidhilfeorganisationen; Verabreichung der letalen Medikation nur durch und unter Aufsicht einer Medizinalperson) für den gesamten Bereich der Suizidhilfe. Im Rahmen der Überarbeitung wurden diese Anliegen im Zusammenhang mit den tatsächlichen Entwicklungen im Kanton Aargau und den aktuellen politischen Bestrebungen auf Bundesebene geprüft. Der Regierungsrat ist nach wie vor der Meinung, dass ein eigentlicher Handlungsbedarf für eine Regelung der Suizidhilfe aufgrund der bereits bestehenden Instrumente und der aktuellen Entwicklung nicht bestehe (vgl. Stellungnahme des Regierungsrats vom 26. März 2008 zur [07.303] Standesinitiative der EVP-Fraktion betreffend Änderung von Art. 115 StGB zwecks Verhinderung des Sterbetourismus). Seit 2005 findet im Kanton Aargau kein ausländischer Suizidhilfetourismus mehr statt. Aktuell sind beim Bund mehrere parlamentarische Vorstösse hängig, die demnächst in der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats zur Behandlung kommen sollten. Inhaltlich streben diese Vorstösse eine bundesgesetzliche Regelung der Suizidhilfe an (insbesondere Aufsicht; Vermeidung interkantonaler Suizidhilfetourismus; Änderung von Art. 115 StGB, womit Suizidhilfe an Personen aus dem Ausland nicht mehr zulässig wäre). Im kantonalen Verfahren befinden sich zwei Standesinitiativen (Aargau und Zürich), welche ebenfalls eine Anpassung von Art. 115 StGB im eben erwähnten Sinne fordern. In dieser Ausgangslage werden vorerst die weiteren Entwicklungen auf Bundesebene abgewartet. Die vorgeschlagene Fremdänderung der aargauischen Strafprozessordnung (StPO) bezüglich der Kostenauflage an Suizidhelfende (neuer § 139 Abs. 3bis) gab in der Vernehmlassung zu keinen Diskussionen Anlass und wird somit unterstützt. Mit Blick auf die neue eidgenössische Strafprozessordnung (voraussichtliches Inkrafttreten: 1. Januar 2010) besteht hierzu allerdings noch Abstimmungsbedarf. 3.7 Medikamentenabgabe (§ 45 GesG-E) Der Vorschlag, die bisherige Regelung im Bereich der Medikamentenabgabe unverändert weiterzuführen, stiess auf grossmehrheitliche Zustimmung. Damit befürwortet eine überwiegende Mehrheit die Weiterführung des Systems, wonach Ärztinnen und Ärzte (mit kleineren Ausnahmen wie zum Beispiel im Notfall) grundsätzlich zu rezeptieren haben und die Medikamentenabgabe primär durch die öffentlichen Apotheken erfolgt. Lediglich vereinzelte Vernehmlassende sowie der Aargauische Ärzteverband fordern die Freigabe der Medikamentenabgabe. Als Begründung wird im Wesentlichen die Freiheit der Patientin beziehungsweise des Patienten bei der Wahl der Medikamentenabgabestelle sowie der Verzicht auf einen Standesschutz der Apotheken angeführt. Aufgrund dieser deutlichen Rückmeldung aus der Vernehmlassung wird aus den bereits einlässlich dargelegten Gründen (vgl. Ziffer 2.2.6) am bisherigen System des grundsätzlichen Selbstdispensationsverbots festgehalten. - 30 - 3.8 Weitere Vernehmlassungsergebnisse Die Grünen fordern mit ihrer Vernehmlassung die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für so genannte Gesundheitsstützpunkte und nehmen dabei Bezug auf die als Postulat überwiesene (02.184) Motion Geri Müller vom 4. Juni 2002, welche bei dieser Gelegenheit umgesetzt werden könnte. Gesundheitsstützpunkte werden definiert als "niederschwellige, interdisziplinäre Anlaufstellen mit einer Konzentration von Fachwissen und -erfahrung in verschiedenen Gesundheitsbereichen, wo in einem 24-Stunden-Dienst unter anderem Pflegende (Spitex, Spitin), Suchtberatung, Elternberatung, Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Apothekerinnen und Apotheker, Sozialarbeitende etc. arbeiten". Gesundheitsstützpunkte sollen in bestehende Strukturen (Arztpraxis, Pflegeheim, etc.) integriert werden können. Abgesehen davon, dass die als Postulat überwiesene (02.184) Motion Geri Müller mit Beschluss des Grossen Rats vom 4. Juli 2006 zum Rechenschaftsbericht 2005 abgeschrieben wurde mit der Begründung, dass die strategische Ausrichtung in der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) festgelegt und vom Grossen Rat genehmigt wurde (vgl. Rechenschaftsbericht 2005, Seite 100), lehnt der Regierungsrat diesen Vorschlag ab. Die ambulante Versorgung soll dabei ohne staatliche Lenkungsmassnahmen grundsätzlich dem Prinzip von Angebot und Nachfrage unterliegen (vgl. Strategie 11 der GGpl). Es gibt im Übrigen bereits heute gewisse Arten von Gesundheitsstützpunkten (zum Beispiel HMO-Praxen) mit einem interdisziplinären Angebot (vgl. Art. 35 Abs. 2 lit. e KVG). Die Grünen schlagen zudem die Einführung einer Gesundheitsverträglichkeitsprüfung vor. Diese soll – analog der Umweltverträglichkeitsprüfung – dafür sorgen, dass Grossprojekte jeglicher Art unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit im Sinne der Prävention beurteilt werden, wobei die entsprechenden Vorgaben, Indikatoren und Messgrössen durch den Kanton gemeinsam mit entsprechenden Fachstellen zu entwickeln wären. Der Regierungsrat lehnt diesen Vorschlag ab. Er geht davon aus, dass vorab im Bauwesen genügende Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung bestehen (vgl. § 52 Abs. 2 des Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen [Baugesetz, BauG] vom 19. Januar 1993: "Alle Gebäude müssen den Anforderungen des Gesundheitsschutzes entsprechen, namentlich in Bezug auf Raum-, Wohnungs- und Fenstergrössen, Besonnung, Belichtung, Belüftung, Trockenheit, Wärmedämmung und Schallschutz"). - 31 - 4. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 1. Allgemeines § 1 (Zweck) Abs. 1 In § 1 Abs. 1 GesG-E werden vier zentrale Zwecke genannt, welche das Gesundheitsgesetz verfolgt: Gesundheitsvorsorge (Prävention); Schutz der Gesundheit der Bevölkerung; Förderung der Gesundheit der Bevölkerung; Wiederherstellung der Gesundheit der Bevölkerung. Die Zweckumschreibung mit diesen vier Aspekten wird jedoch insofern in Relation gestellt, als die Eigenverantwortung des einzelnen Menschen dabei eine zentrale Rolle spielt. Damit soll verhindert werden, dass Prävention, Schutz, Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit nicht einseitig in den Verantwortungsbereich des Staats übertragen wird. In gleicher Weise liegt es in der Verantwortung der einzelnen Person, einen Beitrag an die eigene Gesundheit zu leisten. Abs. 2 § 1 Abs. 2 GesG-E statuiert als weiteren zentralen Zweck des Gesundheitsgesetzes die Förderung der Zusammenarbeit und die Vernetzung der im Gesundheitswesen beteiligten Partner. Damit sollen Synergien geschaffen werden, die dazu führen, die Qualität des Gesundheitswesens unter wirtschaftlichem Einsatz der Mittel zu erhalten und wo nötig zu optimieren. 2. Organisation und Zuständigkeiten § 2 (Kanton) Abs. 1 Im Gegensatz zum heutigen Recht soll auf eine Aufzählung der verschiedenen kantonalen Gesundheitsbehörden (vgl. §§ 3–13 GesG-1987) verzichtet werden. Stattdessen wird der Regierungsrat durch Verordnung die kantonalen Gesundheitsbehörden bezeichnen, deren Organisation regeln sowie die Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen der kantonalen Gesundheitsbehörden im Detail bestimmen (§ 2 Abs. 1 GesG-E). Dazu gehören im Wesentlichen das Departement Gesundheit und Soziales mit seinen Abteilungen, der Kantonsarzt und die nebenamtlichen Amtsärztinnen und Amtsärzte, die Kantonsapothekerin mit den Apotheken- und Drogerieinspektorinnen und Drogerieinspektoren, der (nebenamtliche) Kantonszahnarzt, die Kantonstierärztin mit den nebenamtlichen Amtstierärztinnen und Amtstierärzten sowie den Organen der Fleischkontrolle, der Kantonschemiker mit den Organen der Lebensmittelkontrolle und die kantonale Ethikkommission. - 32 - Abs. 2 Wie bereits unter geltendem Recht leitet und überwacht das zuständige Departement (Departement Gesundheit und Soziales) das öffentliche Gesundheitswesen (§ 2 Abs. 2 GesG-E). Abs. 3 Aufgabe des Kantons ist es zudem, für eine ausreichende Grundlage an Gesundheitsdaten zu sorgen (§ 2 Abs. 3 GesG-E). Auf die ursprünglich vorgesehene Pflicht der Gemeinden, den Kanton bei dieser Aufgabe zu unterstützen, wurde nach erheblicher Kritik in der Vernehmlassung verzichtet. Dies schliesst nicht aus, dass die Gemeinden im Rahmen von § 3 Abs. 1 lit. a GesG-E dem Kanton bei Bedarf Hilfestellung im Vollzug leisten. Selbstverständlich besteht ein Bedürfnis nach Daten nur insoweit, als nicht der Bund ("eidgenössische Gesundheitsstatistik") über diese bereits verfügt. Da Gesundheitsdaten als besonders schützenswerte Daten gelten (vgl. Art. 3 lit. c Ziffer 2 des Bundesgesetzes über den Datenschutz [DSG] vom 19. Juni 1992; SR 235.1), sollen diese nur soweit erhoben werden könne, als sie zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben erforderlich sind. § 3 (Gemeinden) Die Gemeinden haben im Vollzugsbereich der Gesundheitsgesetzgebung nur vereinzelte Aufgaben. § 3 GesG-E fasst diese in der Übersicht zusammen. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufgaben, die bereits nach dem geltenden Recht von den Gemeinden wahrgenommen werden. Abs. 1 Zu den Aufgaben der Gemeinden gehören einerseits die im Katalog von § 3 Abs. 1 lit. a–c GesG-E aufgeführten Aufgaben, andererseits die weiteren im GesG-E explizit genannten Aufgaben (§ 37 Abs. 4, § 48 GesG-E). Bei der Aufgabenzuteilung wurde darauf geachtet, die anerkannten Grundsätze der Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden (vgl. § 2 GAT I; SAR 691.100) umzusetzen. Die Aufgaben der Gemeinden sind im Einzelnen die Folgenden: Vollzugsunterstützung Mit § 3 Abs. 1 lit. a GesG-E wird als allgemeine Aufgabe der Gemeinden die Pflicht zur Unterstützung des Kantons beim Vollzug des Gesundheitsgesetzes statuiert, sofern der Kanton auf die Mithilfe der Gemeinden angewiesen ist. Mütter- und Väterberatung Mit § 3 Abs. 1 lit. b GesG-E sind die Gemeinden – wie bisher – zuständig für die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Bereich Mütter- und Väterberatung. Ein bedarfsgerechtes und qualitativ gutes Angebot im Bereich Mütter- und Väterberatung wird von der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden als wichtig erachtet und es wurde deshalb in der Vernehmlassung das Anliegen nach einem einheitlichen professionellen Angebot im gesamten Kanton geäussert. Mit der Ergänzung "durch qualifiziertes Fachpersonal" wurde diesem Wunsch nach gewissen kantonalen Qualitäts-Vorgaben – trotz gewisser Bedenken in Bezug auf die Grundsätze der Aufgabenteilung – Rechnung getragen. Als qualifizierte - 33 - Fachperson gelten Personen, die den Abschluss "HöFa Mütter- und Väterberatung" besitzen. Pilzkontrolle § 3 Abs. 1 lit. c GesG-E überträgt die Organisation und Durchführung der Pilzkontrolle den Gemeinden. Der Kanton wird – wie bis anhin – seine Mithilfe im Bereich der Weiterbildung der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure anbieten. Vollzug Tabak- und Alkoholprävention In § 37 Abs. 4 GesG-E wird die Zuständigkeit der Gemeinden für Testkäufe durch Minderjährige im Bereich Tabak und Alkohol verankert. Die Zuständigkeit für Testkäufe im Bereich alkoholischer Getränke liegt bereits nach geltendem Recht bei den Gemeinden, weil sie für den Vollzug der Gastgewerbegesetzgebung zuständig sind (vgl. § 25 der Gastgewerbeverordnung [GGV]; SAR 970.111). Eine geteilte Zuständigkeit für Alkohol und Tabak erscheint nicht sinnvoll, ansonsten sich bei der Durchführung ergebende Synergien nicht genutzt werden können. Zudem sind Testkäufe auch ein Mittel um den strafrechtlichen Vollzug der Verkaufsverbote (Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken an unter 16Jährige sowie von Spirituosen an unter 18-Jährige, Verkaufsverbot von Tabakwaren an unter 16-Jährige [vgl. § 37]) durchzusetzen und stellen daher eher verwaltungspolizeiliche Aufgaben dar. Im Übrigen sind die Kontrolle von gesundheitspolizeilichen Vorschriften sowie die Bearbeitung bei Übertretungen solcher Bestimmungen gemäss § 4 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Abs. 2 des Dekrets über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Polizeidekret; SAR 531.210) verwaltungspolizeiliche Aufgaben der Gemeinden, was auch den Vollzug präventiver Massnahmen umfasst. Weiter soll der Vollzug des neu aufgenommenen Abgabeverbots für alkoholische Getränke an nicht kaufsberechtigte Jugendliche sowie der Verstoss gegen das Rauchverbot durch die Gemeinden erfolgen, da es sich bei diesen Massnahmen ebenfalls ausschliesslich um Aufgaben handelt, die in die Kompetenz der Polizeikräfte der Gemeinden fallen. Die übrigen Verwaltungsaufgaben im Bereich Passivrauchschutz sollen hingegen vom Kanton wahrgenommen werden. Bestattungswesen Der Vorschlag, in konsequenter Umsetzung der Grundsätze der Aufgabenteilung das Bestattungswesen integral und ohne kantonale Vorgaben den Gemeinden zu übertragen, stiess in der Vernehmlassung auf Gemeindeseite auf Kritik und es wurde die Forderung erhoben, gewisse Grundsätze im Bestattungswesen weiterhin einheitlich vom Kanton zu regeln. Dieser Forderung wurde insofern Rechnung getragen, als die gesundheitspolizeilich relevanten Grundsätze vom Kanton für das gesamte Kantonsgebiet einheitlich geregelt werden sollen. Details dazu können dem Kommentar zu § 48 GesG-E entnommen werden. Abs. 2 Es ist den Gemeinden freigestellt, wie sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemeindeintern organisieren. Ihnen stehen die Möglichkeiten gemäss dem Gesetz über die - 34 - Einwohnergemeinden vom 19. Dezember 1978 (SAR 171.100; insbesondere §§ 3 und 39) zur Verfügung. Die Zuständigkeit für gesundheitspolizeiliche Anordnungen auf kommunaler Stufe geht über die im Baugesetz vom 19. Januar 1993 (SAR 713.100; §§ 50 und 52) verankerten Grundsätze des Gesundheitsschutzes und der Wohnhygiene als allgemeine Anforderungen im Bauwesen hinaus. 3. Berufe im Gesundheitswesen Einleitung Die geltende Gesundheitsgesetzgebung regelt die Berufszulassung von Berufen im Gesundheitswesen in abschliessender Aufzählung und diplomorientiert. Dies bedeutet, dass nur die im Gesundheitsgesetz beziehungsweise im Dekret über weitere bewilligungspflichtige Berufe der Gesundheitspflege (DBG) vom 16. November 1999 (SAR 301.130) aufgeführten Berufe ausgeübt werden dürfen, vorausgesetzt die betreffende Person ist im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung. Allen anderen Berufe, insbesondere im gesamten Spektrum der Komplementärmedizin, ist eine therapeutische Tätigkeit untersagt. Ihnen sind die Beratung und Begleitung von im medizinischen Sinne gesunden Personen, Massnahmen und Methoden zur Steigerung des körperlichen und/oder seelischen Wohlbefindens etc. erlaubt. Es besteht aktuell im komplementärtherapeutischen Bereich also weder eine Bewilligungs- noch eine Meldepflicht, sondern ein grundsätzliches Verbot. Dieses entspricht weder den Bedürfnissen der Bevölkerung noch den Entwicklungen im Bereich Komplementärmedizin und deren Anerkennung in der Gesellschaft. Faktisch bestehen sowohl eine grosse Nachfrage und ein Bedürfnis als auch ein effektives Angebot an komplementärtherapeutisch tätigen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern. Der Vollzug ist unbefriedigend und die Aufsicht basiert auf Hinweisen und primär risikobasiert. Aufgrund der gesellschaftlichen Bedürfnissen und Entwicklungen, aber auch unter Berücksichtigung der gesundheitspolizeilichen Relevanz von Tätigkeiten im Bereich der Gesundheit, soll das Berufszulassungssystem grundsätzlich geändert werden und neu das so genannte tätigkeitsspezifische Modell im Gesundheitsgesetz eingeführt werden. Das tätigkeitsspezifische Modell ist so konzipiert, dass im Gesundheitsgesetz nicht mehr einzelne bewilligungspflichtige Berufe bestimmt werden, sondern die Tätigkeiten definiert werden, welche unter gesundheitspolizeilicher Optik eine kantonale Bewilligung benötigen (§ 4 GesG-E). Damit einhergehend ist eine grundsätzliche Liberalisierung der Tätigkeiten und Berufe im komplementärtherapeutischen Bereich. Die Naturheilkunde (bei Mensch und Tier) darf weitgehend ohne staatliche Bewilligung und Beaufsichtigung ausgeübt werden. Zusätzlich wird jedoch auch die Möglichkeit der Bewilligungspflicht zur Ausübung der Komplementärmedizin eingeführt. Diese Regelung setzt eine eidgenössische Reglementierung der komplementärmedizinischen Berufe voraus. Voraussetzung für eine Bewilligungserteilung ist das Vorhandensein eines eidgenössischen Diploms in einem Bereich der Komplementärmedizin (zum Beispiel Komplementärtherapie, Alternativmedizin; § 4 Abs. 1 lit. g GesG-E). Mit dieser Regelung wird das tätigkeitsspezifische Modell in seiner Reinheit im GesG-E zwar durchbrochen, es kann damit jedoch den Entwicklungen in der Reglementierung der Berufe im Bereich Komplementärmedizin adäquat Rechnung getragen werden. - 35 - - 36 - Die nachstehende Grafik zeigt in der Übersicht dieses tätigkeitsspezifische Modell, inklusive Verweis auf die massgebenden Bestimmungen des GesG-E, auf. Die linke Spalte nennt die Tätigkeiten, welche eine Bewilligungspflicht zur Folge haben, sowie die für diesen Bereich geltenden Bestimmungen des GesG-E in Bezug auf Berufsausübung, Rechte und Pflichten, Aufsicht sowie Disziplinar- und Strafmassnahmen. Soweit einer grundsätzlich bewilligungspflichtigen Tätigkeit aufgrund der konkreten Umstände kein Gefährdungspotential zukommt, kann der Regierungsrat diese als bewilligungsfrei erklären (§ 4 Abs. 3 GesG-E). Die rechte Spalte enthält demgemäss die bewilligungsfreien Tätigkeiten (inklusive die als bewilligungsfrei erklärten Tätigkeiten) mit den anwendbaren Bestimmungen des GesG-E in Bezug auf Berufsausübung, Rechte und Pflichten, Aufsicht sowie Disziplinar- und Strafmassnahmen. Bewilligungspflichtige Berufe Bewilligungsfreie Berufe § 4 GesG-E vom GesG-E nicht erfasst Tätigkeiten im Rahmen der anerkannten Wissenschaften (§ 4 Abs. 1 lit. a) Komplementärtherapie MedBG-Berufe (§ 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 1) KVG-Berufe (§ 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 2) Div. potentiell gefährliche Tätigkeiten (§ 4 Abs. 1 lit. c – f) Tätigkeit unter einem eidg. anerkannten Diplom der Komplementärmedizin (§ 4 Abs. 1 lit. g) Sonderfälle: Tätigkeiten gemäss Pflegegesetz und Spitalgesetz (§ 4 Abs. 2) Berufsausübung ist ohne Bewilligung möglich Befreiung von der Bewilligungspflicht durch Verordnung möglich Ungefährliche Tätigkeiten (§ 4 Abs. 3) Berufsausübung, Rechte und Pflichten Berufsausübung, Rechte und Pflichten § 13- 21 § 13 Abs. 3 und § 18 Aufsicht Aufsicht § 22 Abs. 1, §§ 49 ff. § 22 Abs. 2, § 23, §§ 49 ff. Disziplinarmassnahmen Disziplinarmassnahmen § 24 - Strafrechtliche Massnahmen Strafrechtliche Massnahmen - § 54 3.1. Allgemeine Bestimmungen § 4 (Bewilligungspflicht zur Berufsausübung) Abs. 1 § 4 Abs. 1 GesG-E bestimmt, dass jedermann, der sich fachlich selbstständig, also eigenverantwortlich nach den Regeln der Schulmedizin, das heisst der wissenschaftlichen Medizin verpflichtet betätigt (§ 4 Abs. 1 lit. a GesG-E) eine Berufsausübungsbewilligung braucht. Als anerkannte Wissenschaften gelten diejenigen Gebiete, welche an Schweizerischen Universitäten und Fachhochschulen gelehrt oder von der Medizinalberufegesetzgebung erfasst sind. Die aufgezählten Tätigkeiten sind weit gefasst zu verstehen. So beinhaltet beispielsweise die "Behandlung von Schwangeren" auch die Begleitung während der Geburt und die Nachbetreuung von Mutter und Kind (Wochenbettzeit). Bei Tieren (primär Nutztieren) ist die Zyklusuntersuchung als tierärztliche Handlung (Bewilligungspflicht gemäss § 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 GesG-E) zu verstehen, die beispielsweise nicht durch eine Besamungstechnikerin beziehungsweise einen Besamungstechniker ausgeübt werden kann. - 37 - Die Bewilligungspflicht im Zusammenhang mit der Heilmittelabgabe ergibt sich entweder gestützt auf § 25 GesG-E (Apotheken, Drogerien) oder in Anwendung von §§ 43ff. GesG-E. - 38 - Weiter bedarf unabhängig von der zur Anwendung gelangenden Behandlungsmethode einer Bewilligung, wer sich fachlich selbstständig in Berufen betätigt, die unter die Medizinalberufegesetzgebung (Art. 2 MedBG) fallen (§ 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 GesG-E) oder die in der Krankenversicherungsgesetzgebung zur Gruppe der Leistungserbringer (vgl. Art. 35 ff. KVG und Art. 38 ff. Verordnung über die Krankenversicherung, KVV) gehören (§ 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 GesG-E). Ebenso ist der Bewilligungspflicht unterstellt, wer gefährliche übertragbare Krankheiten (zum Beispiel Tuberkulose, Hirnhautentzündungen) behandelt (§ 4 Abs. 1 lit. c GesG-E). Dies rechtfertigt sich im Hinblick auf das mögliche grosse Risiko einer Krankheitsübertragung. Ebenfalls der Bewilligungspflicht unterstellt sind Behandlungen im Bereich der Empfängnisund Zeugungsfähigkeit (§ 4 Abs. 1 lit. d GesG-E), Gelenkmanipulationen mit Impulsen (§ 4 Abs. 1 lit. e GesG-E), wobei hier als Beispiel die Vitalogie zu nennen ist. Ebenfalls fallen weitere bezeichnete Eingriffe, welche Verletzungen unter der Haut verursachen (Akupunktur) oder instrumental in die Körperöffnungen eingreifen, unter die Bewilligungspflicht (§ 4 Abs. 1 lit. f GesG-E). Als Beispiel für einen derartigen Eingriff sei die Magenspiegelung erwähnt. Als Ergebnis der Vernehmlassung wird zwar an der grundsätzlichen Liberalisierung der komplementärtherapeutischen Berufe festgehalten. Das heisst, dass alle nicht unter § 4 GesG-E fallenden Berufe und Tätigkeiten frei ausgeübt werden können. Zusätzlich wird auch die Bewilligungspflicht zur Ausübung der Komplementärmedizin eingeführt. Diese Regelung setzt eine eidgenössische Reglementierung der komplementärmedizinischen Berufe voraus. Voraussetzung für eine Bewilligungserteilung ist das Vorhandensein eines eidgenössisch anerkannten Diploms (zum Beispiel in Komplementärtherapie oder Alternativmedizin; § 4 Abs. 1 lit. g GesG-E). Mitunter sind auch die telemedizinischen Behandlungen wie zum Beispiel Telefonkonsultation, Internetkonsultation, Videokonsultation, Biodatenmonitoring etc. in Anwendung von § 4 Abs. 1 GesG-E bewilligungspflichtig. Mit anderen Worten kommt es dabei nicht auf die Unmittelbarkeit des Kontakts an. Abs. 2 Personen, die in stationären Einrichtungen gemäss den Bestimmungen der Pflegegesetzgebung (zu denken an Pflegeheime) und der Spitalgesetzgebung (insbesondere Spitäler und Rehakliniken) tätig sind, sind auch ohne Berufsausübungsbewilligung zur fachlich selbstständigen, eigenverantwortlichen Berufsausübung zugelassen (§ 4 Abs. 2 GesG-E). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tätigkeit im stationären Bereich oder ambulant ausgeübt wird. Die Befreiung von der Bewilligungspflicht basiert auf der Überlegung, dass Personen (so zum Beispiel Medizinalpersonen wie Ärztinnen und Ärzte, weitere Berufspersonen wie zum Beispiel Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, Logopädinnen und Logopäden und andere) in stationären Einrichtungen gemäss § 4 Abs. 2 GesG-E in einem Vertragsverhältnis (Anstellung, Mandat oder Ähnliches) zur Institution stehen, welche ihrerseits eine – gesundheitspolizeilich motivierte – Bewilligung besitzt (vgl. § 6 Pflegegesetz-E und § 8a (neu) SpiG gemäss 12. Übergangs- und Schlussbestimmungen Ziff. II GesG-E). Über die Bewilligung an die stationären Einrichtungen gemäss Pflege- und Spitalgesetzgebung wird - 39 - von der erteilenden Behörde die fachliche Qualität der Versorgung und Betreuung gefordert (vgl. auch Art. 39 KVG) und es kann so dem gesundheitspolizeilichen Aspekt Rechnung getragen werden. Ebenfalls kann via Aufsicht und allfälliger Überprüfung dieser Betriebsbewilligung sowie allenfalls via Auflagen und Weisungen beziehungsweise Entzug möglichen Verletzungen der in der Bewilligung statuierten Voraussetzungen betreffend Qualität und Fachlichkeit Einhalt geboten werden. Selbstredend benötigt die Belegärztin und der Belegarzt an zum Beispiel einem Regionalspital für ihre beziehungsweise seine Tätigkeit ausserhalb des Spitals eine Berufsausübungsbewilligung. Ebenso benötigen Personen, die in bewilligungspflichtigen Berufen tätig sind und ihre Privatpraxis in einem Spital oder ähnlichem führen, ganz normal eine Berufsausübungsbewilligung. Hingegen benötigen Medizinalpersonen, die ausschliesslich innerhalb des Spitals (zum Beispiel Oberärztin/Oberarzt, Chefärztin/Chefarzt) – unabhängig von dessen Trägerschaft und Rechtsform – tätig sind, keine Berufsausübungsbewilligung. Dies im Unterschied zur geltenden Regelung. Diese Neuregelung entspricht auch dem Gedanken des MedBG. Art. 34 MedBG statuiert diesfalls die Bewilligungspflicht für die selbstständige Ausübung eines universitären Medizinalberufs. Dabei ist der Begriff der Selbstständigkeit nach MedBG unter anderem in Beachtung der Ausführungen des Bundesamts für Gesundheit anhand eines für den Steuerund Sozialversicherungsbereichs erarbeiteten Berichts (BBl 2002 I 1126) und in Anwendung der Rechtsprechung im Einzelfall unter Würdigung der gesamten Umstände zu betrachten. So fallen gemäss Ausführungen des Bundesamts für Gesundheit in aller Regel zum Beispiel Chefärztinnen und Chefärzte oder in Aktiengesellschaften angestellte Medizinalpersonen nicht unter die Reglung von § 34 MedBG. Falls die Kantone eine entsprechende Bewilligungspflicht vorsehen möchten, ist dies speziell zu legiferieren. Dies erfolgt im Kanton Aargau durch die grundsätzliche Formulierung in § 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 GesG-E (fachlich selbstständige das heisst eigenverantwortliche Ausübung eines Berufs, der unter das MedBG fällt) weshalb die Ausnahmebestimmung in § 4 Abs. 2 GesG-E nötig wird. Der Selbstständigkeitsbegriff des MedBG und des GesG-E sind somit grundsätzlich nicht deckungsgleich. In stationären Einrichtungen der Pflegegesetzgebung beziehungsweise Spitalgesetzgebung tätige Personen, die in Anwendung von § 4 Abs. 2 GesG-E ohne Berufsausübungsbewilligung zur eigenverantwortlichen Tätigkeit berechtigt sind, unterstehen den gleichen Berufspflichten mit entsprechendem Disziplinarrecht und haben dieselben Berufsrechte wie Medizinalberufe gemäss MedBG beziehungsweise die in weiteren Berufen des Gesundheitswesens tätigen Personen (vgl. §§ 13 ff. GesG-E). Die Bewilligungspflicht für Medizinalberufe, die ausserhalb von stationären Einrichtungen gemäss § 4 Abs. 2 GesG-E in einem nach der Definition der Medizinalberufegesetzgebung (Art. 34 MedBG) nicht selbstständigem Statuts tätig sind (denkbar zum Beispiel im Rahmen einer als Aktiengesellschaft konzipierten Praxisgemeinschaft, wobei die Beurteilung wie erwähnt immer im Einzelfall vorzunehmen ist), ergibt sich automatisch gestützt auf § 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 GesG-E (Beruf, der unter das MedBG fällt). Vgl. dazu auch die Ausführungen zu § 25 Abs. 1 lit. c GesG-E. - 40 - Abs. 3 Der Regierungsrat wird ermächtigt, für Menschen und Tiere ungefährliche Anwendungen von der Bewilligungspflicht zu befreien (§ 4 Abs. 3 GesG-E), was beispielsweise bei der Akupunktur vorgesehen ist. Piercen und Tätowieren hingegen fällt bereits von der Tätigkeit und den betroffenen Personen her nicht unter die Gesundheitsgesetzgebung und untersteht derart keiner Bewilligungspflicht. Unter "bewilligungsfrei" sind somit Berufe und Tätigkeiten, die von vornherein gemäss Konzeption von § 4 Abs. 1 und 2 GesG-E nicht der Bewilligungspflicht unterliegen sowie Berufe und Tätigkeiten, die gemäss § 4 Abs. 3 GesG-E von der Bewilligungspflicht befreit sind, zu verstehen. Abs. 4 Mit § 4 Abs. 4 GesG-E werden die auch für Berufe und Tätigkeiten an und mit Tieren anwendbaren Bewilligungsbestimmungen genannt. Zusammengefasst sind also grundsätzlich nur noch Berufstätigkeiten nach den Erkenntnissen der anerkannten Wissenschaften sowie die Betätigung in einem in der Krankenversicherungsgesetzgebung als Leistungserbringer vorgesehenen Beruf und die Betätigung in Bereichen mit besonderem Gefährdungspotential bewilligungspflichtig und unterstehen damit der staatlichen Regelung. Sobald künftig die Berufe in der Komplementärmedizin auf Stufe Bund mit einem Diplom geregelt werden, ist auch für diese Berufe eine explizite Zulassung beziehungsweise Bewilligungspflicht vorgesehen. Mit dieser Regelung wird es Patientinnen und Patienten freigestellt, sich eigenverantwortlich auch ausserhalb der staatlich beaufsichtigten Berufskategorien behandeln zu lassen. Verschiedenste Gesundheitsberufe können damit im komplementärtherapeutischen Bereich frei und ohne staatliche Bewilligung und nur mit entsprechend minimaler Aufsicht (vgl. § 13 Abs. 3, § 18, § 22 Abs. 2, § 23 und §§ 49 ff. GesG-E) selbstständig tätig sein. Die bewilligungsfrei Tätigen haben sich bei ihrer Arbeit selbstverständlich an die allgemeinen Regeln des Vertrags- und Haftpflichtrechts sowie an die generellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu halten. Ebenso ist zu erwarten, dass die häufig bereits vorhandenen verbandseigenen Qualitätsbestimmungen und -richtlinien den Patientinnen und Patienten bei der Auswahl ihrer Therapeutinnen und Therapeuten dienlich sein können. Für die bewilligungsfrei tätigen Berufe ergeben sich die Möglichkeiten zur Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln gestützt auf § 44 GesG-E. § 5 (Bewilligungsvoraussetzungen) Abs. 1 Anspruch auf eine Bewilligung hat, wer die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Die Formulierung der einzelnen Voraussetzungen (§ 5 Abs. 1 GesG-E) lehnt sich eng an die Bundesgesetzgebung an. Im Geltungsbereich des MedBG sind sowohl die fachlichen als auch die persönlichen Bewilligungsvoraussetzungen abschliessend geregelt. Entsprechend kann der Kanton keine weiteren Voraussetzungen stipulieren. Kantonale Ausführungsbestimmungen können hingegen die Voraussetzungen gemäss MedBG präzisieren. Insofern kann beispielsweise nicht generell die Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung als Bewilligungsvoraussetzung statuiert werden. Wie im MedBG ist die Berufshaftpflichtversicherung als Berufspflicht ausgestaltet (§ 15 Abs. 1 lit. c GesG-E). - 41 - Wo von Bundesrechts wegen bereits an die Berufsausübung Voraussetzungen formuliert werden, gehen diese natürlich vor (vgl. Art. 36 und 15 Abs. 4 MedBG; Art. 32 PsyG-E u.a.). So sieht unter anderem Art. 36 Abs.1 lit. b MedBG vor, dass Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller vertrauenswürdig sein müssen sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung zu bieten haben. Unter Vertrauenswürdigkeit ist zu verstehen, dass die Person über einen guten Leumund verfügt beziehungsweise allgemein vertrauenswürdig sein muss. Die Vertrauenswürdigkeit kann durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden. Mitunter ist vorauszusetzen, dass keine berufsrelevanten Straftaten vorliegen. Die berufliche Relevanz einer Straftat bestimmt sich nach der Schwere und nach dem Zusammenhang mit der Ausübung des Berufs. Dafür ist ein Auszug aus dem Strafregister und bei ausländischen Gesuchstellenden (zusätzlich) auch ein gleichwertiges ausländisches Dokument vorzulegen. Zur Belegung der Voraussetzungen können auch weitere Bestätigungen wie Letter of Good Standing, Arbeitszeugnisse, Arztzeugnisse etc. verlangt werden. Im Rahmen der Vernehmlassung hat sich ergeben, dass gestützt auf die neue Richtlinie 2005/36/EG (siehe Ausführungen zu § 6 GesG-E) auf das explizite Erfordernis der Beherrschung der deutschen Sprache verzichtet werden muss. Neu wird verlangt, dass eine Person über die für die Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse verfügt. Bei in Berufen im Gesundheitswesen tätigen Personen ist einer möglichst optimalen und sachgerechten Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten aber auch gegenüber den Behörden Beachtung zu schenken. Dies ergibt sich mitunter im Zusammenhang mit den Berufspflichten. Faktisch dürften äusserst gute Kenntnisse der deutschen Sprache als Amtssprache im Praxisstandortkanton zu verlangen sein. Abs. 2 Die detaillierte Formulierung der Zulassungsvoraussetzungen erfolgt auf Stufe Verordnung (§ 5 Abs. 2 GesG-E). Es ist beabsichtigt, primär und ausschliesslich auf die bundesrechtlichen Anforderungen in verschiedenen Lebenssachverhalten (Verweis MedBG, Krankenversicherungsgesetzgebung, SRK/BBT-Regelungen etc.) Bezug zu nehmen. Hier wird sich die Verordnung insbesondere an die Ausbildungs- und Weiterbildungserfordernisse gemäss den KVG-Berufen, den SRK/BBT-Regelungen und den Empfehlungen der GDK (Osteopathinnen und Osteopathen) etc. halten. Die Formulierung zusätzlicher Erfordernisse wie zum Beispiel längere praktische Tätigkeit als bereits in der Krankenversicherungsgesetzgebung verlangt etc. ist nicht beabsichtigt. Ebenso soll in der Verordnung geregelt werden, welche Unterlagen zur Belegung der Voraussetzungen notwendig sind. Weiter werden in der Verordnung die – zusätzlich zu § 4 Abs. 1 lit. b – gemäss § 4 als bewilligungspflichtige Berufe bezeichnet (§ 5 Abs. 2 GesG-E). Dies dient der Rechtssicherheit sowohl im Sinne der Patientinnen und Patienten als auch der in Berufen des Gesundheitswesens tätigen Personen. - 42 - Unter die in der Verordnung zu bezeichnenden Berufe fallen (Stand heute): Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Solange das Psychologieberufegesetz noch nicht in Kraft ist, ist diesbezüglich noch kein Verweis auf Bundesrecht möglich. Mit den Übergangs- und Schlussbestimmungen (§ 55 GesG-E) wird die Möglichkeit gegeben, dass dannzumal eine Einordnung in § 4 Abs. 1 lit. b GesG-E erfolgen wird. Zwischenzeitlich wird in der Verordnung eine eigenständige Regelung notwendig sein, welche sich an den bisherigen Zulassungsvoraussetzungen gemäss § 36 GesG-1987 ausrichten wird. Aktuelle und zukünftige BBT-Berufe und/oder ehemalige SRK Berufe, welche nicht bereits unter die KVG-Berufe fallen (zum Beispiel Dentalhygienikerin/Dentalhygieniker, Medizinische Masseurin/Medizinischer Masseur, Podologin/Podologe, Drogistin/Drogist, Augenoptikerin und Augenoptiker und andere) wobei für eine Berufszulassung eine gewisse Stufe der Ausbildung vorauszusetzen ist (zum Beispiel eidgenössisch höhere Fachprüfung/ Diplom für Augenoptikerinnen/Augenoptiker, für Drogistinnen/Drogisten, u.ä.). allenfalls weitere Berufe, die von der GDK geregelt werden (zum Beispiel Osteopathin/ Osteopath). Diese Liste kann durch Verordnungsänderung jederzeit angepasst werden. Ein entsprechender Bedarf kann sich insbesondere aufgrund neu auf Bundesstufe geregelter Berufe ergeben. Mit dieser Lösung kann flexibel auf Veränderungen in den Berufsanerkennungen und bei Ausbildungen eingegangen werden. Erklärtes Ziel im Hinblick auf die Binnenmarktliberalisierung ist es, dass die Voraussetzungen, die von Bundesrecht wegen bereits gelten, in der Verordnung abschliessend als fachlich notwendige Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung bezeichnet werden. Dabei ist zu denken an Bestimmungen für die Berufsausübung (MedBG und PsyG-E), für die Berufsausbildung mit entsprechenden Abschlüssen (Berufbildungsgesetzgebung), für die Anerkennung von Ausbildungen (Berufsbildungsgesetzgebung/Empfehlungen der Gesundheitsdirektorenkonferenz beziehungsweise -SRK/BBT-Anerkennungen) und für die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenversicherungsgesetzgebung). Entgegen der geltenden Regelung wird auf eine explizite Möglichkeit, Medizinalpersonen bei einer Notstandssituation unter erleichterten Bedingungen zuzulassen (§ 17 Abs. 3 GesG1987), verzichtet. Mit der EU-Personenfreizügigkeit und -Diplomanerkennung ist bei Medizinalberufen eine Notstandssituation in Zukunft eher unwahrscheinlich und wäre allenfalls über Art. 36 Abs. 3 MedBG abzudecken. Abs. 3 Grundsätzlich ist die gesuchstellende Person oder die Bewilligungsinhaberin und der Bewilligungsinhaber in Anwendung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Bestimmungen gegenüber der Bewilligungsbehörde verpflichtet, Auskunft zu erteilen. Die Abklärung der Bewilligungsvoraussetzungen geht somit im Normalfall über die gesuchstellende Person oder die Bewilligungsinhaberin und den Bewilligungsinhaber. In Zeiten der Mobilität und in Anbetracht der Realität, dass verschiedene in Berufen des Gesundheitswesens tätige Personen an verschiedenen Standorten ihre Tätigkeit ausüben, ist eine Berechtigung zur - 43 - direkten Einholung von Auskünften sachgerecht (§ 5 Abs. 3 GesG-E). Zu denken ist an die Anfrage von Behörden und Amtstellen (Unbedenklichkeitsbestätigungen, Details zum Umfang der Berufsausübungsbewilligung in anderen Kantonen/Ländern u.ä.) aber auch von weiteren Stellen wie Patientenorganisationen, Ombudsstellen, Versicherern u.ä. Selbstverständlich sind für die Entscheidung, ob und in welchem Umfang diese Stellen Informationen weitergeben dürfen, die entsprechenden – allenfalls spezialgesetzlichen – Bestimmungen anwendbar. Kommt es zum Beispiel aufgrund von Zweifeln am Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung zur Anordnung einer Begutachtung betreffend die gesuchstellende Person (zum Beispiel Krankheit, Suchtproblematik), müssen die entstandenen Kosten den betroffenen Personen in Rechnung gestellt werden können (§ 5 Abs. 3 GesG-E). § 6 (Meldepflicht) Abs. 1 Nicht der Bewilligungspflicht sondern lediglich der Meldepflicht unterstehen gestützt auf das bilaterale Abkommen vom 21. Juni 1999 über die Freizügigkeit die so genannten 90-TageDienstleistenden (§ 6 Abs. 1 GesG-E). Dabei handelt es sich um Personen, die aus dem EG-EFTA-Raum kommend, im Kanton Aargau beziehungsweise der Schweiz pro Jahr temporär bis zu 3 Monaten eine gemäss § 4 GesG-E bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben. Zu denken ist beispielsweise an einen ausländischen Zahnarzt, der bei einem Kollegen in der Praxis spezialzahnärztlich tätig ist. 90-Tage-Dienstleistende, die in einer stationären Einrichtung gemäss § 4 Abs. 2 GesG-E tätig sind, unterliegen keiner Meldepflicht. Abs. 2 Bei den anlässlich der Meldung zu erbringenden Dokumente und Angaben (§ 6 Abs. 2 GesG-E) stützt sich der Gesetzgeber auf die entsprechenden Regelungen in der neuen Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung der Berufsqualifikationen vom 7. September 2005. Die EU hat diese neue Richtlinie über die Anerkennung von Diplomen im EU-Raum am 20. Oktober 2005 verabschiedet. Die Schweiz muss nun festlegen, ob sie diese Richtlinie im Rahmen von Anhang III ("Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen") des Abkommens über den freien Personenverkehr übernehmen will. Im Jahr 2007 hat der Bund dazu eine Anhörung durchgeführt, die insgesamt ein positives Ergebnis zugunsten einer Übernahme der Richtlinie ergab. Seither hat die Schweiz entsprechende Verhandlungen mit den zuständigen Stellen aufgenommen. Ein genauer Zeitplan für die Übernahme der Richtlinie ist zurzeit der Erstellung dieser Botschaft noch nicht bekannt. Es darf jedoch damit gerechnet werden, dass die Richtlinie 2005/36/EG in der Schweiz vor 2009 angewendet wird. So rechtfertigt sich in der Gesetzesarbeit ein Abstellen auf die künftig geltenden EUVorschriften (insbesondere betreffend Berufsqualifikation und Versicherungsschutz und zu erbringender Bescheinigung über die rechtmässige Ausübung des Berufs in der EU, § 6 Abs. 2 lit. a–c GesG-E). Ebenfalls wurde seitens der Kantone im Rahmen der Anhörung eine 2-jährige Umsetzungsfrist verlangt. Das Ergebnis ist noch offen. - 44 - Abs. 3 Die zuständige Behörde prüft die verlangten Unterlagen in einem beschleunigten Verfahren (§ 6 Abs. 3 GesG-E). Unter einem beschleunigten Verfahren wird in der Regel eine Beurteilung innert 10 Arbeitstagen verstanden. Abs. 4 Personen mit einer Berufsausübungsbewilligung aus anderen Kantonen haben in Beachtung der Binnenmarktgesetzgebung Anspruch auf Ausübung ihres Berufs auch im Kanton Aargau. Aus Ausfluss des Territorialitätsprinzips ist zu statuieren, dass derartig tätige Personen der zuständigen Behörde eine gemäss § 4 GesG-E bewilligungspflichtige Tätigkeit ebenfalls melden (§ 6 Abs. 4 GesG-E) und die Behörde in einem analogen beschleunigten Verfahren die Unterlagen prüft. Als Bescheinigung über die Rechtmässigkeit der Berufsausübung im Herkunftskanton wird in der Regel eine Berufsausübungsbewilligung und Unbedenklichkeitsbestätigung der ausstellenden Behörde Auskunft zu geben haben. Ebenso sind Diplome und allfällig erforderliche Weiterbildungstitel einzureichen. Als Ausfluss der allgemeinen Aufsichtspflicht kann die zuständige Behörde auch weitere Angaben zur Person (zum Beispiel Strafregisterauszug, Lebenslauf o.ä.) verlangen. Abs. 5 Sowohl für 90-Tage-Dienstleistende als auch für Personen, die gestützt auf die Binnenmarktgesetzgebung im Kanton Aargau tätig sind, gelten die Bestimmungen betreffend Einschränkung, Entzug, Auflagen/Weisungen, Erlöschen der Bewilligung sowie Veröffentlichung (§ 6 Abs. 5 GesG-E). Die Berufspflichten und -rechte ergeben sich umfassend aufgrund §§ 13 ff. GesG-E § 7 (Unselbstständige Tätigkeiten) Abs. 1 Mit „unselbstständig“ im Sinne dieses Gesetzes ist die fachliche Unselbstständigkeit gemeint, mit anderen Worten die nicht eigenverantwortliche Tätigkeit. Dies unabhängig davon, ob jemand wirtschaftlich selbstständig ist oder nicht (§ 7 Abs. 1 GesG-E). Die fachlich unselbstständige Berufsausübung hat unter der direkten Verantwortung und der Aufsicht der Bewilligungsinhaberin beziehungsweise des Bewilligungsinhabers zu erfolgen. Damit ist insbesondere verlangt, dass die Bewilligungsinhaberin beziehungsweise der Bewilligungsinhaber vor Ort in den Praxisräumlichkeiten anwesend ist und so effektiv eine Aufsicht führen kann. Selbstredend muss sie beziehungsweise er zeitlich gleichzeitig zusammen mit der unselbstständig tätigen Person anwesend sein. Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse wurde aus Gründen der Praktikabilität auf die explizite Erwähnung der Unmittelbarkeit der Aufsicht verzichtet. Die Art und Weise einer korrekten Wahrnehmung der Aufsicht liegt im Verantwortungsbereich der Bewilligungsinhaberin beziehungsweise des Bewilligungsinhabers. Grundsätzlich wird für fachlich unselbstständig tätige Personen keine Bewilligung gefordert (Spezialregelung bei Medizinalberufen gemäss § 8 GesG-E). So können Drogistinnen und Drogisten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Podologinnen und Podologen, Augenoptikerinnen und Augenoptiker etc. ohne behördliche Bewilligung oder Meldung fachlich unselbstständig tätige Personen beschäftigen. Ebenfalls soll weiterhin möglich sein, - 45 - dass Nichtmedizinalpersonen bei Personen mit universitären Medizinalberufen mit Berufsausübungsbewilligung im Rahmen von § 7 fachlich unselbstständig ohne Bewilligung tätig sind (zum Beispiel ärztlich delegierte Psychotherapie, Dentalhygienikerin/Dentalhygieniker bei Zahnärztin beziehungsweise Zahnarzt, Veterinärtechnikerin/Veterinärtechniker bei Tierärztin beziehungsweise Tierarzt u.ä.). Abs. 2 An die fachlich unselbstständig Tätigen werden nicht a priori die gleichen Voraussetzungen wie an Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber gestellt. Fachlich unselbstständige Tätigkeiten können somit durchaus im Kontext mit Aus- und Weiterbildungen stehen (zum Beispiel bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten). Zwingend notwendig ist jedoch, dass adäquate fachliche Qualifikationen vorliegen. Die Verantwortung für das Vorhandensein einer genügenden Qualifikation – sowie allgemein für die unselbstständig tätige Person – trägt die Bewilligungsinhaberin und der Bewilligungsinhaber (§ 7 Abs. 2 GesG-E). Allfällige Fehlhandlungen oder ungenügende Qualifikationen der unselbstständig Tätigen werden der Inhaberin beziehungsweise dem Inhaber der Berufsausübungsbewilligung zugerechnet. Somit stehen die Bewilligungsinhaberin und der Bewilligungsinhaber gegenüber der Aufsichtsbehörde primär in Pflicht. Zur Anwendung gelangen diesfalls mitunter die §§ 10–12 GesG-E. Durch Verweis von § 13 GesG-E zu § 7 GesG-E ist weiter auch sichergestellt, dass auch für fachlich unselbstständig Tätige die Berufspflichten und Berufsrechte Gültigkeit haben. Abs. 3 Fachlich unselbstständig tätige Personen dürfen nur Verrichtungen vornehmen, zu deren Ausübung auch die Bewilligungsinhaberin und der Bewilligungsinhaber berechtigt beziehungsweise befähigt sind sowie die nicht durch die Bewilligungsinhaberin und den Bewilligungsinhaber persönlich ausgeführt werden müssen (§ 7 Abs. 3 GesG-E). Somit ist ausgeschlossen, dass in fachlicher Unselbstständigkeit Tätigkeiten ausgeübt werden, die nicht in den Tätigkeitsbereich der Bewilligungsinhaberin und des Bewilligungsinhabers fallen (zum Beispiel physiotherapeutische Tätigkeit bei Medizinischer Masseurin/Medinischem Masseur mit Berufsausübungsbewilligung, Augenoptikertätigkeit bei Drogistin/Drogist mit Berufsausübungsbewilligung). Abs. 4 Das Handeln im Namen und auf Rechnung der Bewilligungsinhaberin und des Bewilligungsinhabers ist Konsequenz der Regelung gemäss den Absätzen 1 und 2 (§ 7 Abs. 4 GesG-E). Abs. 5 Zur Sicherstellung der Qualität der fachlichen Aufsicht kann der Regierungsrat eine Begrenzung der unselbstständig tätigen Personen pro Bewilligungsinhaberin beziehungsweise Bewilligungsinhaber vornehmen (§7 Abs. 5 GesG-E). - 46 - § 8 (Unselbstständige Tätigkeiten von Personen mit universitären Medizinalberufen [Assistentinnen und Assistenten]; Bewilligungspflicht) Abs. 1 Bei Personen, die einen universitären Medizinalberuf ausüben und gemäss § 4 der Bewilligungspflicht unterstehen, ist wie bis anhin für die Beschäftigung von im Medizinalberuf fachlich unselbstständig tätigen Personen eine Assistentenbewilligung notwendig (§ 8 Abs. 1 GesG-E). Bei Medizinalberufen spricht man bei fachlich unselbstständiger Tätigkeit von Assistentinnen und Assistenten oder Assistenzärztinnen und Assistenztierärzten. Im Unterschied zur geltenden Regelung auf Verordnungsstufe wird die Erteilung der Assistentenbewilligung nicht mehr an das Vorliegen einer speziellen Bedarfssituation geknüpft. Ebenfalls erfolgt keine Unterscheidung, ob die Assistenzperson zu Ausbildungszwecken oder anderweitig beschäftigt werden soll. Abs. 2 Die konkreten Voraussetzungen betreffend fachliche Qualifikationen etc. regelt der Regierungsrat (§ 8 Abs. 2 GesG-E). Abs. 3 Auch bei bewilligungspflichtigen Assistentinnen und Assistenten gelten die Grundsätze von § 7 (§ 8 Abs. 3 GesG-E). Explizit wird auch bei Assistentinnen und Assistenten die Möglichkeit der Begrenzung der bei einer zur selbstständigen Berufsausübung zugelassenen Medizinalperson tätigen Assistentinnen und Assistenten aufgeführt. Dahinter steht, wie auch bei § 7 Abs. 5 GesG-E die Überlegung, dass ab einer gewissen Anzahl von fachlich unselbstständig tätigen Personen eine sachgerechte und korrekte Aufsicht durch die Bewilligungsinhaberin beziehungsweise den Bewilligungsinhaber nicht mehr sichergestellt ist. Bei Ärztinnen und Ärzten kann sich je nach Situation die Frage nach einer Bewilligung gemäss § 25 Abs. 1 lit. c GesG-E (Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärztinnen und Ärzte dienen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG) stellen. Ebenfalls ist die Möglichkeit der Befristung von Assistentenbewilligungen vorgesehen. Eine Differenzierung in verschiedene "Assistentenkategorien" (unter anderem Aus- und Weiterbildungsassistenz) ist unter diesen Überlegungen nicht notwendig. Allfällige Fehlhandlungen der Assistentinnen und Assistenten werden der Inhaberin beziehungsweise dem Inhaber der Assistentenbewilligung, welche beziehungsweise welcher ja auch Inhaberin beziehungsweise Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung ist, zugerechnet. Zur Anwendung können also mitunter die §§ 10–12 GesG-E gelangen. So stehen also die Bewilligungsinhaberin und der Bewilligungsinhaber gegenüber der Aufsichtsbehörde primär in Pflicht. Durch Verweis von § 13 GesG-E zu § 8 GesG-E ist weiter auch sichergestellt, dass auch für Assistentinnen und Assistenten die Berufspflichten und Berufsrechte Gültigkeit haben. - 47 - § 9 (Stellvertretung) Abs. 1 Grundsätzlich können sich alle Berufe im Gesundheitswesen bei Verhinderung oder vorübergehender Abwesenheit vertreten lassen. Bei Medizinalberufen mit Berufsausübungsbewilligung ist eine Vertretung bewilligungspflichtig (§ 9 Abs. 1 GesG-E). Für die Stellvertretung bei Organisationen und Betrieben im Gesundheitswesen haben die §§ 26 und 27 GesG-E Gültigkeit (betreffen Apotheken; vgl. § 27 GesG-E). Bei Medizinalberufen ist analog der geltenden Regelung die Vertretung auch möglich falls die Person mit Berufsausübungbewilligung verstorben ist. Diesfalls wird die Vertreterbewilligung an die Erben erteilt. Abs. 2 Bei den weiteren bewilligungspflichtigen Berufen (Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Medizinischen Masseurinnen und Masseuren etc.) im Gesundheitswesen ist eine Vertretung ohne Bewilligung oder Meldung möglich (§ 9 Abs. 2 GesG-E). Vorbehalten bleibt die Bewilligungspflicht der Stellvertretung in Drogerien gemäss § 27 GesG-E. Abs. 3 Stellvertretungen haben die in § 5 GesG-E genannten fachlichen und persönlichen Voraussetzungen zu erfüllen (§ 9 Abs. 3 GesG-E). Dies rechtfertigt sich unter dem Aspekt, dass sie fachlich eigenverantwortlich (§ 9 Abs. 4 GesG-E) Behandlungen vornehmen. Bei bewilligungspflichtigen Stellvertretungen überprüft die zuständige Behörde das Vorhandensein, bei nichtbewilligungspflichtigen Stellvertretungen liegt dies in der Verantwortung der Person mit Berufsausübungsbewilligung. Abs. 4 Das Handeln im Namen und auf Rechnung der vertretenen Person ist Konsequenz der Regelung gemäss den Absätzen 1 und 2 (§ 9 Abs. 4 GesG-E). Abs. 5 Mittels Verordnung werden Ausführungsbestimmungen zum Beispiel zur möglichen Dauer einer Vertretung und Pensenteilung beziehungsweise Begrenzung der Anzahl Vertretenden erlassen (§ 9 Abs. 5 GesG-E). Es ist weiter zur Regelung auf Verordnungsstufe vorgesehen, dass bei Stellvertreter-Personen, die bereits im Besitz einer Berufsausübungsbewilligung in einem universitären Medizinalberuf sind, eine Meldung an die Bewilligungsbehörde genügt. Ebenso soll wie bis anhin möglich sein, dass zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte auch dann als Stellvertretung zugelassen werden, wenn sie noch nicht über sämtliche grundsätzlich erforderlichen Voraussetzungen verfügen (zum Beispiel Weiterbildung formal noch nicht abgeschlossen), ihre Stellevertretung jedoch durch ein Spital oder eine andere Bewilligungsinhaberin oder einen anderen Bewilligungsinhaber (zum Beispiel Praxispartnerin beziehungsweise Praxispartner der zu stellvertretenden Medizinalperson) qualifiziert begleitet beziehungsweise supervidiert wird. - 48 - Allfällige Fehlhandlungen der Stellvertreterinnen und der Stellvertreter werden – im Fall von bewilligungspflichtigen Stellvertretungen gemäss § 9 Abs. 1 GesG-E – der Inhaberin beziehungsweise dem Inhaber der Stellvertreterbebewilligung, welche beziehungsweise welcher ja auch Inhaberin beziehungsweise Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung ist, zugerechnet. Bei nichtbewilligungspflichtigen Stellvertretungen gemäss § 9 Abs. 2 GesG-E zeichnen die Inhaberin beziehungsweise der Inhaber der Berufsausübungsbewilligung verantwortlich. Zur Anwendung können also mitunter die §§ 10–12 GesG-E gelangen. So stehen also die Bewilligungsinhaberin und der Bewilligungsinhaber gegenüber der Aufsichtsbehörde primär in Pflicht. Durch Verweis von § 13 GesG-E zu § 9 GesG-E ist jedoch auch sichergestellt, dass auch für Stellvertreterinnen und Stellvertreter die Berufspflichten und Berufsrechte Gültigkeit haben. § 10 (Einschränkung der Berufsausübungsbewilligung; Entzug) Abs. 1 Für die universitären Medizinalberufe sehen bereits Art. 37 f. MedBG mögliche Einschränkungen der Bewilligungen und weiteren Auflagen etc. durch die Kantone vor. § 10 Abs. 1 GesG-E nimmt in diesem Sinne für alle Berufe im Gesundheitswesen diese Möglichkeiten auf. Fachliche Einschränkungen betreffen den Bereich der ausgeübten Tätigkeit. Zeitliche Einschränkungen können die Laufzeit der Berufsausübungsbewilligung aber auch zum Beispiel die Dauer der Tätigkeit betreffen. Unter räumlichen Einschränkungen sind Einschränkungen betreffend den geografischen Geltungsbereich zu verstehen. Selbstredend haben sich entsprechende Einschränkungen nach den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts (Prinzip der Verhältnismässigkeit etc.) zu richten sowie – falls sich das nicht aus der unmittelbaren Umsetzung von Bundesrecht (MedBG etc.) ergibt – dem Ziel der Wahrung der öffentlichen Gesundheit zu dienen. Die in § 10 Abs. 2 GesG-E genannten Gründe entsprechen inhaltlich Art. 38 MedBG. Abs. 2 Die in § 10 Abs. 2 GesG-E genannten Gründe entsprechen inhaltlich Art. 38 MedBG. Abs. 3 Bei Vorliegen gewisser Sachverhalte kann die Berufsausübungsbewilligung durch die erteilende Behörde entzogen werden (§ 10 Abs. 3 GesG-E). Da bei Verletzung von Berufspflichten, Vorschriften des MedBG oder Ausführungsvorschriften (damit sind auch kantonale gemeint) bei im Sinne des MedBG selbstständig tätigen Medizinalberufen ausschliesslich Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 43 Abs. 1 MedBG angeordnet werden dürften (abschliessende Regelung im Bundesrecht), wird diese Bestimmung für Medizinalberufe nur subsidiär und/oder in Einzelfällen (vgl. Ausführungen zu § 4 GesG-E betreffend des Begriffs "Selbstständigkeit" gemäss MedBG) Anwendung finden. Hingegen kann bei anderen Berufen des Gesundheitswesens das Erfüllen der in § 10 Abs. 3 lit. a–d GesG-E genannten Sachverhalte zu einem Entzug oder allenfalls einer milderen Einschränkung führen. Die Auflistung entspricht betreffend Litera b der geltenden Regelung mit Bezug auf Art. 43 MedBG und betreffend Litera c inhaltlich der geltenden Regelung mit der Ergänzung der Beihilfeleistung. Unter Litera d fallen Sachverhalte, die nicht in erster Linie im Kontext mit der Berufsausübung im Gesundheitswesen stehen, aber dennoch Auswirkungen auf die Bewilligung haben können. - 49 - Zu denken ist insbesondere an massive finanzielle Probleme ausserhalb der Praxistätigkeit, an ein massiv gespanntes Verhältnis zu den Behörden, an allgemein "unseriöses" Verhalten u.a. Abs. 4 Die verschiedenen umfangmässigen aber auch zeitlichen Dimensionen einer Einschränkung beziehungsweise eines Entzugs werden in § 10 Abs. 4 GesG-E genannt. Abs. 5 In Ergänzung von § 33 Abs. 3 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG) soll eine Kostenauflage bei Abklärungen und Expertisen auch ohne, dass es explizit im Interesse des Beteiligten liegt, möglich sein. Die gesundheitspolizeilichen Interessen des Staats rechtfertigen eine derartige Präzisierung. In der Praxis zeigt sich, dass bei Verfahren um Einschränkung oder Entzug von Berufsausübungsbewilligungen die Gesundheitsbehörde für eine sachgerechte Entscheidfindung häufig weitere Erhebungen (fachliche Abklärungen u.a.) vornehmen oder auch Expertisen einholen muss. § 11 (Erlöschen der Bewilligung) Die einmal erteilte Berufsausübungsbewilligung gilt zeitlich unbefristet. Bewusst werden sowohl auf eine Befristung als auch auf eine "Verfallsbestimmung" (zum Beispiel wenn Praxis nicht innert Frist eröffnet wird oder Altersbegrenzung u.ä.) verzichtet. Stellt eine Bewilligungsinhaberin oder ein Bewilligungsinhaber ihre beziehungsweise seine Tätigkeit für eine bestimmte Zeit ein, indem sie oder er zum Beispiel im Ausland eine Weiterbildung macht, wird dies bei der Meldung an die Behörde vermerkt und die Bewilligung sistiert. Ein automatisches Erlöschen zieht der Tod (§ 11 lit. a GesG-E), der dauernde und vollständige Entzug (§ 11 lit. b GesG-E), der schriftliche Verzicht (§ 11 lit. c GesG-E), mit anderen Worten die erklärte, in der Regel dauernde Einstellung der Tätigkeit u.ä. sowie das in einem Strafverfahren (Art. 67 und 67b StGB) ausgesprochene Berufsverbot (§ 11 lit. d GesG-E) nach sich. § 12 (Veröffentlichung) Mit § 12 GesG-E wird die Grundlage geschaffen, dass die im Kanton Aargau zuständige Aufsichts- und Bewilligungsbehörde unter gewissen, im Gesetz genannten Voraussetzungen Informationen betreffend die Erteilung, die Einschränkung, den Entzug und das Erlöschen einer Bewilligung sowie das Verbot einer Tätigkeit (vgl. § 23 GesG-E) der Öffentlichkeit oder Dritten bekannt geben darf. Eine Information soll gegenüber anderen kantonalen, eidgenössischen oder ausländischen Behörden (zum Beispiel falls dort bereits eine Bewilligung vorhanden ist oder beantragt wird), aber auch gegenüber den jeweiligen Berufsverbänden (unter anderem im Zusammenhang mit § 39 Abs. 2 GesG-E) oder den Krankenversicherern, soweit dies zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgaben erforderlich ist, erfolgen können. Was die Bekanntgabe an ausländische Behörden angeht, müssen die sich aus den internationalen Abkommen (Schengen/ Dublin) ergebenden Grundsätze des Datenschutzrechts eingehalten werden. Diese - 50 - widerspiegeln sich in § 14 Abs. 3 und 4 des kantonalen Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 2006, welche entsprechend anwendbar sind. Je nach dem muss eine Information auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit (Patientinnen und Patienten) möglich sein. So kann der Vernetzung und Qualität im Gesundheitswesen gedient werden und es können allenfalls unwissende Patientinnen und Patienten zum Schutz ihrer Gesundheit über Umfang und Berechtigung zur Ausübung eines Berufs im Gesundheitswesen mit Informationen erreicht werden. 3.2. Berufsausübung § 13 (Geltungsbereich) Abs. 1 § 13 GesG-E bestimmt den Geltungsbereich der Bestimmungen über Rechte und Pflichten der im Gesundheitswesen tätigen Berufe. So haben sie Gültigkeit für alle Berufe mit Pflicht zur Berufausübungsbewilligung (§ 4 Abs. 1 GesG-E), für alle Berufe, welche zur selbstständigen Tätigkeit ohne Bewilligung berechtigt sind (das heisst in stationären Einrichtungen; vgl. § 4 Abs. 2 GesG-E) sowie für alle Berufe, welche meldepflichtig sind (§ 6 GesG-E), dies unabhängig davon, ob die Tätigkeit fachlich eigenverantwortlich und selbstständig oder unselbstständig oder in Vertretung ausgeübt wird (§ 13 Abs. 1 GesG-E). Ebenfalls spielt es keine Rolle, wo der Beruf ausgeübt wird (so auch in Spitälern, Pflegeheimen etc.). Abs. 2 Hier gilt es anzumerken, dass für die universitären Medizinalberufe gemäss MedBG die Berufspflichten (Art. 40 MedBG) einheitlich und abschliessend im MedBG geregelt sind. Selbstverständlich können auf die Medizinalberufe gemäss MedBG entsprechend ausführende kantonalrechtliche Bestimmungen Anwendung finden. Für Berufe ausserhalb der Medizinalberufegesetzgebung haben primär die §§ 14–21 GesG-E Gültigkeit, Art. 40 lit. a, b und e MedBG findet ergänzend Anwendung. So gelten zum Beispiel die Berufspflichten (inklusive Weiterbildung) auch für die nicht unter gemäss Art. 34 MedBG i.V.m. Art. 40 MedBG den MedBG-Berufspflichten unterstehenden Berufe des Gesundheitswesens (§ 13 Abs. 2 GesG-E). Abs. 3 Die Bestimmungen über Rechte und Pflichten finden für die bewilligungsfreien Berufe, das heisst diejenigen Berufe, die nicht unter die Bewilligungspflicht und Meldepflicht fallen nur in Bezug auf die Bekanntmachungen Anwendung (§ 13 Abs. 3 GesG-E). Dies lässt sich trotz Gewichtung der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten aus Gründen des öffentlichen Interesses (Abwehr/Schutz der Patientinnen und Patienten vor Gefahren durch unsachgemässe, irreführende Bekanntmachungen) rechtfertigen. Personen, die bewilligungsfrei tätig sein dürfen, haben sich selbstverständlich an die allgemeinen Verpflichtungen zivil- und strafgesetzlicher Natur zu halten (zum Beispiel Schutz der Persönlichkeit gemäss Zivilgesetzbuch [ZGB], Einhaltung vertraglicher Pflichten gemäss Obligationenrecht [OR], zum Beispiel Dokumentationspflicht gemäss Auftragsrecht etc.). Ebenso unterstehen sie den vertraglichen und ausservertraglichen haftpflichtrechtlichen - 51 - Verantwortlichkeiten. Auch haben die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Beispiel zur Bearbeitung von Personendaten, zur Schweigepflicht u.a. Gültigkeit. - 52 - § 14 (Grundsatz) Abs. 1 Diese Bestimmung entspricht weitgehend dem geltenden Recht. Es hat eine Zusammenführungen der einzelnen Regelungen und die Aufnahme der allgemein anerkannten Begrifflichkeiten und Standards (Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit) stattgefunden (§ 14 Abs. 1 GesG-E). Als Auslegungshilfen zur Bestimmung der jeweils aktuellen anerkannten Grundsätze können neben den wissenschaftlichen Standards mitunter Richtlinien von Fachgesellschaften u.ä. dienen (zum Beispiel SAMW-Richtlinien). Abs. 2 Die sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung ergibt sich aus der Einhaltung der gemäss Absatz 1 genannten Grundsätze und entspricht den allgemeinen Anforderungen an ein Behandlungsverhältnis. Die persönliche Berufsausübung schliesst eigentliche Filialpraxen aus. Denkbar ist die Tätigkeit an mehren Orten, wobei sich die Anwesenheit beziehungsweise die persönliche Berufsausübung mit den Öffnungszeiten decken muss (§ 14 Abs. 2 GesG-E). Denkbar ist – vorbehältlich anderweitiger Bestimmungen (zum Beispiel Art. 46 KVV) – die Führung einer Praxis in Form einer Aktiengesellschaft o.ä. Zentral dabei ist, dass sich dadurch an den beruflichen Verpflichtungen der im Gesundheitswesen tätigen Person überhaupt nichts ändert. Die Bewilligungsinhaberin beziehungsweise der Bewilligungsinhaber ist auch unter solchen Voraussetzungen für die erbrachten Leistungen persönlich verantwortlich. Insbesondere ist sie oder er persönlich für alle diagnostischen, therapeutischen und anderen Verrichtungen verantwortlich, welche sie oder er selbst, oder eine unter ihrer beziehungsweise seiner Aufsicht stehende unselbstständig tätige Person, vornimmt. Sie oder er haftet persönlich für Behandlungsfehler beziehungsweise Verletzung der beruflichen Sorgfaltspflichten etc. Abs. 3 Die Beschränkung der Berufstätigkeit auf das im Rahmen der Aus- und Weiterbildung Erlernte sowie die erhaltene Bewilligung findet sich schon in vergleichbarer Art und Weise im geltenden Recht (§ 14 Abs. 3 GesG-E). Neu ist explizit auch die Weiterbildung aufgeführt. Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf Personen, die ohne Bewilligung zur Berufsausübung berechtigt sind (§ 13 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2). Das Angebot von Tätigkeiten, die bewilligungsfrei möglich sind, ist ohne weiteres möglich. So kann auch eine Person mit Berufsausübungsbewilligung bei entsprechenden Kenntnissen zusätzlich zum Beispiel naturheilkundliche Tätigkeiten anbieten. § 15 (Einzelne Berufspflichten) Abs. 1 In Absatz 1 werden die Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind, auf die sich für die Patientinnen und Patienten gestützt auf die Bundesverfassung und das Zivilgesetzbuch ergebenden grundlegenden Rechte gemäss § 28 GesG-E verpflichtet; sie spiegeln sich in der vorliegenden Bestimmung als Pflichten (lit. a). - 53 - Die Aufzeichnungspflicht sowie die öffentlich-rechtliche Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren gemäss Litera b entspricht dem bisherigen Recht. Im Rahmen des Anwendungsbereichs des kantonalen Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 2006 (vgl. Kommentar zu § 28 hinten) gilt grundsätzlich § 21 IDAG. Dies bedeutet, dass jene Daten zu vernichten sind, wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe oder zu Beweis- und Sicherungszwecken nicht mehr benötigt werden (§ 21 Abs. 1 IDAG). Die Frist von 10 Jahren ab Erstellung der Akten gemäss GesG-E stellt in diesem Sinne eine Mindestaufbewahrungsfrist dar und wird explizit als solche bezeichnet. Der Vorbehalt in § 21 Abs. 2 IDAG, wonach Bestimmungen über das Archivwesen vorgehen, hat für Patientenakten keine Bedeutung. Patientenakten fallen grundsätzlich nicht unter die §§ 43 beziehungsweise 45 IDAG. Für die dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992 (SR 235.1) unterliegenden Rechtsverhältnisse gelten dessen Bestimmungen. Gemäss Litera c haben Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind, dafür zu sorgen, dass die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Dies bedeutet insbesondere, dass Personen, deren Berufsrisiken bereits vollumfänglich durch die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers abgedeckt sind (insbesondere Spitalärzte), keine Berufshaftpflichtversicherung abschliessen müssen. Weiter haben Personen, die gemäss MedBG einen universitären Medizinalberuf selbstständig ausüben, gemäss Art. 40 lit. h MedBG auch die Möglichkeit, für die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken anstelle einer Berufshaftpflichtversicherung andere, gleichwertige Sicherheiten zu erbringen. Abs. 2 Um Klarheit hinsichtlich der in der Vernehmlassung aufgeworfenen Frage, ob Patientenakten zwingend nach Ablauf der Mindestaufbewahrungsfrist zu vernichten sind, obwohl sie aufgrund weiterer Zwecke weiterhin aufbewahrungswürdig erscheinen, wird in Absatz 2 eine spezialgesetzliche und damit dem IDAG diesbezüglich vorgehende Regelung aufgenommen. Es wird eine Maximalfrist von 20 Jahren ab Erstellung der Akten sowie die Archivierungsmöglichkeit vorgesehen. Mit Vorliegen von medizinischen Gründen rechtfertigt sich die längere Aufbewahrung beispielsweise für langandauernde Krankheitsbilder, für welche das Zurückgreifen auf ältere Dokumente zur optimalen Behandlung der betroffenen Person ein ärztliches Bedürfnis darstellt (zum Beispiel psychiatrische Behandlungen, Krebsbehandlungen, vererbbare Krankheiten). Ein besonderes öffentliches Interesse, das zur Archivierung von Patientenakten bei in Berufen des Gesundheitswesens tätigen Personen berechtigt, stellt das Forschungsinteresse dar. Bei dieser Archivierung wird die Zugriffsberechtigung restriktiv zu halten und die Aufbewahrung gesondert vorzunehmen sein. Abs. 3 Mit Absatz 3 wird der Regierungsrat ermächtigt, insbesondere Form, Inhalt und Umfang der Dokumentationen näher zu bestimmen (beispielsweise die Bezeichnung der bei einzelnen Berufen aufzuzeichnenden Sachverhalte; Nachvollziehbarkeit von Änderungen; Aufnahme von Vermerken im Sinne einer Gegendarstellung der Patientin beziehungsweise des Patienten). Dabei soll er den berufsspezifischen Besonderheiten Rechnung tragen können. Weiter wird mit der Regelung der Modalitäten der Aufbewahrungspflicht (beispielsweise Aktenaufbewahrung und Übergabe der Praxis an eine Nachfolge) insbesondere den sich im - 54 - Rahmen der bisherigen Rechtsanwendung aufgetretenen Fragen in diesem Bereich begegnet. § 16 (Beistandspflicht) Das MedBG statuiert als Berufspflicht in Art. 40 lit. g Folgendes: "Sie leisten in dringenden Fällen Beistand (…)." Diese für die Medizinalberufe kraft Bundesrecht geltende Pflicht soll für alle Personen, welche einen Beruf im Gesundheitswesen ausüben, Geltung haben. Relativiert wird diese Pflicht zur Nothilfe lediglich insofern, als diese sich im Umfang an den beruflichen Kenntnissen und den Fähigkeiten der einzelnen Berufskategorien zu messen hat. § 17 (Infrastruktur) Unter dem Aspekt der Qualitätssicherung werden neu explizit Anforderungen an die Ausrüstung, Einrichtung und die Räumlichkeiten von Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind, gestellt (§ 17 GesG-E). Denkbar und aufgrund der allgemeinen Mobilität auch immer häufiger ist eine Tätigkeit ohne stationäre Praxis im Kanton (zum Beispiel in Arzt- oder Zahnarztpraxen ambulant tätige Anästhesieärztinnen und Anästhesieärzte, "fahrende Tierarztpraxen" oder Augenoptikerinnen und Augenoptiker). Auch diesfalls wird jedoch eine zweckentsprechende Infrastruktur, die den Anforderungen an eine sorgfältige Berufsausübung entspricht, verlangt. In der Verordnung werden je nach Gefährdungspotential einer Berufstätigkeit ausführende, ergänzende Bestimmungen erlassen. § 18 (Bekanntmachungen) Abs. 1 Ergänzend zur inhaltlich von Art. 40 lit. d MedBG (Werbung) übernommenen Regelung wird umfassend die "Bekanntmachung", das heisst Werbung, allgemein der Auftritt nach Aussen geregelt (§ 18 Abs. 1 GesG-E). In Anbetracht der Bedeutung dieser Bestimmung als Gegenpol zur Liberalisierung der Berufe im Gesundheitswesen rechtfertigt sich eine explizite Regelung der Bekanntmachung im GesG-E (vgl. auch § 13 Abs. 2 und 3 GesG-E). Jegliche Bekanntmachung muss – wie auch für den Geltungsbereich des MedBG vorgesehen – objektiv sein, einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen sowie weder irreführend noch aufdringlich sein. Insbesondere beim öffentlichen Bedürfnis dürfte es sich um ein in der Praxis schwer definierbares Kriterium handeln. Dies ist übrigens ein Punkt, welcher schon bei Erarbeitung des MedBG erkannt wurde. Es ist an der zuständigen (Aufsichts-) Behörde, die Einhaltung der Bestimmungen über eine korrekte Bekanntmachung zu prüfen und hierzu allenfalls allgemein anwendbare Kriterien zu finden. Anhaltspunkte dazu könnten zum Beispiel im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 19. Dezember 1986 (SR 241) und der daraus ergehenden Rechtsprechung gesucht werden. Das UWG hat im Gegensatz zu den gesundheitspolizeilich motivierten Werbebestimmungen primär den lauteren Wettbewerb und das Verhältnis zwischen den Mitbewerbern im Auge. Abs. 2 Je nach Gefährdungspotential soll bei gewissen Berufen und Tätigkeiten eine Liberalisierung der gesundheitspolizeilich motivierten Beschränkungen möglich sein. So kann es angezeigt sein, die Grundsätze der Bekanntmachungen gemäss Absatz 1 im Kontext mit dem Gefährdungspotential des Berufs beziehungsweise der Tätigkeit in der Verordnung zu regeln - 55 - (18 Abs. 2 GesG-E). - 56 - § 19 (Berufsgeheimnis) Abs. 1 Die Wahrung des Berufsgeheimnisses erfährt mit dem Tatbestand von Art. 321 des Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0; Verletzung des Berufsgeheimnisses) einem strafrechtlichen Schutz. Die Schweigepflicht gemäss GesG-E wird wie bis anhin auf alle Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind, sowie ihre Hilfspersonen ausgedehnt. Ausgenommen sind Berufe und Tätigkeiten mit beziehungsweise an Tieren. Absatz 1 gibt die grundsätzlich geltende Schweigepflicht wieder. Abs. 2 Für die verschiedenen Möglichkeiten der Befreiung vom Berufsgeheimnis, welche in Abweichung vom Grundsatz in Absatz 1 gelten, wird in Absatz 2 auf die zwei nachfolgenden Paragrafen verwiesen. § 20 (Meldepflichten) Die beiden meldepflichtigen Sachverhalte entsprechen dem bisherigen Recht. Es handelt sich um strafrechtliche Anzeigen beim zuständigen Bezirksamt. Die zuständige Behörde wird in der Verordnung bezeichnet. Die epidemiologischen Meldepflichten sind abschliessend im Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) vom 18. Dezember 1970 (SR 818.101) geregelt. § 21 (Melderechte) Abs. 1 Die Einwilligung der dazu berechtigten Person oder subsidiär die schriftliche Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Offenbarung des Geheimnisses übernimmt in Absatz 1 die bestehende Regelung. In Anlehnung an die Regelung des Berufsgeheimnisses im StGB (Art. 321) sowie an Lehre und Praxis wird nun ausdrücklich erwähnt, dass das Gesuch um Entbindung vom Berufsgeheimnis von der schweigepflichtigen Person selbst gestellt werden muss. Bei den Verfahren betreffend Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht vollzieht das Departement Gesundheit und Soziales grundsätzlich Art. 321 Ziff. 2 des Strafgesetzbuchs (schriftliche Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde). Das Departement Gesundheit und Soziales entscheidet auf Gesuch hin in einem normalen Verwaltungsverfahren nach VRPG. Die Ermächtigung zur Offenbarung des Geheimnisses wird erteilt, wenn private oder öffentliche Interessen an einer Offenbarung das Geheimhaltungsinteresse überwiegen. Abs. 2 In Absatz 2 wurde die bisherige Möglichkeit des Melderechts von Wahrnehmungen, die auf Verbrechen oder Vergehen schliessen lassen, auf weitere sich aus den Bedürfnissen der Praxis ergebenden Sachverhalte ausgedehnt, für welche sich eine bereits durch den Gesetzgeber vorgenommene Interessenabwägung eignet. Bei Vorliegen des entsprechenden Sachverhalts handelt es sich nicht um eine Pflicht, sondern um ein Recht des Geheimnisträgers. - 57 - Litera a betrifft das Inkasso (Rechnungsstellung, betreibungsrechtliche und prozessuale Geltendmachung) von Forderungen aus dem Behandlungsverhältnis. Da grundsätzlich bereits die Tatsache eines Behandlungsverhältnisses unter das Geheimnis fällt (zum Beispiel psychiatrische Behandlung), wäre für den Gang zum Betreibungsamt beziehungsweise die prozessual vorgesehenen Instanzen ein Entbindungsverfahren durchzuführen, falls die behandelte Person nicht in die Offenbarung einwilligt. Mit der vorgeschlagenen Lösung soll der grundsätzlich schweigepflichtigen Person ermöglicht werden, ohne Zwischenschaltung eines Entbindungsverfahrens das Bestehen der Forderung zu überprüfen und falls sie gerechtfertigt ist, vollstrecken zu lassen. Die Schweigepflicht hat nicht die Funktion, die Durchsetzung berechtigter Forderungen zu erschweren. Litera b soll der Leichenidentifikation (zum Beispiel Anwendungsfall Tsunami-Opfer; Auskünfte gegenüber Kantonspolizei oder Bezirksamt) dienen. Litera c ermöglicht es den behandelnden Personen, Mitteilungen gegenüber der Vormundschaftsbehörde (beziehungsweise der künftigen Kinderschutzbehörde; vgl. lit. d), den Kinderschutzgruppen der Kantonsspitäler Aarau und Baden, den Strafbehörden sowie Kinder betreffende Sachverhalte der häuslichen Gewalt der kantonalen Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt zu machen. Damit wird dem Schutz des Kindeswohls, welchem bei der Interessenabwägung im Entbindungsverfahren jeweils besondere Bedeutung zugemessen wird, Rechnung getragen. In Anwendung von Litera d können Meldungen an die Vormundschaftsbehörden, die Strafbehörden sowie Erwachsene betreffende Sachverhalte der häuslichen Gewalt an die kantonale Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt erfolgen. Hauptanwendungsbereich stellen in ihrer Selbstständigkeit beeinträchtige Personen (dementkranke Personen) dar, zu deren Schutz die Prüfung von vormundschaftlichen Massnahmen ermöglicht werden soll; eine Einwilligung und die Stellungnahme zum Gesuch der schweigepflichtigen Person während des Entbindungsverfahrens ist meist zufolge fehlender Urteilsfähigkeit nicht möglich. Der Begriff "Erwachsenenschutz" entspricht der Terminologie der Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) vom 28. Juni 2006. Heute erfolgen die Meldungen an die Vormundschaftsbehörde; künftig an eine Erwachsenenschutzbehörde zur Prüfung einer Beistandschaft. Die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 440 der Botschaft zur Änderung des Zivilgesetzbuchs übernimmt auch die Aufgaben der Kindesschutzbehörde. Litera e betrifft Meldungen im Zusammenhang mit der Prüfung einer Fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE) in Anwendung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) an die zur Anordnung einer Unterbringung zuständige Behörde (SAR 210.100; § 67 lit. b: Bezirksamt, Vormundschaftsbehörde, Bezirksarzt). Mit Litera f wird den schweigepflichtigen Personen die Möglichkeit eingeräumt, Wahrnehmungen, die auf Verbrechen oder Vergehen schliessen lassen, bei der Strafverfolgungsbehörde anzuzeigen. Eine Einwilligung durch die Geheimnisherrin oder den Geheimnisherrn ist in derartigen Fällen kaum erhältlich. Der Versuch, eine Einwilligung zu erhalten oder eine Stellungnahme während eines Entbindungsverfahrens einzuholen, kann allenfalls auch die polizeilichen Ermittlungen beeinträchtigen. Auch hier handelt es sich lediglich um eine Berechtigung. Die schweigepflichtige Person wird selbst eine Interessenabwägung vornehmen und das Vertrauensverhältnis zum Patienten - 58 - beziehungsweise zur Patientin nicht leichtfertig in Frage stellen. Damit ist davon auszugehen, dass entsprechende Meldungen gravierende Sachverhalte beinhalten, welche sich gegen besonders sensible Rechtsgüter (beispielsweise sexuelle Integrität, Leib und Leben) richten. Litera g versetzt die schweigepflichtige Person in die Lage, zur Wahrung ihrer Verfahrensrechte das Geheimnis zu offenbaren. Mit der Anstrengung von Verfahren gegen die schweigepflichtige Person offenbart die Patientin beziehungsweise der Patient bereits einen Teil des Geheimnisses gegenüber der zuständigen Behörde. Damit beispielsweise eine wirksame Verteidigung ermöglicht wird und die Beurteilung aufgrund aller relevanten Fakten erfolgen kann, ist die schweigepflichtige Person darauf angewiesen, auch ihrerseits das Geheimnis offenbaren zu können. Die Offenbarung erfolgt beispielsweise gegenüber Strafverfolgungsbehörden und gerichtlichen Behörden. Die Bekanntgabe beinhaltet besonders schützenswerte Personendaten. Die zur Offenbarung berechtigenden Fallkonstellationen werden im Gesetz bezeichnet. Die Meldungen an öffentliche Organe erfüllen die Voraussetzungen i.S. von § 14 Abs. 2 IDAG. Die Bekanntgabe durch öffentliche Organe an Inkassostellen ist zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen i.S. von § 15 Abs. 1 lit. c IDAG erforderlich. Die Bekanntgabe durch private Leistungserbringer an Inkassostellen ist aufgrund der Rechtfertigung in Art. 13 Abs. 1 DSG kompatibel. Abs. 3 Die Offenbarung wird in Absatz 3 weiterhin auf die zur Erreichung des bezeichneten Zwecks erforderlichen Daten mit Geheimnischarakter begrenzt. Adressatinnen und Adressaten der Datenpreisgabe sind die für die besonderen Sachverhalte zuständigen Behörden; diese werden vom Regierungsrat bezeichnet. Abs. 4 Für die in Abs. 2 lit. a und g bezeichneten Fallkonstellationen können auch weitere Adressatinnen und Adressaten als die in Absatz 3 erwähnten Behörden in Frage kommen. Im Fall von Litera a sind dies die von der schweigepflichtigen Person für das Inkasso beauftragte rechtliche Vertretung (Rechtsanwalt beziehungsweise von der entsprechenden Verfahrensordnung zugelassene Dritte) und die vertraglich zum Inkasso beauftragte Person (Auslagerung der Rechnungsstelle an Dritte, zum Beispiel Ärztekasse, Treuhandbüro, Inkassobüro). Hinsichtlich Litera g sind es zusätzlich zu ihrer rechtlichen Vertretung ihre Haftpflichtversicherung und eine medizinische Gutachterstelle. Auch gegenüber diesen Dritten soll die Datenbekanntgabe ohne Entbindungsverfahren ermöglicht werden, was mit Absatz 4 vorgesehen wird. Diese Berechtigung setzt allerdings voraus, dass die schweigepflichtige Person dafür besorgt ist, dass der Datenschutz in geeigneter Weise sichergestellt ist. § 22 (Aufsicht) Die Aufsichtsbehörde ist zuständig, um die notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Berufspflichten und -rechte zu treffen zum Beispiel bis hin zum Entzug der Bewilligung gemäss § 10 GesG-E (§ 22 Abs. 1 GesG-E). Grundsätzlich unterliegen die - 59 - bewilligungsfreien Berufe und Tätigkeiten nur dann der Aufsicht, wenn dies zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist (§ 22. Abs. 2 GesG-E) oder im Zusammenhang mit den ihnen obliegenden Pflichten (§13 Abs. 3 i.V.m. § 18 GesG-E) steht. - 60 - § 23 (Verbot der Heiltätigkeit) Im Bereich der bewilligungsfreien Tätigkeiten (inklusive Tätigkeiten und Berufen die gemäss § 4 Abs. 3 GesG-E von der Bewilligungspflicht befreit werden) besteht der Bedarf nach einer Möglichkeit, diese Heiltätigkeit oder allgemein Handlungen in diesem Bereich bei Gesundheitsgefährdung zu verbieten. Dies drängt sich im Gegenzug zur Freigabe der Berufsausübung auf. So muss unbedingt eine staatliche Eingriffsmöglichkeit für den Fall von gesundheitsgefährdenden Verfehlungen auch gegenüber Personen, die eine an sich bewilligungsfreie Heiltätigkeit ausüben gegeben sein (§ 23 GesG-E). Diese staatliche Eingriffsmöglichkeit ist wie erwähnt unabhängig davon, ob der Beruf beziehungsweise die Tätigkeit primär bewilligungsfrei oder zufolge der Regelung gemäss § 4 Abs. 3 GesG-E von der Bewilligungspflicht befreit worden ist. Ebenso unerheblich ist, in welcher Art und Weise (selbstständig oder unselbstständig etc.) die Berufsausübung oder Tätigkeit erfolgt. § 24 (Disziplinarmassnahmen) Disziplinarmassnahmen sind Sanktionen gegenüber Personen, die unter einer besonderen Aufsicht des Staats stehen. Der Zweck von § 24 GesG-E besteht darin, sämtliche Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind (vgl. § 13 Abs. 1 GesG-E), einer disziplinarischen Verantwortlichkeit zu unterstellen. Die Bestimmung entspricht inhaltlich weitgehend Art. 43 MedBG, welcher Disziplinarmassnahmen gegenüber den dem MedBG unterstehenden Personen regelt. Soweit die Bestimmung auf Organisationen und Betriebe im Gesundheitswesen sinngemäss Anwendung findet (vgl. 26 Abs. 4 GesG-E), ist die fachverantwortliche Person zu belangen. Disziplinarisch geahndet werden Verstösse gegen Vorschriften des dritten Kapitels des GesG-E (inklusive Ausführungsbestimmungen): Im Vordergrund steht die Sanktionierung von Verstössen gegen die Berufspflichten (§§ 14–20 GesG-E), daneben fallen auch andere Widerhandlungen in Betracht, beispielsweise die Verletzung der Meldepflicht gemäss § 6 GesG-E. Das Spektrum der möglichen Disziplinarmassnahmen ist sehr weit und reicht von der Verwarnung über die Busse bis zur Anordnung eines Berufsverbots. Besondere Erwähnung verdient die neu geschaffene Möglichkeit, eine Busse bis Fr. 20'000.– auszusprechen (lit. c, die Höhe der Busse entspricht dem Ansatz in Art. 43 Abs. 1 lit. c MedBG). Eine Disziplinarbusse kann allein oder kombiniert mit einem Berufsverbot angeordnet werden. Die Bussenkompetenz der Aufsichtsbehörde ergibt sich für den vom MedBG erfassten Personenkreis – für die Kantone verbindlich – bereits aus dem Bundesrecht; einzig die Ausweitung auf die übrigen in Berufen des Gesundheitswesens tätigen Personen ist dem Bereich autonomer kantonaler Rechtssetzung zuzuordnen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Bussenkompetenz der Aufsichtsbehörde nicht in Widerspruch zu § 99 Abs. 2 KV steht. Die in § 99 Abs. 2 KV vorgesehene Beschränkung der Bussenkompetenz von kantonalen Verwaltungsstellen und Gemeindebehörden gilt nur für den Bereich des Straf- und Verwaltungsstrafrechts, nicht jedoch für jenen des Disziplinarrechts, das heisst Disziplinarbussen fallen nicht unter § 99 Abs. 2 KV (vgl. Arbeitsgruppe neue Kantonsverfassung, Sitzung vom 6. Juli 1981, Bussenkompetenz der kantonalen Verwaltungsstellen und Gemeindebehörden gemäss § 99 Abs. 2 nKV). Mit der geringfügig vom MedBG (Art. 43 Abs. lit. d und e) abweichenden Formulierung in § 24 lit. d GesG-E wird klar gestellt, dass ein befristetes Berufsverbot nicht nur für das ganze, sondern - 61 - auch nur für einen Teil des Tätigkeitsspektrums angeordnet werden kann. Die Aussprechung eines Berufsverbots ist mitunter auch gegenüber Personen möglich, die fachlich unselbstständig in bewilligungspflichtigen Berufen tätig sind (vgl. § 7 und 8 GesG-E). Personen, die einen bewilligungsfreien Beruf ausüben, unterstehen keiner besonderen Aufsicht des Staats. Sie sind daher vom Geltungsbereich von § 24 GesG-E nicht erfasst; allfällige Verfehlungen werden nicht disziplinarisch, sondern strafrechtlich geahndet (§ 54 GesG-E, vgl. auch Berufsverbot gemäss § 23 GesG-E). 4. Organisationen und Betriebe im Gesundheitswesen § 25 (Betriebsbewilligungspflicht) Abs. 1 Die Pflicht zur Erreichung einer Betriebsbewilligung umfasst mit wenigen Ausnahmen dieselben Organisationen und Betriebe wie in den geltenden kantonalen Bestimmungen (§ 25 Abs. 1 GesG-E). Die Betriebsbewilligung wird auf die gesamtverantwortliche Leitungsperson ausgestellt. Wie bereits unter geltendem Recht bereits bei Apotheken und Drogerien gelebt, benötigen Betriebe gemäss § 25 GesG-E sowohl eine Betriebsbewilligung als auch muss kumulativ die gesamtverantwortliche Person grundsätzlich im Besitz einer Berufsausübungsbewilligung sein (vgl. § 26 GesG-E). Eine Betriebsbewilligung benötigen insbesondere sowohl öffentliche Apotheken als auch Spitalapotheken (§ 25 Abs. 1 lit. a GesG-E) sowie Drogerien (§ 25 Abs. 1 lit. b GesG-E). Neben den bereits bisher im GesG-1987 bewilligungspflichtigen Betrieben gestützt auf die Krankenversicherungsgesetzgebung (Spitex-Organisationen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. e KVG und Art. 51 KVV, Organisationen der Ergotherapie gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. e KVG und Art. 52 KVV, Laboratorien gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. f KVG und Art. 53 f. KVV, Abgabestellen für Mittel und Gegenstände gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. g KVG und Art. 55 KVV) sind neu auch Transport- und Rettungsunternehmen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. m KVG und Art. 56 KVV bewilligungspflichtig (§ 25 Abs. 1 lit. c GesG-E). Ebenso fallen unter die in § 25 Abs. 1 lit. c GesG-E durch die Krankenversicherungsgesetzgebung bezeichneten Leistungserbringer die so genannten Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärztinnen und Ärzte dienen (Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG). Davon zu unterscheiden sind Einzel- oder Gruppenpraxen, die ausser der Berufsausübungsbewilligung (vgl. § 4 GesG-E) keine zusätzliche Betriebsbewilligung benötigen. Unter Einrichtungen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG können HMO-Praxen aber auch andere Zentren der ambulanten Versorgung gezählt werden. Ärztinnen und Ärzte sind im Rahmen eines vertraglichen Angestelltenverhältnisses dort fachlich selbstständig tätig (dies im Unterschied zu Assistenzarztverhältnissen gemäss § 8 GesG-E). Inhaltlich können solche Zentren beispielsweise als Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten mit Angehörigen weiterer Berufe im Gesundheitswesen verstanden werden, denkbar sind jedoch auch Einrichtungen, die medizinische Dienstleistungen ausschliesslich für andere Leistungserbringer im diagnostischen (zum Beispiel Radiologie und Pathologie) oder Behandlungsbereich (zum Beispiel Anästhesie) anbieten. - 62 - Ebenfalls wird neu in § 25 Abs. 1 lit. d GesG-E eine subsidiäre Bewilligungspflicht für Institutionen, die medizinische Forschung an Menschen betreiben, statuiert. Dabei ist an Firmen oder Institutionen zu denken, die ausserhalb anderer Bewilligungen (zum Beispiel Spital, Rehaklinik) Forschung an Menschen betreiben. Abs. 2 Neben den bereits erwähnten möglichen Betriebsbewilligungen gemäss Spital- oder Pflegegesetzgebung fallen unter die aufgrund anderer Bestimmungen erteilten Bewilligungen mitunter auch die Detailhandelsbewilligungen (vgl. §§ 43 ff. GesG-E) nach HMG (§ 25 Abs. 2 GesG-E). § 26 (Bewilligungsvoraussetzungen) Abs. 1 Die Voraussetzungen zur Erteilung der Betriebsbewilligung richten sich – so möglich – primär nach den bundesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Heilmittel- und Krankenversicherungsgesetzgebung (§ 26 Abs. 1 lit. a GesG-E). Bei Betrieben und Organisationen ausserhalb des HMG/KVG-Bereichs sowie falls zum Beispiel die Zulassungsvoraussetzungen offen formuliert sind (zum Beispiel "erforderliches Fachpersonal", vgl. zum Beispiel Art. 51 lit. c KVV), werden die fachlichen, strukturellen und personellen Anforderungen in der Verordnung geregelt. Unter den Begriff "strukturelle Anforderungen" fallen Räumlichkeiten, Labor, Einrichtungen u.ä. Wie unter geltendem Recht bei Apotheken und Drogerien muss für eine Betriebsbewilligung eine gesamtverantwortliche Leitungsperson bezeichnet werden, die über eine Berufsausübungsbewilligung verfügt (Ausnahmen gemäss § 26 Abs. 3 GesG-E). Selbstredend hat die gesamtverantwortliche Leitungsperson während den Betriebszeiten grundsätzlich anwesend zu sein (zur Stellvertretung siehe § 26 Abs. 1 lit. d GesG-E und § 27 Abs. 1 GesG-E). Die Bezeichnung einer gesamtverantwortlichen Leitungsperson dient der Qualitätssicherung sowie ist unter dem Aspekt der Gleichbehandlung in Bezug auf die Ausbildung und praktische Tätigkeit mit freiberuflich tätigen Personen (zum Beispiel Pflegefachfrau oder Pflegefachmann etc.) zu sehen. Da ohne weiteres die gesamtverantwortliche Leitungsperson nicht Eigentümerin oder Eigentümer des Betriebs beziehungsweise der Organisation sein muss, ist der Freiheit in der Entscheidfindung von Fachfragen gebührende Bedeutung beizumessen (§ 26 Abs. 1 lit. c GesG-E). Bei Abwesenheit der gesamtverantwortlichen Leitungsperson muss zwingend eine fachlich qualifizierte Stellvertretung sichergestellt sein. Konzeptionell ist dies bereits bei der Bewilligungserteilung nachzuweisen und in der Umsetzung entsprechend vorzunehmen. Die Abwesenheit kann vorübergehend oder für einen gewissen Zeitraum (zum Beispiel Ferien, Weiterbildung, Mutterschaftsurlaub etc.) andauernd sein. Mitunter dürfte gerade bei Apotheken und Drogerien aufgrund der Öffnungszeiten die Frage nach der Abdeckung durch die gesamtverantwortliche Person beziehungsweise der adäquaten Stellvertretung von Bedeutung sein. Sind die Betriebszeiten grösser als die Anwesenheit der gesamtverantwortlichen Leitungsperson ist eine fachlich qualifizierte Stellvertretung sicherzustellen. Alle Organisationen und Betriebe müssen das Thema Stellvertretung - 63 - qualifiziert regeln (§ 26 Abs. 1 lit. d GesG-E). Stellvertretungen in Drogerien, Apotheken und Einrichtungen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG sind zusätzlich bewilligungspflichtig (vgl. § 27 GesG-E). In den anderen Betrieben und Organisationen ist keine Stellvertreterbewilligung nötig. Abs. 2 In Einrichtungen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG benötigen alle fachlich selbstständig tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie alle weiteren fachlich selbstständig in Berufen des Gesundheitswesens tätigen Personen (zum Beispiel Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten) eine Berufsausübungsbewilligung, dies im Unterschied zu anderen Betrieben gemäss § 25 GesG-E. Dies rechtfertigt sich unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit (vgl. § 39 GesG-E) und allgemein aus gesundheitspolizeilichen Überlegungen (§ 26 Abs. 2 GesG-E). Abs. 3 Wie erwähnt richten sich die zu formulierenden Voraussetzungen zur Erteilung der Betriebsbewilligung primär nach den HMG/KVG-Bestimmungen. Bei Betrieben und Organisationen, bei denen bei den Bewilligungsvoraussetzungen nicht auf bundesrechtliche Vorgaben abgestützt werden kann, sind die fachlichen, strukturellen und personellen Anforderungen in der Verordnung zu regeln. So wird beispielsweise bei Rettungsdiensten auf die Richtlinien des Interverbands für Rettungswesen zu verweisen sein. Allgemein werden in der Verordnung mitunter detaillierte Aussagen zu den Bewilligungsvoraussetzungen für die einzelnen Betriebe und Organisationen zu machen sein. Insbesondere wird eine Aussage notwendig, was unter fachlich qualifizierter Stellvertretung zu verstehen ist, auf wie viele Personen diese verteilt werden kann und welchen zeitlichen Umfang eine Stellvertretung haben kann. Ausnahmen vom Erfordernis, dass die gesamtverantwortlichen Leitungsperson im Besitz einer Bewilligung gemäss § 4 sein muss, können sich aus betriebsinhärenten Gründen zum Beispiel bei Transport- und Rettungsunternehmen, Abgabestellen für Mittel und Gegenstände aufdrängen (§ 26 Abs. 3 GesG-E). Abs. 4 Die Bestimmungen insbesondere zur Schliessung eines Betriebs/Entzug der Betriebsbewilligung und die Berufspflichten und -rechte haben sinngemäss Gültigkeit (§ 26 Abs. 4 GesG-E). § 27 (Stellvertretung in Apotheken, Drogerien und Einrichtungen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG) Abs. 1 Die Stellvertretung bei Apotheken (öffentliche Apotheken und Spitalapotheken), Drogerien und Einrichtungen gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG ist bewilligungspflichtig. Bei Tod der verantwortlichen Leitungsperson kommt die Möglichkeit gemäss § 9 GesG-E ebenfalls zur Anwendung (§ 27 Abs. 1 GesG-E). Abs. 2 - 64 - Mitunter werden in der Verordnung detaillierte Aussagen zu diesen Stellvertreterbewilligungsvoraussetzungen zu normieren sein. Denkbar ist, dass die Stellvertretung durch mehrere Personen wahrgenommen wird, dazu werden in der Verordnung Minimal- und Maximalansätze formuliert sowie allenfalls Aussagen zur Pensenteilung erfolgen. Ebenfalls werden Aussagen zu Umfang und Dauer einer möglichen Stellvertretung zu machen sein (§ 27 Abs. 2 GesG-E). Abs. 3 Die allgemeinen Regelungen zur Stellvertretung, die Bestimmungen zur Schliessung eines Betriebs/Entzug der Betriebsbewilligung und Veröffentlichung sowie gewisse Berufspflichten und -rechte haben sinngemäss Gültigkeit, letztere durch Verweis auf § 26 GesG-E (§ 27 Abs. 3 GesG-E). 5. Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patienten Einleitung Im Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten im Bereich Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patienten erfolgte auch eine Überprüfung der Bestimmungen hinsichtlich des schon länger bestehenden als auch insbesondere des kürzlich in Kraft getretenen Bundesrechts. Entsprechend erwiesen sich verschiedene Bestimmungen des geltenden Gesundheitsgesetzes als gänzlich oder teilweise nicht mehr erforderlich. Es handelt sich dabei um folgende bisherigen Regelungsbereiche: § 50 GesG-1987 (Künstliche Befruchtung) Am 1. Januar 2001 ist das Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) vom 18. Dezember 1998 in Kraft getreten. Damit entfiel die Anwendbarkeit bisheriger kantonaler Bestimmungen im Bereich der medizinisch unterstützten Fortpflanzung. Aus dem Bundesrecht ergaben sich keine zwingend neu zu erlassenden Regelungen. Somit ist eine kantonale Regelung nicht mehr erforderlich. § 51GesG-1987 (Sterilisation, Kastration) Am 1. Juli 2005 ist das Bundesgesetz über Voraussetzungen und Verfahren bei Sterilisationen (Sterilisationsgesetz) vom 17. Dezember 2004 in Kraft getreten. Damit entfiel die Anwendbarkeit bisheriger kantonaler Bestimmungen im Sterilisationsbereich zu Verhütungszwecken. Zeitgleich wurde die kantonale Einführungsverordnung zu diesem Bundesgesetz in Kraft gesetzt, worin die gestützt auf das Bundesrecht erforderlichen Bestimmungen erlassen wurden. Mit dem kantonalen Erlass wurde die Verordnung über die Sterilisation unmündiger und entmündigter Personen vom 7. November 2001 aufgehoben. Die vom Bundesrecht nicht erfasste kantonale Regelung (Sterilisation und Kastration zu anderen als Verhütungszwecken) wurde hinsichtlich ihrer praktischen Bedeutung überprüft. Die chirurgische Kastration – die operative Entfernung der Keimdrüsen (Eierstöcke, Hoden) – wie auch die hormonale (medikamentöse) Kastration werden nicht als Methode zur Beseitigung der Fortpflanzungsfähigkeit zugelassen (vgl. Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 23. Juni 2003, S. 6322). Die chirurgische Kastration hat keine praktische Bedeutung mehr (auch nicht bei Triebtätern). Die medikamentöse - 65 - Kastration ist in der Praxis nur ein ganz marginales Thema; sie ist reversibel und wurde nur sehr selten angewendet (Androcur; denkbar bei Triebtätern). - 66 - Noch denkbare Anwendungsfälle unterstehen der Regelung über die Grundsätze der Wissenschaft und Berufsethik (vorgängige psychiatrische Beurteilung bei Sexualtätern), gelten als normaler Heileingriff (Karzinome in den Keimdrüsen) oder als medizinische Massnahme (Sexchange [Krankenkassen verlangen psychiatrisches Gutachten]; Hermaphrodit [Zwitter]). Für den Bereich, der nicht schon vom Bundesrecht erfasst ist, erübrigt sich mangels tatsächlicher praktischer Bedeutung eine kantonale Regelung. § 52 GesG-1987 (Entnahme und Verpflanzung von Gewebeteilen oder Organen) Am 1. Juli 2007 ist das Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) vom 8. Oktober 2004 in Kraft getreten. Damit entfiel die Anwendbarkeit bisheriger kantonaler Bestimmungen betreffend die Verpflanzung von Gewebeteilen oder Organen sowie die zu diesem Zweck vorgenommenen Entnahmen. Zeitgleich wurde die kantonale Einführungsverordnung zu diesem Bundesgesetz in Kraft gesetzt, worin die gestützt auf das Bundesrecht erforderlichen Bestimmungen erlassen wurden. Die vom Bundesrecht nicht erfasste kantonale Regelung (Entnahme von Organen und Geweben zu anderen als Transplantationszwecken) wurde überprüft. Das Erfordernis der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Spender und Empfänger (bisheriger Abs. 1) ist bereits durch das generelle Recht auf Einwilligung abgedeckt. Die Entnahme zu Forschungszwecken (bisheriger Abs. 4) wird in die künftige Bestimmung über die Forschung überführt. Der Umgang mit embryonalen und fetalen Gewebeteilen und Organen beziehungsweise Material (bisherige Abs. 5 und 6) für andere als Transplantationszwecke ist in Teilbereichen im Fortpflanzungsmedizin-, Stammzellenforschungs-, Sterilisations-, und Transplantationsgesetz sowie im Gesetz über die genetischen Untersuchungen beim Menschen bereits geregelt und wir auch Thema im künftigen Humanforschungsgesetz sein. Nachdem der Bund somit die für diesen Bereich erforderlichen Regelungen bereits erlassen hat beziehungsweise in absehbarer Zeit erlassen wird, erübrigen sich Bestimmungen auf kantonaler Ebene. § 54 GesG-1987 (Sterbehilfe) Der bisherige Absatz 1 regelte die aktive Sterbehilfe. Die direkte aktive Sterbehilfe ist bereits durch das Strafgesetzbuch verboten (gezielte Tötung; zum Beispiel Spritze, die zum Tod führt). Diesbezüglich ist eine kantonale Regelung überflüssig. Die indirekte aktive Sterbehilfe (Nebenwirkung von Medikament setzt Lebensdauer herab; zum Beispiel Morphium) ist im Strafgesetzbuch nur indirekt geregelt. Sie ist gemäss den SAMW-Richtlinien zulässig und wird auch im Aargau praktiziert. Sie ist im Gesundheitsgesetz nicht speziell zu regeln. Der bisherige Absatz 2 bezog sich auf die passive Sterbehilfe (Verzicht auf Aufnahme oder Abbruch von lebenserhaltenden Massnahmen; zum Beispiel Sauerstoffgerät abstellen). Sie ist im Strafgesetzbuch ebenfalls nur indirekt geregelt, gemäss den SAMW-Richtlinien zulässig und wird auch im Kanton Aargau praktiziert. Da dieser Bereich durch das Strafgesetz, die SAMW-Richtlinien und die Berufsethik bereits genügend gesteuert wird, erübrigt sich hier eine kantonale Regelung (vgl. dazu Kapitel 2.2.5 und 3.1.5). - 67 - - 68 - § 28 (Grundsätze) Die Rechte der Patientinnen und Patienten sind Ausfluss verschiedener verfassungsmässiger Rechte (insbesondere Art. 7 BV: Recht auf Schutz der Menschenwürde; Art. 10 BV: Recht auf Leben und persönliche Freiheit; Art. 13 BV: Recht auf Schutz vor Missbrauch der persönlichen Daten) und Gegenstand anderer grundlegender Normen (zum Beispiel Art. 28 ff. ZGB). Die im Gesundheitsgesetz enthaltenen Patientenrechte gelten grundsätzlich für alle Rechtsbeziehungen zwischen medizinischen Leistungserbringern und Patientinnen beziehungsweise Patienten, ungeachtet dessen, ob es sich um privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse im ambulanten oder stationären Bereich handelt. Abs. 1 und 2 § 28 Abs. 1 und 2 GesG-E statuieren im Sinne einer Grundsatzerklärung den Anspruch der Patientinnen und Patienten auf Wahrung dieser Rechte, wobei Abs. 2 die grundlegendsten Patientenrechte aufführt. Dazu gehören auch das Recht auf Akteneinsicht beziehungsweise Aktenherausgabe sowie das Recht auf Schutz der Daten (§ 28 Abs. 2 lit. d und e GesG-E). Für diese Rechte bestehen Schnittstellen zu spezialgesetzlichen Grundlagen, dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992 (SR 235.1) einerseits sowie dem kantonalen Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 2006 andererseits. Abs. 3 Die Patientenrechte gemäss Abs. 2 lit. a–c können durch Verordnung des Regierungsrats eingeschränkt werden. Absatz 3 verlangt dafür ein gegenüber dem Patientenrecht höherwertiges privates oder öffentliches Interesse. Es handelt sich dabei nicht um schwerwiegende Grundrechtseingriffe. Entsprechend der geltenden Regelung in § 7 Abs. 2 des Patientendekrets könnte der zuständige Arzt ein Besuchsverbot anordnen, wenn es das medizinische Interesse der Patientin oder des Patientin erfordert. Ein anderer Anwendungsfall wäre analog § 12 des Patientendekrets, zunächst die Aufklärung der Patientin beziehungsweise des Patienten nicht vorzunehmen, wenn sie geeignet ist, diesen beziehungsweise diese übermässig zu belasten. Die Aufklärung hat jedoch zu erfolgen, wenn der Patient beziehungsweise die Patientin die umfassende Information ausdrücklich wünscht. Ein weiterer Anwendungsfall wäre die Situation, in welcher die gesetzliche Vertretung ihre Zustimmung zu einer lebensrettenden Massnahme verweigert und der Arzt beziehungsweise die Ärztin die Verweigerung der Zustimmung in dringenden Fällen missachten darf (entsprechend § 17 Abs. 2 des Patientendekrets). Da in Absatz 3 ein gegenüber dem Patientenrecht höherwertiges privates oder öffentliches Interesse verlangt wird, stellt diese Bestimmung entgegen einzelner in der Vernehmlassung geäusserter Bedenken kein Freipass für den Regierungsrat dar, die Patientenrechte nach Gutdünken einzuschränken. Die in der Vernehmlassung aufgeworfene Frage, ob gestützt auf § 28 Abs. 3 Zwangsbehandlungen ermöglicht würden, ist zu verneinen, da eine Zwangsbehandlung ein schwerwiegender Grundrechtseingriff darstellen würde, der im Gesetz selbst vorgesehen sein müsste. Auch eine Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE) stellt einen - 69 - schwerwiegenden Grundrechtseingriff dar; deren spezifische Bestimmungen hinsichtlich Voraussetzungen beziehungsweise Inhalt bundesrechtlich und bezüglich Verfahren kantonalrechtlich geregelt ist (vgl. Botschaft zu § 29 unten); die Bestimmungen des GesG-E lassen jene Bestimmungen unberührt. Abs. 4 Gemäss seinem Geltungsbereich gilt das DSG für die Bearbeitung von Daten durch private Personen (Art. 2 Abs. 1 DSG). Das IDAG gilt für den Umgang mit Personendaten durch öffentliche Organe, wobei als öffentliche Organe nicht nur alle Behörden, Kommissionen und Organe von öffentlich-rechtlichen Anstalten auf kantonaler und kommunaler Ebene gelten, sondern auch natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechts, die öffentliche Aufgaben erfüllen (§ 1 lit. b i.V.m. § 3 lit. c Ziff. 1 und 2 IDAG). Dies bedeutet, dass – je nach konkretem Rechtsverhältnis der medizinischen Behandlung – das DSG oder das IDAG anwendbar ist. Das IDAG (inklusive Rechtsschutz; vgl. § 32 Abs. 3 GesG-E) gilt demnach für Spitäler und Heime, soweit sie einen öffentlichen Versorgungsauftrag haben (Spitalkonzeption vgl. § 6 Spitalgesetz; Pflegeheimkonzeption vgl. § 4 Pflegegesetz). Das DSG (inklusive Rechtsschutz; vgl. Art. 15 DSG) gilt demgegenüber für das Rechtverhältnis zwischen Patientinnen und Patienten und ambulanten Leistungserbringern sowie den privaten Spitälern und Heimen ohne öffentlichen Versorgungsauftrag. Mit § 28 Abs. 4 GesG-E werden diese spezialgesetzlichen Grundlagen vorbehalten und damit die Schnittstelle zum GesG-E geklärt. Im Anwendungsbereich des kantonalen Datenschutzrechts bedeutet dies aufgrund der allgemeinen Rechtsgrundsätze, dass datenschutzrechtliche Bestimmungen des spezielleren und neueren Gesundheitsgesetzes vorgehen, sofern diese ein mindestens gleich hohes Schutzniveau wie das IDAG bieten. Zusammenfassend gelten die im Datenschutzrecht anwendbaren Grundlagen gemäss nachstehender Grafik wie folgt: - 70 - Behörden (Behörden, Kommissionen und Organe von öffentlich-rechtlichen Anstalten auf kantonaler und kommunaler Ebene; vgl. § 3 lit. c Ziff. 1 IDAG) IDAG Spitäler/Heime mit öffentlichem Versorgungsauftrag (öffentliche Organe i.S. von § 3 lit. c Ziff. 2 IDAG) Private Spitäler und Heime ohne öffentlichen Versorgungsauftrag ambulante Leistungserbringer IDAG DSG DSG Patientinnen und Patienten - 71 - Abs. 5 Bei der Regelung der Einzelheiten auf Verordnungsstufe gemäss Absatz 5 handelt es sich einerseits um Details zu den Patientenrechten (beispielsweise den Umfang der Aufklärung (insbesondere Arzt, Zweck, Risiken Kosten; freie und aufgeklärte Einwilligung), und anderseits um Bestimmungen zu den Patientenpflichten (beispielsweise, sich an die Hausordnung zu halten und auf Mitpatientinnen beziehungsweise Mitpatienten und Personal Rücksicht zu nehmen). § 29 (Einschränkung der Bewegungsfreiheit) Abs. 1 Diese Bestimmung soll die Rechtsgrundlage für in der Praxis vorkommende Massnahmen wie Gitter am Bett gegen Stürze oder Fixationen bilden. Es handelt sich dabei nicht mehr um einen nicht schwerwiegenden Grundrechtseingriff, weshalb dessen Regelung bereits auf Gesetzesebene erfolgt. Die Bestimmung ist explizit als Massnahme in einer Ausnahmesituation mit restriktiv gehaltenen Voraussetzungen formuliert. Zusätzlich zur besonders im Zentrum stehenden Abwägung der Verhältnismässigkeit wird ausdrücklich die Befristung und Dokumentation verlangt. Nach bisherigem Recht gibt es nur für die Durchführung von Zwangsmassnahmen im Rahmen einer Fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE) und von Zwangsmassnahmen in der psychiatrischen Klinik Königsfelden eine Rechtsgrundlage (Art. 397a ff. ZGB und § 67a ff. EG ZGB; SAR 210.100). Handelt es sich um ein FFE-Verfahren, sind dessen spezifischen Bestimmungen anzuwenden. Liegt eine Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FRE) vor, gelten weiterhin die spezifischen Bestimmungen des ZGB und EG ZGB. Mit der Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) vom 28. Juni 2006 werden mit Art. 383 die Voraussetzungen für die Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen definiert. Daher sollen im kantonalen Recht lediglich die Spitäler geregelt werden. Abs. 2 Die Möglichkeit der Anrufung einer Stelle gemäss Absatz 2 lehnt sich eng an die geplanten Bestimmungen zum neuen Erwachsenenschutzrecht des Bundes an (dort soll die künftige Erwachsenenschutzbehörde angerufen werden können). § 30 (Forschung) Abs. 1 und 3 Die Bestimmungen zur Forschung entsprechen weitgehend dem bisherigen Recht. Es handelt sich um eine Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten des Verfassungsartikels und des Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen. Den Bestimmungen gehen aktuell insbesondere die Bestimmungen der Heilmittelgesetzgebung (insbesondere HMG und VKlin) - 72 - und des Stammzellenforschungsgesetzes vor. Für die Forschung mit beziehungsweise an Tieren findet die Tierschutzgesetzgebung Anwendung. Entsprechend den Grundsätzen des ZGB hat die gesetzliche Vertretung (Abs. 1 lit. b und c GesG-E) bei ihrem Entscheid die Mündelinteressen wahrzunehmen, weshalb sich die in der Vernehmlassung angeregte Aufnahme einer entsprechenden Verpflichtung der gesetzlichen Vertretung im GesG-E erübrigt. Auch die von Vernehmlassenden vorgeschlagene Ergänzung, wonach die Einwilligung jederzeit widerrufen werden könne, erscheint nicht erforderlich. Zunächst ist das Recht einer Versuchsperson, die Einwilligung jederzeit und ohne Beeinträchtigung ihrer therapeutischen Betreuung zu widerrufen, bereits in Art. 54 Abs. 1 lit. e Ziff. 6 HMG statuiert. Hinzu kommt, dass vorliegend davon ausgegangen wird, dass Einwilligungen generell jederzeit widerrufen werden können. Abs. 2 Mit der Ausdehnung der Voraussetzungen für die Forschung am Menschen gemäss Absatz 2 (nicht mehr nur in Institutionen und nicht mehr nur unter Leitung und Verantwortung einer Ärztin beziehungsweise eines Arzts) wurde eine sinnvolle Öffnung der Bestimmung im Wissen um die Bedeutung des Forschungsstandorts Aargau vorgenommen. Auf die Funktion der Ethikkommission im Bereich der Forschung wird in der Verordnung eingegangen (vgl. auch § 2 Abs. 2 GesG-E). § 31 (Obduktion) Abs. 1 Die bisherige Widerspruchslösung wurde in eine grundsätzliche Zustimmungslösung umgewandelt, was dem allgemeinen Einwilligungserfordernis in medizinische Eingriffe entspricht. Abs. 2 Die zum Kreis der Zustimmungsberechtigten gehörenden nächsten Angehörigen gemäss Abs. 2 werden in der Verordnung definiert. Es werden zunächst die von der urteilsfähigen Patientin beziehungsweise die vom urteilsfähigen Patient bezeichneten Personen sein. Mangels Urteilsfähigkeit oder Bezeichnung sind es insbesondere die Lebenspartner und die nahen Blutsverwandten. Dies entspricht der geltenden Regelung in § 2 des Patientendekrets. Abs. 3 Für Obduktionen, welche aus Gründen der öffentlichen Gesundheit auch gegen den Willen der zustimmungsberechtigten Personen zulässig sein sollen, wurde neu in Abs. 3 eine explizite Grundlage geschaffen. Die im gleichen Absatz enthaltene Konstellation der zwingend notwendigen näheren Abklärung der Todesursache entspricht bisherigem Recht und dient der Qualitätssicherung. Abs. 4 - 73 - Abs. 4 entspricht dem bisherigen § 55 Abs. 4 GesG. Er beinhaltet den Hinweis darauf, dass die Obduktion mit § 31 GesG-E nicht abschliessend geregelt wird. - 74 - Abs. 5 Absatz 5 betrifft die Überführung des nach Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes noch zu regelnden Teils der bisherigen Bestimmungen zur Entnahme und Verpflanzung von Gewebeteilen oder Organen (§ 52 Abs. 4 GesG-1987). Er regelt die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen nach dem Tod zu Forschungszwecken. Aufgrund des Gesetzestexts entstand im Vernehmlassungsverfahren berechtigterweise die Befürchtung, dass mit dieser Regelung auch Absatz 3 Anwendung finden würde und damit auch Entnahmen gegen den Willen der zustimmungsberechtigten Personen möglich sein würden. Entsprechend der tatsächlichen Absicht wird in diesem Absatz nun ausdrücklich nur auf die Absätze 1 und 2 verwiesen, womit klargestellt ist, dass die Entnahmen zu Forschungszwecken gegen den Willen der zustimmungsberechtigten Personen nicht zulässig ist. Die in der Vernehmlassung geäusserte Frage, ob § 31 auch für Transplantationen gelte, ist zu verneinen; Handlungen zum Zweck der Transplantation werden abschliessend durch die Bundesgesetzgebung geregelt (vgl. 5. Einleitung; oben) § 32 (Rechtsschutz) Abs. 1 Patientenrechtsstreitigkeiten werden gemäss Absatz 1 auf dem zivilrechtlichen Verfahrensweg entschieden, sofern die Leistungserbringer beziehungsweise ihre Trägerschaften dem Privatrecht unterliegen. Dies sind insbesondere die Kantonsspitäler Aarau und Baden sowie die Psychiatrischen Dienste Aargau AG oder andere stationäre Einrichtungen in Form von Stiftungen oder Vereinen sowie die ambulanten Leistungserbringer. Entsprechende Streitigkeiten aus dem Bereich von öffentlich-rechtlichen Institutionen (beispielsweise Krankenheim Lindenfeld, Regionales Krankenheim Baden) werden auf dem verwaltungsrechtlichen Verfahrensweg entschieden, wobei die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes zur Anwendung gelangen. Abs. 2 In Absatz 2 werden besondere Verfahrensbestimmungen im Anwendungsbereich des eidgenössischen oder kantonalen Datenschutzrechts vorbehalten (vgl. § 28 Abs. 2 lit. d und e und Abs. 4 GesG-E). Datenschutzrechtliche Streitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis mit privaten Institutionen ohne öffentlichen Versorgungsauftrag werden gleich wie jene aus dem Rechtsverhältnis mit ambulanten Leistungserbringern in Anwendung von Art. 15 DSG vor dem Zivilrichter entschieden, wobei die Artikel 28ff. ZGB (Persönlichkeitsschutz) gelten. Datenschutzrechtliche Streitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis mit Institutionen mit öffentlichem Versorgungsauftrag sind öffentliche Organe i.S. von § 3 lit. c Ziff. 2 IDAG, weshalb sich das Verfahren nach dem IDAG richtet. Handelt es sich um öffentlich-rechtliche Institutionen, haben diese nach dem Schlichtungsverfahren allenfalls eine begründete Verfügung im Sinne von § 38 IDAG zu erlassen. Sind es Institutionen des Privatrechts, haben sie grundsätzlich keine Verfügungsbefugnis; diese steht ihnen indessen in diesem - 75 - Bereich kraft IDAG zu. Das Verfügungs- und Beschwerdeverfahren richtet sich bei öffentlichrechtlichen und zivilrechtlichen Institutionen nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz. 6. Gesundheitsvorsorge § 33 (Grundsatz) Abs. 1 In § 33 GesG-E wird der Grundsatz der geteilten Verantwortlichkeit für die Gesundheit verankert. Die primäre Eigenverantwortung jeder und jedes Einzelnen für die eigene Gesundheit wird in Absatz 1 explizit festgehalten. Damit ist gemeint, dass jede und jeder selber für die persönliche Gesundheit im Rahmen der eigenen Möglichkeiten verantwortlich ist. Dies beinhaltet einerseits, dass die gesundheitsförderlichen Aspekte und die Gesundheitsrisiken erkannt und letztere soweit als möglich vermieden werden. Andererseits gehört zur Eigenverantwortung auch eine gesunde Lebensweise wie beispielsweise ausreichende Bewegung und gesunde Ernährung, Verzicht auf Tabak, massvoller Umgang mit Alkohol sowie den nötigen Ausgleich zur Stressbewältigung schaffen. Abs. 2 Nicht alle für die Gesundheit massgebenden Faktoren liegen innerhalb des Einflussbereichs der Individuen. § 33 Abs. 2 GesG-E sieht deshalb eine subsidiäre Verantwortung der öffentlichen Hand vor. Der Kanton und die Gemeinden setzen sich dafür ein, dass die Einzelnen durch gute Rahmenbedingungen und ausreichende Informationen und Unterstützung in der Lage sind, die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit auch wirklich wahrnehmen zu können. Sie sorgen zudem dafür, dass schädliche Umwelt- und Umfeldeinflüsse (natürliche und soziale) vermindert oder aufgehoben werden. § 33 GesG-E stellt eine reine Grundsatzbestimmung dar. Konkrete Massnahmen sind aus dem statuierten staatlichen Engagement nicht ableitbar. Bereits heute hat das Gemeinwesen Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Die gesetzliche Verankerung der geteilten Verantwortung vergrössert diese nicht generell. Die Regelung im neuen Gesundheitsgesetz ist aufwandneutral. § 34 (Gesundheitsvorsorge) Ziel der Gesundheitsvorsorge ist es, die bestehende Gesundheit zu erhalten und zu fördern sowie Krankheiten und Unfälle zu verhüten. § 34 GesG-E statuiert das Zusammenwirken des Kantons mit privaten und öffentlichen Organisationen, welche im Gebiet der Gesundheitsvorsorge aktiv sind, wie es in der Strategie 2 der GGpl vorgesehen ist. Weiter wird die rechtliche Grundlage für Massnahmen der Gesundheitsförderung, der Prävention und des Gesundheitsschutzes in Bezug auf Gefährdungen durch belastende Lebensbedingungen geschaffen. Der Massnahmenkatalog ist abschliessend. Die Gesundheitsförderung bezweckt den Erhalt und die Verbesserung des Gesundheitszustands der gesamten Bevölkerung sowie von Einzelpersonen und von verschiedenen Personengruppen. Es sollen Lebensgewohnheiten und -bedingungen gefördert werden, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung und genügend Bewegung. Ziel der Prävention ist es, Risikofaktoren, die Krankheiten begünstigen oder auslösen, zu reduzieren oder abzuschwächen. Der - 76 - Gesundheitsschutz bezüglich Gefährdungen durch Umwelt- und Umfeldbelastungen umfasst natürliche und soziale Einflüsse. Als Beispiel ist der Schutz vor Infektionen durch die Lebensmittelhygiene zu erwähnen. Die zweckmässigen Massnahmen der Gesundheitsvorsorge beziehen sich nicht nur auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung, Körpergewicht, etc., sondern auch auf verschiedene Lebensphasen (Jugend, Erwerbsleben, Ruhestand) und sind somit auch unterschiedlich auszugestalten. Eine spezielle Erwähnung, zum Beispiel der Prävention im Alter, ist allerdings nicht erforderlich, weil § 34 GesG-E die Grundsätze der Gesundheitsvorsorge in allgemeingültiger Weise für sämtliche Aspekte und Altersgruppen festschreibt. Die Verordnung über die öffentlichen Bäder vom 21. März 2001 (SAR 325.211) stützt sich im geltenden Recht auf §§ 47 und 48 GesG-1987. Im neuen Gesundheitsgesetz dient § 57 als Rechtsgrundlage. Die besonderen Regelungen des Bundes namentlich im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz; SR 818.101), Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 9. Oktober 1992 (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0), Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Gentechnik im Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz [GTG]; SR 814.91) und Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG, SR 916.40) gehen den kantonalen Bestimmungen vor. § 35 (Impfungen) Impfungen werden in gewissen Bevölkerungskreisen kritisch beurteilt. Der Impfschutz wird aufgrund seiner wichtigen Funktion zur Verhinderung von Epidemien explizit im Gesetz geregelt. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass die Bevölkerung und insbesondere abwehrschwächere Personengruppen vor Epidemien geschützt werden. Abs. 1 Der Kanton sorgt im Rahmen der Impfempfehlungen des Bundes für den Impfschutz der Bevölkerung gegen übertragbare Krankheiten. Die Schutzimpfungen werden durch Dritte ausgeführt. Bereits seit längerem werden Impfungen nicht mehr durch den Kanton, sondern nur noch durch die Lungenliga und die niedergelassene Ärzteschaft verabreicht. Im Übrigen können nur Personen Impfungen vornehmen, die gemäss § 4 Abs. 1 lit. f GesG-E zu dieser Tätigkeit legitimiert und zugelassen sind. Abs. 2 Der Kanton informiert die Bevölkerung im Rahmen der Impfempfehlungen des Bundes gemäss den aktuellen Erfordernissen im Kanton. Im Gegensatz zum geltenden Recht wird auf die Möglichkeit, dass Impfungen auf kantonaler Ebene für obligatorisch erklärt werden können, verzichtet. § 36 (Suchtprävention und Suchthilfe) § 36 GesG-E bezieht sich nur auf die substanzgebundenen Abhängigkeiten. Im Bereich der substanzungebundenen Abhängigkeiten (so genannte Verhaltenssüchte) ist noch offen, in - 77 - welchem Rahmen eine notwendige Prävention und Suchthilfe stattfinden soll. Im Projekt Gebietsreform wird geklärt werden, wie sich dieser Bereich entwickelt, welcher Beratungsbedarf sich daraus ergibt, wer diese Dienstleistungen erbringen soll und wie die dazu benötigte Finanzierung gewährleistet werden kann. Eine Aufnahme ins GesG-E wäre demzufolge verfrüht. - 78 - Abs. 1 In § 36 Abs. 1 GesG-E werden die drei gesundheitspolitischen Zielsetzungen der Suchtprävention und Suchthilfe, welche die Aufgabenbereiche der ambulanten Suchtberatung, die stationäre Suchttherapie sowie die Überlebenshilfe umfasst, festgehalten: Verhinderung der Entstehung süchtigen Verhaltens und Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs (Prävention); Ausstieg aus der Suchtmittelabhängigkeit (Suchtberatung und -therapie); Gesundheitsschutz vor den Auswirkungen des Suchtmittelkonsums Dritter. Zweck der Suchtprävention ist es, einen Beitrag zur Verhinderung süchtigen Verhaltens zu leisten, indem Schutzfaktoren für eine Suchtentwicklung aufgezeigt, Risikofaktoren entgegen gewirkt und schützende individuelle und soziale Faktoren gefördert werden. Die Suchtberatung und -therapie haben die Beendigung eines Missbrauchs und wo immer möglich, die physische und psychische Unabhängigkeit von Suchtmitteln sowie die soziale Reintegration, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der süchtigen Menschen zum Ziel. Die Heroinabgabe an schwerstabhängige Drogensüchtige als spezielle Therapieform stellt den ersten, notwendigen Schritt in Richtung Ausstieg dar und stützt sich auf § 36 Abs. 1 lit. b GesG-E. Als weiteres grundsätzliches Ziel wird der Schutz Dritter vor den gesundheitsschädigenden Auswirkungen durch Suchtmittelkonsum festgehalten. Darunter fallen beispielsweise die Bereiche "Strassenverkehr und Suchtmittel" oder der Passivrauchschutz, welcher in § 38 GesG-E detailliert geregelt wird. Abs. 2 Die Bestimmungen zur Verantwortlichkeit des Kantons und der Gemeinden entsprechen dem bisherigen Recht (vgl. dazu §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 8 Abs. 1 der Verordnung über die Suchthilfe vom 11. Mai 1994; SAR 851.311). In § 36 Abs. 2 GesG-E wird die Zuständigkeit des Kantons für die Suchtprävention, die ambulante Suchtberatung sowie der Zugang zur stationären Suchtmitteltherapie statuiert. Zudem koordiniert er die Angebote der Suchtprävention, der Suchtberatung und Suchttherapie und vernetzt die Zusammenarbeit der in diesem Bereich tätigen Institutionen. § 37 (Tabak- und Alkoholprävention; Jugendschutz) Abs. 1 Das Werben für Alkohol und Tabak, insbesondere im Bereich des Jugendschutzes, wird in einer ganzen Reihe von Erlassen des eidgenössischen Rechts eingeschränkt. Die entsprechenden Verbote sind inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet. Im Folgenden soll ein Überblick über das geltende Recht in diesem Bereich gegeben werden. Verbot von Tabak- und Alkoholwerbung, welche sich an Jugendliche unter 18 Jahren richtet (Art. 18 der Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen [Tabakverordnung; TabV; SR 817.06] vom 27. Oktober 2004; Art. 11 des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz; LMG; SR 817.0] vom 9. Oktober 1992; Art. 4 der Verordnung des EDI über alkoholische - 79 - Getränke [SR 817.022.110] vom 23. November 2005; Art. 42b Abs. 3 lit. e des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser [Alkoholgesetz; AlkG; SR 680] vom 21. Juni 1932) Verboten ist insbesondere die Werbung: an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten; in Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Publikationen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind; auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern usw.); mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugendliche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, Badebällen; auf Spielzeug; durch unentgeltliche Abgabe von Tabakwaren oder alkoholischen Getränken an Jugendliche; an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. Zudem dürfen alkoholische Getränke nicht mit Angaben oder Abbildungen versehen werden, die sich speziell an Jugendliche unter 18 Jahren richten oder entsprechend aufgemacht sind. Werbeverbot für Spirituosen an verschiedenen öffentlichen Orten (Art. 42b Abs. 3 AlkG) Verboten ist die Werbung für Spirituosen: in und an öffentlichen Zwecken dienenden Gebäuden oder Gebäudeteilen und auf ihren Arealen; in und an öffentlichen Verkehrsmitteln; auf Sportplätzen sowie an Sportveranstaltungen; in Betrieben, die Heilmittel verkaufen oder deren Geschäftstätigkeit vorwiegend auf die Gesundheitspflege ausgerichtet ist; auf Packungen und Gebrauchsgegenständen, die keine gebrannten Wasser enthalten oder damit nicht im Zusammenhang stehen. Ausserdem dürfen keine Wettbewerbe durchgeführt werden, bei denen Spirituosen als Werbeobjekt oder Preis dienen oder ihr Erwerb Teilnahmebedingung ist. Beschränkung der Werbung für Spirituosen (Art. 42b Abs.1 AlkG) Die Werbung für Spirituosen darf in Wort, Bild und Ton nur Angaben und Darstellungen enthalten, die sich unmittelbar auf das Produkt und seine Eigenschaften beziehen. Sonderbestimmungen für Radio und Fernsehen (Bundesgesetz über Radio und Fernsehen [RTVG] vom 24. März 2006 [SR 784.40]; Alkoholgesetz; Radio- und Fernsehverordnung [RTVV] vom 9. März 2007 [SR 784.401]) Die Werbung für Tabakwaren und Spirituosen ist in TV und Radio verboten. Die Werbung für die anderen alkoholischen Getränke darf in Wort, Bild und Ton nur Angaben und Darstellungen enthalten, die sich unmittelbar auf das Produkt und seine Eigenschaften beziehen (Art. 10 RTVG; Art. 42b Abs. 3 lit. a AlkG). Zum Schutz der Gesundheit und der - 80 - Jugend erliess der Bundesrat weitere Einschränkungen, so darf zum Beispiel keine Alkoholwerbung vor, während oder nach Sendungen ausgestrahlt werden, die sich an Kinder oder Jugendliche richten. - 81 - Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Alkohol- und Tabakwerbung, die sich an Jugendliche unter 18 Jahre richtet, verboten ist. Im Bereich Alkohol ist Werbung für Erwachsene grundsätzlich erlaubt. Zu beachten ist aber die Einschränkung der Darstellungsweise von Werbung für Spirituosen: Diese ist nur erlaubt, wenn sie sich unmittelbar auf das Produkt bezieht. Darstellungen, die dem Produkt oder dessen Genuss eine besondere Anziehung verleihen sind dagegen verboten. Zudem ist das Werben für Spirituosen an bestimmten Orten (zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlichen Gebäuden, Sportveranstaltungen etc.) verboten. In Bezug auf Radio und Fernsehen gelten strengere Regeln. Dort ist die Werbung für Tabakerzeugnisse und Spirituosen ganz verboten. Für die anderen alkoholischen Getränke darf nur geworben werden, wenn sich die Werbung auf das Produkt bezieht. Zudem gelten weitere Ausführungsbestimmungen zum Schutz der Jugend und der Gesundheit. Alkohol- und Tabakprodukte können von Erwachsenen legal erworben werden. Es erscheint daher auch angemessen, wenn für diese Erzeugnisse geworben werden kann, solange sich die Werbung an Erwachsene richtet. Folgerichtig verbietet das Bundesrecht "nur" Alkoholund Tabakwerbung, die sich an Jugendliche richtet. Die bundesrechtlichen Bestimmungen führen aber in Bezug auf den Jugendschutz nur beschränkt zum Ziel. Ein Verzicht auf "jugendbezogene" Werbung erscheint als ungenügend, denn Kinder und Jugendliche fühlen sich auch durch Werbung angesprochen, die sich an Erwachsene richtet. Das Gleiche gilt für die freiwillige Selbstbeschränkung der Zigarettenindustrie in der Werbung. Die Schweizer Zigarettenfabrikanten haben sich mit der Vereinbarung zwischen Swiss Cigarette und der Schweizerischen Lauterkeitskommission vom 27. April 2005 verpflichtet, dass sich die Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten ausschliesslich an erwachsene Rauchende und nicht an Minderjährige richten und im Einklang mit dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit eines informierten Erwachsenen stehen soll. Dadurch kann aber wiederum nicht verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche, gerade auch von der noch zulässigen Werbung angesprochen werden. Zudem bindet diese Vereinbarung nur die Zigarettenindustrie und ist ausserdem kündbar. Im Bereich der restlichen Tabakindustrie und den Herstellern von alkoholischen Getränken sind keine Selbstbeschränkungen bekannt. Trotz den bereits bestehenden Werbeeinschränkungen bestehen noch viele Möglichkeiten für Tabak- und Alkoholwerbung, so zum Beispiel auf Plakaten, in Kinos, in Zeitungen sowie direkte Promotionen über Stände und Wettbewerbe oder durch Sponsoring von Kultur- und Sportveranstaltungen. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und insbesondere der Jugend vor den Folgen von übermässigem Alkohol- und Tabakkonsum kann aber nur wirksam sein, wenn die Werbung für Tabak- und Alkoholprodukte eingeschränkt und der Verkauf dieser Produkte an Jugendliche verboten wird. Ziel dieser Bestimmung ist es, die Jugendlichen im Sinne der Prävention möglichst vom frühzeitigen Konsum von Alkohol- und Tabakprodukten abzuhalten. § 37 Abs. 1 GesG-E statuiert ein Verbot für grossflächige Werbung für Tabakwaren und alkoholische Getränke, wie Plakat-, Kino- und Bandenwerbung. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Mit dem in § 37 Abs. 1 GesG-E statuierten Werbeverbot soll jene Werbung nicht mehr zulässig sein, die aufgrund ihrer Grösse eine weiträumige Wirkung hat. Damit ist all jene Werbung für Tabakwaren und alkoholische Getränke gemeint, die man beispielsweise als Passant, als Verkehrsteilnehmer oder als Besucher einer Veranstaltung üblicherweise wahrnimmt, ohne dieser besondere Beachtung zu schenken. Kleinflächige - 82 - Werbung an einer Plakatsäule, die Auslage in einem Schaufenster oder Inserate in Printmedien werden vom Werbeverbot beispielsweise nicht tangiert. Festzuhalten ist aber, dass ein genügender Jugendschutz auch im Bereich der nicht weiträumig wahrnehmbaren Werbung aufgrund der oben erwähnten bundesrechtlichen Bestimmungen gewährleistet ist, da jegliche Werbung für Tabak- und Alkoholprodukte verboten ist, die sich an unter 18Jährige richtet. Darunter fallen auch zum Beispiel Inserate in Zeitschriften, die sich speziell an Jugendliche richten oder Werbung an Veranstaltungen, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden. Da bei Firmenbezeichnungen der Hersteller nicht das Werben für das Produkt im Vordergrund steht, sollen grossflächige Firmenbezeichnungen am Geschäftssitz oder am Produktionsort nicht unter das Werbeverbot für Tabakwaren und alkoholische Getränke fallen. Ebenfalls nicht erfasst werden sollen Transportmittel, da dies wegen der heutigen Mobilität, die sich überkantonal erstreckt, nicht zweckmässig erscheint. Sollte aber auf einem Werbemittel beispielsweise der Name eines alkoholischen Getränks von weit her sichtbar sein und erst bei näherer Betrachtung der Zusatz "alkoholfrei" wahrgenommen werden können, wäre in Anwendung der oben ausgeführten Überlegungen diese Werbung verboten. Im Gegensatz dazu soll beispielsweise Werbung für eine Veranstaltung zulässig bleiben, die nur ein aus der Nähe wahrnehmbares Logo eines Sponsors enthält, welcher Alkohol- oder Tabakprodukte herstellt/verkauft. Abs. 2 Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist in der eidgenössischen Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung und im Bundesgesetz über die gebrannten Wasser geregelt. Alkoholische Getränke dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgeben werden; Spirituosen nicht an unter 18-Jährige. Dieser Grundsatz wird auch im kantonalen Gastgewerbegesetz festgehalten. Für den Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche und Kinder fehlt jedoch eine Regelung. Gleich wie in anderen Kantonen (Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Thurgau, Wallis, Zürich) wird durch § 37 Abs. 2 GesG-E auch für den Kanton Aargau ein Verkaufsverbot von Tabakwaren für Personen unter 16 Jahren eingeführt. Abs. 3 Um das Verkaufsverbot an unter 16-Jährige konsequent umsetzen zu können, muss auch der Verkauf von Tabakwaren durch Automaten verhindert werden. Personen dieser Altersgruppe haben hier meist unkontrollierten Zugang. Der Verkauf durch Automaten soll daher nur noch zulässig sein, wenn die Betreiber durch geeignete Massnahmen den Verkauf an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verunmöglichen. Dabei kann die Alterskontrolle beispielsweise mittels Chip erfolgen. Die Abgabe von alkoholischen Getränken mittels Automaten ist bereits in § 1 Abs. 2 lit. d des Gastgewerbegesetzes verboten, Eine Regelung im GesG-E erübrigt sich daher. Abs. 4 Ein Verkaufsverbot ohne stichprobenweise Kontrolle ist wenig wirksam. Die Praxis in anderen Kantonen hat gezeigt, dass die effektivsten Kontrollen durch Testkäufe von Minderjährigen erfolgen. § 37 Abs. 4 GesG-E stellt die Rechtsgrundlage dar für Testkäufe zur Kontrolle der Einhaltung der Verkaufsverbote gemäss den Absätzen 2 und 3 sowie der Alkoholabgabeverbote gemäss § 1 Abs. 2 lit. a und b des Gastgewerbegesetzes. Da auch - 83 - bei den gemäss Absatz 2 umgerüsteten Automaten die Alterskontrolle durch eine Person erfolgt, die anschliessend den Automaten mittels Chip frei schaltet, damit das gewünschte Produkt bezogen werden kann, sind auch in diesem Bereich Testkäufe sinnvoll. Mit Hilfe der Testkäufe soll geprüft werden, ob das Verkaufspersonal der Abgabestellen bereit ist, Alkohol- und Tabakprodukte ohne vorgängige Alterskontrolle an Jugendliche abzugeben. Irreführende Machenschaften wie nicht wahrheitsgemässe Angaben durch die Jugendlichen oder der Einsatz von älter wirkenden Jugendlichen, wären dabei nicht zulässig. Obwohl davon ausgegangen wird, dass die Gemeinden im Bereich Alkohol bereits aufgrund des Gastgewerbegesetzes zur Durchführung von Testkäufen legitimiert sind, soll aus Gründen der Transparenz und um die Rechtssicherheit zu gewährleisten in § 37 Abs. 4 GesG-E nun eine explizite Rechtsgrundlage für Testkäufe im Bereich Alkohol und Tabak geschaffen werden. Für die Durchführung zuständig sind die Gemeinden. Sie können den Vollzug mittels Leistungsvereinbarung an Dritte übertragen. Der Regierungsrat legt zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs (so zum Beispiel zur Betreuung der Jugendlichen) und zur Gewährleistung einer rechtmässigen Durchführung der Testkäufe (keine irreführenden Machenschaften) Rahmenbedingungen fest. Die Grundprinzipen des Verwaltungsrechts wie die Grundsätze des verhältnismässigen Handelns und der Fairness gelten aber ohnehin. Abs. 5 Die Abgabe von Alkohol an Jugendliche wird in verschiedenen Erlassen des eidgenössischen Rechts geregelt (Bundesgesetz über die gebrannten Wasser; Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände; Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [SR 817.02]; Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 [SR 311.0]). Auf kantonaler Ebene ist die Abgabe von alkoholischen Getränken an unter 16-Jährige und von Spirituosen an unter 18-Jährige für das Gastgewerbe und Betriebe, die Kleinhandel mit alkoholischen Getränken betreiben, verboten (§ 1 Abs. 2 lit. a und b des Gastgewerbegesetzes). Nach geltendem Recht ist die private Abgabe von Alkohol an Jugendliche unterhalb der gesetzlichen Altersgrenze jedoch nicht strafbar, ausgenommen ist die Verabreichung oder das zur Verfügung stellen von alkoholischen Getränken in Mengen, welche die Gesundheit gefährden können. Damit kann die gesetzliche Altersgrenze der Verkaufsverbote für alkoholische Getränke an Jugendliche leicht umgangen werden, weshalb in § 37 Abs. 5 GesG-E die Abgabe von alkoholischen Getränken an Personen unter 16 Jahren oder von Spirituosen an Personen unter 18 Jahren verboten wird. Davon erfasst werden soll die (un-)entgeltliche Abgabe an Nicht-Kaufsberechtigte, die nicht unter die Abgabeverbote des Gastgewerbegesetzes fallen. Die Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes bleiben deshalb vorbehalten. Damit ein massvoller Konsum erlernt werden kann und es möglich ist, dass Jugendliche beispielsweise an einem Familienfest ein Glas Wein trinken dürfen, ist die Abgabe durch die Eltern (sowohl leibliche als auch Stief- und Pflegeeltern) vom Verbot ausgenommen. Falls hier Missbräuche festgestellt werden müssten, wären wohl ohnehin vormundschaftliche Vorkehren angezeigt. - 84 - § 38 (Schutz vor Passivrauchen) Variante 1 (entspricht der Regelung im Kanton Solothurn) Das Rauchen wird in geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen verboten, nicht also beispielsweise auf Balkonen oder in offenen Innenhöfen von Gebäuden. Private Räume werden grundsätzlich vom Rauchverbot nicht erfasst. Wenn aber private Räume der Allgemeinheit zugänglich sind, so ist das Rauchen nicht mehr zulässig. Zu den geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen zählen insbesondere Gebäude der öffentlichen Verwaltung, Spitäler, Heime, Vereinslokale, sofern diese für Nicht-Vereinsmitglieder zugänglich sind, Kultur- und Sportstätten, Versammlungslokale, Schulen und andere Bildungsstätte sowie alle Bereiche der Gastronomie. Das Merkmal der öffentlichen Zugänglichkeit entfällt nicht durch die Anordnung irgendeiner Begrenzung des Kreises der Zutrittsberechtigten, sondern erst dadurch, dass dieser eindeutig umschrieben und bestimmbar ist. Auf einen bestimmten, abgegrenzten Personenkreis beschränkt ist beispielsweise der Zugang zu Vereinsräumlichkeiten nur für Vereinsmitglieder. Eine Ausnahme vom Rauchverbot in öffentlich zugänglichen Räumen gilt für Rauchräume (Fumoirs). Damit der Schutz vor Passivrauchen trotzdem gewährleistet ist, müssen solche Rauchräume von den übrigen Räumen abgetrennt und ausreichend belüftet sein. Rauchräume sind als solche zu bezeichnen, damit die Gäste bewusst entscheiden können, ob sie einen solchen aufsuchen wollen oder dies unterlassen möchten. Das Bedienen von Gästen in Rauchräumen ist erlaubt. Variante 2 (entspricht dem Vorschlag von GastroSuisse) Das Rauchen wird in geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen verboten. Eine Ausnahme gilt für getrennte und entsprechend gekennzeichnete Rauchräume mit ausreichender Belüftung. Absatz 1 entspricht der Regelung in Variante 1, weshalb auf die oben erwähnten Erläuterungen verwiesen wird. In Gastronomiebetrieben, die über mehr als einen Raum verfügen, kann das Raumangebot in Raucher- und Nichtraucherräume aufgeteilt werden, sofern der Betreiber das Rauchen überhaupt zulassen will. Als weitergehende Ausnahme können Betriebe auf Bewilligung hin als Raucherbetriebe geführt werden. Die entsprechende Bewilligung wird erteilt, wenn der Betreiber des Gastronomiebetriebs den Nachweis erbringt, dass eine Trennung von Raucher- und Nichtraucherräumen nicht möglich oder zumutbar ist. Dies trifft zu, wenn eine Trennung baulich nicht möglich ist oder sie die Existenz des Betriebs bedroht. Die entsprechenden Entscheidungskriterien sollen auf Verordnungsstufe festgelegt werden. Durch die Kennzeichnungspflicht der Raucherbetriebe wird die Wahlfreiheit der Gäste sichergestellt. - 85 - 7. Versorgungssicherheit § 39 (Notfalldienst) Abs. 1 Die Notfalldienstpflicht bestimmter Berufe (Ärztinnen/Ärzte; Apothekerinnen/Apotheker, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Tierärztinnen/Tierärzte) soll im Vergleich zum geltenden Recht unverändert beibehalten werden (§ 39 Abs. 1 GesG-E). § 39 GesG-E enthält aber neu gewisse Bestimmungen, welche gegenüber dem heutigen Recht Klärung bringen und den Vollzug unterstützen. Notfalldienstpflichtig sind jene Personen der genannten Berufskategorien, welche im Besitz einer Berufsausübungsbewilligung sind. Ebenfalls notfalldienstpflichtig sind deren Stellvertretungen. Daraus ergibt sich, dass die in stationären Einrichtungen gemäss Spitalgesetz und Pflegegesetz tätigen Personen nicht notfalldienstpflichtig sind (vgl. § 4 Abs. 2 GesG-E). Dies rechtfertigt sich deshalb, weil diese Personen in aller Regel innerhalb der Einrichtung notfalldienstliche Pflichten haben. Abs. 2 Die Organisation des ambulanten Notfalldiensts soll – wie dies bereits heute weitgehend der Fall ist – über die Berufsverbände laufen. Davon ausgenommen sind allerdings die Tierärztinnen und Tierärzte, die sich ohne Mitwirken des Verbands selbstständig organisieren. Präzisiert wird hierbei, dass diese Organisation auch jene Berufsangehörigen mitumfassen soll, welche nicht Mitglied des Berufsverbands sind (§ 39 Abs. 2 Einleitungssatz GesG-E). Dem Berufsverband wird die Möglichkeit gegeben, bei Vorliegen wichtiger Gründe (zum Beispiel Alter, Spezialisierung, familiäre Pflichten) Personen vom Notfalldienst zu befreien und von diesen eine zweckgebundene Entschädigung zu verlangen, die für die Belange des Notfalldiensts zu verwenden ist (§ 39 Abs. 2 lit. a und b GesG-E). Befreiungen dürfen jedoch die notfalldienstliche Versorgung nicht gefährden. Abs. 3 und 4 Der Kanton soll bei diesem Modell nur dann tätig werden müssen, wenn zwischen dem Berufsverband und der notfalldienstpflichtigen Person Differenzen entstehen (§ 39 Abs. 3 GesG-E) oder Anzeichen bestehen, dass die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung nicht mehr gewährleistet ist (§ 39 Abs. 4 GesG-E). Abs. 5 Mit § 39 Abs. 5 GesG-E wird der Regierungsrat ermächtigt, die erforderlichen Vollzugsbestimmungen zu erlassen. Dem Regierungsrat soll zudem das Recht eingeräumt werden, Organisationen, welche die Lebensrettung von Personen bezwecken, finanziell zu unterstützen (zum Beispiel Schweizer Alpenclub [SAC]). In der Verordnung sollen die konkreten Beitragskriterien geregelt werden. § 40 (Koordination in der Notfallversorgung) Gemäss Strategie 13 der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung sorgt der Kanton für die Gewährleistung der Notfallversorgung und begegnet der zunehmenden Beanspruchung der öffentlichen Notfallstationen an den Spitälern mit Bagatellfällen mit geeigneten Massnahmen. Hintergrund dieser Strategie ist die Absicht, dass Personen eine (teurere) Behandlung in der Notfallstation eines Spitals nur dann in Anspruch nehmen sollen, wenn dies medizinisch - 86 - indiziert ist, ansonsten aber primär der (günstigere) ambulante Notfalldienst benutzt werden soll. Somit geht es letztlich auch darum, für eine zweckmässige Triage zu sorgen. Abs. 1 und 2 In diesem Sinne wird mit § 40 Abs. 1 und 2 GesG-E die Grundlage dafür geschaffen, Massnahmen zur Koordination zwischen der ambulanten und der stationären ärztlichen Notfallversorgung zu treffen sowie Projekte zu fördern und zu unterstützen. Dazu gehör etwa die Einführung einer einheitlichen Notfallnummer. Als weiteres konkretes Beispiel dazu kann auf das am Kantonsspital Baden eingeführte Modell hingewiesen werden. Die notfalldienstpflichtigen Ärztinnen und Ärzte der Region betreiben gemeinsam eine Notfallpraxis, die der Notfallstation des Spitals unmittelbar vorangegliedert ist. So kann sichergestellt werden, dass eine zweckmässige Triage durch den ambulanten Notfalldienst vorgenommen wird und nur jene Fälle ins Spital weitergeleitet werden, die einer Spitalbehandlung tatsächlich bedürfen. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine 24-StundenApotheke in der unmittelbaren Nähe des Kantonsspitals Baden, die von den notfalldienstpflichtigen Apothekerinnen und Apothekern der Region betrieben wird. In diesem Sinne soll seitens des Kantons die Möglichkeit zur Förderung und Unterstützung solcher oder anderer geeigneter Modelle bestehen. Abs. 3 Der Koordination in der Notfallversorgung dient zudem auch der Betrieb einer kantonalen Notrufzentrale (§ 40 Abs. 4 GesG-E), die neben Polizei und Feuerwehr auch die Sanitätsdienste (Spitäler und Private) betreut und koordiniert. Auf diese Weise können zahlreiche Synergien genutzt und Schnittstellen mit Reibungsverlusten beseitigt werden. Dies betrifft die notfalldienstlichen Transporte (so genannte D1), kann aber auch reine Verlegungstransporte betreffen. Einzelheiten sollen hierzu auf Verordnungsebene geregelt werden. § 41 (Förderung der ärztlichen Grundversorgung) Wie in anderen Kantonen gibt es auch im Kanton Aargau gewisse Anzeichen dafür, dass die ärztliche Grundversorgung durch die Hausärztinnen und Hausärzte zurückgeht. So bereitet es offenbar Mühe, Nachfolger für die Übernahme einer Hausarztpraxis zu finden. Gründe dafür sind unter anderem die hohe zeitliche Beanspruchung, die Notfalldienstpflicht sowie die finanzielle Schlechterstellung gegenüber den ärztlichen Spezialdisziplinen. Abs. 1 Sollten sich dieser Trend weiter fortsetzen, muss der Kanton die Möglichkeit haben, Massnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung zu treffen (§ 41 Abs. 1 GesG-E). Abs. 2 und 3 Gemäss Absatz 2 soll der Kanton die Möglichkeit haben, finanzielle Mittel zu diesem Zweck einzusetzen. Dazu gehören Massnahmen im Bereich der Aus-, Weiter- und Fortbildung (vgl. § 41 Abs. 2 lit. a GesG-E), um zum Beispiel wieder vermehrt junge Ärztinnen und Ärzte als Praxisassistenzen in Hausarztpraxen zu bringen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird dies bereits seit dem Jahr 2008 umgesetzt, finanziert über mittel des Lotteriefonds. Mit dem - 87 - Inkrafttreten des neuen Gesundheitsgesetzes würden diese Massnahmen aus dem ordentlichen Staatshaushalt finanziert. Was den Einsatz finanzieller Mittel für weitere Anreizmassnahmen zur Förderung der ärztlichen Grundversorgung gemäss § 41 Abs. 2 lit. b GesG-E angeht, steht hier die Erteilung eines entgeltlichen Leistungsauftrags an den Aargauischen Ärzteverband für die Organisation der notfalldienstlichen Grundversorgung im Vordergrund. Dies entspricht der Forderung, wie sie unter anderem auch von politischen Parteien gestellt wurde. Einzelheiten wird der Regierungsrat durch Verordnung regeln. 8. (Heilmittel- und Betäubungsmittelwesen) Einleitung Das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) vom 13. Dezember 2000 (SR 812.21) trat am 1. Januar 2002 in Kraft. Damit trat eine Bundeslösung an die Stelle der bislang unter den Kantonen vereinbarten Konkordatslösung (Interkantonale Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel mit der interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, IKS). Es verbleiben den Kantonen aufgrund der bundesrechtlichen Bestimmungen vereinzelt Regelungskompetenzen mit Handlungsspielraum, im Wesentlichen aber Vollzugsaufgaben (vgl. Art. 83 HMG). In Bezug auf den kantonalen Regelungsbedarf hat der Bund nebst dem Heilmittelgesetz folgende Verordnungen erlassen: Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (AMBV; SR 812.212.1); Verordnung über die Arzneimittel (VAM; SR 812.212.21); Verordnung über die Tierarzneimittel (TAMV; 812.212.27); Medizinprodukteverordnung (MepV; SR 812.213); Verordnung über klinische Versuche mit Heilmitteln (VKlin; SR 812.214.2). Im Grundsatz kann festgestellt werden, dass der Herstellungs- und Grosshandelsbereich in der Zuständigkeit des Bundes (Swissmedic) und der Detailhandel in jene der Kantone fällt. Im Zug des HMG wurde auch das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) vom 3. Oktober 1951 (SR 812.121) teilrevidiert. Die §§ 45–50 enthalten in diesem Sinne die erforderlichen Regelungen im kantonalen Zuständigkeitsbereich. § 42 (Aufsicht) Abs. 1 Art. 83 Abs. 1 HMG regelt die Vollzugszuständigkeit des Kantons. Im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben ist die Aufsicht und der Vollzug im Heilmittel- und Betäubungsmittelwesen Aufgabe des Kantons (§ 42 Abs. 1 GesG-E). Die Pflicht des Kantons zur Marktüberwachung ergibt sich aus den bundesrechtlichen Bestimmungen. Die Organisation des Inspektionswesens ist dagegen weitgehend Sache des Kantons. Zu den Kontrollaufgaben gehören im Wesentlichen: Aufsicht über den Detailhandel (Marktüberwachung); Inspektionen (Art. 20 Abs. 2 und Art. 58 HMG; Art. 31 VAM); Inspektionen im Bereich der Bewilligungen an Betriebe, die Blut oder Blutprodukte lagern (Art. 34 Abs. 4 HMG); - 88 - Inspektoratswesen (Art. 60 Abs. 3–5 HMG); Kontrollen und Inspektionen im Bereich der Tierarzneimittel (Art. 30 ff. TAMV). - 89 - Abs. 2 § 42 Abs. 2 GesG-E sieht die Möglichkeit vor, diese Aufgabe ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen. Abs. 3 Zudem soll die Grundlage geschaffen werden, dass der Regierungsrat direkt ohne Genehmigung des Grossen Rats mit anderen Kantonen Zusammenarbeitsverträge im Bereich Heilmittelwesen (zum Beispiel gemeinsame Heilmittelkontrolle, gemeinsame Ethikkommission) abschliessen kann (§ 42 Abs. 3 GesG-E). Diese Delegation gibt dem Regierungsrat eine gewisse Handlungsfreiheit im operativen Bereich. Die finanzrechtliche Zuständigkeit des Grossen Rats und die Regeln des Finanzreferendums (§ 63 KV) werden durch diese Delegation nicht tangiert. § 43 (Bewilligungen) Abs. 1 Das Bundesrecht überlässt dem Kanton nur noch im Bereich des Detailhandels einen gewissen Handlungsspielraum. Das Bundesrecht überträgt den Kantonen folgende Bewilligungen: Erteilung von Herstellungsbewilligungen zur Herstellung von Heilmitteln in einem Detailhandelsgeschäft und/oder nach formula magistralis, formula officinalis und nach eigener Formel (Art. 5 Abs. 2 lit. a HMG i.V.m. Art. 6 AMBV); Erteilung der Bewilligungen für den Detailhandel: Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen und des Verfahrens (Art. 30 HMG); Erteilung der Bewilligungen für den Versandhandel, wobei der Rahmen des Versandhandels im Bundesrecht abschliessend geregelt ist (Art. 27 HMG; Art. 29 und 30 VAM); Erteilung von Bewilligungen an Betriebe, die Blut oder Blutprodukte lagern; Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen und des Verfahrens (Art. 34 Abs. 4 HMG); Bewilligungserteilung zur Anwendung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln; Bezeichnung der Berufe und der Arzneimittel, welche angewendet werden dürfen; Regelung der Aufsicht (Art. 27a VAM); Kompetenz der Kantone, zu bewilligen, dass bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel durch entsprechend ausgebildete Fachpersonen unter Aufsicht angewendet werden dürfen (Art. 24 Abs. 3 HMG); Bewilligung zur Abgabe von Arzneimitteln in Zoo- und Imkerfachgeschäften (Art. 9 TAMV). Abs. 2 und 3 Vom Konzept her ist vorgesehen, dass im GesG-E in allgemeiner Weise die Voraussetzungen der Bewilligungserteilung geregelt sind und die Details dann vom Regierungsrat auf Verordnungsstufe bestimmt werden (vgl. § 43 Abs. 2 und 3 GesG-E). Betriebsbewilligungen an Apotheken und Drogerien gemäss § 25 GesG-E decken die Bewilligung für den Detailhandel gemäss § 30 HMG ab. - 90 - Bewilligungsvoraussetzungen sind: das für eine fachgerechte Tätigkeit erforderliche Personal; zweckentsprechende betriebliche Verhältnisse; ein geeignetes Qualitätssicherungssystem. Die bisher in § 43 Abs. 2 GesG-1987 formulierte Bewilligungspflicht für die "Anwendung von Präparaten zu Versuchen am Menschen" (das heisst Durchführungsbewilligungen von klinischen Studien; Forschungsvorhaben mit Heilmitteln) fällt im GesG-E weg. Begründen lässt sich dies mit der Regelung der klinischen Versuche durch die eidgenössische Heilmittelgesetzgebung (Art. 53 ff. HMG) sowie der Verordnung über klinische Versuche mit Heilmitteln (VKlin). Danach ist jeder klinische Versuch mit Heilmitteln in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Regeln durchzuführen. Für die Durchführung muss ein positives Votum der zuständigen Ethikkommission vorliegen. Ebenso sind weitgehende Meldepflichten gegenüber der Swissmedic vorgesehen etc. Damit ist eine zusätzliche, spezielle gesundheitspolizeiliche Durchführungsbewilligung obsolet geworden. § 44 (Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln; Allgemeine Grundsätze) Die Abgabe und die Anwendung von Arzneimitteln ist im Bundesrecht bereits weitgehend geregelt (vgl. dazu Art. 23 ff. HMG und Art. 20 ff. VAM). Abs. 1 Für den im Zuständigkeitsbereich der Kantone liegenden Detailhandel sollen allgemeine Grundsätze in Bezug auf die Abgabe- und Anwendung von Arzneimitteln verankert werden. Dazu gehören gemäss § 44 Abs. 1 lit. a–d (GesG-E): Verbot der Abgabe von Arzneimitteln in Form des Haustür- und Strassenverkaufs sowie durch Verkauf auf Märkten; Verbot der Abgabe von Arzneimitteln durch Fachleute der Komplementärmedizin; Verbot der Abgabe in Selbstbedienung; Verbot der Abgabe in Automaten. Bei dem in § 44 Abs. 1 lit. c GesG-E statuierten Verbot der Selbstbedienung sind Ausnahmen denkbar, die der Regierungsrat durch Verordnung näher regeln kann. So soll der Regierungsrat die Möglichkeit haben, Arzneimittel der Abgabekategorie D in Selbstbedienung zulassen zu können. Die Zulassung der Selbstbedienung verlangt gleichwohl, dass die in Art. 26 Abs. 1 lit. c VAM bundesrechtlich vorgeschriebene Beratungspflicht eingehalten wird. Ausnahmen vom Selbstbedienungsverbot werden sich auch danach auszurichten haben, ob und wenn ja, welches Gefährdungspotential den einzelnen Arzneimitteln zukommt. Abs. 2 Das Verbot der Abgabe von Arzneimitteln durch Fachleute der Komplementärmedizin gemäss § 44 Abs. 1 lit. b GesG-E steht unter dem Vorbehalt des Bundesrechts. Gemäss Art. 25a VAM sollen Personen mit einer eidgenössisch anerkannten Ausbildung in einem Bereich der Komplementärmedizin bei der Ausübung ihres Berufs die von der Swissmedic bezeichneten Arzneimittel der Abgabekategorien C und D selbstständig abgeben dürfen. - 91 - Zurzeit existiert noch keine eidgenössisch anerkannte Ausbildung. Sollte diese einmal vorliegen, wäre der Regierungsrat befugt, durch Verordnung eine Ausnahme zum Verbot gemäss § 44 Abs. 1 lit. b GesG-E zu statuieren. Art. 27a VAM regelt, welche Berufskategorien mit Bewilligung des Kantons verschreibungspflichtige Arzneimittel anwenden dürfen. Es sind dies nebst den Medizinalpersonen diplomierte Hebammen, diplomierte Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker, diplomierte Chiropraktorinnen und Chiropraktoren, diplomierte Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Fachleute der Komplementärmedizin mit eidgenössisch anerkannter Ausbildung. Das kantonale Recht muss also festlegen, welche dieser Berufskategorien verschreibungspflichtige Arzneimittel der Abgabekategorien A und B anwenden dürfen. Zudem bestimmt der Kanton die zur Anwendung freigegebenen Arzneimittel im Detail. Die zur Anwendung berechtigten Berufskategorien und die dazu freigegebenen Arzneimittel soll der Regierungsrat durch Verordnung festlegen können. § 45 (Ärztinnen und Ärzte; Zahnärztinnen und Zahnärzte) § 45 GesG-E übernimmt die bisherige Regelung des so genannten Selbstdispensationsverbots unverändert. Abs. 1 und 2 Vom Grundsatz des Selbstdispensationsverbots gibt es drei Ausnahmen: Unmittelbare Anwendung des Arzneimittels (§ 45 Abs. 1 GesG-E); Abgabe von Arzneimitteln im Notfall (§ 45 Abs. 1 GesG-E); Abgabe mit Bewilligung der zuständigen Behörde (§ 45 Abs. 2 GesG-E). Für Zahnärztinnen und Zahnärzte besteht die Abgabe- und Anwendungsberechtigung im Rahmen von § 45 Abs. 1 GesG-E, das heisst unmittelbare Anwendung und Abgabe im Notfall. Die Bewilligung an Ärztinnen und Ärzte gemäss § 45 Abs. 2 GesG-E setzt voraus, dass die Arztpraxis in einer Ortschaft ohne öffentliche Apotheke ist und zudem die Beschaffung der Arzneimittel nicht – rasch und für jedermann möglich – in einer öffentlichen Apotheke einer nahe gelegenen Ortschaft gewährleistet ist. Im Kanton Aargau besitzen rund 20 Ärztinnen und Ärzte eine so genannte Selbstdispensationsbewilligung (Berechtigung zur Führung einer Privatapotheke). Es handelt sich im Wesentlichen um Arztpraxen in relativ abgelegenen Ortschaften. Abs. 3 In § 45 Abs. 3 GesG-E wird neu der Grundsatz verankert, dass das Recht der Patientinnen und Patienten auf freie Wahl unter den zugelassenen Arzneimittelabgabestellen nicht beeinflusst werden darf. Diese Bestimmung ist Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts und soll dazu dienen, Interessenkonflikte und Interessenverflechtungen zwischen den beiden beteiligten Berufsständen (Ärztinnen/Ärzte und Apothekerinnen/Apotheker) präventiv zu verhindern. - 92 - § 46 (Tierärztinnen und Tierärzte) Abs. 1 Tierärztinnen und Tierärzte sind – wie bereits unter geltendem Recht – berechtigt, Tierarzneimittel abzugeben und anzuwenden. Voraussetzungen sind gemäss § 46 Abs. 1 GesG-E der Besitz einer Berufsausübungsbewilligung und neu der Besitz einer separaten Abgabebewilligung. Die Abgabe von Arzneimitteln in der Tierarztpraxis gilt als Detailhandel im Sinne von Art. 30 HMG, weshalb eine kantonale Bewilligung von Bundesrechts wegen vorgeschrieben ist. Abs. 2 Da gerade im Bereich der Veterinärmedizin sehr oft Gemeinschaftspraxen mit mehreren selbstständig tätigen Tierärztinnen und Tierärzten existieren, soll in diesem Fall die Abgabebewilligung für die gesamte Praxis auf eine verantwortliche Person sowie eine Stellvertretung ausgestellt werden (§ 46 Abs. 2 GesG-E). § 47 (Spitäler und Heime) In Spitälern und Heimen sind de facto zwei grundsätzliche Formen von Apotheken denkbar. Grössere Spitäler (Kantonsspital Aarau AG, Kantonsspital Baden AG) haben eine eigene Spitalapotheke. Diese ist gemäss § 25 Abs. 1 lit. a GesG-E bewilligungspflichtig und wird durch eine Apothekerin oder einen Apotheker mit Berufsausübungsbewilligung geführt. Bei den meisten Spitäler und Heime wird die Apotheke demgegenüber nicht durch eine festangestellte Apothekerin oder einen festangestellten Apotheker geführt. Die pharmazeutische Versorgung wird in diesen Fällen einer Apothekerin oder ein Apotheker mit öffentlicher Apotheke mittels Vertrag übertragen. § 47 GesG-E hält hierzu fest, dass die Verantwortung einer Apothekerin oder einem Apotheker mit einer Berufsausübungsbewilligung zu übertragen ist. 9. Bestattungswesen § 48 (Zuständigkeit und Grundsätze) Das Bestattungswesen ist im geltenden GesG-1987 in den §§ 59–61 geregelt. Von zentraler Bedeutung ist die "Zuständigkeitsnorm" in § 59 GesG-1987, wonach das Bestattungswesen Aufgabe der Einwohnergemeinden ist. § 60 GesG-1987 enthält Grundsatzbestimmungen (insbesondere zur Grabesruhe sowie zu Leichenschau, Legalinspektion und Legalobduktion) und regelt die Kostentragung. Gemäss § 61 GesG-1987 erlässt der Regierungsrat nähere Bestimmungen über die Leichenschau, die Einsargung, Zeitpunkt, Art und Form der Bestattung, die Durchführung von Legalinspektionen, Legalobduktionen und Exhumationen sowie über die Anlage von Friedhöfen und Gräbern. Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Regierungsrat die Bestattungsverordnung (SAR 371.111) sowie die Verordnung über die Leichenschau, die Legalinspektion und die Legalobduktion (SAR 371.311) erlassen. Die Detailregelung des Bestattungswesen obliegt den Gemeinden, welche zu diesem Zweck ein Friedhofreglement zu erlassen haben. Wenngleich die bisherige Regelung in der Vergangenheit keine grösseren Probleme aufgeworfen hat, vermag sie in verschiedenerlei Hinsicht nicht mehr zu genügen. So - 93 - bestehen im Bereich Legalinspektion und Legalobduktion Doppelspurigkeiten zur Strafprozessordnung (§§ 116 und 117 StPO; SAR 251.100), die durch den Verzicht einer Regelung im Gesundheitsgesetz zu beheben sind. Weiter widerspricht die recht weit gehende kantonale Regelung des Bestattungswesens den Grundsätzen der Aufgabenteilung, handelt es sich doch um eine Materie, die unbestrittenermassen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fällt. Daher soll den Gemeinden inskünftig neben der Vollzugs- auch eine stark erweiterte Rechtssetzungskompetenz zukommen. Der damit verbundene Wegfall von Rechtsnormen im kantonalen Recht wird durch Anpassungen und Ergänzungen in den kommunalen Friedhofreglementen aufzufangen sein. Da die Regelung des Bestattungswesens durch eine grosse Kontinuität geprägt ist und die Gemeinden die Vorgaben der Bundesverfassung (insbesondere "Anspruch auf schickliche Bestattung" beziehungsweise Menschenwürde) zu beachten haben, kann davon ausgegangen werden, dass zentrale, weithin unbestrittene Grundsätze des Bestattungswesens keine Änderungen erfahren werden (zum Beispiel Zulässigkeit der Erdbestattung und Urnenbeisetzung auf öffentlichen Friedhöfen, BGE 45 I 119). Einen grösseren Freiraum kommt den Gemeinden dagegen bei der Regelung von organisatorischen und finanziellen Belangen im Zusammenhang mit dem Bestattungswesen zu (insbesondere Kosten der Bestattung, Anlage von Friedhöfen und Gräbern, Abräumung von Gräbern). Abs. 1 Die Zuständigkeit der Gemeinden erstreckt sich nicht nur auf den Vollzug, sondern – unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 – auch auf die Rechtssetzung im Bereich des Bestattungswesens. Abs. 2 Der Regierungsrat regelt – für sämtliche Gemeinden einheitlich – gewisse Aspekte des Bestattungswesens; dies jedoch nur insoweit, als dies zur Wahrung von gesundheitspolizeilichen Interessen erforderlich ist. Die Regelung zielt insbesondere darauf ab, eine Gesundheitsgefährdung der Öffentlichkeit durch Leichen sowie die Bestattung Scheintoter zu verhindern. Die vom Regierungsrat zu diesem Zweck festzulegenden Grundsätze betreffen insbesondere Ort und Zeitpunkt der Bestattung, Einsargung, Grabesruhe, Grabestiefe, Exhumation und Leichenschau. Abs. 3 Der Vorbehalt der Gesetzgebung über die Strafrechtspflege dient der klaren Abgrenzung von gesundheitsrechtlichen und strafprozessualen Aspekten des Bestattungswesens. Nach den Bestimmungen des Strafprozessrechts richtet sich insbesondere die Legalinspektion, die Legalobduktion und die Exhumation einer Leiche zur Aufklärung einer Straftat. 10. Aufsicht und Massnahmen Die Bestimmungen dieses Kapitels sollen einen wirkungsvollen Vollzug gewährleisten. Da es um den Schutz hochwertiger Rechtsgüter geht, sind griffige Aufsichtsinstrumente vorzusehen; daneben sind die zuständigen Behörden mit den notwendigen Aufsichtskompetenzen auszustatten. Wenngleich dies bei den nachfolgenden Bestimmungen jeweils nicht ausdrücklich erwähnt wird, sind die Behörden bei der Wahrnehmung von Aufsichtsbefugnissen und der Anordnung von Massnahmen an die - 94 - allgemeinen verfassungsmässigen Schranken staatlichen Handelns, namentlich an den Verhältnismässigkeitsgrundsatz, gebunden. So dürfen sie von den gesetzlich umschriebenen Aufsichtsbefugnissen nur Gebrauch machen, wenn dies zur Wahrung von öffentlichen Interessen (insbesondere Abwehr einer drohenden Gesundheitsgefährdung) erforderlich ist; stehen verschiedene Mittel zur Verfügung, so ist dasjenige zu wählen, das am wenigsten in die Rechtsstellung der betroffenen Person eingreift. Aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgt beispielsweise, dass die zuständige Behörde nur in dem Umfang in Unterlagen Einblick nehmen darf, als dies zur Erfüllung der Aufsichtsfunktion tatsächlich erforderlich ist. Insoweit erweist sich die in der Vernehmlassung beantragte ausdrückliche Verankerung des (ohnehin geltenden) Grundsatzes, dass die Aufsichtsbehörde nur "notwendige Unterlagen" herausverlangen dürfe, als entbehrlich (vgl. § 49 lit. a GesG-E). § 49 (Aufsichtsbefugnisse) Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden sind im geltenden Recht nur fragmentarisch geregelt; entsprechende Normen finden sich in diversen Erlassen und auf verschiedenen Normstufen (beispielsweise Art. 58 HMG, Art. 18 BetMG, § 30 der Verordnung über die Apotheken [SAR 311.511], § 16 der Verordnung über die Zahnärzte [SAR 311.335]). Angesichts möglicher Regelungslücken besteht die Gefahr, dass im Einzelfall ein Eingreifen mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich ist beziehungsweise erschwert wird. Mit § 49 GesG-E werden die den zuständigen Behörden zukommenden Aufsichtsbefugnisse in allgemeiner Weise, das heisst mit Geltung für sämtliche Vollzugsbereiche, auf Gesetzesstufe normiert. Die Befugnis, Auskünfte sowie die Herausgabe von Unterlagen zu verlangen (lit. a), stellt ein eher mildes Aufsichtsmittel dar, das in vielen Fällen ausreicht, um den massgebenden Sachverhalt abzuklären. Bei den Daten, die der Aufsichtsbehörde zugänglich zu machen sind, wird es sich unter Umständen um sensible Personendaten handeln, die zudem durch ein Berufsgeheimnis geschützt sind. Diesem Umstand haben die Vollzugsbehörden durch ein verhältnismässiges Vorgehen Rechnung zu tragen. Allerdings ist festzuhalten, dass sich die der Aufsicht unterstehenden Personen gegenüber der Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht auf das Berufsgeheimnis berufen können. Soll beispielsweise überprüft werden, ob ein Arzt seiner Dokumentationspflicht nachkommt, setzt dies voraus, dass in die Patientendossiers Einblick genommen werden kann. In derartigen Fällen kann sich die beaufsichtigte Person nicht hinter einem Berufsgeheimnis "verstecken", um so die Aufsicht durch die zuständige Behörde zu vereiteln. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass für seine eigenen Verfehlungen niemand das Privileg eines Berufsgeheimnisses beanspruchen kann. Anders präsentiert sich die Lage, wenn nicht der Geheimnisträger selbst im Fokus der Abklärungen der Aufsichtsbehörde steht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Psychiater einen Arzt behandelt, der psychisch erkrankt ist und gegen den in diesem Zusammenhang ein aufsichtsrechtliches Verfahren eingeleitet wurde. Für den Psychiater gilt uneingeschränkt das Berufsgeheimnis, da sich die Untersuchung nicht gegen ihn richtet; dementsprechend fällt die Herausgabe von Unterlagen nur unter den in § 21 Abs. 1 GesG-E umschriebenen Voraussetzungen in Betracht. Der Zutritt zu Räumlichkeiten (lit. b) hat in der Regel nach Voranmeldung und zu den üblichen Betriebszeiten zu erfolgen. In Fällen zeitlicher Dringlichkeit oder wenn die Gefahr besteht, dass der Zweck der Kontrolle vereitelt würde, können Räumlichkeiten auch ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten und ohne Voranmeldung betreten werden. Die - 95 - konkrete Ausgestaltung des Zutrittsrechts richtet sich zudem nach den dem jeweiligen Vollzugsbereich eigenen Erfordernissen und Gepflogenheiten: So erfolgen beispielsweise im Heilmittelbereich Kontrollen im Rahmen der behördlichen Marküberwachung grundsätzlich unangemeldet (Botschaft zum HMG, BBl 1999, S. 3540). Die Behörden sind befugt, Proben zu erheben und Gegenstände zu Abklärungszwecken zu beschlagnahmen (lit. c). Eine Bestimmung in dieser allgemeinen Form rechtfertigt sich insbesondere deshalb, weil unklar sein kann, wie ein Gegenstand rechtlich zu qualifizieren ist (zum Beispiel Heilmittel, Medizinprodukt, Lebensmittel). Soweit die zu Abklärungszwecken beschlagnahmten Gegenstände gesundheitsgefährdend sind beziehungsweise einer verbotenen Tätigkeit dienen oder gedient haben, können sie gemäss § 50 Abs. 2 lit. a GesG-E "amtlich verwahrt" oder "vernichtet" werden. Ansonsten sind sie grundsätzlich dem Eigentümer zurückzugeben. § 50 (Verwaltungsmassnahmen) Abs. 1 Die Bestimmung umschreibt die Verwaltungsmassnahmen, welche die zuständigen Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben treffen können. Abs. 2 Mögliche Massnahmen sind in Absatz 2 aufgeführt. Dieser Katalog ist nicht abschliessend. Ausdrücklich genannt werden Massnahmen, welche die Rechtsstellung der Bürgerin beziehungsweise des Bürgers empfindlich beeinträchtigen können und somit einer möglichst präzisen Rechtsgrundlage bedürfen. Die zuständigen Behörden können Proben erheben und Gegenstände zu Abklärungszwecken beschlagnahmen (lit. a). Als Beispiel für einen Gegenstand, der einer verbotenen Tätigkeit dient, kann ein von einem Naturheiler eingesetztes Gerät zur Bekämpfung von AIDS oder zur Veränderung der Zeugungsfähigkeit genannt werden. Beispiele für Gegenstände, welche die Gesundheit gefährden: rostiges Skalpell, defekte und verkeimte Zahnarztinstrumente. Bei gravierenden Missständen, kann es sich als notwendig erweisen, die Benützung von Räumen und Einrichtungen zu untersagen sowie Betriebe zu schliessen (lit. b; Beispiele: Verbot einen Operationssaal zu benutzen, Schliessung einer Arztpraxis oder einer Apotheke). Der Begriff "Bekanntmachungen" (lit. c) umfasst neben eigentlicher Werbung auch andere Formen der Information über eine Heiltätigkeit (zum Beispiel Briefkopf mit Berufsbezeichnung, Telefonbucheinträge). Unzulässige Bekanntmachungen sind zu unterbinden. Je nachdem, in welcher Form sie erfolgen, stehen hierzu verschiedene Mittel zu Verfügung: Werbebroschüren, Flugblätter und dergleichen können beschlagnahmt werden; bei Telefonbucheinträgen, Zeitungsinseraten, Internetpublikationen und dergleichen kommt eine Beschlagnahme kaum in Betracht, hier bleibt als Handlungsoption nur das Verbieten beziehungsweise Beseitigen. - 96 - § 51 (Kosten) Unter Vorbehalt besonderer Bestimmungen ist das Verwaltungsverfahren in erster Instanz unentgeltlich (§ 33 Abs. 1 VRPG). Aufsichtsrechtliche Verfahren können bei der zuständigen Behörde einen erheblichen Aufwand verursachen. Mit § 51 GesG-E soll daher die Möglichkeit geschaffen werden, auch im erstinstanzlichen Verfahren Kosten zu erheben. Die Verlegung von Kosten rechtfertigt sich jedoch nur dann, wenn tatsächlich Massnahmen angeordnet werden (auch im Rahmen von § 51 GesG-E gilt somit das "Unterliegerprinzip"). § 52 (Informationspflicht anderer Behörden) Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, der zuständigen Behörde Tatsachen und Wahrnehmungen zu melden, die ein aufsichtsrechtliches Einschreiten erfordern. Die Bestimmung dient vor allem der speditiven Erfassung und Abklärung von Disziplinarfällen. Voraussetzung für die Meldepflicht sind substanzielle Hinweise, dass die Berufspflichten verletzt sein könnten beziehungsweise die Eignung zur Berufsausübung in Frage gestellt ist. Zu melden sind somit nur Vorfälle und Tatsachen, die eine gewisse Schwere aufweisen und die aller Voraussicht nach ein Tätigwerden der Aufsichtsbehörde erfordern. In Bezug auf Personen, die dem MedBG unterstehen, gilt die Meldepflicht im Grundsatz bereits von Bundesrechts wegen (Art. 42 MedBG). Eine vergleichbare Regelung findet sich beispielsweise auch in der Anwaltsgesetzgebung. Meldepflichtige Vorfälle, welche die Berufspflichten verletzen könnten (lit. a), sind beispielsweise grobe Behandlungsfehler oder sexuelle Übergriffe auf Patientinnen und Patienten. Gemäss Litera b zu melden sind Tatsachen, welche die Eignung zur Berufsausübung in Frage stellen. Darunter fallen insbesondere Tatsachen, die darauf hindeuten, dass die Bewilligungsvoraussetzungen gemäss § 5 lit. b GesG-E im Nachhinein weggefallen sind ("Vertrauenswürdigkeit", "physische und psychische Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung"). Als Beispiele zu nennen sind: Suchtprobleme, gravierende psychische Störungen oder schwere Delinquenz. § 53 (Information der Öffentlichkeit) Bei einer drohenden Gesundheitsgefährdung informieren die zuständigen Behörden die Öffentlichkeit. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung rechtfertigt sich insbesondere deshalb, weil unter Umständen über konkrete Sachverhalte – beispielsweise individuell bezeichnete Personen oder Produkte – informiert werden muss. In derartigen Fällen soll die als notwendig erachtete Information nicht mit Hinweis auf das Amtsgeheimnis oder den Datenschutz unterbleiben, vielmehr hat die zuständige Behörde zu entscheiden, ob das Interesse an der Information der Öffentlichkeit die entgegenstehenden privaten Interessen überwiegt. Die zuständige Behörde ist bei der Art und Weise der Kommunikation keinen Beschränkungen unterworfen. Sie hat diejenige Form zu wählen, die geeignet ist, den mit der Bestimmung verfolgten Zweck (Abwendung einer Gesundheitsgefährdung) tatsächlich zu erreichen (so wäre beispielsweise neben der Information der breiten Öffentlichkeit über die Medien auch eine zielgruppenspezifische Information per E-Mail denkbar). - 97 - - 98 - 11. Strafbestimmungen § 54 (Allgemeine Widerhandlungen) Es besteht ein unabweisbares Bedürfnis, Widerhandlungen gegen das Gesundheitsgesetz wirkungsvoll zu sanktionieren. Die Sanktionierung muss jedoch nicht zwingend durch eine im Gesundheitsgesetz verankerte Strafbestimmung erfolgen. Verschiedene strafwürdige Verhaltensweisen sind bereits von Bestimmungen in anderen Gesetzen erfasst. So werden Widerhandlungen beim Umgang mit Heilmitteln durch das HMG geregelt (beispielsweise die Herstellung von Arzneimitteln ohne Bewilligung oder die Abgabe von Arzneimitteln durch unberechtigte Personen; vgl. Art. 86 f. HMG). Weiter kann die Aufsichtsbehörde bei Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind, weit gehende Disziplinarsanktionen, insbesondere eine Busse bis Fr. 20'000.–, anordnen. Es wäre wenig sinnvoll, wenn für die gleiche Verfehlung neben der disziplinarischen zusätzlich noch eine strafrechtliche Busse ausgesprochen würde (so werden beispielsweise auch Anwälte bei der Verletzung von "Berufsregeln" ausschliesslich disziplinarisch bestraft). Für Verfehlungen im Geltungsbereich des Disziplinarrechts (insbesondere Verletzung von Berufspflichten) sind daher im GesG-E keine strafrechtlichen Sanktionen vorzusehen. Abs. 1 In Absatz 1 werden Tatbestände aufgezählt, die weder durch das Disziplinarrecht noch durch Strafbestimmungen in anderen Erlassen abgedeckt sind, und somit einer Normierung im GesG-E bedürfen. Bei Widerhandlungen kann eine Busse bis maximal Fr. 100'000.– ausgesprochen werden. Der Bussenrahmen dürfte am ehesten ausgeschöpft werden bei Personen, die – allenfalls gewerbsmässig und in grossem Stil – bei der Ausübung einer bewilligungsfreien Tätigkeit die Gesundheit von Menschen gefährden (lit. a). Machenschaften von dubiosen Heilern und Scharlatanen soll mit strafrechtlichen Mitteln entschieden entgegengetreten werden; zu diesem Zweck muss die Möglichkeit bestehen, Bussen zu verhängen, welche die fehlbaren Personen empfindlich treffen. lit. a Personen, die eine bewilligungsfreie Tätigkeit ausüben, unterstehen keiner disziplinarischen Verantwortlichkeit. Verfehlungen sind daher strafrechtlich zu sanktionieren. In diesem Bereich dürfte der wichtigste Anwendungsfall von § 54 GesG-E liegen. lit. b Das Nichteinholen einer Berufsausübungsbewilligung wird disziplinarrechtlich sanktioniert; dies zumindest dann, wenn die Bewilligung für die betroffene Person grundsätzlich erhältlich wäre (zum Beispiel Arzt ist ohne Bewilligung tätig; vgl. Botschaft zum MedBG, BBl 2005, Seite 231). Wenn eine Person hingegen eine Tätigkeit ausübt, für die sie die entsprechenden persönlichen und fachlichen Voraussetzungen nicht mitbringt, ist sie gemäss § 54 GesG-E zu bestrafen (zum Beispiel Tätigkeit eines Handwerkers als Arzt beziehungsweise einer Verkäuferin als Hebamme). - 99 - lit. c Zu Litera b analog Bestimmung für Betriebe gemäss § 25 GesG-E: Das Nichteinholen einer grundsätzlich erhältlichen Betriebsbewilligung wird disziplinarrechtlich sanktioniert; sind die in § 26 GesG-E umschriebenen Voraussetzungen für eine Bewilligungserteilung nicht gegeben, ist die fachverantwortliche Person zu bestrafen. Abs. 2 Da es sich bei § 54 GesG-E um einen Übertretungsstraftatbestand handelt, muss die Strafbarkeit von Versuch und Gehilfenschaft ausdrücklich erwähnt werden. Abs. 3 Werden in einem Unternehmen Delikte begangen, sind grundsätzlich die natürlichen Personen zu bestrafen, welche für das Unternehmen gehandelt haben (beziehungsweise hätten handeln sollen). Wenn die Straftat keiner natürlichen Person zugerechnet werden kann, hat das Unternehmen die Busse zu bezahlen. Eine gleichlautende Bestimmung findet sich auch in § 160 Abs. 4 des Baugesetzes (SAR 713.100) sowie § 29 Abs. 4 des Energiegesetzes (SAR 773.100). § 55 (Widerhandlungen im Bereich Tabak- und Alkoholprävention) Abs. 1 und 2 Die in § 55 Abs.1 GesG-E erwähnten Widerhandlungen gegen Massnahmen der Tabak- und Alkoholprävention werden mit Busse bis maximal Fr. 10'000.– sanktioniert (Abs. 1). Der Gemeinderat ist für Bussen bis zu Fr. 2'000.– das zuständige Straforgan (Abs. 2). Die Verkaufsverbote von Tabakwaren gemäss § 37 Abs. 2 und 3 GesG-E stehen in einem sachlichen Zusammenhang zu den Verkaufsverboten von alkoholischen Getränken gemäss § 1 Abs. 2 lit. a und b des Gastgewerbegesetzes. Das Gleiche gilt für das Abgabeverbot von alkoholischen Getränken an nicht kaufsberechtigte Jugendliche (vgl. Kommentierung zu § 37 Abs. 5 GesG-E). Aufgrund von § 14 Abs. 2 des Gastgewerbegesetzes liegen Widerhandlungen gegen die Verkaufsverbote von alkoholischen Getränken in der Strafkompetenz des Gemeinderats. Eine Gleichbehandlung in Bezug auf das Strafverfahren liegt deshalb auf der Hand. Die Bussenkompetenz wird in Anpassung an das per 1. Januar 2009 in Kraft tretende Gesetz über die Umsetzung der neuen Bundesgesetzgebung im Strafrecht und Strafprozessrecht auf Fr. 2'000.– festgesetzt. Um die Gleichbehandlung auch in Bezug auf den Bussenrahmen zu gewährleisten, wird mittels Fremdänderung § 14 Abs. 2 des Gastgewerbegesetzes angepasst (von der maximal auszusprechenden Busse von Fr. 500.– auf Fr. 2'000.–). Ebenso soll der Gemeinderat als Strafbehörde für Widerhandlungen gegen das Rauchverbot gemäss § 38 GesG-E zuständig sein. Eine strafrechtliche Sanktionierung der "Betreiber" von öffentlich zugänglichen Räumen ist nicht vorgesehen. Um den Gemeinden im Bereich ihrer Strafkompetenz den Vollzug zu erleichtern, sollen Widerhandlungen gemäss § 55 Abs. 1 lit. b und c GesG-E ins Ordnungsbussenverfahren verwiesen werden. Die Bussenbeträge fallen zugunsten der aufwandbelasteten Gemeinden an (vgl. § 5 Verordnung über das Ordnungsbussenverfahren - 100 - [Ordnungsbussenverfahrenverordnung, OBVV; SAR 991.512]. - 101 - Abs. 3 Widerhandlungen gegen das Werbeverbot für Tabakwaren und alkoholische Getränke (§ 37 Abs. 1 GesG-E) werden mit Busse bis Fr. 100'000.– bestraft. Da ein Verstoss gegen das Werbeverbot im Vergleich zu den Straftatbeständen gemäss Abs. 1 eine gravierendere Tathandlung darstellt, rechtfertigt sich der höhere Bussenrahmen. Zudem sind die Gemeinden im Bereich der Werbeverbote mit keinen Vollzugsaufgaben betraut, weshalb ihnen auch die Strafkompetenz nicht zufallen soll. Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. Ebenso ist § 54 Abs. 3 GesG-E (Verantwortlichkeit des Unternehmens) anwendbar. 12. Übergangs- und Schlussbestimmungen § 56 (Übergangsrecht) In übergangsrechtlicher Hinsicht besteht Bedarf nach folgenden Bestimmungen: Abs. 1 Es wird in Absatz 1 festgehalten, dass die vor Inkrafttreten des neuen Gesundheitsgesetzes erteilten Bewilligungen grundsätzlich gültig bleiben, was sich aus Gründen des Besitzstands rechtfertigt. Für den Fall, dass die Bewilligungsvoraussetzungen im Vergleich zum alten Recht strenger ausfallen, muss die Bewilligungsinhaberin beziehungsweise der Bewilligungsinhaber die strengeren Voraussetzungen nach Ablauf einer Frist von 2 Jahren seit Inkrafttreten des neuen Gesundheitsgesetzes erfüllen. Diese Einschränkung rechtfertigt sich aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Patientinnen und Patienten. Abs. 2 Vereinzelt werden mit dem neuen Gesundheitsgesetz gewisse Tätigkeiten neu einer Bewilligungspflicht unterstellt. Personen oder Organisationen, welche eine solche Tätigkeit bereits heute ausüben, müssen innert einem Jahr seit Inkrafttreten des Gesundheitsgesetzes ein entsprechendes Gesuch stellen. Unter diese Bestimmung könnten zum Beispiel Transport- und Rettungsunternehmen oder Osteopathinnen und Osteopathen fallen. Abs. 3 Für die Umsetzung des Schutzes vor Passivrauchen (vgl. § 38 GesG-E) sind unter Umständen baulichen Massnahmen erforderlich, die eine gewisse Zeit benötigen. Aus diesem Grund wird eine Frist von 2 Jahren für die Umsetzung der Massnahmen gesetzt. Aus Gründen der Gleichbehandlung soll die Übergangsfrist für alle, welche von der Regelung des Schutzes vor Passivrauchen tangiert sind, Geltung haben, auch wenn die Massnahme ohne weiteres umsetzbar wäre (Abs. 3). Abs. 4 Mit Abs. 3 wird zudem eine Frist von 2 Jahren zur Umsetzung der Regelung bezüglich Verkauf von Tabakwaren durch Automaten an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren (vgl. § 37 Abs. 4 GesG-E) gesetzt. - 102 - § 57 (Änderung bundesrechtlicher Bestimmungen) Auf Bundesebene sind weitere Erlasse mit direktem oder indirektem Bezug zum Gesundheitsgesetz im Gang (zum Beispiel Bundesgesetz über die Psychologieberufe; Humanforschungsgesetz; Erwachsenenschutzrecht), die unter Umständen eine Anpassung des Gesundheitsgesetzes notwendig machen. Unter sehr eingeschränkten Bedingungen ("keine erhebliche Entscheidungsfreiheit") soll der Regierungsrat ermächtigt werden, die zur Ausführung von Bundesrecht erforderlichen Anpassung des Gesundheitsgesetzes vorzunehmen. § 58 (Vollzug) § 59 (Publikation und Inkrafttreten) Es handelt sich hier um gängige Schlussbestimmungen. Fremdänderungen 1. Strafprozessordnung (StPO) vom 11. November 1958 Mit einem neuen § 139 Abs. 3bis Strafprozessordnung (StPO) soll die Grundlage geschaffen werden, dass im Fall von Suizidhilfe die Kosten der Untersuchung einer Selbsttötung den Personen oder Organisationen, welche bei der Selbsttötung Hilfe geleistet haben, auferlegt werden können, soweit sie nicht dem Nachlass der verstorbenen Person belastet werden können. Hat die verstorbene Person zuletzt einen ausländischen Wohnsitz, sollen die Kosten immer der Hilfe leistenden Person oder Organisation auferlegt werden können. Voraussichtlich am 1. Januar 2010 wird die neue Schweizerische Strafprozessordnung (CH-StPO) in Kraft treten und damit zur Aufhebung der kantonalen Strafprozessordnung führen. Die Frage, inwieweit die bundesrechtliche Regelung des Strafprozessrechts noch Raum für kantonale Bestimmungen im Sinne von § 139 Abs. 3bis zulässt, wird zurzeit noch geprüft und soll auf die 2. Beratung hin geklärt werden. 2. Spitalgesetz (SpiG) vom 25. Februar 2003 Die rein gesundheitspolizeiliche Bewilligungspflicht für Spitäler ist nach geltendem Recht in § 58 GesG-1987 enthalten. Ausgehend von den inhaltlichen Vorgaben gemäss Art. 39 KVG soll die Bewilligungspflicht ins Spitalgesetz überführt werden. Die Bewilligungspflicht für stationäre Pflegeeinrichtungen befindet sich ebenfalls im entsprechenden Spezialerlass (§ 6 Pflegegesetz). Die Bewilligungsvoraussetzungen richten sich nach Art. 39 Abs. 1 lit. a–c KVG. Es sind dies: ausreichende ärztlichen Betreuung; erforderliches Fachpersonal; zweckentsprechende Einrichtungen; zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung. Die Bewilligung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden oder befristet werden. Die Bewilligung wird vorübergehend oder dauernd entzogen, wenn die Voraussetzungen für deren Erteilung nicht mehr erfüllt sind. Die Bewilligung kann sodann auch entzogen werden, wenn Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten oder gesetzliche Bestimmungen verletzt - 103 - werden. Vor dem Entzug soll zuerst eine Verwarnung mit Fristansetzung zur Behebung der festgestellten Mängel ergehen. In Absatz 4 wird die Grundlage geschaffen, um bei drohender oder bestehender Gefährdung der betreuten Personen eine sofortige Schliessung des Spitals verfügen zu können. Absatz 5 regelt die Aufsicht und die der Aufsichtsbehörde zustehende Rechte (Zutritt zu den Räumen, Auskünfte, Unterlagen). Die ursprünglich in der Vernehmlassungsfassung vorgesehene Formulierung, dass "Eröffnung und Betrieb einschliesslich Erweiterung und Änderung des bisherigen Angebots" einer Bewilligung bedürfen, wurde von mehreren Parteien, aber auch von den Spitälern stark kritisiert. Man befürchtete damit eine Verschärfung der Bewilligungspflicht sowie eine planerische Einflussnahme seitens des Kantons. Obwohl diese Befürchtungen nicht zutreffen und damit auch keine über die bisherige Bewilligungspflicht in § 58 GesG-1987 hinausgehende Regelung und schon gar nicht eine Einflussnahme insbesondere im planerischen Bereich beabsichtigt war, wurde der entsprechende Passus gestrichen. Allerdings bleibt festzuhalten, dass eine gesundheitspolizeiliche Bewilligung immer nur eine Momentaufnahme darstellen kann, mit welcher zum Ausdruck gebracht wird, dass die erforderlichen personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen für den Spitalbetrieb aktuell erfüllt sind. Bei wesentlichen Veränderungen muss das Vorhandensein der Bewilligungsvoraussetzungen auch entsprechend neu überprüft werden können. 3. Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken (Gastgewerbegesetz, GGG) vom 25. November 1997 § 6 des Gastgewerbegesetzes (GGG; "Wo es die betrieblichen Möglichkeiten erlauben, ist auf die Bedürfnisse der nichtrauchenden Gäste Rücksicht zu nehmen.") kann aufgrund der Regelung in § 38 GesG-E aufgehoben werden. Analog zu § 55 Abs. 2 GesG-E wird der Bussenrahmen für die Strafkompetenz des Gemeinderats in § 14 Abs. 2 GGG von Fr. 500.– auf Fr. 2'000.– erhöht. Fremdaufhebungen Mit dem neuen Gesundheitsgesetz können verschiedene Erlasse aufgehoben werden. Nebst dem geltenden Gesundheitsgesetz aus dem Jahr 1987 kann auch das Gesetz über die Bekämpfung der Tuberkulose aus dem Jahr 1951 aufgehoben werden. Des Weiteren können das Gesundheitsgesetz (GesG) vom 10. November 1987, das Gesetz über die Bekämpfung der Tuberkulose (Tuberkulosegesetz) vom 10. Juli 1951, das Dekret über weitere bewilligungspflichtige Berufe der Gesundheitspflege (DBG) vom 16. November 1999, das Dekret über die Rechte und Pflichten der Krankenhauspatienten (Patientendekret, PD) vom 21. August 1990, das Dekret über die Organisation des Kantonalen Laboratoriums vom 26. Mai 1909 - 104 - aufgehoben werden. - 105 - Die Regelungsinhalte dieser Dekrete werden – soweit erforderlich – in den Grundsätzen im neuen Gesundheitsgesetz und im Übrigen auf Verordnungsstufe (zum Beispiel bewilligungspflichtige Berufe vgl. § 5 Abs. 2 GesG-E; Patientenrechte vgl. § 28 Abs. 5 GesGE; Organisation § 2 Abs. 1 GesG-E) abgehandelt. § 6 des Gastgewerbegesetzes wird durch § 38 GesG-E ersetzt. 5. Auswirkungen 5.1 Auf den Kanton sowie die Gemeinden 5.1.1 Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden Das neue Gesundheitsgesetz erwähnt explizit in § 3, § 37 Abs. 4 sowie § 48 die Aufgaben der Gemeinden. Insbesondere die in § 3 Abs. 1 lit. a–c festgehaltenen Aufgaben (Unterstützung Kanton bei Vollzug GesG; Bereitstellung bedarfsgerechtes Angebot im Bereich Mütter- und Väterberatung; Organisation und Durchführung der Pilzkontrolle unter Mithilfe Kanton) werden bereits heute durch die Gemeinden unverändert vollzogen. Daraus ergeben sich weder für den Kanton noch für die Gemeinden oder Dritte Mehrbelastungen. Im Bereich des Bestattungswesens (§ 48 GesG-E) werden neu durch den Kanton nur noch diejenigen Grundsätze durch den Regierungsrat geregelt, welche zur Wahrung von gesundheitspolizeilichen Interessen erforderlich sind. Das heisst, dass gewisse Bereiche gemäss den Grundsätzen der Aufgabenteilung dem Regelungsbereich der Gemeinden zu überlassen sind (zum Beispiel Bestattungsarten, Anlage von Friedhöfen und Gräbern). Der Wegfall von Regelungen im kantonalen Recht wird bei den Gemeinden einen gewissen Rechtssetzungsaufwand auslösen. Dieser Aufwand dürfte aber moderat ausfallen, da die Normen des kantonalen Rechts in den bereits bestehenden Friedhofreglementen häufig "wiederholt" werden. Soweit die eine oder andere Regelungslücke entstehen sollte, ist im Übrigen davon auszugehen, dass die Gemeinden weitestgehend die bisherige kantonale Regelung übernehmen werden. Im Bereich des Vollzugs, der unverändert bei den Gemeinden liegt, ist weder für den Kanton noch für die Gemeinden mit einem Mehraufwand zu rechnen. 5.1.2 Liberalisierung der Berufszulassung Die vorgesehene Liberalisierung bei der Berufszulassung im Gesundheitswesen, wonach aufgrund des Wechsels vom diplomorientierten zum tätigkeitsspezifischen Modell Tätigkeiten und Berufe im komplementärtherapeutischen Bereich weitgehend ohne staatliche Bewilligung ausgeübt werden dürfen, zieht eine vermehrte Informationstätigkeit des Kantons, nach sich. Einhergehend mit der Eigenverantwortlichkeit der Patientinnen und Patienten bei der Auswahl ihrer Behandlung ist es Pflicht der Behörden, umfassend und kontinuierlich über das tätigkeitsspezifische System und die staatlich geregelten Zulassungen etc. zu informieren (zum Beispiel gezielte Information via Verbände). Ebenso ist als Folge der Liberalisierung ein allfälliger Mehraufwand im Aufsichtsbereich inklusive Vollzug nicht auszuschliessen. So hat der Kanton auf Anzeige oder Meldung von Dritten hin, möglicherweise vermehrt entsprechend tätig zu werden. Ziel ist es, den anfallenden Mehraufwand mit den bestehenden personellen Ressourcen abzudecken. Auf der anderen Seite wird der administrative Aufwand in bestimmten Bereichen geringer ausfallen (bisherige - 106 - Aufsicht in Bezug auf die verbotenen Tätigkeiten im Bereich der Komplementärtherapie, Entbindungen Berufsgeheimnis). - 107 - 5.1.3 Massnahmen der Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz Gesundheitsvorsorge (§ 34 GesG-E) Die Massnahmen gemäss § 34 werden grundsätzlich vom Kanton finanziert, so wie dies bereits heute der Fall ist. So finanziert der Kanton seine aktive Gesundheitsförderungspolitik (zum Beispiel Schwerpunktprogramme "Betriebliche Gesundheitsförderung" und "Gesundes Körpergewicht"; Newsletter "Forum Gesundheit"; Gesundheitsförderungspreis) aus den ordentlichen Budgetmitteln. Die Gemeinden haben in diesem Bereich keine Verpflichtungen. Es ist allerdings erwünscht, wenn sie selbst auch aktiv sind. Vgl. zum Beispiel die Stadt Aarau mit der Stiftung "Aarau eusi gsund Stadt". Ein neues Engagement zeichnet sich auch in der Region Baden/Wettingen ab. Impfungen (§ 35 GesG-E) Die Kosten der Impfungen werden in der Regel von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen, da sich der Kanton Aargau an die Empfehlungen des Bundes hält. Falls es sich bei einer Impfung nicht um eine Pflichtleistung handelt, gehen die Kosten zulasten der Patientinnen und Patienten. Kosten für den Kanton entstehen somit keine. Suchtprävention und Suchthilfe (§ 36 GesG-E) Im Bereich der Suchtprävention und der Suchthilfe ergeben sich keinerlei Veränderungen zu bisher. Die Zuständigkeit des Kantons in diesen Bereichen bleibt bestehen. Werbeverbot Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 1 GesG-E) Durch die neue Verankerung des Verbots von grossflächiger Werbung für Tabakwaren und Alkohol ergibt sich eine neue Vollzugsaufgabe für den Kanton. Von der Sache her ist es im Sinne der Synergiennutzung sinnvoll, diese Aufgabe dem Amt für Verbraucherschutz zu übertragen, da das Amt für Verbraucherschutz bereits heute für den Vollzug des bundesrechtlichen Werbeverbots im Bereich Tabak und Alkohol für Werbung, die sich direkt an Jugendliche richtet, zuständig ist. Da Werbung im Tabak- und Alkoholbereich gemäss den neuen Bestimmungen auch dort platziert werden kann, wo kein konkreter Bezug zu Lebensmitteln gegeben ist, wird das Amt für Verbraucherschutz mit einer neuen Aufgabe betraut, die zu einem gewissen Mehraufwand führt, der nicht durch die bestehenden personellen Ressourcen abgedeckt werden kann. Insbesondere kein Bezug zu Lebensmitteln ist zum Beispiel bei der Überprüfung von Plakaten an Strassenabschnitten gegeben. Generell kann gesagt werden, dass die Kontrolle der neuen Werbeverbote Tabak und Alkohol im Rahmen der Verhältnismässigkeit stichprobenweise oder auf Anzeige von Dritten hin ausgeübt werden. - 108 - Verkaufsverbot von Tabakwaren inklusive Automaten (§ 37 Abs. 2 und 3 GesG-E) Ebenfalls neu ist das Verkaufsverbot von Tabakwaren (inklusive Automaten) an Personen unter 16 Jahren. Auch hier können für den Vollzug im Sinne der Synergiennutzung bereits bestehende Absatzkanäle im Rahmen der Kontrolle der Verkaufsverbote für Alkohol genutzt werden. So kontrolliert das Amt für Verbraucherschutz bereits heute Betriebe, die Alkohol abgeben (Gastrobetriebe, Hotels, Kioske, Tankstellen, etc.). Durch die neue Aufgabe der Alterskontrolle beziehungsweise der Kontrolle von Zugriffseinschränkungen bei Zigarettenautomaten, entsteht dem Amt für Verbraucherschutz nur ein geringer Mehraufwand. Die meisten Automaten, die heute noch Tabakwaren anbieten, befinden sich in den Gastronomiebetrieben. Es besteht somit die Möglichkeit, gleichzeitig im Rahmen von üblichen Betriebskontrollen Kontrollen im Bereich des Tabakwarenverkaufs durchzuführen. In dem Sinne erhält das Amt für Verbraucherschutz eine neue Vollzugsaufgabe, welche sich jedoch nur gering zu einer Mehrbelastung auswirken wird. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Amt für Verbraucherschutz mit dem Vollzug des Werbeverbots sowie des Verkaufsverbots einen zusätzlichen Stellenbedarf von total 50 % aufweist. Testkäufe im Bereich Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 4 GesG-E) Die Gemeinden sind aufgrund von § 37 Abs. 4 GesG-E für die Durchführung von Testkäufen im Bereich Tabak und Alkohol zuständig. Da es sich bei der neuen gesetzlichen Grundlage um keine verpflichtende Formulierung handelt ("kann-Formulierung"), hängen etwaige für die Gemeinden anfallende Kosten davon ab, ob die Gemeinde sich überhaupt zur Durchführung solcher Testkäufe entscheidet und auf welche Art und Weise sie diese durchführen will (Aufgabe der Gemeindepolizeien oder Zusammenarbeit mit Dritten, zum Beispiel Blaues Kreuz). Da es sehr schwierig ist, hier annähernd verlässliche Aussagen über die anfallenden Kosten zu machen, kann hier höchstens das zurzeit laufende speziell vom Kanton in Zusammenarbeit mit der Suchtprävention Aargau, dem Kinder- und Jugendwerk des Blauen Kreuzes und der Vereinigung der Aargauer Gemeindepolizeien dafür entwickelten Projekt "Alkohol-Testkäufe" beispielhaft aufgeführt werden. Vgl. dazu die Zahlen in der nachfolgenden Tabelle zu den Testkäufen. Sofern man sich dafür entscheidet, TabakTestkäufe in ähnlichem Rahmen wie die Alkohol-Testkäufe durchzuführen, können die genannten Zahlen vergleichsweise herangezogen werden. Sofern sich eine Gemeinde jedoch dafür entscheidet, die Verkaufsverbote nicht im Rahmen von Testkäufen zu überprüfen, fallen keine Mehrkosten an. Abgabeverbot von Alkohol an nicht Kaufsberechtigte (§ 37 Abs. 5 GesG-E) Ebenfalls neu für den Vollzug zuständig sind die Gemeinden für die Überprüfung des Abgabeverbots von Alkohol an nicht kaufsberechtigte Jugendliche aufgrund von § 37 Abs. 5 GesG-E. Dabei handelt es sich – wie bei den Testkäufen – um eine gemeindepolizeiliche Aufgabe. Auch in diesem Bereich ist mit personellen sowie finanziellen Mehraufwendungen der Gemeinden zu rechnen. Der Umfang dieser Aufwendungen hängt unter anderem von der Art und Weise der Durchführung der Kontrollen ab. - 109 - Passivrauchschutz (§ 38 GesG-E) Der Vollzug des neuen Paragrafen des Passivrauchschutzes (§ 38 GesG-E) wird in geteilter Zuständigkeit Kanton/Gemeinden vorgenommen. Für die Ahndung des Verstosses gegen das Rauchverbot sind die Gemeinden zuständig. Die Bewilligungserteilung in der Gastronomie zur Führung eines Raucherbetriebs (vgl. Variante 2) wird insbesondere aus Gründen der Rechtsgleichheit und -einheit bei der Beurteilung durch den Kanton vorgenommen werden können. Die Durchführung der Kontrolle der Kennzeichnung als Raucherraum, der räumlichen Abtrennung sowie der Belüftung der Raucherräume (Fumoirs) können dem Amt für Verbraucherschutz übertragen werden (Variante 1 und 2). Das Amt für Verbraucherschutz prüft bereits heute in den Gastronomiebetrieben die Belüftungen in den Küchen. Im Rahmen dieses Vollzugs für das Amt für Verbraucherschutz neu sind jedoch die diesbezüglichen Kontrollen in anderen Räumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (zum Beispiel Spitäler, Heime, Schulen, Bildungsstätten, etc.), sofern kein lebensmittelrechtlicher Bezug besteht. Dabei ist zum heutigen Zeitpunkt unklar, in welchem Umfang hier tatsächlich Fumoirs vorhanden sein werden, die kontrolliert werden müssten. Diese neue Vollzugsaufgabe wird zu einem gewissen Mehraufwand führen, der nicht durch die bestehenden personellen Ressourcen des Amts für Verbraucherschutz abgedeckt werden kann. Im Bereich der Kontrolle des Passivrauchschutzes ist ebenfalls mit einem zusätzlichen Stellenbedarf von 50 % zu rechnen. Auch hier ist natürlich vorgesehen, die diesbezüglichen Kontrollen, falls tatsächlich solche Fumoirs bestehen sollten, im Rahmen der Verhältnismässigkeit stichprobenweise oder auf Anzeige von Dritten hin auszuüben. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl dem Kanton, als auch den Gemeinden im Rahmen des Vollzugs der Massnahmen der Gesundheitsvorsorge nur aus den §§ 37 und 38 GesG-E zusätzlicher Aufwand entsteht. Auf der anderen Seite ist aber auch zu beachten, dass den Gemeinden aus dem Vollzug in Form von Gebühren- und Bussenerträgen auch wieder Einnahmen zufliessen werden. 5.1.4 Versorgungssicherheit Durch das verstärkte Engagement des Kantons im Bereich der Versorgungssicherheit können sich je nach Entwicklung Mehrkosten ergeben. Finanzielle Unterstützung von Organisationen, welche die Lebensrettung von Personen bezwecken (§ 39 Abs. 5 GesG-E) Gemäss § 39 Abs. 5 GesG-E kann der Regierungsrat Organisationen, welche die Lebensrettung von Personen bezwecken, finanziell unterstützen. Diese Rechtsgrundlage wurde insbesondere für den bereits heute jährlich geleisteten wiederkehrenden Beitrag des Kantons von rund Fr. 23'000.–/Jahr an den Schweizer Alpenclub (SAC) geschaffen. Da es sich hierbei um Betriebsbeiträge im Rahmen des Kantonsbudgets (Departement Volkswirtschaft und Inneres) handelt, fallen hier keine zusätzlichen Kosten an. Gleiches gilt für die Beiträge an das Schweizerische Toxzentrum (Fr. 85'000.–/Jahr) sowie den Interverband für Rettungswesen (Fr. 40'000.–/Jahr), welche bereits heute im Rahmen der ordentlichen Budgets geleistet werden. - 110 - Koordination in der Notfallversorgung (§ 40 Abs. 2 GesG-E) In § 40 Abs. 2 GesG-E hat der Kanton die Möglichkeit, Projekte, die der Koordination zwischen der ambulanten und der stationären Notfallversorgung dienen (vgl. Kantonsspital Baden) zu fördern und zu unterstützen, was sich jedoch im Endeffekt kostensparend auswirken wird, weil die teureren Strukturen der Spitäler nur noch bei entsprechender Indikation in Anspruch genommen werden. Förderung der ärztlichen Grundversorgung (§ 41 GesG-E) Mit § 41 GesG-E bekennt sich der Kanton zum Problem des Hausärztinnen und Hausärztemangels und zur Notwendigkeit der Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung im ambulanten Bereich. Durch die verpflichtende Formulierung in Absatz 2, wonach er zu diesem Zweck finanzielle Mittel einsetzt, werden Mehrkosten für den Kanton zu erwarten sein. Finanzielle Unterstützung ist konkret im Bereich Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten zu erwarten (lit. a), wobei der Regierungsrat im Rahmen eines Pilotprojekts für die Jahre 2008 und 2009 für die Förderung und Finanzierung der Praxisassistenzstellen in den Grundversorgerpraxen insgesamt 1 Mio. Franken zulasten des Lotteriefonds bereits bewilligt hat. Sollte nach Ablauf dieser Pilotphase entschieden werden, die Praxisassistenzstellen weiterhin finanziell zu unterstützen, ergeben sich daraus ab dem Jahr 2010 Mehrkosten für den Kanton in budgetiertem Umfang von jährlich voraussichtlich 0.5 Mio. Franken. Ein starkes Hausarztsystem sollte sich jedoch insgesamt Kosten sparend auswirken. Ebenfalls verpflichtet sich der Kanton Aargau mit erwähnter Bestimmung, finanzielle Mittel für weitere Anreizmassnahmen einzusetzen, die der Förderung der ärztlichen Grundversorgung dienen (lit. b). Hier ist insbesondere an eine gut funktionierende Organisation des ambulanten Notfalldiensts zu denken. Seitens des Aargauischen Ärzteverbands liegt dazu ein konkretes Konzept vor. Eine Beteiligung des Kantons an diesen Kosten ist im Rahmen der Erteilung eines entgeltlichen Leistungsauftrags im Umfang von Fr. 270'000.– denkbar. 5.1.5 Vollzug Heilmittel- und Betäubungsmittelwesen Der Vollzug des Heilmittel- und Betäubungsmittelwesens führt zu keinen zusätzlichen Aufgaben. Allfällige Einsparungen lassen sich durch die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen erzielen (vgl. § 42 Abs. 3 GesG-E). 5.2 Auf die Wirtschaft des Kantons Aargau Die im Rahmen des total revidierten Gesundheitsgesetzes vorgeschlagenen neuen Massnahmen tangieren die Wirtschaft im Kanton Aargau bedingt bis gar nicht. Betroffen ist die Wirtschaft nur durch die Bereiche "Liberalisierung Berufszulassung" sowie die Massnahmen der Gesundheitsvorsorge. - 111 - Liberalisierung der Berufszulassung § 4 Abs. 1 lit. g GesG-E verlangt neu eine Bewilligungspflicht für fachlich Selbstständige mit einem eidgenössisch anerkannten Diplom der Komplementärmedizin. Da zurzeit noch kein Berufsbild im Rahmen der Komplementärmedizin vom Bund definitiv verabschiedet ist, fallen hier keine zusätzlichen Mehraufwendungen für die beruflich selbstständig Tätigen im Bereich der Komplementärmedizin an. Zudem wurde § 4 Abs. 1 lit. g GesG-E aufgrund der Vernehmlassung neu insbesondere auf Wunsch der Verbände im naturheilkundlichen Sektor nach vermehrter staatlicher Anerkennung der Komplementärmedizin ins Gesetz aufgenommen. Die Bestimmung liegt somit im Interesse der Wirtschaft. Im Übrigen zieht sich der Staat durch die generelle Liberalisierung der Berufszulassungsregelung aus der Wirtschaft zu einem gewissen Teil zurück. Werbeverbote Tabak und Alkohol (§ 37 Abs. 1 GesG-E) Im Bereich der Werbeverbote Tabak und Alkohol ergeben sich insbesondere deshalb für die Wirtschaft keine massgebenden Einschränkungen, weil sich der Markt hier durch die bereits in anderen Kantonen bestehenden Werbeeinschränkungen beziehungsweise -verbote selbst reguliert. So weicht die Allgemeine Plakatgesellschaft (APG; gemäss eigenen Aussagen) bei Plakatwerbeverboten von gewisser Grösse aufgrund der beschränkten Werbewirksamkeit nicht automatisch auf Plakate kleineren Formats aus. Sie verzichtet aufgrund der Einschränkungen gänzlich auf das Werbemittel des Plakats. Zugleich wird bereits heute in öffentlichen Verkehrsmitteln auf Tabak- und Alkoholwerbung verzichtet. In Kinovorführungen ist die Ausstrahlung von Werbefilmen und Diapositiven vor 20 Uhr untersagt. Zudem dürfen höchstens zwei Werbefilme pro Vorstellung gezeigt werden. Gemäss Rücksprache mit der Cinecome AG (einziger Vertreiber für Kinowerbung in der Schweiz) gibt es seit 2008 insbesondere für Tabakwerbung eine Selbstbeschränkung in den Kinos, wonach keine Tabakwerbung mehr ausgestrahlt wird. Im Bereich Alkohol gibt es lediglich noch eine Werbung für Wein. Verkaufsverbot von Tabakwaren durch Automaten (§ 37 Abs. 3 GesG-E) Im Bereich des Verkaufs von Tabakwaren durch Automaten ergeben sich für die Betreiber aufgrund der Pflicht zur Umrüstung insofern Kosten, als dass sie sich entscheiden, in ihren Automaten weiterhin Tabakwaren anzubieten. Eine solche technische Umrüstung (auf Jetonbetrieb) ist nicht billig. Gewisse Hersteller (zum Beispiel der Tabakmulti British American Tobacco Switzerland) haben ihre Automaten aufgrund solcher kantonaler Einschränkungen/ Verbote bereits umgestellt (zum Beispiel in den Kantonen Luzern, Waadt, Graubünden). Ebenfalls haben auch in diesem Bereich bereits Selbstbeschränkungen stattgefunden. So hat sich die SELECTA-Gruppe letztes Jahr dazu entschieden, auf den Verkauf von Tabakwaren durch Automaten gänzlich zu verzichten. - 112 - 5.3 Tabelle Auswirkungen (Übersicht) Kanton Massnahmen Gemeinden Aufwand Ertrag bzw. Minderaufwand Aufwand Mütter-/ Väterberatung --- --- Keine Veränderungen Pilzkontrolle Keine Veränderungen Berufszulassung Mehraufwand Aufsicht und Information (können mit den bestehenden Ressourcen abgedeckt werden) Allgemeine Gesundheitsvors orge Keine Veränderungen Impfungen --- Suchthilfe Keine Veränderungen Werbeverbote Alkohol/Tabak Zusätzlicher Vollzugsaufwand Verkaufsverbot Tabak (inklusive Automaten) Nur geringer Mehraufwand (Kontrolle im Rahmen bestehender Absatzkanäle für Alkohol) Ertrag bzw. Minderaufwand Keine Veränderungen Administrativer Minderaufwand; Erträge aus Disziplinarverfah ren --- --- --- --- --- --- --- Keine Veränderungen Gebühren- und allfällige Bussenerträge --- --- Gebühren- und allfällige Bussenerträge Aufwand je nach Umfang des Vollzugs (z.B. im Rahmen von Testkäufen)* Allfällige Bussenerträge Aufwand je nach Umfang des Vollzugs (z.B. im Rahmen von Testkäufen)* Allfällige Bussenerträge Total: 50 %-Stelle Verkaufsverbot Alkohol (bereits bestehende Massnahme!) Keine Veränderungen Verbot Abgabe Alkohol --- --- Aufwand je nach Umfang des Vollzugs Allfällige Bussenerträge Passivrauchschut z Zusätzlicher Vollzugsaufwand (50 %-Stelle) Gebühren- und allfällige Bussenerträge Aufwand je nach Umfang des Vollzugs Allfällige Bussenerträge - 113 - Kanton Massnahmen Aufwand Gemeinden Ertrag bzw. Minderaufwand Aufwand Ertrag bzw. Minderaufwand --- --- Finanzielle Unterstützung von Organisationen, welche die Lebensrettung von Personen bezwecken Keine Veränderungen Versorgungssicherheit; Koordination Notfallversorgung Vollzugsaufwand; Förderung und Unterstützung von Projekten --- --- --- Förderung ärztliche Grundversorgung ambulanter Bereich Massnahmen Aus-, Weiter und Fortbildung: ca. Fr. 500'000.–/Jahr --- --- --- Leistungsauftrag an Ärzteverband ca. Fr. 270'000.– Heilmittel-/Betäubungsmittelwese n Keine Veränderungen --- --- Bestattungswese n Keine Veränderungen Rechtssetzung --- * Im Bereich Alkohol werden die Testkäufe im Rahmen eines vom Kanton zusammen mit der Suchtprävention Aargau, dem Kinder- und Jugendwerk des Blauen Kreuzes und der Vereinigung der Aargauer Gemeindepolizeien lancierten Projekts anlässlich von drei Testkaufserien durchgeführt. Die Teilnahme an diesem Projekt seitens der Gemeinden ist fakultativ. Die Verteilung der anfallenden Kosten beziehungsweise die Kostenbelastung seitens des Kantons und der teilnehmenden Gemeinden hängt von diversen Faktoren ab. Entscheidender Faktor ist die Anzahl der zu testenden Alkoholverkaufsstellen in einer Gemeinde. Im Rahmen der 1. Testkaufserie übernimmt der Kanton jeweilen die vollen Kosten. Im Rahmen der 2. und 3. Testkaufserie tragen die anfallenden Kosten die Gemeinden: Testkaufserie: Kanton: Fr. 2'750.– bei 50 getesteten Verkaufsstellen in einer Gemeinde; Testkaufserie: Gemeinde: Fr. 1'989.– bei (noch) 33 getesteten Verkaufsstellen in einer Gemeinde; 3. Testkaufserie: Gemeinde: Fr. 1'525.– bei (noch) 25 getesteten Verkaufsstellen in einer Gemeinde. - 114 - 6. Weiteres Vorgehen; Zeitplan Geschäfte 2008 1. Beratung Kommission Gesundheit und Soziales Juni 1. Beratung im Grossen Rat August/September Beschluss Regierungsrat Botschaft 2. Beratung Dezember 2009 2. Beratung Kommission Gesundheit und Soziales Januar 2. Beratung im Grossen Rat sowie Schlussabstimmung März Beschluss Regierungsrat: Redaktionelle Überprüfung April Grosser Rat: Genehmigung redaktionelle Überprüfung Mai Publikation im Amtsblatt Mai Referendumsfrist (90 Tage) Mai bis Juli Termine Volksabstimmung 27. September oder 29. November Anpassung Verordnungen Vorbereitungsarbeite n ab ca. Mitte Jahr Inkraftsetzung Gesetz und Verordnung 1. Januar 2010 im Verlauf des Jahrs Antrag: 1. Der vorliegende Entwurf einer Totalrevision des Gesundheitsgesetzes (GesG) wird in 1. Beratung zum Beschluss erhoben. - 115 - 2. Die folgenden parlamentarischen Vorstösse werden abgeschrieben: (99.423) Postulat Urs Leuenberger, Widen, vom 21. Dezember 1999 betreffend Schaffung rechtlicher Grundlagen im aargauischen Rettungswesen; (03.139) Motion Liliane Studer, Wettingen, vom 20. Mai 2003 betreffend Ausweitung der Werbeeinschränkungen für Alkohol und Tabak; (04.290) Motion Liliane Studer, Wettingen, vom 2. November 2004 betreffend rauchfreie öffentliche Räume zum Schutz der Bevölkerung vor Passivrauchen; (06.109) Motion Dr. Rainer Klöti, Auenstein, vom 13. Juni 2006 betreffend Sterbehilfe im Kanton Aargau. Aarau, 21. Mai 2008 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS Landammann: Peter C. Beyeler Staatsschreiber: Dr. Peter Grünenfelder Beilage: Synopse Gesundheitsgesetz (GesG)


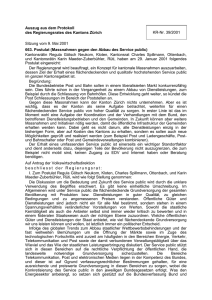

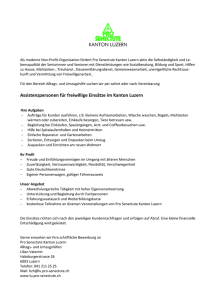
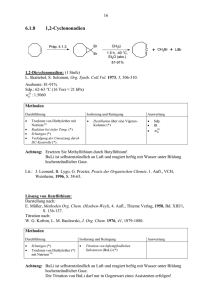
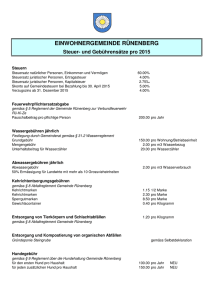
![1 Beschluss [Behörde] vom [Tag Monat Jahr] Protokoll Nr. [……] In](http://s1.studylibde.com/store/data/002061766_1-5ba6dca93390fe44f1269038b05fcba6-300x300.png)