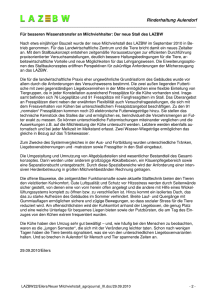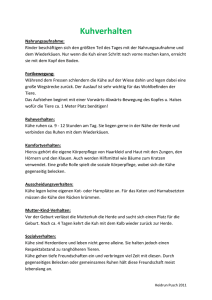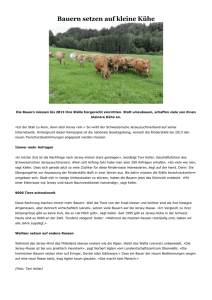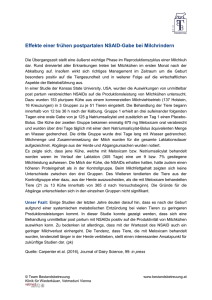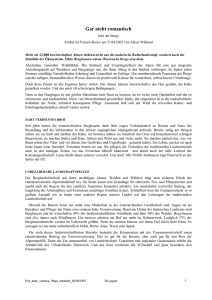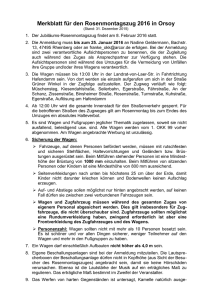57. ** Rinder- und Pferdegespanne
Werbung
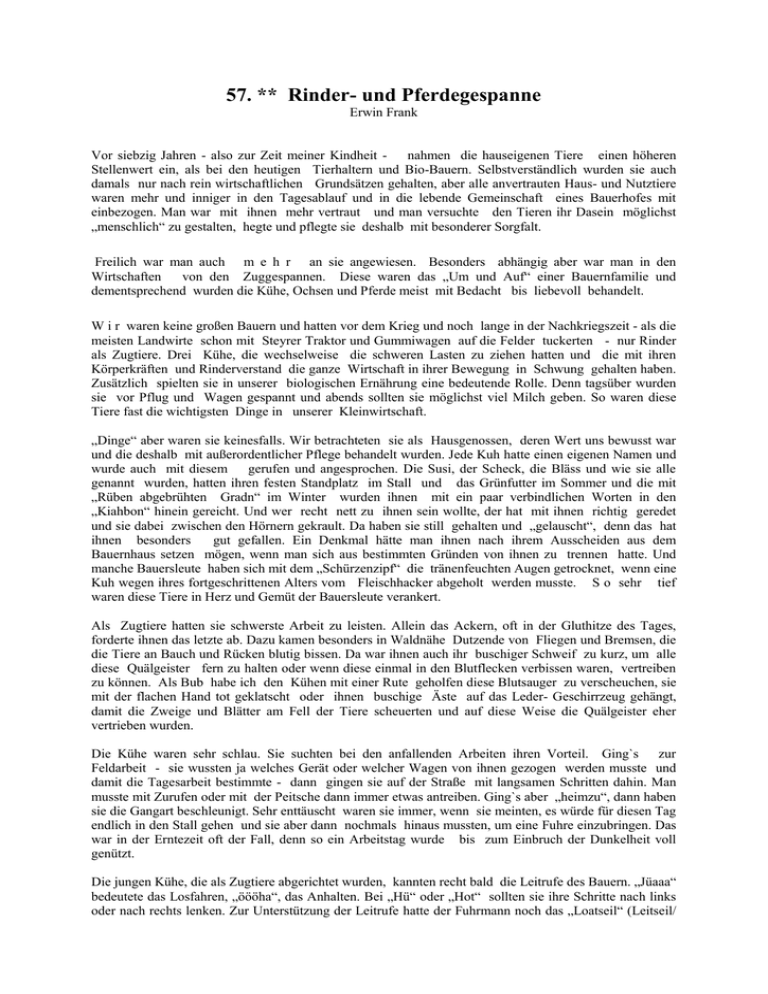
57. ** Rinder- und Pferdegespanne Erwin Frank Vor siebzig Jahren - also zur Zeit meiner Kindheit nahmen die hauseigenen Tiere einen höheren Stellenwert ein, als bei den heutigen Tierhaltern und Bio-Bauern. Selbstverständlich wurden sie auch damals nur nach rein wirtschaftlichen Grundsätzen gehalten, aber alle anvertrauten Haus- und Nutztiere waren mehr und inniger in den Tagesablauf und in die lebende Gemeinschaft eines Bauerhofes mit einbezogen. Man war mit ihnen mehr vertraut und man versuchte den Tieren ihr Dasein möglichst „menschlich“ zu gestalten, hegte und pflegte sie deshalb mit besonderer Sorgfalt. Freilich war man auch m e h r an sie angewiesen. Besonders abhängig aber war man in den Wirtschaften von den Zuggespannen. Diese waren das „Um und Auf“ einer Bauernfamilie und dementsprechend wurden die Kühe, Ochsen und Pferde meist mit Bedacht bis liebevoll behandelt. W i r waren keine großen Bauern und hatten vor dem Krieg und noch lange in der Nachkriegszeit - als die meisten Landwirte schon mit Steyrer Traktor und Gummiwagen auf die Felder tuckerten - nur Rinder als Zugtiere. Drei Kühe, die wechselweise die schweren Lasten zu ziehen hatten und die mit ihren Körperkräften und Rinderverstand die ganze Wirtschaft in ihrer Bewegung in Schwung gehalten haben. Zusätzlich spielten sie in unserer biologischen Ernährung eine bedeutende Rolle. Denn tagsüber wurden sie vor Pflug und Wagen gespannt und abends sollten sie möglichst viel Milch geben. So waren diese Tiere fast die wichtigsten Dinge in unserer Kleinwirtschaft. „Dinge“ aber waren sie keinesfalls. Wir betrachteten sie als Hausgenossen, deren Wert uns bewusst war und die deshalb mit außerordentlicher Pflege behandelt wurden. Jede Kuh hatte einen eigenen Namen und wurde auch mit diesem gerufen und angesprochen. Die Susi, der Scheck, die Bläss und wie sie alle genannt wurden, hatten ihren festen Standplatz im Stall und das Grünfutter im Sommer und die mit „Rüben abgebrühten Gradn“ im Winter wurden ihnen mit ein paar verbindlichen Worten in den „Kiahbon“ hinein gereicht. Und wer recht nett zu ihnen sein wollte, der hat mit ihnen richtig geredet und sie dabei zwischen den Hörnern gekrault. Da haben sie still gehalten und „gelauscht“, denn das hat ihnen besonders gut gefallen. Ein Denkmal hätte man ihnen nach ihrem Ausscheiden aus dem Bauernhaus setzen mögen, wenn man sich aus bestimmten Gründen von ihnen zu trennen hatte. Und manche Bauersleute haben sich mit dem „Schürzenzipf“ die tränenfeuchten Augen getrocknet, wenn eine Kuh wegen ihres fortgeschrittenen Alters vom Fleischhacker abgeholt werden musste. S o sehr tief waren diese Tiere in Herz und Gemüt der Bauersleute verankert. Als Zugtiere hatten sie schwerste Arbeit zu leisten. Allein das Ackern, oft in der Gluthitze des Tages, forderte ihnen das letzte ab. Dazu kamen besonders in Waldnähe Dutzende von Fliegen und Bremsen, die die Tiere an Bauch und Rücken blutig bissen. Da war ihnen auch ihr buschiger Schweif zu kurz, um alle diese Quälgeister fern zu halten oder wenn diese einmal in den Blutflecken verbissen waren, vertreiben zu können. Als Bub habe ich den Kühen mit einer Rute geholfen diese Blutsauger zu verscheuchen, sie mit der flachen Hand tot geklatscht oder ihnen buschige Äste auf das Leder- Geschirrzeug gehängt, damit die Zweige und Blätter am Fell der Tiere scheuerten und auf diese Weise die Quälgeister eher vertrieben wurden. Die Kühe waren sehr schlau. Sie suchten bei den anfallenden Arbeiten ihren Vorteil. Ging`s zur Feldarbeit - sie wussten ja welches Gerät oder welcher Wagen von ihnen gezogen werden musste und damit die Tagesarbeit bestimmte - dann gingen sie auf der Straße mit langsamen Schritten dahin. Man musste mit Zurufen oder mit der Peitsche dann immer etwas antreiben. Ging`s aber „heimzu“, dann haben sie die Gangart beschleunigt. Sehr enttäuscht waren sie immer, wenn sie meinten, es würde für diesen Tag endlich in den Stall gehen und sie aber dann nochmals hinaus mussten, um eine Fuhre einzubringen. Das war in der Erntezeit oft der Fall, denn so ein Arbeitstag wurde bis zum Einbruch der Dunkelheit voll genützt. Die jungen Kühe, die als Zugtiere abgerichtet wurden, kannten recht bald die Leitrufe des Bauern. „Jüaaa“ bedeutete das Losfahren, „öööha“, das Anhalten. Bei „Hü“ oder „Hot“ sollten sie ihre Schritte nach links oder nach rechts lenken. Zur Unterstützung der Leitrufe hatte der Fuhrmann noch das „Loatseil“ (Leitseil/ Leitriemen aus Leder) in der linken Hand und in der rechten Faust hielt er die unentbehrliche Peitsche, die aber meist nur als Drohmittel verwendet wurde. Richtig schnalzen konnte man mit dieser „birkenen Liesl“ kaum und richtig geschlagen wurden sie im Zorn nur von rohen Lümmeln. Der Kuhbauer ging meist bescheiden im Schritt neben dem Fahrzeug einher, und manche Ochsenbauern hielten sich sogar vorne an der Stange abgestützt fest, indem sie zwischen den beiden Tieren, dem Gespann voranschritten und sich dabei als bequemen Nebeneffekt ein wenig „schieben“ ließen. Während einer Fahrt in bergigen Straßenstücken musste mehrmals die „Schleife“ ( das war ein Holzklotz, der mit einem schraubenähnlichen Mechanismus an den Vorderrädern eines Wagens schleifte/ bremste) angedreht werden um den Wagen bei Talfahrten zu bremsen. Hatte der Fuhrmann einzuspannen, so löste er den „Knebel“ der Stirnkette (mit der die Tiere im Stall angehängt waren) und stülpte das „Kummet“ über ihren Kopf. Das war ein aus Leder hergestelltes und mit Rosshaar gefüttertes/ ausgepolstertes Zugkissen, an dem die Stränge (Zugseile) befestigt waren, die wiederum an ihrem Ende in die „Waagln“ eingehängt wurden. Die Kuh zog damit mit ihrer „Schulter“ was hinter ihr eben „angehängt“ wurde. Die Ochsen hingegen zogen ihre Lasten mit dem „Hirnjechl“ (Hirnjoch)“. Das war ein kleineres, ebenfalls ausgepolstertes Kissen, das an der Stirne angelegt und dort auch mit zwei Riemchen befestigt wurde. Die Kraft des Ochsen ging ausschließlich vom kräftigen Nacken und der Stirn des Tieres aus. Den Tieren konnte man in der Regel voll vertrauen. Nach dem „Einspannen“ wussten sie meist von selbst, wo es hinging und selbstverständlich kannten sie genauestens den Nachhauseweg. Der Kuhbauer setzte sich, nachdem die Tiere zum Losfahren bereit waren, auf seinen Wagen, zündete sich die Pfeife an und hing seinen Gedanken nach. Zeit hatte er dazu genug. Die Tiere zogen das Gefährt ruhig dahin und wichen begegnenden Fahrzeugen selbständig aus. Der Bauer gestattete ihnen mit dem Zuruf „öha“ das Stehen bleiben, wenn sich das Tier erleichtern wollte. „Feldaus“ ging es etwas langsamer, heimwärts immer recht flott. Schwierig für Zugtiere und auch für die Bauern war die Umstellung der Links- auf die RechtsfahrOrdnung im Jahre 1938. Das ging oft kaum in die Schädel der Rindviecher hinein, dass sie jetzt von einem Tag auf den andern, die rechte Straßenseite zu benützen hatten. Die Tatsache, dass sich auf unseren Landstraßen recht wenig schneller Verkehr abspielte, kam aber allen zugute. Aber auch den Bauern selbst, war diese Umstellung fremd. Ich höre heute noch meinen Vater, der meinte, „Ja vorher bin ich bei herankommenden Autos ( die es damals ja auch schon gegeben hat) mich schützend in den Straßengraben gestiegen, jetzt muss ich sehr aufpassen und weit nach rechts hinüberfahren, damit ich nicht in Gefahr komme.“ Während der Sommermonate haben die Kuhbauern ihre Tiere auch „ausgetrieben“, das heißt, sie hin und wieder - wenn es ihre Zeit erlaubte - zum „Fressen“ auf die Weide geführt. Man ersparte sich damit das aufwendige Futterholen und die Kühe konnten sich auf der Grünfläche mit frischem Gras richtig satt fressen. Vier Tiere - zwei vorne und zwei dahinter - an einem Strick gebunden, ließ man die Wegränder, die Hutweiden und andere bewachsenen Flecken, soweit diese nicht zum Grasschnitt genützt wurden „abweiden“. Dieses „Austreiben“ wurde allgemein als „fad“ eingestuft und war deshalb nicht besonders beliebt, weil es stundenlange Beaufsichtigung erforderte, d.h. die Tiere am Strick geführt werden mussten. Besonders die Kinder haben sich, wenn sie konnten, davon „gedrückt“ und diese Tätigkeit mehr den Alten überlassen. Aber im Herbst, nach dem „Groamat-Schnitt“, da konnte man die Kühe und Kälber auf den weitläufigen Wiesen frei grasen lassen und da sind auch die zukünftigen Bauern und Bäuerinnen gerne „Kühe halten“ gegangen. Als Nebenbeschäftigung wurden in einem offenen Feuer meist „Erdäpfel“ gebraten und die ersten Rauchversuche gestartet. Die Kühe haben ihre Bewegungsfreiheit dann oft über Gebühr genützt, haben sich die besten Buschen und Gräser ausgesucht und sind dabei oft weit vom eigentlichen Weideplatz weg abgekommen. Mit viel „ Gerenne“ mussten sie oft für den Heimtrieb erst wieder zusammengeholt werden. Bevor sie dann in den Stall „eingetrieben“ wurden, hat man sie im Bach „tränken lassen“. Dazu gab es im Orte mehrere leicht begehbare Stellen, wo sie sich ohne Mühe in aller Ruhe „vollsaufen“ konnten. Pferde hingegen hat man nie auf die Weide geführt und schon gar nicht im Bachbett saufen lassen. Wenn ihre Arbeit beendet war, führte man sie in den Stall, ließ sie eventuell vorher am Brunnentrog ihren Durst löschen. Wie die Pferde in der Rangordnung der Tiere um eine Stufe höher standen und stehen, so fühlten sich auch ihre Besitzer gegenüber den Kuhbauern. Die Pferdebauern waren die „Größeren“, hatten meist mehr Landbesitz und schauten deshalb ein wenig mitleidig auf die „Kuhgespanne“ und ihre Fuhrleute herunter. Die Rossbauern saßen, oft zu zweit, hoch oben auf den schräg gestellten Leitern ihres Einfuhrwagens oder hatten sogar ein eigenes Sitzbrett, schnalzten im Dorfe weit hörbar mit ihren im Handel gekauften, glatten, quastengeschmückten Peitschen. Mit den Leitseilen in den Händen, so fuhren sie selbstbewusst flott dahin. Der Kuh- und Ochsenbauer hingegen saß meist in der breiten Ausnehmung auf dem großen, langen Wagenbrett in der Mitte seines Wagens und ließ die Füße herunterbaumeln. Er hielt seine Peitsche in der Hand oder legte sie lässig auf das Wagenbrett und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Gab es bei dieser Fuhre eine weitere Begleitperson, so musste diese, besonders bei voll beladenem Erntewagen, ganz einfach daneben mitgehen oder am Ende der Fuhre, auf dem breiten Bodenladen, der rückwärts aus den Leitern heraus etwas „vorschaute“, Platz nehmen. So ein Rinder-Gespann war schon eine mühsame Sache. Die Wege waren oft schlecht, die Hohlwege ausgewaschen und hatten tiefe ausgefahrene Spuren. Wenn die vollbeladenen Wägen dann oft recht schwankten und der Fuhrmann nervös reagierte, wurden auch die Tiere unruhig und störrisch. War der Bauer oder der Knecht auch noch „narrisch“, dann hat es manchmal ein Malheur gegeben. Die Zugtiere „gingen durch“, das heißt, sie liefen mit Überkräften und mit allen, was dahinter angespannt war, solange sie konnten oder bis sie vor dem vermeintlich „schützenden Stall“ standen. Geschirr und Wagen wurden dabei oft arg in Mitleidenschaft gezogen, wenn nicht gar zerrissen und damit vorerst unbrauchbar gemacht. An ein solches Ereignis kann ich mich noch recht gut erinnern. Mein Vater und ich, wir hatten aus dem „hinteren Wald“ - so nannten wir den Waldacker, auf dem heute ein prächtiger Jungwald steht – den Roggen einzuführen. Es ging gegen Mittag zu, die Tiere waren schon recht unruhig, da es gewittrig war, die Bremsen und großen Fliegen schon recht bissig waren und die Tiere bis aufs Blut quälten. Eiligst wurden die Garben geladen, ich spießte sie auf, hob sie hoch und mein Vater als „Leger“ brachte sie mit ihrem „Schädel“ nach außen, so drei bis vier „Lagen“ auf den Leiterwagen. Die Heimfahrt ging los. Menschen und Tiere waren froh, aus dem Wald herauszukommen. Aber gegen die Waldgrenze, im Niederwald noch drinnen, war noch ein schlechtes, schräges Wegstück zu durchfahren. Die hohe und bereits schon recht schief-stehende Fuhre musste auf einer Seite, mit der dreizinkigen langen Ladegabel abgestützt werden, damit sie nicht umfalle. Die Kühe, die von hier schon eiligst weg wollten, rissen das „Fadl“ mit ungestümer Kraft vorwärts. Das Entgegenstemmen mit der Gabel nützte nichts mehr und schon neigte sich der Leiterwagen vollends und fiel schließlich um. Die oberen „Lagen“ der Garben suchten das Weite und die Zugtiere sahen partout nicht ein, wieso es denn auf einmal eine Unterbrechung geben sollte. Sie zogen weiter an den Strängen und mussten erst nach und nach beruhigt werden. Die Tiere wurden ausgespannt und an einen Baum angehängt, sonst wären sie durchgegangen. Es galt nun, als unsinnige „ Zweitarbeit“, die in den Leitern noch verbliebenen Garben zuerst abzuladen, damit der schwere Wagen ohne besondere Hilfsmittel wieder auf seine vier Räder gestellt werden konnte. Dann, in einer mühevollen Arbeit, nochmals dieselbe Tätigkeit des Aufladens. Das Ganze mit ein wenig Schimpfen und Schelten gewürzt. Erleichtert waren wir erst, als der Wagen mit seiner Last wieder ruhig auf der doch besseren Schotterstraße dahinzockelte. Ja, der Umgang mit Zugtieren erforderte viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Die Pferde zogen ihre Fuhren hingegen mit größerer Kraft und Ausdauer gelassener dahin und ihre Bauern konnten sich auf ihre Zugtiere besser verlassen. Da gab’s in unserem Orte einen Fuhrwerksunternehmer, der nach getaner Arbeit so manche Über- oder Feierstunde zusätzlich im Gasthaus verbrachte. Die beiden Pferde warteten, an den Wagen gespannt, oft stundenlang gelassen vor der Gasthaustür. So lange, bis der Fuhrwerker, seinen Durst gelöscht hatte. Das konnte aber oft sehr lange dauern. Manchmal ist aber auch den Rössern die Geduld ausgegangen und sie haben sich eigenmächtig, ohne ihren Herrn und Gebieter zu fragen und ohne ihn in Bewegung gesetzt. Sehr oft aber ist es vorgekommen, dass der „ mit Alkohol schwer geladene Frächter“ seine Balance von sich aus nicht mehr zu halten vermochte, so haben ihn seine Freunde auf den Wagen gelegt, den Pferden den „Marschbefehl“ gegeben und diese haben ihn, zwar nur mit ihrem „Pferdeverstand“, aber doch sicher und heil, mitten in der Nacht, bis vor die heimische Stalltür gebracht. Die Frau Gattin, für derartige Fälle bereits bestens geschult, hat ihren Mann in Empfang genommen, ihn vom Wagen gehoben und ins Bett befördert, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Dann hatten auch die Rösser ihren Feierabend. Jahrtausende lang, bis in unsere Generation hinein, hatten die Zugtiere die härtesten Arbeiten in der Landwirtschaft durchzuführen. Vorbereitung des Bodens, Anbau und Ernte wurde unter Verwendung ihrer Körperkraft mit größter Mühsal durchgeführt. Aber auch der Mensch kam dabei nicht ungeschoren davon. Er hatte ebenfalls wie die Tiere, seinen Teil beizutragen, da er ebenso, wie seine Helfer, unter diesen Arbeitsbedingungen litt. Nach dem Kriege kam bei uns die große Motorisierung und mit ihr wurden die Tiergespanne überflüssig. Als ich als junger Mann die ersten Traktore und später die Mähdrescher auf den Feldern sah, freute ich mich für die unzähligen Rinder und Pferde, denen diese Arbeit ab nun erspart blieb. Ich dachte auch an die vielen Plagegeister, Mücken, Fliegen und Bremsen, die an diesen Motorfahrzeugen nun keine Opfer mehr vorfinden würden und in der Tat, man hat ab dieser Zeit nur mehr wenige dieser Quälgeister bemerkt. Aber auch die Rinder und die Pferde des Bauerndorfes sind verschwunden