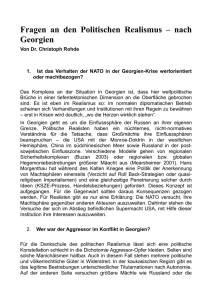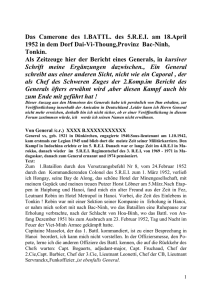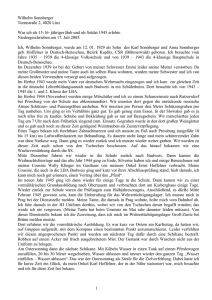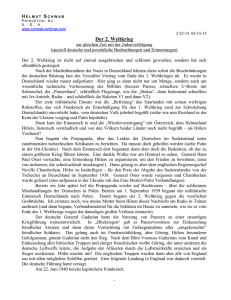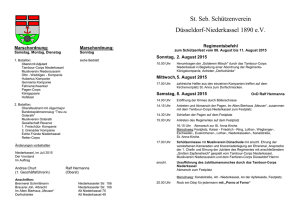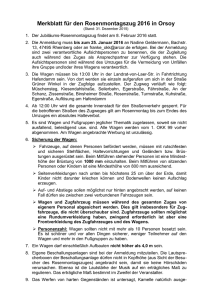Franz Kögler, Meine Kriegserlebnisse, 1. Weltkrieg, Ostfront, Juni
Werbung
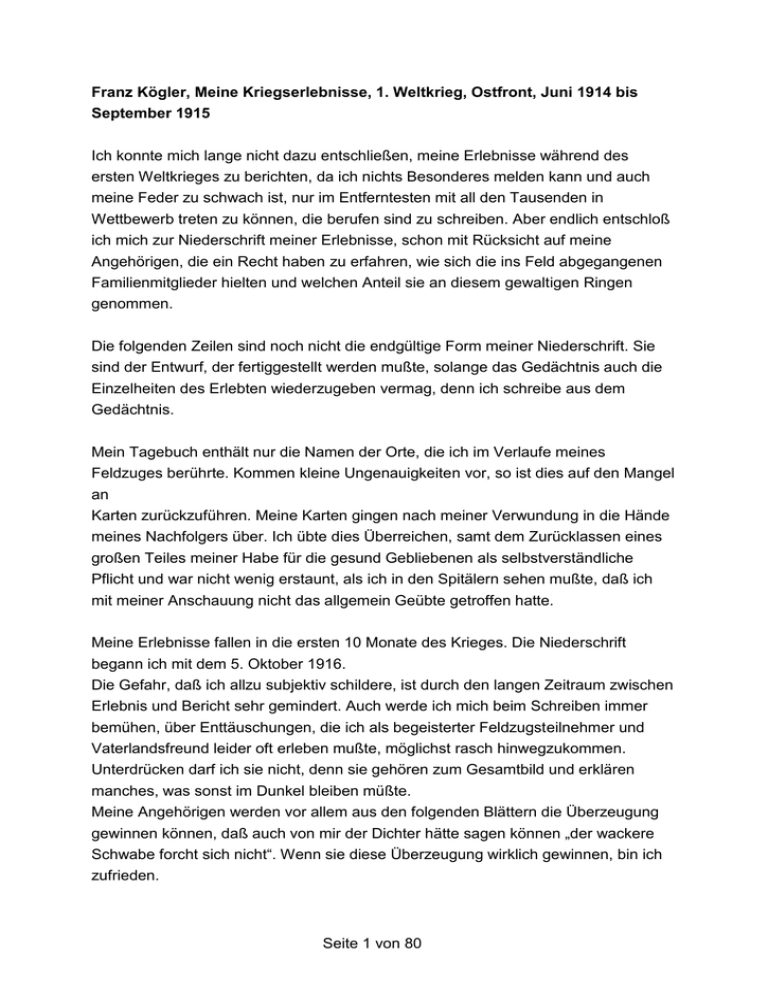
Franz Kögler, Meine Kriegserlebnisse, 1. Weltkrieg, Ostfront, Juni 1914 bis September 1915 Ich konnte mich lange nicht dazu entschließen, meine Erlebnisse während des ersten Weltkrieges zu berichten, da ich nichts Besonderes melden kann und auch meine Feder zu schwach ist, nur im Entferntesten mit all den Tausenden in Wettbewerb treten zu können, die berufen sind zu schreiben. Aber endlich entschloß ich mich zur Niederschrift meiner Erlebnisse, schon mit Rücksicht auf meine Angehörigen, die ein Recht haben zu erfahren, wie sich die ins Feld abgegangenen Familienmitglieder hielten und welchen Anteil sie an diesem gewaltigen Ringen genommen. Die folgenden Zeilen sind noch nicht die endgültige Form meiner Niederschrift. Sie sind der Entwurf, der fertiggestellt werden mußte, solange das Gedächtnis auch die Einzelheiten des Erlebten wiederzugeben vermag, denn ich schreibe aus dem Gedächtnis. Mein Tagebuch enthält nur die Namen der Orte, die ich im Verlaufe meines Feldzuges berührte. Kommen kleine Ungenauigkeiten vor, so ist dies auf den Mangel an Karten zurückzuführen. Meine Karten gingen nach meiner Verwundung in die Hände meines Nachfolgers über. Ich übte dies Überreichen, samt dem Zurücklassen eines großen Teiles meiner Habe für die gesund Gebliebenen als selbstverständliche Pflicht und war nicht wenig erstaunt, als ich in den Spitälern sehen mußte, daß ich mit meiner Anschauung nicht das allgemein Geübte getroffen hatte. Meine Erlebnisse fallen in die ersten 10 Monate des Krieges. Die Niederschrift begann ich mit dem 5. Oktober 1916. Die Gefahr, daß ich allzu subjektiv schildere, ist durch den langen Zeitraum zwischen Erlebnis und Bericht sehr gemindert. Auch werde ich mich beim Schreiben immer bemühen, über Enttäuschungen, die ich als begeisterter Feldzugsteilnehmer und Vaterlandsfreund leider oft erleben mußte, möglichst rasch hinwegzukommen. Unterdrücken darf ich sie nicht, denn sie gehören zum Gesamtbild und erklären manches, was sonst im Dunkel bleiben müßte. Meine Angehörigen werden vor allem aus den folgenden Blättern die Überzeugung gewinnen können, daß auch von mir der Dichter hätte sagen können „der wackere Schwabe forcht sich nicht“. Wenn sie diese Überzeugung wirklich gewinnen, bin ich zufrieden. Seite 1 von 80 Im Juni 1914 gab es in Brünn bewegte Tage. Ein Sokol-Fest wurde in den Mauern der Stadt abgehalten, das unheilvoll zu enden versprach, denn eine seltsame Erregung war überall zu spüren. Und wie mir mein in den Sturmjahren Prags geschärfter Sinn für Auflauf und Tumult verriet, war diese Erregung im Begriff, Gewalttaten zu bringen. Die Tschechen unterdrückten natürlich ihr Triumphgefühl bei ihrer Sokol-Schau, alle Slawen begrüßen zu können, gar nicht, und wussten genau, dass sie mit ihrem Feste ihrem großen allslawischen Ziel in Mähren ganz gewaltig den Boden geebnet hatten. Während des Nachmittags war ich mit Bekannten in den Glacisanlagen, nachdem der Festzug der Sokoln beendigt war. Wir sprachen über dies und das, und ich mußte viel aus meiner Studentenzeit zu Prag erzählen. Ich wurde wieder ein Jüngling dabei und hätte bei Raufhandel noch ganz gut meinen Mann gestellt, „so wie einst im Mai“. Da durcheilte die Stadt die Trauerkunde von der Mordtat zu Sarajevo. Mein erstes Wort war: „Das ist der Krieg“. Meine Bekannten wollten es nicht glauben, erinnerten mich aber nach meiner Rückkehr aus dem Felde daran. Wenige Tage später kamen die Ferien. Mit meinem Freunde Geißler, der seit dem Falle vom Przemysl in russischer Gefangenschaft schmachtet, trat ich am 6. Juli eine Fahrt in die Alpen an, die wohl für lange für mich die letzte gewesen sein mag. Die Eisenbahn brachte uns bis St. Anton am Arlberg. Die Arlberghöhe, die zum Teil noch im Winterschnee steckte, machten wir zu Fuß, in Langen mussten wir wegen starker Regengüsse zwei Tage liegen bleiben. Aber der dritte Tag führte uns schon durch das Nenzigast Tal, der Tübinger Hütte auf der Wildebene zu. Die Wanderung war sehr beschwerlich, da von 1600 m an hoher Neuschnee lag. Je höher, umso beschwerlicher und gar bald setzte neues Schneetreiben ein, das in kurzer Zeit in Schneesturm überging. Diese Stunden waren eine treffliche Vorübung für den Krieg. Wir verloren nicht den Weg und kämpften wacker gegen den Sturm, der uns nach dem Erreichen des Hochplateaus der Wildebene mit furchtbarer Härte fasste. Abwechselnd ging bald der eine, dann der andere stampfend und keuchend voraus, um durch die Schneemassen durchzudrücken. Immer häufiger mußten wir keuchend stehen bleiben. Das Einhalten der Wegrichtung wurde immer schwerer, da der Nebel uns bald die Sicht auf die nächste Umgebung nahm und so die Orientierung unmöglich machte. Wir sprachen nichts, sondern schauten uns nur in die Augen, und unsere Blicke sagten ganz deutlich, daß wir wußten, es geht um unser Leben. Zähne zusammenbeißen und nicht unterkriegen lassen, das war unsere Losung. Da kam uns ein guter Weggenosse zu Hilfe: Der Führer auf der Tübinger Hütte hatte in einem Augenblick des Hellerwerdens die zwei mit dem Sturm und Schnee Ringenden erspäht und kam ihnen entgegen. Und zu dritt gelang uns der Sieg. Wir betraten bald Seite 2 von 80 der Hütte gastliche Räume. Drei – ein deutscher Älpler und zwei Deutschböhmen – hatten sich gemeinsam durchgekämpft. Ein schönes Beispiel für die kommende Waffenbrüderschaft. Ich grüße dich, wackerer Führer von der Wildebene. Du stehst jedenfalls als Standschütze gegen die Welschen. Möge dich ein gütiges Geschick die Heimat wiedersehen lassen. Zwei wunderselige Tage auf der sturmumbrausten Höhe folgten nun. Abgeschieden von der Welt lebten wir fröhlich, dem Leben wiedergegeben. Der dritte Tag stieg mit leuchtender Schönheit empor, und wir wanderten auf die Eistaler-Spitze, von der weithin der Blick schweifte über all die stolzen weißen Gipfel. Unser Auge blieb immer wieder an den Bernienerbergen hängen, denn dorthin wollten wir. Doch der nächste Tag zeigte uns die Unmöglichkeit. So zogen wir wieder talab durch das Klostertal, um über Landeck und den Finstermünzpass in die Ötztaler Berge zu gehen, die nicht so viel Neuschnee hatten, daher bezwingbar erschienen. Die Wanderung von Landeck über den Finstermünzpass bis Mals brachte uns selige Stunden. Zu beiden Seiten des Straßenzuges die stolzen Gipfel und hoch über ihnen die Sonne, die so gründlich brannte, wie ich es liebe. Bald wurde es so heiß, daß die Luft zum Flimmern kam, aber fröhlich, wenn auch ein wenig müde, zogen wir unseren Weg. Auf dem Finstermünzpass sahen wir da und dort einen Wachtposten, der träge in die Sonne blinzelte und nicht ahnte, daß ihn sehr bald der Donner der Geschütze aufscheuchen werde aus seinem Traum von Heimat und Hütte. Und dann, nach mühevoller Wanderung, der Feierabend in Mals, der erfüllt war vom Dufte des schönsten Bergheues, das von allen Seiten auf hochgetürmten Fudern hereingebracht wurde. Bald nach unserer Ankunft verdeckten die Schatten der im Westen ragenden Berge den Ort, die Dämmerung kam tastend und fast unbemerkt zwischen die Häuserzeilen. Aber hoch in den Bergen, da leuchtete noch der glühende Sonnenball frohlockend über den glücklichen Tag, der hinter uns lag und einen neuen Gottesmorgen verheißend. Der nächste Morgen, es war ein Sonntagmorgen, war auch Gottes voll! Wir bestiegen eine östlich vom Städtchen aufragende Lehne, um das Bild der Landschaft aufzunehmen. Ich stand wohl schon so manches mal auf Schönheit über Schönheit schenkenden Aussichtspunkten, aber so wie der Blick über Mals und Umgebung hat sich noch nicht gleich einer in meiner Seele festgesaugt. Ich wollte den Sonntag in Mals verträumen, aber mein lieber Wandergenosse trieb zum Aufbruch, war doch sein Urlaub nur kurz. In wenigen Tagen sollte ihn wieder das ewige Einerlei seiner Kanzlei mitleidlos umfassen, und da wollte er recht viele schöne Bilder mitnehmen. Seite 3 von 80 Wir nahmen die Rucksäcke und schritten in den Sonntag hinein, das Malsertal aufwärts zur Höllerhütte. Spät am Abend kamen wir dort an und fanden glücklich noch ein Plätzchen, wo wir uns strecken konnten. Früh um drei Uhr waren wir schon wieder unterwegs, die Weißkugel war unser Ziel. Stunde um Stunde verrann, über eine steile Lehne nach der anderen kamen wir dem Gletschergebiet der Weißkugel immer näher, bis uns endlich eine steile, vereiste Rinne auf das ewige Eis brachte. Die weitere Wanderung war sehr mühsam für mich. Während mein Genosse von der Neuschneedecke getragen wurde, brach ich fast bei jedem Schritt bis zum Knie ein, denn die gute Mutter Natur hat mir eine behagliche Leibesfülle verliehen, die auch den stärksten Anstrengungen nicht weicht, und immer fröhlich behauptet, sie werde mich niemals verlassen. Der Gipfel der Weißkugel brachte uns leider den heiß ersehnten Rundblick nicht. Er hüllte sich hartnäckig in einen Wolkenmantel und legte ihn, trotzdem wir lange warteten, nicht ab. Enttäuscht machten wir uns auf den Abstieg zur Schönen Aussicht. Hier hielten wir kurze Rast und setzten uns als Ziel für den Abend Vent, das wir auch glücklich erreichten, als die Glocke von Vent Feierabend verkündete. Von Vent aus bestiegen wir noch die Kreuzspitze, die Hintere Schwärze und den Ramolkogel. Alles bei schönem Wetter. Die Krönung aller unserer Bergfahrten war aber die Ersteigung der Wildspitze. Von Vent aus brachen wir um ein Uhr nachts auf und die Mittagsglocke begrüßte uns, als wir von glücklicher Bergfahrt heimkehrend, in Vent wieder einrückten. Von Sölden aus gedachten wir, noch den Stubaier Alpen einen Besuch zu machen. Wir unterließen ihn aber wegen der Ungunst des Wetters und beabsichtigten in Innsbruck schönes Wetter abzuwarten. Das schöne Wetter kam bald, schon wollten wir wieder zur Bergfahrt rüsten, da trieben mich die ungünstigen Nachrichten über die serbische Frage in die Heimat. Eine Ahnung sagte mir, es gibt Krieg, und da wollte ich noch einmal die Heimat sehen. Als ich im Bahnhof der Heimat einfuhr, war soeben die Nachricht von der teilweisen Mobilisierung eingetroffen. Überall gab es ein Raten und Fragen, und am nächsten Tage reisten die Wehrmänner meiner Heimat ab. Ich habe das Abschiednehmen vor der Abfahrt des Zuges mit angesehen. So ruhig, würdevoll, zuversichtlich, aber doch, ob des Schicksales des einzelnen wehmütig, habe ich auf der Reise durch weite Länder noch kein Volk sich geben sehen, wie die Deutschböhmen. Ein guter Kern ist in ihnen. Sie haben es auf allen Kriegsschauplätzen bewiesen. Seite 4 von 80 Eine Woche blieb ich in der Heimat, dann rief auch mich die allgemeine Mobilisierung zu meinem Regimente. In Brünn blieb ich einen Monat bei der 2. Ersatzkompanie des L.-St.-I.-R. 14. Mit Rüsten, Exerzieren, Ab- und Zukommandierungen verging diese Zeit wie im Fluge. Ende August wurde das L.-St.M.B.1 aufgestellt und ich zum Proviantoffizier ernannt. In wenigen Tagen waren wir marschbereit. Unruhige Stunden habe ich mit der Frage der Ausrüstung meiner 27 Fuhrwerke verbracht. Vom Amte eines Proviantoffiziers hatte ich mir nie etwas träumen lassen. Und jetzt mußte ich im Kriege ohne Hilfsmittel, ohne Dienstbuch, ohne Unterstützung dieses schwierige Amt versehen. Es ging. Der Krieg hatte die erste große Aufgabe an mich gestellt. Am 2. September wurden wir einwaggoniert und gegen Norden ging’s. Wir wussten nicht mehr. Auf der Fahrt durch Mähren wurden die Leute mit Massen von Lebensmitteln beschenkt, trotzdem ich sehr reichlich für sie gesorgt hatte. Für vier Tage hatten wir Reisevorrat, und am zweiten Tage waren wir schon am Ziel in Oswiecim, wo wir als Eisenbahnsicherungstruppe Verwendung fanden. Meine Tätigkeit hatte gar nichts Kriegerisches an sich. Den ganzen Tag saß ich über meinen Büchern und Tabellen und war froh, wenn ich am Abend sagen konnte, es stimmt. Gar bald kam ich über die ersten Schwierigkeiten hinaus und fand sogar ein freies Stündchen, um zu Pferde zu steigen. Das war ein komischer Kampf zwischen Reiter und Pferd. Das Pferd blieb meistens Sieger. Aber stolz blieb ich immer im Sattel. Und auch draußen im Felde habe ich immer fest den Sattel behauptet, trotzdem es manchmal ein tolles Jagen gab. Von Oswiecim kamen wir nach Trzebinia. Dort war der Dienst der Nämliche. Im Oktober lagen wir in Krakau in der Landwehrkaserne in Krowodrza. Alle hatten sich schon mit den Gedanken befreundet, als Festungsbesatzung in Krakau den Krieg mitzumachen. Aber in der Nacht des letzten Oktober kam der Alarm und hinaus ging es ins Land des Feindes. Jeden Leser wird sich nun die Frage aufdrängen, was für Gefühle haben dich ergriffen, da du Stunde um Stunde näher an den Feind kamst. Da muß ich nun sagen, die Antwort bleib ich leider schuldig. Ich habe einen großen Teil der Eisenbahnfahrt verschlafen. Die Anstrengungen bei der Einwaggonierung waren nicht unbeträchtlich, und dann zeigten sich auch sehr unangenehm die Folgen der zweiten Cholera - Impfung, die unmittelbar vor dem Abmarsch vorgenommen wurde. Das Bein – es war eine Oberschenkelimpfung – schmerzte zeitweise so, dass man sich nur mit Mühe aufrecht erhielt. Eine Erlösung war daher die Eisenbahnfahrt, und die Erlösung war ausgiebiger Schlaf. Seite 5 von 80 Spät abends kamen wir in Andrejow an. Sofort wurden wir auswaggoniert und erfuhren auch gleich, dass wir die letzten waren, die die Strecke benützt hatten. Am nächsten Morgen sollte sie gesprengt – für die Russen unbenützbar gemacht – werden, die hart hinter unseren Truppen her waren. Ein Nachtlager auf bloßen Dielen, ohne ein Hälmchen Stroh, brachte wenig Erquickung. Im Morgengrauen brachen wir wieder auf und standen bald in Marschkolonne auf der großen gegen Krakau führenden Reichsstraße, um Befehle abzuwarten. Neben uns brachen reichsdeutsche Flieger eilig ihre Zelte ab, und die vor uns liegende Eisenbahnlinie fiel der Zerstörung anheim. Mit unheimlicher Regelmäßigkeit erfolgten die Explosionen. Eine Brücke und eine Bahnhofanlage nach der anderen wurden zerstört und zwar mit echt deutscher Gründlichkeit. Gegen Abend kam der Abmarschbefehl. Das Bataillon (Baon) vor uns kam rascher vorwärts und gar bald hatte ich die Fühlung mit ihm verloren. Die erste Schwierigkeit. Der Ernst hatte aber eigentlich noch gar nicht begonnen. Mit zwei Wagen blieb ich kurze Zeit in Andrejow stehen, um Fleisch einzukaufen. Ein Kilogramm eine Krone. Als ich dann wieder weiterfuhr, war ich bald allein. Keine Ahnung, wohin das Baon gegangen war. Die Nacht kam, und unser Wegweiser waren die frischesten Wagenspuren, die uns nachts glücklich zum Baon brachten. Auf dieser Fahrt lernten wir das Gefühl der Gefahr kennen. Zwei Wagen und sechs Mann auf der Hochfläche, hart am Feind, ohne Karte und ohne Orientierung. Ich ging mit dem Gewehr in der Hand voraus und durchsuchte Gesträuch, Gehöfte und Waldteile längs des Weges. Die Sinne wurden bald schärfer. Es dauerte nicht lange, und die Augen unterschieden Menschen genau von Gesträuch. Und dem Ohr erschien nicht jedes Geräusch als das Getrappel ansprengender Kosaken. Aber anstrengend ist dieser Zustand der Erregung. Danach fiel ich denn auch in einen tiefen Schlaf. Der nächste Tag sollte uns noch mehr Mühe und Erregung bringen. Wir hatten Befehl gegen Pinczów zu marschieren und mussten die Nida passieren. Polnische Bauer sagten uns nun, dass der Fluss nicht passierbar sei. Ich meldete das pflichtschuldig dem General. Er kam nach vorn, ließ sich die Meldung nochmals wiederholen und gab mir eine Nase, weil ich nicht schön genug salutierte und nicht die vorgeschriebenen drei Schritte vor ihm Stellung genommen hatte. Eine Patrouille stellte dann fest, dass Pioniere über Nacht eine Notbrücke gebaut hatten. Warum hat das der General nicht gewusst? Beim Passieren des ersten Seite 6 von 80 Fuhrwerkes stürzte das Sattelpferd in den Fluss. Mit fabelhafter Geschicklichkeit holten die Pioniere das Pferd wieder aus dem Wasser und von nun an ging das Übersetzen des Flusses ohne Störung. Vor uns entwickelte sich das Baon teilweise zum Gefecht, da Kosaken avisiert waren. Ich stand mit meinem Wagen in der sumpfigen Ebene, auf schmalem Wege, der nicht einmal das Umkehren gestattete. Was wäre aus uns geworden, wenn wir wirklich angegriffen worden wären. Doch bald setzten wir uns wieder in Marsch und kamen in Pinczów in die zurückflutenden Truppen. Endlos zog es da an uns vorüber. Alle Truppengattungen und Trains in unaufhörlichem Zuge. Wir machten den Schluss, und nach uns sprengten Pionieren die Brücke, denn wir gingen auf das rechte Nidaufer zurück. Der weitere Marsch war eine furchtbare Plage. Unsere Wagen waren für die Feldwege viel zu schwer und die mährischen Pferde nicht so ausdauernd, wie es sich für ein Land mit solchen Wegen gehört. Außerdem schmuggelten die Leute fortwährend Sachen auf die Wagen, die nicht hingehörten und die Pferde unnütz beschwerten. Nachts habe ich dann die Ladungen überprüft und eine Menge von unnützen Dingen weggeworfen. Im Morgengrauen des nächsten Tages ging es weiter. Der Befehl lautete nach X. Aber eine Kunst war es zu erfahren, wo X lag. Da musste ich erst einen Offizier suchen, der eine Karte besaß. Endlich waren wir im Marsch. Wir fuhren rüstig drauf los. Während der Mittagsrast hörten wir, unsere Landsturmmarschbrigade sei aufgelöst und jedes Baon einer anderen I.E. zugewiesen. Nach etlichen Stunden, während Tausende von Wagen, darunter Hunderte von Büffelgespannen an uns vorüberzogen, wussten wir unser Marschziel. Das Baon marschierte voraus. Da wir im Rückzug waren, hätte es hinter uns bleiben sollen. Und bald war ich in einem Waldgebiet allein mit dem Bewusstsein, hinter dir sind keine eigenen Leute. Der Marsch auf dem Waldwege war sehr mühselig. Bald stürzte ein Wagen, bald war der Weg so schmal, dass unsere Spurbreite nur mit Mühe Platz fand. Gegen Abend stellte sich Regen ein und es wurde so finster, dass man nicht zehn Schritte weit sah. Wegen der Nähe des Feindes sollte jedes unnütze Geräusch vermieden werden, aber bei Stockungen gab es Lärm genug. Licht sollte auch keines gebrannt werden, doch blieb schließlich nichts anderes übrig, als die Laternen anzustecken. So fuhren wir stundenlang einem ungewissen Schicksal entgegen. Vor einem Dorfeingang mussten wir erst Baumstämme beiseite schaffen und Löcher zuschütten und zum Überfluss einen Teich durchfahren. Ich glaubte nicht, dass dies Kunststück gelingen werde. Aber es gelang doch. Endlich waren wir am Marschziel, Seite 7 von 80 einer sumpfigen Wiese. Vom Baon lies sich niemand sehen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich auffahren sollte und so blieb ich denn auf gut Glück stehen. Ein scharfer kalter Wind ging uns bis auf die Knochen. Die Feuer wollten gar nicht brennen und die Pferde ließen die Köpfe hängen. Da kroch ich denn – später tat ich das sehr oft – zwischen zwei Pferde und fand, dass das bei unfreundlichem Wetter das beste Plätzchen sei. Auch diese Frostnacht ging vorüber und am nächsten Tage hatten wir dieselbe Arbeit bis zum Abend. Mühseliges Fortschleppen auf schlechten Wegen – in qualvoller Ungewissheit, ob es gelingen werde, das Baon, das wieder durchgegangen war zu entdecken. Den ganzen Tag gab es ein entsetzliches Durcheinander. Trainkolonnen fuhren einander vor, durchbrachen sich, und den Kürzeren zog dabei regelmäßig ich, da ich leider bei Streitfällen der Niedrigste im Range war und außerdem niemals mein Marschziel nennen konnte. Bei einer Straßenkreuzung gab es ein Durcheinander, wie am jüngsten Tage. Als ein General ordnend eingriff, wurde es etwas besser. Ihm verdanke ich auch eine verhältnismäßig kurze Wartezeit. Er ließ mich bald durch. Jetzt ging es längere Zeit recht flott, bis der Wirbel in der Stadt Dz. neuerdings unentwirrbar schien. Da konnte ich mich glücklicherweise an einige Honvedbatterien anhängen, die denselben Weg hatten und entwischte dem Städtchen. Vor dem Ziel, einem kleinen Dörfchen, gab es stundenlanges Warten, da eine Verpflegskolonne den Weg versperrte. Müßig saß ich im Straßengraben und schluckte den Groll über all die Unordnung schwer genug hinunter. Ich sah, dass ich, an Ordnung und das Einhalten der Befehle gewöhnt, immer im Nachteil war, da die anderen bei jeder Gelegenheit auf eigene Faust weiterfuhren. In wenigen Tagen war ich auch brutal und rücksichtslos, und dann ging’s besser. Die Ordnung habe ich dabei freilich nicht vermehren helfen. Der Abend vereinigte mich glücklich wieder mit dem Baon. Wir luden ab, und bald begab sich alles zur Ruhe. Meine Wagen standen an einem Wiesenabhang, und daneben brannten hellauf die Feuer. In weiter Ferne hörte man den ganzen Abend Infanteriefeuer. Ich saß bei einem Feuer und wartete auf meinen Kaffee, den der Koch in der Glut stehen hatte. Von Zeit zu Zeit hatte es den Anschein, als ob neben uns etwas einschlüge. Ich glaubte an Täuschung, bis mich der Koch auch darauf aufmerksam machte. Wir lauschten beide angestrengt, da schlug es einige Mal knapp hintereinander ins brennende Holz, dass die Funken aufstoben. Jetzt wusste ich es. Die vorgeschobenen feindlichen Infanterieabteilungen hatten uns unter Feuer genommen. Unauffällig musste der Koch die Feuer verlöschen, auch gebot ich ihm zu schweigen, um die Leute nicht unnötig zu beunruhigen. Kaum war der letzte Seite 8 von 80 Feuerschein verglommen, hörte das Einschlagen der Geschosse auf. Ein Stündlein verging nun in Ruhe. Der Mond stieg langsam in die Höhe, und bald ließ er die neuen Plachen bei der Wagenburg weithin leuchten. Da hatten wir auch wieder das feindliche Feuer und zwar wurde der ganze Wiesenhang systematisch abgestreut. Hier war unseres Bleibens nicht länger und ich brachte meine Wagenburg – einen Wagen nach dem anderen fahren lassend – in der Tiefe hinter einer Parkmauer in Sicherheit. Die Nervosität der Feuertaufe erfasste die ganze Mannschaft und es bedurfte meiner ganzen Tatkraft, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Als wir unseren neuen Aufstellungsplatz bezogen hatten, musste die Meldung an Baon gehen. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, jetzt ist die beste Gelegenheit, um ein für allemal das moralische Übergewicht über die Leute zu erringen. Ich sagte dem Feldwebel, dass ich dem Baon selbst die Meldung überbringen werde und ging nun über den immer noch im feindlichen Feuer liegenden Wiesenhang, tat meine Meldung, und kam langsam wieder zurück. Die Geschosse schlugen sehr zahlreich um mich ein. Aber das Bewusstsein der Verantwortung ließ das Gefühl der Lebensgefahr nicht zu laut werden. Als ich zurückkam, hörte ich die Leute sagen: „Ze neboji“. Ich hatte gewonnen! Ich konnte nun jeden Einzelnen auf die gefährlichsten Wege schicken. Sie alle gingen ohne Zaudern, wussten sie doch, wenn es gefährlich wird, so bin ich sicher mit dabei. Mancher wird gewiß mit Recht sagen: Der Offizier darf sich nicht ohne besondere Not der größten Gefahr aussetzen. Das ist richtig, aber er muss seinen Leuten bei der ersten Gelegenheit zeigen, dass er den Tod nicht fürchtet. So habe ich es gehalten, während der ganzen Zeit, da ich im Felde lag. Die Leute hatten auch das größte Vertrauen in meine Einsicht. Sie wussten, leichtsinnig ordne ich nichts an. Und so erfüllten sie immer tadellos ihre Pflicht,und sie haben sich auch stets wacker geschlagen. Keinen einzigen Gefangenen habe ich als Kompaniekommandant verloren. Trotzdem man sich nicht hätte wundern dürfen, wenn des einen oder des anderen Widerstandskraft erlahmt wäre. Um Mitternacht mussten wir schon wieder weiter. Mit einem Führer wanden wir uns auf verschwiegenen Feldwegen weiter, bis wir plötzlich auf einer Hochfläche ins Stocken gerieten. Die Vorpatrouille meldete: Kosaken vor uns! Die Nachricht legte sich allen wie ein eisernes Band um den Hals. Unsere Stimmen klangen alle so merkwürdig gequetscht. Doch bald schüttelte ich das lähmende Gefühl ab, und mit ein paar Leuten ging ich die Kosaken an, die sich beim Näherkommen in weidende Bauernpferde verwandelten. Seite 9 von 80 Ein erlösendes Lachen ging vom ersten bis zum letzten Wagen. Es war das letzte Mal, dass die Leute Feinde dort sahen, wo es gar keine gab. Aber wir waren ja erst eine Woche im Krieg und hatten bisher nur den tollen Rückzug erlebt. Das drückt und macht Ängste, besonders bei schwerbeweglichen Trains. Als wir in die Reichsstraße einbogen, steckten wir mitten im Trubel der zurückflutenden Trainmassen. Vier Wagenkolonnen nebeneinander wälzte sich diese viele, viele kilometerlange Masse dahin. Die letzten Wagen wurden schon von der russischen Artillerie unter Feuer genommen. Und da ging es wie ein Ruck durch den riesen Leib. All die tausenden und abertausenden von Fuhrwerken setzten sich in Trab. Es entstand ein Donnern und Getöse, wie wenn der jüngste Tag hereingebrochen wäre. Da stürzte ein Pferd, dort wurde ein Mann gequetscht, und auch bei mir gab es Unheil. Eine Achse brach. Ehe wir es fertig brachten, die Ladung auf die anderen Wagen zu verteilen, den Wagen in den Straßengraben zu werfen und ohne merklichen Aufenthalt weiter zu rasen, das vermag ich nicht mehr zu sagen. Mittags machten wir kurze Rast, und dann ging es von der Hauptstraße weg. Mir wurde ein Dorf zur Nächtigung angewiesen. Ich wollte mir‘s gerade gemütlich machen und feinen Kaffee kochen, als wie erstaunt ein Oberst zu mir trat und verwundert fragte, ob ich denn hier bleiben wolle? Von ihm erfuhr ich, dass ich innerhalb der Feldwachenlinie säße. Da gab ich natürlich, ohne zu zaudern, Befehl zum Abmarsch. Aber wohin? Niemand konnte mir die Verteilung der Truppen melden. Und so fuhr ich denn aufs Geratewohl gegen Südwesten. Wenn ich irgendwo einen Stab entdeckte, fragte ich nach dem Baon. Niemand wusste es. Endlich musste ich bei einem Meierhofe halten, die Pferde konnten nicht mehr weiter. Die Zeichen eines Divisionskommandos waren überdies am Meierhof zu sehen. Dort erfuhr ich, dass mich das Schicksal zum Baon geführt. Es lag in dem zum Meierhof gehörenden Dorf. Der unfreundliche Empfang bei den Kommanden war gerade zu typisch. Ich bin beim Auskunftholen niemals als Offizier aufgenommen wurden, wurde niemals als Kamerad empfangen, sondern so ähnlich, wie man einen Bettler behandelt. Das verstimmt für immerwährende Zeiten. Ohne Karte und ohne Befehl habe ich mich die ganze Zeit mit dem ganzen Aufgebote meiner Kraft durchgeschlagen, und wenn ich dann um Auskunft bat, musste ich manches Mal lange vor dem Hause stehen, bis ich eine Antwort bekam, deren Ton immer tief verletzend war. Die Ruhe während dieser Nacht war recht karg. Seite 10 von 80 Zwei Stunden verkroch ich mich unter einen Wagen, denn lange vor Sonnenaufgang ging es weiter im Verbande des Divisionstrains. Den ganzen Tag gab es ähnliche Bilder wie tags vorher. Endlose Wagenreihen hinter- und nebeneinander, überall verendende Pferde und gebrochene Wagen und ein Drängen und Hasten, da sehr bald die ganze Trainmasse wieder im Trab vorwärts strebte. Merkwürdig war vor allem die Unruhe, welche die Pferde erfasste. Aus eigenem Antrieb wurde ihre Gangart immer rascher. Oft waren sie nur mit Mühe zu halten. Haben sie`s gewusst, was von ihnen abhängt? Trotzdem ich mich anstrengte, meine Fuhrwerke beisammen zu halten, waren sie bald auf drei Teile zerrissen, und jeder dieser Teile steckte in einer anderen Divisionskolonne. Am Rastplatz fanden sie sich glücklicherweise wieder alle zusammen. Auf der großen Gutweide des Dorfes Chrastowice lagerte der Divisionstrain. Der Befehl kam, jeder hatte mit seiner eigenen Abteilung so lange stehenzubleiben, bis er den nächsten Marschbefehl von der eigenen Truppe erhält. In meiner Nähe stand ein Feldmarschallleutnant, der rief mich und nun entwickelte sich folgendes Gespräch: „Wer sind Sie?“ „Proviantoffizier des L.St.M.B.1“ „Was machen Sie da?“ „Ich erwarte den Marschbefehl.“ „Das Baon ist nach Krakau dirigiert, fahren Sie sofort nach!“ Ich wollte sofort abrücken, als es sich noch rechtzeitig herausstellte, dass der Befehl dem Baon 4 galt. Ich wartete also ruhig weiter. Die Pferde wurden gefüttert. Für unser eigenes leibliche Wohl sorgten wir auch. Die Verbindung mit dem eigenen Baon war rasch hergestellt und wir erhielten den Auftrag, dem Baon am nächsten Morgen Proviant zu bringen. Im Morgengrauen labte ich befehlsgemäß das Baon und kehrte mit dem Auftrag, weitere Befehle abzuwarten, auf den alten Aufstellungsplatz zurück. Die Gutweide leerte sich langsam. Ein Train nach dem anderen fuhr ab und bald war ich allein. Es wurde mir ein wenig unbehaglich zu Mute. Ich fand aber Trost in dem klaren Befehle zu warten. Da kam eine Batterie an mir vorüber. Der Kommandant teilte mir leise – ohne dass es die Leute hörten – mit, dass ich zwischen den Feuerlinien stehe. Da bin ich aber Seite 11 von 80 schleunig abgekratzt. Doch das wohin blieb eine offene Frage. Nach langer Zeit erfuhr ich, dass die Trains in Golczowice zusammenzukommen hätten. Weil mir keine Karte zur Verfügung stand, machte ich einen entsetzlichen Umweg. Nachts kam ich glücklich an, und sofort kam ein neuer Befehl, mit dem Gefechtstrain nach Kolbarck zu marschieren und dort Küchen für das Baon zu fassen. Der Weg führte in schwärzester Nacht durch Bäche und über sumpfige Wiesen und den letzten Hauch von Roß und Mann galt es dran zu setzen, um bis hin zu kommen. Nach der Ankunft erfuhr ich, dass die Küchen schon längst abmarschiert seien. Wohin, wusste niemand. Die Küchen hatten am Vormittag den Abmarschbefehl erhalten und ich am Nachmittag den Auftrag, die Küchen abzuholen. Die Nacht war bitterkalt. Ehe noch die Sonne empor stieg, war ich schon wieder unterwegs auf der Suche nach dem Baon. Ich fragte da und dort. Von niemand erhielt ich Auskunft. So irrte ich von Stellung zu Stellung, von Regiment zu Regiment, und erst am Abend entdeckte ich das Baon. Der Empfang war nicht gerade höflich. Da ich schuldlos war, konnte sich meine Antwort natürlich auch hören lassen. Nun gab es ein furchtbares Gefrett wegen der Verpflegung. Ich wurde an das 91. Infanterieregiment gewiesen. Dieses fand es nicht einmal der Mühe wert, mir eine ordentliche Antwort zu geben. Am nächsten Tage war ich schon wieder einem anderen Regiment zugeteilt. Das fand ich zum Glück gar nicht. Am dritten Tage kam endlich Ordnung in die Sache, da ich wieder selbständig fassen konnte. Die viel gerühmte Kameradschaft hatte sich nicht gerade im besten Lichte gezeigt. Eine Woche lag ich nun in Golczowice, besorgte täglich die Fassungen und brachte sie nachts zum Baon. Bei einer dieser nächtlichen Fahrten stürzte der Wagen, auf dem ich saß, beim Durchqueren eines Baches, und ich lag mitsamt der Ladung im Wasser. Mühsam krabbelte ich in die Höhe, noch mühsamer brachten wir den Wagen wieder hoch. Nach getaner Arbeit kauerte man am Lagerfeuer und röstete abwechselnd die Körperhälften. Am 16.11. nachmittags wurde das Baon alarmiert. Ich erhielt Befehl, mit dem Gefechtstrain dem Baon zu folgen. Der Provianttrain sollte auf dem Aufstellungsplatze bleiben. Ich erreichte das Baon natürlich nicht mehr. Um es zu suchen, ließ ich die Wagen am Walde warten, und ich ritt auf eine Höhe, um Ausschau zu halten. Je höher ich kam, umso deutlicher wurde der Gefechtslärm, und hin und wieder traf ich auch einen Blutzeugen, der vorne tobenden Schlacht, der mühsam zum Hilfsplatz humpelte. Seite 12 von 80 Als ich den Wald verließ, hatte ich noch wenige Schritte im Freien bis auf eine sandige Kuppe zurückzulegen. Zu dieser lenkte ich mein Rösslein, um von ihr Ausschau zu halten. Ich mühte mich ab, etwas zu finden, aus dem ich auf die Marschlinie des Baons schließen könnte, entdeckte aber nichts. Doch meines Bleibens war nicht lange. Die russische Artillerie mochte mich vielleicht für den Aufklärer einer Batterie, die hinter mir im Walde stecken konnte, gehalten haben, und sandte mir ihre eisernen Grüße. Vier Granaten schlugen in meiner Nähe ein. Bespritzten mich und das Pferd im Sand. Das Pferd stieg kerzengerade in die Höhe, ich behauptete mich im Sattel und riß es herum. Nun ging es in schärfster Karriere wieder den Abhang hinab, dem deckenden Walde zu. Doch hier kam ich in noch schlimmere Lage. Anscheinend waren es mehrere Batterien, die nun den Wald unter Feuer nahmen. Schrapnells platzten in den Kronen der hochstämmigen Kiefern und überschütteten weithin den Boden mit Geschoßund Astteilen, und schwere Granaten knickten starke Bäume so leicht, wie ein müßiger Wanderer zarte Halme umbiegt. Und in diesem Hexenkessel – ich auf dem immer rasender werdenden Pferde! Wie der wilde Jäger sauste ich durch den Wald. Einen tiefen Graben gab es vor mir. Da hinein kullerten Reiter und Pferd. Zitternd an allen Gliedern sprang das Pferd auf, und ich saß merkwürdiger Weise wieder oben. Und weiter ging’s, wie auf Sturmesflügeln. Als ich zu meinen Leuten wieder zurückkam, war das Pferd mit Schaum bedeckt, und mir taten alle Glieder so weh, daß man mich vom Pferde heben mußte. Im Dorf Kolbarck warteten wir nun mit anderen Trains, bis wir erfuhren, wo unsere Abteilungen lagen. Spät am Abend, als eben ein heftiger Wind und Regen uns heimsuchten, wurde mir endlich die Auskunft beim 54. Infanterieregiment erteilt, ich könne erfahren, wo mein Baon sei. Nach Stunden fanden wir das 54. Infanterieregiment, und dort sagte man mir, daß Baon liege irgendwo bei Chrastowice. Da war nun guter Rat teuer. Keine Karte – kein Führer! Ein Proviantoffizier eines Artillerieregimentes, einer der wenigen wirklichen Kameraden, die ich im Felde traf, verschaffte mir einen Führer, mit dem wir uns nun mühsam durch Sumpf und Wald vorwärts wanden, bis wir nach endlosen Stunden ganz erschöpft und vollständig durchnässt in Chrastowice eintrafen. Nach allen Seiten schickte ich Patrouillen. Alle kamen zurück, ohne das Baon gefunden zu haben. Seite 13 von 80 Da hielt ich nun auf der Dorfstraße in tiefdunkler Nacht und gedachte, das Morgengrauen abzuwarten. Mit dem Gewehre im Arm schritt ich bei meinem Wagen auf und ab. Die meisten Leute waren so erschöpft, dass sie in Pfützen kauernd einschliefen. Mich hielt nur das Gefühl der Verantwortung aufrecht. Von Zeit zu Zeit umhalste ich ein Pferd, um ein wenig zu ruhen. Aber bald gab ich es auf, da ich spürte, dass die von den Tieren ausgehende Wärme das Schlafbedürfnis unwiderstehlich zu machen drohte. Vor uns krachte von Zeit zu Zeit ein Schuß. Da hatte ich plötzlich das Gefühl von der rechten Flanke müssen Menschen kommen. Ich ging ihnen, ohne das ich sie hören oder sehen konnte, entgegen und sah auch bald dunkle Punkte leise heranschleichen. Mit dem Gewehr im Anschlag rief ich sie an. Da ertönte eine Antwort, die mich in jubelnde Freude versetzte. Das ist ja der Kögler, sagte die mir wohlbekannte Stimme meines Kameraden Permann. Er war mit einer Patrouille unterwegs. Wir erzählten uns von unseren Irrfahrten, während ich ihn mit Kaffee labte. Nicht allzu weit entfernt stand das Baon, zu dem er nach wenigen Minuten wieder aufbrach. Ich sollte ihn nicht mehr sehen. Das Gefecht, das bald nach Sonnenaufgang anhub, hat auch ihn verschlungen. Als es lichter wurde, begann das Gefecht. Es wogte lange Zeit unentschieden hin und her, wie ich aus dem Näherkommen und Fernerwerden des Feuers schloß. Durch eine Patrouille ließ ich dem Kommando meinen Aufstellungsplatz melden, und um Verständigung bitten, wenn ich gebraucht werden sollte. Stunde auf Stunde verging. Vom Baon hörte ich nichts. Da fuhr ich denn mit dem Munitionswagen los. Nach 20 Minuten stieß ich schon auf die dritte Kompanie, die sich zurückgezogen hatte. Ein wenig später traf ich das Baonskommando. Mit einem Mann schleppte ich Munitionskisten zur Schwarmlinie. Die Wagen hielten hinter der letzten Deckung. Viel konnte ich nicht erfahren. Nur soviel sah ich, daß es nicht besonders gut stand. Nach der Verteilung der Munition kehrte ich auf den alten Aufstellungsplatz zurück. An mir vorüber zog der Strom der Verwundeten. Gar mancher vom eigenen Baon war dabei. Auch der Kommandant ging wegen Erkrankung zurück. Die Verlustliste des Tages zählte 117 Mann. Während der Nacht hielt ich mit den Küchen an der Straße von Chrastowice. Alle Verwundeten oder Erschöpften, die vorüber wankten, wurden mit Kaffee oder Suppe gelabt. Auch entzündeten wir ein wärmendes Feuer innerhalb der vier geschwärzten Wände eines ausgebrannten Hauses und täuschten uns so recht wirksam eine Seite 14 von 80 warme Stube vor, trotzdem wir meist in feinen Kälteschauer verursachendem Regen standen. Am nächsten Tage kehrte ich auf den Trainplatz von L. Gol. zurück. Stumm und in sich gekehrt, tat jeder seine Arbeit. Auf allen lastete die erste Begegnung mit dem Tode, dem ich gleich am nächsten Tage wieder gegenüber stehen sollte. Eine Staffel von 30 Fuhrwerken wurde mir zugewiesen, mit denen ich die Bergegüter des Gefechtsfeldes von Golacowi abholen sollte. Wir setzten uns in Bewegung und erreichten sehr bald das Baon, das das Gefechtsfeld absuchen und die Toten bestatten sollte. Alle, die dieses traurige Geschäft besorgten, gingen so merkwürdig langsam und schienen fast ohne Leben, trotzdem sie sich schwer mühten, dem hart gefrorenen Boden einige Gräber abzuringen. Wir sammelten 110 Tote. 70 Österreicher und 40 Russen. Alle waren steif gefroren und reckten die Arme wie flehend, viele aber auch wie Rache suchend zum Himmel. Die meisten Todeswunden rührten vom Artilleriefeuer her, das die Getroffenen nicht allzu lange leiden ließ. Abgedeckte Schädel, sodass das Gehirn bloß lag, weggerissene Gesichter, fehlende Arme und Beine, zerrissene Brustkörper und Bauchwände - so lagen sie da. Einer nach dem anderen wurde durchsucht, um Namen und Heimat festzustellen und den Nachlass aufzunehmen. Die meisten Russen blieben für uns namenlos. Man hatte ihnen die Erkennungstäfelchen schon abgenommen oder es hatten die meisten keine besessen. Auch hatten sie nur sehr selten Briefe. Von unseren konnten wir Namen und Heimat feststellen. Viele hatten auch Briefe bei sich und sehr oft fand man die Bilder von Weib und Kind und den Eltern. Gar manches trug Spuren des vergossenen Blutes. Da lag nun, in einem Tüchlein zusammengebunden, der armselige Nachlass von 110 Männern, die im Kampfe gefallen waren. Unter dem Häuflein lag auch eine Uhr, die noch ging. Ihr Tick Tick klang deutlich vernehmbar und unwillkürlich mußte man denken, wie lange noch. Und auf einer eisigen Höhe wird jemand deine Uhr und deine Briefe in ein Tüchelchen binden als letzten Gruß für die Heimat. Die Gräber waren fertig, in Reihen wollten wir die Toten hineinlegen. Da rollten auf einmal über uns Granaten. Die Russen hatten uns entdeckt und für vorgehende Reserven gehalten, denn vor uns ging das Gefecht. Gleich die erste Salve ging in die Nähe eines Grabes nieder. Eine Granate wühlte sich in eine Reihe toter Russen ihr Seite 15 von 80 Loch, und Arme und Beine der hart gefrorenen Leichen tanzten einen furchtbaren Reigen. Wir mußten uns in die nächste Deckung zurückziehen und mit der Beendigung unserer Arbeit bis zum Dunkelwerden warten. Als die Sonne gesunken war, legten wir die Toten in die Gräber. Ein Vaterunser, dann arbeiteten die Spaten. Und bald wölbten sich die Hügel, die das Leid von 110 Familien einschloß. Zum Schluß wurden Kreuze aus weiß schimmerndem Birkenholz aufgerichtet. Als wir ins Nachtquartier gingen, da drehten die Leute nach einigen Schritten immer wieder die Köpfe gegen die Gräber, die mit ihren weiß leuchtenden Kreuzen in der dunklen Novembernacht noch lange sichtbar blieben. Und auf dass den begrabenen Helden der Salut nicht fehle, donnerten die ganze Nacht die Geschütze. Ich stand noch lange, nachdem ich die Kantonierungswachen aufgestellt, lauschte auf das Grollen der Geschütze und schaute in der Richtung der Gräber, bis ich endlich mein einsames Strohlager im Winkel einer Hausflur aufsuchte. Lange konnte ich nicht einschlafen. Meine Gedanken waren da draußen bei den Toten. Nun kamen drei Wochen verhältnismäßig behaglichen Lebens. Einige Tage davon verbrachte ich mit dem Gefechtstrain in Zarcozce und besuchte jeden Abend das Baon, das drei Kilometer entfernt in X lag. Den größten Teil dieser Zeit war ich beim Provianttrain auf der Waldblöße von L.Gol. Ein Tag verstrich wie der andere mit der ungestörten Beschaffung der Verpflegung. Nur hin und wieder gab es Ereignisse, die uns ein wenig in Schwung brachten. So saßen wir einmal im sonnenhellen Mittagsschein, als ein Flieger über uns seine Kreise zog. Er blieb verhältnismäßig lange über uns stehen und kehrte nach einigen kunstvollen Schleifen in die russischen Stellungen zurück. Keiner dachte mehr an den Flieger, als plötzlich das charakteristische Aufheulen immer näher kommender Granaten an unser Ohr schlug. Alles duckte sich, wie die Hühner, denen der Habicht droht. Dann ein furchtbares Krachen, begleitet vom Brechen einiger Bäume, und acht hohe Staub- und Rauchsäulen stiegen mitten aus unserem Lager auf. Die Russen hatten, von ihrem Flieger belehrt, ausgezeichnet geschossen. Nach allen Richtungen rasten die bespannten Fuhrwerke und Küchen auseinander. Es war schwer, sie wieder auf einen Fleck zu sammeln. Merkwürdigerweise war bei meinen Fuhrwerken gar nichts geschehen. Nach geraumer Zeit kehrte ich wieder auf den alten Aufstellungsplatz zurück, da die Russen nach meiner Meinung den selben Ort kaum noch beschießen würden. Seite 16 von 80 Die anderen Trains suchten sich andere Aufstellungsplätze und wurden doch wieder von schwerer Artillerie beschossen, während ich auf dem alten Platze unbehelligt blieb. Auffallend war, dass wir mehrmals am Tage beim Zuführen des Proviantes, während der Rasten, von russischer Artillerie erwischt wurden. Es muss da unbedingt Verrat im Spiele gewesen sein. Einmal kamen bald nach der Ausfahrt die Küchen mit schweißbedeckten Pferden zurück, ohne das Baon erreicht zu haben. Die Russen hatten die Küchen mit Feuer überfallen. Da ging ich denn mit den Küchen nochmals hinaus, suchte einen gedeckten Weg und brachte sie ohne Verluste zum Baon. Die Tätigkeit als Proviantoffizier bringt zwar nicht so oft die Gefährdung des Lebens wie in der Front, ist aber keineswegs so angenehm, wie sich das die meisten vorstellen dürften. Qualvolle Stunden sind die des Herumirrens ohne Karte und ohne Führer, das Fragen nach dem Baon u.ä.. Hat man es endlich erreicht, gibt es natürlich Vorwürfe, die, weil ganz ungerechtfertigt, sehr verbittern. Das unangenehmste Geschäft ist wohl die Buchführung und die Geldgebarung. In einer kalten Herbstnacht am Lagerfeuer sitzend, Aufzeichnungen kontrollieren und Hunderter und Tausender in schöne Päckchen ordnen, wenn nicht allzu ferne die Geschütze rollen und die Maschinengewehre knattern, ist eine Aufgabe, die den Geist furchtbar ermüdet. Und dann immer und immer wieder die grüblerischen Gedanken: Wird die Proviantstaffel rechtzeitig ankommen, usw.? Denn obzwar meine Leute brav und willig waren, so fehlte ihnen doch die Wärme des Pflichtgefühles, das unablässige Denken, wie mache ich es besser und praktischer. Alles überließen sie der Fürsorge des Offiziers, vom Pferdebeschlagen bis zum Brotzählen und Postabholen. Und dazu noch die Einsamkeit, kein Vertrauter weit und breit, mit dem man sich hätte manchmal in den blühenden Gärten der Begeisterung und den Wünschen für die kommende Gestaltung Europas ergehen können. So kam es, dass ich tagelang nichts anderes sprach als Befehle. Andererseits wuchs aber auch von Tag zu Tag die Überzeugung, dass in meiner Umgebung mein deutsches Pflichtgefühl doppelt wichtig war. Und so wuchs ich an den zu überwindenden Schwierigkeiten und habe während des Feldzuges alles, was ich unternahm, zum guten Ende gebracht. Aber wie gerne hätte ich manchmal ein Augenpaar leuchten sehen, das mir sagt, ich fühle mit dir und an mir soll‘s nicht fehlen. Der Gehorsam, auch wenn er todverachtend ist, allein tuts nicht. Und so habe ich denn Tage und Wochen im polnischen Lande verbracht, allein auf mich gestellt, und Seite 17 von 80 die soldatischen Eigenschaften, die mir von meinen Vorderen her im Blute stecken, haben sich entwickelt und bewährt, trotzdem ich äußerlich so gar nichts Soldatisches an mir habe. Wie hätte die Leistungsfähigkeit vervielfacht werden können, wenn man öfter ein aufmunterndes Wort von oben und ein kameradschaftliches Gespräch gehört hätte. Aber nichts von alledem. Im Gegenteil: Verletzendes und Höhnisches gab‘s genug zu hören. Niemals spürte man die geistige und vor allem soldatische Überlegenheit, die blindes Vertrauen einflößt und den halben Erfolg macht. Da taucht eine Erinnerung aus späterer Zeit auf: Ich hatte mit meiner Kompanie einen ganzen Monat eine Stellung inne, habe dort unermüdlich geschanzt und Hindernisse gebaut, Tag für Tag feindliches Feuer über mich ergehen lassen und in steter Wachbereitschaft nicht das Geringste verabsäumt, sondern im Gegenteil, mich beinahe im Dienste aufgerieben. Wir kommen zurück, werden vom Oberst zum Rapport befohlen und von ihm nicht einmal mit einem Handschlag begrüßt. Man sollte doch meinen, dass man das Offizieren, die einen Monat ununterbrochen vor dem Feinde lagen, nicht bieten sollte. Das Schönste kam aber noch. Der Oberst besprach eine Reorganisation im Trainwesen u. ä. und meinte, jetzt müsse endlich einmal etwas gearbeitet werden. Das faule Leben, wie es im Schützengraben geführt werde, sei hier in der Reservestellung ganz ausgeschlossen. Diesen selben Oberst sah ich während dreier Monate, die ich im Schützengraben verlebte, einmal! Er wusste anscheinend vom Schützengraben nicht mehr als die Besucher des Schützengrabens im Wiener Prater und hatte sich ein ganzes Leben lang auf den Beruf des Kriegers vorbereitet. Ähnliche Episoden ließen sich in Menge erzählen. Doch zurück zu den fröhlichen Episoden. Trotzdem die Verpflegung sehr gut war, vermissten wir doch einen Genuss gar sehr - das Bier! Da raunte mir eines Abends ein Artillerist geheimnisvoll ins Ohr: In Olkucz gibt‘s Bier! Gleich rüsteten wir eine Expedition. Zwei Offiziersdiener banden sich kunstvoll leere Gurkengläser auf den Rücken und traten den Marsch gen Olkucz an. Als sie weg waren, befiehl mich eine seltsame Unruhe. Den ganzen Tag begleitete ich sie in Gedanken auf dem mir bekannten Wege. Mit der Uhr in der Hand stellte ich zu jeder Stunde fest, wo sie sein könnten. Und endlich kamen sie zurück. In den Gurkengläsern schwappte köstliches Bier, das für meinen lechzenden Gaumen trotz der 10 km langen Reise nichts an Güte eingebüßt hatte. Seite 18 von 80 Da gab es kein Wanken und kein Weichen, Glas auf Glas wurde eingegossen und allem, was das Herz bewegte, geweiht. In so gehobener Stimmung wie damals im polnischen Walde habe ich wohl selten noch gezecht. Einmal brachte eine von mir ausgeschickte Requisitionsabteilung einige uralte Kühe, die keine Milch mehr gaben. Doch unser Koch verstand es, der einen noch täglich ein kleines Glas Milch abzuschmeicheln. Ich hatte nun längere Zeit als das Haupt der lagernden Bande Milchkaffee und wurde ob dieses seltenen Genusses von gar manchem beneidet. Aber auch die Milch schenkende Kuh hatte es sehr gut. Sie bekam einen Windschutz aus dichtem Gezweig und einen alten Sack als Decke und überlebte zur Belohnung für ihre herrliche Eigenschaft alle Genossinnen. Doch eines Tages mussten wir auch sie erschlagen, da das Fleisch knapp geworden war. Als die Neigung bemerkbar wurde, an der genannten Stelle zu überwintern, gingen wir daran, zwei Häuser zu bauen. In zwei Tagen hatten wir eine Offiziershütte für zwei Personen mit Tisch und Bank fertig gestellt, in der es sehr traulich war. Das Hauptstück der Einrichtung war ein eiserner Ofen, den wir aus einer zerstörten Eisenbahnstation geholt hatten. Es gab dort auch Kohle, und es wurde nun für behagliche Wärme gesorgt. Da ich in diesem Unterstand auch die Kassa hatte, konnte bei Nacht der Kassaposten weiter heizen und das Schlafen wurde wirklich zum Vergnügen. Ausgezogen und leicht zugedeckt, ruhte es sich wie im schönsten Herrschaftshaus. Verwöhnt war ich freilich nicht, denn bisher waren Munitionswagen mein Ruheplatz gewesen. In diesem Häuslein fühlte ich mich sehr wohl. Meine Bücher und meine Kasse waren immer in Ordnung. Zu tun gab es nicht allzu viel und die unangenehmen Stunden, die der Dienst oft brachte, gingen rasch vorüber. Je größer die Enttäuschung bei dienstlichen Angelegenheiten war, um so rascher und auch fröhlicher kehrte ich zu meinem Wigwam zurück. Da war ich König. In den Tagen, da wir unseren Häuserbau fertiggestellt hatten, ereignete sich noch etwas, das unsere gute Stimmung soweit hob, als es überhaupt möglich war. Die Verbindung mit der Heimat war nach längerer Pause glücklich hergestellt. Ein feierlicher Augenblick war es, als Feldwebel Z. das erste Mal auszog, um die Post abzuholen. Mit stiller, aber nachhaltiger Freude wurden die ersten Grüße aus der Heimat in Empfang genommen, und von nun an blieb das Verteilen der Post die festliche Stunde des Tages. Eine günstige Verbindung der Kämpfer mit der Heimat ist von großem Wert und erhöht die Widerstandskraft. Seite 19 von 80 Ihr, die ihr zu Hause geblieben seid, sendet daher alle fleißig Grüße ins Feld. Es muß nichts Besonderes sein, was Eure Karten berichten. Jede bringt Heimatduft und erfüllt ihren Zweck, auch wenn sie ganz Belangloses erzählt. Und als gar die ersten Pakete kamen, da sah man verklärte Augen! Unsere Waldidylle sollte bald ein Ende finden. Unser Baon wurde der 46. L.I.T.D. zugeteilt, und ich musste den Anschluß an das neue Proviantamt suchen. Das lag in Ryczowok. Ein Halbtagsmarsch brachte uns dorthin. Ich traf den speisenden Herrn Hauptmann, der nun mein Vorgesetzter war im Kreise zahlreicher Offiziere. Ich meldete mich und musste, trotzdem ich sehr begehrlich auf den gedeckten Tisch blickte, die Tür nach erstatteter Meldung wieder von draußen zumachen. Mehr als einen halben Monat lag ich nun immer mit den Herren des Proviantamtes der 46. L.I.T.D. im selben Ort, ohne mit ihnen in gesellschaftliche Berührung zu kommen. Sie hatten eine wunderbare Offiziersmenage eingerichtet und waren sehr gut verpflegt. Es fiel ihnen aber nicht ein, mich nur ein einziges Mal einzuladen. Sie saßen im schön geheizten Zimmer, und ich hockte ein paar hundert Schritt davon entfernt am Wachtfeuer. Vielleicht wollten die Herren von mir nichts wissen, weil ich einer Landsturmformation angehörte. Wir waren eben nicht gleichwertig. Wenn es aber in den Tod ging, war immer der Landsturm voran. In Ryczowok blieben wir nur zwei Tage. Dann setzten sich die Trains der ganzen Division in Bewegung. Ich machte den Schluss der Kolonne. Nachts wurde während des Marsches das Marschziel geändert, aber nur die Spitze davon verständigt. Da die Wagenreihe bei den schlechten Wegen öfter zerrissen wurde, bestand die Gefahr, daß die Kolonne nach verschieden Richtungen auseinander fährt. Daran dachte ich. Nun sehe ich, daß die Wagenreihe vor mir einen falschen Weg einschlägt, rase atemlos nach vorn, um den Fehler zu vermeiden, und dort teilt man mir lächelnd mit, dass schon vor vier Stunden ein neues Marschziel bekannt gegeben wurde. In derselben Nacht geschah noch etwas Bezeichnendes. Der Weg war so schmal, dass nur ein Wagen Platz fand. Von Zeit zu Zeit gab es Pausen. Eine dehnte sich ins Endlose. Endlich riss mir die Geduld, ich ging nach vorn, und sah, dass ein Wagen stecken geblieben war. Um ihn herum standen die Kutscher der anderen Fuhrwerke ohne einen Finger zu rühren. Es waren Slawen. Als ich sie zum Zugreifen antrieb, war die Stockung in einer Minute behoben. Vor uns warteten die Kampftruppen auf Nachschub und ein paar faule Lümmel brachten einer gesamten Wagenreihe Seite 20 von 80 stundenlange Verspätung. Die Herren Kommandanten müssen es sich eben abgewöhnen, ins Quartier voraus zu reiten. Vielfach fuhren wir an Gefallenen vorüber, die nackt waren. Der Mangel an Kleidern muss damals sehr drückend gewesen sein! Über einen solchen Toten stolperte ich im dunklen Wald und fiel auf ihn. Da ist mir wohl die Gänsehaut gekommen, umso mehr, da ich wußte, wir sind in einer Choleragegend. Das Grausen wurde noch größer, als ich im Walde bald darauf in eine russische Latrine fiel. Doch habe ich auch das überwunden. Eine recht traurige Nacht verbrachten wir in Czizowa. Für die Pferde war kein Dach zu finden. Alles war überfüllt, und so standen sie die ganze Nacht in Sturm und Regen und ließen die Köpfe immer tiefer hängen. Wir standen neben ihnen in Zeltblätter gehüllt und drängten uns an die Feuer. Trotz des wasserdichten Umhanges fanden doch auf ganz unerklärliche Weise verschiedene Wässerlein den Weg bis zur Haut. Am nächsten Tag machte die mühselige Fahrt bis nach Zarnowinc zu einem Plagetag ersten Ranges! So lange wir auf Seitenwegen fuhren, war es angenehm. Als wir aber auf die Hauptstraße einbogen, begann das Tappen im Ungewissen und die Disziplinlosigkeit. Niemand wusste, in welchen Teil der Kolonne er gehörte, und so gab es bald ein tolles Vor- und Ineinanderfahren. Der Rücksichtsloseste kam am besten vorwärts. Ich wollte lange nicht an dieses Durcheinander glauben, sah aber schließlich ein, dass ich allein in der viele Kilometer langen Marschlinie gar nichts erreichen könne und kümmerte mich von nun an nur noch um meine Wagen. Auf zermürbter Straße ging es in wilder Hast den ganzen Tag vorwärts. Je näher die Nacht kam, um so unruhiger wurde ich, weil ich nicht das Marschziel und noch weniger den Standort des Baons erfahren konnte. In Zarnowinz waren die Pferde am Ende ihrer Kraft. Ich musste halten. Auch erfuhr ich, dass Rogow, der nächste Sitz des Proviantamtes sei, und dorthin wollte ich am nächsten Morgen aufbrechen. Das Einstellen der Pferde war wieder nicht möglich; sie sahen aber auch schon recht jämmerlich aus. Unsere schweren Pferde aus den Sudeten sind für einen Feldzug nicht geeignet, vor allem sind sie gar nicht abgehärtet. Ich kroch in einen Wagen, legte mir ein kleines Bündel Stroh unter den Kopf und schlief bald ein. Nicht lange sollte meine Ruhe dauern, denn ich wurde durch die Berührung eines Lebewesens geweckt. Es dauerte geraume Zeit, bis ich begriff, um was es sich handelte. Ein am Wagen angebundenes Pferd hatte den Kopf unter der Seite 21 von 80 Plache durchgeschoben, meinen Kopf beiseite gedrückt und sich über mein Kopfpolster gemacht. Ich gab ihm eins auf die Nase und schloß die Plache wieder. Doch nach kurzer Zeit war das Pferd mit seinem Kopf wieder bei mir. Dieses Spiel wiederholte sich solange, bis mein Kopfpolster verzehrt war und mein Kopf auf einer Munitionskiste ruhte. Der nächste Morgen war angenehmer, da es mir gelang, mich von der Hauptkolonne loszulösen und allein auf Seitenwegen zu marschieren. Ich kam ohne Störung als erster in Rogow an, fand gutes Quartier und schöne Unterkunft für meine Leute. Die Meldung beim Herrn Hauptmann, der beim Mittagessen saß, war insofern erschwert, als die Ordonanz ihn während des Essens nicht stören lassen wollte. Ich schob sie aber beiseite und wurde dienstlich empfangen. Vom Essen bekam ich nur den Duft. Auch scheint es nicht üblich zu sein, daß diese Leute einen müden Offizier einen Stuhl anbieten. Doch Schwamm drüber. Der nächste Tag brachte uns als Marschziel Mugoslawice, das wir trotz des mangelnden Marschbefehles und des Durcheinanders glücklich erreichten. Eine Woche blieben wir hier stehen. Diese Woche unterschied sich in der Arbeit nicht viel von den verflossenen. Fassungen und Verteilung an das Baon waren die Arbeit. Auch gelang es meinen Leuten, eine große Menge vergrabener Gewehre ausfindig zu machen. Trotzdem für das Zustandebringen von Waffen Belohnungen ausgesetzt waren, habe ich nichts empfangen, was ich als Belohnung hätte auffassen können. In Mugoslawice verbrachten wir auch unseren Weihnachtsabend. Die Leute hatten eine in unserem Gehöft stehende Fichte mit Kerzen, die sie von Brünn im Tornister für den Weihnachtsabend mitgetragen hatten und mit Christbaumschmuck geziert. Die Luft war so ruhig, dass die Lichter so brannten, wie in einem Zimmer. Als alle versammelt waren, sangen wir das Lied „Stille Nacht“ usw.. Dann sprach ich einige Worte. Ich sagte, wir feiern mitten im Feindesland das Fest des Friedens, weil wir die feste Zuversicht haben, dass wir uns in Kurzem den siegreichen Frieden erkämpft haben werden. Je tüchtiger der Einzelne ist, um so kürzer der Kampf und um so früher das heißersehnte Wiedersehen in der Heimat. Mit dem Wunsche für eine glückliche Heimkehr, schloß ich. Es ist wohl dabei kein Auge trocken geblieben. Alle waren mit ihrem Geiste in der Heimat. Der Körper freilich hatte auch an diesem Tage seine Pflicht getan, und das Ohr hörte das Brüllen der schweren russischen Geschütze. Das Kaiserlied, das zum Schluß gesungen wurde, klang von all den halb erstickten rauhen Männerstimmen ergreifend. Ich erstieg dann allein noch einen kleinen Hügel und lauschte auf das Seite 22 von 80 Toben der Schlacht. Bald waren aber meine Gedanken in der Heimat, und die Frage, „Wirst Du sie wiedersehen?“, legte ich mir an diesem Abend gewiss hundertmal vor, ohne aber die befreiende Antwort finden zu können. Die Offiziere des Proviantamtes hatten eine glänzende Weihnachtsfeier im Meierhof. Da ich nicht eingeladen wurde, hörte ich nur Verschiedenes über den Verlauf erzählen, der jedenfalls nicht so erhebend war, wie bei uns. Der 21. Dezember hatte unserem Baon so starke Verluste gebracht, dass es aufhörte zu bestehen. Die Reste der Mannschaft wurden zu einer Kompanie vereinigt, deren Befehl ich zu übernehmen hatte. Zwei Tage wurden mir zum Abschluß der Rechnungen gegönnt. Dann nahm ich Abschied vom Train und meldete mich in Zu Tur zur Übernahme der Kompanie. Ein neuer Abschnitt meines Kriegerlebens hatte begonnen. Zuerst sah ich mir die Kompanie an. Sie zählte 280 Mann, war aber durch die vorhergegangenen Strapazen und vor allem durch das Gefecht bei Pinczow sehr mitgenommen. Auch befanden sich viele Leute darunter, die keineswegs felddiensttauglich waren und für eine Fronttruppe nur unnötiger Ballast. Meine Beobachtungen meldete ich pflichtgemäß dem Regimentskommando, erkannte aber dabei sofort, dass im Kriege ein Oberleutnant ebenso wenig eine Meinung haben darf, wie im Frieden, und dass alles auf Glanz herrichten, immer noch die Losung war. Ich wurde wegen meiner Freimütigigkeit ganz gehörig angepfiffen, bekam aber doch den Auftrag, alle Leute vom Arzt untersuchen zu lassen und über den Befund zu melden. Dies geschah, und mit Bewilligung des Regimentskommandos schickte ich nach 2 Tagen die erste Gruppe Frontdienstuntauglicher an das Korpskommando ab. Ich meinte damals, es sei doch großartig zu dienen, wenn man es mit einsichtigen Vorgesetzten zu tun hat. Am 28. Dezember verließen wir Zu Tur und marschierten nach Mlodrowie duze, wo wir Stellung zu beziehen hatten. Es gab einen entsetzlichen Nachtmarsch. Meine Leute versagten körperlich in erschreckender Weise. Aber doch kam ich mit einem ansehnlichen Trupp morgens zwei Uhr beim Regimentskommando an. Die Leute waren zwar willig, aber es fehlte ihnen der Schwung. Da ist es nun erklärlich, dass die müden Knochen sehr bald im Straßengraben rasteten. Da und dort verkrümelt sich einer, ohne dass man es merkt. Das Gefüge der Kompanie wird immer lockerer und die Prozession ist bald fertig. Wie oft habe ich mich da nach meinem Stammregiment, den 73ern gesehnt. Seite 23 von 80 Hier bezog ich das erste Mal einen Schützengraben. Der Teil, der mir zufiel war nur angedeutet. In einer Nacht waren wir ziemlich tief in der Erde und auch die Verbindung zwischen den einzelnen Grabenteilen war bald hergestellt. Kaum war der Graben fertig, wanderten wir an eine andere Stelle, und ich musste oft bemerken, dass man meiner Kompanie stets die größte Arbeit zuwies. Es kam dabei eine gewisse Gehässigkeit gegen den Landsturm zum Ausdruck. Auch mag der Gegensatz zwischen Polen und Tschechen dieser Erscheinung aufgeholfen haben. Kurz und gut, ich spürte sehr bald, dass man mir und meinen Leuten die Rolle eines Soldaten zweiter Güte zuwies. Und wie bald zeigte es sich, daß meine Leute viel besser waren, als die viel gerühmten edlen Polen. Die zweite Grabenstelle, die wir in Mlodrowie duze nun regelmäßig auf je 24 Stunden nach 24 stündiger Rast besetzten, sperrten den einzigen im Winter passierbaren Weg, der von uns zu den Russen durch das Sumpfgelände führte. Der Graben zog sich längs des Sumpfrandes hin und war meist 20 bis 25 cm hoch mit Wasser gefüllt. Der Boden war mit Wasser gesättigt, so daß der Verkehr in dem tiefen Schlamm sehr missmutig machen mußte. Da hockte ich denn jede zweite Nacht und verbesserte nach Möglichkeit die Stellung. Bäume wurden gefällt, halbwegs brauchbare Unterstände gebaut und Wasserabzugsgräben gezogen, die freilich nicht viel nützten. Auch ein Drahthindernis entstand allmählich. Die Kompanie, die uns regelmäßig ablöste, lies sich‘s gut sein und machte keinen Spatenstich. Es war oft die Aufwendung der größten Tatkraft notwendig, um die Arbeiten durch die eigenen Leute fortsetzen zu können. Auf dem genannten Wege, gegen 500 m vor der Stellung lag eine Feldwache, die die Russen schon einige Mal ausgehoben hatten. Um das zu verhindern, wenn meine Leute draußen waren, wandelte ich jede Nacht zwei bis dreimal hinaus, um mit Wachen zu helfen. Meine Leute waren immer sehr aufmerksam und ohne einen Gefangenen zu verlieren, habe ich manche Nacht auf diesem nicht ungefährlichen Wege gehorcht. Es war sehr schwer, nachts keinen Fehltritt zu tun, und so geschah es denn, dass ich immer während des Marsches zur Feldwache da und dort in Wassertümpel geriet, die mich meist bis zum Nabel mit ekligem Wasser umspielten. Dieses Halbbad nahm ich nun mehrmals jede zweite Nacht, ohne eine Verkühlung davonzutragen. Nicht einmal einen Schnupfen bekam ich, und wir standen doch mitten im Winter. Meist herrschte düsteres Nebelwetter, und oft regnete es die ganze Nacht. Ich kam daher aus der Verwunderung nicht heraus, als sich keine ernsteren Seite 24 von 80 Erkrankungen bei meinen Leuten einstellten. Über Reißen in den Gliedern klagten wohl die meisten, und mancher wird noch nach Jahren durch Zucken und Reißen in den Beinen an die Wacht im Sumpf von Nilod D. erinnert werden. Manchmal gab es auch helle Sonnentage. Da war alles wie verwandelt. Die Hütten im Dorfe sahen so freundlich drein, der Meierhof erschien wie ein vornehmer Edelsitz, und die Sumpflandschaft hatte besonders bei Sonnenauf- und -untergang einen eigenen Reiz. Die Farben, die über der Landschaft lagen, waren viel satter und kräftiger als bei uns. Einige Male erschienen im Norden auch die weiß blinkenden Türme der Stadt Pinczow, bei der am 21. Dezember 249 Mann des Baons geblieben waren. Da mußte ich denn immer und immer wieder hinüber sehen, und oft meinte ich, die Natur müsse dort ob der vielen Gräber besonders traurig sein. Aber wenn man länger hinsah, so sah man die Sonne über der weißen Kirche und den dunklen Kiefernwäldern so verheißungsvoll leuchten wie im Frieden. In einer Nacht kam der telefonische Auftrag zu besonderer Aufmerksamkeit, da links von uns ein Jagdkommando ein von den Russen besetztes Dorf überfallen werde. Mit geschärftem Ohr lauschten wir nun auf alle Stimmen der Nacht. Um Mitternacht erhob sich plötzlich bei dem Dorfe ein lebhaftes Gewehrfeuer, dann brauste deutlich vernehmbar ein Hurra durch die Lüfte und danach nur noch einzelne Schüsse und Schreie. Das Handgemenge war im Gange. Nach wenigen Minuten brannte das Dorf an allen Ecken und beleuchtete weithin alles. Der Überfall war gelungen. Die Russen hatten sich nach kurzem Widerstand ergeben. Gegen Morgen waren die Häuser und Scheunen niedergebrannt und nur dicke Rauchschwaden stiegen aus den Trümmern auf. Als es hell geworden war, kam aus der Richtung des zerstörten Dorfes zwei Gestalten auf uns zu. Ein junger Rekrut brachte einen riesigen Russen. Mit all der Unbekümmertheit der Jugend ging der Rekrut voran und hinter ihm trabte gehorsam der Russe, dessen Faustschlag den Führer leicht hätte niederstrecken können. Wir riefen ihm zu, den Russen vorausgehen zu lassen. Da wurde er sehr verlegen und entschuldigte sich mit dem Hinweis auf seine erst wenige Wochen dauernde Dienstzeit. Und dabei zeigte seine Kleidung, daß er im Handgemenge seinen Mann gestellt. Seite 25 von 80 Der Kampf war zu Ende, und schon kam er dem Besiegten mit rührendem Vertrauen entgegen. Dieser Rekrut erschien mir wie unser zu Mißtrauen und zur Rachsucht gar nicht fähiges Volk. An den Rasttagen war ich einigen anderen Offizieren im Meierhof untergebracht. Ich lag gerade auf meinem Strohlager, als es mir vorkam, es hätte eine weibliche Stimme den Weg bis zu unserem Ohr gefunden. Auch die anderen waren aufmerksam geworden und sahen einander fragend an. Ehe wir uns noch zum Austausch von Bemerkungen aufraffen konnten, ging die Tür auf und der Regimentskommandant trat mit einer Dame und einem Herren in Zivil ein. Es war der Besitzer des Meierhofes mit seiner Frau. Wir machten alle sehr dumme Gesichter und starrten auf die Frau, die uns wie ein Gruß aus einer anderen Welt erschien. In hocheleganter Toilette, von einer Parfümwolke eingehüllt, eine brennende Zigarette in der nervösen mit Ringen überladenden Fingern der rechten Hand, scheint sie sich innerlich über uns lustig gemacht zu haben, da wir ganz sprachlos waren. Doch bald kam Leben in uns. Da hatte sie aber schon der Regimentskommandant wieder entführt. Das Gespräch kam nun natürlich auf die Weiber. Ich begegnete der Frau an diesem Tage noch einige Male, da sie die Schäden besah, die der Krieg auf ihrem Gut angerichtet. Und jedes Mal konnte ich sehen, wie es in den Augen der Soldaten, an denen sie vorüber kam, eigentümlich aufleuchtete. Und es wurde mir erklärlich, wenn die Truppen – sobald die Zucht gelockert – manchmal Gewalt üben. Sonst floß unser Leben in dieser ersten von uns bezogenen Grabenstellung recht einförmig dahin, einförmig insbesondere mit Rücksicht auf die sich gleichbleibenden Höchstanforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit. Noch heute ist es mir unerklärlich, daß ich ohne zu erkranken, jede zweite Nacht den Dienst in den nassen Stellungen versehen konnte. Jedes Mal wurde man ganz naß, mindestens bis zu den Knien. Manches Mal versank ich auch bis über die Hüften im Sumpf, wenn ich die Feldwache besuchen ging. Aber die Erregung, die in der ersten Zeit des Wachdienstes im Graben alltäglich war, half über die Schädlichkeiten hinweg, die einem im normalen Geleise des Friedensalltages sicherlich auf das Krankenlager geworfen hätten. Hin und wieder schoß die Artillerie. Den Einschlag unserer Geschütze konnte ich nicht beobachten, die Wirkung der russischen Geschosse meist auch nicht. Nur Seite 26 von 80 einmal an einem hellen Tage sah ich, wie ein einziger Schuß der Russen die Spitze des von uns zur Beobachtung genutzten Kirchturmes wegnahm. Auch die Türkenbatterie, die in unserer Nähe stand und so genannt wurde, weil ihre Geschütze ursprünglich für die Türkei bestimmt waren, bekam in diesen Tagen russischen Geschoßbesuch, trotzdem sie tief versteckt im Walde stand. Wahrscheinlich hatten da russophile Landeseinwohner die Hand im Spiel. Überhaupt konnte man auf Schritt und Tritt feststellen, daß der Kundschafterdienst der Russen bestens eingerichtet war und jedenfalls von gar manchem wichtigen Vorgang auf unserer Seite sehr bald melden und die entsprechenden Gegenmaßnahmen veranlassen konnte. Einige Male fanden auch Verhaftungen von Landeseinwohnern statt. Ich selbst schickte manchmal Streifwachen, die nachts den oder jenen Ratsherren in einem einsamen Dorfe ausheben mußten. Doch erfuhr ich nie etwas Bestimmtes über die Ergebnisse der Untersuchungen. Verluste hatte ich, abgesehen von einigen Leuten, die erkrankten, keine zu beklagen. Nur einmal erhielt ein Mann, der einer Erkundungsabteilung beigegeben war, einen Schuß durch den Arm. Diese Erkundungsabteilung, aus meiner Kompanie gebildet, war die Einzige von mehreren, die die russischen Stellungen in einem Frontabschnitt festzustellen hatten, welche mit einem Ergebnis von der Streife zurückkam. Der Landsturm hatte wieder einmal seine militärische Tüchtigkeit erwiesen. Davon sprach man aber nicht. Nur davon, daß auf langen Märschen „die alten Herren“ manchmal versagten. In den ersten Jännertagen wurden wir zwei Tage nach Koczubow in die Reservestellung zurückgenommen. Trotzdem nur wenige Kilometer zu marschieren waren, kamen meine Leute doch in ziemlich erschöpftem Zustande an, da wir unterwegs in hohem Schnee fleißig übten und dadurch die in harter Stellungsarbeit müde gemachten Leute, die überdies 300 Patronen trugen, auspumpten. Die Unterkunft in Koczubow, einem kleinen armseligen Neste, war schlecht. Die Leute froren in den halb offenen Scheuern, daß sie den ganzen Tag mit steifen Knien herumtorkelten. Hier begab sich nun etwas, was ich lieber nicht erzählen möchte. Aber es gehört zur Vollständigkeit des Bildes, das ich von meinen Kriegserleben entwerfen will. Seite 27 von 80 Als ich in Zu Tur die aus den Resten des L.St.M.B. 1 gebildeten Kompanie übernahm, lies ich die Leute antreten und schaute sie mir an. Viele machten einen jämmerlichen Eindruck und waren geradezu hinfällig. Ich meldete nach meiner Auffassung pflichtgemäß diese Beobachtung und knüpfte daran die Bemerkung, daß die Leute nicht leistungsfähig sind. Da kam ich aber schön an. Nachdem ich das erste Donnerwetter ausgehalten hatte, erhielt ich den Auftrag, alle Leute vom Arzt untersuchen zu lassen und die nicht Felddiensttauglichen mit Bezug auf einen Erlass des Korpskommandos, der solche Leute für den Etappendienst bestimmte, zum Korps zurückzuschicken. Dies geschah. Wenn ein Trupp Felddienstuntauglicher beisammen war, meldete ich dies dem Regimentskommando, mit dessen Erlaubnis ich dann die Absendung veranlasste. So hatte ich einige kleine Abteilungen abgehen lassen und dadurch die Kriegstüchtigkeit meiner Kompanie bedeutend gehoben. Dann kam eines schönen Tages die eine Abteilung zurück, da man sie beim Korpskommando, ohne sie näher anzuschauen, zurückgejagt hatte. Die Absendung weiterer Felddienstuntauglicher wurde gleichzeitig verboten. Damit meinte ich die Sache abgetan, aber dem war nicht so. Nach dem Exerzieren am ersten Tage unseres Aufenthaltes im Koczubow wurde ich zum Regimentsrapport befohlen und erhielt auf freiem Felde in Gegenwart des Baonskommandanten vom Regimentskommandanten über Auftrag des kommandierenden Generals einen scharfen Verweis, weil ich die Frontscheue der Leute unterstütze. Der Regimentskommandant war derselbe Mann, der von der Absendung der Leute regelmäßig die schuldige Meldung erhielt. Seine Pflicht wäre es gewesen, die Sache mit seinem Namen zu decken. Doch das geschah nicht. Das Opfer war ich. Ich mußte nachher über die ganze Komödie bitter lachen. Man hätte nicht gleich einen zweiten Offizier bei der ganzen Division finden können, der mit so warmem Herzen bei der Sache war wie ich. Und zur Belohnung meines Eifers eine Strafe! Und warum? Weil beim Korpskommando der Erlaß, dem zufolge die Leute zurückgeschickt wurden, in einem unglücklichen Augenblick eine andere Auslegung fand, als die übliche. Ich versuchte über die Sache hinwegzukommen, aber bis heute, wenn ich daran denke, packt mich die Erregung. Seite 28 von 80 Der Aufenthalt in Koczubow währte nur zwei Tage. Dann kamen wir wieder in die alte Stellung zurück. Der Dienst war ähnlich wie das erste Mal. Abwechslung brachten Patrouillen, der Bau der zweiten Stellung, das Heranbringen von Aufrufen an die russische Stellung, sogenannte Demonstrationen, wie z. B. eine nächtliche Brückenbaudemonstration und so fort. In der Nacht vom 13. auf den 14. Jänner wurden wir abgelöst und marschierten nach Probolowice, wo wir bis 5. Feber in Reserve lagen. Die Muße, die uns da gegeben war, wurde durch leichte Übungen im Gelände nutzbringend gemacht. Vor- und nachmittags wurde geschwärmt, marschiert, geschossen und gestürmt. Diese Ausbildung war gewiss wünschenswert, aber es wäre auch zu empfehlen gewesen, einige Tage für die Verbesserung der Unterkünfte zu verwenden. Die Leute waren zum großen Teil in Scheuern mit Flechtwerkwänden untergebracht und froren in den kalten Nächten, dass sie früh beim Ausmarsch kaum aus den Augen sehen konnten. Mein Quartier war in einer kleinen zweifenstrigen Bauernstube, die ich mit noch neun Leuten teilte. Wenn ich abends nach Hause kam, so brauchte es immer einige Zeit, bis ich mich an die Luft so vieler ungewaschener Menschen gewöhnt hatte, denn mit unserer Reinlichkeit war es übel bestellt. Noch ärger war es in der Küche, wo der polnische Bauer mit der ganzen Familie – es waren wohl 10 Personen – hauste. Die Unterkünfte hätten viel weniger belegt sein können, wenn sich die höheren Herren an die Quartierausteilung gehalten hätten. Der Hauptmann Proviantoffizier, der Feldkurat und der Regimentsarzt nisteten sich in den mir zugewiesenen Ortsteil ein und nahmen die besten Unterkunftsräume für sich und ihre Leute in Anspruch, weil ihnen die für sie bestimmten Quartiere nicht passten. Sie lagen zu weit weg von der Menage, und damals hatten die genannten Herren wirklich nichts zu tun. Wenn man auf sein Recht besteht, so zieht man gewiss später einmal den Kürzeren. Denn die Pfade, die die Intrigen wandeln, sind für den Harmlosen und Ungeübten nicht auffindbar. Dreimal wehe dem, der nicht zur Clique gehört und sich aufbäumt. Er und seine Leute bekommen es zu fühlen. Eigenartig war auch mein Verhältnis zu meinem unmittelbaren Vorgesetzten. Ohne besonderen Anlass gab es da manchmal Schimpfereien, dass man sich fragen musste, ob man überhaupt im Kriege sei. Oft hat es den Anschein, als ob der Baonskommandant keinen anderen Beruf hätte, als die eingerückten Reserveoffiziere zu quälen und ihnen zu zeigen, dass sie die unfähigsten Mitglieder des Heeres seien. Seite 29 von 80 Besonders auf den Landsturm hatte man es abgesehen. Oft schien eine Sache das Wohlgefallen der Vorgesetzten errungen zu haben; entdeckten sie aber beim näheren Zusehen, dass der Landsturm sie gemacht, fand man sofort Fehler über Fehler. Jeder Beobachter musste aber zugeben, dass im Schießen und Wachdienst sowie in der Aufklärung die Landsturmleute den Landwehrleuten bedeutend überlegen waren. Im Marschieren waren sie naturgemäß schwächer. Doch vor allem auch deswegen, weil sie getreulich alles mitschleppten, was vorgeschrieben war, während die jüngeren Leute mit federleichter Bürde daher kamen. Nicht geringe Aufregung gab es, als der Korpskommandant seinen Besuch ansagte. Am Tage vorher wurde probeweise die Paradeaufstellung bezogen. Hier waren die Entfernungen zwischen Abteilungen und Unterabteilungen mit Pflöcken ausgesteckt, gerade so wie im tiefsten Frieden bei der Kaiserparade in Dejwitz bei Prag. Da meine Leute meist stattliche Bärte trugen, musste ich dafür sorgen, dass alle geschoren wurden. Sie sollten jugendlicher aussehen. Warum man dem Korpskommandanten verheimlichen wollte, dass auch alte Männer dastanden, habe ich nicht begriffen, da er doch von der Zuweisung aufgeriebener Landsturmformationen zu Landwehrregimenten wissen musste bzw. sollte. Am Paradetag rückten wir im Morgengrauen aus und standen nun stundenlang in Reih und Glied, bis der Korpskommandant mit glänzendem Gefolge erschien. Eine Rede an das Regiment, Ansprache an die Offiziere, dann war es wieder vorbei und fröstelnd eilten wir den Quartieren zu. Die Gelegenheit wäre sehr günstig gewesen, die Leute seelisch über den Alltag zu erheben; es geschah aber nicht. Dafür fehlt es bei uns am Verständnis. Während wir in Probolowice lagen, wurde auch eine Hinrichtung von uns vollzogen. Ein Mann der 6. Kompanie war während des Feldzuges desertiert und nach geraumer Zeit wurde er aufgegriffen. Das Feldgericht verurteilte ihn zum Tode. Das Urteil wurde vom Gerichtsherren bestätigt. Beim eigenen Regimente sollte es vollzogen werden. Der Verurteilte wurde nach Probolowice gebracht, um 11 Uhr vormittags wurde ihm das Urteil verlesen und um 12 Uhr erfolgte in althergebrachter Weise die Hinrichtung. Die Kompanie, in der der Verurteilte gedient, führte ihn in langsamen Schritten zum Richtplatz, wo inzwischen die anderen Kompanien Aufstellung genommen hatten. Bevor der Zug mit dem Verurteilten zum Richtplatz marschierte, wurde dem Regimente in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache das Verbrechen Seite 30 von 80 geschildert. Auch Abordnungen aller anderen Regimente der Division waren dabei anwesend. Ich stand mit meiner Kompanie gerade beim Richtplatz. Die Kompanie mit dem Verurteilten kam nun heran und bildete ein Viereck, in dem der Verurteilte, der Auditor, der Exekutionskommandant, der Feldkurat und die acht für die Vollziehung der Hinrichtung bestimmten Männer standen. Der Auditor verlas das Urteil, hierauf wurde das Viereck auf einer Seite geöffnet und dem Verurteilten wurden die Augen verbunden. Ein Säbelwink, vier Männer legten an, dann das Kommando „Feuer“ und der Verurteilte war nicht mehr. Der Arzt stellte den eingetretenen Tod fest und das Regiment rückte wieder ab. Bis Sonnenuntergang blieb der Gerichtete liegen. Dann wurde er an derselben Stelle begraben. Durch einige Tage lag auf gar Manchem ein schwerer Druck; eine solche Wirkung hatte die Hinrichtung hinterlassen. Lichtblicke waren in dieser Zeit die Weihnachtskistln, die in stattlicher Anzahl nach Probolowice kamen. Mit solch freudiger Erregung wurden wohl, wenn wir von den frühesten Kinderjahren absehen, selten Geschenke ausgepackt und genossen, wie damals. In die Augen eines jeden, den ein Kistl erfreute, kam ein stilles Leuchten. Der Krieg hat in vielen Fällen die Beziehungen in den einzelnen Familien verinnerlicht und die Anhänglichkeit der Männer an die Familie vertieft. Während das Exerzieren Verdrossenheit erzeugte, waren die Scharfschießübungen allen sehr lieb. Mir insbesondere deswegen, weil ich da selbständig war und mit dem Baonsverbande nichts zu tun hatte. Dann ging der Marsch durch wunderschönen Fichtenwald und jedes Mal freute ich mich, wenn ich an der Spitze der Kompanie reitend zwischen den ersten Baumstämmen verschwunden war und nun einige Stunden die Freiheit genießen konnte. Hin und wieder wurden auch große Märsche unternommen. Im Morgengrauen rückten wir ab und den Rückmarsch machten wir über Bergeshöhen, in der Regel so, dass uns die russischen Beobachter - die Schützenlinie war 7000 m von Probolowice entfernt - sehen mussten. Sie haben dann regelmäßig Verstärkungen gemeldet und dadurch Unsicherheit in ihre eigenen Maßnahmen gebracht. Vorausgesetzt, dass sie nicht besser von den Einheimischen, mit denen sie in vielen Fällen in enger Fühlung blieben, unterrichtet Seite 31 von 80 wurden. Einmal zeigte sich das Regiment auf einer Höhe an einem Tage sogar zweimal, den Russen so die Ankunft einer neuen Brigade vortäuschend. Die gesundheitlichen Verhältnisse während des Aufenthaltes in Probolowice waren nicht günstig, da wir zahlreiche Typhusfälle zu verzeichnen hatten. Besonders die 2. Kompanie wurde arg heimgesucht. Die Gründe für die Erkrankung der Leute waren jedenfalls vor allem in der sehr ungünstigen Bequartierung zu suchen. Sie lagen eng zusammengedrängt in zugigen Scheuern, und es fehlte eine entsprechende Waschgelegenheit, die sehr leicht zu beschaffen gewesen wäre. In unmittelbarer Nähe lagen einige kleine Dörfer, die keine Garnison hatten. Hätte man das Baon auseinandergezogen, so wäre es ein Leichtes gewesen, alle Leute in Stuben unterzubringen. Warum man das nicht getan hat, ist sehr schwer zu sagen. Ich vermute aber, man wollte einzelne Kompanien nicht selbständig machen. Sie hätten sich ohne das Sekkieren durch den Baonskommandanden zu wohl fühlen und sich wirklich erholen können. Wegen der Schlagfertigkeit war das Zusammendrängen nicht notwendig, da ja überall durch entsprechende telefonische Verbindung für sofortige Übermittlung der Befehle gesorgt werden konnte. Wäre die Unterstützung der vorn liegenden Schwarmlinien einmal notwendig gewesen, so wären die einzelnen Kompanien gewiss allein marschierend rascher vorwärts gekommen, als die Baons- bzw. Regimentskolonne. Am 5. Feber gab es Alarm. Ich rückte mit meinen Leute ab und war der Erste auf dem Alarmplatz. Lange standen wir da, bis die anderen Kompanien eintrafen. Wir waren halt doch die besseren Soldaten. Der Marsch war nicht weit. Mittags brachen wir auf und vor Einbruch der Dämmerung waren wir in Kolosy, wo wir in Paradeaufstellung übergingen und eine Rede unseres neuen Brigadiers, eines Polen, über uns ergehen lassen mussten. Es war bitterkalt, aber die Paradeaufstellung war sicher notwendig. Mich fror so an die Schwerthand, dass mir der Säbel fast aus den Fingern geglitten wäre, denn lange mussten wir habtacht stehen. Nachdem der Brigadier die Rede an die Mannschaften beendet hatte, rief er die Offiziere vor, um ihnen in einem etwas anderen Tone dasselbe noch einmal zu sagen. Für seine Persönlichkeit ist es bezeichnend, dass er das Säbelsalut von den Offizieren wiederholen ließ, da es das erste Mal nicht klappte. Seine Worte waren kalt und gefühllos, abweisend und unnahbar stolz der ganze Mann. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen, trotzdem wir fast 3 Monate Seite 32 von 80 unter seinem Befehl im Schützengraben lagen. Schließlich gab es noch einen Vorbeimarsch, und dann durften wir in den Schützengraben abrücken. Meinem Baon war der Abschnitt bei Kuchary zugewiesen. Der Baonskommandant, ein aktiver Hauptmann, der sich die Stellung schon besehen hatte, führte und führte uns auf einem endlosen Umwege. An der Spitze ohne Gepäck gehend, schlug er eine rasche Gangart ein und die Folge davon war, dass das Baon – es war eine sehr finstere Nacht – bald zerrissen war. Ich bat ihn mehrmals langsamer zu marschieren, immer vergeblich. Schließlich wurde er so saugrob, dass ich es mir allmählich abgewöhnte, Vorschläge zu machen, die die Erhöhung der Schlagfertigkeit der Truppe zum Zwecke hatten. Denn jede von mir gegebene Anregung hatte immer die nicht erwünschte Folge. Nach langem Umherirren kamen wir endlich an Ort und Stelle. Ich bezog mit meiner Kompanie die in einem Hohlweg untergebrachte Baonsreservestellung. Aber schon in der nächsten Nacht wurde ich zwischen die 2. und 3. Kompanie eingeschoben, da die Schützenlinie zu dünn war. Die Stellungen, vor uns lag ein polnisches Regiment da, waren entsetzlich verlaust und furchtbar vernachlässigt. Mein Unterstand war ein Erdloch, in das ich auf allen Vieren kriechen musste und in dem ich gerade noch sitzen konnte. Ich teilte den Raum mit meinem Diener, der bekam am zweiten Tag ein merkwürdiges Aussehen, wurde bald nachher vom Fieber gepackt und musste schließlich weggetragen werden. Ich hörte, dass ihn ein schwerer Typhusanfall niedergeworfen hatte. Da wartete ich nun während der Dauer der Inkubationszeit der Typhuserreger geduldig, bis auch bei mir die Krankheit zum Ausbruch kommen würde, da ich fest davon überzeugt war, ich müsse unbedingt auch angesteckt sein, da es in dem engen Erdloch ja nicht anders möglich war. Merkwürdiger Weise war ich nicht gerade unruhig und aufgeregt, sondern es lag nur eine stille Resignation über mir, die von dem Gedanken getragen wurde, dass es nicht gerade rühmlich sei, einen Teil des Feldzuges auf dem Typhuslager zu verbringen. Wider Erwarten blieb ich gesund. Acht Tage blieben wir an dieser Stelle und hatten alle Hände voll zu tun, um den Graben halbwegs widerstandsfähig zu machen. Allzu tief konnten wir nicht gehen, da wir bald auf Grundwasser stießen. Feuer bekamen wir selten. Nur hin und wieder eine Salve leichter Granaten oder Schrapnellen. Nachts stand ich fast ununterbrochen im Graben, da sowohl auf unserer als auch auf der russischen Seite reger Patrouillenverkehr war. Seite 33 von 80 In den ersten Morgenstunden kam der gut geruht habende Baonskommandant und fluchte und wetterte, dass es ein Graus war, weil die Leute ausruhten. Das musste aber so sein, da sie doch die ganze Nacht wach waren. Sehr oft hatte er auch die Pistole in der Hand und fuchtelte damit herum. Der Mann trank gern und viel. Solche Dinge sollte man in Kriegszeiten nicht dulden. Seine Vorgesetzten wussten davon. Da er aber vom Schreien bald wieder Durst bekam, verschwand er rasch wieder, um in seinem Unterstand mit den Weinflaschen zu exerzieren. Als ich an einem Morgen den letzten Gang durch den Graben machte, gerade als es anfing grau zu werden, hatten die Leute inzwischen einen Baumstamm kerzengerade aufgerichtet. Er guckte wie ein Zeigefinger aus dem Graben heraus und bot der russischen Artillerie ein bequemes Ziel. Ich rief sofort: „Baumstamm umwerfen!“ Kaum lag er im Graben, da kamen auch schon vier Granaten und wühlten sich 80 Schritte vor dem Graben in den Sumpfboden. Die späteren Salven gingen unschädlich über uns hinweg, da es in der flachen Wiese dem Artilleriebeobachter nicht möglich war, festzustellen, ob die Geschosse den Graben treffen. Diese Episode erhöhte mein Ansehen bei den Leuten in erheblichem Maße. „Pan Oberleutnant osceko vi“ sagten sie nachher oft. In dieser Stellung sah ich auch den neu ernannten Regimentskommandanten zum ersten Male. Er kam aus irgendeiner Kanzlei in Wien und musste notgedrungen in den Schützengraben, um das Regiment zu sehen. Tadelnd ging er durch meinen Abschnitt, fragte belanglose Dinge. Gesundheit, Verpflegung usw. schienen ihn gar nicht zu interessieren. Er erkundigte sich nur von Zeit zu Zeit, ob Feuer zu erwarten sei und ob der Weg bis zum nächsten Dorfe gedeckt zurückgelegt werden könne. Dann verschwand er, und ich hatte ihn in der vorderen Linie zum ersten und letzten Mal gesehen. Am 13. Feber wurden wir von einem anderen Baon des Regimentes abgelöst und kamen als Regimentsreserve nach Kolosy, einem Drecknest sondergleichen. Der Ort besteht aus einer Ziegelei, einem Meierhof und einer Reihe kleiner Bauernhütten. Die Wege zum Dorf und im Dorf waren grundlos. Auf der Dorfstraße steckte ich plötzlich in einem Morastloch bis über die Knie und nur mit Unterstützung konnte ich mich aus dem zähfließenden Schlamme herausarbeiten. Kaum waren wir angekommen, erhielten wir strenge Befehle für die Ausbildung der Mannschaft. Ich dachte, es wäre besser, zuerst einmal die elenden Unterkünfte der Mannschaften zu verbessern, die zum großen Teil in Scheuern lagen, deren Wände Seite 34 von 80 aus Weidengeflecht bestanden. Auch die Ausbesserung der Wege wäre von Vorteil gewesen. Die gegen Abend eintreffenden Verpflegsstaffeln blieben regelmäßig einige Male stecken und zwar mitten im Dorfe. Auch eine Bekämpfung der Läuseplage wäre eine dankbare Aufgabe gewesen. Aber Ausbildung war das Schlagwort. So rückten wir denn zum Üben aus. Mein Pferd vertrug den Sälbelgruß nicht, ich meldete daher die Zahl der ausgerückten Männer salutierend. Ein Wutanfall des Herren Baonskommandanten. Ich zog den Säbel und wie er dem Pferde bei den Ohren vorbeifuhr, wurde es toll und schmiss die ersten beiden Züge meiner Kompanie um. Da ich aber fest im Sattel blieb, war der Herr Kommandant enttäuscht, denn er wollte mich auf dem Boden liegen sehen. Dann gab es noch einmal Decken und Richten, denn der Regimentskommandant in höchsteigener Person kam, um die Ausbildung zu leiten. Erst hielt er mit dem Kompanie- und Zugkommandanten Schule, wie auf dem Exerzierplatze. Da wir alle schon eine sehr lange Felderfahrung hatten, er aber erst ins Feld gekommen war und naturgemäß auch seine Überlegenheit zeigen wollte, gab es scharfe Widersprüche zwischen Theorie und Praxis. Während der Belehrung und des nachher als Schulbeispiel durchgeführten Schwärmens mit einem Zuge, mussten wir zu Pferde auf einem Flecke halten. Mein Pferd war sehr unruhig und das hat mir manchen strafenden Blick eingetragen. Auch war beim Herrn Obersten die Meinung schon fertig, ich könne kein guter Soldat sein, da ich mein sechsjähriges Pferd nicht so beherrschte, wie er seinen ehrwürdigen Gruppengaul. Auf einem weiten Kornfeld übten wir Tag für Tag. Meine Bauern sah ich nur zögernd die Spaten gebrauchen. Es tat ihnen leid um das schöne Korn. Aber da gab es nichts. Nach wenigen Tagen war das Feld verwüstet, trotzdem ein A.O.K.-Befehl die Schonung der Felder befahl. Gelernt haben die Leute nichts, da bei ihnen allen die größte Verdrossenheit zu bemerken war. Gewundert hat mich das nicht. Freilich musste man manchmal ganz gehörig dreinfahren. Auch zur Beichte wurden die Kompanien geführt. Ein Teil meiner Leute erklärten, dass sie nicht zur Beichte gehen. Ich sah ein, dass man dazu niemanden zwingen könne und ließ sie natürlich zu Hause. Dagegen wurde zwar nichts getan, aber angeordnet, dass diese Leute am dienstfreien Kommunionstage zu exerzieren hätten. Warum? Seite 35 von 80 Doch zu diesem Exerzieren kam es nicht. Einige Minuten vor zwölf gab es Alarm. Wir wurden nach Süden verschoben. Stunde um Stunde verrann, und wir marschierten am späten Mittag immer noch gegen Süden. Wir nahmen an, dass wir auf einen anderen Kriegsschauplatz verlegt werden sollten. In Bojsce machten wir endlich Halt. Es war inzwischen trüb und feucht geworden und fröstelnd lagen wir an der Straße. Die Rast dauerte ungewöhnlich lange. Als wir endlich aufbrachen, marschierten wir denselben Weg wieder nach Norden. Wir waren nach Zaporzice bestimmt, dass von unserem Ausgangspunkt soweit nördlich lag, als wir eben nach Süden gezogen waren. Der Stab der Division hatte uns falsch instruiert. Da quälten sich denn vier Baone auf miserablen Wegen ab, wegen eines Fehlers, den ein junger Offizier des Stabes gemacht hatte. Allzu anstrengend kann in dieser Zeit des Stellungskrieges seine Tätigkeit nicht gewesen sein. Ob er auch, wie ich, in Koczubow einen Verweis bekommen haben mag? Schlimm wird es nicht gewesen sein, denn unser Baonskommandant, der während der Rast in Bejsce beim Divisionsstab gespeist hatte, brachte nur die neuesten Witze und einen Schwips mit. Da bald ermüdeten die Leute, und der Marsch wurde zur Quälerei, die durch den Mangel jeglicher Marschdisziplin ins Unerträgliche wuchs. Niemals erfuhr man die Dauer der Rasten. Hatte man aus gewissen Anzeichen auf eine lange Rast geschlossen und daher das Verabreichen von Kaffee angeordnet, so konnte man sicher sein, dass mitten in der Verteilung der Abmarschbefehl kam. Oder es wurden fünf Minuten Rast angesagt, und aus diesen fünf Minuten wurde eine Stunde, dagegen eine angeblich lange Rast schon nach wenigen Minuten abgebrochen. Die Marschkolonne sah daher furchtbar aus. Aller guter Wille, der noch vorhanden war, wurde durch die Kopflosigkeit des Baonskommandanten wie weggeblasen. Früh um vier Uhr rückte ich mit einigen Leuten in Zaporzice ein. Kaum hatten wir uns dort niedergelegt, kam neuerlicher Alarm; sofortiger Abmarsch nach Probolowice. Nach 36stündigem Gesamtmarsch kamen wir dort an. Hätten wir sofort den richtigen Befehl erhalten, wäre es ein Spaziergang von zwei Stunden gewesen. Im Verlaufe des nächsten Tages fanden sich alle Nachzügler ein, und die Kompanie war wieder vollzählig. Fünf Tage blieb nun das Baon allein in Probolowice. Es war verhältnismäßig gemütlich. Vormittags gingen wir exerzieren, nachmittags wurde Holz geholt und ähnliches mehr. Seite 36 von 80 Am 25. Feber nachts verließen wir Probolowice, um wieder in Stellung zu gehen. Das Baon kam in die Gräben bei Jurkow. Hier hatte ich Glück. Ich bekam einen Abschnitt von großer landschaftlicher Schönheit und konnte mich seiner über einen Monat – vom 25. Feber bis 26. März – erfreuen. Die Behaglichkeit wurde noch dadurch erhöht, dass ein neuer Baonskommandant uns von dem alten erlöste, der sich nun mit einem Kompaniekommando begnügen musste. Trotzdem bereitete er uns fortwährend Unannehmlichkeiten, da er in der Trunkenheit die merkwürdigsten Dummheiten machte. Der Ordnung hat er sehr viel geschadet. Wie viel guten Willen er gemordet hat, lässt sich gar nicht abschätzen. Auf meine Leute und mich hatte er es besonders scharf. Fortwährend schnüffelte er in meinem Graben. Alle Beobachtungen trug er entstellt dem Baonskommandanten zu, der nach einigen Wochen soweit bearbeitet war, dass er seine ursprünglich gute objektive Meinung verlor und durch die Brille des ehemaligen Baonskommandanten sah. Am meisten quälte man mich mit der Frage, ob meine Mannschaft, mit geringen Ausnahmen Tschechen, verlässlich sei. Während der hinter uns liegenden Feldzugsmonate hatten tschechische Truppenteile sehr oft versagt und waren mehr als einmal in hellen Haufen zu Mütterchen Russland übergelaufen. Es wurde daher eine strenge Beobachtung aller tschechischen Truppenteile angeordnet und überall nach Spuren gesucht, die auf ein Einverständnis mit dem Feinde schließen ließen. So wurden z.B. die Logblätter mehrmals genau untersucht, da es sich herausgestellt hatte, dass tschechische Soldaten geheime Zeichen auf der Rückseite hatten. Der Besitzer eines mit solchen Zeichen versehenen Logblattes fand in Falle der Gefangennahme brüderliche Aufnahme. Das Bewusstsein, an der Spitze einer Kompanie zu stehen, der man von vornherein mit berechtigtem Misstrauen begegnete, war sehr lästig und bereitete mir viele ruhelose Wochen und überbürdete mich mit Arbeit. Um sicher zu gehen, habe ich alles, was man sonst dem Zugskommandanten und Chargen überläßt, Tag für Tag mehrmals kontrolliert, jede Feldwache, Patrouille und dergleichen besucht und beobachtet und so während mehrerer Monate eine unglaubliche Menge aufreibender Arbeit geleistet. Ich gewann die Überzeugung, dass meine Leute zuverlässig sind und nur einer normalen Beaufsichtigung bedürfen. Freilich fehlte ihnen der soldatische Schwung. Sie taten klaglos ihre Pflicht, aber damit war es auch genug. Oft und oft wurde ich nun von meinen Vorgesetzten darüber befragt und begegnete immer misstrauischen Blicken, wenn ich erklärte, ich könne den Leuten keinen Vorwurf machen. Da hieß es immer, ich nähme sie zu sehr in Schutz. Man hätte mich gern als Handhabe benutzt, um ein Exempel zu statuieren. Denn wenn von hoher Seite eine Meinung geäußert wird, dann hat eben der Niedere sofort Beweise für die Richtigkeit dieser Meinung beizubringen, wenn er Seite 37 von 80 nicht den Verdacht der Lässigkeit auf sich lenken will. Ich blieb aber trotz vieler Rekriminationen fest, und gehörte daher bald zu den missliebigen Offizieren. Die Ereignisse haben aber mir Recht gegeben. Die Kompanie hat sich bestens gehalten, keinen Gefangenen verloren und war während der Maioffensive entschieden tüchtiger, als die polnischen Kompanien. In den Gefechten östlich des Dunajec erwiesen sie sich sogar als draufgängerisch. Wie mich der Regimentskommandant beurteilte, geht aus folgender Episode hervor. Einige Tage vor Beginn der Maioffensive wurde wieder einmal ausführlich über meine Kompanie verhandelt. Da hatte nun der Regimentskommandant des Rätsels Lösung gefunden. Er meinte, den Schutz, den ich der Kompanie angedeihen lasse, sei zu erklären durch meine Nationalität. Ich sei ein verkappter Tscheche und das seien die Gefährlichsten. Der Baonskommandant hielt dem entgegen, dass ich ja gar nicht tschechisch spreche und ein alter Prager Student sei, über dessen Nationalität man wirklich nicht den geringsten Zweifel hegen könne. Der Regimentskommandant blieb aber bei seiner Meinung und ließ mir schließlich durch den Baonskommandanten sagen, ich möge den Leuten in ihrer Muttersprache zureden und ihnen zu Herzen sprechen, auf dass sie in den kommenden schweren Kämpfen ihren Mann stellen. Das war nun freilich ein Auftrag, den ich nicht ausführen konnte. Ich habe den Leuten nicht zugeredet, sondern gezeigt, wie man im Gefechte draufgeht; und so erwiesen sie sich als tapfere Männer, so dass sie Kompanie bald auf ein kleines Häuflein zusammengeschmolzen war. Doch nun zurück zum Schützengraben bei Jurkow. Ich habe schon erwähnt, dass er in einer wunderschönen Landschaft lag. Vor mir schlängelte sich träge die Nida, auf beiden Seiten von Sumpf und nassen Wiesen umsäumt. Diese stiegen auf beiden Seiten allmählich zu kleinen Bodenwellen an, auf der ersten des rechten Ufers lag ich mit meiner Kompanie, rechts schloss das zweite Baon an, links von mir war die zweite Kompanie. Der linke Flügel meiner Kompanie begann auf einem Hügel, der hochstämmige Buchen trug. Von da zog sich der Schützengraben durch eine sumpfige Wiese, im weiteren Verlaufe um eine kleine, mit Nadelholz bestandene Kuppe, stieg von da auf eine trockene Lehne hinauf, wo er die Verbindung mit dem zweiten Baon hatte. Er war über einen Kilometer lang. Zur Besetzung hatte ich 160 Gewehre. Als wir die Stellung bezogen, war sie in sehr verwahrlostem Zustande. Die Grabensohle war nicht tief genug, der Kopfschutz mangelhaft, die Schießscharten Seite 38 von 80 nicht gebrauchsfähig und das Drahthindernis wackelig und schief. Auch fehlten Flankierungsanlagen und gedeckte Zugänge zu den Unterständen. Da gab es nun Arbeit in schwerer Fülle, und ich spannte meine Leute ganz gehörig ein. Freilich war ich Tag und Nacht auf den Beinen. Einmal tauchte ich da auf, um nach dem Rechten zu sehen und bald wieder am anderen Ende. Ich will nun einmal versuchen, alle die Arbeiten kurz aufzuzählen, die ein Kompaniekommandant während 24 Stunden leisten muss. Mit dem Sinken der Sonne beginne ich, weil da der schwerere Teil der Arbeit anhebt. Mit dem Einbruch der Dämmerung müssen die Horchposten und Feldwachen aufziehen. Dies fordert den ersten Gang durch den Graben, denn es muss nicht nur vom Kompaniekommandanten festgestellt werden, ob die erwähnten Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind, sondern er muss sich auch überzeugen, ob alle Gewehre gebrauchsfertig in der Schießscharte liegen, ob jeder Mann 300 Patronen bei der Hand hat und ob die Munitionskisten für die einzelnen Züge leicht erreichbar so lagern, dass sie gegen Artillerietreffer gesichert sind. Die für den Handgranatenkampf bestimmten Leute müssen auf ihre Ausrüstung untersucht und den Beleuchtungsmännern nochmals ihre Pflichten klargelegt werden. Dann erfolgt noch die Belehrung der einzelnen Züge über die eigenen Vorfelduntersuchungen und über ähnliche Pläne der Nachbarkompanien, um in finsteren Nächten das Anschießen eigener Leute tunlichst zu verhüten. Nach der Erledigung aller dieser Geschäfte erfolgt die Rückkehr in den Unterstand, wo schon die Baons - Ordonanz mit dem Befehl wartet. Der bringt, wenn nichts Besonderes vorliegt, mindestens einige Tabellen zur Ausfüllung oder fordert die schriftliche Beantwortung etlicher Fragen. Inzwischen ist es vollständig Nacht geworden und die Küchen können sich ungesehen vom Feinde heranpirschen. Die Verteilung der Menage muss besonders scharf beaufsichtigt werden, denn während dieser Zeit darf kein Nachlassen der Wachsamkeit eintreten. Ist doch die erste Nachstunde, die Stunde nach Mitternacht und die vor Tagesanbruch die Zeit, in der feindliche Unternehmungen am wahrscheinlichsten sind. Als Letzter habe ich mich dann über‘s Essen gemacht. Während der Nacht musste befehlsgemäß der Kompaniekommandant viermal durch seine Stellung wandern. Jeder dieser Gänge forderte gegen eine Stunde. Bei schlechtem Wetter oder während finsterer Nächte noch mehr. In den zwischen diesen Gängen liegenden Rastzeiten kamen noch oft verschiedene Meldungen über besondere Ereignisse, denn jedes auffallende Geräusch, jedes verdächtige Licht und endlich auch Seite 39 von 80 Ahnungen, mussten mir gemeldet werden. Jede dieser Meldungen forderte wieder angestrengtes Beobachten, da der Kompaniekommandant die Entscheidung darüber zu treffen hat, ob die Wahrnehmungen weiter zu geben sind oder nicht. Unnötige und unbegründete Alarmmeldungen verzehren viel Kraft in unnützer Weise, da eine einzige Nachricht beunruhigenden Charakters einer ganzen Division die so wichtige Nachruhe rauben kann. Die ersten Wochen der Schützengrabentätigkeit überhaupt sind natürlich oft von qualvoller Ungewissheit erfüllt, da man die Stimme der Nacht noch nicht verstehen lernte. Gar bald gewinnt man aber die Sicherheit des Jägers und weiß aus dem Blaffen der Hunde und aus dem Aufscheuchen von Wild und Vögeln, mit großer Sicherheit die richtigen Schlüsse zu ziehen. Allerdings gehört dazu eine gewisse Veranlagung und mancher lernt‘s nie. Ich war bald soweit, dass ich aus der Art des Bellens der Hunde auf der russischen Seite genau beurteilen konnte, ob Bewegungen alltäglicher Art, wie der Marsch der Küchen usw. stattfinden oder ob Verstärkungen herangezogen werden. So lag als sicherer Wächter vor meiner Stellung ein kleines Wäldchen, das nachts ungezählten Krähen als Ruheplatz diente. Kam in diese auffallende Unruhe, so konnte man sicher sein, dass die Russen versuchen, vorzufühlen. Besonders unruhig wurde so eine Schützengrabennacht, wenn die feindliche Artillerie zu schießen begann. Ein Schauspiel von eigenartiger Macht und Schönheit. Weit, weit hinter dem russischen Schützengraben fliegen plötzlich an verschiedenen Stellen je vier Flammengarben zum Himmel - die Mündungsfeuer der Geschütze, und bald vernahm man das Geheul und Gezische der herannahenden Geschosse. Der Ton, den sie auf ihrem Fluge erzeugten, ließ ganz treffende Schlüsse auf Kaliber und Geschossart zu. Auch erkannte man, wenn sie auf ihrer Reise bis in unsere Nähe gekommen waren, ob sie bei uns einschlagen oder unschädlich vor oder hinter dem Graben niedergehen oder platzen werden. Da rasselte nun sehr bald das Telefon hinein. Regiment, Brigade usw. verlangten einen Situationsbericht um den anderen. Wir hatten uns sehr rasch an solche nächtliche Feuerüberfälle gewöhnt. Ganz gemütlich warteten wir in der Nähe der Gewehre, ob der Artilleriebeschießung ein Infanterieangriff folgen werde. Beschrieben und gesagt sind solche Dinge sehr leicht und schnell, aber was es heißt, in einer solchen Nacht mit zum Reißen gespannten Nerven nach vorn zu lugen, ob Infanteriemassen durch die Nacht daher kommen, während in der Nähe des Grabens schwere Granaten tiefe Löcher reisen und die Sprengstücke der Seite 40 von 80 Schrapnells fortwährend klatschend niedergehen, das lässt sich wohl kaum sagen. Das kann der, der es nicht miterlebt, nur ahnen, aber vielleicht nicht verstehen und würdigen. Die Männer, die da wochenlang oder Monate hindurch vor dem Feinde liegen und täglich vom Tode umlauert werden, wachsen über sich selbst hinaus. Man möge nur daran denken – ich sehe da ein Beispiel aus meiner Kompanie vor Augen – wie sich ein armseliges Schreiberlein, das im Frieden vor jedem Stirnrunzeln des schmerbauchbewehrten Kanzleivorstandes zitterte, geändert haben muss, um im schwersten Feuer festen Schrittes als Gefechtsordonanz von Zug zu Zug zu gehen, ohne zu zagen und immer klare Auskünfte zu bringen. Eine Erlösung war es naturgemäß immer, wenn sich der erste rosige Streifen der aufgehenden Sonne im Osten zeigte. War es doch das Zeichen für den Beginn der behaglichen Tageszeit. Auf dem Zug genügte ein Posten zur Beobachtung und die anderen konnten ihre müden Glieder zur Ruhe strecken. Nicht so der Kompaniekommandant. Der musste jetzt den schriftlichen Frührapport ausfertigen. War der glücklich draußen, so gab es immer noch keine ungestörte Ruhe. Um sechs Uhr morgens, um halb elf und um halb drei mussten tagsüber telefonische Situationsmeldungen ans Regiment abgehen. Außerdem noch so oft, als sich Besonderes ereignete, z.B. acht Uhr morgens: Feindliches Gewehrfeuer auf dem rechten Flügel der Kompanie; neun Uhr: Auf der Straße nach X fünf Wagen mit Stroh; zwölf Uhr: Hinter dem Kirchhof des Ortes X Bewegung, anscheinend Batteriebau; ein Uhr: Einzelne Reiter auf dem Wege von Y nach Z; vier Uhr: Feuer am Südausgang des Dorfes N, bisher brennt eine Scheuer und ein Haus; - mit diesen Meldungen war es natürlich nicht abgetan, da immer eine Reihe von Anfragen erfolgten, die Genaueres erfahren wollten. Dazu kamen noch verschiedene Geschäfte anderer Art. Zum Beispiel: Es ist sofort zu melden, wie viele Schlosser die Kompanie hat. Es ist die Reserveportion zu kontrollieren und unter persönlicher Verantwortung des Kommandanten das Ergebnis zu melden. Die Kompanie hat sofort einen Pferdewärter nach X zu schicken, die Verbandspäckchen sind nachzuzählen. Es ist zu melden, wie viel Schuss die Kompanie am x-ten abgegeben hat, usw. Außerdem hatte jeder Kompaniekommandant jeden dritten Tag über den physischen und moralischen Zustand der Truppe zu melden. Da gab es natürlich oft Feuer auf dem Dach. Als ich das erste Mal meldete „moralischer Zustand“ gut, der „physische“ lässt größere Marschleistungen nicht zu, hätte man mich bald umgebracht. Es sollte unbedingt immer eine glänzende Meldung da sein. Wie sehr man mich auch Seite 41 von 80 drangsalierte, ich ließ mich nicht verleiten, etwas anderes als meine Überzeugung zu melden. Sogar den Brigadier und Divisionär führte man ins Treffen und mehr als einmal hat mir ein Baonskommandant gesagt, dass meine Meldungen sehr missfällig aufgenommen werden. Ich bin auch diesem Drucke nicht gewichen, hatte aber infolge dessen viel zu leiden. Auch auf die Kompanie war man nicht gut zu sprechen; doch war es die reine Wahrheit, dass sie zu hohen Marschleistungen nicht fähig waren. Allein als es darauf ankam, hat sie mit den berühmten, viel belobten anderen Kompanien mehr als Schritt gehalten. Die Berichte über diese waren immer schön aufgeputzt auf Kosten der Wahrheit. Mit den Rapporten über die Verpflegung war es ähnlich. In den Erlässen hieß es, der Kompaniekommandant hat genau über den Verpflegszustand zu melden, damit ein richtiges Bild entsteht und Mängel raschestens behoben werden können. In die Sprache des Regimentes übersetzt, hieß das ganz einfach: Alles muss in bester Verpflegsverfassung sein. Eine Zeitlang bekamen wir nur sehr wenig Fleisch, 35 Kilogramm für 200 Mann. Ich hatte damals eine MGA in Verpflegung. Da der Kompaniekommandant bei unzureichender Zufuhr im eigenen Wirkungskreise für Verpflegungsaufbesserung sorgen kann, nahm ich eine günstige Gelegenheit wahr und kaufte ein Schwein. Als das Schwein in der Monatsrechnung erschien, erklärte der Proviantoffizier, das Schwein werde nicht bezahlt. Ich meinte gleichmütig, dann würde ich es eben aus meiner Tasche bezahlen. Das erschien den Herren unerwartet zu kommen, da sie meinerseits auf ein demütiges Bitten gerechnet hatten. Am nächsten Tag schickte mir der Proviantoffizier einen Teil des Kaufpreises mit dem Bemerken, er habe nicht soviel Geld, um die Summe sofort in Gänze begleichen zu können. Ich sagte der Ordonanz, sie möge das Geld nur schön wieder mitnehmen, denn ich könne warten, bis ich den ganzen Betrag auf einmal erhalte. Tags darauf hatte ich den ganzen Betrag. Zugleich erschien ein Regimentsbefehl – ein schöner Satz. Ein Kompaniekommandant hat mit Umgehung der Proviantur und des Regimentskommandos Lebensmittel eingekauft. Das ist unstatthaft, denn ein solcher Einkauf ist an die vorherige Genehmigung des Regimentskommandos gebunden. Ausnahmsweise wird der Betrag refundiert. Im Wiederholungsfalle kann eine Refundierung nicht mehr stattfinden. Außerdem wird der betreffende Kompaniekommandant bestraft. Seite 42 von 80 Wie die Herren sich das vorstellen. In Greifnähe ist das Schwein. Das Regimentskommando zehn Kilometer weit. Bevor die Antwort da ist, haben andere Truppenteile das Schwein im Topf. Hinter meinem Schützengraben lagen viele hundert Zentner Speisekartoffeln in Kämmen aufbewahrt. Jede Nacht holten wir uns den Tagesbedarf. Warum haben die vielen beschäftigungslosen Fuhrwerke diese Kartoffeln nicht zur nächsten Bahnstation gebracht? Im Hinterlande war Not und bei uns verfaulten die Kartoffeln. Der Verlauf eines solchen Schützengrabentages brachte, wie ich im Vorstehenden ausgeführt, eine Unsumme von Arbeit und Ärger in Fülle. Und solche Tage reihten sich zu Wochen, die Wochen zu Monaten. Es ist merkwürdig, dass man das alles erträgt. Der Mangel an Schlaf ist wohl am empfindlichsten. Ich habe mich freilich durch große Mengen schwarzen Kaffees und starkes Rauchen aufreizen müssen, um immer, wenn es notwendig war, wach zu bleiben. Wenn man nicht ununterbrochen im Freien gewesen wäre, hätte das nicht unbedenkliche gesundheitliche Störungen bringen müssen. In dieser Stellung befiel mich auch das erste Unwohlsein während des Feldzuges. Ich wurde so merkwürdig matt, konnte mich oft nur mit Mühe durch den Graben schleppen und geriet auch bei der geringsten Bewegung in Schweiß. Am meisten spürte ich die Mattigkeit in der linken Körperhälfte. Auch bekam ich Schmerzen im linken Bein. Ich hielt mich aber aufrecht und tat meinen Dienst. Freilich kam ich dabei sehr herunter und das war so auffallend, dass mir der Kommandant eines anderen Baons, der öfter an meinem Unterstand vorüberging, einen Arzt schickte. Der untersuchte mich, zuckte dann mit den Achseln und meinte: Schützengrabenkrankheit. Ich erholte mich aber nach zehn Tagen und spürte bald nichts mehr von dieser Schwäche. Nie werde ich die wunderschönen Frühlingsnächte vergessen, die ich in dieser Stellung verleben durfte. Wenn der Mond schien, lag die ganze Landschaft so feierlich friedlich da, wie wenn gar kein Krieg wäre, denn das aufgeregte Gebell der Hunde auf der russischen Seite und das Krachen vereinzelter Schüsse vermochte den friedlichen Eindruck nicht zu verwischen. Krieg war nur dann, wenn die russische Artillerie Salven schoss und mindestens eine halbe Kompanie dazu die Begleitung mit rasselndem Schnellfeuer gab. Oft und oft zischten die feindlichen Gewehrgeschosse über unsere Köpfe, gar manchmal gab es Seite 43 von 80 einen Treffer durch die Schießscharten, aber daran war man so gewöhnt, dass man sich nicht einmal beim Anzünden der Zigarre stören ließ, wenn das charakteristische ssssss... scharf bei den Ohren vorbei ging. Am 26. März nachts wurden wir von einer Honvedabteilung abgelöst. Die war mit Weirndlgewehren ausgerüstet und hatte 80 Schuss für einen Mann. Kriegerisch waren die Leute gar nicht. Ein Oberleutnant der mich ablösenden Kompanie, dessen Brust das Millitärverdienstkreuz zierte, erkundigte sich sogar, ob man laden müsse. Die Ablösung war mit den größten Umständlichkeiten verbunden, und als ich abmarschieren wollte, bekam ich Befehl, noch da zu bleiben, um die neue Mannschaft in der ersten Nacht in alle Pflichten einzuführen. Erst am nächsten Tage ging ich zu meiner Kompanie zurück. Die ablösenden Offiziere (Madjaren) saßen in meinem Unterstand. Als ich ihnen den ganzen Dienstbetrieb erklärt hatte, hörte ich von ihnen – trotzdem alle gut Deutsch sprachen – kein deutsches Wort mehr, und ich saß unter ihnen wie auf einer fernen Insel. Ich war ja nur ein Schwabe. Vom 27. bis 30.3. waren wir in Kolosy in Reserve. Am 31. wurden wir einem anderen Landwehrregiment zugewiesen und marschierten nach Opatowice. Ich hatte natürlich die Vorhut und schlängelte mich glücklich bis ans Marschziel. Die Kompanien blieben in der letzten Deckung liegen und die Kommandanten gingen noch bei Tag vor, um die neuen Stellungen zu besichtigen. Da hatte uns auch bald die russische Artillerie und begleitete uns einen großen Teil des Weges mit Granaten, die oft so nahe kamen, dass wir mit Erde bespritzt wurden. Unbehaglich wurde es vor allem dann, wenn wir in einer Geschossgabel steckten. Es geschah aber nichts. In Opatowice musste man über die Straßen immer springen, da die Russen die Straßen beständig unter Feuer hielten. Die Stellung wurde besichtigt, nachts kam die Kompanie nach und bis zum 23. April sollten wir hier liegen bleiben. Opatowice liegt am linken Ufer der Weichsel gegenüber der Mündung des Dunajec, dessen rechtes Ufer damals in russischen Händen war. Die Lage unserer Stellung war von wunderbarem landschaftlichem Reiz. Die beiden mächtigen Ströme zu Füßen in einer abwechslungsreichen fruchtbaren Landschaft und fern im Süden grüßten die Karpaten. Das Wetter war gerade zu herrlich. Tag für Tag Sonnenschein, Seite 44 von 80 der uns die Glieder wieder gesund machte, da wir täglich viele Stunden lang auf dem erwärmten Sandboden lagen. Nur selten störte diese Idylle die russische Artillerie. Nachts freilich wurden unsere Stellungen unaufhörlich von der russischen Infanterie aus eingespannten Gewehren beschossen. Über der Tür meines Unterstandes klopften da die russischen Geschosse unaufhörlich in regelmäßigen Zwischenräumen. Ich war bald so daran gewöhnt, dass ich aufwachte, wenn einmal nicht geschossen wurde. Es ging mir so wie dem Müller, der von der stillliegenden Mühle aufgeweckt wird. Wenn auch diese Geschosse nur selten Schaden anrichteten, so erreichten sie doch insofern ihren Zweck, als sie zur ständigen Aufmerksamkeit zwangen und so Nervenkraft verzehrten. Man musste eben immer auf der Hut sein. Die Stellung wurde von uns sehr stark ausgebaut, mit stählernen Schutzschilden versehen, mit mehrfachen Drahthindernissen geschützt. Tretmienen, Stolperdrähte, Fußangeln und Schrapnellschirme kamen dazu. Eine Kompanie des Baons lag in Opatowice als Reserve. Im Anfang war das die 3. Kompanie. Nach zehn Tagen löste ich diese Kompanie ab und freute mich königlich auf ein wenig Ruhe. Aber nur einen Tag ließ man mich in der Stadt. Am zweiten wurde meine Unentbehrlichkeit im Schützengraben entdeckt und ich musste wieder zurückwandern, um dem Herrn Hauptmann der 3. Kompanie die Arbeitslast wieder abzunehmen. In dieser Stellung sah ich auch wieder einmal einen General. Der Divisionär ging die Gräben ab. Zufällig wurde nicht geschossen. Das Wetter war auch prachtvoll. Voll des Lobes über die gewonnenen Eindrücke und ganz entzückt über die angenehmen Stellungen verschwand seine Exzellenz nach wenigen Minuten. Ein Oberstleutnant seines Stabes, mit dem ich durch meinen Graben ging, meinte: „Ihr tut mir furchtbar leid. Ihr führt ja ein Hundeleben“. Als ich ihm sagte, dass ich nun schon bald ein halbes Jahr in den Gräben liege und noch die jetzige Stellung die beste sei, wollte er aus dem Wundern gar nicht herauskommen, da er meinte, das könne man ja gar nicht so lange aushalten. Ob er eine Ahnung gehabt hat, wie man uns zum Überfluss noch sekkierte? Der Schützengraben ist so recht geeignet, das Verweilen bei den abenteuerlichsten Gedanken zu begünstigen und gibt so den besten Boden für die unglaublichsten Seite 45 von 80 Gerüchte. Einmal ging auch ein seltsames Raunen durch meine Leute. Bald wusste ich auch das große Geheimnis. Wir waren für Belgien bestimmt und sollten sehr bald abgehen. Da wurden alle lebendiger, alle schwärmten von schönen Städten, behaglichen Quartieren, tadellosen Straßen und sündigen, reingewaschenen Weibern. Lange konnte ich nicht dahinter kommen, woher denn das Gerede seinen Anfang genommen. Endlich wusste ich‘s. Ein Pferdewärter bei einem Stab weit hinten hatte das Wunder erfunden. Dann wusste man wieder, wir seien nach Wien bestimmt und ähnliches mehr. Staunenswert war die Unermüdlichkeit, mit der solche Dinge immer wieder erfunden wurden und auch die Langmut, mit der sich die meisten immer wieder beschwatzen ließen. In die Zeit bei Opatowice fiel die Feier der Ostertage. Prachtvolles Wetter herrschte und die Friedenssehnsucht trieb die üppigsten Blüten. Alle wollten wissen, ein Waffenstillstand mit den Russen stehe unmittelbar bevor. Dann folge der Sonderfriede und dann geht es mit voller Kraft gegen Westen. In wenigen Wochen sollte Paris fallen und auch wir wollten da mittun. Freilich sollte es ganz anders kommen. Gewisse Anzeichen verrieten, dass etwas vorgehen werde. Die Zahl der hinter uns stehenden Batterien nahm beständig zu, doch schossen sie nicht. Auch sehr schwere Geschütze kamen in kurzen Abständen an, alles Heergerät wurde verbessert, die Stellungen noch mehr mit Hindernissen gespickt. Eine Arbeiterkompanie kam Nacht für Nacht und schaffte an Hindernissen, Schrapnellschirmen und Flankierungsanlagen. Von Zeit zu Zeit lebte auch das russische Artilleriefeuer wieder auf. Besonders die Stadt wurde häufig beschossen. Die Kirche hatte schwer zu leiden. Schwere Granaten hatten das Innere verwüstet. Eine war bis in ein Erbbegräbnis eingedrungen und hatte hier erst ihr Zerstörungswerk begonnen. Oft kamen auch Brandgranaten, die da und dort ein Haus einäscherten, aber nicht viel Unheil anrichteten, da die Luft immer still war und daher keine großen Brände entstanden. In der Nacht vom 22. auf den 23. April sollten wir von Opatowice Abschied nehmen, um in Ruhestellung zu gehen. Gleichzeitig fand eine Reorganisation des ganzen Regimentes statt, da ein starkes Marschbaon eingetroffen war und die Zahl der Feldbaone um eins vermehrt wurde. Seite 46 von 80 Es tat mir fast leid, von diesem schönen Fleckchen Erde scheiden zu müssen, das ich im prangenden Frühling unter freilich eigenartigen Verhältnissen so lange genießen durfte. Der Blick vom steilen linken Ufer der Weichsel gegenüber der Dunajecmündung reichte weit nach Süden bis zu den steil aufragenden Karpaten und ich kann mir nicht leicht ein schöneres Bild denken. Ich glaube, dieses Land habe ich trotz des Jammers, in dem wir manchmal steckten, lieb gewonnen und gar manchmal, wenn die Granaten in allzu bedrohliche Nähe kamen, da sagte ich mir, solltest Du lebend aus diesem Feuerloch herauskommen, dann musst Du einmal im Frieden all die Wege wieder wandern, die Dich während des Krieges als Soldaten gesehen haben. Die Ablösung erfolgte durch ein anderes Baon des eigenen Regimentes und wir tasteten uns in der Nacht nach Piotrkowice, wo wir sechs Tage sogenannte Ruhe genießen sollten. Ich verlor auch den bisherigen Baonskommandanten, da er ein anderes Baon übernahm. Von seinem Nachfolger will ich nichts erzählen. Es dürfte zwei Uhr morgens gewesen sein, als wir in den neuen Quartieren ankamen. Dann streckte ich mich nach langer Zeit wieder einmal in einem Bett zur Ruhe. Wir hatten noch nicht ausgeschlafen, als die Kompaniekommandanten den Befehl erhielten, sofort beim Oberst zu erscheinen. Ich meinte, er hat das Bedürfnis, uns zu begrüßen, da wir einen Monat im Verbande eines anderen Regimentes gewesen waren und treue Wacht an einem wichtigen Punkte des Grabens gehalten hatten. Ich hatte mich aber getäuscht. Er fragte kurz, ob alle mit der in der Nacht begonnenen Reorganisierung verbundenen Arbeiten vollendet seien und musste dabei hören, dass mir noch ein paar Küchenpferde fehlten, die von weither aus einem Depot kamen. Ich wusste aber, dass sie noch im Verlaufe des Vormittages eintreffen werden, früher konnten sie noch nicht da sein. Da meinte der Herr Oberst, das faule Leben im Schützengraben sei nun vorbei und man müsse auch einmal sich um etwas kümmern. Die Stellung, die ich einen Monat inne hatte, hat er nie gesehen. Er wusste nichts davon, dass wir Tag täglich an dem Ausbau ruhelos geschafft hatten, und dass einmal ein Wolkenbruch unser ganzes Grabensystem unter Wasser gesetzt und sehr viel Arbeit gebracht hatte. Ich musste natürlich schweigen. Ein Beispiel dafür, wie von mancher Seite die Berufsfreude gefördert wird. Er ließ uns bald ungnädig abtreten und die Tage der Rast wurden mit Übungsmärschen ausgefüllt. Einer war so anstrengend, dass der größte Teil der Mannschaft liegen blieb. Man nahm gar keine Rücksicht darauf, dass das monatelange ununterbrochene Hocken Seite 47 von 80 im Schützengraben die Marschfähigkeit untergräbt und jagte bei starker Hitze die Leute zu Übungszwecken bis ans Ende der Kraft. Dass daran aber wieder die Kompaniekommandanten Schuld waren, liegt auf der Hand. Einmal alarmierte uns auch der Baonskommandant in der Nacht. Das Baon stand mit Ross und Wagen gerüstet auf der Dorfstraße und er torkelte von Kompanie zu Kompanie und hielt Reden, die den guten Geist heben sollten. Bei seinem Zustande erreichte er das Gegenteil. Am vorletzten Rasttage besuchte uns der Divisionär. Eine reich gedeckte Tafel erwartete ihn, und ich sah da feine Speisen, köstliche Weine und kostbare Zigarren. Da wurde nun getafelt und schließlich hielt der Divisionär eine Rede über die großen Aufgaben, die uns bevorstehen und nahm Abschied von uns. Besonders eindrucksvoll war die Geschichte nicht. Ich dachte merkwürdiger Weise immer mit einer gewissen Befriedigung daran, dass ich nun wusste, welchen Zweck die 30 Kronen hatten, die jedem Offizier von der Monatsgage abgezogen wurden. Der Stab wurde in die Lage versetzt, Gäste gut zu bewirten. Wir saßen derweil fast immer im Graben, tranken Fusel und Etappensäure und die weiter hinten ergötzten sich an Flaschenweinen, Schnäpsen und dergleichen. Es hat mich da ordentlich geschüttelt. Die Tage in dieser Ruhestellung wurden durch die Übungsmärsche nicht zu Erholungstagen, sondern die Abspannung der Leute wurde nur noch gesteigert. Am 28. kam der Marschbefehl; am folgenden Morgen brachen wir auf und marschierten nach Galizien. Auf allen Wegen und Stegen war wimmelnde Bewegung. Auch sehr viele Flieger ließen sich sehen und hören. Der Marschtag war wunderschön. Ich ritt seelenvergnügt an der Spitze meiner Kompanie. Nach wenigen Stunden hatten wir die Weichsel erreicht, die wir auf einer Kriegsbrücke überschritten. Wir waren wieder im altösterreichischen Gebiet. Im nächsten Dorf, am rechten Weichselufer, in Wola Przemikodka wurde Rast gemacht. Ich hatte Glück und bekam bei einem sauberen Kaufmann ein freundliches Zimmer, das ich allein bewohnte. Nach vielen Monaten war ich endlich wieder einmal Herr innerhalb meiner vier Wände. Die sogenannte Rast wurde durch gründliche Überprüfung der gesamten Ausrüstung abwechslungsreicher gemacht. Freilich gab es auch wieder Ärger über Ärger nach oben und nach unten. Seite 48 von 80 Am zweiten Tage des Aufenthaltes marschierten wir in ein benachbartes Dorf, wo auf einem Platze Pontons aufgestellt waren. Da wurde nun fleißig das Ein- und Aussteigen geübt. 17 Mann hatten in einem Ponton Platz. Jetzt wusste auch jeder, was der geheimnisvolle Marsch nach Galizien zu bedeuten hatte. Wir waren unter den Truppen, die den Dunajec überschreiten sollten. Diese Übungen am Ponton waren bald beendigt und wir zogen wieder nach Hause und legten uns den anderen Teil des Tages in die Sonne. Im Verlauf des Nachmittags bekamen die Kompaniekommandanten den Gefechtsbefehl. Nach Eintritt der Dämmerung des ersten Maitages sollten wir unter Vermeidung jedes unnützen Geräusches zum linken Ufer des Dunajec ziehen und uns an einer bestimmten Stelle des Dammes bereitstellen. Der Weg war nicht weit. Jeder wusste, es gibt einen schweren Tag. Und so gingen die meisten noch einmal im Geiste durch all die schönen Tage, die ihnen die Vergangenheit beschert hatte. Auf allen Feldwegen und Fußpfaden wälzte es sich gegen Osten dem Dunajec zu. Gesprochen wurde hin und wieder ein heiseres Wort oder manchmal war ein unterdrückter Fluch zu hören, wenn einer stolperte und fiel. Oft gab es Stockungen, Kolonnen gerieten in- und durcheinander, aber immer wieder gelang die Entwirrung. Als wir nur noch zwei Kilometer vom Dunajecdamm entfernt waren, bekamen wir die weitgehenden Infanteriegeschosse zu spüren. Verletzt wurde niemand. Zwischen elf und zwölf Uhr war mein Baon an der Überschiffungsstelle angekommen. Wir drückten uns an den Damm, denn das Feuer wurde immer lebhafter. Da und dort schrie ein Unvorsichtiger auf, denn das Schicksal hatte ihn erreicht. Am Grunde des Dammes hatten die Pioniere einen Gang gegraben, durch den sollten wir auf ein gegebenes Zeichen vorrücken. Inzwischen wurde die Artillerie, die hinter uns stand sehr lebhaft. Leichte und schwere Geschütze tauchten immer mehr auf, je zahlreicher die Mündungsfeuer unserer Geschütze wurden, um so beruhigter wurden wir. Zumal die Antwort der russischen Artillerie auffallend schwach war. Das Gewehrfeuer, das über die Dammkrone und über unsere Köpfe hinwegraste, wurde jedoch immer lebhafter und der Geschossregen immer dichter. Da, auf einmal, es war halb eins, kam eine Ordonanz und sagte mir: „Herr Oberleutnant, die 1. Kompanie kommt jetzt an die Reihe.“ Ich darauf zu den nächsten: „Auf, leise weitergeben,“ und 160 Männer gaben sich einen Ruck und schüttelten die Seite 49 von 80 zagemachenden Gedanken der letzten Stunden ab und standen auf. Dann ging es einzeln abgefallen in das finster gähnende Loch am Dammgrunde hinein. Ich stolperte als erster voran und kam bald auf der feindwärtigen Seite ins Freie. Hier sah ich in einer Deckung einen Kameraden in hysterischen Krämpfen liegen. Er bildete sich ein, schwer verwundet zu sein, trotzdem ihm die Haut nicht einmal geritzt war. Doch das gab für mich keinen Aufenthalt; hinein mit weiten Sprüngen in Gewehr- und Schrapnellkugelsaat hin zu den Pontons. Als meine Leute in das so stark bestrichene Gelände kamen, stutzten sie einen Augenblick, dann aber dröhnte von allen Seiten das Gepolter der in die Pontons springenden Männer. Die Pioniere legten sich in die Ruder und wehrlos waren wir. Maschinengewehrfeuer und Infanterieschüsse legten manchen schon ins Gras, bevor er den Sprung ins Ponton getan. Noch ärger aber wurde das Feuer, als wir auf dem Flusse schwammen, denn die russische Artillerie hatte mittlerweile die Überschiffungsstelle entdeckt und deckte uns mit rasendem Feuer zu. Die Granaten rissen hohe Wassersäulen in die Höhe und die Schrapnells platzten haarscharf über unseren Köpfen. Die kurze Zeit des Flussüberganges schien endlos zu sein. Endlich waren wir drüben und sprangen aus. Alle konnten es nicht mehr, und die Pioniere nahmen Tote und Verwundete wieder mit hinüber. Als wir an Land waren, drückte sich jeder so fest wie möglich an den Boden, denn das russische Feuer wurde stark fühlbar. In 10 Pontons war meine Kompanie über den Fluss gegangen. Da die Pontons an verschiedenen Stellen angelegt hatten, musste ich mir meine Kompanie zusammensuchen. Wie ein Rasender schwamm und sprang ich ein Stück flussab und dann flussauf durch Schwärme pfeifender Geschosse. Nach mühseligem Suchen hatte ich die Kompanie beisammen. Nach der Karte wusste ich Folgendes: Von der Landungsstelle gegen 800 m halb rechts, dann gerade aus. So musste ich die befohlene Stelle, das Nordende von Bienaczowice erreichen. Die 800 m waren sumpfiger Boden, den dichtes Weiden- und Erlengebüsch bedeckte. So trat ich denn in der dunklen Nacht den Marsch an, ständig vom Besteigen der Pontons an in scharfem Gewehrfeuer. Ich setzte mich an die Spitze der Kompanie, denn ich fühlte, aus diesem Hexenkessel kommen wir nur mit dem ganzen Aufgebot meiner Kräfte heraus. Seite 50 von 80 Die vor mir befindlichen Kompanien – ich war Baon-Reserve – waren schon im Gefecht, und der Gefechtslärm war bald so stark, dass man sich nur schreiend verständigen konnte. Der Weg war voller Tücken und Hindernisse. Bald war der Sumpf so zähe, dass er uns nicht durchließ, bald waren die Wassertümpel so tief, dass wir sie nicht durchwaten konnten. Schon nach wenigen Schritten war ich bis über die Hüften im Wasser, das, wie ich mit einem Stock fühlen konnte, immer tiefer wurde. Da ließ ich die Leute halten, um einen Weg auszukundschaften. Ich drang durch das Gebüsch kriechend vor, musste manchmal Gräben und Löcher überspringen. Und da brach ich auch mal wieder mit ganzer Kraft durch ein Gestrüpp, dass die Zweige brachen und wurde aus der nächsten Nähe vom Feuer überfallen. Es war eine eigene Pionierabteilung, die dort in einem Graben als festhaltende bzw. aufnehmende Gruppe gedacht war, und die hatten mich für vorbrechende Russen gehalten, kam ich doch von der feindwärtigen Seite. Ein kräftiger Fluch bewirkte das Einstellen des Feuers und ich konnte weiter meinem Pfadfindergeschäft obliegen. Ich entdeckte auch gangbare Stellen, holte mir die Kompanie heran und nun ging es nach Indianerart durch Sumpf und Gestrüpp, während die Geschosse uns umsausten. Das Durcharbeiten durch diese Sumpfstrecke nahm ziemlich lange Zeit in Anspruch. Endlich hörte das Gestrüpp auf, fester Boden begann und in einer Mulde ließ ich die Leute verschnaufen. Mein Häuflein war klein geworden, denn die Verbindung war zerrissen und ein Teil der Kompanie nicht halb rechts, sondern geradeaus gegangen, wie ich bei Tagesanbruch feststellen konnte. Während die Leute in der Mulde keuchend nach Luft rangen, ging ich zum Kommandanten des 4. Baons, um ihm zu melden, dass ich mit einer halben Kompanie zur Verfügung stände. Dabei erfuhr ich, dass das Gefecht gut stehe und die Russen im Zurückweichen seien. Bald bekam ich den Befehl, mich mit meinen Leuten in eine Brücke zwischen den 4. und 3. Baon einzuschieben. Ich teilte das Häuflein in zwei Gruppen; mit der ersten brach ich vor, mit der zweiten sollte der Feldwebel folgen. Vor uns erhob sich der Dunajecdamm, den die Russen an manchen Stellen noch hielten. Als wir glücklich einige Sprünge gemacht hatten, ohne nennenswerte Seite 51 von 80 Verluste zu erleiden, bekam ich unvermutet, während eines weiteren Sprunges Maschinengewehrfeuer aus der linken Flanke, das unter meinen Begleitern stark aufräumte. Glücklicherweise wurden alle nur verwundet, wie ich später erfuhr. Mit dem Aufgebote aller Kräfte stürmte ich nun solange vorwärts, bis ich eine kleine Vertiefung fand, in die ich mich hineinschmiegen konnte. Dort blieb ich, bis der Rest der Leute herankam, und dann rückten wir bis an den Damm, den die Russen kurz vorher aufgegeben hatten und richteten ihn sofort zur Verteidigungsfront nach Osten ein. Der erste Teil des Gefechtszieles, die Besetzung des feindlichen Dammes, war erreicht, als die Sonne aufging. Die Stunden von der Übersetzung des Flusses bis zur Erreichung des Dammes stellten wohl sehr hohe Anforderungen an unsere Kampftüchtigkeit. Stundenlang durch Gestrüpp und Sumpf im feindlichen Feuer vorzugehen und den Feind nicht zu sehen, dabei Verluste zu erleiden und nicht zu wissen, wie es rechts und links steht, mit dem Flusse im Rücken, der im Falle eines feindlichen Gegenstoßes ein unüberwindliches Hindernis gewesen wäre,.- das ist eine Lage, die gute Soldaten erfordert. Und wir haben unsere Sache gut gemacht, war doch alles ein Leichtes im Vergleich zu den qualvollen Minuten, die wir im Ponton ganz hilflos hockten. Ein Sprengstück einer Granate oder eines Schrapnells, das den Pontonboden durchlöchert hätte, hätte uns alle elend ersaufen lassen. Vom Damm rückten wir nach geraumer Zeit vor, durchsuchten das Dorf Bienaczowice, kamen ohne Schwierigkeiten darüber hinaus bis zu einem Meierhof östlich von Bienaczowice. Da ging dann die müden Reihen entlang der Befehl: Gefechtsziel erreicht, eingraben. Es war halb zehn Uhr vormittags. Zehn harte, aber selten erfolgreiche Stunden lagen hinter uns. Die Verluste des Regimentes betrugen 800 Verwundete und 200 Tote. Ich wurde mit meinen Leuten sofort als Reserve ausgeschieden und legte mich hinter die ausgebrannte Meierhofscheuer. Bald bekam ich den Befehl an das Nordende von Bienaczowice zurückzugehen. Hier stand schon der andere Teil der Kompanie. Alles war in der besten Stimmung und mit einem gewissen Stolz und großer Freude meldete ich dem Baonskommandanten, dass ich mit der Kompanie an der befohlenen Stelle sei. Seite 52 von 80 Die Antwort war eine unglaubliche Anflegelei, weil in der Nacht meine Kompanie auf zwei Teile zerrissen war. Andere Kompanien waren auf viele Teil zerschlagen - bei denen war es durch die Gefechtslage bedingt. Bei meiner Kompanie war es halt etwas anderes. Ich drehte mich schweigend, die Kompanie legte sich auf eine Gutweide, in wenigen Minuten schliefen alle, nur ich wachte, weil mich der Zorn nicht schlafen ließ. Während wir auf der Gutweide lagen, wurde der Gefechtslärm immer schwächer und schwächer und verstummte endlich ganz. Geraume Zeit verging so im müden Dahindösen, dann sah ich Bewegung bei den anderen Kompanien des Baons, die sich nach Norden in Marsch setzten. Ich musste wieder einmal riechen, dass ich auch dazu gehörte und strebte hastig nach, um nicht die Verbindung zu verlieren. Der Baonskommandant hatte sich wieder einmal in Schweigen gehüllt. Der Marsch dauerte nur eine halbe Stunde bis zu dem Dorfe Okreg, der nördlichsten Siedelung, die wir heute dem Feinde entrissen hatten. Wir wurden als Regimentsreserve hinter den Überflutungsdamm von Okreg gelegt. Die Sonne schien sehr warm und machte nun endlich unsere Kleider trocken. Dann ließ ich mir die Kotkrusten mit einem Messer abschaben und war wieder salonfähig. Das Baon lag in Kompaniekolonne und ruhte. Lebhafter wurden erst die Leute, als in der Ferne die Küchen auftauchten, die über die während der Nacht geschlagene Kriegsbrücke gekommen waren. Dann gab es ein seliges Versinken in die Wonne des Essens und Trinkens. Hernach schnarchte alles, bis auf die ausgestellten Sicherungen. Ich saß auf einer kleinen Erhöhung und schaute gegen Osten, wohin die Russen abgezogen waren und fragte mich: War es ein Teilerfolg, den wir errungen haben, oder ist die ganze gewaltige Front ins Wanken geraten? Wirre Gerüchte wurden von jeder Ordonanz gebracht, aber Zuverlässiges war noch nicht zu hören. Gegen Abend kamen von allen Seiten die Sanitätsleute mit den Gefallenen, die sie in dem Gestrüpp und Sumpf zusammenlasen. Die Verwundeten waren schon geborgen. Nur hin und wieder brachte man einen, der noch Leben in sich hatte. Seite 53 von 80 Nicht weit von uns legte man die Gefallenen Offiziere nebeneinander, die dann von leeren Trainfuhrwerken zum nächsten Friedhof zur Bestattung gebracht wurden. Ein polnischer Leutnant war auch darunter, dessen Besitz wir heute erobert hatten. Er kam ins Erbbegräbnis zu seinen Ahnen, altadeligen Herren dieser Gegend. Gegen Abend gab es noch einen herzhaften Kaffee, dann legten wir uns nieder in Reih und Glied, die Gewehre bei der Hand. Feuchte Nebelschwaden stiegen aus Sumpf und Fluss und es wurde bitterkalt. So kalt, dass ich nur auf kurze Zeit Schlummer finden konnte. Neben mir lag die Telefonpatrouille. Oft ertönte das charakteristische Tütü des Anrufes. Besonderes gab es nicht. Vor Sonnenaufgang war schon alles auf den Beinen und mit grotesken Bewegungen suchte jeder Wärme zu erzeugen. Die Nasen waren blau und die Zähne klapperten. Als uns die ersten Sonnenstrahlen trafen, wurden wir bald wieder fröhlich und gemütlich. Dann kam das Fragen und Raten. Wird es weitergehen oder erwarten wir einen Gegenstoß? Es kam der Befehl, das Dorf in Verteidigungszustand zu setzen. Wir sollten die vorgeschobenen Befestigungen halten für einen großen Brückenkopf am Ostufer des Dunajec. Wir hatten kaum die ersten Spatenstiche gemacht, da kamen schon die Schrapnells der Russen. Sie taten zwar keinen Schaden, versetzen aber die Bevölkerung in namenlose Aufregung. Und bald strömten Weiber und Kinder mit Betten und Nahrungsmitteln bepackt gegen Westen. Ein langer, weinender, kreischender, erbarmungswürdiger Zug. Alte Ausgedinger schleppten sich auf Stöcke gestützt mühsam einher, um ihr armseliges Leben zu retten. Das russische Feuer hörte bald auf und wir gedachten, uns in dem Dorfe gemütlich einzurichten. Ich hatte mir ein Haus gesucht und war gerade mit dem Waschen fertig geworden – Befehl: Zum Baon! Der Kommandant teilte uns den Befehl des Abschnittkommandos mit. In 30 Minuten hatten wir zum Angriff überzugehen. Dann gab es einen Befehl für das Baon; ich wollte mitschreiben. Das verbot er mir im groben Ton. Meine Kompanie war Baonsreserve am linken Flügel. Ich ließ die Kompanie zusammentreten und gab ihnen Verhaltensmaßregeln und wollte mich eben in Marsch setzen, als der Baonskommandant mit einem Gefreiten herbeistürzte, der zur Stillung eines unabwendbaren Bedürfnisses ausgetreten war. Der Baonskommandant hielt dem Gefreiten die Pistole an die Stirn, fluchte, zeterte, drohte vor Wut zu ersticken und brüllte: Ein Feigling, Deserteur usw.ums andere. Der Mann war selten gut. Die ganze Kompanie musste zusehen. Endlich war die Szene Seite 54 von 80 abgespielt. Der Baonskommandant verschwand und wurde während der folgenden schweren Gefechte nicht mehr gesehen. In gedeckter Stellung konnte ich mich in das richtige Verhältnis bringen. Kaum schwärmten die Kompanien der Feuerlinie aus, kam lebhaftes Gewehrfeuer von den Russen und ununterbrochen sauste es über unsere Köpfe, dass ich während des Beobachtens manche tiefe Verbeugung machte, wenn ich den Hauch des Geschosses an Stirn und Ohren spürte. Da war nun bald der Augenblick, der mir bedeutete: Heraus und den feuernden eigenen Kompanien nach! 800 m mussten wir über ebenes, keine Deckung gewährendes Gelände durch flankierendes Feuer durch. Da hieß es mit Aufgebot der ganzen Kraft sprungweise vorwärts und die kleinsten Geländefalten und –fältchen ausnützen. Ohne Verluste – bis auf einen Ohnmächtigen – preschten wir durch das Feuer bis uns ein deckender Straßengraben aufnahm. Aus jeder Pore tropfte der Schweiß. Das Herz und die Schläfen hämmerten wie ein Motor und die Brust ging keuchend auf und nieder. Vor den Augen tanzten farbige Lichter. Vom linken Flügel der eigenen Feuerkompanie waren wir nur 200 Meter entfernt. Da ergab sich nun plötzlich eine gefährliche Lage. Die links von den eigenen Feuerkompanien kämpfenden Truppen blieben hängen, ein gefährliches Loch entstand und gegen dieses Loch stürmten auch schon die Russen gegen unsere linke Flanke. Einer unserer eigenen Maschinengewehrabteilungen drohten sie in wenigen Minuten in den Rücken zu kommen. Die Not des Augenblicks gebot, und ich warf meine Kompanie den Russen entgegen. Das Baon hatte dann freilich keine verfügbare Reserve mehr. Es gelang uns auch wirklich im ersten Feuerüberfall, die Russen zum Stehen zu bringen und so konnte ich die gefährliche Lücke stopfen. Und da entwickelte sich ein rasendes Feuergefecht auf 300 Metern. Wir waren gut gedeckt und erlitten wenig Verluste. Aber die nagende Sorge, ob ich stark genug sein würde, fraß an mir. Im Verlaufe mehrerer Stunden drückten wir die Russen bis an den Rand des Dorfes Ujocie Jesuizkie, aus dem sie vorgebrochen waren, zurück. Aber bei meiner Kompanie sah es nicht gut aus, da ich zu einer rechtwinkeligen Front gezwungen war, und daher mit meinen Leuten keine Verschiebungen vornehmen konnte. Doch es ging. Wir schossen anscheinend sehr gut, denn bald sah ich, wie die vor meinem Seite 55 von 80 rechten Flügel liegenden Russen zurückkrochen und ihre Gefechtslinie so dünn wurde, dass sie augenblicklich keine Gefahr für mich bedeutete. Da gab ich den Leuten Befehl festzuhalten bis zum letzten Mann und nicht einen Schritt zu gehen und wandte mich dem linken Flügel, der dem Dorfe Uyscie Jes. gegenüber lag, zu. Die russischen Maschinengewehre fegten gegen mich, dass die Straßenbäume, unter denen wir lagen, uns mit Laub überdeckten und von der Straße selbst stiegen ununterbrochen kleine Wölkchen auf von den einschlagenden Geschossen. Besonders unangenehm war das Feuer aus einer Häusergruppe, die dem Dorfe vorgelagert war. Dahin richteten wir nun unsere Geschosse, krochen schrittweise immer näher und näher und waren endlich so nah, dass wir mit einem Sprung drin sein konnten. Da ließen wir eine Weile mit rasender Eile unsere Gewehre sprechen, dann ein gurgelndes Hurra und wie die Wilden waren wir drin. Die Russen brachen durch die rückwärtigen Zäune, sie hielten uns nicht Stand. Ein paar Tote und Verwundete lagen umher und zehn Riesenkerle mit Pelzmützen konnte ich selbst noch mit entwaffnen helfen. Die schickten wir gleich zurück und sofort stürzten wir uns wieder dem prasselnden Feuer entgegen und nahmen die ganze Häusergruppe, die uns nun selbst ein guter Stützpunkt wurde und insbesondere wegen eines Brunnens hoch willkommen war. Da lagen wir nun, freuten uns unseres Erfolges und trotz desselben lagen wir in großer Bedrängnis, denn auf Unterstützung war in absehbarer Zeit nicht zu rechnen und die Russen uns gegenüber waren sehr stark. Mit zwei Sprüngen wären sie bei uns gewesen und ihrer Übermacht hätten wir im Handgemenge vielleicht nicht standhalten können. Als ihr Feuer schwächer wurde, krochen wir langsam näher; wir konnten ihre Maschinengewehrstände sehen, sahen ihre Gestalten hinter allem, was Deckung bot, hocken und liegen. Ein paar Leute mehr und ich hätte den Ansturm wagen können. Einer meiner Leute kroch bis zur ersten Scheuer, um sie in Brand zu stecken. Es gelang ihm leider nicht, aber er brachte die Meldung über die Richtigkeit unserer Beobachtung über die starke Besetzung des Dorfes. Da mussten wir uns mit dem Festhalten begnügen und die Spaten schufen uns eine kleine Festung. Als ich festgestellt hatte, wie gut wir uns verbissen hatten, ging ich ein wenig zurück und fand den Major des 2. Baons. Ich erklärte ihm die Lage und er gab mir noch eine Kompanie und Munition. Seite 56 von 80 Da konnten wir nun mit Vertrauen auch einem größeren Ansturm trotzen. Auch zwei Maschinengewehre verstärkten die Stellung. Trotzdem war nicht weiterzukommen, weil die Gruppe links von uns immer noch stockte. Inzwischen wurde es Abend. Das Gefecht hatte um acht Uhr begonnen. Zwölf Stunden waren also mit den geschilderten Vorgängen verflossen. Die Nacht war gefährlich. Da durfte die Wachsamkeit nicht nachlassen. Um nicht einzuschlafen, braute ich in dem eroberten Gehöft einen starken Kaffee nach dem anderen und eine Virgina nach der anderen leuchtete mir mit behaglicher Glut. Und von Zeit zu Zeit schlich ich von Mann zu Mann und ermunterte sie. Während nachts nur hin und wieder ein Schuss krachte und irgendwo von weither das Mündungsfeuer schwerer Geschütze aufblitzte, wurde das Feuer gleich mit Anbruch der Dämmerung lebhafter, bis endlich ein ununterbrochenes Rattern aus Gewehren und Maschinengewehren uns mürbe machen sollte. Die Russen wussten ganz genau, dass hier weithin unsere empfindlichste Stelle war. Wir hielten uns in dem übermächtigen Feuer sehr gut; da und dort lag freilich einer, der sich nicht mehr rächen konnte, und gar mancher humpelte zum Verbandsplatz oder wurde weggetragen. Starke Verluste hatte die 8. Kompanie, die mir zur Verstärkung gegeben worden war. Der eine Zug derselben war nach kurzer Zeit eine Schwarmlinie toter Männer. Im Verlaufe des Tages kam endlich entsprechende Verstärkung; ein kroatisches Jägerbaon wurde an meinem linken Flügel eingesetzt, und das Feuergefecht lebte nun mit furchtbarer Gewalt wieder auf. Die Russen wussten, es geht ihnen jetzt an den Kragen, und bei uns regte sich die Erbitterung ob ihres langen Widerstandes. Im Verlaufe des nachmittags wurde das Dorf endlich sturmreif und die Kroaten nahmen es. Sie erlitten starke Verluste; es wurde erzählt, alle Offiziere und jeder zweite Mann seien bei dem furchtbaren Ringen geblieben. 700 unverwundete Gefangene wurden eingebracht, eine Ziffer, die ganz deutlich spricht, gegen welche Übermacht ich mich einen Tag und eine Nacht und wieder einen halben Tag glücklich gehalten habe. An dem Erfolge dieses Tages hatte ich einen nicht unbedeutenden Anteil. Seite 57 von 80 Als das Dorf Uyscie Jes. genommen war, blieben wir als Reserve noch eine zeitlang im Straßengraben liegen, dann aber, es war gegen vier Uhr, musste ich zum Angriff gegen Greboscow ansetzen. Das war das Ziel des Vortages gewesen. Dort hielten sich die Russen und wir sollten sie nun hinauswerfen. Mit eineinhalb Kompanien ging ich zum Angriff gegen Greboscow, das ca. 1200 Meter vor mir lag. Nach den ersten zwei Sprüngen hatte uns die russische Feldartillerie mit unheimlicher Sicherheit gepackt, und eine Granate nach der anderen fuhr in die Schwarmlinie. Die Granattrichter nutzte ich immer als Deckung. Wenn sich in meiner Nähe wieder eine Granate eingewühlt hatte, machte ich einen Satz und suchte dort Deckung. Solange uns die Artillerie allein bearbeitete, ging es trotzdem recht gut vorwärts, und ich hätte mich bis an das Dorf vorarbeiten können. Bald bekamen wir aber linkes Flankenfeuer, das mit unheimlicher Sicherheit scharf über uns hinweg strich. Da war nun das Vorrücken unmöglich geworden. Ich hätte nach einigen Sprüngen meine ganze Mannschaft eingebüßt. Ich wartete nun auf das Einwirken der links von mir vorgehenden Truppen, aber das kam und kam nicht und bald konnte ich feststellen, dass diese stockten und infolge dessen mein linker Flügel in der Luft hing. Aber doch wollte ich von dem Angriff nicht ablassen und grub mich ein. Stunde auf Stunde verrann. Ununterbrochen wühlten die Granaten Löcher um uns und bedeckten uns mit Erde, Schrapnellen platzten genau über unseren Köpfen und von der linken Flanke kam wohl gezieltes Infanteriefeuer, so dass man mit der Nase immer auf der Erde steckte. Da unter solchen Umständen an einen Erfolg nicht zu denken war und nur hohe Verluste in Aussicht standen, gab ich Befehl, einzeln in den Straßengraben zurückzukriechen. Das Manöver gelang und ich hatte die Kompanie glücklich wieder in der Hand. Doch sagte mir der Major des 2. Baons, die Verantwortung dafür müsse ich tragen. Der entsprechende Bericht ging durch den Draht nach hinten und nach langer Zeit – ich glaube, es waren zwei Stunden schon vorüber – kam die Entscheidung. Das Kommando schloss sich meiner Anschauung an. Wäre das nicht der Fall gewesen, so war mir eine gerichtliche Untersuchung sicher. In solchen Lagen ist das Telefon oft von unheilvoller Wirkung, denn der den Befehl Gebende kann die Lage vorn doch nicht so beurteilen, wie der Kampfoffizier, und die Seite 58 von 80 Folge davon ist, dass viele Angriffe zu früh befohlen werden und daher mit großen Opfern erkauft werden müssen. Im Straßengraben hatten wir noch lange Artilleriefeuer auszuhalten. Die Russen schossen aber 30 bis 50 Meter zu weit. Es kam daher zu keinen Verlusten. Während einer Feuerpause begruben wir einen polnischen Fähnrich, dessen Brust ganz zerrissen war. Das Grab war fertig. Er lag daneben. Da durchsuchten wir seine Brieftasche. In ihr fanden wir zwei Briefe. Einen an seine Mutter und einen an seine Braut, beide nach Groß - Grünau bei Deutsch – Gabel, meine Heimat, gerichtet, wo die Genannten als Flüchtlinge weilten. Wehmütige Gedanken haben mich während der ganzen Kämpfe niemals gepackt. Als ich aber die zwei Briefe in der Hand hielt, da war mir doch recht weh ums Herz. Doch ließen uns die Russen keine Zeit, diesen Gedanken nachzuhängen. Sie schossen wieder mit schweren Granaten. Eilig wurde das Grab zugeworfen, und ein Pionier schmückte es während des Feuers mit einem Kreuz, das wir mit Namen und Regiment versahen. Dann hockten wir wieder im Graben, eng an die feindwärtige Seite geschmiegt. Als es Abend geworden war, bekamen wir seit zwei Tagen wieder einmal die Küchen zu sehen. Hastig verschlangen wir Suppe und Fleisch und gedachten dann, einen langen Schlaf zu tun. Doch diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Ich bekam Befehl mit meiner Kompanie sofort als Verstärkung einer weiter östlich liegenden Gruppe abzurücken. Die Nacht war stockfinster. An Hand der Karte maß ich mir genaue Schrittzahl, Wege und Richtung und dann stolperte ich an der Spitze meiner todmüden Leute ins Ungewisse. Das Gefecht war eingeschlafen, nur hin und wieder lebte das Infanteriefeuer für kurze Zeit auf, wie wenn ein schlafender Hund manchmal einige knurrende Laute hören lässt. Unangenehm war nur, dass dabei die weittragenden Geschosse in unserer Nähe einschlugen. Bald hatte ich auch Verluste zu beklagen; ein Mann bekam einen Kopfschuss und war sofort tot. Das erregte nun die Leute und machte sie unsicher, weil sie nicht wussten, woher die Gefahr kam. Doch bei dem einen Verluste blieb es nicht. Es kamen noch andere, und da und dort zuckte einer schmerzlich zusammen. Seite 59 von 80 Endlich hatte ich Fühlung mit dem zu verstärkenden Abschnitt und bald nachher lag ich an der mir zugewiesenen Stelle und das Schanzen begann, denn vor Sonnenaufgang mussten wir in der Erde sein; wir hatten stärkere russische Kräfte vor uns und gegen die hatten wir uns auf alle Fälle zu behaupten. Ich lag der Südfront von Greboscow gegenüber, während ich tags vorher den Angriff gegen die Westfront versucht hatte. Als die Sonne in die Höhe stieg, waren wir zum Umfallen müde. Wir hatten aber auch genug geschafft, denn die Kompanie hatte einen durchlaufenden Graben, indem man gebückt gehen konnte. Unsere Nachbarkompanie zur Rechten, Polen, hatte es sich bequemer gemacht. Von denen lag noch jeder Schütze in einem Loch, das mit dem Nachbarn nicht in Verbindung stand. So kam es, dass unser Gefechtswert bedeutend größer war, als der der polnischen Kompanien. Bei Tagwerden konnten wir uns auch unsere Umgebung genauer ansehen. Vor uns erstreckte sich ganz ebenes Land bis zum Dorfe. Hinter uns war es auf 800 Meter ebenfalls ganz flach. Keine Erdfalte oder sonstige Deckung zu sehen. Bei Tag war daher eine Verbindung nach hinten ausgeschlossen. In unserer Nähe lagen viele Tote vom Ringen des Vortages. Als die Sonne etwas höher stand, brannte sie unbarmherzig auf uns nieder und drückte uns den Schweiß aus allen Poren. Da das Heranschaffen von Wasser erst abends möglich war, stand uns ein Dursttag bevor. Bald merkten wir auch, dass die in unserer Nähe liegenden Leichen in Verwesung übergingen. Wir machten uns daher ans Begraben. Erst wurden einige Leute von der 2. Kompanie aus der St. Pöltener Gegend, die zum Greifen nahe waren, im Schützengraben bestattet. In dem Bericht gaben wir ganz genau an die Lage der Gräber und bezeichneten sie mit Zetteln. In der nächsten Nacht holten wir dann Holz zu rechtschaffenen Kreuzen. Es war etwas ganz Eigenes, den Kampf sozusagen auf den Gräbern der Kameraden fortzusetzen. Als die erreichbaren Kameraden bestattet waren, suchten wir die vor uns ganz nahe liegenden Russen in den Graben zu ziehen. Diese Versuche mussten wir bald aufgeben, da die aus den Häusern beobachtenden Russen das Feuer sofort dorthin lenkten, wo ihre Toten lagen. Wir ließen nicht früher ab, als bis wir ein paar Seite 60 von 80 Streifschüsse erwischt hatten. Da sparten wir uns das Bestatten der Russen für die Nacht auf. Der Leichengeruch wurde von Stunde zu Stunde unangenehmer. Die Zigarre schmeckte nach Leiche, der schwarze Kaffee ebenso. Auch unsere Kleider schienen mit diesem entsetzlichen Geruch behaftet, der in der drückenden Hitze besonders dann fast unerträglich wurde, wenn ein leiser Lufthauch von den Russen zu uns herüber kam. Während des ganzen Tages schwieg auch das Feuer nicht. Die Russen beschossen uns wirksam von den Dachböden der Häuser in Greboscow und verwundeten und töteten eine Reihe meiner Leute. Während dieser Zeit schrieb ich die Belohnungsanträge für meine Kompanie. Zweimal bekam ich sie wegen schlechter äußerer Form zurück und dann gab man ihnen nicht statt. Das war zum Schreien. Kanzleileute hockten hinten gemütlich in Stuben und brachten es fertig, mir die im Feuer geschriebenen Anträge zurückzuschicken. Das Einfachste und vom Standpunkt der Kameradschaft einzig Mögliche wäre gewesen, die Anträge umzuschreiben und mir zur Unterschrift zu schicken. Am Nachmittage tastete sich schwere Artillerie an uns heran. Es waren 17 cm Granaten. Erst schlugen sie vor dem Graben ein und kamen immer näher und näher, so dass wir schon ausrechnen konnten, die dritte oder vierte Salve wird mitten unter uns sitzen. Wir drückten uns an die feindwärtige Grabenwand und machten uns so dünn, wie nur möglich. Dann lauschten wir auf das charakteristische Heulen. Das erhob sich auch bald, kam immer näher und näher und in der nächsten Sekunde musste es bei uns einschlagen. Aber die Ungetümer heulten länger als bisher, und endlich gingen sie 400 Meter hinter uns nieder, gewaltige Erdsäulen aufreißend. Erleichtert atmete alles auf. Wahrscheinlich hatte der Artilleriebeobachter hinter uns Bewegung entdeckt und das Feuer dorthin gelenkt. Mehrere Stunden dauerte die Beschießung und die Russen suchten systematisch das ganze hinter uns liegende Gelände ab. So verging der Tag und die heiß ersehnte Nacht sollte mit ihrer Erquickung kommen. Das Essen musste von weither von Patrouillen geholt werden. Dann gab es Kaffee und Tabak, lauter Dinge, die sehr gut geschmeckt hätten, wenn der Leichengeruch nicht gewesen wäre. Seite 61 von 80 Als es ganz finster geworden war, krochen einige Leute aus dem Graben, um die Russen zu bestatten. Sie kamen aber bald zurück ohne ihr Geschäft verrichtet zu haben. Die Russen hatten während des Tages Gewehre auf ihre Toten gerichtet und eingespannt und ließen nun seit Einbruch der Dunkelheit regelmäßig einzelne Schüsse ab. Jetzt wussten wir auch, warum es bei den Russen regelmäßig krachte. Wir hatten dem bei dem Eintritt der Dämmerung gar keine besondere Bedeutung beigemessen. Unsere Stimmung wurde recht gedrückt, besonders wenn wir an die Hitze des kommenden Tages dachten. Von einer entsprechenden Nachtruhe konnte da selbstverständlich nicht die Rede sein. Auch erhob sich gegen elf Uhr zu unserer Rechten ein lebhaftes Feuergefecht, das nach geraumer Zeit auch uns in seinen Bann zog, sodass wir nach Mitternacht auf einmal wie toll drauf losschossen. Ich tat selbst eine zeitlang mit. Die Nerven waren durchgegangen. Bald besann ich mich und brachte bei meiner Kompanie und der rechten Nachbarkompanie das Feuer zum Schweigen. Ich habe mich oft noch geärgert, weil mich die allgemeine Erregung ohne Grund mitgerissen hatte. Aber auch diese Nacht ging zu Ende. In gewohnter Klarheit stieg der nächste Morgen auf, wieder eine Hitzewelle verkündend. Das Feuer lebte wie am Vortage von Zeit zu Zeit auf und besonders aus einem Hause, das 800 Meter vor mir war, bekam ich genau gezieltes Maschinengewehrfeuer, das Verluste verursachte, dem wir aber nicht beikommen konnten. Ich sprach daher durch den Draht, die Artillerie möge Brandgranaten in das Haus setzen. Zwei Stunden lag ich am Telefon, die Artillerie schoss, aber das Haus blieb stehen und war weiter ein unangenehmer Nachbar. Der Gestank der Leichen brachte uns an diesem Tage fast zur Verzweiflung. Die Nacht wurde ziemlich kühl, sodass wir wieder ein wenig munterer wurden. Während dieser Nacht gaben nun die Russen unter dem Drucke einer Nachbargruppe Greboscow auf und im Morgengrauen setzten wir ihnen nach und marschierten an diesem Tage, 8. Mai, bis nach Boleslaw, wo wir um fünf Uhr nachmittags ankamen. Von diesem Marsche habe ich mir wenig gemerkt, da ich nur so hinduselte. Die Arbeit der letzten Tage hatte mich allzu sehr hergenommen. Wir kamen durch eine Reihe reichbevölkerter Dörfer; überall war der Meierhof zerstört. Die Russen hatten systematisch die Großgrundbesitzer geplündert, während sie mit den Bauern anscheinend glimpflich verfahren waren. Seite 62 von 80 In Boleslaw bekam ich sogar ein Bett ohne Ungeziefer, aß und trank bis ich nicht mehr konnte und schlief acht Stunden wie ein Toter. Um fünf Uhr waren wir schon wieder in der Marschkolonne. Ich war ganz fröhlich und guten Mutes. Es war aber auch eine Lust zu marschieren. Herrliches Wetter, fröhliche Gesichter und gute Straßen. Die Gegend war sehr reich. Überall waren die Felder aufs Beste bestellt, auch sah man verhältnismäßig viel Vieh. Wenn nicht die ausgebrannten Meierhöfe gewesen wären, hätte man meinen können, es geht ins kaiserliche Manöver. Der Marsch ging eine Reihe von Stunden ohne Störung. Gegen Mittag begann freilich in der großen Hitze das Ächzen und Stöhnen der schwer bepackten Leute. Auch bekamen wir plötzlich aus einem Walde zu unserer Linken Feuer von versprengten Kosaken. Eine Kompanie musste ausschwärmen und den Wald säubern. Nachmittags gab es eine längere Rast; während derselben ging das Gerücht, die Russen hätten sich auf einer Höhe neuerdings gestellt und müssten unbedingt heute noch gepackt werden. In fiebernder Hast drängten wir daher vorwärts. Doch in einer Mulde machten wir Halt. Diese war von kleinen Erlengebüschen durchzogen. Die Kompanien wurden in diesen Erlengebüschen versteckt und sollten Schirme gegen Schrapnellfeuer anlegen. Ich lag in einem Gehölz, 150 Meter hinter den anderen Kompanien des Baons und richtete mich befehlsgemäß ein. Auch bekam ich den Auftrag, durch Feldwachen die rechte Flanke zu sichern. Plötzlich kam in die drei anderen Kompanien krabbelnde Bewegung; sie setzten sich in Marsch. Ich schickte sofort, Erkundigungen einzuholen, da waren sie auch schon verschwunden. So wie ein neuer Befehl kam, wurde der Baonskommandant wie toll, vergaß die notwendigsten Befehle und stürmte mit den ersten Leuten drauf los; aber nur dann, wenn das Gefecht noch weit war. So wie es kritisch wurde, verschwand er. Ich konnte keine Auskunft bekommen, ob ich bleiben solle oder nicht. Andere Truppen zogen kreuz und quer, sodass ich einsah, ich werde bald in einem fremden Verbande stecken. Da trat ich denn auch den Marsch an und traf auch nach dreieinhalb Kilometern das Baon, das verschoben worden war. Es lag als Seite 63 von 80 Brigadereserve in unmittelbarer Nähe des Brigadiers. Der Mann war an diesem Tage General geworden; da rannte alles, was zur Aktivität gehörte, um zu gratulieren. Die Generalsuniform hatte er im Koffer mitgebracht und so strahlte er dann auf dem Feldherrenhügel in einer Schar geleckter Ordinanzoffiziere. Über dem Gratulieren hatte man anscheinend auch mich vergessen. Ich legte mich schweigend zu den anderen. Vor uns rollte und grollte das Gefecht. Bald hieß es, wir sollten eingesetzt werden, bald kam wieder ein anderes Gerücht. Endlich gingen wir auf den alten Aufstellungsplatz zurück, legten uns in unsere Mäntel gehüllt auf ein Feld und versuchten zu schlafen. Vor uns tobte während der ganzen Nacht die Schlacht. Bald schlief ich ein und erwachte nur dann, wenn schwere Munitionskolonnen rasselnd durch die Straße zogen. Fröstelnd erwarteten wir den Morgen und die Sonne. Noch vor Sonnenaufgang kam klappernd alles auf die Beine. Den ganzen Tag lagen wir gähnend und langsam redend in den Furchen. An uns vorbei zog alles, was das Gefecht vor uns zu seiner Nahrung brauchte. Aber auch die Leerkolonnen, die Verwundeten und sonst dienstunfähig Gewordenen humpelten und ächzten an uns vorüber. Jeden Augenblick sollte der Befehl kommen: „Ergreift das Gewehr!“ Aber es wurde nichts daraus. Im Verlaufe des nachmittags wurde das Brüllen der Geschütze heiser, manchmal setzte es ganz aus; auch das Infanteriefeuer wurde schwächer. Es stand gut. Und in der Dämmerung wichen die Russen. Da kam auch der Abmarschbefehl für uns. Das Baon stand. Der Baonskommandant ließ „rechts um“ machen und raste davon. Niemand, auch die Kompaniekommandanten nicht, wussten wohin. Ich war mit meiner Kompanie leider am Ende der Marschkolonne, hatte also alle die Leiden eines hastigen Nachtmarsches vor mir; schon nach kurzer Zeit zerriss sehr oft die Marschkolonne, und ich hatte meine liebe Not, sie notdürftig wieder zusammenzuflicken. Alle die Zurückgebliebenen der anderen Kompanien sammelten sich bei mir und störten den gleichmäßigen Fluss meines Marsches. Die ersten Pausen im Vormarsch benutzte ich dazu, um beim Baonskommandanten Vorstellungen wegen des unregelmäßigen Marschtempos zu erheben und um wenigstens die Marschlinie zu erfahren. Hätte ich die gewusst, wäre mir um die rechtzeitige Erreichung des Zieles nicht Bange gewesen, denn in der zweckmäßigen Seite 64 von 80 Anordnung langer Märsche war ich den anderen über. Ich hatte das schon oft gezeigt. Aber meine Versuche, dies zu erfahren, musste ich aufgeben. Vom ersten Anschnarren hatte ich genug. Beim Überqueren eines Baches gab es die erste große Störung. Die vorderen Kompanien gingen einfach durch. Als ich mit meinen Streitern durchs Wasser gestapft war, war ich allein auf weiter Flur. Dem Instinkt nach wanderte ich mit meinem Häuflein weiter. Bald nahm uns dichter Wald auf. Viele Stunden zogen wir weiter, ohne die vor uns Marschierenden einzuholen. Von Stunde zu Stunde wurde die Ungewissheit, bist du auf dem rechten Wege oder nicht, größer und beunruhigender. Zumal es ja auch leicht möglich gewesen wäre, dass ich unvermutet auf russische Stellungen stieß. Die Leute schleppten sich schwer atmend weiter. Endlich hatte ich Fühlung. Auf einer Waldblöße lagen die anderen Kompanien. Kaum hatte ich Anschluss gefunden, ging es weiter. Wieder ohne Aufklärung über Ziel und Weg. Endlich kam der Morgen. Im ersten Graulicht überschritten wir eine verlassene russische Stellung, die noch am Abend gehalten worden war. Als uns die Sonne hell beschien, hieß es rasten. Wie Kartoffelsäcke fielen die Leute um; die meisten schliefen sofort ein. Da schnarrte auch eine Stimme: „Herr Oberleutnant Kögler zum Regimentskommando!“ Ich kam und hörte. „Herr Oberleutnant, Sie übernehmen mit ihrer Kompanie die Spitze der Brigade; Marschlinie XY. In den Wäldern versprengte russische Abteilungen. Brücken sind zu untersuchen, weil minengefährlich. Marsch sofort antreten!“ Da hatte ich es also wieder. Während des Nachtmarsches die schwerste Stellung in der Marschkolonne und nun, da es zum Gefechte ging, wieder die schwerste Stellung, während die Schonung der Leute gerechterweise meine Kompanie weiter rückwärts eingeteilt verlangte. Ich setze mich in Marsch und war auch schon allein. Baon und Regimentskommando gingen weiter rückwärts. Sie gehörten aber naturgemäß zu mir. Da zogen wir denn los. Ich mit einem Zuge voraus, Flankendeckungen in entsprechend wechselnder Zahl, je nach Bodenbedeckung und Aussicht. Die Sonne wurde bald drückend und mancher meiner Streiter blieb liegen. Seite 65 von 80 Da kam denn von hinten auf schnaufendem Ross der Regimentshornist und richtete mir aus, ich möge mich mehr um die Marschdisziplin kümmern. Meine Aufgabe war aber einzig und allein die Sicherung. Was ich diesem Boten sagte, war wahrscheinlich nicht fein. Dann hatte ich eine zeitlang Ruhe. Dann kam es wieder von hinten: „Schneller marschieren!“ Und da marschierte ich denn schneller, aber das ging nur mit Vernachlässigung der Sicherung. Im weiteren Verlaufe verzögerten Ziegelgruben in der Flanke und eine hohe Brücke in der Front meinen Vormarsch. Ohne entsprechende Durchsuchung wollte ich nicht weiter. Man sah ganz deutlich, dass vor ganz kurzer Zeit hier noch die Russen gewesen sein mussten. Aber da hetzte man mich wieder von hinten weiter, ohne mir Zeit zu gründlicher Sicherungsarbeit zu lassen. Es ging gegen Mittag, es wurde Mittag und es kamen die ersten Nachmittagsstunden. Siebzehn Stunden war meine Kompanie ohne Unterbrechung, ohne Schluck und ohne Bissen marschiert. Lange konnte es nicht mehr so fortgehen. Die Leute stierten aus verglasten Augen schon ganz blöde. Dann kam endlich der Befehl, zu beiden Seiten der Straße in Schützenlinien übergehen und auf dem nächsten Hügel gesicherten Halt beziehen. In weite Kartoffeläcker versanken wir bald darauf zu köstlicher Ruhe. Aber die Ruhe war nur halb, galt es doch immer, auf die Sicherung zu achten. Die anderen Teile des Baons lagen weiter hinten behaglich und menagierten. Bei uns ging das nicht. Beim Fortsetzen des Vormarsches fiel die Sicherung weg, da andere Kolonnen vorkamen. Da wurde ich wieder in das Ende der Kolonne eingeteilt, damit meine Leute recht brav Staub schlucken konnten. Ja, ja, der Landsturm! Mühselig schleppten wir uns weiter. Drückend lag die heiße Sonne auf uns. Noch drückender war der feine Staub, der alles mit einer dichten Schicht überzog und auch in die tiefsten Falten der Kleidung eindrang. Aber vorwärts ging es doch, trotzdem wir vom Dunajec bis zur Wisloka, die jetzt in greifbarer Nähe lag, rastlos vorwärts geeilt und daher ganz ausgepumpt waren. In diesen Tagen kam mir ein Zeitungsblatt in die Hand, das den jubelumbrausten Vormarsch der Überwinder der Dunajec-Front pries, als ginge es zum Maientanze. Da gab es nach der Meinung des Artikelschreibers lachende und singende Seite 66 von 80 Kolonnen, mit frischem Siegesgrün geschmückt und jubelnde, von Freude berauschte Landeseinwohner. In Wahrheit schleppten sich die stolzen Sieger mühselig dahin, voll stummen Ingrimms eine Hügelreihe nach der anderen nehmend. Oft hatte es den Anschein, als ob eine Reihe Mondsüchtiger dahinwankte. Wenn es aber wieder ins Gefecht ging, dann strafften sich die krummen Rücken, die schlotternden Beine festigten sich, der stiere, blöde Blick bekam wieder Glanz und Feuer. Immer lebhafter wurde das Feuer, immer rascher folgten die Sprünge aufeinander, bis endlich ein heiseres, mit dem letzten Kräftevorrat herausgequetschtes „Hurra“, den Gegner fliehend machte. Die Infanterie hat in diesen Tagen Leistungen vollbracht, mit denen sich keine andere Waffengattung nur im Entferntesten messen kann. Aber bis heute habe ich keinen gefunden, der ihr stilles Heldentum entsprechend gewürdigt hätte. Nach geraumer Zeit verließen wir die Straße und marschierten querfeldein bis zu einem dichten Wald, den wir aufgelöst durchschritten. Im Walde fiel ich mit meinen Leuten etwas zurück, da ich das dichteste Gestrüpp zu durchbrechen hatte. Beim Austritt aus dem Wald lag vor uns auf vielleicht 3000 Metern das Dorf Wolacelecka, unser Ziel. Kaum hatte ich den Wald verlassen, da kamen die russischen Granaten vom anderen Wisloka-Ufer herangeheult und in langen aufreibenden Sprüngen arbeitete ich mich ohne Verluste bis ans Dorf, jede Bodenfalte gut ausnützend. Hinter dem Dorfe mussten wir uns sofort eingraben und Stellungen für schwere Geschütze ausheben helfen. Kaum war die Sonne gesunken, mussten wir unsere freundlichen Löcher verlassen und vorrücken und uns den Russen gegenüber auf Vorpass legen. Das wurde eine bittere Nacht. Die Leute waren so erschöpft, dass sie kaum richtige Antworten gaben. Die Patrouillen torkelten, wie wenn sie betrunken wären; die Beine wollten nicht mehr. Glücklicherweise wurde es sehr kalt und die Leute konnten nur in einen unruhigen Halbschlummer versinken und waren daher leicht zu wecken. Mit steigender Sonne gingen wir in die alte Aufstellung zurück, blieben aber nicht lange, sondern brachen bald gegen Mikleo auf. An der Wisloka warteten wir auf die Fertigstellung der Brücke, die Tags vorher die Russen zerstört hatten. In Reihen überschritten wir sie. Erst die drei anderen Kompanien und zwei Maschinengewehrkompanien mit ihrer langen Tragtierreihe und dann meine Seite 67 von 80 Kompanie. Nach dem Übergang wartete der Baonskommandant nicht auf den Anschluss von hinten und gar bald war ich ohne Verbindung. Ich habe damals vor Wut geschäumt. In Mikleo wogten die verschiedensten Truppenteile und Trains straßauf und straßab, und ich musste wieder einmal riechen, wohin das Baon verschwunden war. Ich fand es glücklich, wurde vom Baonskommandanten in der maßlosesten Weise angeflegelt - und war wieder bei den Kameraden. Auf einer großen Wiese lagerten wir, die Küchen kamen, und es gab ausnahmsweise einmal das Mittagessen zur Mittagszeit. Nach dem Essen wurden wir in der Nähe in einem Meierhofe einquartiert. Leider musste ich das Zimmer mit den anderen Offizieren teilen und auch die Gesellschaft des Baonskommandanten den ganzen schönen Ruhehalbtag ertragen. Beim Meierhofe war ein Teich, so dass sich die Leute endlich einmal waschen konnten und den Dreck der letzten Tage herunterbrachten. Den Abmarschbefehl gab am nächsten Morgen der Baonskommandant, der mit uns am selben Tische saß, schriftlich. Er hatte nur Abmarschstunde und -reihenfolge zu bestimmen. Die Gefechtsbefehle gab er mündlich und duldete nicht, dass wir dabei Notizen machten. In flotter Marschart ging es den ganzen Tag rüstig vorwärts. Da es sehr heiß war und die Straße von endlosen Kolonnen gefüllt wurde, kamen in der Mittagszeit die ersten Zeichen der Ermüdung. In den Nachmittagsstunden wurde die Geschwindigkeit des Marsches immer geringer und gar mancher wurde schlapp und blieb im Straßengraben liegen. Um vier Uhr nachmittags kamen wir nach Zarownie, wo wir nächtigen sollten. Einige Stunden lagen wir noch in Schwarmlinie hinter einem Damm, weil vier Kilometer vor uns in einem Walde noch starke russische Kräfte standen, deren endgültiges Zurückweichen, infolge überlegenen Druckes in ihre Flanken, wir abwarten mussten. Nach zwei Stunden kam die Meldung, dass der Gegner zurückgewichen sei und wir konnten unsere Quartiere beziehen. Seite 68 von 80 Ich lag in einem ansehnlichen Bauernhof; die große, verhältnismäßig reine Stube, war mein Reich, das ich sonst mit niemandem teilte. Ich fühlte mich daher auch außerordentlich wohl. Am nächsten Morgen sollten wir erst um sieben Uhr weiterziehen. Eine Lust war daher das Einschlafen mit dem Bewusstsein, solange ruhen zu können. Wir wurden nachts glücklicherweise nicht gestört und frisch gestärkt marschierten wir am nächsten Tag, meist auf Feldwegen, durch gut bebaute Fluren. Das Baon war als Seitenkolonne allein auf der Marschlinie. Daher war alles in viel besserer Verfassung als am Vortage und in bester Stimmung ging es vorwärts, beseelt vom Drang nach Osten. Auf diesem Marsche begab es sich, dass plötzlich der Baonshornist – ich führte die letzte Kompanie – bei mir erschien und meldete, ich hätte das Baonskommando zu übernehmen, da der Hauptmann weggeritten war. Eine peinliche Verlegenheit für mich. Ich hatte keine Ahnung, was rechts und links von mir war, wusste nicht den Stand des Regimentskomandos, kurz und gut, ich hing ganz in der Luft, da der Baonskommandant wieder einmal, wie schon oft, die ganze Weisheit für sich behalten hatte. Zum Glück kam er bald zurück. Gegen Abend wurde der Marsch zur Quälerei, da wir in Gefechtsformation durch tiefen Sand mussten. Gegen Schmielow rasch vorrückend, um die Russen, die sich an die Zerstörung dort lagernder Holzvorräte machen wollten, rasch zu fassen. Sie hielten nicht stand und ohne feindliche Einwirkung rückten wir durch den Ort und machten erst auf den Höhen jenseits Halt. Hier sollten wir bleiben. Meine Kompanie wurde Baonsreserve, und ich konnte behaglich im Straßengraben hocken, während die anderen Kompanien sich vor mir eingruben. Als aber die Dunkelheit hereingebrochen war, musste ich auch hinaus, um die Linie zu verstärken. Auch bekam ich das Telefon und so die Verbindung mit hinten und war wieder auf Baonsbreite der höchste Offizier, denn der Baonskommandant blieb hinten im Dorf. Beim Abgehen der Stellung entdeckte ich rechts von mir ein beängstigend großes Loch. Wir waren nicht geschlossen. Die rechts liegenden Kompanien waren zu weit seitab geraten und ich konnte selbst nicht nachrücken, da ich die beherrschende, mit einer Windmühle gekrönte Höhe besetzt halten musste. Seite 69 von 80 Meine Bemühungen, eine Kompanie heranzuziehen, hatten keinen Erfolg, sodass ich die Lücke nur notdürftig mit Patrouillen sichern konnte. Eine unbehagliche Lage, die mir trotz der großen Erschöpfung, in der ich mich befand, nervöse Unruhe brachte. Jede Patrouille fertigte ich persönlich ab und als die ersten lichten Streifen am östlichen Himmel erschienen, fiel mir ein Alb von der Brust. Konnte ich doch erst jetzt genau sehen, wie unbehaglich die Stellung während der Nacht gewesen war. Da kam der Befehl, wir würden lange an dieser Stelle bleiben und die Kompanie hätte sofort im Erdboden zu verschwinden. Da gab es nun wieder ein Hetzen und Drängen. Die Leute wühlten und wühlten, bis sie unter dem Einflusse der immer wärmer scheinenden Sonne vor Erschöpfung einschliefen und bald der ganze Kompanieraum in Dornröschens Schloß hineinpasste. Da schlummerte einer, Fuß und Hand am Spaten. Da war einem der Spaten entsunken, als er die Erde auswarf. Dort ruhte einer stehend, den der Schlaf beim Anlegen der Schießscharte übermannt hatte. Und da ließ ich sie alle ein wenig verschnaufen. Nach geraumer Zeit brachte ich sie wieder in Gang. Vor meiner Stellung stand auf dreißig Meter ein einzelnes Haus. Dorthin zog ich mich auf eine Weile zurück, um mich zu waschen und auch ein wenig zu schlafen. Kaum hatte ich mich niedergelegt, ließ mich die Meldung, ein General sei da, wieder mühsam auftorkeln. Es war der Brigadier. Er fragte zuerst recht barsch, wo ich gewesen sei, und als ich ihm die Wahrheit berichtete, meinte er, es sei mein Glück, dass das Haus vor der Stellung liege. In mir zitterte es vor verhaltener Wut, da in diesen Worten ein Zweifel an meinem Mute lag. Der Brigadier hatte mich noch nie gesehen. Von dem, was wir geleistet und in den letzten Tagen an unglaublichen Anstrengungen hinter uns gebracht, anscheinend keine Ahnung, und sollte doch – Kraft seiner Stellung – über die Leistungsfähigkeit seiner Leute bestens unterrichtet sein. Dann ging er die Stellung ab, nörgelte bei jedem Plänkler und zeichnete mir auf einem Papier einige Skizzen von mustergültigen Schützengräben, so wie sie eben in der Schule gelehrt werden. Schließlich wurde er sehr gnädig und meinte, das solle kein Vorwurf sein usw.. Inzwischen kam der Hauptmann atemlos aus dem hinter uns liegenden Dorfe; den fragte der Brigadier aber nicht, wo er gewesen. Und dann ging er zur anderen Kompanie und ich hatte Ruhe. Seite 70 von 80 Als der Brigadier verschwunden war, kam der Befehl, mit allen Kräften die Stellung bestens auszubauen. Wir schanzten, da man uns Hoffnung machte, an der Stelle bleiben zu können, unverdrossen den ganzen Tag. Wurden mit dem durchlaufenden Graben fertig und bauten sogar einige Flankierungsanlagen. Bis abends wollten wir uns gemütlich ausruhen, da rasselte das Telefon den Befehl „marschbereit“, und ein Fluch ging durch den ganzen Graben, wie ich ihn noch selten gehört. Als die Sonne gesunken war, kam die Ablösung und sogleich der Befehl nach Zygang zu marschieren. Zum Glück war das nur vier Kilometer weit. Da es außerhalb der Schützenlinie lag, besserte die Hoffnung auf Quartiere unsere Stimmung. Durch die Nacht zog ich da mit dem gemütlichsten Schritt gegen Zygang. Dort war auch Quartier gemacht. Für mich war ein schönes Zimmerchen bereitet, auf das ich mich recht herzlich freute. Ich ließ mein Gepäck und den Diener dort und ging noch einmal fort, um mich von der Unterkunft der Leute zu überzeugen. Sie waren gut untergebracht. Dann schlenderte ich wieder langsam zu meinem Quartier und malte mir seine Wonnen aus. Ich hatte mich zu sehr gefreut. In meiner Abwesenheit hatten Offiziere einer schweren Batterie mein Zimmer belegt und ich hätte mich mit ihnen raufen müssen. Das war mir zu schmutzig. Und nun neuerdings wieder ein Beweis für die mangelnde Kameradschaft und die hochnäsige Rücksichtslosigkeit, von der die vielen Kameraden von der Artillerie und der Kavallerie Grabensoldaten gegenüber erfüllt sind. In einer Ecke kroch ich noch glücklich unter. Im Morgengrauen waren wir wieder auf den Beinen. Das Baon wurde außerhalb der Ortschaft in Alarmgräben untergebracht, im Orte durften wir nicht bleiben, warum habe ich nicht erfahren können. Ein paar Nächte in den geräumigen Scheuern des Dorfes hätten den Leuten gut getan. Und so lagen wir dann sechs Tage in Zygang, tausend Meter hinter der Schützenlinie. Von Zeit zu Zeit schickte uns die russische Artillerie einen Gruß, der aber keinen Schaden anrichtete. Zu tun gab es nicht viel, sodass ich einige Male mit Bedacht auf die Flohhatz gehen konnte. Die Flöhe waren an die Stelle der Läuse getreten und viel unangenehmer, weil sie zu nervös sind. Auf einer einzigen Hatz erlegte ich Seite 71 von 80 einmal fünfunddreißig Stück. Ich war damit der erfolgreichste Jäger weit und breit geworden und genoss als solcher entsprechendes Ansehen. Einmal musste ich auch mit meiner Kompanie zur Verstärkung durch eine Nacht in den Graben, da man einen russischen Angriff vermutete. Zugleich bekam ich das Kommando über den gefährdeten Abschnitt. Im Morgengrauen ging ich in meine alte Stellung zurück, ohne dass ich in der Nacht etwas Besonderes erlebt hatte. Zwei Tage darauf ging ich nochmals an die selbe Stelle. Diesmal nicht zur Verstärkung, sondern zur Ablösung. Das dort liegende Baon wurde abgezogen und wir kamen an dessen Stelle. Ich rückte in dem mir schon bekannten Abschnitt ein. Auffallend war nur, dass man, als ich den Teil des Grabens hielt, dessen Besatzung ich hatte verstärken müssen, eine Verstärkung trotz lebhafterer Tätigkeit der Russen nicht für notwendig hielt. Bei Tage erwischte uns eine Ladung russischer Schrapnells und es gab einige Leichtverwundete. Hier blieb ich zwei Tage. Die Ablösung erfolgte durch Honved. Ich marschierte um elf Uhr nachts nach Schmielow. Wir kamen ins Quartier, mussten aber nach zwei Stunden wieder aufbrechen, da wir an der Straße nach Tarnobrczeg Olmützer Landsturm abzulösen hatten. Die Ablösung erzeugte einen heillosen Wirrwarr, da die Marschkolonne nicht in entsprechender Weise eingeteilt worden war. Es wickelte sich aber nach geraumer Zeit alles wieder in der notwendigen Reihenfolge ab. Die Stellung war mit spanischen Reitern gut bewehrt. Tausend Meter vor mir zog sich die russische Stellung um das Dorf Ocice. Wir hatten nicht mehr viel zu tun, denn die Stellung war gut ausgebaut. Nach einigen Stunden erfuhr ich, dass wir in ein bis zwei Tagen angreifen würden. Da überschaute ich mir das Gelände und sah, dass es für meine Kompanie böse enden musste, denn wir hatten sehr ungünstiges Angriffsgelände vor uns. Auch waren wir bei Vorrücken nicht nur frontalem, sondern auch Flankenfeuer von links ausgesetzt. Ich behielt es für mich. Die Kompanie tat mir aber leid. Ich hatte noch 110 Gewehre. Zu Weihnachten waren es 280 gewesen! Bald kam auch der Angriffsbefehl und der Auftrag, jeder Plänkler müsse sich Stufen bauen, um rasch aus dem Graben herauskommen zu können. In eine große Erregung brachte uns hier auch die Kriegserklärung Italiens. Wir erfuhren es am 24. Mai. Seite 72 von 80 Gegen Abend dieses Tages kamen die genauen Angriffsbefehle. Viereinhalb Uhr sollte die Artillerie, darunter 30,5 cm Mörser mit dem Feuer einsetzen. Sieben Uhr fünfundfünfzig Minuten hatten die Pioniere die Drahthindernisse zu durchschneiden und um acht Uhr hatte alles aus den Schützengräben loszubrechen. Ich schlief die Nacht sehr gut. Als am Morgen die Artillerie das Feuer eröffnete, begann ich die Wirkung zu beobachten. Eine halbe Stunde nach der anderen verrann und die russischen Gräben blieben verschont. Die Artillerie richtete ihr Feuer hinter die Schützenstellungen gegen mutmaßliche Reserven und auf die Verbindungswege hinter der Front. Manchmal schwoll das Getöse der Artillerie zu furchtbaren Donner an. Jedes Auge war gespannt nach vorn gerichtet. Besonders die Wirkungen der 30,5 Mörser, die hohe Erdsäulen hoch über die Dächer des Dorfes empor schleuderten, fesselten alle Leute so, dass sie wohl für eine kurze Zeit vergaßen, wie Schweres ihnen bevorstand. Ich wurde immer besorgter um das Schicksal des Angriffes, denn die russischen Stellungen vorne blieben verschont. Ich meldete es auch öfter zum Regiment. Es hatte aber keinen Erfolg. Ich glaube, wenn einer der Verantwortlichen vorn gewesen wäre, hätte man die Infanterie gegen die unerschütterten russischen Schützenlinien nicht losgelassen. Aber das war eben ein Beispiel für die Nachteile des Telefons, das mit Schuld daran ist, dass die Befehlshaber viel zu selten nach vorn kommen. Sie würden vorne ein anderes Bild gewinnen. Der Zeiger der Uhr rückte immer näher gegen acht. Als es höchste Zeit war, lies ich die Leute erst umhängen, um sie zu beschäftigen und ihnen so die ersten schweren Sekunden zu erleichtern. Denn ist erst einmal der Angriff angesetzt, dann ist auch das Schwerste überwunden. Pünktlich krochen die Pioniere heraus und zerschnitten die Drahthindernisse. Fünf Minuten später erhob sich aus unseren Gräben - soweit das Auge reichte - wie in einem Zaubermärchen, die angreifende Infanterie. Von meiner Kompanie waren es zwei Züge, die in der Feuerlinie sein sollten. Auf die Sekunde sprang jeder die Stufen empor, die er kurz vorher geschlagen. Mancher Seite 73 von 80 hatte sich die Stufen für das eigene Grab geschaufelt, denn die unerschütterte russische Infanterie ließ uns ein wohlgezieltes Feuer entgegenprasseln, das manchen schon bei dem Versuch, den Graben zu verlassen, niederwarf. Als die ersten zwei Züge draußen waren, ging ich mit dem Kompaniestab. Der dienstführende Feldwebel und die vier Gefechtsordonanzen waren bei mir. Nach zwei Sprüngen war ich allein. Der Feldwebel war gefallen, die Ordonanzen waren alle verwundet. Da raste ich in Sprüngen, so rasch ich sie meinem Körper abzwingen konnte, der Feuerlinie nach und ging nun mit ihr gegen die für die Kompanie bestimmte Einbruchsstelle. Da machte sich das Flankenfeuer, das ich im Voraus kommen sah, so unangenehm bemerkbar, dass ein Teil meiner Leute gegen das Flankenfeuer zu durchgingen. Mit dem Rest konnte ich die befohlene Richtung einhalten. Das russische Feuer wurde immer stärker und war ausgezeichnet gezielt. Wir machten uns so dünn wie ein Blatt Papier und krochen und wälzten uns vorwärts. Nach einigen Stunden hatten wir die letzte Bodenwelle vor den russischen Gräben erreicht. Hier mussten wir trachten, die volle Feuerüberlegenheit zu gewinnen, denn bis zum Drahtverhau gab es keine Deckung mehr und bis dorthin waren es noch 500 Meter. Die Leute, die um mich waren, setzten sich schon aus den verschiedensten Kompanien zusammen. Auch zwei Maschinengewehre reitender Tiroler Landesschützen hatte ich in meiner Nähe. Und da begannen wir denn mit dem Feuergefecht. Leider häuften sich die Verluste, da die Russen ausgezeichnet schossen. In meiner Nähe gab es schon Tote und Verwundete, gar nicht die gerechnet, die beim Vorrücken liegengeblieben waren. Da gruben wir uns ein und gedachten einen günstigen Augenblick für den nächsten Sprung abzuwarten. Auch ich schoss fleißig mit. Dabei schlug mir ein Treffer das Gewehr aus der Hand. Ich ergriff ein zweites Gewehr und feuerte weiter; da ritzte mir ein Streifschuss am rechten Handgelenk die Haut, dass einige Bluttropfen austraten. Da und dort schrie einer auf. Das Schicksal hatte ihn erreicht. Von Zeit zu Zeit ließ ich nach rechts und links weitersagen: Spaten hoch, um zu sehen, wie es mit meiner Schar bestellt sei. Nach jedem Ruf „Spaten hoch“, war die Zahl geringer geworden. Seite 74 von 80 An ein Vorwärtskommen war nicht zu denken, denn unsere Artillerie wirkte noch immer nicht gegen die russischen Schützenlinien. Langsam arbeitete sich nun auch meine Reserve heran und die Lücken konnten hier und da geschlossen werden. Da ließ ich von Zeit zu Zeit das Feuer einstellen, um Patronen zu sparen. Als ich in der Mittagsstunde wieder einmal „Spaten hoch“ nehmen ließ, und nach links schaute, habe ich wahrscheinlich mein linkes Bein zu sehr gehoben, so dass es aus der schützenden Furche herauskam. Da – auf einmal ein furchtbarer Schlag gegen meinen linken Oberschenkel. Die Gewalt des Schlages war so groß, dass er mich auf den Rücken umdrehte, ich lag auf dem Bauche, und ein rasender Schmerz ging durch den ganzen Körper, der auch jede Bewegungsfähigkeit eingebüßt hatte. Ein Nebenmann zog mir das gesunde Bein vom Kranken herunter und brachte das Kranke in gerade Lage; ich meinte, das nicht ertragen zu können, ertrug es aber doch. Dann schnitt man mir die Hosen auf, da sah man den Einschuss, aus dem nur wenige Bluttropfen hervorsickerten; das Bein war furchtbar angeschwollen. Ich schloss daraus auf eine schwere Verletzung, was ja auch schon daraus hervorging, dass ich mich gar nicht bewegen konnte. Über mich und um mich ging das rasende Feuer weiter. Mein Gedanke war, nur kein russischer Gegenangriff, denn in Gefangenschaft wollte ich nicht kommen. Trotz der großen Schmerzen blieb ich bei klarer Besinnung und konnte noch Anordnungen für das Gefecht geben; insbesondere nahm ich mich der Feuerleitung an. Die Leute sollten sich nicht verschießen, denn Munitionsersatz war schwer zu beschaffen. Darum ließ ich öfter Feuer einstellen. Ich lag aber ungeschützt im Infanteriefeuer. Die Kugeln schlugen ununterbrochen neben mir ein. Ich selbst konnte nicht die geringste Bewegung machen. Der Mann neben mir kratzte allmählich mit dem Spaten unter mir die Erde weg, so dass ich immer tiefer und tiefer sank und endlich gegen das Infanteriefeuer geschützt war. Wie lange das dauerte, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, es waren Ewigkeiten, während der ich in aller Geduld auf die nächste Kugel wartete. Sie verschonten mich aber, trotzdem sie in meiner unmittelbaren Nähe manche Verheerung anrichteten. Als ich einige Stunden gelegen hatte, kamen die Sanitätspatrouillen meiner Kompanie auf dem Bauche zu mir gekrochen. Es war aber unmöglich, mich wegzutragen. Wir wären alle miteinander von Kugeln zersiebt worden. Seite 75 von 80 Da gruben die Sanitätsleute neben mir ein Loch, stellten eine Tragbahre hinein und zog mich auf die Tragbahre, damit ich besser zu liegen käme. Die wenigen Dezimeter, die ich mich da bewegen musste bzw. die ich da bewegt wurde, waren wohl das Ärgste, was ich durchzumachen hatte. Nach einer langen Marter lag ich endlich auf der Bahre. Mit zusammengebissenen Zähnen hatte ich den Weg dorthin ertragen und fühlte mich außerordentlich erleichtert, als ich auf der Bahre lag. Von allen Seiten schob man mir noch Graspolster unter, so dass ich wirklich gut lag. Da musste ich nun liegen bleiben bis es ganz finster geworden war. Zum Mittag hatte ich den Schuss bekommen und nach neun Uhr begann man damit, mich wenigstens aus dem Feuerbereich zu bekommen, denn das Gefecht raste die ganze Nacht weiter. Nach langem Warten hieß es endlich: „Wir wollen es versuchen.“ Die vier Sanitätsleute legten sich neben mich. Jeder zu einem Fuß der Tragbahre. Der Korporal kommandierte: „Horuck“ und die Bahre schwankte aus der Grube auf das Feld und war nun wieder im Feuerbereich. Neben mir liegend schoben sie immer auf Armlänge die Bahre vor, bis endlich nach manchem qualvollen Ruck wir in eine Bodenmulde kamen, wo die Leute ein wenig verschnaufen konnten. Dann spuckten sie in die Hände und im Laufschritt ging es viele hundert Schritt über von den Kugeln noch bestrichenes Gelände. Das Surren der Kugeln klang bald näher, bald ferner, oft kam eine so nahe, dass man ihren heißen Atem spürte. Im Laufschritt wechselten die Träger mit unnachahmlicher Geschwindigkeit ohne stehen zu bleiben. Ihr Atem ging immer kürzer und stoßender. Endlich stellten sie mich wieder hin. Wir waren im Straßengraben in der Straße, die zum Verbandsplatz führte und in ziemlicher Sicherheit. Diese vollständige Hilflosigkeit, dieses Warten auf Glück oder Unglück ist wohl das Lähmendste, wenn man nichts dazu tun kann, um die Sache zu ändern bzw. zu bessern. Das Gefühl, so ganz hilflos auf der Bahre zu liegen, von Kugeln umsprüht, war noch viel niederdrückender als jenes, das sich bemerkbar machte, als wir im Ponton zusammengepfercht im feindlichen Feuer über den Dunajec schwammen. Endlich kamen wir zum Verbandsplatz, auf dem es schon viele, viele Gäste gab. Hin und wieder kam ein Geschoss von weit her und forderte noch manches Opfer. So riss auf dem Verbandsplatz noch ein Weitgänger einem Manne die Hoden weg. Nun nahm sich meiner der Arzt an. Er sagte mir gleich, der Fall ist schwer, der Krieg sei ein für alle Mal für mich zu Ende. Dann gab er mir Morphium in einigen Tabletten und meinte, ich möge mich zusammennehmen, das Verbinden wird schmerzen. Seite 76 von 80 Dann zogen zwei Sanitätsleute am Fuß, zwei andere am Oberkörper, der Arzt kommandierte scharf „fester und dann halten!“ Dann legte er mir den Notverband an. Die Träger hoben mich und stellten mich in eine Bauernstube. Dort lagen schon etliche Opfer des Kampfes. Neben mir ein Freiwilliger mit der selben Verwundung stöhnte ganz entsetzlich, dass man darüber die eigene Qual vergaß. Er ist an der Verwundung gestorben, wie mir der Arzt, der uns verbunden hatte, bei einem zufälligen Zusammentreffen in Brünn später erzählte. Von Schlafen war in dieser Nacht natürlich nicht die Rede, obwohl ich mich verhältnismäßig wohl fühlte. Der Arzt kam noch einige Male nachschauen. Auch der Feldkurat besuchte mich, den alten Sünder und Ungläubigen etliche Male, konnte aber mein Verlangen nach irdischer Speise nicht erfüllen. Der Morgen kam; er brachte den Truppenrechnungsführer des Regimentes, der mir die Hauptmannszulage bis zum Gefechte auszahlte und zugleich mitteilte, ich sei aus dem Stande gebracht und meinem Ergänzungsbezirk übergeben. Nachmittags setzte sich endlich eine lange Wagenreihe, die auch mich mitnahm, in Bewegung. Ein polnisches Bauernfuhrwerk, von einem Buben gelenkt, nahm mich auf. Dann fuhren wir etliche Stunden dahin – querfeldein – bis wir zu einer ungarischen Brigadesanitätsanstalt kamen. Dort humpelte und krabbelte alles von den Wagen. Mich hob man auch herunter und trug mich in das Operationszimmer, während die anderen in einer Scheune einen neuen Verband erhielten. Der Arzt sah mich bedenklich an; dann kamen wieder fünf Landsturmmänner, die hoben mich auf den Tisch, zwei Morphiuminjektionen und es ging los. Ein Drahtgeflecht in Beinform nahm meinen verwundeten Fuß auf und endlose Binden verwandelten ihn in Mumiengestalt. Auf die feuchten Binden schrieb der Arzt mit Tintenstift: „Fraktura femoris, Steckschuss, Gefäßverletzung“. Ich wurde in einem Hause zu anderen gelegt. Dann lud man mich wieder auf einen Wagen und wir kamen gegen Abend zu einem feldmaroden Haus. Hier muss es wohl viele hundert Verwundete gegeben haben. Auffallend war sogar für meine Teilnahmslosigkeit der Mangel an Ärzten und Pflegern und das Fehlen jedweder Bequemlichkeit. Von Reinlichkeit will ich gar nicht sprechen. Auf Stroh lagen die Schwerverwundeten nebeneinander. Rechts von mir ein Reichsdeutscher mit einem Bauchschuss. Er konnte das Wasser nicht lassen und litt deshalb unsagbar. Links von mir Oberleutnant Manek vom selben Regimente mit Seite 77 von 80 einem Schuss durch den Hals. Er wurde durch den After ernährt und schrieb mir einen Zettel um den anderen mit Todesahnungen. Ich sagte nur immer: „Du bist blöd, wegen so etwas stirbt man nicht.“ Mir gegenüber lag ein Reichsdeutscher, der beide Beine durchschossen hatte und ein Slowake, der wahnsinnig geworden war und immer wie ein Hund bellte. Dann noch einige, die mir nicht im Gedächtnis blieben. Dies alles begab sich in einem Zimmer, das fünf Schritt im Geviert gemessen haben dürfte. Eine lange Nacht und fast einen ganzen Tag lagen wir alle in dem engen Raum, dumpf und stier vor uns hinblickend. Ich wundere mich noch heute, dass ich während dieser Stunden gar so still war. Die anderen stöhnten, ächzten, fluchten und jammerten. Ich blieb ganz ruhig. Das kam wohl daher, weil ich mein ganzes Leben lang alles für mich allein still abgemacht hatte. Ich glaube, ich hätte auch zum Sterben niemanden gebraucht. Am Abend des nächsten Tages wanderte ich auf meiner Tragbahre wieder hinaus und wurde in ein Fuhrwerk verladen. Nun ging‘s zu einem Bahnhof. Dort nahm nach langem hin und her ein leerer Güterwagen drei Kämpfer auf. Einen Jägeroberleutnant mit durchschossener Brust, einen Artilleristen mit einer ähnlichen Verwundung wie meine und mich. Wir lagen ganz friedlich auf Stroh gebettet; hin und wieder rang sich mühsam ein Wort von unseren Lippen. Nach geraumer Zeit wurde der Jäger wieder herausgeschafft. Anscheinend ging es mit ihm zu Ende. Die Fahrt dauerte die ganze Nacht. Doch bescherte sie uns auch ein unliebsames Erlebnis. Der Zug geriet einige Male in Brand, hielt auf offener Strecke und es gab dann immer aufgeregtes Gerenne und Gerede. Unsere Gedanken waren zwar sehr träge, aber doch so lebhaft, dass wir es uns ausmalten, wie es sein würde, wenn der Brand weiter griffe, bis zu unserem Wagen. Da sagten wir dann ganz ruhig: „Wenn sie uns vergessen, verbrennen wir.“ Und erörterten ganz kaltblütig, dass wir infolge des Qualms schon vor dem Herannahen der Flammen ohnmächtig sein würden, und also der Tod gar nicht so schrecklich wäre. Am frühen Morgen kamen wir in Tarnow an; wir wurden am Bahnhof in einem Bett zur Ruhe gelegt, aber nach zwei Stunden in einen Sanitätswagen geladen, der uns in das Tarnower Truppenhospital brachte. Seite 78 von 80 Dort legte man uns wieder in ein Bett. Bald kam ein Arzt, der meinte, unser Fall passe nicht für das Truppenhospital. Da wurden wir wieder auf eine Bahre gelegt und ins Priesterseminar getragen, wo wir endlich zur Ruhe kamen. Hier blieb ich nun drei Wochen. Beim ersten Verbanderneuern standen vier Ärzte im Operationszimmer um mich herum, dann hatten sie in einer Ecke eine lebhafte Beratung. Schließlich wurde ich, nach Erneuerung des Verbandes, wieder ins Zimmer geschafft. Jeden zweiten Tag lag ich auf dem Operationstisch. Der Verband wurde erneuert und der Arzt stand und schaute und wackelte unmerklich mit dem Kopf. Da wusste ich, dass es schlimm mit mir stehen musste. Im Widerspruch dazu stand mein subjektives Wohlbefinden. Ich aß mit Hunger, trank jeden Tag einige Krügel Bier und rauchte wie ein Schlot. Schlafen konnte ich nicht; erst nach Sonnenaufgang schlummerte ich ein, wurde aber immer sehr bald durch den lebhaften Verkehr auf dem Gange geweckt. Das war so Tag für Tag. Gar bald war ich an das Krankenhausleben gewöhnt und fühlte mich recht wohl. Am besten gefielen mir das schöne Bett, das weiße Leintuch und angenehme Kopfpolster, lauter Dinge, die mir wie Grüße aus dem Märchenland erschienen. Nach etwas mehr als drei Wochen war ich endlich soweit, dass ich weiter geschickt werden konnte. Ein Schlafwagenzug nahm mich auf und nun ging es heimwärts. Unterweges hatte ich ein rührendes Erlebnis. Es war wahrscheinlich in Bochnia; der Zug hatte längeren Aufenthalt. Eine polnische Schwester ging mit Blumen und Erfrischungen durch den Zug. Bei mir blieb sie auch stehen und fragte, ob ich ein Deutscher sei. Ich sagte natürlich mit kräftigem Kopfnicken ja und da legte sie mir Kornblumen auf die Brust und sagte: „Da will ich Ihnen deutsche Blumen geben“ und verschwand. Nach mehr als vierundzwanzig Stunden hielt der Zug in Kolin. Hier wurden wir zwecks Entlausung sechs Tage zurückgehalten. Die benutzte ich, um mit der Heimat in Verbindung zu treten behufs Erlangung eines Spitalplatzes in Nordböhmen. Das gelang, und als Einzelreisender ging es auf der Tragbahre nach Reichenberg. An einem Sonntagvormittag kam ich dort an und wartete nun in Geduld Monat um Monat, bis ich wieder humpeln konnte. Seite 79 von 80 Mit dem Soldatsein war es für immer zu Ende. Als Invalid, zu jedem Dienste ungeeignet, wurde ich entlassen und kehrte wieder allmählich zu meiner früheren Beschäftigung zurück. Und bin nun seit eineinhalb Jahren wieder im großen Strom derer untergetaucht, die nicht mit dabei waren. Seite 80 von 80