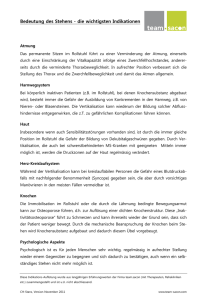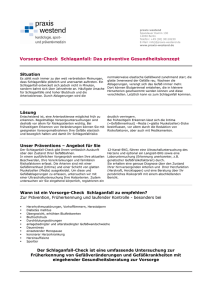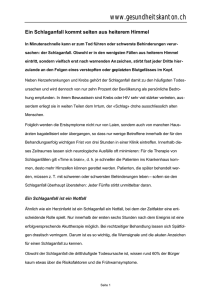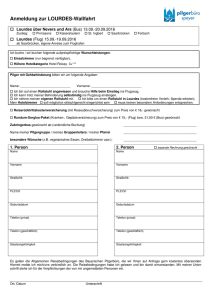Text, Dateigrösse 176KB
Werbung
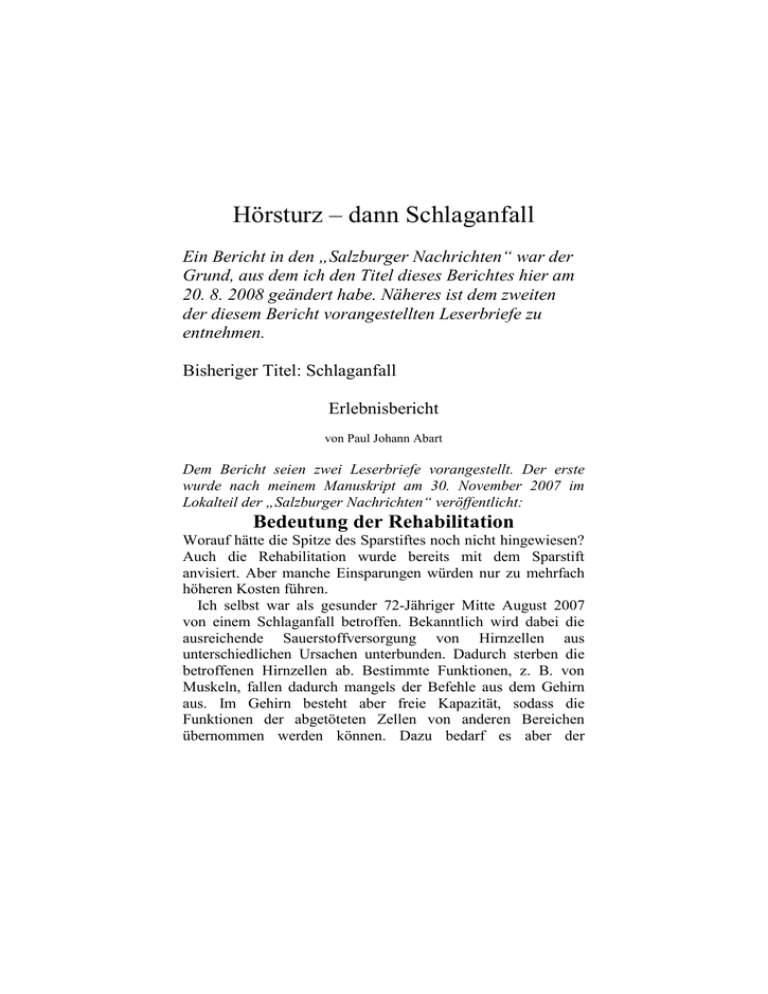
Hörsturz – dann Schlaganfall Ein Bericht in den „Salzburger Nachrichten“ war der Grund, aus dem ich den Titel dieses Berichtes hier am 20. 8. 2008 geändert habe. Näheres ist dem zweiten der diesem Bericht vorangestellten Leserbriefe zu entnehmen. Bisheriger Titel: Schlaganfall Erlebnisbericht von Paul Johann Abart Dem Bericht seien zwei Leserbriefe vorangestellt. Der erste wurde nach meinem Manuskript am 30. November 2007 im Lokalteil der „Salzburger Nachrichten“ veröffentlicht: Bedeutung der Rehabilitation Worauf hätte die Spitze des Sparstiftes noch nicht hingewiesen? Auch die Rehabilitation wurde bereits mit dem Sparstift anvisiert. Aber manche Einsparungen würden nur zu mehrfach höheren Kosten führen. Ich selbst war als gesunder 72-Jähriger Mitte August 2007 von einem Schlaganfall betroffen. Bekanntlich wird dabei die ausreichende Sauerstoffversorgung von Hirnzellen aus unterschiedlichen Ursachen unterbunden. Dadurch sterben die betroffenen Hirnzellen ab. Bestimmte Funktionen, z. B. von Muskeln, fallen dadurch mangels der Befehle aus dem Gehirn aus. Im Gehirn besteht aber freie Kapazität, sodass die Funktionen der abgetöteten Zellen von anderen Bereichen übernommen werden können. Dazu bedarf es aber der Aktivierung dieser Bereiche durch bestimmte Methoden, die Therapeuten durch ihre Ausbildung und Praxis anzuwenden wissen. Ich wurde zwei Wochen in der Christian-Doppler-Klinik untersucht und behandelt. Dabei wurde bereits mit der Therapie begonnen. Die Therapie wurde acht Wochen lang im RehabZentrum Großgmain fortgesetzt. Auch die übrigen Bedingungen dort sind dem Heilverfahren förderlich. Die Zuwendung und Gesprächsbereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, ein in der Praxis umgesetzter Leitsatz der Schwestern und Pfleger: »Den Menschen mit seinem Leben umgehen zu lassen, wie ich mit meinem umgehe.« (David Grason), gute Küche und umsichtiger Service in allen Bereichen. (In meinem Manuskript war dazu noch vermerkt: Sogar der freundliche Klang der LautsprecherDurchsagen unterscheidet sich wohltuend vom »Gebelle«, das man in manchen Einkaufszentren zu hören bekommt.) Für mich war der Erfolg der Therapien verblüffend. Obwohl anfangs rechtsseitig gelähmt, bin ich nun wieder so weit beweglich, dass ich alle Besorgungen erledigen und meinen Haushalt selbst führen kann. Ohne Rehabilitation wäre ich ein kostenintensiver Pflegefall geblieben. Paul Abart 5020 Salzburg Der zweite, der der Zeitung am 23. 7. 2008 übermittelt wurde, ist nicht veröffentlicht worden, soll aber hier den Lesern dieser Homepage zugänglich sein: Schlaganfall nach Hörsturz Auf der Seite „Wissen/Gesundheit“ der SN vom 5.7. wurde berichtet, durch repräsentative Untersuchungen in Taiwan sei festgestellt worden, dass in vielen Fällen auf Hörstürze Schlaganfälle gefolgt seien. Auch ich hatte im Jahr 2005 einen Hörsturz und – ohne irgendwelche asiatische Wurzeln – zwei Jahre später einen Schlaganfall mit zunächst rechtsseitiger Lähmung. Anscheinend bleibende Folge: eine auffallende Gehbehinderung. Wäre ich nach dem Hörsturz auf diese mögliche Folge hingewiesen und über die Merkmale des Beginns eines Schlaganfalles aufgeklärt worden, so hätte diese Behinderung durch sofortige richtige Reaktion wahrscheinlich vermieden werden können. Nach dem Hörsturz hatte ich immerhin zehn Tage in den SALK zur Untersuchung zugebracht. Geschehenes ist nicht mehr zu ändern, aber vielleicht kann anderen vorbeugend geholfen werden. Aus den Anamnesen von Schlaganfallpatienten müsste sich auch nachträglich noch feststellen lassen, wie oft Hörstürze dem Schlaganfall vorangegangen sind. Falls sich auch bei uns wie in Taiwan ein solcher Zusammenhang herausstellt, könnten die HörsturzPatienten auf einen eventuell darauf folgenden Schlaganfall vorbereitet werden. Paul Abart 5020 Salzburg Inhaltsverzeichnis Es werden keine Seitennummern angegeben, da sich die Anwendung des Word-Suchsystems als zweckmäßiger erweist. Das Ereignis Die schöne Zeit vorher Der Tag des Ereignisses Die Wirkung des Schwächeanfalls Lethargie Den Schlaganfall nicht erkannt Leben im Rollstuhl? Sonderbare Aktivitäten Organisation der Hilfe In der Klinik In die Schlaganfallabteilung gebracht Beginn der Behandlung Wird ein Stent eingesetzt? Verstopfung Hoffnungsschimmer Mobilität mittels Rollstuhls Endliche Erleichterung Beginn der Therapien Stroke Units Erstmals ein Schlafmittel Schwester mit Rasierapparaten Überstellung ins REHAB-Zentrum Verlust einer Jacke Positive Bilanz des Klinikaufenthaltes Im Rehabilitationszentrum Der Rollstuhl Schlaftablette Der Ablauf des ersten Tages Logopädie Visiten Motomed Standing Psychologische Diagnostik Ergotherapie Physiotherapie Zu wenig Selbständigkeit zugestanden Pflegeleitbild Zu sehr umsorgt Fachliche Kompetenz Private Sphäre Verlängerung der Rehabilitation Wieder in der Klinik Vorbereitung auf die Angiographie Gespräch mit der Oberärztin Ein Wochenende lang Freizeit Die Angiographie und Begleitumstände Eine letzte Peinlichkeit Die letzten zwei REHAB-Wochen Zurück ins REHAB-Zentrum Unerwartet rasche Heilung Urinalkondom Venenentzündung Wohnung im zweiten Stock ohne Lift Ein idealer Rollator Glück im Unglück Training im Stiegensteigen Eifrige Therapie-Übungen Trockenübung in der Badewanne Dank für Leistungen Hinkebein Halbtaube Glieder Dank Wieder unabhängig Wieder in der eigenen Wohnung Die Hilflosigkeit der ersten Tage nachgestellt Verzicht auf Heimhilfe und Pflegegeld Gefahr einer Wiederholung Das Ereignis Ich wurde völlig unvorbereitet von einem Schlaganfall getroffen. Nur wenige Monate vorher hatte ich mich einer Gesundenuntersuchung unterzogen, die mir für mein Alter von 72 Jahren beste Werte bestätigte. Alles normal, geringfügige, schon früher festgestellte Abweichungen waren durch Medikamente korrigiert. Ich fühlte mich auch bestens und wanderte wöchentlich einmal auf den Untersberg, den großen der Hausberge der Stadt-Salzburger, 1400 Meter Höhenunterschied. Ich hatte mich deshalb über Krankheiten, von denen ich mich nicht bedroht fühlte, nicht informiert. Ich wußte daher weder etwas über den Verlauf eines Schlaganfalls, noch über die Chancen einer Rehabilitation. Daher verharrte ich zu meinem Nachteil die ersten zwei Tage nach dem Anfall in völliger Lethargie. Um unnötige böse Folgen vermeiden oder wenigsten mildern zu helfen und um Betroffene zu ermutigen, möchte ich über meine Erlebnisse und die in Verbindung damit erfahrenen Kenntnisse berichten. Ich muß dazu aber betonen, daß ich hier medizinische Informationen nach bestem Wissen und Gewissen wiedergebe, für die Richtigkeit jedoch keine Gewähr geben kann. Ich werde hier auch Medikamente, die mir verordnet waren und die ich anwendete, nicht namentlich bekannt geben. Ich möchte nicht dazu verleiten, daß jemand irgendein Medikament – soweit es ohne ärztliche Verschreibung erhältlich ist – ohne Konsultation eines Arztes verwendet. Warnung: Obwohl dies von der Art des Falles nicht indiziert ist, hatten sich Probleme mit Harn, Stuhlgang und Blut ergeben. Ich möchte daher allen, die auf die Schilderung solcher „unappetitlicher“ Abweichungen von der hygienischen Normalität empfindlich reagieren und keinen Informationsbedarf haben, vom Lesen dieses Berichtes abraten. Ich wollte viele Details unterbringen, und der Bericht erreicht daher einen beträchtlichen Umfang. Wem es trotz Interesses an Zeit oder Geduld fehlt, so umfangreiche Informationen zu lesen, der hat durch den vorangestellten Leserbrief eine Kurzinformation bekommen: Es kommt bei einem Schlaganfall, ähnlich wie bei einem Infarkt, auf schnelle ärztliche Hilfe an, Und zum Unterschied von manchen anderen schweren Schädigungen des Organismus bestehen in den meisten Fällen gute Chancen auf Rehabilitation. Nach einem Schlaganfall also den Mut nicht verlieren! Im Internet sind übrigens auch fachliche Informationen über den Schlaganfall zu finden. Bezüglich der Rechtschreibung im folgenden Bericht verweise ich auf die HTML-Seite „Rechtschreibung“ dieser Homapage. Die schöne Zeit vorher Seit ich harte Nachwirkungen aus der vorzeitigen Beendigung meines selbständigen Berufes überwunden hatte (siehe »Opfer der Politik« in dieser Homepage!), konnte ich meine Pensionsjahre auf angenehme Weise verbringen. Ich lebte allein und konnte mich endlich all jenen Beschäftigungen zuwenden, zu denen ich von Kindheit an meine eigentliche Berufung empfunden hatte, die mir aber den Lebensunterhalt nicht ermöglicht hätten. Ich hatte folglich 45 Jahre lang andere Aufgaben erfüllen müssen und gewissenhaft erfüllt, ehe ich mich ganz jenen Tätigkeiten widmen konnte, die mich faszinierten: In der Hauptsache das Schreiben von Belletristik, dann die Studien von Themen-Grundlagen, das Lesen zur Bildung oder Unterhaltung, das Hören von »klassischer Musik« zur Erbauung oder Unterhaltung und, zu erlebnisreichem Ausgleich, das Bergwandern. Neben diesem vom Alltäglichen abgehobenen Erleben und erhebendem Schaffen gab es natürlich auch Banales zu verrichten wie die Arbeiten im Haushalt. Der Tag des Ereig nisses Aber auch aus der Vergangenheit gab es manches aufzuarbeiten – Ödes und Reizvolles. Zum Reizvollen zählte die Übertragung alter Fotos und Dokumente in den Computer. Ich hatte damit begonnen, Bilder aus alten Alben, DiasSammlungen und sonstigen Bilder- und DokumentenSammlungen in den Computer zu übertragen und zu ordnen, um sie für meine Kinder auf externe Speichermedien zu kopieren. Dies sollte es ermöglichen, jedem meiner drei Kinder die solcherart gespeicherten Erinnerungen an familiäre Geschehnisse und Entwicklungen zu übereignen. Diese Erinnerungen dabei auf dem Bildschirm aufleben zu lassen, war für mich, wie gesagt, eine reizvolle Betätigung. Am Sonntag, den 12. August 2007, saß ich von Mitte des Vormittags bis in den Abend hinein bei den Bildern aus dem Jahr 1978 am Computer. Ich hatte Freude daran, denn die Kinder waren im Jahr 1978 zehn, sieben und fünf Jahre alt. Und wir hatten damals viel gemeinsam unternommen. Ich hatte diese Arbeit nur kurz zu einem Mittagessen und zu einem Abendessen unterbrochen, und ich hoffte, »das Jahr 1978« noch fertigzubringen. Etwa zwei Stunden Arbeit hatten noch gefehlt. Doch um 20 Uhr fühlte ich plötzlich die Kraft aus dem rechten Arm schwinden. Die Wirkung des Schwächeanfalls Es machte mir Mühe, den Arm zu bewegen. »Was wird weiter geschehen?« fragte ich mich besorgt. Und ich hatte die Idee, auf einem Blatt Papier zu notieren, was geschah, damit meine Kinder informiert würden, falls ich später zu keiner Mitteilung mehr fähig sein sollte. Währenddessen kam ich auf die Idee, den Blutdruck zu kontrollieren. Denn ich war bei zu stark abgesunkenem Blutdruck bereits zweimal hintereinander kollabiert. Ich hatte aber versäumt zu bedenken, daß ich keine Anzeichen eines Kollapses verspürte. Die Messergebnisse hielten sich im Bereich des Normalen. Bald war ich zum Schreiben zu schwach und beschloß, mich ins Bett zu legen. Ich war aber nicht mehr kräftig genug, um mein Joka-Ausziehbett herzurichten. Aber ich hatte ein Not-Nachtlager. Falls ich über Nacht Gäste gehabt hatte, hatte ich ihnen das Joka-(Doppel)Bett überlassen, während ich mir, wie ich es aus früheren Jahren von Berghütten gewohnt war, im Arbeitszimmer ein »Matratzenlager« herrichtete. Ich hatte gerade noch genug Kraft, die Matratze aus dem Abstellraum zu holen, das über zwei Stuhllehnen ausgebreitete Bettzeug zu ergreifen, und mich hinzulegen. Im nächsten Augenblick fühlte ich, daß der rechte Arm und das rechte Bein völlig gelähmt waren. Irgendwann waren diese Vorgänge auch von einem Schweißausbruch begleitet worden. Lethargie Ich lag nun hilflos auf der Matratze am Boden. Das Telefon, mit dem ich um Hilfe rufen hätte können, war an der Wand in einer für mich in diesem Zustand unerreichbaren Höhe befestigt. Nachbarn durch Klopfzeichen zu alarmieren, erschien zwecklos. Damit ließe sich keine ausreichende Verständigung herstellen. Bald wurde das erste Problem regsam: Harndrang. Ich konnte mich aber nicht erheben. Eine höchst peinliche Situation. Gab es keine andere Möglichkeit, als den Harn einfach auf die Matratze fließen zu lassen? Auf dem Couch-Tisch links neben meinem Lager stand eine fast geleerte Orangensaftflasche, eine Flasche mit weitem Flaschenhals. Wenn ich die erreichen könnte! Sie stand in Nähe des Tischrandes. Ich streckte die linke, unversehrte Hand nach der Flasche aus. Ein kleines Stück Reichweite fehlte. Ich versuchte mit Hilfe der linken Gliedmaßen ein kleines Stück nach links zu rücken. Es gelang mit Mühe, und ich hielt die Flasche in der Hand. Ich trank den Rest des Orangensaftes aus – im Liegen gar nicht so einfach – und hatte nun nach dem Vorbild der Methode im Krankenhaus eine Harnflasche verfügbar. Sogar eine mit Schraubverschluß. An weiteres dieses Abends vermag ich mich nicht mehr zu erinnern. Wahrscheinlich war ich müde und schlief ein. Den Schlaganfall nicht erkannt Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mir die Situation voll bewußt. Über Nacht hatte sich keine Veränderung ergeben. Die rechten Gliedmaßen waren gelähmt. Rechter Arm und rechte Hand lagen unbeweglich flach auf der Matratze. An der Hand konnte ich lediglich den Zeigefinger ein wenig bewegen. Vom rechten Bein, das ebenso steif und fast gefühllos auf der Matratze lag, konnte ich lediglich das Knie ein wenig anheben. Ich sah Parallelen zum Gehörsturz, den ich vor zwei Jahren erlitten hatte. (Siehe Bericht unter »Eine Krankengeschichte« in dieser Homepage!) Damals war ich unmittelbar davor noch mit städtischen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Nachdem ich heimgekehrt war und mittaggegessen hatte, wurde ich von Brechreiz und Schwindel befallen. Von diesen Übelkeiten war ich nun verschont geblieben; diesen Unterschied führte ich darauf zurück, daß damals ja in Verbindung mit dem Gehör das Gleichgewichtsorgan betroffen war. Alles, was ich von einer Ärztin über den »Gehörsturz« erfahren hatte, war, daß eine Nervenverbindung unterbrochen sein dürfte. Nach zehn Tagen Untersuchungen in den Landeskrankenanstalten hatte sich keine konkrete Ursache herausgestellt. Und in den seitdem vergangenen zwei Jahren war keine entscheidende Besserung eingetreten. Ich nahm daher an, daß wieder eine Nervenverbindung unterbrochen sei; dieses Mal zu Bereichen im Gehirn, die für die Bewegung der Muskulatur der rechten Gliedmaßen zuständig sind. Ich folgerte weiter, daß auch gegen diesen »inneren Unfall« wie seinerzeit gegen den Gehörsturz keine Hilfe möglich sein würde. Leben im Rollstuhl? Wie wäre ein Weiterleben vorstellbar? Würde ich in einen Rollstuhl gesetzt werden können? Ich testete, ob die lahmen Glieder passiv bewegt werden konnten. Ich versetzte mit dem gesunden linken Arm den rechten in verschiedene Bewegungen. Das war möglich, und sogar, ohne Schmerzen zu verursachen. Ich legte das linke Bein unter die Kniekehle des rechten, und es gelang, das Knie höher anzuheben, und mit dem linken Fuß unter der rechten Wade vermochte ich das ganz rechte Bein anzuheben. Demnach müßte also ein Sitzen im Rollstuhl möglich sein. Mit dem Rollstuhl könnte ich vor dem Computer sitzen und mich auf das Schreiben allein mit der linken Hand einüben. Das Schreiben würde mir zum Weiterleben genügend Lebensqualität bieten. Ich brauchte mir also nur vom Hausarzt einen Rollstuhl verschreiben zu lassen und eine Pflege- und Haushaltshilfe durch einen der sozialen Dienste beantragen. Mein Hausarzt war aber auf Urlaub und würde erst in zwei Wochen wieder erreichbar sein. Bis dahin würde mich vielleicht jemand vermissen und Hilfe organisieren. Ich brauchte also nur zu warten. In dieser Erwartungshaltung blieb ich den ganzen Montag, den 13. August, auf der Matratze liegen. Ich empfand weder Hunger noch Durst. Da ein Obstkorb in Reichweite auf dem Fußboden stand, aß ich am Abend einen Apfel. Und offenbar war mir sodann die ganze Nacht hindurch ruhiger Schlaf gegönnt. Sonderbare Aktivitäten Es schien zunächst, daß ich auch am Dienstag, den 14. August, inaktiv bleiben würde. Aber es hatten sich nun doch Hunger und Durst bemerkbar gemacht. Ich hatte im Küchenabteil auf dem Boden einige Packungen Apfelsaft und einige Flaschen Mineralwasser stehen, in einem Küchenkasten lagerte in geringer Höhe ein angebrauchter Wecken Brot und auch die Vorräte im Kühlschrank schienen erreichbar. Ich brauchte nur ins Küchenabteil zu robben. Mit einiger Mühe konnte ich mich auf der Matratze umdrehen. Soweit es nicht um ein Aufrichten ging, konnte ich mit den gesunden linken Gliedmaßen einige Körperbewegungen ausführen. Ich lag schließlich bäuchlings, zum Bücherregal hinter dem Kopfteil des Lagers gewendet, auf dem Parkettboden. Ich mußte mich zuerst einige Meter, die Füße voran, zurückschieben, um mich in Richtung Küchenabteil drehen zu können. Als ich mich gedreht hatte, versuchte ich, mich ein wenig aufzurichten. Ich gedachte, mich in Krabbelhaltung wie ein Baby fortzubewegen. Während ich mich mit linkem Arm und linkem Knie aufzurichten versuchte, kippte ich sofort zur Seite. Ich lag also auf den rechten lahmen Gliedern. Das schmerzte ein wenig. Ich drehte mich in die Bauchlage zurück, was auf dem glatten Parkettboden leichter gelang als auf der Matratze. Die Fortbewegung war also nur möglich, indem ich die linke Handfläche vorstreckte, auf dem Fußboden festdrückte und den Körper nachzog. Da meine Hände stets trocken sind – der Schweißausbruch hatte nur anfangs kurz gedauert –, gelang das nur Zentimeter für Zentimeter. Bei so langsamer anstrengender Fortbewegung muß möglichst viel auf einmal transportiert werden. Ich entnahm den in einem der unteren Fächer der Küchenkasten in einer Plastiktasche aufbewahrten Rest-Wecken Brot, aus dem Kühlschrank eine angebrauchte Mettwurst und schob dies mit mehreren ApfelsaftPackungen und Mineralwasser-Flaschen vor mir her zum Lager. Das alles mit der linken Hand vor mir herzuschieben war einfacher, als mich selbst voranzubewegen. Ich konnte nun Hunger und Durst stillen. Die natürliche Folge verspürte ich einige Stunden später: Stuhldrang. Also ins Badezimmer mit WC robben. Dazu mußte es mir aber zuerst gelingen, die Wohnzimmertüre zum Vorzimmer zu öffnen. Ich hatte diese Türe am Sonntag abend noch schließen können, um den fallweisen nächtlichen Lärm aus dem engen Hof abzuhalten. Das Öffnen erwies sich aber nun als großes Problem. Wie würde ich zur Türschnalle hinaufreichen. Wäre die Türe nach außen aufgegangen, so hätte ich versuchen können, mich mit dem Rücken an Türe und Türstock gelehnt, ein wenig aufzurichten, um mit der nach rückwärts gerichteten linken Hand die Türklinke zu drücken. Daß ich dann aus der sitzenden Haltung rücklings auf den Boden gefallen wäre, wäre nicht schlimm gewesen. Aber die Türe ging nach innen auf. Aus der auf dem Rücken liegenden Haltung reichte die linke Hand nicht zur Türschnalle. Ich versuchte es mit dem Fuß. Bein und Fuß sind ja etwas länger als Arm und Hand. Wäre ich von größerem Wuchs, so hätte ich die Schnalle erreicht. Ich versuchte dann doch, mich an der Türe aufzurichten. Wenn es gelänge, die Schnalle zu drücken und mich danach sogleich nach vorne zu neigen, wäre die Türe offen. Aber ich vermochte nicht, nahe genug zur Türe hinzurutschen. Rechts von der Türe stand, wie an fast allen Wänden in meiner Wohnung, ein Bücherregal. In geringer Entfernung von der linken Seite des Türstocks ragte die Begrenzungsmauer des Küchenabteils ein Stück ins Wohnzimmer. Wenn es mir gelänge, mich mit dem linken Fuß an der Mauer abzustützen und mich dabei, mit dem Rücken an die Regalwand gelehnt, aufzurichten, müßte ich, die linke Hand über die Brust gestreckt, zur Türschnalle reichen. Ich rutsche aber immer wieder von der Regalwand ab und kippte nach links. Ich setzte den linken Fuß etwas weiter außen an und versuchte weiter, mich aufzurichten. Ein erstes Stück konnte ich mich ja mit der linken Hand auf dem Fußboden stützen. Und dann müßte ich mich durch das Anschieben mit dem an die Mauer gestützten Fuß weiter aufrichten können. Aber beim Greifen nach der Schnalle verlor ich nochmals den Halt. Nach mehrmaligen Versuchen und mehrmaligem Rasten gelang es mir mit schnellem Griff, die Schnalle hinunterzudrücken, und, indem ich mich, die Hand an die Schnalle geklammert, nach rechts fallen ließ, zu öffnen. Die Tür war also offen. Ich würde mich dadurch verständigen können, falls jemand an die Wohnungstüre kommen würde, und eventuell wären draußen auf dem Hausgang auch laute Hilferufe von mir zu vernehmen. Aber vorerst wollte ich ins WC. Ich überlegte mir vorher noch, daß ich mich am besten fortbewegen könne, wenn ich auf dem Rücken liegend mit dem linken, dem gesunden Fuß antauchen würde. Tatsächlich kam ich auf diese Weise ungleich schneller voran. Im WC angelangt, mußte ich aber ein neues unüberwindbares Problem erkennen. Ein »Das geht nicht«, oder »Das ist nicht möglich«, kam für mich immer nur in Frage, wenn die Verwirklichung eines Vorhabens aussichtslos war, wenn es unvernünftig gewesen wäre, ein bestimmtes Ziel, weil höchst wahrscheinlich unerreichbar, dennoch anzustreben. Der Fall war nun eingetreten. Organisation der Hilfe Es kam nun unbedingt darauf an, daß ich Hilfe erreichte. Vielleicht würde es mir gelingen, eine Nachbarin, der ich manchen guten Dienst geleistet hatte, bitten, mir zu helfen, bis mein Hausarzt zurück sein würde. Mir Einkäufe zu besorgen, unaufschiebbare Arbeiten im Haushalt zu erledigen, und mir ihr Handy zu borgen, damit ich mir einen Rollstuhl beschaffen könne. Wenn dann das Bett hergerichtet sei und man mich ins Bett gelegt habe, würde ich mit Hilfe der Nachbarin vom Bett in den Rollstuhl gelangen können. Vom Rollstuhl aus würde mir dann auch die selbständige Benutzung des WC möglich sein. Wenn jemand meine Hilferufe hören solle, müsse aber erst noch ein Schlosser kommen, um die Wohnungstüre zu öffnen. Es wird daher sinnvoll sein, daß ich versuche, auch die Wohnungstüre selber zu öffnen, überlegte ich mir. Bei der Türe war ich nach neuer Methode, am Rücken liegend und mit dem gesunden Fuß antauchend, relativ schnell. Aber die Schnappschloß-Türe war versperrt. Es war mir bekannt, daß man ein Schnappschloß mit einem Schlag an die richtige Stelle öffnen kann. Ein zu Hilfe gerufener Schlosser hatte mir dies vorgeführt, als mir einmal die Türe zugefallen war, und ich mich ohne Schlüssel draußen befunden hatte. Seitdem hielt ich es für notwendig, mich vor bösen Überraschungen zu schützen, indem ich die Tür absperrte. Da ich aber von vornherein nicht ausschloß, daß ich in meinem Alter einmal von einem Infarkt betroffen werden könnte, zog ich nach dem Absperren stets den Schlüssel innen ab. Die Tür sollte von einem Schlosser geöffnet werden können. Das war nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme. Ich hatte mir auch einen Anrufbeantworter mit Schnurlostelefon angeschafft (ich besaß kein Handy), um notfalls die Rettung anrufen zu können. Aber dieses Gerät hatte ich wegen unzulänglicher Bedienungsanleitung noch nicht in Gang setzen können. Vielleicht wäre mir dies gelungen, wenn ich die komplette Anleitung im Kleindruck auf 51 DIN A 5-Seiten sorgfältig durchstudiert hätte. Aber ich hatte mir nur jene Details angesehen, deren Inbetriebsetzung mir für meine Zwecke am wichtigsten schien. Aber vielleicht hätte ich die Anruf-Gelegenheit auch nicht genutzt, weil mir nicht bewußt war, daß ich einen Schlaganfall erlitten hatte, und daß es auf sofortige Hilfe angekommen wäre. Der Schlüssel der Wohnungstüre lag in 73 cm Höhe in einem Regalfach nahe der Türe. Ich hatte das Regalfach mit der linken Hand vom Boden aus zwar erreichen können, aber der Schlüssel lag zu tief im Fach. Daß er in diesem Fach lag, wußte ich genau, wenn ich ihn auch nicht sehen konnte. In Reichweite lag ein dreißig cm langer Schuhlöffel, den ich als Greifwerkzeug benützen konnte. Damit konnte ich alles, was in dem Fach lag, herausstreifen. Der Schlüssel fiel zu Boden, auf meine Ebene also. Der Schlüssel war aber in einer Höhe von 98 cm ins Schloß zu stecken. Das Vorzimmer ist schmal. In Nähe der Türe steht auf der Seite des Schlosses ein selbst gebasteltes Schuhregal. Wenn es mir gelingen würde, mich an diesem Regal aufzurichten, könnte ich mit dem Schlüssel das Schloß erreichen. Dazu hätte ich mich an der nahen gegenüberliegenden Wand mit dem linken Fuß abstützen können. Aber am Schuhregal befand sich ein nach hinten schräg liegendes scharfkantiges Fach. Hätte ich beim Bauen dieses Regals gewußt, daß ich einmal mit dem Rücken gegen diese Kante drücken müsse, hätte ich dieses Fach an der Vorderseite gepolstert. Aber nun mußte ich versuchen, mich an diesem Regal abzustützen und aufzurichten. Es gelang zwar, solange ich mich mit der linken Hand auf den Boden stützen konnte. Aber ich mußte dann ja mit der Linken den Schlüssel zum Schloß führen. Dabei kippte ich wieder um. Andrerseits war mir klar, daß dies die einzige Möglichkeit sei, in eine Position zu kommen, um die Türe zu öffnen. Ich rastete zwischendurch und versuchte dann immer wieder, unter Schmerzen durch den Druck der scharfen Kante, mich aufzurichten. Ich plagte mich fast eineinhalb Stunden, bis es mir schließlich gelang, die Türe zu öffnen. Die Türe stand nun offen. Wie gut die frische Luft tat! Ich horchte nach Stimmen und Schritten. Sooft ich jemanden hörte, rief ich um Hilfe. Nicht mit panischem Geschrei, sondern einfach laut: »Hilfe, bitte!« Nach einem solchen Ruf hörte ich von bekannter Stimme: »Das ist der Paul.« Und der hilfsbereite Nachbar war bald an der Türe. Ich bat den Nachbarn, die Nachbarin zu verständigen, von der ich weitere Hilfeleistung erwarten konnte. Falls die Nachbarin gerade in der Arbeit sei, möge deren 13jährige Tochter an die Türe kommen. Bald darauf kam die Tochter der Nachbarin. Ich gab ihr den Wohnungsschlüssel und bat, sie möge ihrer Mutter, sobald sie heimkomme – das würde nach zwanzig Uhr sein – die Situation schildern und ihr meine Bitte mitteilen, daß sie zu mir kommen möge. In der Klinik In die Schlaganfallabteilung gebracht Ich robbte zu meinem Lager zurück und wartete ein paar Stunden. Kurz nach zwanzig Uhr kam die Nachbarin. Sie habe kein gutes Gefühl, meinte sie, als ich ihr mitteilte, zwei Wochen bis zur Rückkunft meines Hausarztes zuwarten zu wollen. Einige Minuten später standen zwei Männer und eine Frau von der Rettung und die Nachbarin an meinem Lager. Sie hätte es nicht verantworten können, mich hier liegenzulassen, erklärte die Nachbarin. Jetzt noch meine Überführung ins Krankenhaus durch die Rettung abzulehnen, wäre sinnlos gewesen. Ich wurde in die Christian-Doppler-Klinik, die Salzburger Landesnervenklinik, gebracht. An irgendeiner Zugangstüre sah ich, daß ich in die Schlaganfall-Abteilung eingeliefert wurde. Aufgeklärt, daß ich von einem Schlaganfall betroffen sei, wurde ich nicht. Vielleicht haben die Ärzte gar nicht erfahren, daß ich nicht ins Krankenhaus gebracht, sondern zwei Wochen auf die Rückkehr meines Hausarztes warten wollte. Aber die Rettungsleute werden schon aus eigener Erfahrung erkannt haben, wo ich hingehörte. Und daß einseitige Lähmungserscheinungen für einen Schlaganfall typisch seien, wurde mir nun bewußt. Beginn der Behandlung Es war bereits 20,30 Uhr. Ich bekam ein Blutverdünnungsmittel in den Bauch injiziert – daß es ein Blutverdünnungsmittel war, erfuhr ich erst tags darauf. Diese Spritze bekam ich fortan täglich morgens und abends. Und an diesem ersten Abend folgte eine Infusion in den linken Arm. Im übrigen wurden mir fast dieselben Medikamente verabreicht, die ich davor nach Verschreibung durch meinen Hausarzt eingenommen hatte. Nur die Tabletten zur Blutverdünnung waren durch die Injektionen ersetzt und zur Regulierung des Blutdrucks bekam ich ein anderes Medikament. Ich wies darauf hin, daß ich auch zwei verschiedene Sorten von Augentropfen anwenden müsse. Man wollte mich daher in die Augenklinik bringen. Mir war aber bekannt, daß dort sehr großer Andrang herrschte. Ich hätte nur im Bett hingebracht werden können und ich hätte dort womöglich stundenlang im Bett auf dem Gang warten müssen. Wie wäre ich dort bei Bedarf zu einer Harnflasche gekommen? Ich erklärte daher, daß ich vom Augenarzt erst vor kurzem gründlich untersucht worden sei und die Tropfen verschrieben bekommen habe. Ich könne mir die Tropfen von daheim bringen lassen. Das wurde akzeptiert. Wird ein Stent eingesetzt? Bereits am ersten Abend begannen die Untersuchungen. Tags darauf wurden die Untersuchungen fortgesetzt. An der MRIUntersuchung war ein Arzt beteiligt, der mich kannte. Von ihm erfuhr ich nun die offizielle Diagnose: Schlaganfall. Und daß ich in den ersten Minuten in die Klinik gebracht werden hätte müssen, daß dann die Lähmung wahrscheinlich verhindert werden hätte können. Aus der MRI-Untersuchung ergab sich der Verdacht auf Verengung einer der Halsschlagadern. Möglicherweise werde ein Stent eingesetzt werden müssen. Die zuständige Fachärztin sei aber auf Urlaub, und die Klärung dieser Frage müsse daher aufgeschoben werden. An einem der nächsten Tage wurde einem mir im Krankenzimmer mit zwei Betten benachbarten Patienten ein Stent (eine Röhre aus einem Metallgeflecht, durch die das verengte Gefäß erweitert wird) in eine Halsschlagader eingesetzt. Ich wunderte mich, warum an ihm diese Behandlung vorgenommen werden konnte, ich aber auf die Rückkehr einer zuständigen Fachärztin warten mußte. Den Arzt, mit dem ich bekannt war, traf ich nicht mehr. Andere Ärzte zu fragen, hielt ich nicht für sinnvoll. Soweit überhaupt, hätte ich wahrscheinlich eine unverständliche medizinische Fachauskunft bekommen. Ich würde die abschließenden schriftlichen Befunde abwarten. Diese vermöchte ich mit Hilfe von Wörterbüchern zu übersetzen. Meine Latein- und Griechischkenntnisse aus der Mittelschule waren dabei erfahrungsgemäß wenig hilfreich. Verstopfung Schon in den nächsten Tagen wurde ich von der Schlaganfallabteilung in die ein Geschoß höher gelegene allgemeine Akut-Abteilung verlegt, dort in ein Vierbettzimmer. Ein Problem folgte mit, es verfolgte mich eigentlich seit dem Schlaganfall. Ich hatte schon tagelang keinen Stuhlgang. Diese Störung hatte ihre Ursache vielleicht in der Stuhlverhaltung, als ich daheim nicht auf die Muschel gelangen konnte. Ich hatte zudem das Gefühl, daß irgendeine Trägheit im Inneren den Stuhlgang ausbleiben ließ. Ich war dadurch nicht besonders beunruhigt, weil mir bekannt war, daß im Notfall ein harmloses Radikalmittel eingesetzt werden könnte: ein Einlauf. Zunächst ergaben sich damit aber allerlei Probleme. Als ich meinte, Stuhldrang zu verspüren, brachte mir die Schwester die »Schüssel«. Die derzeit in den Krankenhäusern verwendeten Schüsseln sind aber äußerst flach beschaffen. Das mag den Vorteil haben, daß sie leicht unterzuschieben sind. Aber ich fühlte, daß die Gesäßbacken den Boden der Schüssel berührten. Wie soll man dabei zurechtkommen? Mir blieb nichts übrig, als mich zur »Enthaltsamkeit« zu entschließen. Das unangenehmste war, daß auch Blähungen hinausdrängten. Ich konnte aber nicht mit Sicherheit unterscheiden, was da kommen würde. Tatsächlich wurde einmal eine Unterhose total beschmutzt. Ich bat die Schwester um einen Müllsack, verstaute sie darin, und ließ sie als Müll entsorgen. Diese Hose aufzubewahren und reinigen zu lassen, wäre nicht zumutbar gewesen. Hoffnungsschimmer Bald kam ein Physiotherapeut an mein Bett. Er untersuchte meine Beweglichkeit und meine Reflexe, und er stellte mir in Aussicht, daß ich wieder gehen und mich weitgehend normal werde bewegen können. Das konnte ich mir zwar nicht vorstellen, dennoch war ich von dieser Vorhersage freudig überrascht. Er würde doch in einem Patienten keine unerfüllbare Hoffnung wecken. Ich wußte inzwischen zwar, daß ich einen Schlaganfall erlitten hatte, aber ich wußte nicht, daß danach wieder die volle Beweglichkeit oder zumindest ein gewisses Maß an Beweglichkeit zurückgewonnen werden könne. Schlaganfall-Patienten waren mir nur aus der kleinen Marktgemeinde, in der ich aufgewachsen war, also aus der Zeit vor etwa sechzig Jahren, bekannt. Damals hieß es: »Den hat der Schlag getroffen.« Das bedeutete, er war daran verstorben. Oder: »Den hats Schlagl gstreift.« Man sah ihn nachher je nach der Heftigkeit dieser Berührung mehr oder weniger »verkrüppelt«. Der Therapeut zeigte mir für den Anfang einen einfachen und zugleich den einzigen »Trick«, wie ich mich aufrichten, und sobald die Kraft im rechten Bein zur Unterstützung ausreichen würde, auch aufstehen könne: Mich mit abgewinkelten Beinen auf den linken Bettrand drehen, mich mit dem gesunden linken Arm aufstützen, gleichzeitig beide Unterschenkel aus dem Bett bewegen, den rechten notfalls mit dem linken aus dem Bett schieben, und schon saß ich auf dem Bettrand. Zugleich in der richtigen Haltung, um später aufzustehen. Mobilität mittels Rollstuhls Aber zunächst ging es nur darum, vom Bett in den bereitgestellten Rollstuhl zu rutschen. Da die rechte Körperhälfte dabei nie der Unterlage entbehrte, gelang es. Mit der linken Hand konnte ich den Rollstuhl antreiben und mit dem linken Fuß den Antrieb unterstützen und steuern. Damit hatte ich bereits ein Minimum an Mobilität zurückgewonnen. Die Rückkehr ins Bett war einfacher, als in den Rollstuhl überzuwechseln. Der Rollstuhl stand mir fortan zur freien Verfügung. Ich hatte vom Therapeuten, da ich mich interessiert zeigte, auch meine Behinderung betreffende Abschnitte der Fachliteratur zu lesen bekommen. Endliche Erleichterung Ich litt weiterhin unter dem fehlenden Stuhlgang. Ich erklärte der Schwester, daß ich mich nun ins WC begeben könne. Ich mußte aber begleitet und kontrolliert werden, bis ich sicher auf der Muschel saß, und hernach, bis ich wieder sicher im Rollstuhl Platz nahm. Der Stuhlgang blieb weiterhin aus, ich konnte mich aber zu meiner Erleichterung von den Blähungen befreien, die sich aufgestaut hatten. Am fünften Tag nach dem Schlaganfall wies ich einen Arzt bei der Visite darauf hin, daß mir die Peristaltik geschwächt erscheine. (Peristaltik: Wirkung von muskulösen Wänden der Hohlorgane, die z.B. Harn oder Exkremente nach außen drückt; einige medizinische Fachausdrücke waren mir durch meine Frau, eine ausgebildete Krankenschwester mit mehrjähriger Praxis, aus Gesprächen, während die Ehe noch aufrecht war, in Erinnerung.) Dem Arzt schien das glaubhaft und er verordnete mir ein Medikament, das mir noch am selben Tag den so lange erwarteten Stuhlgang ermöglichte. Nachdem ich noch einige Male auf dem Weg zur Toilette gesichert worden war, wurde mir bald ausreichende Selbständigkeit zugestanden, um mich allein dorthin zu begeben. Beginn der Therapien Der Physiotherapeut, der inzwischen mit mir weitergearbeitet hatte, teilte mir mit, daß für eine volle Therapie in der Klinik kein Platz mehr frei sei. Aber er werde mich an allen Wochentagen eine halbe Stunde trainieren. Immerhin. Auch eine Ergotherapeutin kam, um mit ihrer Therapie zu beginnen. Ich kannte aber zum Unterschied von der Physiotherapie die Methoden und Ziele der Ergotherapie nicht. Bekannt war mir dagegen aus meiner beruflichen Erfahrung als Steuerberater und Wirtschaftsberater (was nicht allgemein bekannt ist: Jeder Steuerberater hat auch die Befugnis eines Wirtschaftsberaters und übt sie nebenbei zumindest durch eine mündliche Bilanzanalyse auch aus) der wissenschaftliche Begriff der Ergonomie. Ergonomie bedeutet, die maximalen beruflichen Leistungsmöglichkeiten festzustellen und Arbeitsbedingungen zu entwickeln, durch die dieses Leistungsmaximum erreicht werden könne. Ich deutete »Ergotherapie« daher in die Richtung, daß die Fähigkeit zum Leistungsmaximum wieder hergestellt werden solle. Ich meinte daher, daß ich dazu viel besser selber befähigt sei als eine Branchenfremde, die nur allgemeine Erkenntnisse vermitteln könne. Als Pensionist betätigte ich mich ja nun als Schriftsteller, wie wenn ich als solcher noch berufstätig wäre. Als ich der Therapeutin erklärte, ich würde mir die Methoden zur Fortsetzung meiner Arbeit selber aneignen – ich dachte dabei an ein System, um mit fünf Fingern, also mit einer Hand auf dem Computer zu schreiben – und ihre Therapie ablehnte, drohte sie: »Dann werden wir sie in die Geriatrie stecken.« Damit konnte sie mich allerdings nicht erschrecken. Mir war klar, daß eine Therapeutin sicher nicht darüber entscheiden könne, ob ein Patient in die Geriatrie zu verlegen sei. Notfalls würde ich den mir bekannten Arzt zu Hilfe rufen. Ich sprach dann mit einer Krankenschwester darüber, die ich als verständnisvoll und freundlich kennengelernt hatte. Sie bestätigte, daß darüber nicht eine Therapeutin zu entscheiden habe. Als sich mein Missverständnis herausstellte, erklärte die Schwester einfach, die Ergotherapeutin mache dasselbe »mit den Händen« wie der Physiotherapeut »mit den Füßen«. Dank der Klarstellung auf so einfache Weise konnte ich beim nächsten Besuch der Ergotherapeutin das Mißverständnis aufklären und an der Therapie genauso interessiert teilnehmen wie an der Physiotherapie. Stroke Units Während des Aufenthaltes in der Klinik wurde mir als aufmerksame Gabe das Buch »Nach einem Schlaganfall« von Univ.-Prof. Dr. Stefan Kiechl, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Latouschek und Prim. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Lang als Information für Patienten und Angehörige überreicht. Darin sind das Ereignis und seine Folgen beschrieben sowie Ratschläge zur Rehabilitation, zur Reintegration und Selbsthilfe und zur Prävention erteilt. Es ist auch auf das Netzwerk gegen den Schlaganfall – Stroke Units (Schlaganfall-Stationen) in Österreich hingewiesen. Erstmals ein Schlafmittel Im Zimmer mit vier Betten gab es immer irgendwelche nächtliche Störungen. Ein alter Patient stand mehrmals in der Nacht auf, machte Licht, kramte geräuscherregend im metallenen Nachtkästchen herum und fuhr dann mit dem Rollstuhl ins WC, was ebenso geräuschvoll vor sich ging. Da ich über Schlafmangel klagte – ohne mich über die Ursache zu beklagen – bekam ich eine Schlaftablette. Dadurch konnte ich das erste Mal in diesem Zimmer fünf Stunden durchgehend schlafen. Am darauffolgenden Morgen klage jener Patient, der bisher am meisten nächtliche Störungen verursacht hatte, der Schwester, daß ein neu ins Zimmer gekommener Patient »wie fünfzig Elefanten« geschnarcht und er daher nicht schlafen habe können. Da hielt ich ihm aber vor, daß und wie er selbst am meisten den Schlaf der anderen störe, daß ich noch keine Nacht, seit er im Zimmer sei, richtig schlafen hätte können, und daß ich daher in dieser Nacht das erste Mal in meinem Leben ein Schlafmittel genommen hätte. Wenn jemand schnarche, könne er dagegen nichts dafür. Der Ruhestörer schwieg hierauf betroffen. Weist die Bibel nicht auf alle Fehlhaltungen hin? Man sehe den Splitter im Auge des anderen, den Balken im eigenen Auge gewahre man aber nicht. Ich selbst hatte dank dem Schlafmittel das Schnarchen nicht gehört. Schwester mit Rasierapparaten Eines Abends kam eine Schwester mit zwei Rasierapparaten an mein Bett zum »Ausrasieren«. Ich fragte nach dem Zweck. Es werde eine Angiographie gemacht, erfuhr ich. Vom Nachbarpatienten im früheren Zimmer war mir diese Untersuchungsmethode bekannt. Ich beanstandete, daß ich darüber nicht informiert worden sei, und fragte, ob ich diesem Eingriff nicht in einer Erklärung mit meiner Unterschrift zustimmen müsse. Sie glaube schon, erfuhr ich. Ich bestand daher darauf, darüber informiert zu werden und Gelegenheit zu bekommen, mit meinen Angehörigen zu telefonieren. Immerhin hatte mein Sohn als Technikstudium das Spezialgebiet Elektromedizin gewählt und daher auch einige Semester medizinische Vorlesungen besucht. Er erklärte mir, als ich mit ihm sprechen konnte, daß die Angiographie eine Routineuntersuchung sei, der ich mich ohne Bedenken unterziehen könne. Ich war aber gar nicht um mich selbst besorgt gewesen, sondern hatte nur Wert darauf gelegt, daß meine Angehörigen über das Geschehen informiert seien. Die Angiographie wurde aber dann nicht mehr vorgenommen. Überstellung ins REHAB-Zentrum Meine Angehörigen, insbesondere meine Schwiegertochter, bemühten sich inzwischen, für mich einen Platz im REHABZentrum in Großgmain und die Übernahme der Kosten durch die Pensionsversicherung der gewerblichen Wirtschaft, an die ich die letzten dreißig Jahre die Pensionsversicherungsbeiträge entrichtet hatte und von der ich meine Pension bezog, zu erreichen. Am 29. August 2007 war es so weit. Meine Schwiegertochter und mein Sohn hatten mich teils aus den Beständen in meiner Wohnung, teils durch Nachkäufe reichlich mit Wäsche und Joggingkleidung für die Therapien versorgt. Ich verpackte alles in zwei große Reisetaschen – meine Beweglichkeit war inzwischen bereits so weit gediehen, daß ich dies vom Rollstuhl aus erledigen konnte – ich stellte die Reisetaschen bereit und legte eine Jacke für die Übergangszeit darauf. Mein Sohn wollte den Transport mit seinem PKW übernehmen. Dies wurde aber abgelehnt. Die Klinik sei für die Verlegung verantwortlich, ich müsse von der Rettung nach Großgmain gebracht werden. Verlust einer Jacke Zunächst hieß es auf die Rettung warten. Mein Sohn hatte sich, ohne daß ich davon etwas bemrkt hatte, mit einer der Reisetaschen in seinen Wagen begeben, um dann der Rettung hinterherzufahren. Als ich in den Rettungswagen geleitet wurde, fragte ich nach meinen Reisetaschen. Es sei alles da, wurde mir gesagt. Im nächsten Moment kam eine Schwester mit einer meiner Reisetaschen gelaufen. Da man mir gesagt hatte, es sei alles da, nahm ich an, daß die zweite Tasche im Wagen sei. In Großgmain stellte sich heraus, daß eine der Reisetaschen fehlte. An die Jacke dachte ich nicht. Die Rettungsleute meinten, die Tasche würde in der Klinik zurückgeblieben sein. Kurz darauf traf mein Sohn mit der zweiten Reisetasche ein. Des Fehlens der Jacke wurde ich erst gewahr, als sich mein Sohn bereits verabschiedet hatte. Über das Handy, das mir mein Sohn inzwischen beschafft hatte, bat ich meine Angehörigen, in der Klinik und eventuell bei der Rettung rückzufragen. Die Jacke von guter Qualität blieb verschollen. Das war alles sehr hektisch abgelaufen. Ich war in der Klinik ein paarmal ermahnt worden, nicht zu »schusseln«. Ich war noch von meiner beruflichen Arbeit her gewohnt, mich schnell zu bewegen. Wenn ich auch am Schreibtisch saß, so gab es doch viele Handgriffe zu verrichten und ein oftmaliges Auf und Nieder. Die schnelle Bewegung war dabei durchaus sinnvoll. Jetzt, für den Teilgelähmten, war das natürlich unangebracht, aber ich mußte mich erst an die neue Situation gewöhnen. Aber durch die unangebrachte Hektik anderer war mir nun ein Schaden entstanden. Positive Bilanz des Klinikaufenthaltes Davon abgesehen habe ich diese zwei Wochen in der Christian-Doppler-Klinik in guter Erinnerung. Die meisten Schwestern und Pfleger waren freundlich und geduldig. Die Betreuung von Schlaganfall-Patienten und Patienten mit anderen ähnlich schweren Störungen erfordert oft viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Die Therapeuten wirkten erfolgreich. Ich konnte, bevor ich die Klink verließ, immerhin, wenn ich mich festhalten konnte, schon stehen und zwischen langen BarrenStangen im Turnsaal bereits auch gehen. Auch den rechten Arm konnte ich bereits wieder bewegen und leichte Stütz- und Greiffunktionen ausüben. Die Ärzte gaben sich, wie bei Spitalsärzten nach meiner Erfahrung üblich, eher verschlossen. Ihre Diagnosen erfährt man meist erst nach der Entlassung aus einem schriftlichen Bericht. Die Verköstigung aus der gemeinsamen Küche der Salzburger Landes-Krankenanstalten und der Christian-Doppler-Klinik ist reichlich und wohlschmeckend. Für mich zu reichlich. Schade, daß man keine halben Portionen bestellen kann. Da man sowohl mittags wie abends unter drei verschiedenen Menüs wählen kann, sollte niemand Grund zur Unzufriedenheit haben. Im Rehabilitationszentrum Der Rollstuhl Ich befand mich nun zur Therapie im REHAB-Zentrum (Rehabilitations-Zentrum) Großgmain. Obwohl mir durch achtwöchigen Aufenthalt die Orientierung in den weitläufigen Anlagen geläufig geworden ist, kann ich die Lokalität meiner Ankunft nicht bestimmen. Ich erinnere mich nur, daß dort Maß an meinem Körper genommen wurde, um einen für mich passenden Rollstuhl auszuwählen. Und daß mein Sohn dort mit der zweiten Reisetasche erschien. Im Rollstuhl wurde ich zu meinem Bett in einem Krankenzimmer gebracht, es diente mir aber nur zur Nächtigung. Ich hatte die Freiheit, die Zeit im Rollstuhl zuzubringen und mich darin innerhalb der Station auch frei zu bewegen, soweit es der Zeitplan erlaubte. Am Rollstuhl fiel mir auf, daß ich das Antriebsrad, jenes metallene Rad außerhalb des großen Rades, das den Rollstuhl trug und auf dem er lief, nicht mit der rechten, ehedem gelähmten Hand zu bewegen vermochte. Während dieses Antriebsrad am Rollstuhl in der Klinik verchromt war, war es hier mit einer anderen Metallegierung versehen, die zu rutschig war und die ich daher mit der geschwächten rechten Hand nicht fest genug halten konnte, um den Rollstuhl anzutreiben. Eine Schwester, die ich fragte, erklärte mir, daß es auch nicht gut wäre, wenn ich mit der geschwächten Hand den Rollstuhl antreiben würde. Das wäre eine zu große Belastung für die Hand. Da man dort für die Therapie spezialisiert war, zweifelte ich nicht an der Richtigkeit dieser Auskunft und stellte mich darauf ein, den Rollstuhl nur mit der gesunden linken Hand und mit dem linken Fuß anzutreiben. Dem Fuß kam dabei auch die Aufgabe der Steuerung zu. Probleme hatte ich damit keine, da es ja keine großen Strecken zurückzulegen galt. Die Mahlzeiten nahmen alle, die irgendwie bei Tisch sitzen konnten, im Speisesaal der Krankenstation ein, der in der übrigen Zeit als gemeinschaftlicher Aufenthaltsraum diente, und in dem auch der Fernsehapparat stand. Es war erwünscht, sich soweit möglich nicht im Rollstuhl an den Eßtisch zu setzen, sondern auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Mir war das von Anfang an selbständig möglich. Schlaftablette Als ich am Abend schon im Bett lag, wurde in das zweite Bett im Zimmer ein Patient, der eine Gehirnblutung erlitten hatte, gebracht. Er war unruhig, und soweit er redete, redete er wirr. Ich konnte aber ungestört schlafen, denn ich bekam dasselbe Schlafmittel und überhaupt dieselben Medikamente wie in der Klinik. Das Schlafmittel wirkte etwa fünf Stunden lang. Ich nahm es daher erst gegen Mitternacht ein, damit ich bis zum Morgen durchschlafen konnte. Das stand mir frei. Der Ablauf des ersten Tages Am nächsten Morgen wurden mit dem Frühstück im Speisesaal auch die Medikamente, die am Morgen einzunehmen waren, und der Tageszeitplan »serviert«. Der erste Tageszeitplan enthielt die Termine: 7,10 Uhr Blutabnahme, noch vor dem Frühstück um 7,30 Uhr, 10,30 Uhr Physiotherapie, 11,00 Uhr Logopädie, 13,30 Ergotherapie. Logopädie Die Logopädie diente zunächst der Feststellung, ob eine Therapie in dieser Richtung notwendig sei. In einer Art Kinderbilderbuch wurden mir verschiedene Gegenstände und Tiere gezeigt, die ich zu benennen hatte. Ein solcher Test kann durchaus sinnvoll sein, denn durch einen Schlaganfall können ganz spezielle Funktionen ausfallen. Aber bei mir war, wie mir selbst bewußt war und soweit die Tests zeigten, geistig keine Veränderung eingetreten. Meine nicht mehr ganz deutliche Aussprache war durch schlechte Zähne bedingt; dagegen gab es aber bei meinem zu niedrigen Pensionsbezug keine Abhilfe. Die Logotherapeutin überzeugt sich davon durch einen Augenschein – nicht von meinem zu niedrigen Einkommen. Zur Logopädie war ich später noch einmal eingeteilt. In diesem zweiten Test sollte ich Wörter, die mit bestimmten Buchstaben begannen, aufzählen. Mir fiel dazu nicht allzu viel ein. Ich mußte eingestehen, daß dies nicht meine Stärke war. Auch vor dem Schlaganfall wäre mir keine reichlichere Aufzählung gelungen. Dagegen hatte ich früher, wenn es um synonyme Begriffe ging, jeweils auf ein großes Repertoire zurückgreifen können. Das dürfte auf meine Übung oder Begabung(?) als Schriftsteller zurückzuführen sein. Allerdings hatte ich mit zunehmendem Alter – längst vor dem Schlaganfall – eine Verringerung des Wortschatzes feststellen müssen. Mir wäre zur Aufzählung nach dem Anfangsbuchstaben auch viel mehr eingefallen, wenn ich mir gemäß den Wörterbüchern jeweils den zweiten Buchstaben dazugedacht hätte, z.B: Raabe, Rad, Rand, Rappe, Rast, rattern, Raum, Raupe, Recht, Rede, Reeperbahn, Reifen, Rettung usw. Es war mir aber erst nachher eingefallen, daß ich auf die Weise mehr nennen hätte können. Gegenüber der Logopädin hatte ich nur erwähnt, daß dies nicht meine Stärke sei, und daß sich das bereits wiederholt herausgestellt hatte, wenn wir in der Familie, als die Kinder noch schulpflichtig waren, das Spiel »Stadt und Land« gespielt hatten. Ich hatte jedoch keinen Ehrgeiz zu Rechtfertigungen nach dem Irrealis der Vergangenheit entwickelt. Die logopädischen Tests waren damit abgeschlossen. Therapien waren nicht notwendig. (Logopädie sollte übrigens nicht mit Logotherapie verwechselt werden. Logotherapie ist die von Viktor E. Frankl entwickelte Psychotherapie durch Vermittlung von Sinnfindung. Ich persönlich halte diese Therapie-Methode für hervorragend.) Visiten Auf der Rückseite des Tageszeitplanes waren in Kurzangabe die bisherigen Diagnosen und die Medikation vermerkt. Eine Diagnose lautete: »Hirnstaminsult«. Ich scherzte bei der nächsten Visite zu diesem Tippfehler: Jetzt wäre mir die Ursache des Schlaganfalles bekannt. Ich hätte ein Stammhirn mit nur einem M. Der Scherz wurde von der Frau Oberärztin als solcher aufgefaßt. Die Visiten fanden wie in den Krankenhäusern täglich statt. In der Schlaganfallstation B täglich um 9 Uhr. Auf dem Tageszeitplan war angewiesen: „Ab 9 Uhr bis zur Visite im Zimmer zu bleiben!“ Bei Verhinderungen der Ärztinnen und Ärzte konnte sie auch ausfallen. Dafür konnte man sich mit einem ernsten Problem jederzeit an die behandelnde Ärztin, den behandelnden Arzt wenden. Motomed Einer der nächsten Tageszeitpläne (3. 9. 2007) enthielt folgendes: 9,30 Uhr Motomed, 10,30 Standing, 11,30 Logopädie (der bereits beschriebene zweite Test), 13,30 Ergotherapie, 14,00 Psychol. Diagnostik, 14,30 Physiotherapie. Das Motomed war ein Trainingsgerät, das ein Fahrrad simulierte, verschiedene Einstellungen ermöglichte und die Leistung anzeigte. Es war auf zwanzig Minuten Trainingsdauer eingestellt. Ähnliche Geräte sind auch von Fitneßcentern und als Hometrainer bekannt. Ich wurde wiederholt ermahnt, nicht mit zu heftigem Einsatz daran zu trainieren. Meine Fitneß vom Bergwandern wirkte noch nach. Standing Für das »Standing« (das Stehen) war ein Gerät vorhanden, ein metallenes Gestell, das oben mit einer Holzplatte mit halbrundem Ausschnitt abgeschlossen war. Der Ausschnitt ermöglichte ein bequemeres, sichereres Stehen. Auf die Platte konnte man ein Buch legen, damit das halbstündige Stehen nicht zu langweilig wurde. Mit einem Gurt am Rücken konnte man vor der Gefahr eines Sturzes gesichert werden. Nach dem Sicherheitsgurt hatte ich keinen Bedarf, denn im Stehen war ich schon recht sicher. Schon beim zweiten Mal stand ich frei. Und ich versuchte bald, das Gewicht zeitweise zur Gänze auf das beeinträchtigte Bein zu verlagern. Das gelang bald recht gut. Psychologische Diagnostik Die psychol. Diagnostik war an diesem Tag entfallen. Sie ist wichtig, weil mancher durch einen solchen Schicksalsschlag in Depressionen verfallen könnte und daher der psychologischen Betreuung bedürfen würde. Ich konnte jedoch, als diese Diagnostik dann später stattfand, darauf hinweisen, daß meine Psyche durch stete harte Bedingungen von Kindheit an gestählt sei (im Bericht »Opfer der Politik« in dieser Homepage nachlesbar), und daß ich den Schlaganfall mit gewisser Gelassenheit ertragen würde. In meinem Alter habe ich keine wichtigen Aufgaben mehr zu erfüllen. Meine Kinder sind tüchtig und bedürfen meiner Hilfe, die ich ohnedies nur sehr eingeschränkt bieten könnte, nicht mehr. Ich hatte außerdem Glück im Unglück: An meiner geistigen Befähigung hat sich durch den Schlaganfall nichts geändert. Ich kann daher weiterhin literarische Ideen verwirklichen, worin ich nun im Alter meinen Lebenssinn finden würde. (Eine natürliche Stütze nach Viktor E. Frankl.) Die psychologische Diagnostik wurde damit abgeschlossen. Ergotherapie In der Ergotherapie wurde mit allerlei interessanten Behelfen die Beweglichkeit der Hände und Finger geübt. Es war erkennbar, daß diese Übungen auf Muskeln wirkten, deren richtige Funktion für viele Handgriffe im Alltag unentbehrlich war. Und ich konnte auch deutliche Fortschritte beobachten. Durch die Therapie angeregt, versuchte ich bei den Mahlzeiten zunächst den leeren Löffel mit der rechten Hand zum Mund zu führen. Es gelang nicht, ich traf mit dem Löffel irgendwohin im Bereich von Nase bis Kinn und rechter Wange. Ebenso wenig war es möglich, eine Tasse oder ein Glas zum Mund zu führen. Mit Flüssigkeit gefüllt, waren die Gefäße für die beeinträchtigte Hand überhaupt noch zu schwer. Ich konnte mich auch mit der rechten Hand nicht selbst an der Nase nehmen, also mit Daumen und Zeigefinger die eigene Nase anfassen; ich traf sie nicht auf Anhieb. Was vordem selbstverständlich und mit der linken nach wie vor möglich war, gelang nun nicht. Dagegen bot die Ergotherapie spürbare Hilfe. Ich konnte mit der Hand auch nicht schreiben. Kurze Briefe und Notizen schrieb ich mit der linken Hand. Auch das war schwierig und gelang nur in Blockschrift. Physiotherapie In der Physiotherapie wurde die Wiedererlangung der stabilen aufrechten Körperhaltung und der Fähigkeit, wieder möglichst normal zu gehen, angestrebt. Die Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit der Übungen und des Trainings, das auf bestimmte Muskeln wirkte, waren auch hier nachvollziehbar. Ich liege bäuchlings auf der Therapie-Liege und die Therapeutin gibt die Weisung: Mit der Ferse zum Gesäß! Ich versuche den Unterschenkel anzuheben. Er läßt sich nicht bewegen. Ich versuche es mit dem linken gesunden Bein, und die Ferse läßt sich fast bis ans Gesäß führen. Damit wird veranschaulicht, was im Gehirn geschehen ist. Denn die Muskeln sind ja noch unverändert da. Und wie zufällig eingestreut wird die Übung in anderen Therapiestunden wiederholt. Mit einem Mal beginnt sich dann der Muskel ein wenig zu regen. Und nach längerer Therapiedauer erreicht er immerhin die Hälfte der Bewegungsstrecke des gesunden Schenkels. Daran zeigt sich der Wert der Übungen und das spornt an, eifrig mitzutun. Oder ich liege an einem frühen Nachmittagstermin auf dem Rücken, und es zeigt sich auf der rechten Seite des Bauches eine deutliche Wölbung. Die Therapeutin fragt, ob ich bereit wäre, den Bauch freizumachen. Warum nicht? Die leichte Blähung durch das Mittagessen vergrößert die Eingeweide und drückt sie mit den inaktiven Bauchmuskeln in die Höhe. Es sieht aus, als wäre an dieser Stelle der starke Auftrieb eines Hefeteiges zu beobachten. Die Therapeutin spricht von einem Schulbeispiel und macht die Kolleginnen und Kollegen aufmerksam. Mir ist klar, daß es noch vieler Übungen bedürfen würde, um diesen, auf natürliche Weise weniger beanspruchten Bereich der Bauchmuskulatur wieder zu straffen. Ähnliche Erfahrungen und Beobachtungen ergeben sich an mehreren anderen wichtigen Muskeln. Die Fortschritte waren in diesem Bereich umso auffallender, weil das Stehen und Gehen ja für die Selbständigkeit subjektiv zunächst als entscheidend empfunden werden. Eine Zeiteinheit Ergotherapie, zwei Einheiten Physiotherapie, Standing und Motomed waren fortan täglich auf dem Zeitplan. Hinzu kamen fallweise Termine für Untersuchungen. Zu wenig Selbständigkeit zugestanden Apropos Selbständigkeit: Bei all den guten Bedingungen fühlte ich mich im Rehab-Zentrum zu sehr beobachtet und umsorgt. Ich wurde jeweils zum WC begleitet und von dort abgeholt. Ich wies darauf hin, daß mir in der Klinik dazu volle Selbständigkeit zugestanden worden war. Ich sei noch zu unsicher, sie seien für meine Sicherheit verantwortlich, erklärten mir Schwestern und Pfleger. Einer Schwester fiel auf, daß sich mein Bedürfnis zu oft einstellte. Man müsse mich in die Urologie bringen, meinte sie. Ich fand es unfair, daß man einem alten Mann nicht häufig übliche Schwächen wie die Blasenschwäche zugestehen wollte. Ich wußte die Ursache weitläufiger zu erklären und »wendete damit die Urologie ab«. Beim morgendlichen Anziehen wurde ich anfangs von einer Therapeutin überwacht und beraten. Manche ihrer Tips waren nützlich und erhöhten die Sicherheit. Durchaus angebracht war der Hinweis, daß ich beim Aufstehen vom und Setzen in den Rollstuhl nicht gleichzeitig anderes tun dürfe. Andere Anordnungen verursachten mir dagegen unnötige Mühe. Die Schuhe mußte ich im Rollstuhl sitzend anziehen. Es gelang mir aber im Sitzen noch nicht, den Fuß nach unten zu strecken. Es war daher eine Plage, den Schuhlöffel zwischen Schuh und Ferse anzusetzen und den Fuß in den Schuh zu bringen. Wenn ich tagsüber aus irgendeinem Grund die Schuhe aus- und wieder anzog, schlüpfte ich zuerst in den linken Schuh, band ihn fest und stand dann, auf das Nachtkästchen gestützt, auf. Im Stehen konnte ich den Fuß doch ein wenig nach unten strecken, und das erleichterte das Anziehen des Schuhs wesentlich. Aber das durfte ich am Morgen nicht. Die Sturzgefahr sei zu groß. Die Schuhbänder zuzubinden, hatte ich übrigens bereits in der Klinik allein gelernt. Vielleicht war mir dies deshalb gelungen, weil der rechte Zeigefinger von der Lähmung ein wenig verschont geblieben und daher bald wieder beweglicher und kräftiger geworden war. Beim Baden unter dem Brausebad wurde ich von einer Schwester oder einem Pfleger überwacht und mitunter auf gefährdende Bewegungen aufmerksam gemacht, etwa wenn ich mich selbst unsicher gefühlt und mich mit schnellem Griff an einer Stütze festgehalten hatte. Auch dazu wies ich vergeblich drauf hin, daß ich in der Klinik schon allein baden hatte dürfen. Badegelegenheit war übrigens in der Krankenstation, in der ich ja die ersten vier Wochen untergebracht war, nur jeden zweiten Tag. Ich hätte mir gewünscht, mich, wie gewohnt, täglich am Morgen duschen zu können. Aber ich erinnerte mich an meine Kindheit und Jugendzeit. In der Kindheit (bis 1949) hatten wir daheim einen Badeofen, der erst mit Holz und Kohle beheizt werden mußte, damit es heißes Wasser gab. Diese Prozedur nahmen die Eltern nur alle 14 Tage einmal auf sich. Es konnte also nur in diesen Intervallen gebadet werden. In meiner Lehrzeit (HTML-Seite „Wer ist der Abart? II“) war mir auch nur 14täglich, jeweils nach dem Backofen-Kehren, gestattet, mir im Heizkessel in der Waschküche Wasser zu wärmen und in einem Holzzuber zu baden. Erst als ich als 19jähriger in die Stadt Salzburg gezogen war und in Untermiete wohnte, konnte ich die Gelegenheit in einem öffentlichen Bad zur gründlichen Köperreinigung benützen. Das tat ich zweimal je Woche. Zum täglichen Bad in der Krankenstation des REHAB-Zentrums, bei dem die meisten Patienten überwacht wurden, fehlte den Schwestern und Pflegern offenbar die Zeit. Wenn ich als zu unsicher getadelt wurde, erklärte ich des öfteren, daß ich zeitlebens auf die Berge gewandert und daher gewohnt sei, auf unsicherem Weg stets irgendeinen Sicherungshalt im Auge zu haben und diesen beim Gefühl der Unsicherheit gewissermaßen reflexartig zu ergreifen. (Ich hatte keine Klettertouren unternommen, bei denen der Grundsatz gegolten hätte: jeweils nur eine Hand oder einen Fuß zu bewegen, andrerseits dreifachen Halt zu bewahren.) Deshalb hätte ich, wie sich gezeigt habe, bei jeder Unsicherheit die Hand sofort an einem Haltegriff oder einer Stütze. Aber das war offenbar nicht geläufig und wurde daher nicht anerkannt. Ich möchte mit dieser Kritik aber nicht zu allgemein größeren Zugeständnissen im REHAB-Zentrum anregen, denn dies könnte in anderen Fällen vielleicht zu Unfällen führen, die die Schwestern und Pfleger zu verantworten hätten. Es ist ja auch aus Erfahrung bekannt, daß manche Patienten ihre Möglichkeiten überschätzen. Insgesamt fühlte ich mich auch gut betreut und gut behandelt. Wo entspricht schon alles optimalen Bedingungen? Nicht einmal in der eigenen Wohnung, in der ich als im Alter Alleinlebender alles selbst und unabhängig gestalte. Ich verweise auch auf das noch folgende Kapitel „Zu sehr umsorgt“ Pflegeleitbild An der Wand neben dem Eingang zum Schwesternzimmer hing ein Plakat folgenden Inhalts: PFLEGE-LEITBILD Wir beginnen eines in der Welt zu lernen: „Den Menschen mit seinem Leben umgehen zu lassen, wie ich mit meinem umgehe.“ David Grason MENSCHENBILD Wir begegnen dem Menschen unabhängig von seiner Herkunft, kulturellen, religiösen, sozialen Situation, wertfrei, achten ihn als ganzheitliche eigenständige Persönlichkeit und gleichwertigen Partner1). 1) Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. SELBSTBILD DER PFLEGE Wir Pflegende haben durch unsere Patientennähe und 24 Stunden Präsenz eine Schlüsselfunktion und sind wichtige Schnittstelle zwischen unseren Patienten/Kunden und anderen Berufsgruppen. Im Rahmen unseres Aufgabenbereiches werden unsere eigenverantwortlichen Leistungen 2) mit der Pflegeanamnese erhoben, diagnostiziert, geplant, durchgeführt und evaluiert. 2) lt. GuKG 1997 § 12 Abs. 1: Die Tätigkeitsbereiche des gehobenen Dienstes für Gesundheitsund Krankenpflege umfassen – eigenverantwortliche, mitverantwortliche und interdisziplinäre Tätigkeiten. ROLLE DER PFLEGEKRAFT IN DER REHABILITATION Ziel unseres Handelns ist die Wiedererlangung der Fähigkeiten des Patienten/Kunden zur Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens und der beruflichen Leistungsfähigkeit. Wir fördern das Gesundheitsbewusstsein, die Eingliederung in den Alltag und eine Verbesserung der Lebensqualität. Den zentralen Schwerpunkt setzen aktivierende, rehabilitative und therapeutische Pflegekonzepte, sowie Beratung, Schulung und Anleitung Patienten – Angehörige. PFLEGEQUALITÄT Ständige Fort- und Weiterbildung gewährleisten unsere Professionalität und eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung. Durch interne und externe Kommunikation sollen die optimalen Bedingungen für den Patienten/Kunden geschaffen werden. ÖKONOMISCHES HANDELN Der Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln ist sachgerecht und verantwortungsbewußt. Leitbild der Pflege der Sonderkrankenanstalten/Rehabilitationseinrichtungen der PV PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT Ich selbst hatte wenig Pflegebedarf. Tagsüber hielt ich mich kaum im Krankenbett auf. Es war für mich nicht zu ermüdend, von den Therapie-Zeiten und Mahlzeiten abgesehen, den ganzen Tag im Rollstuhl zu verbringen. Ich bedurfte nur morgens und abends je einer Blutverdünnungsspritze, nach eigener Wahl in den Bauch. Davon abgesehen wurde ich – wie geschildert gegen meinen eigenen Wunsch zu den Verrichtungen ins WC begleitet. Um nicht des Nachts nach der Schwester läuten zu müssen, benützte ich eine Harnflasche. Und beim Reinigungsbad wurde ich von einer Schwester oder einem Pfleger sicherheitshalber beobachtet. Diese wenigen Pflegedienste wurden mit sehr positiver Einstellung gehandhabt. An manch tragischem Fall konnte ich aber beobachten, daß sich die Schwestern und Pfleger an das Leitbild hielten, das ihnen gemäß dem Plakat vorgegeben war. Das war gewiß nicht immer leicht. Ihr Umgang mit verwirrten Patienten war bewundernswert. Ich bezweifelte, ob ich selbst solcher Geduld und Überlegenheit fähig wäre, wenn ich immer wieder mit unsinnigen Wünschen oder unsinniger Kritik konfrontiert wäre. Die Finger- und Zehennägel hatte ich mir irgendwann kurz vor dem Schlaganfall geschnitten. Aber im Lauf des Aufenthalts in der Klinik und im REHAB-Zentrum von bis dahin insgesamt fünf Wochen, waren sie beträchtlich gewachsen. Die Schwestern und Pfleger verwiesen auf die im REHAB-Zentrum gesondert angebotenen Manikür- und Pedikürdienste. Bei meinem kleinen Pensionsbezug wollte ich diese Dienste aber nicht beanspruchen. Ich bat daher meine Angehörigen, mir eine Nagelschere zu beschaffen. Schon der erste Versuch zeigte dann, daß ich mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand die Nagelschere problemlos benützen konnte, um die Fingernägel an der linken Hand zu schneiden. Ich erklärte mir dies damit, daß ich, wie schon erwähnt, den Zeigefinger der rechten Hand sogar unmittelbar nach dem Schlaganfall ein wenig bewegen konnte. Zu sehr umsorgt Die Muskelfunktionen waren inzwischen soweit aufgebaut, daß ich mit Stöcken oder mit einem Rollator leidlich gehen konnte. Ich erklärte, daß ich nach der Entlassung den Rollator als Gehhilfe vorziehen würde, da in meiner Wohngegend Kinder unaufmerksam umherlaufen und radfahren würden, und daß überall auch auf den Gehsteigen mit dem Rad gefahren würde. Ich würde mich daher mit dem Rollator sicherer fühlen. Ich durfte mich daher allmählich an das Gehen mit Hilfe des Rollators gewöhnen, ohne auf die geruhsamere Fortbewegung im Rollstuhl zu verzichten. Um diese Zeit erwartete ich das übliche Zugeständnis größerer Selbständigkeit im REHAB-Zentrum. Dies bedeutete, den äußeren Bedingungen nach einen Aufstieg vom ersten in das zweite Obergeschoß. Dem Sinn nach das Wohnen in einem Einbettzimmer ohne Überwachung und Betreuung durch Schwestern und Pfleger, von Sonderdiensten wie Injektionen abgesehen. Zur Prüfung, inwieweit mir diese Selbständigkeit zugetraut werden könne, wurde ich beim Anziehen und Baden wieder von einer Therapeutin beobachtet, die offenbar Bedenken hatte, mir die größere Selbständigkeit zuzugestehen. Schließlich eröffnete mir die Oberärztin der Schlaganfallstation aber, daß ich in ein Einzelzimmer überwechseln dürfe. Dies könne nicht von einer einzelnen Stimme abhängen. Auch die Schwestern und Pfleger machten ihre Beobachtungen, die zu beachten seien. Ich mußte der Oberärztin mit Händedruck versichern, daß ich vorsichtig sein würde, um Stürze zu vermeiden. Ich versicherte, daß ich ja selbst das größte Interesse an meiner Rekonvaleszenz ohne Rückschläge hätte. Nach drei Wochen meines Aufenthaltes in Großgmain übersiedelte ich also vom ersten Oberschoß in das zweite; in ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Nach der ersten Nacht erschien die um meine Sicherheit besorgte Therapeutin auch hier, um zu überprüfen, ob ich mich beim Baden nicht gefährden würde. Doch war es hier so eng, daß kaum ausreichend Raum bestand zu stürzen. Ich empfand diese Sorge als übertrieben und erklärte, daß ich in Hinkunft früher aufstehen und baden würde. Dagegen wendete die Therapeutin nichts ein. Sie dürfte also keine weiteren Bedenken gehabt haben. Was wäre aber geschehen, wenn sie befunden hätte, ich sei noch zu unsicher für das selbständige Wohnen im Einzelzimmer? Hätte sie veranlassen können, daß ich in die Krankenstation zurückversetzt worden wäre? In diesem Fall hätte ich mich gewehrt. Ich möchte die akribische Aufsicht nicht allgemein kritisieren. Sie wird vielleicht auf problematische Erfahrungen zurückzuführen sein, und im Falle eines Sturzes – der bei Schlaganfallpatienten folgenschwer sein kann – wird ja doch nach der Mitverantwortung von Ärzten, Therapeuten, Schwestern und Pflegern gefragt werden. Aber ich meine, daß zur Beurteilung individuelle Umstände berücksichtigt werden sollten. In meinem Fall wäre dies, daß ich als Vater auf die Verantwortung für drei Kinder bis zu ihrem Erwachsenwerden, daß ich auf Erfahrung in einem handwerklichen Beruf und nach der AHS-Bildung auf dem zweiten Weg und der Ausbildung zum Steuerberater auf die langjährige verantwortungsvolle Erfahrung als Steuerberater zurückblicken konnte. Der Steuerberater ist auch Wirtschaftsberater, und ich habe als solcher oft den Rat gegeben, daß jegliche Zusammenarbeit, ob mit an einem Betrieb Mitbeteiligten oder mit Arbeitnehmern, auch Vertrauen erfordert. Fehlt es an den im konkreten Fall notwendigen Vertrauensgrundlagen, dann ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. In gewissem Sinn ist auch die Therapie eine Zusammenarbeit, die Vertrauen erfordert. Zu den aufgezählten Erfahrungen kamen noch die Bewegungserfahrung des Bergwanderns und die Bestätigung von Verantwortungsbewußtsein durch jahrzehntelanges unfallfreies Auto Fahren hinzu. Schließlich war auch mein großes Interesse, bald wieder einsatzfähig nach Hause zu kommen, von Bedeutung. Es lag mir daran, an vielen Ideen als Schriftsteller (in dieser Homepage „Wer ist der Abart? I) weiterzuarbeiten. Es befremdet, wenn man nach der Erfüllung so vielseitiger Lebensaufgaben wie ein Kleinkind behandelt wird. Zwar mußte ich mich nach dem Schlaganfall aufs Neue wie vor 70 Jahren bewegen lernen, aber ich war geistig nicht beeinträchtigt, und ich konnte daher Möglichkeiten und Gefahren abschätzen. Vielleicht könnte man bei unterschiedlicher Auffassung zwischen Patienten und Betreuung, welche Verantwortung einem Patienten für sich selbst zugemutet werden kann, den Patienten eine Erklärung unterschreiben lassen, womit er die Verantwortung für alle Risken selbst übernehmen würde. Fachliche Kompetenz Zum vorhin Gesagten möchte ich hervorheben, daß die besorgte Therapeutin die therapeutischen Übungen mit hoher fachlicher Kompetenz leitete. Durch diese Übungen konnte ich, so mein Eindruck, ein Maximum an Beweglichkeit zurückgewinnen. Daß die Feinmotorik in acht Wochen nicht voll zurückgewonnen werden kann, ist unter den Patienten allgemein bekannt. Es ist auch fraglich, ob dies überhaupt in vollem Maße möglich sein wird. Es ist ein Unterschied, ob die von Kindheit an dafür bestimmten Hirnzellen die Bewegungsabläufe leiten, oder ob dies durch andere Zellen geschieht, denen diese Funktion antrainiert wird. Ein Vorgriff auf das Ende der Rehabilitation: Die TherapieFortschritte ermöglichten mir nach acht Wochen, mich in allem ohne fremde Hilfe selbst zu versorgen. Damit erreichten die Therapie-Erfolge auch meine volle Zufriedenheit. Private Sphäre im Einzelzimmer Mein Sohn brachte mir meinen Laptop, alte Lautsprecherboxen und CD sowie DVD aus meiner Wohnung. Auch meine jüngere Tochter und Freunde brachten mir einige DVD. Die ältere Tochter war zu dieser Zeit im Ausland. Ich konnte mich daher fortan auch im REHAB-Zentrum meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Schreiben von Belletristik, widmen, und zur Abwechslung bot sich niveaugerechte Unterhaltung. Einige Tage zuvor hatte ich einen eigenen Rollator bekommen. Ich verzichtete daher bald nach dem Wechsel ins Einzelzimmer auf den Rollstuhl. Später erfuhr ich, daß sich ein Pfleger für mich verbürgt und damit den Wechsel in das Einzelzimmer ermöglicht hatte. Ich dankte ihm herzlich. Diese Bürgschaft bestärkte neben dem eigenen Interesse und dem Versprechen an die Oberärztin noch zusätzlich meine Sorgfalt, jede Unfallgefahr zu vermeiden. Verlängerung der Rehabilitation Die Dauer des für mich im REHAB-Zentrum Großgmain genehmigten Therapie-Aufenthaltes neigte sich dem Ende zu. Ich war aber noch nicht kräftig genug und vermochte mich noch nicht sicher genug zu bewegen, um mich in meiner eigenen Wohnung mit dem Wichtigsten selbst zu versorgen. Es ist ein Unterschied, ob ich im Einzelzimmer nur Freizeitbeschäftigungen ausübe und die eigene Körperpflege besorge, oder ob ich im eigenen Haushalt mit Einkaufen, Kochen und Wohnungsreinigung für mich selbst sorge. Die Oberärztin sagte mir daher zu, daß sie sich für die Verlängerung meines Aufenthaltes einsetzen würde und daß mit der Genehmigung zu rechnen sei. Es wurde tatsächlich eine Verlängerung um weitere vier Wochen genehmigt. Wieder in der Klinik Vorbereitung auf die Angiographie Ich erfuhr auch den Termin für die nachzuholende Behandlung in der Christian-Doppler-Klinik, der Salzburger Nervenklinik. Die zuständige Fachärztin war vom Urlaub zurück und hatte nun einen Termin für meine Behandlung genannt. Ich wurde am Donnerstag, den 4. Oktober 2007, in die Klinik überstellt. Am Donnerstag und am Freitag vormittag fanden die vorbereitenden Untersuchungen statt. Ich bekam auch schriftliche Informationen über die Angiographie und die Einsetzung eines Stent. Eine Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Oberärztin, die den Eingriff vornehmen werde, wurde angekündigt. An den Nachmittagen nütze ich, soweit ich mich nicht für Untersuchungen bereitzuhalten hatte, die Zeit zu Spaziergängen im Freien mit Hilfe eines Rollators, der jedoch zum Unterschied von den üblichen Modellen keine Feststellbremsen hatte und an dem außerdem eine der Normalbremsen defekt war. Da ich darauf aufmerksam gemacht wurde und mich darauf einstellen konnte, kam ich mit dem Gerät problemlos zurecht. Ich war froh, daß ich überhaupt Gelegenheit zum Gehen hatte. Denn auch die Gehübungen waren für die Therapie wichtig. Am Freitag morgen begab ich mich ins Bad. Ein relativ großer Raum, in dem nur neben der Duscheleitung von Kniehöhe abwärts ein Haltegriff angebracht war. Ich rätselte, welchen Zweck dieser Haltegriff erfüllen sollte. Diente er etwa als Aufstehhilfe, falls sich jemand beim Duschen auf den Fliesenboden setzte? Es war allerdings auch eine senkrechte runde Gleit- und Feststellstange für die Brause an der Wand befestigt, die von ungefähr einem Meter Höhe an einen Meter hinaufragte. Ich testete diese Stange und erkannte, daß sie mein Stützbedürfnis zu befriedigen vermochte. Ich machte zunächst mit Hilfe der Brause nur eine Seite der Bodenfliesen naß und testete, ob ich darauf ungefährdet stehen und gehen könne. Denn die paar Schritte von der Dusche zur Plastiktüre, mit der man den Ausgang zum WC-Raum verschließen konnte, gab es keine Möglichkeit, sich anzuhalten. Der Test ergab, daß ich auch auf dem nassen Boden keiner Rutschgefahr ausgesetzt war. Ich konnte also mit einiger Vorsicht ungefährdet allein Baden. Bei der Aufnahme hatte ich ja angegeben, daß ich beim Baden keine Hilfe brauchte. Hätte ich mich gefährdet gefühlt, so hätte ich eine Schwester um Hilfe gebeten. Der Schwestern-Rufknopf war vorhanden. Es amüsierte mich nur der Unterschied: Im REHAB-Zentrum die übertriebene Sorge um die Sicherheit, in der Klinik das Vertrauen auf die Eigenverantwortung des Patienten. Gespräch mit der Oberärztin Am Freitag nachmittag fand das Gespräch mit der Oberärztin statt. Es war aus meiner Sicht ein sehr gutes Gespräch. Die Oberärztin ging auch auf meine laienhaften Fragen ein, ob durch die Sonde nicht Kalkpartikel von den Gefäßwänden gelöst werden könnten, und ob ein stark verkalktes Gefäß durch den Stent nicht gesprengt werden könne. Die Spezialistin räumte ein, diese Fragen seien durchaus berechtigt, und sie erklärte mir, wodurch man diese Probleme im Griff habe. Die Oberärztin hatte erklärt, daß sie den Eingriff lieber unter Vollnarkose durchführe. Sie halte es auch für am zweckmäßigsten, die Angiographie und Einsetzung eines Stents in einem Eingriff zusammenzufassen. Ich meinte dazu, daß ich darin Vorteile sähe. Es sei auf jeden Fall vorteilhaft, wenn alles zusammen mit einem Eingriff erledigt werde. Und in der Vollnarkose sähe ich den Vorteil, daß der Patient den Eingriff nicht am Bildschirm verfolgen und in Panik geraten könne, wenn er etwa ein Vorkommnis mißdeute. Demnach war es offensichtlich von Vorteil, daß ich die Angiographie bei meinem ersten Aufenthalt, die die Schwester mit den Rassiermessern vorbereiten wollte, abgewendet hatte. Ich hatte auch erfahren, daß Angiographie und Einsetzung des Stents relativ lange dauern können. Das veranlaßte mich, auf meine Blasenschwäche hinzuweisen. Es werde ein Katheter in die Harnröhre gesetzt. Im Juni 2005 hatte ich mich einer Prostata-Resektion unterziehen müssen. Ich erinnerte mich an die genaue Darstellung, die ich damals bekommen hatte, (siehe Bericht »Lebensrettung als Routine« in dieser Homepage) wonach der Ringmuskel »Prostata« innen nur ausgehölt werden konnte, indem die Harnröhre zerstört wurde. Ich war daher besorgt, daß die im Heilprozeß nach der Resektion nachgebildete Harnröhre vernarbt sein könnte. Die Oberärztin bestätigte dies und empfahl mir, das den Eingriff vorbereitende Team darauf aufmerksam zu machen. Die Oberärztin teilte mir schließlich noch mit, daß der Eingriff am Montag vormittag stattfinden und daß die kleine Operationswunde dann auf die Dauer von 24 Stunden mit einem Druckverband versehen werde. Bis zum Erwachen aus der Narkose würde ich in einer Intensivstation beobachtet. Ein Wochenende lang Freizeit Damit hatte für mich die »Wochenend-Freizeit« begonnen. Ich konnte nun bereits wieder mit der rechten Hand schreiben und ich benützte die Zeit, um die gedanklich bereits vorbereitete Erzählung »Die Übersiedlung« zu Papier zu bringen – nun wie in den Anfängen meiner belletristischen Arbeiten vor mehr als dreißig Jahren ohne Computer. Es stand bereits fest, daß ich nach meiner Rückkehr ins REHAB-Zentrum Großgmain aus internen Gründen des Instituts ein anderes Zimmer bekommen würde. Ich hatte daher alle meine Habe, die sich dort angesammelt hatte, in zwei Reisetaschen und einen großen Karton verpackt und sie zur Verbringung ins andere Zimmer bereitgestellt. Die dort an der Wand beieinander stehenden Gepäckstücke erinnerten mich an meine Jugendzeit, als ich in Untermiete wohnte und des öfteren das Bedürfnis nach einem Ortswechsel hatte. Damals hatte überhaupt mein ganzes Besitztum in zwei großen Kartons Platz, die ich jeweils nacheinander, das Fahrrad schiebend, auf dem Gepäckträger beförderte. Diese Erinnerung ließ ich nun in eine Erzählung einfließen. Die Bedingungen junger Leute vor fünfzig Jahren, die nicht bei den Eltern wohnen konnten, schienen mir des Erzählens wert. Diese Erzählung brachte ich noch am Samstag fertig. Ich hatte nämlich gute Arbeitsbedingungen, da alle drei Patienten, die mit mir im selben Krankenzimmer gewesen waren, am Freitag abend entlassen worden waren. Da ich nicht damit gerechnet hatte, so treffliche Bedingungen zum Schreiben zu bekommen, hatte ich zu wenig Schreibpapier bei mir. Auf meine Bitte brachte mir die Schwester ein paar Blätter Papier. Da ich diese Erzählung in die Auswahl für den nächsten Seniorenkalender, in dem alljährlich Texte von mir veröffentlicht werden, aufnehmen werde und sie damit einen einer Öffentlichkeit zugänglichen Wert erreichen könnten, wird es gerechtfertigt sein, daß mir zehn Blatt Kopierpapier aus den Beständen der Klinik überlassen wurden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ich von Durchfall geplagt. Am Sonntag morgen hatte ich aber wieder normalen Stuhlgang. Also eine harmlose Störung, wie sie bei Umstellung der Verköstigung vorkommen kann. Das war auch deshalb nicht problematisch, weil ich ja allein im Zimmer lag und das wiederholte Aufstehen daher niemanden störte. Ich fürchtete allerdings, daß dies weitere Unregelmäßigkeiten zur Folge haben und mir nach dem Eingriff Probleme verursachen könnte. Ich teilte dies vorsichtshalber einer Schwester mit, da aber bereits Normalisierung eingetreten war, schienen sich Maßnahmen zu erübrigen. Noch am Samstag und am Sonntag vormittag schrieb ich Beiträge zur Erinnerungsreihe »Grenzerlebnisse«. Damit waren Erlebnisse gemeint, in denen ich mich in Lebensgefahr befunden hatte, und mit deren Schilderung ich schon begonnen hatte. Die Fragilität unseres Daseins – wer hätte sich nicht schon in ähnlichen Situationen befunden – schien mir auch erzählenswert. Dazu hatte ich viel mehr in Erinnerung als ich in dieser Zeit schreiben konnte, zumal ich auch auf Ausgänge mit dem Rollator nicht verzichten wollte. Für Sonntag hatten mein Sohn und die jüngere meiner Töchter einen Besuch angekündigt. Wir unternahmen dann mitsammen einen Ausflug, der mir nach fast sieben Wochen Aufenthalt in den Krankenhäusern (auch das REHAB-Zentrum zählt als Sonderkrankenanstalt zu den Krankenhäusern) eine besonders erfreuliche Abwechslung bot. Die Angiopraphie und Begleitumstände Am Montag morgen blieb der Stuhlgang aus, worüber ich ein wenig beunruhigt war. Von allem weiteren habe ich den Operationsraum als Technikraum in Erinnerung, und daß sich ein Team an mir zu schaffen machte. Ich wies noch, wie mir die Oberärztin geraten hatte, darauf hin, daß im Juni 2005 an mir eine Prostataresektion vorgenommen wurde, daß daher die Harnröhre vernarbt sei könnte. Hierauf schaltete die Wirkung der Narkose mein Bewußtsein aus. Wann ich aus der Narkosewirkung erwacht bin, ist mir nicht genau in Erinnerung. Wahrscheinlich wirkte eine gewisse Benommenheit nach. Es war wahrscheinlich am Nachmittag, als ich erkannte, daß aus dem in die Harnröhre gesetzten Katheter – er war gesetzt worden, als ich bereits in Narkose lag – Blut in den Harnbeutel floß. Ich wurde in die Urologie der Landeskrankenanstalten gebracht. Dort konnte nur der unpassende Harnkatheter entfernt werden. Der behandelnde Urologe erklärte, daß die verletzte Harnröhre so am besten heilen würde. In der darauffolgenden Nacht hatte ich anhaltende Schmerzen auszustehen. Ich hatte stundenlang ständigen Harndrang, etwa alle drei Minuten mußte ich die Harnflasche ansetzen. Es war aber Blut, das aus der Harnröhre drängte. Zugleich litt ich unter Blähungen, dabei vermochte ich wieder nicht zu unterscheiden, ob nur Blähungen oder auch Stuhl andrängte. Eine Schüssel zu verwenden, versuchte ich nach den bisherigen Erfahrungen erst gar nicht. Als ich es nicht länger aushielt, versuchte ich bei der Nachtschwester Verständnis zu erreichen. Sie hatte Verständnis, und ich durfte Aufstehen und mich aufs WC begeben. Ich mußte dann noch zweimal aufstehen. Ich tat dies aber sehr vorsichtig, jede Anstrengung vermeidend. Beim Gehen stützte ich mich nur mit der linken Hand auf den Rollator, mit der rechten hielt ich den Druckverband fest. Im weiteren wurde ich nur die Blähungen los, da ich auch dabei jede Anstrengung vermied. Das verschaffte mir immerhin eine große Erleichterung. Ich dankte der Schwester für ihr Verständnis und erklärte, daß ich für allfällige Folgen natürlich selbst die Verantwortung übernehmen würde. Falls notwendig, hätte ich auch einen Revers unterschrieben. Die Blutung ließ gegen Morgen ein wenig nach. Der Blutverlust hielt sich, wie ich am Inhalt der Harnflasche erkennen konnte, innerhalb des Verkraftbaren. Zweimal während der Nacht hatte ich wegen ungeschickten Umgangs mit der Harnflasche die Bettwäsche beschmutzt, sodaß diese ausgewechselt werden mußte. Auf meine Bitte wurde dann eine die Wäsche schonende Unterlage ins Bett gegeben. Am Morgen kam die Schwester, die nun an dem Tag Dienst hatte, und ordnete an: »Sie bleiben bis elf im Bett!« Wahrscheinlich hatte sie beim Dienstwechsel von der Nachtschwester erfahren, daß ich entgegen der verordneten Bettruhe in der Nacht aufgestanden war. Ich ließ mich auf keine Debatten ein, denn ich nahm an, daß ich es die drei Stunden ohne aufzustehen aushalten würde. Aber um halb elf waren die Blähungen wieder so heftig geworden, daß ich darauf bestand, aufzustehen und mich aufs WC zu begeben. Während ich auf dem WC weilte, hatte ein Pfleger aufgebettet und die Schonunterlage entfernt. Ich setzte mich daher auf einen Sessel, um das Ende der Ruhezeit abzuwarten. Da kam eine junge Schwester und machte mich unfreundlich aufmerksam, daß ich bis elf im Bett zu bleiben hätte. Als ich ihr den Grund, aus dem ich mich nicht ins Bett gelegt hatte, mitteilte, brachte sie wieder ein Schontuch. Um elf wurde mir wenig freundlich erklärt, daß das Bett gebraucht und ich es zu verlassen hätte. Ich hatte ohnedies mit großem Freiheitsbedürfnis darauf gewartet. Im weiteren wurde angeordnet, daß ich mich im Bad entkleiden und läuten solle. Ich dürfe den Druckverband nicht selber abnehmen, und es müsse untersucht werden, ob die Wunde und die Einstichstellen ausreichend verheilt seien. Bevor ich mich aber entkleidet hatte, kam die Anordnung, daß ich mich bereithalten solle, ich werde noch zu einer Ultraschalluntersuchung in die betreffende Station gebracht. Dort herrschte ein wohltuend freundlicher Ton. Der Druckverband wurde mir abgenommen, ich wurde untersucht und es wurde festgestellt, daß alles in Ordnung sei. Das war für mich umso beruhigender, als ich ja fürchten hatte müssen, daß das mehrmalige Aufstehen geschadet haben könnte. (Siehe auch Urinalkondom!) Eine letzte Peinlichkeit Nach der Untersuchung wartete ich aber länger als eine halbe Stunde im Rollstuhl auf dem Gang, um abgeholt zu werden. Diese Wartezeit war zu lang. Die verletzte Harnröhre signalisierte Harndrang. Ich hoffte, daß bald vom Personal jemand vorbeikommen würde, an den ich mich um Hilfe wenden könne. Aber da begann ein noch älterer Patient als ich, der auch im Rollstuhl auf dem Gang wartete, entsetzlich laut »hallo« zu rufen. Da kam sogleich eine Schwester. Sie kam aber zuerst bei mir vorbei, und ich klagte ihr mein dringendes Bedürfnis, nicht ohne zu erwähnen, daß der andere Patient gerufen habe. Ich durfte aber dann doch zuerst das WC aufsuchen. Das mag den Eindruck von Nebensächlichem geben, aber solch eine Notsituation bringt einen doch in arge Verlegenheit, da hat man das Gefühl, arg vernachlässigt zu sein. Jedem Patienten, der sich noch eines normalen geistigen Zustandes erfreuen darf, müßte es höchst peinlich sein, wenn ein blutdurchsetzter Harnfluß durch die Anstaltskleidung und über die Sitz- oder Liegeunterlage auf den Boden fließen würde. Mir wäre es jedenfalls höchst peinlich gewesen. Hierauf dauerte es nicht mehr lange bis ich abgeholt und ins Krankenzimmer zurückgebracht wurde. Nun war ich frei. Baden und Ankleiden konnte ich mich nun ohne weitere Kontrolle. Als ich mich im Bad mit der Unterwäsche bekleidet hatte, wollte man mich wieder zu einer Untersuchung abholen. Das müsse ein Irrtum sein, widersetzte ich mich, ich würde mich gerade auf die Entlassung vorbereiten. Es stellte sich sogleich heraus, daß eine Verwechslung passiert war. Man bot mir an, sogleich die Rettung für den Transport nach Großgmain zu rufen. Ich bat zu warten, bis ich fertig sei. Wenngleich ich dieses Mal so wenig wie möglich an Kleidung, Wäsche und sonstigem Bedarf bei mir hatte – alles hatte in einer Plastik-Einkaufstasche eines Großmarktes Platz – wollte ich in Erinnerung an meine verlorene Jacke dafür sorgen, daß alles in Ruhe geschehen könne. Es könne eine halbe Stunde dauern, bis die Rettung komme, warnte man mich. Aber ich erklärte mich bereit zu warten. Die letzten zwei REHAB-Wochen Zurück ins REHAB-Zentrum Als ich dann im Rettungswagen Richtung Großgmain unterwegs war, hatte ich ein Gefühl, als würde ich nach einer belastenden Tortour heimfahren. Heim zu den Betreuerinnen und Betreuern, die den Menschen mit seinem Leben umgehen lassen, wie sie selbst mit ihrem eigenen umgehen. Das Wesentliche wurde zwar gut geleistet, nämlich die Angiographie, die Untersuchung der Gefäße. Es war nun gewiß, daß die Halsschlagadern noch durchlässig genug waren, daß also kein Stent eingesetzt zu werden brauchte. Und auch die Behandlung durch die Schwestern und Pfleger war gut und zuvorkommend. Eine Aversion hatte sich nur deshalb eingestellt, weil ich gerade am Schluß des kurzen Aufenthalts unter der Verletzung der Harnröhre litt und in den letzten Stunden von Unfreundlichkeit betroffen war. Am Dienstag, den 9. Oktober 2007, war ich also wieder ins REHAB-Zentrum Großgmain gebracht worden. Unerwartet rasche Heilung Die Blutung der Harnröhre war zurückgegangen, im Harn war nur mehr wenig Blut enthalten. Aber die Harnwege hatten sich noch nicht beruhigt. Ich mußte nun mit etwa stündlichem Harndrang zurechtkommen. Obwohl ich grundsätzlich viel trinken sollte, stellte ich schon zu Mittag das Trinken ein. Dennoch scheute ich mich, für die Nacht das Schlafmittel, das mir seit dem ersten Klink-Aufenthalt unentbehrlich geworden war, zu nehmen. Ich fürchtete, daß ich unter diesen Umständen in »meinen alten Tagen« noch zum Bettnässer werden könnte. Urinalkondom Da ich nun schon zwei Nächte nicht geschlafen hatte, nur zeitweise ein wenig eingedöst war, riet mir ein Pfleger, ein Urinalkondom zu verwenden. Dieses Kondom ist auch ein Verhütungsmittel, es unterscheidet sich aber von der bekannten Art dadurch, daß es vorne an einen Schlauch mit Harnbeutel anzuschließen ist. Es verhütet also, daß Harn ins Bett rinnt. Solcherart beruhigt, nahm ich diese Nacht wieder das Schlafmittel und konnte gut schlafen. Der Harn war über Nacht in die »externe Harnblase« geglitten. Das Urinalkondom hatte also seinen Zweck bestens erfüllt. Ich stellte mir die Frage, ob dieser Behelf nicht auch bei solchen Eingriffen, wie er an mir in der Christian-DopplerKlinik vorgenommen worden war, falls eine Vernarbung der Harnröhre nach einer Prostataresektion anzunehmen sei, anstatt des Katheters verwendet werden könne. Der Operationstisch hätte sich auch damit von Harn sauber halten lassen, und die Verletzung der Harnröhre wäre vermieden worden. Ob dies aus irgendwelchen medizinischen Gründen nicht möglich sei, ist mir natürlich nicht bekannt. Kostengründe sollten nicht entscheidend sein. Denn die zweimalige Untersuchung in der Urologie mit Hin- und Rücktransport, einmal aus der Christian-DopplerKlinik, einmal aus Großgmain, durch die Rettung war sicher kostspieliger. Und dieses Urinalkondom kann auch nicht sehr teuer sein, denn im REHAB-Zentrum wurde es mir zur Verfügung gestellt, damit ich endlich eine Nacht durchschlafen konnte. Am Donnerstag, den 11. Oktober 2007, wurde ich mit dem Rettungswagen zu einer Nachuntersuchung in die Urologie der Landeskrankenanstalten gebracht und anschließend wieder nach Großgmain zurückgebracht. Der Heilungsprozeß erwies sich als zufriedenstellend. Aber der häufige Harndrang dauerte noch an. Wie sollte ich die nächste Nacht zubringen? An das Urinalkondom, das gute Dienste geleistet hat, wollte ich mich nicht gewöhnen. Denn einmal daran gewöhnt, könnte ich ohne dieses Verhütungsmittel womöglich doch noch zum Bettnässer werden. Nach Beratung mit den Pflegern wurde eine SchutzUnterlage ins Bett gegeben, und ich nahm wieder das Schlafmittel. Die Befürchtung, ich würde im Schlaf urinieren, erwies sich aber als unbegründet. Ich erwachte mehrmals und konnte die bereitgestellte Harnflasche benützen. Da ich sodann wieder die erforderliche Menge Flüssigkeit zu mir nahm, heilte die verletzte Harnröhre nach wenigen Tagen. Es waren jedenfalls keine Spuren von Blut mehr im Harn erkennbar. Auch der Harndrang ging auf das Ausmaß vor dem Eingriff zurück. Ich wunderte mich über die natürliche Heilkraft des Körpers, noch dazu in einem so sensiblen, weil natürlich unhygienischen, Bereich. Venenentzündung An der kleinen OP-Wunde und an einer Einstichstelle, in der während des Klinikaufenthaltes eine Kanüle für Infusionen gesteckt war, bildeten sicht große Hämatome. Das Hämatom an der Einstichstelle diagnostizierte die zuständige Ärztin als Venenentzündung und behandelte sie entsprechend. Es dauerte länger als eine Woche, bis die Entzündung abgeheilt war. Wohnung im zweiten Stock ohne Lift Ich konnte nun wieder ungehindert therapiert werden. In den Vordergrund trat nun die Überlegung, daß die Rehabilitation in zwei Wochen beendet sein würde und ich in meinem Haushalt allein zurechtkommen müsse. Es wurde mir zwar geraten, eine Heimhilfe in Anspruch zu nehmen, und ich war auch bereit, mir auf die Weise helfen zu lassen. Aber diese Hilfe würde sich auf bestimmte Zeiten beschränken, und es ließe sich nicht programmieren, daß nicht außerhalb dieser Zeiten Probleme zu lösen seien. Ein Problem, für das ich eine Lösung brauchte, war jedenfalls, daß meine Wohnung im zweiten Stock lag. Den Rollator brauchte ich zwar nicht in der Wohnung, und die Handläufe an der Stiege hätten es mir ermöglicht, bequem über die Stiege zu gehen. Hätte ich aber den Rollator beim Stiegenaufgang – mit einem Fahrradschloß abgesperrt – abgestellt, so hätte die Gefahr bestanden, daß er von Kindern mit zu stark ausgeprägtem »Spieltrieb« beschädigt worden wäre. Das wollte ich in Hinblick auf meinen niedrigen Pensionsbezug nicht riskieren. Ich überlegte, daß ich am Rollator einen Gurt anbringen und ihn damit über die Stiege hinter mir herziehen könnte. Außerdem wollte ich Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternehmen können. Man riet mir, daß ich mit der Rettung zum Arzt gebracht werden und daß ich Gutscheine für Taxifahrten bekommen könne. Dazu fühlte ich mich schon zu sehr gekräftigt. Hilfe aus öffentlichen Mitteln sollte nur beanspruchen, wer absolut darauf angewiesen ist. Da sogar Rollstuhlfahrer die Städtischen Busse benützen, müßte das auch mit dem Rollator möglich sein. Ich besprach die Idee mit einem Therapeuten, der, wie erwartet, ohne große Bedenken auf meine Probleme einging und das Experiment vorbereitete. Zu meiner Freude konnte ich den Rollator wie erwartet über die Stiege ziehen und ihn wieder Stufe für Stufe hinunterrollen lassen. Den Rollator allerdings auf die Weise in den Bus zu ziehen, würde schwieriger sein. Ein idealer Rollator Am letzten Tag vor seinem Urlaubsantritt wies der Therapeut darauf hin, daß es auch leichtere Rollator-Modelle gebe und auch solche, die zusammengeklappt werden könnten, und er riet mir, ein solches Modell zu beschaffen und es damit zu versuchen. Damit wäre es auch eher möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Es wurden mir zwei Modelle zur Auswahl ins REHABZentrum gebracht. Eines davon war wie für mich geschaffen. Dieser Rollator klappte zusammen, wenn ich ihn an einer Schlaufe in die Höhe hob. Mit der gesunden Linken war es kein Problem, das Gerät über Kopfhöhe hochzustemmen. Der Rollator wog nur 7,3 Kg. In der rechten hatte ich bereits genügend Kraft, um mich am Handlauf an der Stiege festzuhalten, und zu meiner Wohnung im zweiten Obergeschoß führten zwei spiegelgleiche Stiegen, sodaß ich auf der einen zum Hinaufgehen und auf der anderen zum Hinuntergehen einen durchgehenden Handlauf hatte. Daher war das Gerät wie für mich geschaffen, oder ich wurde so weit verschont, daß ich zu diesen Bewegungen befähigt blieb. Glück im Unglück Ich hatte ja überhaupt Glück im Unglück. Wie sich bereits anfangs herausstellte, dadurch, daß sich durch den Schlaganfall an den zwar altersgeschwächten aber teils noch regen geistigen Fähigkeiten nichts geändert hatte, und daß ich, wie sich jetzt herausstellte, zu den für die Selbständigkeit wichtigsten Bewegungen wieder fähig war. Training im Stiegensteigen Im REHAB-Zentrum, in dem ich bisher die NiveauUnterschiede zwischen drei Geschoßen, zum Eingang ins Zentrum, zu den Verwaltungsbüros, zur Apotheke, zu den Therapieräumen, zum Pflegetrakt, zum Ausgang ins Freie vom Pflegetrakt, zum Speisesaal und zum Einzelzimmer, stets mittels des Lifts überwunden hatte, waren auch mehrere Stiegen verfügbar. Ich übte nun in der letzten Woche täglich zwei- bis dreimal den Rollator über die Stiege vom zweiten Obergeschoß ins Erdgeschoß und wieder hinauf zu tragen. Oft wollten mir freundliche Besucher oder weniger gehbehinderte Patienten Hilfe anbieten. Aber ich mußte ihnen erklären, daß ich die Mühe zur notwendigen Übung auf mich nehmen müsse. Durch diese Übungen gewann ich das nötige Selbstvertrauen, um mir nach der Entlassung den Weg zu meiner Wohnung im zweiten Obergeschoß zuzutrauen. Eifrige Therapie-Übungen In diesen letzten Tagen hatte ich wie bisher – mit der verletzungsbedingten Unterbrechung – noch eifrig an den therapeutischen Übungen teilgenommen, um möglichst viel für die Zeit nachher zu profitieren. Da auch Übungen in der Küche vorgesehen waren – für mich als mein eigener Hausmann ja auch von praktischer Bedeutung – bot ich in Hinblick auf meinen vor 53 Jahren aufgegebenen Handwerksberuf an, ein einfaches Konditorerzeugnis herzustellen: Anisbögen, allerdings mit der Vereinfachung, daß ich sie mangels Vorrichtung nicht biegen konnte und daß ich sie – da kein Anis vorhanden war – nicht damit bestreuen konnte. Aber sie waren auch so ein wohlmundendes Gebäck für eine Kaffeerunde geworden. Die um meine Sicherheit besorgte Therapeutin, unter deren Aufsicht ich arbeitete, hatte nun keine Bedenken mehr, als ich mich in der Übungsküche ohne Rollator oder Stöcke bewegte. Und ich selbst fühlte mich dazu sicher genug. Ich hatte tatsächlich auch keine Probleme. Kontrolle des Therapieerfolges Am vorletzten Tag meines Aufenthaltes im Therapiezentrum wurde von den beiden Therapeutinnen, die am meisten mit mir gearbeitet hatten, der endgültige Stand des Fortschrittes getestet und es wurden die Einzelergebnisse des Tests in einer Liste erfaßt. Das war auch für mich ein Anlaß, das Ergebnis nach acht Wochen Therapie gedanklich mit meinen Möglichkeiten am Anfang zu vergleichen. Ich war vom Fortschritt, den ich unter der Anleitung der Therapeutinnen und Therapeuten erreicht hatte, beeindruckt. Ich hatte ja die Beeinträchtigungen noch unmittelbar in Erinnerung, die Hilflosigkeit an den ersten beiden Tagen in den Wohnung, das weitgehende Fehlen der Feinmotorik nach der Überstellung ins REHAB-Zentrum und die vergeblichen Versuche, bestimmte Bewegungen auszuführen. Nun gelang vieles: Ich konnte den rechten Unterschenkel auf dem Bauch liegend beinahe so weit in Richtung Gesäß bewegen wie den gesunden linken. Ich konnte das Besteck fast normal zum Mund führen, nur zum Suppe Löffeln zog ich noch die Linke vor. Und ich konnte mich bei der Nase nehmen. Trockenübung in der Badewanne Es folgte noch eine »Trockenübung« in der Badewanne. Ich lag bekleidet in der Wanne und sollte vorführen, daß ich aufstehen könne. Aber es gelang mir nicht. Ich rutschte mit dem Füßen davon, sodaß ich mich nicht erheben konnte. Ich entledigte mich der Socken. Das nützte aber nicht, da meine Hände und Füße stets trocken waren. Mit Hilfe der Therapeutin stieg ich schließlich aus der Wanne. Ein letztes Mal gab mir die um mich besorgte Therapeutin Ratschläge, wie ich mich dagegen sichern könne, hilflos in der Badewanne gefangen zu sein. Es gäbe eine Sitzbank, die einfach auf die Wanne gelegt werden könne. Der Vorschlag gefiel mir aber nicht, weil von der Bank das Wasser auf den Boden fließen würde, am Boden in meiner Wohnung aber kein Abfluß angebracht war. Ich einigte mich schließlich mit der Therapeutin, daß ich daheim, wenn ich allein in der Wohnung sei, kein Vollbad nehmen, sondern zum Duschen in der Wanne stehen würde. Es müsse aber unbedingt ein Haltegriff an der Wand angebracht werden. Das sah ich ein. Mein Sohn hatte mir auch bereits angeboten, einen solchen zu montieren. Es war mir klar, daß ich selbst noch keinesfalls mit einer Bohrmaschine hantieren könne. Das Problem beschäftigte mich nachher noch. Ich hatte doch einer anderen Therapeutin vorgeführt, daß ich vom Liegen auf dem Fußboden aufstehen kann. Ich wiederholte in meinem Zimmer sodann den Versuch: Ich setzte mich auf den Fußboden und legte mich zurück. Den Druckknopf, mit dem ich notfalls eine Schwester oder einen Pfleger zu Hilfe rufen hätte können, hätte ich aus dieser Position nicht erreichen können. Ich drehte mich auf den Bauch stützte mich mit den Armen auf, schob das vom Bett weiter entfernte Knie vor und konnte, mich am Bettrand festhaltend, mühelos aufstehen. Es war mir klar, daß ich mich auf die Weise auch aus der Badewanne erheben könne. Ich würde also nicht dauernd auf ein Vollbad verzichten müssen. Dank für Leistungen Hinkebein Nicht ganz den inzwischen hoch angesetzten Erwartungen entsprach das Gehen. In der Position, in der das Bein beim Schreiten durchgestreckt wird, geriet das Knie anstatt der normalen Streckung entweder zu weit zurück oder es blieb zu weit vorne. Ich hatte mich bei weiten Gehübungen im Freien, oft dreimal täglich je eine halbe Stunde rund um das Gelände des REHAB-Zentrums, immer wieder um die richtige Haltung bemüht, aber sie gelang nicht. Ich wurde von mehreren Seiten vertröstet, daß dies »noch kommen werde«. Aber nach meinen Beobachtungen hatte ich den Eindruck, daß an irgendeinem Muskel oder einer Sehne ein irreparabler Schaden entstanden sein könne. Das hatte aber nur ein auffallendes Hinken, jedoch keine weitere Behinderung zur Folge. Ich fühlte mich also für den Wiederbeginn eines selbständigen Lebens gewappnet. Halbtaube Glieder Ich weiß nicht, wie das medizinisch richtig zu benennen sei. Im rechten Arm von der Schulter bis zu den Fingerspitzen und im rechten Bein von der Hüfte bis zu den Zehenspitzen hat sich seit der Lähmung, trotz weitgehend wiederhergestellter Beweglichkeit, das normale Gefühl nicht mehr eingestellt. Bei vollkommener Gefühllosigkeit würde ich von tauben Gliedern sprechen, womit natürlich nicht eine Gehörlosigkeit gemeint wäre. Das Bedeutungswörterbuch von Duden sieht diese zweite Bedeutung ausdrücklich vor. Meine Glieder sind aber nicht gefühllos, sondern ich fühle mit ihnen oder in ihnen schwer erklärbar vermindert. Tastsinn und Schmerzempfindungen sind normal, Kälteempfinden ist vermindert, die rechten Gliedmaßen fühlen sich auch weniger warm an (ich konnte dies natürlich nur mit der linken Hand am linken und am rechten Bein vergleichend testen, allerdings fühlt sich auch der rechte Arm ebenso nicht so warm an wie das linke Bein), wenn ich auf der rechten Seite im Bett liege, fühle ich das ungefähr so, als würde ich auf einem Brett liegen, nicht ganz so hart. Ein Bekannter der schon vor 16 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat, erklärte mir, daß dieses halbtaube Gefühl bei ihm geblieben sei. Ich habe mich aber nun vier Monate nach dem Ende der Rehabilitation auch daran gut gewöhnt. Dank Am Mittwoch, den 24. Oktober 2007, verabschiedete ich mich im REHAB-Zentrum. Ich bin davon überzeugt, daß man im REHAB-Zentrum unternimmt, was möglich ist, um jedem Patienten wieder ein normales, selbständiges Leben zu ermöglichen. Was für mich erreicht wurde, übertrifft jedenfalls bei weitem meine Erwartungen, und ich danke dafür allen, die an meiner Rehabilitation durch ärztliche Betreuung, Therapie und Pflege mitgewirkt haben. Ich habe dem Bericht eine Beschreibung der „schönen Zeit vorher“ vorangestellt. Und ich kann nun, da ich bereits wieder vier Monate allein und unabhängig lebe, mitteilen, daß sich diese schöne Zeit nun fortsetzt. Es ist manches anstrengender als mit „gesunden Gliedern“, es läßt sich alles nur langsamer verrichten, aber ich erfreue mich wieder am Schreiben von Belletristik, an den Studien von Themen-Grundlagen, am Lesen zur Bildung oder Unterhaltung, am Hören von »klassischer Musik« zur Erbauung oder Unterhaltung und, zum erlebnisreichem Ausgleich, sogar wieder an ersten Versuchen des Bergwanderns. Auf vertrauten Wegen hinke ich bereits wieder ein Stück bergan. Es ist also alles wieder wie vorher möglich, nur langsamer. Für das alles bin ich dankbar. In Dankgebeten wende ich mich aber auch an Gott. Ich glaube an Gott als den eigentlichen Urheber des Alls, unserer Welt, unseres Seins. Dem wird oft die Frage entgegengesetzt, warum Gott soviel Leid und soviel Böses zulasse. Wir stehen mit unserer Erkenntnisfähigkeit vor vielen Grenzen und stoßen auch mit dieser Frage an Grenzen. Der Gläubige wird darauf vertrauen, daß auch dies alles seinen Sinn im Schöpfungsganzen habe. Natürlich gilt es für mich nach wie vor auch, Banales zu verrichten wie die Arbeiten im Haushalt. Im folgenden gebe ich noch eine konkreten Einblick in das „Banale“ und in Ungewöhnliches. Wieder unabhängig Wieder in der eigenen Wohnung Mein Sohn holte mich mit dem Wagen ab, wofür ich dankbar war. Er mußte dann allerdings, nachdem er den Haltegriff bei der Badewanne montiert hatte, mir bei einem ersten Einkauf behilflich gewesen war und wir meine Rückkehr in meine Wohnung gefeiert hatten, zurück zu seiner Familie. Er nahm an, und ich war auch darauf eingestellt, daß ich eine Heimhilfe bekommen würde. Am Freitag, den 26. Oktober würde der Staatsfeiertag sein, darauf das Wochenende folgen. Ich könnte also, wenn ich noch am Donnerstag, den 25. Oktober, telefonisch anfragen würde, frühestens am Montag, den 29. Oktober, Hilfe bekommen. Nach dieser Überlegung beschloß ich, zunächst einmal zu versuchen, wie ich allein zurechtkommen würde, und bei Bedarf am Montag um Unterstützung anzufragen. Morgens war das Bett in Ordnung zu bringen, beim Baden entstanden besonders anfangs im Badezimmer große Wasserlachen, die ich aufwischen mußte, das Geschirr war abzuwaschen, am Donnerstag und am Samstag hatte ich noch dringende Einkäufe im nahen Einkaufszentrum zu besorgen. Das Kochen konnte noch einige Wochen aufgeschoben werden, da sich im Gefrierschrank reichlich Vorräte befanden, die nur aufgetaut und in der »Mikrowelle« erhitzt zu werden brauchten. Ich hatte auch wieder mit schriftstellerischen Arbeiten begonnen und brauchte dazu ein Buch, das sich in einem obersten Fach der bis zur Zimmerdecke reichenden Regale befand. Früher hatte ich dieses Fach auf einer beweglichen Treppe freistehend erreichen können. Das war jetzt nicht möglich. Ich stellte die fünfsprossige Stehleiter ans Regal und konnte mich mit der rechten Hand sichernd festhalten und mit der linken das Buch an mich nehmen. Schon am ersten Sonntag, also am 28. Oktober, gönnte ich mir ein Vollbad. Der erste Teil des Erhebens wird ja, wie ich mir inzwischen noch überlegt hatte, durch das archimedische Prinzip unterstützt: Ein Körper verliert in einer Flüssigkeit scheinbar soviel an Gewicht, als die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt. Für die Muskelkraft wird das Scheinbare zur Tatsache. Ein Vorteil, der bei der Trockenübung nicht wirksam war. Das Email meiner Badewanne ist außerdem nicht mehr so glatt wie jenes der Übungswanne. Und meine Wanne ist etwas schmäler und kürzer. Ich konnte daher vom Sitzen aus mühelos aufstehen, indem ich mich am Haltegriff und am Wannenrand festhielt. Notfalls hätte ich mich sitzend oder in Bauchlage auf das linke Knie erheben können. Hätte ich ernste Probleme gehabt, so hätte ich nachher noch die Therapeutin angerufen und ihr bestätigt, daß sie recht gehabt habe. Ernst genommen hatte ich ihre Warnungen ja stets, indem ich mich vorsichtig, jedoch nicht zu vorsichtig verhalten hatte. Die Hilflosigkeit der ersten Tage nachgestellt Ich weiß nicht, ob das übermütig war? Die Neugier trieb mich dazu, die Szenen, durch die ich am zweiten Tag nach dem Anfall Hilfe organisierte, nachzustellen. Auch das verlief problemlos. Ich konnte dabei eigentlich nicht mehr recht begreifen, warum es mir stundenlange Anstrengungen bereitet hatte, die Türen zu öffnen. Das gelang nun wieder mühelos. Aber für den einseitig Gelähmten sind gewisse Bewegungen unmöglich. Ich erinnerte mich und erinnere mich, wie ich beim Versuch, wie ein Baby zu krabbeln, umgekippt bin, bevor ich mich aufrichten hatte können. Verzicht auf Heimhilfe und Pflegegeld Ich überlegte mir nach all diesen Erfahrungen, daß ich ohne Heimhilfe zurechtkommen könne. Ich erklärte dies der zuständigen Stelle. Ich erklärte auch den Verzicht auf das mir zustehende Pflegegeld. So mancher wird mir dazu sagen: »Du bist ja dumm. Bei deiner kleinen Pension auf etwas zu verzichten, das dir zusteht.« Aber die Beeinträchtigung verursacht mir keinen finanziellen Mehraufwand. Daß ich nun bei allem deutlich langsamer bin, schmerzt mich zwar, weil weniger Zeit für mein schriftstellerisches Wirken bleibt. Da ich aber mit meinen Texten bisher kein Einkommen zu erreichen vermochte, verursacht dies keinen Verdienstentgang – für dessen Ausgleich das Pflegegeld übrigens nicht vorgesehen wäre. Ich meine, daß in Fällen ohne tatsächlichen finanziellen Aufwand und ohne Leistungen von Angehörigen überhaupt kein Pflegegeld gewährt werden sollte. Das wäre immerhin eine kleine Entlastung der insgesamt kaum mehr finanzierbaren Pflegekosten. Diese allgemeine Einschränkung würde aber daran scheitern, daß der wirkliche Pflegebedarf nicht exakt überprüfbar sein dürfte. Ich möchte jedenfalls – unabhängig von der Gesetzeslage – keine nach meinem eigenen Ermessen ungerechtfertigte Unterstützung auf Kosten der Allgemeinheit beanspruchen. Gefahr einer Wiederholung Was mir seit dem Studium der abschließenden Befunde Sorge bereitet, ist, daß keine vorangegangene Ursache für den Schlaganfall gefunden wurde. Die unmittelbare Ursache ist in den meisten Fällen eine Durchblutungsstörung im Gehirn, durch die die Hirnzellen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden und absterben. Daß in meinem Gehirn die Zellen, die für die Muskulatur der rechten Seite zuständig waren (linke Gehirnhälfte) abgestorben sind, konnte durch eine Untersuchung eindeutig festgestellt werden. Ursachen, die zur Kalkablagerung in den Gefäßen und daher zu einer unzureichenden Durchblutung führen, konnten aber nicht erkannt werden. Als solche Ursachen sind vor allem zu nennen: Bluthochdruck – mein Blutdruck war aber seit Jahren durch Medikamente auf den Normalwert gesenkt. Hohe Blutfette – damit lag ich im Grenzbereich, es bestand jedoch keine Gefahr. Zuckerkrankheit – alle Messungen hatten Normalwerte ergeben. Bewegungsarmut – ich wanderte seit Jahren einmal wöchentlich auf den Untersberg (1400 m Höhenunterschied); durch das stete Training hatte mich dies nicht übermäßig angestrengt. Rauchen – ich war zeit meines Lebens Nichtraucher. Übermäßiger Alkoholkonsum – ich trank jeweils nur zum Essen »eine Halbe« Bier oder »ein Achterl« Wein; laut ärztlicher Auskunft unbedenklich. Tatsächlich haben die Untersuchungen auch keine kritische Verkalkung von Halsschlagadern gezeigt. In dem diesem Bericht vorangestellten Leserbrief habe ich daher geschrieben: »… als gesunder 72-Jähriger …«. Dennoch war meine Gesundheit angeschlagen. Im Alter von etwa fünfzig Jahren begann meine für den Beruf des Steuerberaters, in dem man alljährlich mit einer unglaublichen Fülle von Änderungen in den verschiedenen Rechtsbereichen konfrontiert ist, so wichtige Lern- und Merkfähigkeit nachzulassen, und ich begann an Ermüdbarkeit und Konzentrationsschwäche zu leiden. Diese Probleme nahmen im Lauf von acht Jahren so sehr zu, daß ich meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Es passierten mir Fehler, die nicht tragbar waren. Ich mußte die Pensionierung wegen Brufsunfähigkeit beantragen, und diese wurde auch genehmigt. Wahrscheinlich fehlte es an geeigneten Untersuchungsmethoden, um die gesundheitlichen Probleme exakt zu überprüfen, andrerseits fehlten nur noch eineinhalb Jahre bis zur Frühpension, die damals noch ohne weiteres gewährt wurde. Die Ursache dürfte wahrscheinlich in zu schwacher Durchblutung liegen. Dies kann anscheinend durch die Routineuntersuchungen nicht festgestellt werden, und es gibt dagegen anscheinend keine dem Bedarf anpassungsfähigen Medikamente. Der Augenarzt stellte die zu schwache Durchblutung aber durch Überdruck in den Augen fest, der ohne Behandlung zum grünen Star und zur Erblindung führen könnte. Die Erblindung ist auch trotz Behandlung nicht auszuschließen, weil die Sehnerven „angegriffen“ sind. Damit könnten auch die Ermüdbarkeit, das Nachlassen der Lern- und Merkfähigkeit sowie die Konzentrationsprobleme erklärbar sein. Nach dem Übertritt in den Ruhestand widmete ich mich im vermehrten Ausmaß der schriftstellerischen Tätigkeit. Und auch dabei stellte sich heraus: Nach etwa zwei Stunden am Computer ermüdete ich sosehr, daß ich die Arbeit auf längere Dauer unterbrechen mußte. Daran änderte sich seit Pensionsantritt nichts mehr. Am Sonntag, den 12. August 2007, saß ich aber, wie eingangs beschrieben, vom frühen Vormittag an bis 20 Uhr, unterbrochen nur durch das Mittagessen und das Abendessen, Fotos ordnend und beschreibend am Computer. Dies war für mich eine interessante Arbeit. Dennoch dürfte mich die ununterbrochene lange Arbeit am Computer zu sehr angestrengt haben. Ich nehme daher an, daß diese Anstrengung der unmittelbare Auslöser des Schlaganfalls gewesen sein könnte. Die Ärzte bestätigten dies zwar nicht. Aber nach den langjährigen Erfahrungen des Ermüdens nach einigen Stunden beliebiger Schreibtischarbeit werde ich diesen Verdacht nicht mehr so einfach los. Dies schien sich zudem auf unsichere Weise zu bestätigen: Als meine Freizeitbeschäftigung im REHABZentrum noch auf Lesen eingeschränkt war, las ich als anspruchsvolle Lektüre den Roman »Doktor Faustus« von Thomas Mann. Nach etwa zweistündigem Lesen geriet ich in einen Zustand von sonderbarer leichter Verwirrung. Das war für mich ein Zeichen, das Buch für längere Zeit beiseite zu legen und mich entweder körperlich zu beschäftigen oder mich auf das Bett zu legen und auszuruhen. Diese Erfahrung bestärkte mich weiter in der Annahme, daß die lange Computer-Arbeit am 12. August 2007 den Schlaganfall unmittelbar ausgelöst haben könnte. Ob diese Annahme nun richtig ist oder nicht – ich werde in Hinkunft zu lange einseitige geistige Beschäftigung vermeiden. Wenn ich die Nachwirkungen des Schlaganfalls, von denen ich betroffen bin, überdenke und mit Beobachtungen an viel schwerer betroffenen Patienten in der Klinik und im REHABZentrum vergleiche, so kann ich von Glück im Unglück sprechen. Die körperliche Beeinträchtigung – falls ich für den Rest meiner Zeit zum Hinken verurteilt sein sollte – ist erträglich. Ich kann nicht nur meinen Rollator mehrmals täglich über die Stiege in den zweiten Stock tragen, sondern ich vermag auch allen Erfordernissen des Alltags ohne fremde Hilfe gerecht zu werden. Und hinsichtlich der geistigen Fähigkeiten ist durch den Schlaganfall keine Änderung eingetreten. Daher ist es mir ein besonders ernstes Anliegen, einen weiteren Schlaganfall zu vermeiden. Dazu werde ich beachten, was allgemein zum Vorbeugen empfohlen ist: Gesunde und nicht zu reichliche Ernährung. (Im REHABZentrum wurde eine Broschüre mit Tipps und Rezepten zur gesunden Ernährung angeboten, die ich erworben habe.) Salzkonsum reduzieren Übergewicht vermeiden Nicht rauchen – dieses Verbot halte ich als Nichtraucher ohnedies ein. Kein übermäßiger Alkoholkonsum Regelmäßige Bewegung, körperliche Ertüchtigung Täglich zweimal den Blutdruck messen Die vorgeschriebenen Medikamente regelmäßig einnehmen Sich regelmäßig den ärztlichen Untersuchungen unterziehen Darüber hinaus werde ich, wie beschrieben, zu lange andauernde geistige Beschäftigungen vermeiden und versuchen, mich möglichst auch jedem Streß zu entziehen. Ich habe vor, diesen Bericht nach Jahresfrist, wenn möglich, noch mit den weiteren Erfahrungen, die ich in diesem Zeitraum gewinnen werde, zu ergänzen. Salzburg, den 24. Februar 2008 Paul Abart e.h. Ein Jahr später Wie angekündigt, berichte ich nun über meine Erfahrungen im ersten Jahr nach dem Schlaganfall bzw. nach der Rehabilitation: Eine wesentliche Besserung konnte ich nicht mehr erreichen. Ich habe aber auch keine weitere Behandlung von Physiotherapeuten in Anspruch genommen. Gegen die »Restbehinderung« im Gehen wußten die gewiß bestens ausgebildeten Therapeuten im Rehabzentrum keinen Rat. Und ich hatte auch den Eindruck, daß ich von einer irreparablen Veränderung im rechten Knie betroffen sei. Ich konnte im Rehabzentrum ja auch schwerwiegendere irreparable Schädigungen an Patienten beobachten, und daraus folgerte ich, daß es irreparable Veränderungen gibt. Da nach der Rückkehr in die eigene Wohnung alle Verrichtungen viel mehr Zeit beanspruchten, wollte ich die ohnedies zu kurze verbleibende Zeit dem Schreiben widmen. In der Zwischenzeit sind wieder einige wichtige Texte entstanden. Wenngleich keine weitere Besserung erreicht wurde, so bin ich nun bereits mehr als ein Jahr lang in der Lage, alle AlltagsAufgaben selbst zu bewältigen. Ich verrichte also alle Haushaltsarbeiten wie Kochen und Reinigen selbst. Die Verrichtungen von Hand nehmen zwar mehr Zeit in Anspruch, aber der Herd und die Haushaltsgeräte arbeiten im StandardTempo. Für die Besorgungen verwende ich nach wie vor einen Rollator (Rollwagen). Dieses Gerät wiegt nur 7,2 kg, und ich vermag es daher mit dem gesunden linken Arm hochgestemmt über die Stiegen zu meiner Wohnung im zweiten Stock zu tragen. Auch sonst überall überwinde ich, wo kein Lift vorhanden ist, den Weg in höhere Geschoße über die Treppen – vorausgesetzt, es ist ein Handlauf angebracht. Ohne Geländer, an dem ich mich mit der rechten Hand festhalten kann, ist mir das Stiegensteigen nicht möglich. Auf gleiche Weise kann ich auch in die Städtischen Busse einsteigen und aussteigen. Dadurch sind für mich alle wichtigen Ziele erreichbar. Zugreisen sind mir jedoch nicht möglich. Die schmalen, senkrechten Einstiege in die Waggons sind mit dem Rollator nicht zu überwindende Hindernisse. Meine Freude am Bergwandern hat mich jedoch in diese Richtung initiativ werden. Nach der Schneeschmelze im Tal habe ich mich im Februar 2008 zu einem ersten, kleinen Versuch auf den wohlvertrauten Weg am Untersberg gewagt. (Ich gebe hier für ortskundige Leser die lokalen Orts-, Weg- und Grundstücksnamen an.) Ich ging von der Bus-Endstation in Fürstenbrunn das steile Wegstück zum Kiefer-Marmorbruch Frürstenbrunn (über die ehemalige Schrägaufzug-Trasse). Ich brauchte dazu allerdings doppelt so lange wie früher, als ich noch gesund war. Und ich war nach diesem Wegstück – hin und zurück etwa eine Stunde – ermüdet. Da aber Bewegung auch nach dem Schlaganfall geboten war, beschloß ich, diese Wanderversuche auf steilem Gelände fortzusetzen. Ich ging jedesmal ein Stück weiter. Auf die Weise erreichte ich am 4. Juli 2008 zum ersten Mal wieder die Schwaigmühlalm. Diese Teilstrecke auf der Schiabfahrt von der Bergstation der Untersbergseilbahn, von der aus durch einen kleinen Anstieg der Salzburger Hochthron – mein früheres wöchentliches Wanderziel – erreichbar ist, hatte ich, solange ich gesund war, in 2 ¼ Stunden bewältigt. Nun brauchte ich bis zur Schwaigmühlalm 4 ½ Stunden, zuzüglich ½ Stunde Rast-Zeiten. Nach so langem Ausdauer-Training fühlte ich mich glücklich, daß ich dieses Ziel wieder erreichen konnte. Beim Abstieg mußte ich mich besonders auf den Weg konzentrieren, und ich brauchte daher 3 ½ Stunden. Diese Wanderung war für mich nun also eine Tagestour. Es hätte daher keinen Sinn gehabt, die Versuche weiter in Richtung Gipfel auszudehnen. Fortan ging ich, um mich ausreichend zu bewegen, wenn das Wetter einigermaßen geeignet war, einmal jede Woche auf die Schwaigmühlalm und einmal die kürzere Strecke bis zum Hubschrauber-Landeplatz 3. Eine Besserung meiner Gehfähigkeit erreichte ich durch dieses ausgedehnte Training – nach ungefährer Berechnung pro Tour 29.000 Schritte – auch nicht. Aber es genügte mir, daß ich eine so weite steile Strecke bergauf und wieder bergab hinken konnte. Als ich zum ersten Mal die Piste erreichte, dort die Mittagsrast hielt und nach einem bescheidenen Imbiß den Rucksack auf den Rücken schwingen wollte, erlebte ich den ersten Sturz. Aber ich fiel neben dem Stein, auf dem ich gesessen war, auf das dürre Laub des Waldbodens, und ich blieb daher unverletzt. In der Folge stürzte ich wiederholt, vor allem, wenn ich mich beim Bergabgehen einen Augenblick nicht konzentrierte. Aber ich fiel immer auf erdigen Boden, Wiesenboden oder auf relativ weichen Waldboden. Ich zog mir daher nie eine Verletzung zu. Und ich hatte ja, seit nach dem Hörsturz auch der Gleichgewichtssinn ein wenig gestört war, die Schipiste als Wanderweg gewählt, weil man dort zwar stürzen, aber nicht abstürzen kann. Schlimmstenfalls wäre es möglich, den Hang hinunterzukollern. Da ich nie Gelegenheit hatte, das Schifahren zu lernen, war ich auch früher im Winter mit Schneeschuhen auf dem Pistenrand auf den Salzburger Hochthron gewandert. Am 15. November 2008, als auf etwa 900 Höhenmetern der erste Schnee wieder geschmolzen war, war die Piste und ihr Umfeld besonders rutschig. Als ich mich ein kleines Stück über den Pisterand hinaus begab, rutschte ich auf nassen Gräsern und einem nassen Stein aus und fiel auf den Rücken. Ich kam in einer Mulde auf dem Rucksack, mit dem Oberkörper abwärts geneigt, zu liegen. Es schien, als würde es mir nicht gelingen, mich wieder zu erheben. Nach einiger Plage gelang es mir, den Rucksack abzuschnallen. Dann konnte ich mich umdrehen, sodaß ich mich auf die Knie erheben und dann aufstehen konnte. Kurze Zeit später kamen aber ein Mann die Piste herab und wieder ein wenig später eine Frau die Piste aufwärts gegangen. Ich hätte also mit Hilfe rechnen können. Mein Handy hatte sich im Rucksack befunden, und ich hätte es nicht erreicht, wenn es mir nicht gelungen wäre, den Rucksack abzuschnallen. Seit diesem bedenklichen Erlebnis gehe ich über das flachere Endstück der Schiabfahrt, das von der Bus-Endstation zur »Umfahrung«, einer Forststraße, und auf dieser Forststraße (Umfahrung) weiter zur steilen Schipiste führt. Auch dort kann es auf dem Wiesenboden rutschig, oder ein Stück weiter oben eisig sein. Wenn es ausgiebig bis ins Tal schneit, liegt dort Schnee, wie es für die Schipiste erwünscht ist. Dafür bin ich mit Gröderln und mit Schneeschuhen ausgerüstet. Auf der steilen Piste würde ich mich, im Unterschied zu früher, mit diesen Hilfen nicht mehr sicher fühlen. Aber auf diesem relativ flachen Weg kann ich auch den Winter über problemlos wandern. Der Weg ist zwar nicht so weit wie der im Sommer zur Schwaigmühlalm, aber das Gehen mit Gröderln oder Scheeschuhen ist anstrengender, sodaß ich ausreichendes Training erreiche. Alles in allem bietet sich mir bis auf weiteres befriedigende Lebensqualität. Ich danke Gott dafür, und ich erinnere mich auch dankbar der Behandlungen in der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und im Rehabzentrum in Großgmain. Salzburg, 4. Jänner 2009 Paul Abart e.h.