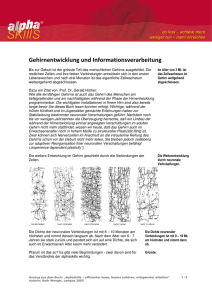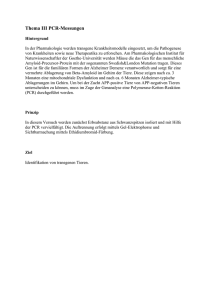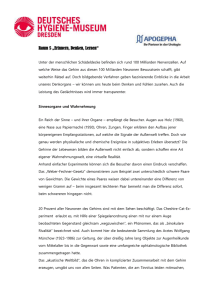neurobiologischen Grundlagen des Lernens
Werbung

Prof. Dr. Annette Scheunpflug Neurobiologische Grundlagen des Lernens Die Beschreibung von Lernprozessen durch Beobachtungsmethoden und erklärende Theorien aus den Biowissenschaften steht bisher noch am Anfang. In den letzten Jahren ist zwar viel Detailwissen entwickelt worden, eine umfassende Theorie der Gehirnentwicklung, die das Gesamtsystem des Gehirns umfassend beschreiben könnte, steht aber noch aus. Zudem ist der interdisziplinäre Dialog zwischen der Erziehungswissenschaft und den Biowissenschaften an dieser Stelle noch unterentwickelt und in der Überdehnung der Aussagen häufig nicht unproblematisch (vgl. Becker 2006). Auch die nachfolgenden Aussagen sind vorsichtige Schritte in ein unübersichtliches Gelände. Wenn Kinder auf die Welt kommen, sind die Nervenzellen im Gehirn zum Zeitpunkt der Geburt im Wesentlichen angelegt. Sie sind nur wenig miteinander verbunden. Nicht die Nervenzellen machen die kognitive Leistung des Gehirns aus, sondern die Art ihrer Verbindung miteinander. Viele der Verbindungen wachsen im ständigen Kontakt mit der umgebenden Umwelt. Das Gehirn steht über Nervenzellen in Kontakt zu allen Körperteilen. Die aus den Sinnesorganen gesendeten Impulse regen zu entsprechenden Verbindungen an. Zudem sind die Neuronen des Gehirns noch nicht ausgewachsen, genauso wie in anderen Körperteilen findet auch im Gehirn Wachstum statt. Beide Prozesse, der Aufbau neuronaler Netze und das Wachstum der Neuronen, sind für die kindliche Entwicklung von Bedeutung. Nun werden nicht wahllos alle neuronalen Verbindungen geknüpft und erhalten, die sich anbieten oder die entstanden sind. Vielmehr werden neuronale Verbindungen einem internen Bewertungsprozess unterzogen, der geeignete Verbindungsmuster heraussucht: „Das Gehirn entscheidet, gesteuert von seinen eigenen Bewertungen, welche Aktivitätsmuster Veränderungen der Verschaltung induzieren dürfen. Das hierfür benötigte Vorwissen liegt in der funktionellen Architektur der Bewertungssysteme gespeichert und ist genetisch festgelegt.“ (Singer 2001, S. 5) Ca. ein Drittel der einmal angelegten Verbindungen bleibt erhalten, der Rest wird wieder vernichtet. Nach welcher Logik diese Prozesse vollzogen werden, wird zur Zeit intensiv untersucht. Vermutlich sind sie vergleichbar mit einem darwinischen Ausleseprozess: „Kontakte werden im Überschuss angelegt und solche, die einer funktionellen Validierung standhalten, bleiben.“ (Singer 2001, S. 3) Werden Neuronenverbindungen nicht gebraucht, verschwinden diese. Genau genommen passiert Lernen damit immer auf der Grundlage des schon Gekonnten oder Gekannten. Neues entsteht im Gehirn durch die Verknüpfung von schon Vorhandenem. Die Mannigfaltigkeit der Kombinationsmöglichkeiten lässt aber sehr unterschiedliche Denkstrukturen entstehen. Was sind die Kriterien für eine Integration oder eine Nichtintegration von Neuronenverbindungen in den Gesamtkontext? Auch hierzu liegen einige erste Informationen vor. Offensichtlich ist das Gehirn keine „tabula rasa“, sondern enthält gespeicherte Hypothesen, an denen entlang sich der Aufbau neuer Erkenntnisse organisiert. Diese sind unterschiedlich, angesichts der Tatsache, dass Menschen sehr unterschiedliche Dinge Wissen, Verhaltensweisen, logische Muster, Bewegungen etc.) lernen. Gefühle Gefühle stellen eine sehr wichtige Bewertungsinstanz für Eindrücke dar. Sie sind für den Aufbau der neuronalen Netze von Bedeutung sowie für die nachfolgende Handlungssteuerung. Anschlussfähigkeit Im Gehirn wird blitzschnell entschieden, ob ein Impuls aus der Umwelt an irgendeiner Stelle anschlussfähig ist. Die Anschlussfähigkeit kann im Einzelnen sehr unterschiedlich aussehen. Konvergenz und Divergenz zu bestehenden Mustern sind wichtige Aspekte, ebenso wie die konkrete Anknüpfungsmöglichkeit an bestehendes Wissen. Ohne Anschlussmöglichkeiten wird ein Impuls von Außen im Gehirn nicht aufgenommen, er rauscht einfach vorbei. Die Sinneswahrnehmungen von Außen werden in die elektrischen Reize des Gehirns umgewandelt und dann auf Anschlussfähigkeit überprüft. Dabei spielt die Art der Sinnesreizung – anders als in vielen pädagogischen Lehrbüchern unterstellt – keine Rolle. Schließlich wird das Gehirn nicht durch Sinnesreizungen zu neuen Verbindungen angeregt, sondern dadurch, dass Sinnesreize als Sinneseindrücke zugelassen und diese dann im Gehirn in neuronale Verbindungen umgesetzt werden, also eine Anschlussmöglichkeit an bereits bestehende Verbindungen finden. Deshalb ist es nicht die Kombination mehrerer Sinne, die als solche zu einem besseren Lernergebnis führt, sondern bei unterschiedlichen Herangehensweisen ergibt sich eine höhere 1 Wahrscheinlichkeit, finden. Anschlussfähigkeit zu Module Das Gehirn verfügt vermutlich – dieser Theorieansatz ist allerdings nicht unumstritten (vgl. abwägend Barrett 2002, S. 270-294) – über verschiedene Module zur Bearbeitung und Erkennung unterschiedlicher Probleme. Welche das sind, von wie vielen solcher „Module“ man sprechen kann und wie diese im Einzelnen aussehen, ist umstritten. Bekannt ist, dass unterschiedliche Neuronen auf unterschiedliche Funktionen spezialisiert sind (vgl. Damasio 2000, S.59f.), z. B. auf die Bearbeitung von Formen oder Farben, Emotionen oder Sprache. Diskutiert wird, in welcher Form sich die Spezifität neuronaler Mechanismen in die Form der Informationsverarbeitung hinein verlängert. Offensichtlich ähnelt das Gehirn weniger einem Allzweckcomputer, der alle Probleme mit demselben Programm bearbeitet, sondern eher einem Schweizer Taschenmesser, das für unterschiedliche Probleme unterschiedliche Werkzeuge bereithält. Demnach wären eine Vielzahl kognitiver Programme evolviert, um spezifische Probleme lösen zu können. Diese „Module“ (Cosmides/Tooby 1997) oder „Algorithmen“ dienen z. B. dazu den Spracherwerb zu steuern (Pinker 1998), den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeiten zu ermöglichen (Gigerenzer 2002), zu zählen (Dehaene 1999) oder soziale Regeln zu verstehen (Cosmides/Tooby 1992). Unklar ist bisher, wie sich die einzelnen Aktivitäten im Gehirn koordinieren bzw. einzelne Module gegenseitig koordiniert werden. In der Hirnforschung wird dieses Problem als „Bindungsproblem“ diskutiert. Vieles spricht dafür, dass dieser Prozess dezentral abläuft (vgl.zu den einzelnen Modellen Singer 2002, S. 65-72). Wiederholung Neuronale Verbindungen bestehen umso sicherer, je öfter sie verwendet werden. Je häufiger eine Verbindung verwendet wird, umso automatisierter wird auch der mit ihr verbundene Impuls. Das Einüben bestimmter Verbindungswege, z. B. im motorischen Bereich das Erlernen des Laufens oder eines Musikinstrumentes, ist nur über die Wiederholung möglich. Wer häufig Fahrrad fährt, wird dabei geschickter. Wer sein Musikinstrument häufig übt, wird eine Zunahme der Geläufigkeit spüren. Wer den Zehnerübergang oder das Einmaleins häufig übt, wird dieses besser können. Wer englische Vokabeln eifrig lernt, wird diese geläufiger verwenden können. Die Wiederholung ist damit ein wichtiges Kriterium für den Aufbau neuronaler Netze. Zusammenfassend kann die Arbeitsweise des Gehirns stark vergröbert so beschrieben werden: Das Gehirn saugt nicht etwa wie ein Schwamm alle einströmenden Eindrücke auf, sondern arbeitet hoch selektiv nach der Maßgabe seiner eigenen Funktionalität. Anmerkung: Dieser Text stellt eine sehr kurze Zusammenfassung dar. Genauer ist dies nachzulesen in: Duncker, Ludwig/Scheunpflug, Annette/Schultheis, Klaudia: Schulkindheit. Anthropologie des Lernens im Schulalter. Kohlhammer, Stuttgart 2004, S. 172-230. Literatur: Barrett, L./Dunbar, R./Lycett, J.: Human Evolutionary Psychology. Princeton 2002 Becker, N.: Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik. Bad Heilbrunn 2006 Eigeninitiative Sehr bedeutend scheint die Eigeninitiative des Organismus zu sein. Häufig werden Verbindungen nur dann induziert, wenn sie „Folge aktiver Interaktion mit der Umwelt sind, bei denen der junge Organismus die Initiative hat“ (Singer 2002, S. 50). Für viele Operationen sucht sich das Gehirn selbst die Informationen, die es braucht. Sowohl tätiges Handeln als auch Denken sind kognitiv gesteuerte Prozesse. Die Betonung der Eigentätigkeit und Eigeninitiative für das menschliche Lernen nobilitiert damit nicht die Bedeutung des praktischen Handelns vor dem Denken. Vielmehr ist gerade auch die denkerische Eigentätigkeit gemeint und in diesem Kontext gleichermaßen wie das tätige Handeln von Bedeutung. 2