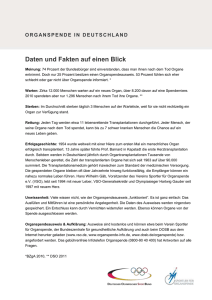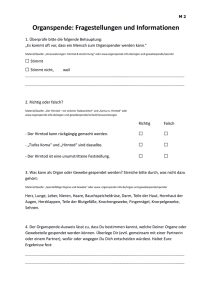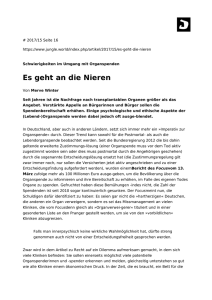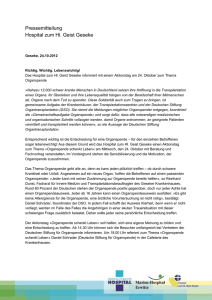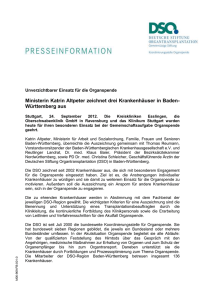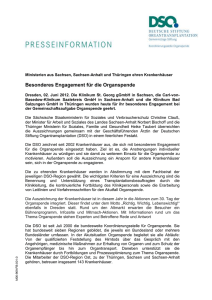Es gibt zu wenig Transplantationsbeauftragte
Werbung
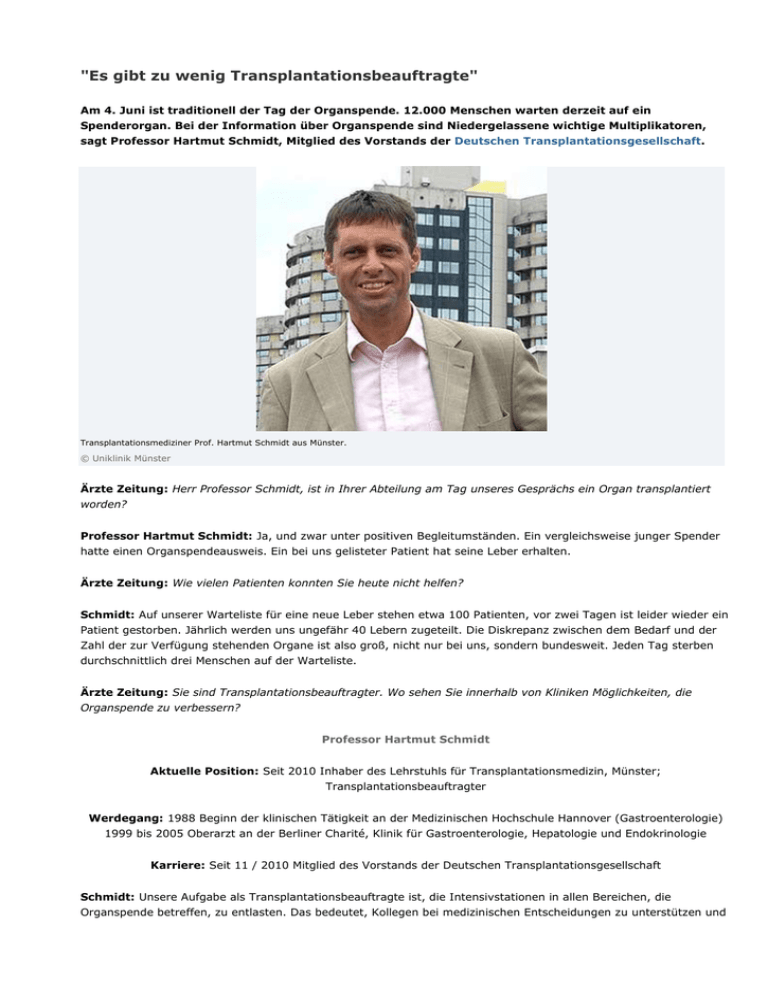
"Es gibt zu wenig Transplantationsbeauftragte" Am 4. Juni ist traditionell der Tag der Organspende. 12.000 Menschen warten derzeit auf ein Spenderorgan. Bei der Information über Organspende sind Niedergelassene wichtige Multiplikatoren, sagt Professor Hartmut Schmidt, Mitglied des Vorstands der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Transplantationsmediziner Prof. Hartmut Schmidt aus Münster. © Uniklinik Münster Ärzte Zeitung: Herr Professor Schmidt, ist in Ihrer Abteilung am Tag unseres Gesprächs ein Organ transplantiert worden? Professor Hartmut Schmidt: Ja, und zwar unter positiven Begleitumständen. Ein vergleichsweise junger Spender hatte einen Organspendeausweis. Ein bei uns gelisteter Patient hat seine Leber erhalten. Ärzte Zeitung: Wie vielen Patienten konnten Sie heute nicht helfen? Schmidt: Auf unserer Warteliste für eine neue Leber stehen etwa 100 Patienten, vor zwei Tagen ist leider wieder ein Patient gestorben. Jährlich werden uns ungefähr 40 Lebern zugeteilt. Die Diskrepanz zwischen dem Bedarf und der Zahl der zur Verfügung stehenden Organe ist also groß, nicht nur bei uns, sondern bundesweit. Jeden Tag sterben durchschnittlich drei Menschen auf der Warteliste. Ärzte Zeitung: Sie sind Transplantationsbeauftragter. Wo sehen Sie innerhalb von Kliniken Möglichkeiten, die Organspende zu verbessern? Professor Hartmut Schmidt Aktuelle Position: Seit 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Transplantationsmedizin, Münster; Transplantationsbeauftragter Werdegang: 1988 Beginn der klinischen Tätigkeit an der Medizinischen Hochschule Hannover (Gastroenterologie) 1999 bis 2005 Oberarzt an der Berliner Charité, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Karriere: Seit 11 / 2010 Mitglied des Vorstands der Deutschen Transplantationsgesellschaft Schmidt: Unsere Aufgabe als Transplantationsbeauftragte ist, die Intensivstationen in allen Bereichen, die Organspende betreffen, zu entlasten. Das bedeutet, Kollegen bei medizinischen Entscheidungen zu unterstützen und - in Zusammenarbeit mit dem Koordinator der Deutschen Stiftung Organtransplantation - potentielle Spender zu erkennen. Das Klinikum Münster beteiligt sich an der Inhouse-Koordination, einem Projekt der DSO - Deutsche Stiftung Organtransplantation -, bei dem die Arbeit der Koordinierungsstelle und der Klinikmitarbeiter eng miteinander verzahnt werden. Als Transplantationsbeauftragter spreche ich auch mit den Angehörigen. Es ist unbedingt notwendig, dass für die Gespräche genügend Zeit und geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Daran fehlt es oft. Ärzte Zeitung: Das Verbesserungspotential liegt also in erster Linie in der Bereitstellung von Transplantationsbeauftragten selbst? Schmidt: Zum großen Teil, ja. Und wir müssen die Arbeit der Transplantationsbeauftragten professionalisieren. Die Intensivstationen benötigen eine sehr qualifizierte Hilfestellung, anders ist Organspende nicht zu leisten. Es gibt zu wenig Transplantationsbeauftragte und es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzgeber bei der anstehenden Novellierung des Transplantationsgesetzes die Spenderkrankenhäuser verpflichten würde, Transplantationsbeauftragte zu etablieren. Ärzte Zeitung: Gäbe es denn genügend qualifizierte Ärzte? Schmidt: Leider nein, dafür müssen wir sorgen. Die Aufgaben eines Transplantationsbeauftragten sind sehr spezialisiert und erfordern unter anderem längere praktische Erfahrung auf einer intensivmedizinischen Station. Es wäre wünschenswert, wenn es für diese Tätigkeit eine dem Facharzt vergleichbare Qualifizierung und eine angemessene Honorierung gäbe. Wir müssen, um Nachwuchs zu gewinnen, zusätzlich zur guten Ausbildung berufliche Entwicklungsmöglichkeiten mit finanziellen Anreizen schaffen. Ärzte Zeitung: Gibt es Konzepte, um den Nachwuchs zu fördern? Schmidt: Teilweise gibt es Curricula. Aber die Fachgesellschaften müssen gemeinsam mit der Standesvertretung der Ärzteschaft ein umfassendes Konzept entwickeln und in die Ärzteschaft hineintragen. Die Universität Münster hat für Humanmedizinstudenten im 3. klinischen Semester einen einwöchigen Kurs zum Thema Organtransplantation verpflichtend gemacht. Das ist ein Baustein. Außerdem engagieren sich Studenten in der Initiative "SOS Studenten für Organspende". Medizinstudenten sind nicht nur der Nachwuchs von morgen, sie tragen das Thema auch in die Gesellschaft. Ärzte Zeitung: Die Bevölkerung wird durch verschiedene Institutionen wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder die Krankenkassen informiert. Intensität und Qualität der Information sind heterogen. Schmidt: Natürlich haben die von Ihnen genannten Institutionen unterschiedliche Interessen. Hier muss die Politik dringend Aufgabenbereiche und Kompetenzen klären. Wir brauchen ein strukturiertes, nationales Konzept, basierend auf einer Konkretisierung im Gesetz. Aus meiner Sicht sollte sich die DSO auf ihre Kernkompetenz der Koordinierung postmortaler Organspenden konzentrieren und die BZgA die führende Rolle bei der Information der Bevölkerung bekommen. Dazu benötigt die BZgA natürlich die finanziellen Mittel. Ärzte Zeitung: Sollte eher für Organspende geworben oder neutral informiert werden? 2 Schmidt: In erster Linie muss man deutlich machen, dass Organspende Leben retten kann, also etwas Positives ist. Meine persönliche Meinung: Jeder Mensch, der im Notfall ein Organ annehmen würde, sollte auch bereit sein, Organe zu spenden und dies dokumentieren. In erster Linie sollte es bei der Aufklärung der Bevölkerung darum gehen, die Menschen überhaupt zu einer Entscheidung zu motivieren. Wenn jemand kein Organspender sein möchte, ist es wichtig, Klarheit zu schaffen und die Angehörigen im Fall des Hirntods von einer Beschäftigung mit dieser Frage zu entlasten. Ärzte Zeitung: Würden Sie sich der Forderung anschließen, die Widerspruchslösung einzuführen? Schmidt: Ich würde eine Selbstbestimmungslösung favorisieren, wie sie auch die Bundesärztekammer vorschlägt. Danach würden die Menschen nach einer strukturierten Aufklärung gebeten, sich zur Frage der Organspende zu erklären. Liegt keine Erklärung vor, dürften postmortal Organe entnommen werden. Ärzte Zeitung: Wie soll gesichert werden, dass jemand, der sich nicht erklärt, die Folgen einer Nichtäußerung verstanden hat? Nur dann bestünde ein Unterschied zur Widerspruchslösung. Schmidt: Wir müssen obligat dieses Thema in den Schulen und gegebenenfalls auch im Rahmen von Erste-HilfeKursen, Erwerb des Führerscheins, Ausstellen eines Personalausweises und Ähnlichem ansprechen und informieren. Ärzte Zeitung: Immer mehr Menschen begrenzen in Patientenverfügungen die Intensität medizinischer Behandlungen am Lebensende. Bleibt da Raum für die Fortführung einer intensivmedizinischen Therapie zum Zweck der Hirntoddiagnostik und Organspende, häufig ja über mehr als 24 Stunden? Schmidt: Wenn der Patient in der Verfügung nicht ausdrücklich angibt, dass er trotz einer Begrenzung lebenserhaltender Maßnahmen Organspender sein sollte, darf das Leben nicht auf eine mögliche Organspende hin verlängert werden. Anders, wenn einer Organspende zugestimmt wurde. Dann sind die erforderlichen Maßnahmen vom Willen des Patienten abgedeckt. Viele Musterentwürfe von Patientenverfügungen, auch der vom Bundesjustizministerium empfohlene Entwurf, erwähnen Organspende ganz am Ende und weitgehend formal. Das reicht nicht. Wir müssen die Berufsgruppen, die über Patientenverfügungen beraten, besser informieren: also Notare, Rechtsanwälte und Ärzte. Ärzte Zeitung: Welche Rolle sollten Hausärzte bei der Information über Organspende haben? Schmidt: Niedergelassene Ärzte haben die meisten Patientenkontakte, sie sind daher wichtige Multiplikatoren für das Thema Organspende und sie sind natürlich die ersten, individuellen Ansprechpartner für den Patienten. Aus meiner Sicht sollte ein Gespräch über das Thema Organspende zu einer obligatorischen hausärztlichen Leistung werden und über die Gebührenordnung der Ärzte abzurechnen sein. Die Beratung darüber, was ein Patient im Falle eines nahenden Lebensendes verfügen möchte, auch zur Frage der Organspende, sollte auf Kenntnis der individuellen Biografie beruhen und gehört in die Hand des Hausarztes. Das Interview führte Nicola Siegmund-Schultze 3