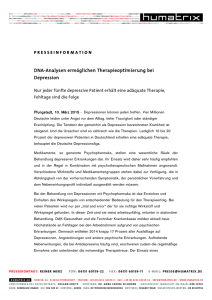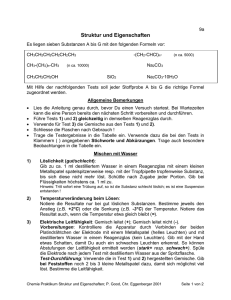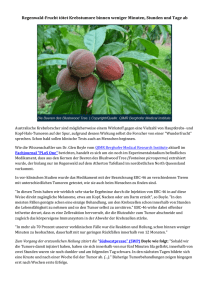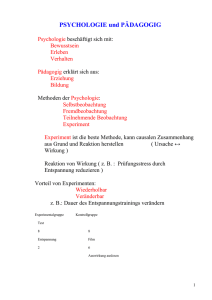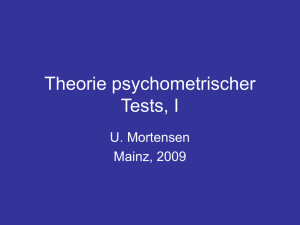Michael Winkler: Möglichkeiten und Grenzen der Kompetenzforschung
Werbung

Michael Winkler: Möglichkeiten und Grenzen der Kompetenzforschung Zwei Vorbemerkungen, die zugleich als Einleitung dienen: Ich gestehe zunächst eine leichte Irritation über Ihre Einladung, damit verbunden eine gewisse Befangenheit. Das hängt damit zusammen, dass ich kein Berufspädagoge bin, sondern von Haus aus zum einen Sozialpädagoge – das ist schon schwierig genug, weist aber wenigstens im Bereich etwa im Bereich der Forschung zu belasteten Jugendlichen und zur Arbeit der Jugendberufshilfe Nähe zum Feld der beruflichen Bildung auf. Zum anderen aber bin ich nun Allgemeinpädagoge, mithin Angehöriger einer seltsamen Spezies, der man die Kompetenz zur Inkompetenz nachsagt; dass ich nun im Feld der beruflichen Bildung und der Auseinandersetzung mit der Problematik benachteiligter Jugendlicher auftauche, führt also dazu, dass die u. a. von Bojanowski beschriebene Unübersichtlichkeit in diesem Feld noch ein wenig erweitert wird. Dabei trete ich gewissermaßen als Amateur auf – Trost gibt hier die Einsicht, dass selbst im olympischen Sportgeschehen die Amateure längst Vollprofis sind. Jedenfalls bedeutet dies, dass ich doch gewissermaßen als naiver Außenbeobachter auftrete, vor Insidern und Spezialisten; das kann eine Chance bedeuten, geht aber unweigerlich damit einher, dass ich vieles nicht weiß, was in diesem Feld nun zu wissen ist. Bitte haben Sie also Nachsicht mit mir. Diese Bitte um Nachsicht mache ich auch für meine zweite Vorbemerkung geltend. Mein Vortrag hat eine Oberflächenstruktur und eine Substruktur. Auf der Oberflächenstruktur schlage ich in fünf knapp skizzierten Punkten eine Brücke zwischen den ursprünglichen Intentionen der allgemeinen Kompetenztheorie und den Möglichkeiten, diese in einem erweiterten Verständnis von Kompetenzforschung, insbesondere für benachteiligte Jugendliche, als hilfreiches Instrument zu nutzen. Ich beginne also – erstens – mit einer kleinen Erinnerung an das Konzept der Kompetenz, spreche – zweitens – einige Probleme der Kompetenzforschung im Feld des Übergangs von Schule zu Beruf an, um – drittens – dann nach der Tauglichkeit der Testverfahren zu fragen. Viertens referiere ich einige Befunde, die wir inzwischen zu Kompetenzen von Jugendlichen haben. Fünftens deute ich Perspektiven an, wie Kompetenzforschung vielleicht aussehen könnte. Die Substruktur meines Vortrages bestimmt aber eine wachsende Skepsis gegenüber einer wuchernden Testunkultur, die inzwischen mit immensem Aufwand betrieben wird und deren Ergebnissen von Ministerien wie von Unternehmen eine 1 Wahrheit zugesprochen wird, welche sie nicht bietet. Diese Testunkultur verbirgt, wie sehr sie instrumentalisiert, wie stark sie eingebettet wird in Verfahren der Selektion. Etwas boshaft formuliert: was heute als Kompetenztests vermeintlich sichere Ergebnisse verspricht, ist nichts anderes als ein formalisiertes Verfahren, Menschen aus dieser Gesellschaft auszuschließen und dem Ausschlussakt die höhere Weihe von Wissenschaftlichkeit zu geben. Das muss nicht so sein – deshalb schlage ich eine Alternative vor. Doch sollten wir die Augen gegenüber den Risiken und Nebenwirkungen der Kompetenztests nicht verschließen. 1. Kleine Erinnerung an die Kompetenztheorie Der Begriff der Kompetenz, mit diesem auch die Kompetenztheorie und Kompetenzforschung gehören heute zu jenen Selbstverständlichkeiten der pädagogischen Debatten, die uns vor allem dadurch beglücken, dass ihnen jegliche Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist. Das hängt damit zusammen, dass ein ursprünglich theoretisch ambitioniertes Konzept zunehmend trivialisiert worden ist, vor allem aber (und vielleicht zugleich) in eine kaum mehr zu überblickende Vielzahl wenig klar ausformulierter und konkurrierender Vorstellungen eingemündet ist. Worin bestand der ursprüngliche Charme des Konzepts? Eine lange Traditionslienie von Kompetenz geht bekanntlich auf die Rechts- und Verwaltungslehre zurück, in der Kompetenz einerseits Zuständigkeit und Verantwortlichkeit bedeutete, andererseits aber zugleich einen Raum markiert, in welchem zuständige und verantwortliche Akteure in einem gewissen Umfang selbständig agieren konnten. Die jüngere Traditionslinie setzt in der linguistischen Theorie Noam Chomsky´s ein. Competence bezeichnet bei ihm eintheoretisches Konstrukt, um eine der faszinierendsten Leistungen der menschlichen Sprache zu erfassen. Zum einen – deshalb konstruiert er competence relativ nahe zum sogenannten language acuisition device – erfasst es mit diesem Konzept, dass offensichtlich jeder Neugeborene seine Sprache aufgrund banaler und minimaler Umweltinformationen adäquat und komplex konstruiert. Zum anderen bezeichnet competence die eigentümliche Fähigkeit natürlicher Sprecher, niemals zuvor gehörte Sätze korrekt phonetisch, grammatikalisch, lexikalisch und semantisch zu identifizieren, bzw. selbst mit den bislang erworbenen sprachlichen Mitteln neue, vorher nie formulierte Sätze generieren zu können. Competence bezeichnet also die Möglichkeit, mit einem relativ beschränkten 2 Repertoire an Möglichkeiten und unter Nutzung von ebenfalls eingeschränkten Speichern letztlich unendlich viel Neues zu erzeugen. Damit hatte Chomsky – wieder – die Grundeigenschaft menschlichen Handelns thematisiert, dass es eben nicht bloß erworbenes Verhalten darstellt, sondern in der Lage ist, Neues zu erfinden, bzw. zu begreifen. Er beruft sich dabei auf zwei Ahnherren, nämlich auf Descartes, und Humboldt. Das scheint auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen zu gehen, trägt genauer betrachtet aber Züge des Genialen. Mit dem Verweis auf Descartes zeigt er auf, das competence etwas mit Natur zu tun hat; im Kern geht es um neuronal basierte Strukturen, die angeboren, aber selbst nach eigenen Gesetzmäßigkeiten modifikationsfähig sind – ein Ansatz, der starke Verwandtschaft mit den Überlegungen von Piaget und Wygotskis aufweist. Naturgegebenheit bedeutet, dass sie nicht beliebig modifizierbar sind, die Grundstrukturen vom competence lassen sich nicht beeinflussen, sondern müssen pfleglich behandelt und entwickelt werden – das macht deutlich, dass und wie die heute üblichen, noch in Lehrpläne hineinreichenden Vorstellungen mit diesem Modell gar nicht kompatibel sind, welche eine scholar betriebene Ausbildung von Kompetenzen unterstellen. Der zweite Ahnherr Chomsky´s ist vielleicht noch wichtiger: Das Konzept knüpft nämlich explizit an Wilhelm von Humbold an, genauer an dessen Sprachtheorie, die ihrerseits enge Bezüge zu seiner allgemeinen Bildungstheorie hat – welche er letztlich nur fragmentarisch ausgeführt hat. Humboldt zeigt, wie menschliche Entwicklung nur zu begreifen ist, wenn wir eine natürlich gegebene Kraft unterstellen, welche zur Weltaneignung und Weltgestaltung befähigt, sich aber darin selbst zunehmend spezifiziert und sich noch selbst reflexiv auffassen kann. Man könnte von Emergenzprozessen sprechen, das Autopoiesiskonzept hat Affinitäten. Die Theorie der Kompetenz will also ein komplexes, vor allem dynamisches Geschehen der Selbsterzeugung begreifen, das in der Zeit geschieht. Es hat mit Natur auf der einen Seite, mit Selbständigkeit, Subjektivität und Autonomie auf der anderen Seite zu tun, welche in sozialen Zusammenhängen und in der Auseinandersetzung mit Welt sich konstituieren. Diese Theorie – die übrigens auch mit Hegel in Verbindung gebracht werden kann – ist von Jürgen Habermas implizit in der berühmten, zunächst als Raubdruck erschienenen Vorlesung zur Theorie der Sozialisation und explizit in einem wenige Jahre später verfassten Text zur Rollenkompetenz aufgenommen worden, hat dann rasche Verbreitung in der Erziehungswissenschaft 3 gefunden. Den Hintergrund dafür bildet der Versuch, von einem durch seine bürgerlichen Konnotationen für überkommen gehaltenen Bildungsbegriff Abschied zu nehmen und an die jüngere sozialwissenschaftliche Entwicklung anzuschließen. Kompetenz wurde von der Erziehungswissenschaft interessanterweise im Kontext sowohl der realistischen Wendung wie im Rahmen ihrer kritischen, mit dem Begriff der Emanzipation verbundenen Theoriebildung favorisiert, nicht zuletzt, weil man mit dem Konzept eine Chance gesehen hat, sich von den Verengungen zu befreien, die mit dem Begriff der Qualifikation entstanden waren. Dieser knüpfte allzu eng an gesellschaftliche und ökonomische Erwartungen an und bezog sich vornehmlich auf die Inhalte und Ziele, die von Abnehmern des Bildungssystems für die Arbeitskräfte formuliert wurden. Kompetenztheorie eröffnete demgegenüber eine Perspektive auf Subjektivität; sie war durchaus emanzipatorisch zu denken, war zugleich realistisch im Blick auf die Anforderungen moderner Gesellschaften, die in ihrer inneren Dynamik und Komplexität letztendlich auf Subjekte in ihrer Autonomie angewiesen ist. Damit tritt freilich eine Dialektik hervor: Die Debatte um Kompetenz war nämlich zunächst in hohem Maße gedanklich mit positiv belegten Vorstellungen von sozialem und kultureller Fortschrittliche assoziiert. Kompetenz stand dem optimistischen Fortschrittsprojekt nahe. Heute ist jedoch die Debatte um Kompetenz und Kompetenztheorie sozusagen affirmativ geworden. Kompetenz wird nämlich nicht nur als der Weg gesehen, wie die Subjekte in die Lage kommen könnten, mit einer offenen und hochdynamischen Gesellschaft und ihrer Kultur, vor allem mit deren ökonomischen Anforderungen umgehen zu können. Vielmehr dient Kompetenz sozusagen der Modernisierung der Moderne und ihrer Ökonomie, weil es möglich wird, das Subjekt als solches zu instrumentalisieren. Bei Kompetenz geht es mithin nicht mehr um die Bedingungen der Möglichkeit von Autonomie in einem emphatischen Sinne des Ausdrucks, sondern in einem hochgradig funktionalen Verständnis der Angelegenheit. Man könnte von der nützlichen Kompetenz sprechen, die hier begriffen und erzeugt werden soll. In der Vielzahl von grundlagentheoretischen Vorstellungen von Kompetenz, mit welchen wir heute zu tun haben, spiegelt sich diese dann doch massive Veränderung wider; nüchtern betrachtet haben wir nicht nur eine Vielzahl zu konstatieren, sondern eine massive Diffusität und damit eine Art undertheorising, welches dazu führt, dass das Konzept kaum mehr die Komplexität erreicht, die es 4 ursprünglich zu erfassen suchte. Dabei wird es zum einen – formal gesehen – schon in seiner Grundkonzeption unklar. Kompetenz stützt sich auf keine solide Theorie mehr, selbst in der großen PISA-Untersuchung zeigt sich bei näherer Betrachtung – höflich formuliert – eine konzeptionelle Vielfalt, die keine klare Konstruktion von Aufgaben und Tests erlaubt. Zum anderen geht es mit Kompetenz nicht anders als mit den parallel entwickelten Schlüsselqualifikationen – die ja selbst oftmals als Schlüsselkompetenzen bezeichnet werden. Das Dilemma besteht hierin, dass eine nahezu unendliche Zahl von solchen Schlüsseln definiert wird – man fühlt sich ein wenig an jene Schmetterlingen gleich schwirrenden Schlüssel erinnert, welche Harry Potter in der Kammer des Schreckens zu schaffen machen; jeder formuliert – inhaltlich – eine andere Kompetenz als entscheidend, die Debatte verlagert sich also auf die spezifischen Anforderungen, welche von den Branchen des Wirtschaftssystems erwartet werden; diese divergieren aber in einem solchen Maße, dass das Konzept keinen Sinn mehr macht. Dies führt dann dazu, dass die einschlägigen Untersuchungen im Übergang von Schule zur betrieblichen Bildung gar keine Kompetenzen mehr erheben, schon gar nicht die Erwartungen modernen Unternehmen prüfen, sondern sehr basale Fähigkeiten abfragen und untersuchen, bei welchen gar nicht sicher ist, ob und wieweit sie begründete Aussagen und Prognosen für die künftige Leistungsfähigkeit eines Probanden ermöglichen. Endlich geht die Chance verloren, welche der Kompetenzansatz ursprünglich eröffnete: Gerade mit seinem Blick auf Subjektivität verlangte er, Leistungspotenziale und individuelle wie nahräumliche, vom Subjekt selbst zu aktualisierende Ressourcen zu prüfen und die Frage danach zu stellen, wie diese Möglichkeiten durch dieses selbst aktualisiert werden. Ein kompetenzorientierter Ansatz verlangt nämlich eigentlich zweierlei: Traditionell formuliert sollte er zeigen, was Pädagogik zu allererst zu bewältigen hat, nämlich Bildsamkeit als zentrales Merkmal junger Menschen zu entdecken, das dem Bildungsprozess zugrunde liegt. Zum anderen sollte er zeigen, wie biographisch die Erfindung des Neuen ermöglicht wurde, wie sie sich als Stärken unter Herausforderungen zeigen, in welchen Welt- und Selbstkonstruktion angestoßen wird. Die Wirklichkeit der Kompetenzdebatte ist davon gegenwärtig weit entfernt. Letztlich geht es ihr um die Identifikation von Defiziten, nicht um eine biographisch und an Ressourcen interessierte prozessbezogene Entdeckung von Potenzialen, welche der Unterstützung bedürften – und vielleicht auch den Unternehmen helfen. 5 2. Kompetenzforschung und Beruf Aus den angedeuteten Grenzen der Kompetenzdebatte sollte man jedoch keine generellen Vorbehalte gegen Kompetenztheorie und Kompetenztests ableiten. Denn: Sofern sich diese auf den Kontext des Berufs- und Beschäftigungssystems beziehen und innerhalb dessen Rahmungen bleiben, liegen interessante und im Ergebnis ergiebige Zugänge vor. Vor allem ist die Pragmatik der Messung weit genug vorangeschritten, um plausible Verfahren und Befunde zu erzeugen – das belegen die von Erpenbeck und Heyse sowie die von Clement und Arnold herausgegebenen Bände. Plausibilität gewinnen diese Kompetenztests, weil sie in der Perspektive beruflicher Weiterbildung im System durchgeführt werden, damit die Arbeitswelt als biographisch relevantes stabiles Referenzsystem, zudem selbstbestimmtes Lernen untersuchen. Sehr viel schwieriger stellt sich die Lage dar, wenn es um den Übergang von Schule zum beruflichen Bildungssystem geht. Nicht zuletzt die neue Arbeitsmarktpolitik mit ihrem Konzept des Förderns und Forderns verlangt neue Instrumentarien, die eng mit der Kompetenztheorie verbunden scheinen; Eignungsfeststellung, Potenzialanalyse, Förderdiagnostik, gar ein persönlichkeitsorientiertes Profiling werden hier gefordert, ohne dass jedoch präzise Vorstellungen darüber bestehen, was damit gemeint ist. Systematisch gesehen, werden jedenfalls eigentlich gar keine Kompetenzmessungen durchgeführt, sondern punktuelle Leistungsfeststellungen nach Kriterien, welche außerhalb des eben abgeschlossenen Bildungsganges formuliert werden. Um es pointiert zu sagen: Obwohl gerade hier Kompetenztests als Entwicklungsdiagnostik sinnvoll und notwendig sind, werden sie letztlich sinnwidrig eingesetzt, nämlich als eine Feststellung des in dem einen System Erreichten, das am Maßstab des anderen Systems gemessen wird. Man fragt nicht, welche Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung ein Proband subjektiv mit sich bringt, sondern man such nach dem, was er nicht leistet – und vermutlich auch nicht leisten kann, weil er bislang anderen Maßstäben genügen musste. Faktisch beobachten wir im Feld des Übergangs von Schule und Beruf eher triviale Testverfahren, die deutlich unter dem konzeptionellen Niveau bleiben, das in der eben beschriebenen Kompetenzforschung allgemein und für Beruf und Weiterbildung im besonderen entwickelt worden ist. Sieht man einmal von den öffentlich und in den Medien gern zum Ausdruck gebrachten, generellen Urteilen über die Leistungs- und Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen ab, dann zeigt sich, dass die 6 von Unternehmen durchgeführten Untersuchungen die geprüften Domänen eher konventionell anlegen; sie bleiben noch vor allem weit vor den Erwartungen, welche in den öffentlichen Debatten für künftige Arbeitskräfte artikuliert werden. Etwas überspitzt formuliert: Sie prüfen Rechtschreibung und Mathematikkenntnisse, zum Teil in fas absurder Weise Wissensbestände aus dem Bereich der Allgemeinbildung, sie prüfen aber selten Team- und Kommunikationsfähigkeit, sie testen nicht, ob und inwiefern ein Jugendlicher bereit ist, sich für einen Betrieb einzusetzen u.s.w.. Im Grundsatz trifft dieser Vorbehalt auch die Untersuchungen, wie sie im Rahmen der internationalen Vergleichsstudien gemacht wurden, insbesondere durch die Programme for International Student Assessment. Diese geben vor, kompetenzoerientiert zu sein, behaupten dabei, auf Basiswissen zu rekurrieren, wie es für die Lebensbewältigung in den modernen Gesellschaften der Gegenwart unabdingbar sei. Sie operieren also mit einer Vorstellung von Allgemeinbildung. Nur, abgesehen davon, dass sie methodisch allein eine punktuelle Überprüfung vornehmen, helfen sie ärgerlicherweise gerade mit dieser Ausrichtung an allgemeiner Bildung nut wenig, wenn es um Kompetenzen für die berufliche Ausbildung oder für die Berufstätigkeit geht. Denn, obwohl gerade PISA vermeiden wollte, sich am Schulsystem zu orientieren und eine breitere Perspektive eröffnen möchte, verfehlt es durch diese inhaltliche und durch die Aufgabenstruktur in den Tests vorgenommene Ausrichtung am Allgemeinen des Bildungsgeschehens den Zusammenhang zu den Lebenszusammenhängen in einer ganzen Kultur des Aufwachens wie aber auch zu den betrieblichen Anforderungen. Fatalerweise verstärken die jüngeren Entwicklungen im Bildungssystem dies sogar noch. Nicht nur sind die nationalen Qualitätsstandards und die diesen korrespondierenden Tests nahezu ausschließlich schulbezogen; vielmehr haben die jüngeren Untersuchungen, wie sie etwa im DESI-Programm durchgeführt wurden und zumindest rudimentär in ihren Ergebnissen vorliegen, wieder eine stark curriculare Komponente gewonnen. Damit blenden sie lebensweltliche Bezüge von jungen Menschen aus, ignorieren die Felder, welche inzwischen unter dem Begriff des informellen und non-formalen Lernens gefasst und als relevant für die Entstehung von Kompetenzen für das Arbeitsleben angesehen werden; sie blenden vor allem die Dimensionen des sozialen Kapitals aus, das von jungen Menschen biographisch erworben oder ihnen aber aufgrund ihrer Lebensumstände verweigert wird. In der Tat liegt hier ein entscheidendes Problem, nämlich dass die sozialen und 7 kulturellen Belastungen überhaupt nicht erfasst werden, welche über den Lebenserfolg von jungen Menschen letztendlich mehr entscheiden als die Vorbereitung durch die Schule. 3. Tauglichkeit der Testverfahren Im Grunde gründen diese Defizite in den uns vertrauten Testverfahren: Wie alle Tests, beanspruchen auch Kompetenztests ein objektives Verfahren zu entwickeln, das mit objektivierten Daten ein Bild der Leistungsmöglichkeiten und der Leistungsfähigkeit (nicht nur) von jungen Menschen erbringt. Insbesondere im Schulzusammenhang erhofft man sich, somit Abstand von dem als willkürlich erscheinenden Urteilen von Lehrern zu gewinnen, und zugleich ein Bild von deren Leistungsfähigkeit, allzumal von der Qualität des Unterrichts zu bekommen. Zugleich aber blenden Tests geradezu systematisch Faktoren aus, welche entscheidend sind, um Aussagen über Kompetenz zu machen – zumindest wenn wir Kompetenz eben so umfassend fassen, wie ich dies im Rückgriff auf die Theorie des Konzepts eingangs angedeutet habe. Letztlich verengen die verfügbaren Tests in der Regel ihren Beobachtungsgegenstand zu einer Art Unkenntlichkeit – ein wenig klingt dies nach, wenn Beobachter übrigens auch in anderen Ländern eine arge Diskrepanz zwischen PISAErgebnissen und den eigenen Erfahrungen mit dem jeweiligen Bildungssystem konstatieren. Ich will diese Problematik der Tests in acht Punkten zusammenfassen – sehr pauschal natürlich und daher angreifbar: Das nun wirklich ganz erstaunliche Phänomen auch bei den doch mit großem Aufwand betriebenen Untersuchungen wie THIMSS und PISA – zu DESI liegen bislang noch zu wenig Unterlagen vor, um ein Urteil zu rechtfertigen – besteht – erstens – in den handwerklichen Fehlern allzumal bei der Erstellung der Aufgaben – zur statistischen Auswertung, vor allem zur Definition von Kompetenzniveaus gibt es ebenfalls massive Kritik, die aber bisher eher in engeren Kreisen artikuliert worden ist. Dies hängt wiederum mit einer bemerkenswerten Abschottung gegenüber Kritik zusammen, die von den PISA-Akteuren betrieben wird. Zu diesen handwerklichen Fehlern gehört beispielsweise, dass die Testaufgaben zum Teil in aberwitzigen Übertragungen aus der für die Tests maßgebenden Leitsprache englisch geradezu sinnentstellend entwickelt worden sind; man kann sprachliche Schnitzer 8 feststellen, die bis in die Sinnstrukturen der Aufgaben so weit reichen, dass diese eigentlich nicht mehr zu lösen sind. Das ist inzwischen überzeugend vor allem für die Aufgaben nachgewiesen worden, welche Lesekompetenz und Mathematikkompetenz erschließen sollen, trifft aber auch die Problemlösetests. Ein zweites, leider sehr grundsätzliches Problem besteht darin, dass eigentlich offen bleibt, was Tests erheben. Dies gilt allzumal, wenn wir mit komplexen Sachverhalten zu tun haben. Etwas zugespitzt formuliert gilt daher: Tests testen Tests. Ob sie wirklichsichere Auskunft geben über Beziehungen etwa zwischen Unterricht und Outcome ist zumindest unter Testtheoretikern und – praktikern umstritten – oder eigentlich schon nicht mehr. Weinert hat beispielsweise darauf hingewiesen, dass man über Tests eine nahezu unendliche Vielzahl von für Unterricht relevanten Wirkungszusammenhängen und Faktoren gewinnt, ohne jedoch definitiv Aussagen machen zu können, was denn kompetentes Verhalten eigentlich auslöst und bewirkt. Das führt zu meinem dritten Vorbehalt. Tests verengen das zu Erhebende auf das Messbare. D. h., sie operieren von vornherein mit Aufgabenstellungen, die im Dual „0“ oder „1“, „wahr oder falsch“ bewertet werden können. Möglicherweise funktioniert dies in Mathematikaufgaben und vielleicht taugt es für naturwissenschaftliches Wissen. Wann immer aber wir mit textgebundenen Sinnstrukturen zu tun haben, geht dies schief – als ein Beispiel nenne ich hier eine Testaufgabe eines Betriebes in den neuen Bundesländern, die nach dem ersten deutschen Nachkriegskanzler fragt. Dass es sich dabei um Adenauer handeln muss, ist zwar klar, nur geraten etwa ostdeutsche Jugendliche mit ihrem noch auf die DDR zurückgehenden Wissen in eine – vorsichtig formuliert – Irritation. Insbesondere bei den Sprachtests zeigt sich, dass und wie eine – für die Auseinandersetzung mit Texten allerdings entscheidende – Fähigkeit schlicht auf der Strecke bleibt, mögliche Sinnstrukturen zu erkennen und gegeneinander abzuwägen; Tests können keine Variabilität in der Aufgabenbewältigung erkennen – manch kluge Lösung bei PISA führte zu einem niedrigen Kompetenzniveau, weil sie von den Tests nicht vorgesehen wurde. (Übrigens sind die Vorgaben bei den gültigen Lösungswegen aus bearbeitungstechnischen Gründen in der Regel so rigide, das man der 9 Kreativität von Jungendlichen gar nicht auf die Spur kommt. Das setzt nämlich intensive Arbeit an den offenen Antworten voraus). Diese Verengung führt – vierten – zur Ausblendung von Lebensumständen, damit aber auch von Ressourcen, die ein Jugendlicher mitbringt. Dies zeigt sich sogar bei den Erhebungen zur Problemlösefähigkeit, welche in der Erhebung von 2003 durch PISA gemessen worden ist. Dort werden Aufgaben gestellt, die nur in einzelnen nationalen Kulturen zutreffen können. Fünftens nehmen Tests häufig auf eine ganz eigentümliche Weise Jugendliche nicht erst. Stellen sie vor komplex erscheinende Aufgaben, handelt es sich um Hüllen, welche eine triviale Angelegenheit einkleiden, aber die Beteiligten auf falsche Spuren bringen. Das Manifeste und Evidente der Tests verführt nachdenkliche Leute dazu, einen Hintersinn zu vermuten und eine tiefere Bedeutungsschicht zu erkennen. Tests ignorieren also wie Menschen, zumindest die weniger abgebrühten Jüngeren, davon ausgehen, dass ihnen anspruchsvolle Aufgaben zugemutet werden, die das, was sie sagen, auch wirklich meinen – genau dies wäre das eigentliche und spannende Thema von Kompetenztests. Wenn also Mathematikaufgaben mit Hinweisen auf Dörfer eingeführt werden, geht man davon aus, dass diese Einführungsüberlegungen sinnrelevant sind – nur ist dies, wie Meyerhöfer gezeigt hat, gar nicht der Fall. Das bedeutet nun für unseren Zusammenhang, dass damit weder die für betriebliche Zusammenhänge und für die Arbeitswelt vermutlichwichtige Kompetenz eines kontextbezogenen und problemerschließenden Denkens erhoben wird. Noch zeigt sich aber, ob und wie ein junger Mensch sich die Aufgabenstellung zu eigen macht und sinnvolle, zielführende Lösungen entwickelt – zugegeben aber: Die üblichen, Ausbildungsfähigkeit erhebenden Untersuchungen bleiben noch einmal unterhalb dieses Niveaus. Dann – sechstens – kranken die meisten Testverfahren daran, dass sie punktuell gegebene Leistungsstände im Querschnitt erheben, mithin keine Entwicklungen, schon gar nicht Entwicklungspotenziale. Das häng wiederum mit ihrer Engführung zusammen. Denn so trivial dies klingt: Entwicklung und Lernen gehen mit komplizierten biographischen Prozessen einher, die zum einen mit neuronalen Vorgängen zu tun haben – immerhin dürfen wir nicht vergessen, dass die Strukturbildung des Gehirns, wie wir aus bildgebenden 10 Verfahren wissen, erst mit dem 20. Lebensjahr abgeschlossen ist, die zum anderen mit dem Austausch mit Umwelt, mit der Aneignung von Kultur zu tun haben, die eingebettet sind in komplexe soziale Prozesse, zu denen die Ablösung von den Eltern, der Einfluss der Peer Group und endlich die Entwicklung sexuell relevanter Beziehungen verbunden sind. Hinzu kommt,, dass neue Formen der Selbstvergewisserung entstehen, die nicht zuletzt wiederum relevant sind für eine zukunftsgerichtete Haltung, die ganz entscheidend wird für den Übergang zum Erwachsenensein. Dass in einer solchen komplizierten und komplexen Lebensphase punktuelle Leistungserhebungen irgendeinen prognostischen Wert haben sollen, verblüfft einen schon. Endlich – siebtens – muss man festhalten, dass die Tests in Deutschland ohne eine förderliche und unterstützende Kultur eingesetzt werden. Darin liegt schon prinzipiell ein Zynismus der neuen Testunkultur in diesem Land, wie sie mit Outcome-Orientierungund Standardfestlegung einhergeht. Anders als in den skandinavischen Ländern werden sie in einem pädagogisch ungesättigten Zusammenhang eingesetzt; dies gilt ganz besonders bei der Frage nach der beruflichen Bildung und den für sie nötigen Kompetenzen. Wer Kompetenzen messen will, muss nämlich nicht nur angemessene Aufgaben formulieren, sondern vielmehr sowohl auf Stärken wie auf Schwächen mit entsprechenden Angeboten und Leistungen reagieren. Da sich aber Kompetenztests im Übergang von Schule zur betrieblichen Bildung ein einem pädagogischen Niemandsland bewegen, ist sozusagen keiner zuständig für die Befunde. Darin liegt nun – achtens – die wohl entscheidende Problematik der Kompetenztests hierzulande: Sie führen letztendlich nur dazu, Defizite zu identifizieren. Sie tun dies unter Zugrundlegung von Maßstäben, die letztlich willkürlich sind – boshaft formuliert geht in sie ein, was Betriebe als allgemeine Bildung definieren wollen. Dabei ignorieren sie die Erfahrungen, welche Jugendliche in ihren außerschulischen Kontexten gewonnen haben. Schließlich erfassen sie überhaupt nicht die Leistungsfähigkeit von Jugendlichen in komplexen Prozessen. Unter den Bedingungen eines objektiv eingeschränkten Angebots an Ausbildungsstellen haben die Verfahren schlicht und einfach die Funktion einer Selektion, welche durch die vermeintliche Wissenschaftlichkeit und Objektivität der Verfahren nur geheiligt wird. Und – schlimmer noch – Nebenfunktion besteht wohl darin, junge 11 Menschen auf Testfähigkeit abzurichten – dies zielt schon auf Employability und nicht auf Kompetenz. 4. Befunde der Forschung Diese eher testkritischen Feststellungen sind notwendig, um vorsichtig zu relativieren, was an Befunden aus einschlägigen Untersuchungen vorliegt. Zweifelhaft erscheint jedenfalls, ob sie wirklich so etwas wie Kompetenz erheben. Um ein angemessenes Bild der Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglichkeiten junger Menschen für Arbeitswelt und berufliche Welt entwerfen zu können, müsste man letztlich mit umfassenden Ansätzen arbeiten, vielleicht mit solchen des SozialCapitals. Nötig ist wohl auch, dass man Ergebnisse der Jugendforschung aufnimmt und biographische Zugänge findet. Ohnedies lassen sich die Widersprüche kaum übersehen, welche sich aus den Befunden ergeben: Betrachten wir – mit allem Vorbehalt – das in den Tests Erhobene, dann zeigt sich allerdings, dass Jugendliche in den gemessenen Bereichen Allgemeinwissen, sprachlichen und mathematischen sowie naturwissenschaftlichen Grundfähigkeiten wie Grundfertigkeiten regelmäßig Mängel aufweisen. Nüchtern muss man wohl davon ausgehen, dass – unabhängig von deren Validität und Reliabilität – allen Testverfahren bei etwa einem Fünftel bis zu einem Viertel der Jugendlichen Defizite insbesondere bei Aufgaben konstatieren, welche die genannten Bereiche prüfen. Die Konstanz des Ausmaßes dieser Gruppe – PISA bezeichnet sie als die Risikogruppe derjenigen, die auf Kompetenzstufe I oder darunter anzusiedeln sind – verblüfft und beruhigt; sie legt die Vermutung nahe, dass es um einen harten und starken sozialen Tatbestand geht. Noch einmal: Ein – im schlimmsten Fall – Viertel bis zu einem – immer noch schlimmen – Fünftel der fünfzehn bis sechzehnjährigen Jugendlichen in Deutschland bewältigen nicht die Aufgaben, welche man an diese Altersgruppe stellen kann und muss – muss, weil es in der Tat darum geht, einen Platz in der Gesellschaft, die Möglichkeit zu einer autonomen, auf eigenwirtschaftlich erworbenes Einkommen gestützten Lebensweise zu sichern. Zugleich verfügen aber 70 bis 80 Prozent der Jugendlichen über Fähigkeiten, die als eine wichtige Grundlage für die berufliche Bildung anzusehen sind. Sie haben gute IT-Kenntnisse, gehen unbefangen mit PCs um. Sie beherrschen moderne 12 Kommunikationsmedien – freilich auf jugendspezifische Art, mit einem englisch, das sich nur lautem Lesen erschließt. Weit auseinander gehen die Befunde zu Motivation, betrieblichem Engagement. Auf der einen Seite messen die Jugendlichen ihre persönlichen Beziehungen, nicht zuletzt den Gleichaltrigenbeziehungen und ihrer Feiheit Vorrang zu. Sie lehnen scheinbar die Übernahme zusätzlicher Aufgaben, ausbildungsfremder Aufträge ab – doch handelt es sich dabei um die typischen Lehrlingsaufgaben, welchen ein Sinn für eine gute Ausbildung abgesprochen wird. Dies spricht letztlich für das Interesse der Jugendlichen an einer fachlichen soliden Ausbildung. Insbesondere ostdeutsche Jugendliche betrachten die betriebliche Zugehörigkeit und die Übernahme von Aufgaben für diese als vorrangig. Zudem: Betriebszugehörigkeit und nötigen Verantwortungsübernahme werden umso wichtiger, je mehr die Jugendlichen das Gefühl haben, im Betrieb anerkannt zu sein; werden die Auszubildenden als Personen in Arbeitsprozesse eingebunden, deren Bedeutung von ihnen nachvollziehbar ist, umso stärker engagieren sie sich für ihren Betrieb. Hier liegt ein Potenzial vor, das bislang nicht angemessen wahrgenommen wird; Kompetenz wäre mithin weniger über Rechtschreibkenntnisse, sondern mehr über die Bereitschaft zu fassen, dass Jugendliche in den Betrieben sich einbringen und mitwirken wollen. Die Daten ergeben also ein ziemlichklares positives Bild der sozialen, kommunikativen und für Integration relevanten Haltungen und Einstellungen. So sind junge Menschen an Arbeit und Beruf interessiert; eine Null-Bock-Generation lässt sich nicht nachweisen. Junge Menschen wollen arbeiten. Sie sind hoch flexibel imBlick auf die Wahl des Ausbildungsberufes wie auch mobil für diesen, verfolgen beharrlich das Ziel, einen Beruf zu erreichen, reduzieren dafür eigene Erwartungen und Hoffnungen. Erfahrungen des Scheiterns schreiben sie sich selbst zu, noch der eigentlich nicht gewollte Ausbildungsplatz wird biographisch integriert. Was führt aber dann zu den Etiketten fehlende Kompetenz, mangelnde Ausbildungsfähigkeit? Fünf Dimensionen lassen sich zeigen: Der Grundsachverhalt lautet: Mangelnde Kompetenz korreliert der Zahl der Ausbildungsplätze. Werde diese nicht bereitgestellt, wird dies als Defizit der Jugendlichen behauptet. Obwohl – zweitens – Mädchen formal gesehen die besseren Leistungen bringen, schneiden sie letztlich schlechter ab. Sie müssen als Risikogruppe angesehen werden, die um ihre Bildungschancen wie darum gebracht wird, ihre 13 Leistungen auch tatsächlich realisieren zu können. Kompetenz hat also eine GenderDimension. Kompetenz bildet – drittens – den harten und starken sozialen Tatbestand einer tief reichenden Segmentierung der bundesdeutschen Gesellschaft aus. Diese hat mit einem massiven Armutsproblem zu tun, das sich auf alle Bereiche seines Bildungssystems auswirkt. Dies reicht über die ökonomische Armut hinaus, die sich in der Bewerbungsmappe, im Fehlen eines Computers, vielleicht sogar in der Kleidung niederschlägt, mit der junge Menschen zum Bewerbungsgespräch erscheinen. Sie geht – ich weiß, dass ich mich hier auf eine strittige Problematik einlasse – mit einer kulturellen Armut einher, die ein ungekonntes Verhalten erzeugt – also den Auftritt eines Jugendlichen, der noch niemals in einer ihn überzeugenden Weise davon gehört hat, wie man sich unter bestimmten Bedingungen dann doch besser verhält. Faktisch entscheiden die feinen Unterschiede darüber, ob man einen Ausbildungsplatz erhält oder nicht. Kompetenz ist mithin sozial und kulturell sensibel. Viertens reichen weder formell erworbene, noch die informell angeeigneten Kompetenzen für den Eintritt in die Ausbildung hin. Jugendliche sind vielmehr auf soziale Netzwerke angewiesen, um einen Ausbildungsplatz zu gewinnen, sie benötigen materielle und symbolische Ressourcen. Insofern hat Kompetenz mit sozialem Kapital zu tun, auf das man zurückgreifen kann: Auf Verwandte, Bekannte, Beziehungen, Freundschaften. Solche Ressourcen bilden die Bedingung dafür, um erfolgreich den Übergang zu bewältigen wie auch mögliche Krisen in den Griff zu bekommen: Soziale und kulturelle Sicherheiten erzeugen Kompetenz; Kompetenz bringt zum Ausdruck, dass man über einen stabilen, ökonomisch tragfähigen, psychischen zu strapazierenden Hintergrund mit guten sozialen und kulturellen Beziehungen verfügt. Solche Netzwerke, auch intakte Familien sind besonders wichtig, weil die Phasen von Kindheit und Jugend hochgradig riskant und belastet sind. Diese Lebensphasen werden objektiv schwieriger – und man darf sich nicht vormachen, dass eigentlich alle jüngeren Entscheidungen im Sozial- wie auch im Bildungssystem nahezu regelmäßig Familien überfordern, mithin das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen objektiv wie subjektiv verschlechtert haben. Fünftens sind Jugendliche – so trivial dies nun klingt – Jugendliche ihrer Gesellschaft. Debatten um Kompetenzen und Ausbildungsfähigkeit übersehen nicht, wie junge Menschen gesellschaftlich und kulturell formiert werden. Sie ignorieren in ihrer Forderung etwa nach mehr Leistungsbereitschaft, nach mehr Lernwillen, dass 14 und wie Motivationen, Leistungsfähigkeit sozial und kulturell hervorgebracht werden – und zwar in einem schwierigen Zusammenspiel von Prozessen auf der Makro- und der Mikroebene. Sozialstrukturen, Mentalitätsmuster und individuelle Bewältigungsstrategien hängen zusammen. Die vorgeblich leistungsschwachen Jugendlichen sind zumindest auch zu solchen sozialisiert: Veränderungen im Verhalten, im Bildungsund Lernhandeln von jungen Menschen, ihre scheinbaren oder auch tatsächlichen Leistungsdefizite sind Ausdruck einer sozialen und kulturellen Lage und spiegeln die nachlassende Leistungsfähigkeit von sozialen und kulturellen Institutionen wider. Es ist also gerade zynisch, von jungen Menschen eine korrekte Sprachverwendung und Rechtschreibung zu verlangen, wenn sie in der öffentlichen Sprache, in Werbung und Medien ständig Inkorrektheiten begegnen. Mehr noch: Gerade weil die moderne Gesellschaft der Gegenwart überkommene Institutionen zunehmend erodieren lassen, wirken sich gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen nahezu ungebremst auf die jungen Menschen aus. Konkreter gesagt: Wir wissen, dass Familien und Schulen keinen hinreichend schützenden Rahmen mehr bieten, um Jugendliche beispielsweise vor dem Einfluss der Medien und den mit diesem verbundenen Konsumverhalten zu bewahren. Es sind sogar die Jugendlichen selbst, die sichere Beziehungen verteidigen wollen. Vielleicht verbirgt sich genau dies hinter dem von den Unternehmen beklagten Umstand, dass die Jugendlichen ihre privaten Lebenszusammenhänge nicht hinter betriebliche Anforderungen zurückstellen wollen; diese stellen – entwicklungs- und sozialpsychologisch gesehen – zurecht die eigenen Lebensbedingungen gegen die geforderte Flexibilität, zumal sie kaum mehr einen besonderen Wert am Erwachsenenstatus erkennen können. Jugendliche sind dabei oft genug auf sich selbst zurückverwiesen, sehen sich in einem Prozess, den eine Vielzahl von mühsamen Entscheidungen, von Unsicherheit und Instabilität kennzeichnet. In ihm muss ein jeweils eigenes Konzept von Erwachsensein herausgearbeitet werden – ohne Vorbilder, ohne Anpassung an sozial und kulturell geformte, überlieferte Muster. Sie bewegen sich, wie J.-J. Arnett so schreibt, auf der „long winding road to adulthood“. Dabei werden sie anfälliger für die Unsicherheiten moderner Gesellschaften; nehmen Ungewissheit, Ambivaltenz in das eigene Selbstkonzept und in die eigenen Handlungsentwürfe als selbstverständliche Merkmale auf und lernen, genau damit umzugehen. Sie werden gleichsam instabiler sozialisiert und agieren entsprechend, nämlich moderner, flexibler – beispielsweise mit Vielfachbewerbungen auf Ausbildungsplätze und Ausbildungsab15 brüchen. Paradoxerweise zeigen sich in diesem of kritisierten Verhalten Kompetenzen zur Lebensbewältigung, die ihrer Situation völlig angemessen sind. Man kann darin Indikatoren eines fortgeschrittenen Selbstmanagements, einer stärkeren Individualisierung sehen. Kurz und gut: Hier zeichnen sich, gesellschaftlich und kulturell erzwungen, Kompetenzen ab, die zwar wenig mit dem zu tun haben, was die üblichen Tests messen. Sie müssen aber in einem erweiterten Verständnis von Kompetenztests aufgenommen werden. 5. Kompetenzforschung revisited Meiner Kritik an den Kompetenztests geht es also nicht um deren prinzipielle Ablehnung. Aber: Wer ernsthaft Kompetenz erfassen will, muss Lebenskontexte, scholare wie informelle Lernzusammenhänge und die subjektive Selbstbeurteilung des eigenen Bildungsprozesses erheben sowie noch diese biographisch gewordene Subjektivität in neue Anforderungskontexte stellen. Das eingangs skizzierte Modell der Kompetenztheorie muss schon aufgenommen werden, auch wenn es vielleicht sehr abstrakt klingt. Doch in Wirklichkeit sind wir mit ihm durchaus vertraut. Ohne stringende Methode und ohne die vermeintliche Objektivität des Verfahrens macht dies jeder ordentliche Ausbilder und Meister, der einen Jugendlichen in einem Betrieb mit Aufgaben konfrontiert und dabei beobachtet. Insofern gebe ich zu: Angesichts der nur schwachen Verlässlichkeit scheinbar objektiv erhobener Befunde scheint mit inzwischen eine auf Erfahrung gestützte Intuition sogar zuverlässiger als die vorgeblich gesicherten Testverfahren. Nachzudenken wäre jedenfalls über komplexere Zugänge. Dabei scheinen vier Aufgaben besonders notwendig: Wer Kompetenzen beschreiben und analysieren will, braucht nicht nur eine kom- plexe, Prozesse erfassende Theorie, sondern vor allem eine breite Datengrundlage, die weit über die verengten Tests hinausgeht. Man benötigt also eine integrierte Berichterstattung über Schule, Beruf und jugendliche Lebenswelten. Ansätze dafür gibt es beispielsweise etwa mit den inzwischen vorliegenden Bänden über nationale Bildungsstandards bis hin zu dem über non formale und informelle Bildung im Kindes- und Jugendalter. Wichtige Wege weist der Entwurf der konzeptionellen Grundlagen für den Bereich Berufliche Bildung und Weiterbildung/lebenslanges 16 Lernen. Vorarbeiten für eine solche Berichterstattung bieten die Berufsbildungsberichte. Für sinnvolle Tests müssen Grundstandards in gemeinsamer Absprache zwischen Schule und Wirtschaft, Jugendforschung und Sozialer Arbeit vereinbart werden, wobei selbst Fragen der politischen Bildung nicht außer Acht bleiben sollten. Erst mit diesen Standards kommt man von der bloßen Zuschreibung von Defiziten weg, so muss die Wirtschaft ihre Erwartungen definieren, um nicht in den Verdacht zu geraten, die Kompetenzforschung als bloßes Politainment zu instrumentalisieren. Erst solche Festlegungen verhindern inhaltlich untaugliche Tests. Rechtschreibung sagt wohl nicht viel aus, vermutlich sind selbst die auf Lesekompetenz zielenden Untersuchungen von PISA eher irrelevant. Verstehensleistungen müssen eine andere Qualität haben, wenn sie mit technischen Texten zu tun haben, die in einem Betrieb begriffen werden müssen. Vermutlich muss man etwa an der „Übersetzung“ eines schriftlichen Textes in eine bildliche Darstellung prüfen, ob ein Jugendlicher einer Beschreibung die Abbildung eines Gerätes zuordnen kann. Wahrscheinlich muss man ganz andere Aufgabentypen und Anforderungssituationen konstruieren, vor allem aber müssen Beobachtungsverfahren entwickelt werden, welche dem Prozess gerecht werden, in welchen Jugendliche in realistischen Rahmungen Aufgaben bewältigen. Man kann hier wahrscheinlich eine Menge bei guten Assessment – Verfahren lernen. Endlich wäre ein Perspektivwechsel in der Debatte und der Forschung zu vollziehen; sie müssen weg von der Orientierung an Defiziten und hin zur Suche nach positiven, Leistung und Erfolg begünstigenden, Faktoren. Was macht junge Menschen so stark, dass sie einen Ausbildungsplatz nicht nur erhalten, sondern auch die Ausbildung erfolgreich nutzen können? Forschung wie Tests benötigen also qualitative Designs, die interviewgestützt sich an dem anlehnen, was die ResilienzForschung bei ihrer Suche nach protektiven Faktoren betreibt. Man muss bei Achievern ansetzen, um herauszufinden, was die tatsächlichen Kompetenzen waren und sind, die auf dem Weg in den Beruf helfen. Vermutlich waren es nämlich weder die guten Schulnoten noch die weniger guten Testergebnisse – wenn sie denn nicht einen vorzeitigen Selektionseffekt hatten. Um zu einem allerdings unbefriedigenden Schluss zu kommen. Wahrscheinlich müssen wir ohnehin dreierlei zur Kenntnis nehmen: Zum einen kann man sich Debatten um Kompetenz sparen, wenn und weil es objektiv gesehen letztlich gar 17 nicht um diese geht; sie sind vorgeschoben, um ein Form rigider Governance durchzusetzen, die ihre Grundlage auf der Knappheit von Arbeits- und Ausbildungsplätzen hat. Zum anderen muss man wohl begreifen, dass die vorgeblichen Kompetenzdefizite und die nicht minder vorgeblichen Mängel an Ausbildungsfähigkeit in ihrer Mehrzahl Ausdruck einer gesellschaftlichen und kulturellen Situation darstellt, die kaum oder nur mit Mühe zu bewältigen sind; wenn Wissen fehlt, wenn Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht hinreichend ausgebildet sind, wenn Jugendliche ungekonntes Verhalten zeigen, stehen dahinter eben auch Lernprozesse – oder auch die soziale und kulturelle Verhinderung von Lernprozessen. Dies müssen analytisch und weniger moralisch beurteilt werden. Dabei liegt ein Problem der Kompetenztests durchaus darin, dass sie dieses Spiel einer subjektiven Zuschreibung von gesellschaftlichen und kulturellen Depraviationsprozessen durchaus noch vorantreiben. Hier ist dann doch einiger Zynismus entstanden, dem man vielleicht doch besser mit pädagogischer Überzeugung begegnen sollte. Das aber wäre das Dritte. Pädagogischer Überzeugung, einem pädagogischen Interesse an Kompetenz geht es nicht um Defizite, sondern um Potenziale, ihm geht es vor allem um eine Kultur der Anerkennung, die begreift, wie junge Menschen sich in einer extrem schwierigen Situation befinden, die sie dann doch auf eine bemerkenswerte Weise bewältigen. Man gibt ihnen letztlich keinen Platz in dieser Gesellschaft, der Raum bleib ihnen verwehrt, der eben – wie ich eingangs festgehalten habe – Kompetenz erst definiert. Oder anders formuliert: Kompetenz ist als ein doppelt relationales Konzept zu begreifen, in welchem sich eben immer wieder niederschlägt, wie eine Gesellschaft mit den Angehörigen nicht nur ihrer jungen Generation umgeht. Zum einen wirken sich gute soziale und kulturelle Ressourcen aus, auf die sich die jungen Menschen stützen können, die ihnen Vertrauen und Selbstsicherheit geben. Zum anderen müssen sie erfahren können, dass und wie sie von uns, von Erwachsenen in dem doch gewürdigt und anerkannt sind, was sie leisten – selbst wenn wir manchmal diese Leistung gar nicht begreifen. Diese Leistungen und Fähigkeiten junger Menschen sollten wir doch erst einmal prüfen und testen, ehe wir mit Defizitzuschreibungen dazu beitragen, sie als – wie der polnisch englische Soziologe Zygmunt Bauman schreibt – wasted lives, als verworfenes, ausgegrenztes Leben zu behandeln! 18