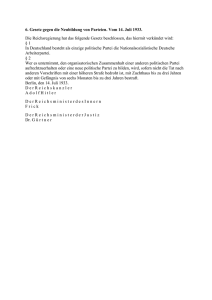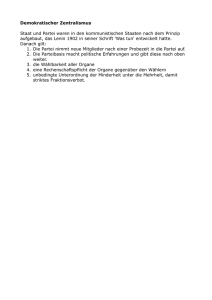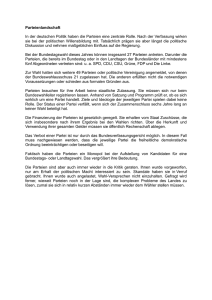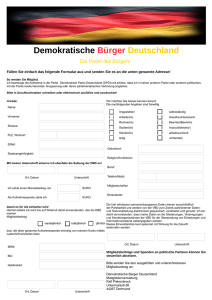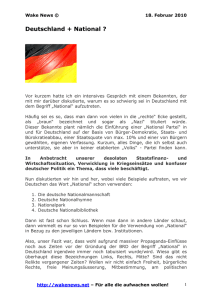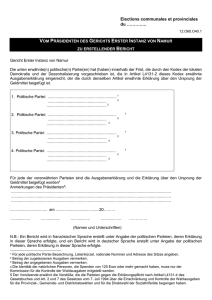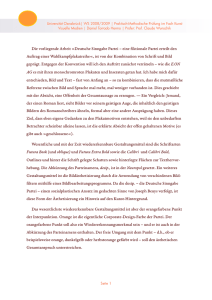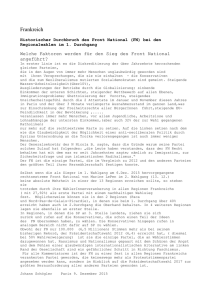Durch die Sünde zur Erlösung
Werbung

Durch die Sünde zur Erlösung Die Faszination, die Georg Lukäcs auf die westliche Intelligenz ausgeübt hat, hat ihren Grand in der Ablehnung des gewöhnlichen Menschenverstandes und der konventionellen Moral, in der Schaffung einer esoterischen Lehre für eine Elite und dem Glauben an diese Elite. Lukäcs lieferte die berauschende Vision des seligmachenden Augenblicks nach den „letzten Dingen". Was könnte ein Eingeweihter mehr verlangen? Den ersten Hinweis auf diese Geheimlehre gab Franz Borkenau, der früher selbst Kommunist gewesen war, in seinem 1939 in England erschienenen Buch „The Communist International". In einem Abschnitt über die verschiedenen Fraktionen innerhalb der kommunistischen Parteien Österreichs und Ungarns zitierte er einen Artikel über Lukäcs, den Ilona Duczynska, die Frau von Karl Polänyi und selbst „apostolisches Mitglied" des Zirkels, verfaßt hatte: „Ein Theoretiker, der vielleicht der einzige Kopf des ungarischen Kommunismus war, beantwortete meine Frage, ob Parteiführer ihre eigenen Genossen belügen und täuschen dürften, mit folgender Feststellung: Die kommunistische Ethik mache die Anerkennung der Notwendigkeit, Böses zu tun, zur höchsten Pflicht. Dies, so erklärte er, sei das größte Opfer, das uns die Revolution abverlange. Der wahre Kommunist sei davon überzeugt, daß sich das Böse durch die Dialektik der Geschichte in Gutes verwandele Die dialektische Theorie des Bösen ist nie veröffentlicht worden — Dennoch hat sich dieses kommunistische Evangelium als eine Geheimlehre von Mund zu Mund ausgebreitet, bis man darin schließlich den eigentlichen Maßstab für einen wahren Kommunisten erblickte Diese Bemerkungen fanden damals wenig Beachtung, denn sie standen versteckt in einem Kapitel über die „Fraktionen" einer obskuren kommunistischen Bewegung, das sich mit den Anschauungen von „ungefähr dreißig Leuten, die in Wiener Kaffeehäusern herumsitzen", beschäftigte. Und der Theoretiker selbst, den Borkenau als Lukäcs identifizierte, war außerhalb kommunistischer Zirkel damals praktisch unbekannt. In verkappter Form hat Thomas Mann in seinem Roman „Der Zauberberg" (1924) ein beklemmendes Portrait von Lukäcs entworfen — in der Gestalt Leo Naphtas, des jüdisch jesuitischen Revolutionärs, der den liberalen Settembrini entsetzt, indem er den Terror kaltherzig als Mittel zur Befreiung der Epoche von dem dümmlichen liberalen Glauben an das Gute befürwortet. „Das Proletariat (so Naphta) hat das Werk Gregors des Großen aufgenommen, sein Gotteseifer ist in ihnij und so wenig wie er wird es seine Hand zurückhalten dürfen vom Blute. Seine Aufgabe ist der Schrecken zum Heile der Welt und zur Gewinnung des Erlösungsziels, der Staats- und klassenlosen Gotteskindschaft " Als Settembrini. Naphta die Ungereimtheiten seines Glaubens an, den Dualismus von christlichem„Msia;nismus, und Spzialisirms; vorhält, entgegnet Naphta: „Gegensätze mögen sich reimen " Daß Lukäcs in mancher Hinsicht für die Gestalt Naphtas Modell stand, hat schon Arthur Eloesser 1925 in der ersten autorisierten Thomas MannBiographie angedeutet, wo er versucht, die lebendigen Vorbilder für die verschiedenen Gestalten des „Zauberbergs" zu identifizieren. Daß Mann selbst sich zu dieser Verbindung nicht äußern mochte, ist verständlich. In der faszinierenden Gestalt Leo Naphtas, dieses „rasenden Theoretikers und stählernen Logikers", wie Eloesser ihn nennt, und in der rätselhaften Person von Georg Lukäcs gehen Maske und Gesicht nahtlos ineinander über. Ist es Naphta oder Lukäcs, der sagt: Wenn wir die Saat des Zweifels tiefer säen, als es das gegenwärtige, modische Freidenkertum je wagte, dann wissen wir durchaus, was wir tun. Nur aus radikaler Sepsis, aus dem moralischen Chaos, kann das Absolute hervorgehen, der geweihte Schrecken, dessen unsere Zeit bedarf " Georg Lukäcs wuchs im Milieu des assimilierten jüdischen Großbürgertums auf, das in Ungarn unterhalb einer älteren Schicht von Aristokraten rangierte und das, wie es in vielen kosmopolitischen „Kompressionskammern" dieser Art der Fall war, eine bemerkenswerte Zahl außergewöhnlicher Individuen hervorbrachte: Naturwissenschaftler wie Michael Polänyi und John von Neumann; Intellektuelle wie Oskar Jäszi und Karl Polänyi; Soziologen wie Karl Mannheim, Kunsthistoriker wie Arnold Hauser und Frederick Antal. Viele von ihnen gehörten zu Lukäcs „Sonntagskreis", der sich während des Ersten Weltkriegs regelmäßig in Budapest versammelte. Es gab wenige Familien, die so reich und einflußreich waren wie die von Jözsef Löwinger, dem Vater von Georg Lukäcs. Jözsef Löwinger, Sohn eines Steppdeckenfabrikanten aus der südungarischen Provinzstadt Szeged, verließ mit dreizehn Jahren die Schule, wurde mit achtzehn Angestellter einer Bank und war mit fünfzig Direktor der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank und zugleich einer der mächtigsten Männer in Österreich Ungarn. Die Mutter, in Budapest geboren, aber deutschsprachig, stammte aus einer der ältesten und wohlhabendsten jüdischen Familien in Osteuropa; diese Familie hatte während der voraufgegangenen zweihundert Jahre einige der bekanntesten Talmudgelehrten und Rabbis hervorgebracht. Lukäcs Familie war zwar vollkommen assimiliert, aber Georgs Privatlehrer kam aus einer der tonangebenden jüdischen Familien; der Bruder dieses Lehrers, ein Kantianer, war Oberrabbi der Zentralsynagoge. Georg Lukäcs, geboren 1885, trat im Alter von zweiundzwanzig Jahren zum evangelischen Glauben über, allerdings, wie es scheint, nicht aus intellektuellen Gründen, sondern aus Klugheitserwägungen. Jözsef Löwinger wurde im Jahre 1901 geadelt, wofür er eine beträchtliche Summe zahlte, und führte seither den Namen „von Lukäcs". 1906 wurde er Hofrat und außerdem Ratgeber und persönlicher Freund von Istvan Tiza, dem erzkonservativen Staatsmann und Ministerpräsidenten. Insofern spielte er in kleinerem Maßstab eine ähnliche Rolle wie der jüdische Bankier Bleichröder in bezug auf Bismarck. Spannungen innerhalb der Familie ergaben sich daraus, daß Lukäcs Verhältnis zu seiner Mutter ganz anders beschaffen war als das zu seinem Vater. Während er seinen Vater respektierte, verabscheute er seine Mutter — ihr großbürgerliches Gehabe, die leeren Gesellschaftsrituale, ihren matriarchalen Despotismus und vielleicht auch die Tatsache, daß sie den älteren, geistig trägen Bruder Jänos bevorzugte. Georg Lukäcs hat ihn in seinen Erinnerungen nie erwähnt. Jänos starb während des Zweiten Weltkriegs in einem deutschen Konzentrationslager. Georg quälte seine Mutter, indem er sich mit ihr auf ungarisch unterhielt, einer Sprache, die sie nie ganz beherrschte. Stolz behielt Georg Lukäcs das „Von" vor seinem Namen, bis er der Kommunistischen Partei beitrat, und lebte während dieser Jahre von den ansehnlichen finanziellen Zuwendungen seines Vaters. Aber schon im Gymnasium faszinierte ihn, wie sein Freund Lajos Fülep bemerkte, die franziskanische Armut. Die „absolute Wahrheit" des heiligen Franziskus „machte auf Lukäcs und einige seiner Freunde einen nachhaltigen Eindruck". In jenen frühen Jahren pflegte Lukäcs nacheinander mit drei Freunden eine „mystische Bruderschaft" - mit Leo Popper, Ernst Blöch und Bela Baläsz, obgleich Popper ein Hedonist war, Bloch ein Nassauer und Baläsz ein Frauenheld, während Lukäcs meist eine asketische Haltung einnahm. Ihre große Offenbarung fanden sie in Nietzsche, dem „größten Propheten des Zeitalters". Zu jedem erdenklichen Thema, das ihn interessierte — literarischer Stil, Eros, Religion, Schicksal — konsultierte Lukäcs die Werke von Nietzsche und ließ sich in imitatione dei sogar einen Schnauzbart wachsen. Immerzu ging es in diesen Freundschaften um Selbstdarstellung, und jeder der Beteiligten spielte seinen eigenen Dämon — Lukäcs den Faust und Baläsz den Don Juan. Dreh- und Angelpunkt in Lukäcs früher Zeit war eine heftige Schwärmerei für die Malerin Irma Seidler, „die Gebieterin seiner Seele", die er idealisierte, während er in erotischer Beziehung Distanz wahrte. Aus dem Blickwinkel Otto Weiningers sah Lukäcs nämlich im Mann das schöpferische Wesen, in der Frau hingegen die bloße Natur. Aber Irma verwirrte ihn. Gequält von ihrer unerfüllten Liebe zu Lukäcs und gedemütigt durch die Art, wie Baläsz sie zum Opfer seiner sexuellen Begierde machte, beging sie im Mai 1911 Selbstmord. Von Schuldgefühlen erschüttert und gepeinigt von dem Gedanken, ein großer Sünder zu sein, fand Lukäcs den rettenden Ausweg in Dostojewski], der mehr als jeder andere zum Ariadnefaden in das Labyrinth des Minotaurus wurde. Dostojewski] lehrte Lukäcs, daß ein Leben in Rechtschaffenheit die Reinheit oder Lauterkeit voraussetzt, daß man aber durch die Sünde zur Erlösung gelangen kann. Das Thema Reinheit und Sünde trieb Lukäcs jahrelang um und führte ihn über gespenstische Pfade auf Friedhöfe, von denen er nie mehr zurückkehrte. Von Dostojewskij lernte er die doppelte Wahrheit: die Pflicht gegenüber den Institutionen und die Pflicht gegenüber der Seele. Die erstere lehnte er ab, die letztere machte er sich zu eigen. Während vieler Jahre kämpfte Lukäcs mit einem Buch über Dostojewskij — einem ethischen System, das den Mystizismus mit dem revolutionären Terror, die Verdammnis mit der Erlösung vereinen sollte , aber schließlich gab er das Projekt auf und ließ das Manuskript in einem Bankschließfach in Heidelberg zurück, das erst nach seinem Tod wieder geöffnet werden sollte. Wenn dieses Milieu durch eine bestimmte Stimmung geprägt war, dann durch die Angst. Aus der zeitlichen Distanz läßt sich schwer klären, wie ernst man die klischeehaften Ausrufe nehmen soll, die aus dieser alles durchdringenden Angst hervorbrechen „Wie verachtenswert sind die grotesken, philisterhaften Bürgerseelen. Wie ich dieses Leben hasse", schrieb Lukäcs in sein Notizbuch. In einer Richtung lag der subtile, parfümierte Ästhetizismus Stefan Georges, der sich ganz der Dichtung, der Schönheit und der Idealisierung des Homoerotischen im Kultus der Jugend verschrieben hatte. Sein Bild von Hellas leitete dieser Ästhetizismus von Hölderlin her; sein ganzer Habitus war vom Glauben an den Adel des Geistes geprägt. Diese Welt, so attraktiv sie sein mochte, war Juden verschlossen, auch wenn sie jener Generation angehörten, die ihren Namen zum erstenmal ein „Von" hinzugefügt hatte. Die entwurzelten Kinder dieser Generation schnitten zugleich aber auch alle Verbindungen zur Welt ihrer Eltern ab. Das Jüdische war nur für einzelne unter ihnen, für Franz Rosenzweig, Martin Buber und Gerhard (Gershom) Scholem (dessen Bruder Kommunist wurde), ein Weg, aber dieser Weg führte von den klassischen Traditionen der europäischen Kultur fort, die sich Lukäcs und viele andere seiner Generation zu eigen machen wollten. In der kulturellen Orientierungslosigkeit dieser Generation wurde die Idee der Entfremdung für viele ihrer Angehörigen zur Initiation in die Mysterien, und ihre Schutzpatrone fanden sie in Autoren, die diese Leidenschaft in einer religiös geprägten Sprache ausdrückten - in Kierkegaard und Dostojewskij. Religiös war sie allerdings im Sinne einer Suche nicht nach Gott, sondern nach einer Gottheit, in der das Ich mit dem Absoluten verschmolz. In den beiden bedeutenden Essaybänden, die Lukäcs während seiner Heidelberger Jahre veröffentlichte („Die Seele und die Formen" und „Die Theorie des Romans"), taucht immer wieder das Thema der „Seelenlosigkeit" des gegenwärtigen Lebens auf, die nur durch die ästhetische Form bezwungen werden könne. Der Bezirk der Ästhetik ist die von Entfremdung unberührte, autonome Wertsphäre, eine Welt idealer Wesenheiten. Der Künstler selbst hat es mit konkreten Bildern zu tun, aber ihre Bedeutung liegt in den Formen, und sie zu entschlüsseln ist Aufgabe der philosophischen Kritik. Die alte Form war das Epos, die homerische Welt, in der sich die Seele keines Zwiespaltes zwischen ihr und der Welt bewußt war, die organische Welt der „Gemeinschaft", die von Entfremdung nichts wußte — ein merkwürdiges Beispiel für eine Ideologie im klassischen Sinne von Marx, typisch für die deutsche Romantik, die die Sklaverei im antiken Griechenland nicht zur Kenntnis nahm. Das Epos, so schrieb Lukäcs in der „Theorie des Romans", könne nur erneuert werden, wenn die Wirklichkeit wieder zur „naiv erlebten Selbstverständlichkeit" werde, wenn sie als eine „neue und abgerundete Totalität" erfahren werde, in der wir „unsere gespaltene Realität" so überwunden haben, wie wir die Welt der Natur hinter uns gelassen haben. Dem Motiv der Totalität fügt Lukäcs die Idee der Geschichtlichkeit hinzu. Lukäcs war, wie Lee Congdon bemerkt hat, fasziniert von der Geschichtsphilosophie, die Fichte zwei Jahre vor dem Erscheinen von Hegels „Phänomenologie des Geistes" in seinen „Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters" (1804 1805) umrissen hatte. Lukäcs griff auf einen Begriff von Fichte zurück und machte ihn zum Leitmotiv seines Buches. Wir leben, so erklärte er im Anklang an Fichte auf der letzten Seite seines Buches (1914 15), in der „Epoche der vollendeten Sündhaftigkeit" — und nur in den Werken Dostojewskijs (der „keine Romane geschrieben hat") finde sich die verlockende Vision eines neuen Zeitalters. Fichte war der Auffassung, jede Epoche müsse ihren tiefsten Punkt durchlaufen, ehe sie in die nächste Epoche übergehen könne. Der aus Ungarn emigrierte Schriftsteller Ervin Sinkö (dessen Roman „Die Optimisten" eine unschätzbare Quelle für die Zeit der Ungarischen Räterepublik darstellt) hat berichtet, daß Lukäcs oft über Fichte sprach: „ der gesagt hat, die Menschheit müsse auf dem Weg zu ihrer Rechtfertigung das Zeitalter der absoluten Sündhaftigkeit durchlaufen. Heute ist dieses Zeitalter gekommen, und wer es versäumt, das Gebot der Zeit zu befolgen, der lehnt nicht die Sünde ab, sondern den einzigen Weg, der aus der Sünde herausführt " Im Bereich der Ästhetik, so schrieb Paul Tillich einmal, herrscht eine „Spannung zwischen dem Formschaffenden und dem Formzerstörenden, auf der das Dämonische beruht". In dem Streben nach Überwindung der Entfremdung wird das Dämonische zum Mittel der Negation „bei der vergeblichen Suche nach einer absoluten Wirklichkeit", die die ästhetische Distanz zu den dämonischen Mächten und den Widerstand gegen sie überstrahlen soll. Die außerordentliche Bedeutung von Georg Lukäcs für die Geschichte der modernen Intelligenz besteht demnach darin, daß er zum erstenmal bewußt — in dem Wissen um die Gefahr, die mit einem solchen Sprung über den „Abgrund der Sinnlosigkeit" verbunden ist — aus dem Bezirk der Ästhetik in den der revolutionären Politik überwechselte und dabei die dämonischen Mächte mitbrachte. Das Dämonische, so könnte man sagen, ist das Pendant zu Hegels „Weltgeist". Im Dezember 1918, kurz nach der Gründung der Ungarischen Kommunistischen Partei, veröffentlichte Lukäcs einen Aufsatz mit dem Titel „Der Bolschewismus als moralisches Problem". Wird die Revolution, so fragte er dort, in Unterdrückung enden? Wenn man diese Frage bejahe, dann müsse man „das Schlechte als Schlechtes, die Unterdrückung als Unterdrückung, die neue Klassenherrschaft als Klassenherrschaft bezeichnen". Die von Razumichin in „Schuld und Sühne" geäußerte Ansicht, daß es möglich sei, „sich durchzulügen bis zur Wahrheit", sei ein Glaube, ähnlich dem Zeilen", so Lukäcs, „kann diesen Glauben nicht teilen, und daher sieht er in den Wurzeln der bolschewistischen Position ein unlösbares moralisches Problem " Eine Woche später trat Lukäcs der Kommunistischen Partei bei. Wie Kierkegaard hatte er den Sprung über den Abgrund des Glaubens getan, der zur „Metamorphose der ganzen Existenz eines Menschen" führt, in diesem Fall jenen Sprung zum Politischen, der — auf gleichsam eschatologische Weise — eine ganze Gruppe von „Virtuosen" der politischen Moral hervorbrachte, deren Leben sich in einem ständigen Wechsel zwischen Sünde und Läuterung bewegte und die ständig in schrecklicher Ungewißheit darüber lebten, ob am Ende die Erlösung oder die Verdammnis stehen würde. Aber hinter Lukäcs Schritt stand keine Regine Olson, wie bei Kierkegaard, sondern eine halbverrückte russische Revolutionärin, Jelena Grabenko, die Lukäcs erste Frau wurde. 1913 hatte Lukäcs sie kennengelernt, eine kleine, temperamentvolle, fiebernde Frau. Sie war Mitglied einer Terroristengruppe der Russischen Sozialrevolutionären Partei gewesen und hatte einmal ein Baby ausgeliehen und mit sich herumgetragen, um darunter eine Bombe zu verstecken. Bela Baläsz notierte in seinem Tagebuch: „Sie ist ein wundervolles Beispiel der DostojewskijGestalten. Alle ihre Geschichten, alle Einfalle und Gefühle könnten aus Dostojewskijs phantastischsten Kapiteln stammen. Sie war Terroristin. Jahrelang eingekerkert. In der entsetzlichen Arbeit hat sie Nerven, Magen und Lunge zugrunde gerichtet. Jetzt ist sie krank und müde Mit ihrer Neigung zur Promiskuität und zum Bohemeleben war sie für Lukäcs das Ebenbild der heiligen Hure Sonja. Und zum Entsetzen seiner Familie heiratete er sie. Es wurde eine Groteske daraus. Sie bezogen ein Haus in Heidelberg, das sich bald zu einer meKlavier; Lukäcs machte die Betten und wusch das Geschirr ab, und ihr Liebhaber, der Pianist Bruno Steinbach, stapfte wütend herum und schlug Jelena gelegentlich. Bald waren die drei mit den Nerven so fertig, daß sie sich in Behandlung zu Karl Jaspers begaben, der damals als Psychiater praktizierte. Der Nervenzustand von Lukäcs führte zu seiner Befreiung vom Militärdienst. Aber Jelena machte Lukäcs auch mit den Schriften von Boris Sawinkow bekannt, dem Terroristenführer der Sozialrevolutionären Partei, der 1909 unter dem Pseudonym V. Ropschin den Roman „Das fahle Pferd" mit seinen Anklängen an die Apokalypse des Johannes veröffentlicht hatte. Für Ropschin war der Terrorismus ein Akt der Liebe, eine Tat, die, wie die Auferstehung Christi, in den „Sozialismus und den Anbruch des Paradieses auf Erden" münden werde. Diese Passagen, die Jelena für Lukäcs übersetzte, wurden der Angelpunkt seiner „Konversion". In dem Aufsatz „Taktik und Ethik", seiner Version einer „Zustimmungslehre", den er kurz nach seinem Parteibeitritt verfaßte, rechtfertigt es Lukäcs, daß der einzelne „auf dem Altar der höheren Idee sein minderwertiges Ich opfert", um dem „Befehl der welthistorischen Situation" zu genügen. Der Aufsatz endet mit einem Verweis auf die Thesen von Sawinkow: „Morden ist nicht erlaubt, es ist eine unbedingte und unverzeihliche Schuld; es darf zwar nicht, aber es muß dennoch getan werden. Mit anderen Worten: Nur die mörderische Tat des Menschen, der unerschütterlich und alle Zweifel ausschließend weiß, daß Mord unter keinen Umständen zu billigen ist, kann — auf wahrhaftige und tragische Weise — moralischer Natur sein " Auf den Zusammenbruch der Donaumonarchie folgte in Ungarn eine demokratische Regierung unter der Leitung des Grafen Mfäly Kärolyi. Die Kommunistische Partei, 1918 von dem gerade aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Bela Kun gegründet, erklärte ihre Opposition. Die Parteizeitung Vöris proletarischen Revolution auf und verkündete, das Proletariat habe das Recht, die Bourgeoisie „zu hängen und zu begraben". Um die zunehmende Gewalt unter Kontrole zu bringen, ließ die Regierung Kärolyi den größten Teil des Zentralkomitees der Partei, darunter B61a Kun, verhaften. Ein neues Zentralkomitee unter der Führung von Tibor Szamuely und Lukäcs trat an seine Stelle. Ohne Wissen Kuns begannen sie mit den Vorbereitungen für einen bewaffneten Aufstand. Dazu Rodney Livingstone: „Es sollte mit einem Generalstreik beginnen, gefolgt von einer bewaffneten Erhebung, der Exekution bürgerlicher Geiseln und einer dreitägigen Herrschaft des Lumpenproletariats von Budapest. Dann sollte die Partei die Ordnung wiederherstellen und eine proletarische Republik bilden " Der Aufstand fand nicht statt, weil der Druck der Entente Mächte auf die territoriale Integrität Ungarns zum Zusammenbruch der Regierung Kärolyi führte. Ein von Kun aus dem Gefängnis heraus vereinbarter Zusammenschluß von Soziademokraten und Bolschewisten führte zur Proklamation der Ungarischen Räterepublik. Mit stets wachem Gespür für den Zeitgeist schrie: Lukäcs einen Aufsatz unter dem Titel „Partei und Klasse", in dem er erklärte „Die Parteiei hörten auf zu existieren — es gibt jetzt ein einheitliches Proletariat: Das ist die entscheidend; theoretische Bedeutung dieser Vereinigung. Die ungarische Revolution hat gezeigt, daß diese Revolution ohne den Bruderkampf der Proletarier möglich ist. Somit gelangt die Weltrevolution in ein immer fortgeschritteneres Stadium Die Ungarische Räterepublik währte 133 Tage. Sie war zwar nicht durch einen Aufstand, sondern durch ein friedliches Abkommen zustande gekommen, aber ihre Vorkämpfer, die sogenannten Szamuely Kommandos, durchstreiften das Land, um Terror zu verbreiten. Lukäcs wurde stellvertretendei (faktisch aber leitender) Volkskommissar für Unterricht und erklärte, seine Aufgabe sei die , volutionierung der Seelen". Er gründete einen Nationalrat für Erzeugnisse des Geistes. Die Buchhandlungen wurden geschlossen und durch Büchertische ersetzt, die die Literatur bei allen öffentlichen Versammlungen vertreiben sollten. Das Urheberrecht wurde abgeschafft, und die Schriftsteller erhielten, entsprechend ihrer Einordnung in ein bestimmtes Kategorienschema, über die ein Sonderausschuß befand, einen Monatslohn. Die Theater wurden verstaatlicht, und ihren Leitern wurde gesagt, was sie nicht mehr aufführen sollten (ungarische Operetten zum Beispiel). Für volle Säle wurde gesorgt, indem man die ungarischen Proletarier in langen Marschkolonnen von den Fabriken in die Theater führte. Das alles schmeichelte den Schauspielern und Theaterdirektoren so lange, bis sie selbst in die Provinz abkommandiert wurden, und dann traten sie in den Streik. Daraufhin ließ Lukäcs die Theater unter dem Vorwand schließen, es sei kein Papier für Programmhefte vorhanden. Welcher Mystagoge ist in seinen Träumen nicht auch Militärbefehlshaber? Lukäcs wurde Politkommissar der Fünften Division. In den letzten Gesprächen mit seinem Biographen Istvän Eörsi erinnert er sich: „Ich meldete mich für diese Arbeit und wurde nach Tiszafüred geschickt. Die Verteidigung Tiszafüreds war sehr schlecht gelungen, weil die Budapester Rotarmisten, ohne auch nur einen Schuß abzugeben, davonliefen. Und da habe ich auf sehr energische Weise die Ordnung wiederhergestellt, das heißt, als wir nach Poroszlö übersetzten, rief ich ein außerordentliches Kriegsgericht zusammen und ließ dort auf dem Marktplatz acht Leute dieses davongelaufenen Bataillons erschießen. Dadurch war dort die Ordnung im großen und ganzen wiederhergestellt " Und welcher Politkommissar könnte der Versuchung widerstehen, Reden zu halten? In Knickerbockers, grünen Strümpfen und schweren Wanderschuhen sprach Lukäcs zu den erschöpften Truppen: „Die Jugend verlangt nach Terror. Terror an sich. Danach sehnt ihr euch, und dazu werdet ihr es bringen. Wenn Blut vergossen werden kann, und wer wollte bestreiten, daß es vergossen werden kann, dann haben wir das Recht, es zu vergießen. Kurz, Terror und Blutvergießen sind eine moralische Pflicht oder, direkter gesagt, eine Tugend " Auf den eschatologischen Anfall folgt immer auch der nächste Morgen. Konterrevolutionäre Truppen tauchten vor Budapest auf. Ein letzter Hilferuf B61a Kuns an Lenin blieb unbeantwortet, und am 2. August 1919 kapitulierte Kun. Unter seiner Führung bestiegen die meisten kommunistischen Kommissare einen Zug nach Wien, dem diplomatische Immunität garantiert worden war. Lukäcs erhielt den Befehl, zusammen mit Otto Korvin zurückzubleiben und die Partei im Untergrund zu „führen". Als Korvin verhaftet und zum Tode verurteilt wurde, beschloß Lukäcs zu fliehen. Im Gespräch mit Eörsi erinnerte er sich: „Meine Familie bestach so einen Oberleutnant aus Mackensens Armee. Mit dem verließ ich als dessen Chauffeur das Land. Da ich aber nicht Auto fahren konnte, banden wir meinen Arm hoch, als hätte ich unterwegs einen Unfall gehabt, und der Offizier chauffierte das Auto. Die Wahrheit ist, daß die Angelegenheit ein reines Geschäft war " jRei Am Beginn der neuzeitlichen Politik, so sagte Karl Mannheim in seinem Buch „Ideologie und Utopie", stand der „orgiastische Chiliasmus der Wiedertäufer", jener Augenblick des Jahres 1534, in dem die Wiedertäufer die Stadt Münster eroberten und mit Feuer und Schwefel dal Rejch Gottes auf Erden verkündeten. Vieileic ht hatte Mannheim Lukäcs vor gen, als er schrieb: „Für das absolute Erleben des Chiliasten wird das Gegenwärtige zur Einbruchstelle, wo das, was früher innerlich war, nach außen schlägt und die Außenwelt plötzlich mit einem Schlage verändernd ergreift " In einer bemerkenswerten, wenig später verfaßten Analyse der ungarischen Ereignisse unterschied der liberale Schriftsteller Oskar Jäszi drei Arten von Revolutionsführern: zunächst die Leninisten, politische Manipulatoren, denen es gleichgültig war, ob das Proletariat auf ihrer Seite stand oder nicht; ihr Ziel war die Diktatur. Zu ihnen gehörte B61a Kun. Die zweite Gruppe „bestand aus Verrückten, psychisch unausgeglichenen Menschen, die nach Rache dürsteten und von der Idee des Tötens besessen waren, von dem jakobinischen Hang zum Blutopfer". Man könnte wohl sagen, daß Tibor Szamuely diesen Typus verkörperte. Und die dritte Gruppe: diese „metaphysische Generation religiöser oder gar mystischer Seelen" bildete eine bizarre Mischung, sie „wurzelte im Boden des deutschen Idealismus und eines ethischen Rigorismus. Angesichts der schrecklichen Sünden des Kapitalismus und seiner Kriege entdeckten sie in unbarmherziger Gewalt den einzigen Weg zum Heil " Am besten hat das alles vielleicht Max Weber ; Au? begriffen. Gegen Ende seines Vertrags „Politik als Beruf" aus dem Jahre 1918 erklärte er nach langen, ziemlich dürren Ausführungen über Parteien und Politiker mit plötzlich aufbrechender Leidenschaft: „In der Welt der Realitäten machen wir freilich stets erneut die Erfahrung, daß der Gesinnungsethiker plötzlich umschlägt in den chiliastischen Propheten, daß zum Beispiel diejenigen, die soeben Liebe gegen Gewalt gepredigt haben, im nächsten Augenblick zur Gewalt aufrufen — zur letzten Gewalt, die dann den Zustand der Vernichtung aller Gewaltsamkeit bringen würde. Auch die alten Christen wußten sehr genau, daß die Welt von Dämonen regiert sei und daß, wer mit der Politik, das heißt: mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einläßt, mit diabolischen Mächten einen Pakt schließt und daß für sein Handeln es nicht wahr ist: daß aus Gutem nur Gutes, aus Bösem nur Böses kommen könne, sondern oft das Gegenteil. Wer das nicht sieht, ist in der Tat ein politisches Kind. Die materialistische Geschichtsdeutung ist auch kein beliebig zu besteigender Fiaker und macht vor den Trägern von Revolutionen nicht halt!" Weber nennt keine Namen. Dachte er damals an Lukäcs? Heute wissen wir, daß er es tat. Lukäcs hatte von Marx nicht viel gelesen (und das, was er gelesen hatte, als Vulgärmaterialismus abgelehnt); auch von Lenin hatte er nicht viel gelesen. Lukäcs stand unter dem Einfluß eines Anarcho Syndikalisten, Ervin Szabö, des ungarischen Übersetzers von Marx und Engels. Tatsächlich standen die ersten radikalen Gruppen, die sich der Komintern anschlössen, großenteils unter der Führung von Syndikalisten wie Jack Tanner aus Großbritannien, Billy Haywood aus den Vereinigten Staaten, Alfred Rosmer aus Frankreich und Bordiga aus Italien. Für Lenin bedeutete das alles eine Infragestellung seiner Auffassung und der von der Komintern erhobenen Forderung, alle Mitglieder müßten die Autorität der russischen Partei anerkennen. 1920 formulierte Lenin unter dem Titel „Der linke Radikalismus — die Kinderkrankheit im Kommunismus" einen vernichtenden Angriff gegen die Theoretiker der „Spontaneität", die glaubten, eine Revolution könne durch revolutionären Elan entfacht werden. Lenins Broschüre richtete sich vor allem gegen den holländischen Marxisten Herman Gorter, aber auch Lukäcs, der damals als Parteiführer von untergeordneter Bedeutung galt, war in den Angriff einbezogen. Dies also war der Hintergrund von Lukäcs Buch „Geschichte und Klassenbewußtsein", das ihm seinen Ruf als großer gnostischer Lehrer des Marxismus eingetragen hat. Leider gerät Arpad Kadarkay in seiner Lukäcs Biographie („Georg Lukäcs: Life, Thought and Politics", Blackwell) über der Darstellung dieses Buches fast in Verzückung: „In seiner kontroversen Brillanz, seinem intellektuellen Schwung und seiner Leidenschaft", so schreibt er, „legt es den Vergleich mit Machiavellis Schrift Der Fürst nahe. Es wurde sofort als marxistischer Klassiker anerkannt Nichts von alledem trifft zu. Das Buch wurde nicht sofort „anerkannt", und naqh 1924, als Lukäcs in Moskau gezwungen wurde;, sich, von ihm zu distanzieren, wurde kaum nochdarüber gesprochen. Der Vergleich mit Machiavelli ist völlig abwegig, denn „Geschichte und Klassenbewußtsein" ist weder ein Handbuch der Politik noch eine prägnante Sammlung von Aphorismen, sondern ein Text von weitschweifiger Undurchsichtigkeit. Dennoch verlieh „Geschichte und Klassenbewußtsein" der damals ziemlich heruntergekommenen marxistischen Theorie neuen Glanz, indem es eine neue Theorie des proletarischen Bewußtseins entwarf. Für den marxistischen Materialismus, vor allem in der Version von Engels, bestand die Gesellschaft aus zwei Ebenen, der ökonomischen Basis und dem ideologischen (politischen, rechtlichen, kulturellen) Überbau. Da die „Materie" Vorrang vor den „Ideen" hatte, bewegte sich die Materie dialektisch, und Erkenntnis war infolgedessen Widerspiegelung der materiellen Praxis. Diese Anschauungen führte Lenin in der simplen Abbildtheorie seines Buches „Materialismus und Empiriokritizismus" weiter aus, mit der Folge, daß Einsteins Relativitätstheorie und die Quantentheorie in der Sowjetunion jahrzehntelang verboten waren und nicht gelehrt werden konnten. Lukäcs lehnte dieses mechanistische Denken ab und bemühte sich um eine neue philosophische Grundlage. Drei Motive, so könnte man sagen, bilden das Gerüst seiner Überlegungen. Zum einen der Begriff „Totalität", das Schlüsselwort des Hegelianismus. Lukäcs lehnte die Dialektik der Natur und den Primat des Ökonomischen ab und versuchte die hegelsche Denkweise zu erneuern. In seiner Phänomenologie entwickelte Hegel eine Vorstellung von der Entwicklung des Bewußtseins, angefangen bei der inneren Anlage des Begriffs bis hin zu dessen manifesten Erscheinungsformen, als eines umfassenden Zusammenhangs, gleich einem in viele Kammern unterteilten Schneckenhaus: die Ökonomie als Vergegenständlichung der Natur; die Polis oder die Gemeinschaft als verbindendes Prinzip des gesellschaftlichen Lebens; die Religion als Grundlage von Mythos, Ästhetik und Moral und das Denken als Paläontologie des Geistes. Die Geschichte ist für ihn der Prozeß der Entfaltung des Selbstbewußtseins, in dessen Verlauf alle diese innerhalb jeder Epoche miteinander verbundenen Elemente dialektisch auf immer höhere Stufen gelangen, dergestalt daß am Ende der Geschichte die entfremdete Spaltung von Objekt und Subjekt, von Natur und Geschichte im Triumph der Vernunft überwunden wird. Das historische Subjekt, die Kraft, durch die der Weltgeist wirkt, war für Lukäcs nicht Hegels „welthistorisches Individuum", das die Strukturen der alten Gesellschaften aufbricht (Alexander, Caesar, Napoleon), sondern das Proletariat. Das zweite Motiv war die Idee der Verdinglichung — jener Prozeß, in dem Gegenstände und Menschen zu „Dingen" werden und dadurch ihre Fähigkeit verlieren, eine Identität auszubilden. Verdinglichung wurde für Lukäcs zur wichtigsten Form der Entfremdung — ein Begriff, von dem sich Marx selbst im Zuge seiner Entwicklung zu einer naturalistischen Auffassung mehr und mehr gelöst hatte. An die Stelle der vier Spielarten von Entfremdung in den „Pariser Manuskripten" setzte er später die Ausbeutung als den ökonomisehen Dreh- und Angelpunkt von Herrschaft. Den Begriff der Verdinglichung, der auf die Abschnitte über Entfremdung und Rationalisierung in Georg Simmels „Philosophie des Geldes" zurückgeht, wandte Lukäcs auf Überlegungen zur Klassenbedingtheit und Verdinglichung des Denkens an. Lukäcs Buch, dem Max Scheler unabhängig davon ein Werk mit ähnlichen Überlegungen an die Seite stellte, wurde auf diese Weise zu einer Anregung für die Wissenssoziologie, vor allem für Karl Mannheim (der Lukäcs mehr verdankt, als er zugegeben hat). Grundlage der Wissenssoziologie war die Annahme, daß sich eine bestimmte Denkweise als Idealtypus konzipieren und dann einer sozialen Gruppe zuschreiben lasse. In diesem Sinne schrieb Lukäcs dem Proletariat Klassenbewußtsein zu — obgleich sich die Klasse dieses Bewußtseins nicht völlig bewußt war. Wenn man den verschiedenen sozialen Gruppen oder, direkter, den verschiedenen Klassen unterschiedliche Denkweisen zuschreibt, wie läßt sich dann noch zwischen authentischem Wissen und Ideologie unterscheiden? Die positivistische empirische Wissenschaft antwortet hier mit dem Hinweis auf das Experiment, die Verifizierung oder, mit Popper, die Nicht Falsifizierung. Aber aus der Sicht der marxistischen Soziologie bleiben dabei die Perspektive des Wissenschaftlers und sein Klasseninteresse und vor allem die inneren Wandlungsprozesse, durch die man die Wahrheit findet, unberücksichtigt. An diesem Punkt tritt die Dialektik in Erscheinung. Für Hegel ist das Gegenwärtige, das Daseiende, das Aktuale nicht die wahre Wirklichkeit, denn es ist unvollkommen. Wahrheit findet sich erst in der Vollendung des Bewußtseins, am Endpunkt der Geschichte. Für Hegel wirkte der Weltgeist auf der manifesten Ebene durch die „Nationen", aber einer solchen historischen Vereinzelung fehlte jene immanente Geschlossenheit, die die Geschichte zur Universalität vorantreiben konnte. Für Lukäcs war die Vollendung der Geschichte natürlich mit dem Schicksal des Proletariats verbunden, und Wahrheit war infolgedessen die Wahrheit einer Klasse. In alledem lag nun allerdings viel intellektuelle Kühnheit, die eines Leo Naphta durchaus würdig war, insofern nämlich, als die Theorie zur Praxis rie nicht modifizieren, denn die Praxis ist selbst beschränkt und von Zufällen abhängig. Allein in der Theorie liegt Wahrheit. Und hier, mit einem Sprung zu Lenin, erhebt Lukäcs die Partei, die den Sinn der Geschichte enträtselt hat, zur Quelle jener Wahrheit. Die kommunistische Partei, so Lukäcs, müsse als unabhängige Organisation existieren, „damit das Proletariat erkennen kann, wie sein eigenes Klassenbewußtsein Gestalt annimmt". Die Partei ist eine Totalität, die „die verdinglichten Spaltungen in Nationen, Berufe durch ihr Handeln transzendiert". Ihre „eiserne Disziplin und ihre Forderung nach totaler Hingabe zieht den Schleier der Verdinglichung beiseite, der das Bewußtsein des Individuums in der kapitalistischen Gesellschaft vernebelt". Als Werkzeug der Geschichte fordert sie, daß jedes Mitglied „seine ganze Persönlichkeit und sein ganzes Dasein der Partei widmet". Nach dem Scheitern der ungarischen „Revolution" lebte Lukäcs noch fast fünfzig Jahre, und wenige Angehörige seiner Generation machten so außerordentlich reiche Erfahrungen wie er, vor allem deshalb, weil so viele während der großen Säuberungen in der Sowjetunion und während der kleinen Säuberungen in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Die zwanziger Jahre verbrachte Lukäcs größtenteils in Wien. Hier war er in die kleinlichen Fraktionskämpfe verwickelt, wie sie für Emigrantenparteien typisch sind, deren Mitglieder nichts anderes zu tun haben, als sich gegenseitig die Fehler der Vergangenheit zur Last zu legen. Lukäcs wurde aus dem Zentralkomitee der winzigen ungarischen Partei und aus der Redaktion der in Wien erscheinenden Zeitschrift Kommunisnoch direkt in die Politik ein, als er 1928 dem Kongreß der Ungarischen Kommunistischen Partei die sogenannten Blum Thesen vorlegte (Blum war sein Deckname im Untergrund), die die Taktik der Fraktion um Bela Kun verurteilten und eine Volksfront mit Sozialdemokraten und Bauern vorschlugen, statt die linksrevolutionäre Haltung der Komintern zu übernehmen, die von der Annähme ausging, der Kapitalismus sei angesichts der bevorstehenden ökonomischen Krise in sein „letztes" Stadium eingetreten. Auf die Blum Thesen ist Lukäcs immer stolz gewesen, und in einem posthum 1971 veröffentlichten Interview mit der waren mein Rückzugsgefecht gegenüber dem Sektierertum der Dritten Internationale, die auf der These beharrte, Sozialdemokratie und Faschismus seien Zwillingsbrüder Die Komintern dachte hierüber ganz anders. Wie Neil Mclnnes in seinem ausgezeichneten Buch „The Western Marxists" schreibt, wurden die Blum Thesen als das „Werk eines Rechtsabweichlers, eines Anti Leninisten, fines halben Sozialdemokraten, eines Liquidators der Ungarischen Kommunistischen Partei angegriffen. Blum habe nicht erkannt, daß die Sozialdemokraten zu Sozialfaschisten geworden seien und daß es für die Bolschewisten nun an der Zeit sei, gegen demokratische Illusionen zu kämpfen " Lukäcs wurde nach Moskau zitiert und blieb fünfzehn Jahre dort, bis zu seiner Rückkehr nach Budapest im Anschluß an den Krieg. Die Jahre in Moskau waren wahrscheinlich die bedrückendste und demütigendste Phase seines Lebens. Er überlebte. Die meisten anderen führenden Emigranten, die damals in Moskau lebten, überlebten nicht, unter ihnen fast die gesamte Führungsspitze der Polnischen Kommunistischen Partei, Bela Kun und die meisten anderen Ungarn, viele deutsche Kommunisten wie Heinz Neumann und so weiter und so weiter. Das Überleben war eine Frage des Glücks, der Protektion und zufälliger Beziehungen und Allianzen in der Vergangenheit. Bela Kun hatte sich mit Sihowjew verbündet, und deshalb hatte Lukäcs als sein Gegner Unterstützung bei Stalin gesucht. In Moskau wurde Lukäcs von den fanatischsten Philosophen Stalins, etwa von Judin, protegiert. Und Lukäcs wußte, wie man einen Kniefall macht. Vor der Philosophischen Sektion der Kommunistischen Akademie vollzog er, nach den Worten von Morris Watnick, einen „Akt der Selbsterniedrigung, wie man ihn jämmerlicher kaum je erlebt hat, und sparte nicht mit Worten, um das Publikum von seiner unverbrüchlichen Orthodoxie zu überzeugen". Die Jahre in Moskau, Jahre, die sein Freund Ervin Sinkö als „gähnenden Abgrund zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und ethischem Empfinden" bezeichnete, waren (Kadarkay zufolge) für Lukäcs „die harmonischsten Jahre seines Lebens". Ist das ironisch gemeint? Wie in all seinen Schriften aus dieser Zeit gab es die doppelten Wahrheiten und die Lügen zweiten Grades. Er wahrte Distanz zu den Emigrantenkreisen, sah nur hin und wieder Eugen Varga, den wichtigsten marxistischen Fachmann für Fragen der Weltwirtschaft. Er arbeitete für die Zeitschrift Internatiolismus und Romane aus dem Ausland schrieb. (Russisch lernte er nie ) „Der historische Roman", sein Hauptwerk aus dieser Zeit, befaßt sich mit der Entfaltung des historischen Bewußtseins in der Literatur, wobei es die Romane von Walter Scott als erste Verkörperung dieser Tendenz betrachtet, und sieht in Balzac und Tolstoi] die bedeutendsten Vertreter des Realismus, den er als das Bemühen definiert, ein umfassendes Bewußtsein von Gesellschaft und Geschichte zu entwikkeln. Zugleich singt dieses Buch aber auch tendenziöse Loblieder auf den „demokratischen Humanismus", hebt Autoren wie Lion Feuchtwanger, Romain Rolland und Heinrich Mann, die allesamt die Sowjetunion zu jener Zeit unterstützten, hervor. Wie Brecht in seinen Lehrstücken hat Lukäcs immer anerkannt, daß das Individuum seine Freiheit notfalls der höheren Sache opfern müsse. Aber auch, daß es mit zwei Zungen sprechen müsse. Als Brecht auf der Grundlage eines alten japanischen No Spiels sein Lehrstück „Der Jasager" schrieb, in dem sich ein Junge, um seine Gefährten nicht aufzuhalten, damit einverstanden erklärt, daß man ihn tötet, da hieß es, man könne darin auch ein Plädoyer für die preußischen Tugenden Gehorsam und Disziplin erblikken. Brecht schrieb daraufhin eine neue Fassung unter dem Titel „Der Neinsager" und erklärte: „Wer A sagt, muß nicht auch B sagen Lukäcs sagte immer A und B. Es ist jedoch klar, daß er sich auf einer bestimmten psychischen und philosophischen Ebene nach „Totalität" sehnte und die Unaufrichtigkeit hinnahm, die dies voraussetzte. So bemerkt Kadarkay: „So verführerisch er ihn in Dialektik kleidete, seinen Stalinismus hat sich Lukäcs selbst zurechtgelegt Und im Hinblick auf Lukäcs Moskauer Jahre kam Isaac Deutscher zu dem Schluß, daß die Stalinverehrung und seine Unterwerfung unter den Stalinismus „e cht" gewesen seien. Bei den Säuberungen wurden achtzig Prozent der ungarischen Emigranten in der Sowjetunion ermordet. Lukäcs Freund Johannes Becher, der später unter Walter Ulbricht in Ostdeutschland Kulturminister wurde, unternahm während seiner Zeit in der Sowjetunion mehrere Selbstmordversuche. Und Lukäcs Stiefsohn, Ferenc Jänossy, der Sohn seiner geliebten Frau Gertrud Bortstieber, wurde wegen „antisowjetischer Aktivitäten" verhaftet und versuchte sich in einem sowjetischen Arbeitslager das Leben zu nehmen — durch Erfrieren. Im April 1945, als sein sechzigster Geburtstag gefeiert wurde, bereitete sich Lukäcs darauf vor, als Mitglied des neuen Parlaments nach Ungarn zurückzukehren. Er vertraute Eugen Varga an, wie peinlich es ihm sei, zurückzukehren, während sein Stiefsohn im Arbeitslager stecke. Zwei Wochen später war Jänossy wieder zu Hause. Später berichtete er darüber: „Varga sagte, er spiele jeden Donnerstagabend mit Berija Bridge. Am nächsten Bridgeabend wolle er meinen Fall zur Sprache bringen. Es muß eine sehr gute Bridgepartie im Kreml gewesen sein " Lukäcs Inferno, die Gefilde seiner Verzweiflung waren das endlose Kreisen zwischen Himmel und Hölle. 1945 wurde er auf den Lehrstuhl für Ästhetik an der Universität Budapest berufen. In einer Rückbesinnung auf seine alte Vision erklärte er, in der Antike seien Kunst und Literatur ein integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens gewesen, und deshalb sollten Kunst und Literatur auch in der kommunistischen Gesellschaft darauf zielen, den „Menschen als gesellschaftliches Wesen" darzustellen. Als sein alter Freund Lajos Fülep, mit dem er seine erste Zeitschrift A Szellem herausgegeben hatte, ihm ziemlich überrascht schrieb, in der Welt, in der er jetzt lebe, hätten die Kommunisten keine Unterstützung im Volk, erwiderte Lukäcs: „Die Dialektik der Geschichte beweist, daß das, was aus subjektiven Gründen geschehen ist, zum objektiven Faktum wird " Am 30. Mai 1949 wurde der ungarische Innenminister Läszlö Rajk verhaftet und unterzeichnete bald darauf ein handschriftliches Geständnis, demzufolge er mit Tito gegen Stalin konspiriert habe. Die neuen Säuberungen hatten begonnen. (In Paris schrieb Julien Benda, der früher einmal den Einzug der clercs in die Politik verurteilt hatte, einen Artikel, in dem er das Todesurteil gegen Rajk guthieß ) Wenn Rajks Schicksal eine Warnung für die Partei war, geriet eine Kritik an Lukäcs zur Warnung für die Intelligenz. Das Teuflische daran war, daß die Anschuldigungen von Läszlö Rudas und Jözsef Revai formuliert wurden, die 1919 beide Gefolgsleute von Jenö Landler, einer der ehrwürdigen Gestalten des ungarischen Kommunismus, gewesen waren. Rudas war schon früh zum erbitterten Feind von Lukäcs geworden, aber Revai war sein Schüler gewesen, und im neuen ungarischen Regime war er der Kulturminister. Rudas beschuldigte Lukäcs des Idealismus, des Kosmopolitismus, der Verunglimpfung Lenins — lauter alte Vorwürfe. Kosmopolitismus war das Schlüsselwort Schdanows für jene, die „vor der westlichen Kultur den Kotau machten" und sich dem sozialistischen Realismus widersetzten. Revai führte den vergifteten Dolch eher verstohlen. Er rühmte Lukäcs für seine Angriffe gegen den Modernismus, die Dekadenz und den Existentialismus Sartres. Sein Irrtum jedoch, so erklärte Revai, bestehe darin, daß er sich weigere, den Fortschritt der sowjetischen Literatur anzuerkennen. Wie könne man guten bürgerlichen Werken den Vorzug gegenüber schlechten sozialistischen Werken geben, da doch die bürgerliche Ideologie der proletarischen Ideologie prinzipiell unterlegen sei. Und war denn die Sowjetunion kein proletarischer Staat? Lukäcs saß in der eigenen Falle. Er gab klein bei und verfaßte eine neue Selbstkritik. Es wäre nutzlos gewesen, Revai mit Zitaten aus seinen, Lukäcs, früheren Werken zu begegnen. Die Partei wollte keine Debatte, sie wollte Unterwerfung. In „Kritik und Selbstkritik", erschienen im August 1949, räumte Lukäcs ein, in seiner Arbeit habe der notwendige „aufmerksame Blick nach Moskau" gefehlt. Zur Wiedergutmachung publizierte er zwei Aufsätze über sowjetische Romane. Als Lukäcs treue Schüler ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachten, daß er, wie Galilei, den Kompromiß gewählt hatte, erwiderte Lukäcs (nachzulesen in dem Buch „Revolt of the Mind" von Tomas Aczel und Tibor Meray, zwei führenden kommunistischen Schriftstellern, die nach 1956 geflohen sind): „Was wollt ihr eigentlich, im entscheidenden Punkt habe ich nicht Selbstkritik geübt!" Die Studenten sahen ihn verständnislos an „Was war der entscheidende Punkt?" fragten sie „Ist euch das denn nicht aufgefallen?" fragte Lukäcs ernst „In meinem Artikel habe ich kein einziges Wort gegen Hegel gesagt " Im Oktober 1956 kam es zum Ausbruch der ungarischen Revolution, initiiert von kommunistischen Intellektuellen aus dem Petöfi Kreis, geführt von Mitgliedern der Kommunistischen Partei — und wunderbarerweise bildeten sich überall im Land spontan Arbeiterräte zur Unterstützung der Revolution. Innerhalb des Petöfi Kreises schloß sich Lukäcs den Intellektuellen an, die sich für eine Veränderung aussprachen, doch, wie Kadarkay schreibt, „in jeder Einzelfrage mel , dete sich Lukäcs mit einem einschränkenden Kunst müsse aufhören, aber das könne nicht Chancengleichheit für alle literarischen Richtungen bedeuten. Marxisten und Nichtmarxisten sollten einen Dialog aufnehmen, aber die freie Meister der Moderne sollten zugänglich gemacht werden, aber das könne nicht heißen, die Werke von Kafka und Joyce zu propagieren " Der Wendepunkt der Ereignisse war die ehrenvolle zweite Bestattung der sterblichen Überreste Rajks auf dem Heldenplatz des Budapester Friedhofs. Zweihunderttausend Menschen nahmen daran teil. Zu diesem Zeitpunkt war die stalinistische Partei so sehr in Mißkredit geraten, daß sie nach Lukäcs Meinung bei einer Wahl nicht mehr als „fünf Prozent" der Stimmen erhalten hätte. Am 25. Oktober nahm Lukäcs einen Posten im Kabinett von Imre Nagy an. Binnen einer Woche hatte Moskau beschlossen, die „Konterrevolution" zu zerschlagen. Am selben Tag, als Nagy beschloß, das Einparteiensystem abzuschaffen, entwarf Lukäcs sein Rücktrittsgesuch. Als Grund nannte er in seinem Schreiben, die Regierung enthalte noch immer stalinistische Elemente, aber Kadarkay, der alle erdenklichen Zeugnisse hierzu geprüft hat, gelangt zu dem Schluß, daß der listige Überlebenskünstler von dem bevorstehenden Eingreifen der Russen erfahren hatte und nun hastig den Rückzug antrat. Nagy und seine Regierung, darunter auch Lukäcs, flohen in die jugoslawische Botschaft. Schließlich ließen die Sowjets Nagy das gleiche grausige Schicksal widerfahren wie Rajk. Seine Leiche wurde ohne Sarg irgendwo außerhalb von Budapest verscharrt. Lukäcs überlebte. Einer der Gründe hierfür war vielleicht die Intervention von Bertrand Russell, der drohte, von seinem Posten als Präsident des Weltfriedensrates zurückzutreten, falls Lukäcs nicht freigelassen würde. Außerdem hatte Lukäcs auch privat die Nähe zu Kadar gesucht. Als er Monate später nach Budapest zurückkehrte, versprach er Revai, er werde sich nie wieder in die Politik einmischen. Er bat darum, ihm sein Parteibuch zurückzugeben. Zehn Jahre später, wenige Jahre vor seinem Tod, bekam er es. Georg Lukäcs war kein Feigling. Er hatte den scharfen Verstand und den eisernen Willen des gläubigen Gnostikers. Und, was das Entscheidende in solchen Fällen ist: Charakter, Temperament und Ideologie verschmolzen bei ihm zu einer Einheit. In den letzten Monaten seines Lebens, als er schon an Krebs litt, im Alter von 86 Jahren, versuchte Lukäcs, eine autobiographische Skizze zu verfassen, „Gelebtes Denken", aber seine Kraft reichte nicht mehr aus, und das Resultat waren 57 Seiten kryptischer Andeutungen. Zwischen März und Mai 1971 machte sein früherer Schüler Istvän Eörsi, der mit Tibor Dery nach der Revolution von 1956 eine Zeitlang im Gefängnis gesessen hatte, eine Reihe von Interviews, in denen er Lukäcs bat, sich zu seinen Notizen zu äußern. Dort hatte Lukäcs zum Beispiel geschrieben: „Guerillakampf mit Mutter: Dunkelkammer circa 8 Jahre. Vater: Befreiung ohne Sichentschuldigen Dazu gab Lukäcs nun folgende Erläuterung: „Gegen meine Mutter führte ich einen Partisanenkrieg. In der Wohnung gab es eine Holzkammer, eine Dunkelkammer. Es gehörte zu den Strafen meiner Mutter, daß sie uns dort einsperrte, bis wir sie um Verzeihung baten. Meine Geschwister baten auch sofort um Verzeihung, während ich scharf differenzierte. Wenn sie mich morgens um zehn einsperrte, dann bat ich fünf Minuten nach zehn um Verzeihung, und alles war in Ordnung. Mein Vater kam um halb zwei nach Hause. Meine Mutter vermied es nach Möglichkeit, daß es bei der Ankunft meines Vaters Spannungen gab. Dementsprechend hätte ich um nichts in der Welt um Verzeihung gebeten, wenn ich nach ein Uhr eingesperrt wurde, weil ich wußte, daß ich fünf Minuten vor halb zwei auch herausgelassen werden würde, ohne um Verzeihung gebeten zu haben Hierzu Eörsi: „Diese Logik wirft auf den späteren SelbstkritikMechanismus ein grelles Licht. Der kindliche Guerillero und der erwachsene Partisan übten übereinstimmend nur dann Selbstkritik, wenn sie die Lage so einschätzten, daß der rettende Papa nicht rechtzeitig nach Hause kommen würde " Erstaunlich ist, daß Lukäcs sich selbst nun sogar mit Stolz in der Gestalt Leo Naphtas wiedererkennt. Zu Eörsi sagte er: „Es besteht überhaupt kein Zweifel, daß er bei der Figur Naphtas mich als Modell genommen hat. Er war jedoch zu intelligent, als daß er nicht gewußt hätte, daß Naphtas Anschauungen nicht meine Anschauungen waren Aber Eörsi schreibt in seiner Einleitung: „Thomas Mann hat die heiklen, man könnte sagen, unlösbaren Widersprüche dieser geistigen Beschaffenheit und Situation sehr feinfühlig erfaßt. Naphta ist Jesuit. Infolge seines scharfen Intellekts steht er aber gleichzeitig auch außerhalb der Bewegung, der er seine Kraft widmet Und über Lukäcs schreibt Eörsi, es sei schwer für ihn gewesen, mit einer Konfliktsituation fertig zu werden, die ihn „an den Rand der als todbringend empfundenen Exkommunikation trieb". Welche Überzeugung könnte für Intellektuelle verführerischer sein als die, daß man die Wahrheit besitzen und zugleich verspeisen könne? Aber das Jahrhundert des Betrugs geht zu Ende. Und wie vielleicht auch Lukäcs im Jenseits erkannt hat, kann man den „Abgrund der Sinnlosigkeit" nicht in zwei Schritten überwinden.