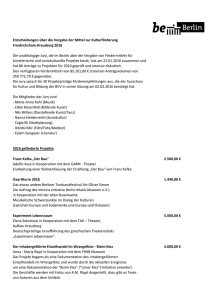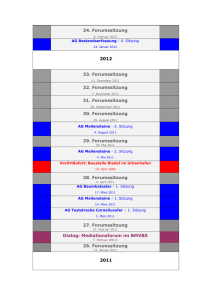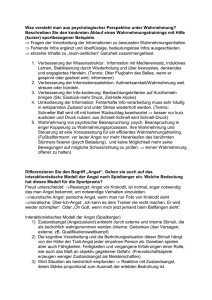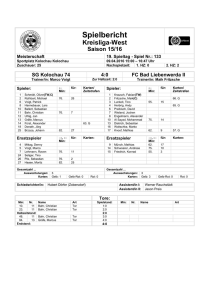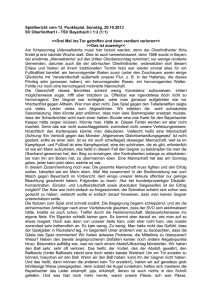Martin Düspohl
Werbung

Martin Düspohl SO 36 - DER OSTEN KREUZBERGS Am Kottbusser Tor, am Südstern oder am Mehringdamm kann es einem freitags abends passieren, dass sich freundliche Menschen nach dem Weg „nach Kreuzberg" erkundigen. Die Berliner, die ja sonst nicht auf den Mund gefallen sind und in der Regel bereitwillig jedem den Weg erklären („da 'runter und dann um die Ecke, da kommt dann ein Imbiss, da wieder abbiegen und dann auf die andere Seite...") hinterlässt diese Frage zunächst einmal ratlos, verweist sie doch auf ein bestimmtes Klischee von Kreuzberg, das seine Erstbesucher gerne bestätigt finden möchten, ein Klischee, dem die Gegend, in der sie gerade herumlaufen - obwohl mitten im Herzen Kreuzbergs gelegen - so gar nicht entsprechen will. Aber weil Kreuzberg nicht Frankfurt-Sachsenhausen ist und auch nicht Düsseldorfer Altstadt, hat es auch keine Sperlingsgasse. Es gibt nicht Kneipe an Kneipe, und keine fröhliche Bierseligkeit, die auf den Bürgersteig schwappt. Wer sich nicht auskennt, dem kann es passieren, dass er Kreuzberger Nächte gar nicht lang, sondern einfach nur langweilig findet. Reichte es vor dem Fall der Mauer noch aus, sich den Strömen junger Vergnügungssüchtiger anzuschließen, die die U-Bahn abends um halb elf am Kottbusser Tor ausspuckte, so gehört jetzt Ortskenntnis hinzu, um wenigstens ein bisschen vom Kreuzberger Klischee bestätigt zu bekommen. Nachdem die Ströme des Ausgehvolks sich nach Mitte oder Prenzlauer Berg verlagert haben, bleiben die Kreuzberger weitgehend unter sich. Aber auch mit Ortskenntnis und guten Tipps ausgerüstet, wird man schnell feststellen: Es gibt viele Kreuzbergs (nicht nur) in der Nacht, je nachdem, wo im Bezirk man sich gerade befindet. Auch der östliche Teil, der alte Postbezirk S(üd)O(st) 36, um den es in diesem Kapitel geht, hat unterschiedliche Gesichter. Bevor wir uns aber in das Nachtleben stürzen, hier ein paar Tipps für eine Erkundung bei Tageslicht. Frühaufstehern sei geraten, sich für den Vormittag etwas anderes vorzunehmen, denn Kreuzberg lebt erst von der Mittagszeit an. Das Kottbusser Tor, Kreuzungspunkt zweier U-Bahn-Linien, ist ein guter Ausgangspunkt für einen Spaziergang durch SO 36. Wer mit der Hochbahn (Linie 1) anreist, bewegt sich dorthin auf der Linie der ehemaligen Zollmauer Berlins, die nach 1860 löchrig wurde, weil die Berliner sie als BaumaterialRessource entdeckt hatten. Nach einigen Jahren war die Mauer nicht mehr da. Das gleiche Schicksal ereilte schon etwas früher das Kottbusser Tor, das Hallesche Tor und das Schlesische Tor, die Stadttore, die mit ihren Namen auf Städte und Landschaften verwiesen, zu denen Landwege aus Berlin herausführten, und mit deren Namen heute die U-Bahn-Stationen gekennzeichnet sind. „Ausstieg links" lautet die Durchsage im Zug, wenn die überirdische Untergrundbahn am Kottbusser Tor hält, und man begibt sich zunächst in das Untergeschoss der Station, vorbei an dem hier häufiger als anderswo präsenten hundebewehrten Wachpersonal, steuert dann auf die reiche Blumenpracht zu, die ein türkischer Florist dankenswerterweise täglich neu aufbaut, nimmt sie doch der unterirdischen Schalterhalle ein wenig von der Tristesse, die den ganzen Bahnhof umgibt. Nur im April ist das anders: Dann blühen draußen vor der Station zwischen tosendem Verkehr auf der Insel im Kreisverkehr zwei wunderschöne Mandelbäume. Einmal jedes Jahr zur Blütezeit versammeln sich zwischen den Bäumen Freunde, Verwandte und Bekannte des türkischen Lehrers Celalettin Kesim zum Gedenken an den engagierten Gewerkschafter, der am 5. Januar 1980 am Kottbusser Tor verblutete, nachdem ihm rechtsradikale „Graue Wölfe" ein Messer in den Rücken gerammt hatten. An der Süd-Ost- 1 Seite des Kreisverkehrs erinnert eine Bronzestele an Celalettin. Der türkische Bildhauer Hanefi Yeter hat sie zusammen mit Grundschülern geschaffen - übrigens ein Denkmal, das noch nie durch Graffiti und Vandalismus beschädigt worden ist. Den beiden blühenden Bäumen geht es manchmal anders. Es kommt vor, dass nach Verkehrsunfällen ein Rettungshubschrauber am Kottbusser Tor landen muss - dann ist es mit der Blütenpracht in Sekundenschnelle vorbei. Die Bebauung am Kottbusser Tor - oft verniedlichend „Kotti“ genannt - repräsentiert die erste Sanierungsphase Kreuzbergs, die in die Zeit Anfang der siebziger Jahre zurückreicht. Damals wollten sich Stadtplaner und Politiker möglichst umgehend und radikal von dem baulichen Erbe der Gründerzeit trennen. Die Mietshäuser aus Backstein mit ihren in den fünfziger Jahren entstuckten, glattgeputzten Fassaden galten als überkommen, den Anforderungen an „modernes" Wohnen nicht mehr entsprechend: zu dunkel die Wohnungen in den unteren Etagen, zu gering der sanitäre Standard, zu mühsam das ewige Kohleschleppen. Der Abriss erfolgte hier mit einer Brutalität, die in Benin nur noch in dem Weddinger Stadtviertel Gesundbrunnen übertroffen wurde. Statt der alten Bebauung erhebt sich an der Nordseite des Platzes heute das Neue Kreuzberger Zentrum, ein kurz „NKZ" genannter Hochhauskomplex mit Geschäftszeilen und Wohnungen für etwa 1000 Menschen. Schon bald nach der Fertigstellung stellte sich heraus, dass die Investorengruppe Gunter Schmidt Beteiligungen GmbH und Co. sich mit dem Bauvorhaben, das zu einem Meilenstein sozialdemokratischer Modernisierungspolitik werden sollte, übernommen hatte. Aber da war es schon zu spät, um Rio Reisers Rat „Schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus!"1 zu befolgen. Nach vier Jahren meldete Schmidts Gesellschaft Konkurs an, eine Zwangsverwaltung wurde eingesetzt, und seitdem hat die Berliner Bau- und Sozialpolitik ein Problem, das CDU-Fraktionschef Klaus-Jürgen Landowski jetzt durch - wiederum - Abriss meint lösen zu können, womit er nicht nur den maroden Baukörper loszuwerden gedenkt, sondern auch dessen Bewohner, denen er alle Arten von Delinquenz vorhält. Ob es sich lohnt, diesen Baukörper zu durchstreifen, mag jeder selbst entscheiden. Die unübersichtlichen, zugigen Passagen, in den letzten Jahren zum Leidwesen der Bewohner auch ein Ort des Drogenkonsums und -handels, laden nicht gerade zum Verweilen ein. Über Treppen erreicht man das erste Stockwerk. Dort befinden sich Arztpraxen, Büros der türkischen Gemeinde und eine der größten Moscheen des Bezirks, die Mevlana-Moschee. Ihre Gemeide gehört zur konservativen Islamischen Föderation und gilt als fundamentalistisch ausgerichtet. Der ursprünglich als Gemeinschafts- und Sozialraum des NKZ gedachte achteckige Versammlungsraum kann mittels Jalousien in mehrere kleinere Gebets- und Gottesdiensträume aufgeteilt werden, so dass ungestörtes Beten oder parallele Veranstaltungen von Männern und Frauen möglich sind. Die Wände schmücken arabische Kalligraphien, die (Kanzel?) des Hodschas ist nach Mekka ausgerichtet. Ein kleines Geschäft mit Literatur, Videos, Kassetten und Lebensmitteln gehört ebenfalls zur Innenausstattung. Besucher/innen, die am Eingang die Schuhe in die bereitgestellten Regale stellen, sind durchaus willkommen und erhalten geduldig Antwort auf alle Fragen. Der Moschee gegenüber hat Kinderarzt Falkowski seine Praxis. Er beschäftigt mehrsprachige Sprechstundenhilfen und kennt die Nöte der Menschen im Kiez genau. Den Müttern seiner kleinsten Patienten bietet der türkische Apotheker im darunter liegenden Stockwerk eine Abstellmöglichkeit für Kinderwagen und Buggies, müssten sie sie doch sonst über die steilen, engen Betontreppen hoch in die Praxis schleppen. Einen Aufzug gibt es nicht, eine Rolltreppe nur zur „Möbel-Oase" in einem anderen Flügel des Komplexes. 2 Dort kann man zu Niedrigstpreisen alles bekommen, was zur Standardausstattung eines Kreuzberger türkischen Wohnzimmers gehört. Ein leicht übersehener Wegweiser zwischen den Gemüseständen weist die Richtung zur Dresdener Straße, die früher in den Kreisverkehr am Kottbusser Tor mündete, durch das NKZ aber zur Sackgasse degradiert wurde. Dort angekommen, kann man zunächst einmal aufatmen: Hier ist es viel ruhiger, der Blick fällt in eine alte Gründerzeitstraße, deren Bebauung die Abrisspläne überlebt hat. Im Zuge der Internationalen Bauausstellung 1987 (IBA) ist sie sogar regelrecht herausgeputzt worden. Im Rücken liegt das schroffe, abweisende Hinterteil des NKZ, linkerhand das zugehörige ehemalige Parkhaus, das sich gleich nach Fertigstellung als überflüssig erwies und fortan nichts als ungenutzte Hässlichkeit darbot. Weil dem Überangebot an PKW-Einstellplätzen ein eklatanter Mangel an Kindergartenplätzen gegenüberstand, ließ die IBA das Parkhaus in eine große öffentliche Kindertagesstätte umwandeln: ein Glücksgriff architektonischer Stadtreparatur, davon kann man sich vor allem im Innern des Gebäudes überzeugen. Sehenswert ist auch das begrünte Spieldach. Einhundertundsechzig Kinder können in der „Parkhaus-Kita" von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends betreut werden. Kreuzberg, das in den sechziger Jahren zu vergreisen drohte, ist nach Hellersdorf Berlins jüngster Bezirk. 26 000 Kinder unter 15 Jahren leben in Kreuzberg, 17,5 % der Bevölkerung (Hellersdorf: 22 %, Prenzlauer Berg 11 %). Knapp die Hälfte der Kreuzberger Kinder haben Eltern nichtdeutscher Herkunft. Sie stammen aus der Türkei (56%), den Nachfolgestaaten von Jugoslawien (12%), aus den arabischen Staaten (ca. 10%), aus Polen, Griechenland (jeweils 3 %) und fast allen anderen Ländern der Erde. Mehr und mehr Familien haben den Wunsch, an den Stadtrand und in das Umland Benins zu ziehen. Beobachter prognostizieren „Segregationsprozesse", deren sozialen Auswirkungen noch gar nicht absehbar sind. Innerhalb von drei Jahren zogen Mitte der neunziger. Jahre ein Viertel alter deutschen Kinder mit ihren Familien aus SO 36 weg. Auch ausländische Familien verlassen den Bezirk. Die Umzugshäufigkeit war noch nie so groß wie im Moment, und ein Ende ist nicht absehbar. Die nach der Maueröffnung vorhergesagte „Gentrifizierung" Kreuzbergs, ein aufgrund der günstigen Innenstadtlage erwarteter Zustrom von Singles und Yuppies mit überdurchschnittlicher Bildung und Kaufkraft, fand nicht statt. Im Gegenteil, im Zuge der überall in Berlin zu beobachtenden „sozialräümlichen Polarisierung", stellt ein Gutachten der Stadterneuerungsgesellschaft S.T.E.R.N. fest, werde Kreuzberg SO 36 räumlich abgesondert, verarme zusehends und sei mehr und mehr gekennzeichnet von einem Klima der Perspektivlosigkeit und der Benachteiligung. Dass die an die Parkhaus-Kita anschließende Häuserzeile in der Dresdener Straße nicht abgerissen wurde, ist vor allem ein Erfolg der Berliner Mieterprotest- und Selbsthilfebewegung, die in der Dresdener Straße ihren Ausgangspunkt nahm. Sie wurde zunächst von Geschäftsinhabern initiiert, deren Umsätze wegen der doppelten Sackgassensituation der einstigen Hauptverkehrsstraße (die Mauer im Norden, das NKZ im Süden) ständig zurückgingen, weil die Laufkundschaft ausblieb. Werner Orlowsky, damals Drogist in der Dresdener Straße 19, avancierte zum Sprecher der Protestbewegung gegen unsinnige und sozial unausgewogene Stadtplanung. Die Alternative Liste hievte ihn 1981 - auf dem Höhepunkt des „Berliner Häuserkampfes" - an die Spitze des bezirklichen Bauressorts. Danach begann eine Phase der "behutsamen Stadterneuerung". Das Gebäude Dresdener Str. 12 ist ein gelungenes Beispiel dafür. Die Instandsetzung und Modernisierung kostete mit 1,3 Mio. DM ungefähr die Hälfte eines vergleichbaren 3 Neubaus und erfolgte weitgehend in Übereinstimmung mit den Bewohnern. Über den Zugang zum benachbarten Grundstück (Dresdener Str. 11) kann man einen Blick in den begrünten Hof tun. Stehen geblieben ist dort das ehemalige Fachwerk-Toilettenhäuschen, in dem heute Gartengerät untergestellt ist. Es hatte vier Sitzplätze - vor hundert Jahren ein Luxus in dieser Gegend! Aber was heute romantisch anmutet, verweist auf die damals erbärmlichen hygienischen Zustände: Die Aborte wurden nicht nur von den Bewohnern der Mietshäuser genutzt, sondern auch von den Arbeitern der Betriebe in den Fabriketagen, den Gästen der Kneipen in den Vorderhäusern und Straßenpassanten aufgesucht. Die gemauerte Sickergrube lag oftmals neben der Trinkwasserpumpe. Undichte Stellen bedeuteten eine ständige Gefahr für das Trinkwasser. Eine Cholera- und Typhusepidemie war 1866 die Folge. Allein in der Dresdener Straße fielen ihr zwanzig Menschen zum Opfer. Die Ansteckungsursachen erkannte indes erst 1883 der Mediziner Robert Koch. 1875 verfügten in diesem Teil Berlins nur die Hälfte der Wohnungen über eine Wasserleitung und nicht einmal 10% über ein WC. Erst nach und nach bekamen die Häuser Podesttoiletten auf den Treppenabsätzen und Kanalisationsanschlüsse. Heute weist die Dresdener Straße die für Kreuzberg typische Mischung von Einzelhandel und Gastronomie auf. Ihr Tagleben unterscheidet sich stark von ihrem Nachtleben. Tags gehört die Straße den Kindern, den Bauarbeitern und den parkplatzsuchenden Autofahrern, geöffnet sind dann der „Sikasso-Markt" und das „metissage" (afrikanische Lebensmittel und Kunstgewerbe), das downbeat (MusikCDs), der „Milchladen", die türkische Änderungsschneiderei, der Mieterladen, die Glaserei, die Keramik-Werkstatt „o-ton", der Fan-Club Altin Ordu und die türkischen Cafes. Abends kann man im „Babylon" und im „Kellerkino" ausländische Filme in Originalsprache sehen und danach in den Restaurants „Diyar" oder „Gorgonzola Club" (mit Garten im Hof) speisen oder in die Traditionskneipe „Franziskaner" einkehren, und ganz spät lockt die immer überfüllte Nachtbar „Würgeengel". Aber Vorsicht: Letztere hat ihren Namen nach einem Bunuel-Film von 1962, in dem eine Partygesellschaft von einer geheimnisvollen Kraft am Ort ihrer Zusammenkunft festgehalten wird... Die Dresdener Straße mündet in den Oranienplatz, einen von mehreren Schmuckplätzen, die Peter Joseph Lenné in seinem Bebauungsplan für die Luisenstadt, wie der Berliner Süden damals hieß, vorgesehen hatte. Hätte sich die noch für ganz Berlin vorgesehene Verkehrsplanung der sechziger Jahre durchgesetzt, befände sich hier heute im Schnittpunkt der geplanten Süd- und Osttangente ein Autobahnkreuz. Die andauernde deutsche Teilung machte das aberwitzige aber ernstgemeinte Vorhaben zur Makulatur. Und so präsentiert sich der Oranienplatz heute als eine Mischung von großstädtischer Platzanlage, die schon bessere Tage erlebt hat, und verspielter Grünanlage, die ein wenig mehr Pflege verdient hätte. Zur Zierde dient ein wenig „Kunst im Stadtraum": der Katamaran auf der Spitze eines Metallgestänges soll an die rege Schifffahrt auf dem Luisenstädtischen Kanal erinnern, der den Platz einst in Nord-Süd-Richtung durchquerte, und - so die Künstler - für den Abtransport der dicken Kreuzberger Luft sorgen; der klobig wirkende Brunnen aus Granit ein paar Meter weiter ist mangels Haushaltsmitteln zu ewiger Trockenheit verdammt. Die Bezeichnung „Oranien" weist zurück in das frühe 18. Jahrhundert, als hugenottische Obst- und Gemüsebauern hier Gärten anlegten. Sie waren aus dem südfranzösischen Fürstentum „Orange" vor Verfolgungen geflüchtet und hatten in Benin Aufnahme gefunden. Die Bebauung des Platzes stammt aus der ersten Hälfte unseres Jahr- 4 hunderts, nur die Nutzung hat sich geändert: Das ehemals feine Bekleidungsgeschäft C & A Brenninkmeier (Oranienstr. 40/41 - man beachte das Treppenhaus!) teilen sich ein türkischer Hochzeits-Festsaal, ein Billardsalon, eine Diskothek und ein Billig-Discounter. Auf der gegenüberliegenden Seite (Oranienplatz 2) ist u.a. das bezirkliche Jugendamt in Räumen untergebracht, die Max Taut 1927 für das erste Warenhaus der gewerkschaftlichen Konsum-Genossenschaft entworfen hatte. Es existierte bis 1935, als sich nach der Zerschlagung der Gewerkschaften die nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront des Gebäudes bemächtigte. Nur „Kuchen Kaiser" an der Nordseite des Platzes (Nr. 11-13) knüpft seit Anfang 1998 zumindest dem Namen nach an die Tradition einer legendären Konditorei an gleicher Stelle an. In der Oranienstraße, die vor dem Krieg auch „Kudamm des Osten" genannt wurde, befanden sich außerdem die in Berlin führenden Oberbekleidungsgeschäfte Maassen (164/65) und Heitinger & Co. (Nr. 165a), das Stammhaus des Warenhauskonzerns A. Wertheim (Nr. 53/54) und das „Hermann Leiser Schuhwaren"-Geschäft des Julius Klausner (Nr. 34), der 1898 aus Galizien nach Berlin gekommen war und von seinem Onkel Hermann Leiser Geld zur Eröffnung eines Schuhlagers geliehen hatte (Heute befindet sich dort ein türkischer Supermarkt und im Hof der „Familiengarten", das Nachbarschaftszentrum des Kotti e.V.). Noch immer ist die Oranienstraße vor allem Einkaufsstraße. In den letzten Jahren entwickelte sie sich auch zu einer Büchermeile. Einmal im Jahr und einzigartig in Berlin veranstalten die in der Straße ansässigen Antiquariate, Buchhandlungen, Verlage und Bibliotheken die „Lange Nacht des Buches", ein großes Treffen von Schriftstellern, Journalisten und deren Lesern. Folgt man vom Oranienplatz dem Fußweg im schon seit 1927 zugeschütteten Luisenstädtischen Kanal nach Norden, kann man nach wenigen Metern links die Bronzebüste des Gewerkschaftsführers Carl Legten (1861 -1920) im Gebüsch entdecken. Eine der beiden früheren Uferpromenaden ist nach ihm benannt, die andere nach dem Politiker und Gewerkschafter Wilhelm Leuschner (1890 -1944), den die Nazis als Angehörigen der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis" ermordeten. Das Gedenken an dieser Stelle verweist auf die Nähe zur ersten Berliner Gewerkschaftszentrale (fertiggestellt im Jahr 1900. Das rote Backsteingebäude steht am Engeldamm 62 im Bezirk Mitte; zu DDR-Zeiten war es „Krankenhaus Mitte", jetzt wird nach langem Streit um die Eigentumsrechte ein solventer Mieter gesucht). Das Kopfgebäude der ehemaligen Markthalle VII (Legiendamm 32) beherbergt die Gaststätte „Kleine Markthalle", die ebenso wie die nur einen Steinwurf entfernte „Henne" an der Ecke Waldemarstraße / Leuschnerdamm überregionale Berühmtheit wegen ihrer Brathähnchen erlangt hat. Beide sind nur abends geöffnet. Zwischen den beiden Gaststätten steht ein langgestreckter Bau, in dessen Putz ein großes verblichenes christliches Kreuz erkennbar ist. Die methodistische Kirche wurde 1998 von Berliner Vereinigung der anatolischen Aleviten gekauft. Die religiöse Minderheit der Aleviten wird in der Türkei von der Sunnitenmehrheit ignoriert, teilweise auch verfolgt. Aleviten sind laizistisch und demokratisch ausgerichtet und zeichnen sich durch Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen aus sowie durch ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Das wichtigste religiöse Ritual der Aleviten heißt CEM. Tänze, Gesang und vor allem die Musik der Langhalslaute Saz spielen darin eine große Rolle. 5 Die Waldemarbrücke unterquerend gelangt man in einen sehr gepflegten Abschnitt der neuen Grünanlage im Kanalbett. Sie gehört bereits zum Bezirk Mitte, war Teil des hier sehr breiten Grenzstreifens zwischen der „Hinterland"- und der „Vorderlandmauer" und wurde erst in den letzten Jahren nach historischem Vorbild aus den dreißiger Jahren rekonstruiert - man beachte insbesondere den indischen Brunnen, der anders als die Kreuzberger Brunnen auch mit Wasser gespeist wird. Linkerhand warten neu errichtete Wohn- und Geschäftsbauten auf weitere Nutzer und Mieter. Im Baufieber der Nachwendezeit haben die Investoren den Bedarf an Neubauten an dieser Stelle offensichtlich überschätzt. Wer die Mieten aufbringen kann, siedelt lieber anderswo in der Stadt als gerade hier im Schnittfeld zwischen Kreuzberg und Mitte, das auch zehn Jahre nach der politischen Wende seltsam zerrissen wirkt. Neue Urbanität will sich nicht einstellen. Auch die katholische St. Michaelgemeinde verharrt freiwillig im zunächst erzwungenen Zustand der Zerrissenheit: Der Kreuzberger Gemeindeteil nutzt eine BetonBehelfskirche am linkerhand gelegenen Alfred-Döblin-Platz, die Katholiken aus Mitte behelfen sich mit der Ruine der ehemaligen Garnisonskirche St. Michael (1853-56 nach Entwurf von Soller), die dem wüsten Gelände um das ehemalige Engelbecken immerhin so etwas wie Gestalt verleiht. Wieder zueinander gefunden haben die beiden Gemeindeteile nach dem Mauerfall nicht - zu unterschiedlich war ihre Entwicklung in der Zeit der Teilung. Nur auf alten Aufnahmen ist der einstige Charme dieser Gegend noch erkennbar. Viele Kreuzberger erinnern sich an Eislauf-Vergnügen auf dem Engelbecken, einem künstlichen See im Verlauf des Kanals. Obwohl von der die beiden Bezirke bis 1990 trennenden Mauer so gut wie nichts übriggeblieben ist, will hier einfach nicht „zusammenwachsen, was zusammen gehört". Nach der willkürlichen politischen Entscheidung, den Bezirk Kreuzberg nicht - wie es nahegelegen hätte - mit dem Bezirk Mitte zu vereinigen, sondern mit dem auf der anderen Spreeseite gelegenen Bezirk Friedrichshain, besteht noch weniger Hoffnung auf ein Anknüpfen an die städtebauliche Tradition der alten Luisenstadt, die durch die Bezirksreform von 1920 und mehr noch durch die Mauer in zwei Teile zerfiel. Das Mauerbollwerk zog sich über Waldemarstraße und Waldemarbrücke und folgte dann dem Verlauf des Leuschnerdamms und Bethaniendamms. Genaugenommen befanden sich die Bewohner der Mietshäuser am Leuschnerdamm schon, wenn sie aus der Haustür traten, auf dem Gebiet des sowjetischen Sektors. Denn die Grenze zwischen den Sektoren führte direkt an der Hausfassade entlang. Die Mauer stand nur einige Meter nach Osten versetzt; sie ließ einen schmalen Zugang zu den Kreuzberger Mietshäusern frei. West-Berliner Offiziellen, sprich Postboten, Polizei und Gerichtsvollziehern, war die Passage aber nicht gestattet. Kein Wunder, dass gemunkelt wurde, die Wohnungen in diesem Abschnitt des Leuschnerdamms stellten eine willkommene Wohnadresse für zwielichtige Gestalten dar, konnten sie doch vor Strafverfolgung, Pfändungen usw. sicher sein. Die Gasse zwischen Mauer und Hausfassaden ließ auch keinen Lieferverkehr zum eindrucksvollen EngelbeckenGewerbehof (Leuschnerdamm 13) mehr zu. Ein Durchbruch durch Hinterhöfe zur Adalbertstraße ermöglichte Ende 1961 wieder die Zufahrt. Inzwischen wurde diese Öffnung erneut zugemauert und der sehenswerte Gewerbehof ist über seinen alten Haupteingang erreichbar. Der Spaziergang durch SO 36 führt weiter über das Gelände eines Kinderbauernhofes im Winkel von Bethaniendamm und Adalbertstraße (Zugang hinter dem Haus Bethaniendamm 61). Zischende Gänse, meckernde Ziegen und grasende Pferde bevölkern diese Insel bäuerlichen Lebens mitten in der Großstadt. Der Kinderbauernhof ging 1981 6 aus einer Initiative von Besetzern der angrenzenden, damals leerstehenden Mietshäuser hervor. Kreuzberger Kinder, die vielfach noch nie eine Ziege oder ein Schwein „live" gesehen hatten, übernahmen mit Begeisterung die Pflege und Fütterung des Viehs, ritten auf den Ponys nicht nur in der Koppel umher, sondern auch schon mal bis zum Mariannenplatz, wo sie die Tiere stehen ließen und den herbeigerufenen Polizisten Gelegenheit gaben, mit Lassos Cowboy zu spielen und die Tiere wieder einzufangen. Fast zwanzig Jahre lang wehrten sich die Kinderbauern erfolgreich gegen eine Bebauung des Brachgeländes. Noch vor wenigen Jahren schlugen sie einen Gebietsaustausch mit dem an das Gelände grenzenden Bezirk Mitte vor, um dem Verantwortungsbereich der ihnen nicht immer wohlgesonnenen Kreuzberger Politiker und Stadtplane zu entkommen. Der große Komplex des ehemaligen Diakonissen-Krankenhauses Bethanien erstreckt sich von der gegenüberliegenden Seite der Adalbertstraße bis zum Mariannenplatz. Zunächst fällt der Blick auf das backsteinerne „Seminargebäude" (Adalbertstraße 23). Dessen verglaste Dachterrassen, so heißt es, seien wegen ihrer Lage in luftiger Höhe und nahe der Sonne ein „Kreuzberger Davos" für Tuberkulosekranke gewesen. Die Tuberkulose war in den Beniner Arbeiterbezirken besonders gefürchtet, weil sie vor Entdeckung des Penicillins praktisch nicht behandelt werden konnte. Die Krankenkassen machten zurecht die unzulänglichen und beengten Wohnverhältnisse in den Mietshäusern für ihr Ausbreiten verantwortlich. Ignaz Zadek, ein sozialdemokratischer Stadtverordneter und Arzt mit Praxis in der Oranienstraße 158, gab in der Schriftenreihe „Arbeitergesundheitsbibliothek" unter dem Titel „Die Proletarierkrankheit" einen vielgelesenen Tuberkulose-Ratgeber heraus. Folgt man dem Weg am Mauerstreifen entlang, gelangt man zu einem weiteren Gebäude des Bethanien-Komplexes, dem „Martha Maria Haus", einem ehemaligen Schwesternwohnheim, das unter dem Namen „Rauch-Haus" als erstes besetztes Haus Berlins Geschichte gemacht hat. Im Dezember 1971 drangen 150 Schüler, Lehrlinge, Arbeitslose und Trebegänger in das große leerstehende Gebäude ein und benannten es nach Georg von Rauch, einem Absolventen der angesehenen Lübecker „Gelehrtenschule", der in Berlin zum Sympathisanten der Rote-Armee-Fraktion (RAF) geworden und durch den Schuss eines West-Berliner Kripobeamten ums Leben gekommen war. Bei der Besetzung des war die Agit-Rock-Gruppe „Ton, Steine, Scherben" zugegen, deren „Rauch-HausSong" bis heute die Hymne aller Hausbesetzer ist. Die „Scherben" pflegten zum Abschluss ihrer Konzerte die Adresse eines leerstehenden Hauses bekannt zu geben, woraufhin die Fan-Gemeinde zur Tat schritt... Das Rauch-Haus ist übrigens bis heute ein unter (bestimmten) Jugendlichen international bekanntes Wohnprojekt in Selbstverwaltung. Im Garten entstand vor einigen Jahren zusätzlich die „Rollheimer"-Siedlung „Kreuzdorf". Nachdem sich die West-Berliner Behörden allmählich mit dem Projekt abgefunden und es quasi legalisiert hatten, forderte die Hausgemeinschaft Anfang der achtziger Jahre die Staatsmacht der DDR heraus. Die Besatzung eines nur etwa zwanzig Meter entfernten Beobachtungsturmes auf dem Mauerstreifen war bei Sonnenschein den SpiegelBlendattacken der Rauchhäusler schutzlos ausgeliefert, so dass sie den Turm schließlich aufgab, abreißen ließ und etwas weiter östlich neu errichtete. Die Bewohner der DDRSozialwohnungsbauten auf der anderen Seite des Grenzstreifens, die nächsten Nachbarn der Besetzer, fühlten sich belästigt durch stundenlange Beschallung aus großen Lautsprecherboxen. Die Rauchhäusler spielten für sie alte Ernst-Busch-Schallplatten mit Arbeiterliedern, die Internationale und -immer wieder - „Der Rote Wedding marschiert'. 7 Anzeigen wegen ruhestörenden Lärms, die nach wochenlangem Umweg über das Außenministerium der DDR und das Bonner Jugendministerium irgendwann den Beniner Senat erreichten, verliefen aber im Sande. Das Hauptgebäude des Bethanien, seit 1974 Kulturzentrum, liegt am ebenfalls von PeterJoseph Lenné geplanten Mariannenplatz und wird flankiert von der neoromanischen evangelischen Thomaskirche, einer der größten Kirchen Berlins (1864 -1869 errichtet nach Plänen von Adler). Nach aufwendiger Restaurierung wartet sie jetzt auf eine neue Nutzung, denn der heute kleinen Gemeinde reicht das nahegelegene Gemeindehaus. Das Bethanien war eines der ersten Gebäude auf dem Köpenicker Feld südöstlich Berlins. Errichtet wurde es 1847 nach Entwürfen des Schinkel-Schülers Ludwig Persius. Das Mutterhaus steht in Düsseldorf - Kaiserswerth. Als Diakonissen-Anstalt galt es zunächst der Ausbildung von Schwestern im „Dienst für den Herrn", bald aber überwog die Versorgung von Kranken. Der Bethanien-Chirurg Robert Wilms steht als Bronzebüste auf einem Sandsteinsockel vor dem Gebäude. Die schwere hölzerne Eingangstür gibt den Weg frei zur denkmalgeschützten Eingangshalle, und obwohl die letzten Schwestern und Patienten schon vor 30 Jahren (1970) das Haus verließen, meint man bis heute etwas zu spüren von dem strengen pietistischen Geist, der die Institution prägte. In den langen, zwar weiß gestrichenen, aber trotzdem bedrohlich wirkenden Fluren fühlt man sich als Eindringling und erwartet, dass jeden Augenblick eine Diakonisse in dunkler Tracht um die Ecke biegt und einen misstrauisch mustert. Recht freundlich hat Theodor Fontane, 1848 der erste Apotheker der Diakonissenanstalt, die Atmosphäre im Bethanien erlebt: „Ein Sonnenstrahl des Glücks hat mich getroffen!", notierte er, „Ich bin in Bethanien bei freier Wohnung und Station... Nur während zweier Mittagsstunden habe ich in der Apotheke zu arbeiten, die übrige Zeit ist mein..." Und: „Mein Leben mit den Diakonissen ist ein Idyll, wie's schöner nicht gedacht werden konnte." Fontane erinnert sich, wie er am Tag seines Dienstantritts durch die langen Flure im Erdgeschoss zu einem hohen Eckzimmer geführt wurde, in dem sich die Apotheke befand. Erstaunlich genug: Sie befindet sich noch heute dort, und ihr Originalmobiliar kann durch eine gläserne Zugangstür jederzeit besichtigt werden. Von dem Inventar der Krankenhauskapelle (heute: Studio l), der Operationssäle und Krankenzimmer hat sich dagegen nichts erhalten. Seit 25 Jahren nutzen verschiedene soziale und kulturelle Einrichtungen den riesigen Gebäudekomplex, der als „Künstlerhaus Bethanien" einen weit über Berlin hinausreichenden Ruf zu verteidigen hat. Die Musikschule und das Kunstamt Kreuzberg mit seinen Ausstellungsräumen, die türkische Namik-Kemal-Bibliothek, Ateliers, Werkstätten und Studios der Künstlerhaus Bethanien GmbH und des Berufsverbandes Bildender Künstler, ein Seniorenzentrum, das Sozialamt und verschiedene Jugendeinrichtungen verteilen sich über die einzelnen Etagen und Nebengebäude. Eine kulturelle Vielfalt, die Anfang der siebziger Jahre in langen Kämpfen dem Berliner Senat abgetrotzt und gegen Abrisspläne durchgesetzt wurde. Die „KünstlerFraktion" hatte sich dabei auch durchzusetzen gegen die mit Vehemenz vorgetragene und in großen Demonstrationen untermauerte Forderung nach einer neuen Poli- und Kinderklinik für das medizinisch unterversorgte SO 36. Am letzten Augustsonntag eines jeden Jahres findet im Garten und in fast allen Räumen des ehemaligen Krankenhauses ein großes Sommerfest statt, eine Art „Werkschau" der Kreuzberger Kulturszene vom frühen Nachmittag bis zum frühen Morgen des nächsten Tages. Den Garten nutzt in den Sommermonaten darüber hinaus ein Freiluftkino. Am nördlichen Mariannenplatz erinnert neben einem Toilettenhäuschen eine Bronzetafel 8 des Bildhauers Nikolaus Langhans an den Rentner Wilhelm Lehmann, der im August 1942 an die Innenwand einer damals dort stehenden Bedürfnisanstalt die Worte „Hitler, du Massenmörder musst ermordet werden, dann ist der Krieg zu Ende" gekritzelt hatte. Sie kosteten ihn das Leben. Aufgrund einer Denunziation wurde er vom „Volksgerichtshof" zum Tode verurteilt und am 10. Mai 1943 in Plötzensee hingerichtet. Ein wenig weiter wird neben dem früheren Leibniz-Gymnasium (Mariannenplatz 28, heute NürtigenGrundschule) der Schüler gedacht, die im Ersten Weltkrieg fielen. „Dulce et decorum est pro patria mori", heißt es dort. Eine weitere Tafel liefert die Übersetzung: „Es ist süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben" und distanziert sich gleichzeitig: „Mit diesem Spruch wurden in der Vergangenheit junge deutsche Männer auf den sogenannten Heldentod vorbereitet. Die Bezirksverordnetenversammlung Kreuzberg fordert demgegenüber im UN-Jahr des Friedens 1986: Nie wieder Krieg." Der Feuerwehrbrunnen von Kurt Mühlenhaupt (1983) am Südrand des Platzes bezieht sich auf ein im Krieg zerstörtes Denkmal von 1902 zur Erinnerung an den aufopferungsvollen Einsatz der Berliner Feuerwehrleute und ergänzt eine ebenfalls auf „Feuer" bezogene Reliefwand von 1960 auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Durch einen Zugang in der Waldemarstraße 62/64 gelangt man in einen „entkernten" Block-Innenbereich, ein Beispiel für die etwas moderatere Form der Stadtsanierung in den späten siebziger Jahren, die immerhin die Blockrandbebauung respektierte bzw. sie durch Neubauten ersetzte. In dem großen gepflasterten Hof hat ein altes Ballhaus von 1867 die Zeiten überdauert. Nach aufwendiger Sanierung ist es seit 1983 Spielstätte des Kunstamtes Kreuzberg (Naunynstr. 27, lohnende Innenbesichtigung nur an den Veranstaltungsabenden, Programmansage unter Tel. 2588-6644). Über die Naunynstraße (eindrucksvolles Wandgemälde im Hof der Nr. 65/65a) und die Mariannenstraße (Frauen-Stadtteilzentrum „Schokoladenfabrik" mit dem türkischen Bad „Hamam" in Nr. 6) gelangt man zum Heinrichplatz, einem von Revolutionsmythen umrankten kleinen Platz, der so etwas wie das Herz von SO 36 darstellt. Westdeutsche Polit-Touristen versammelten sich hier in den achtziger Jahren schon Tage vor den traditionellen l. Mai-Demonstrationen, und Presseund Fernsehreporter fielen in Scharen ein, wenn nur das Gerücht umging, es könne sich in SO 36 etwas „zusammenbrauen". Die Enttäuschung war groß, wenn sie dann nur einige schwäbische Punks antrafen, die auf Mülltonnen wilde Rhythmen trommelten. „Bin im Jenseits" hinterlassen die Anwohner die Nachricht auf ihren Anrufbeantwortern, bevor sie das gleichnamige Cafe am Heinrichplatz aufsuchen, um dann später in den „Elefanten" oder die „Rote Harfe" zu wechseln. Das ehemalige Kino „SO 36" in der Oranienstraße 190 ist bekannt für seine schrägen Diskos und attraktiven Musikveranstaltungen. Vom Heinrichplatz aus gelangt man über Oranienstraße und Wiener Straße zum Gelände des einstigen Görlitzer Bahnhofes, der nach der Teilung Berlins seine Funktion verlor und 1959 abgerissen wurde. Unterwegs sieht man rechts die Ruinenreste des während der MaiKrawalle 1987 geplünderten und dann abgebrannten „Bolle"-Supermarktes. Auf dem Bahnhofsgelände entstand in zwanzigjähriger Planungs- und Bautätigkeit der Görlitzer Park, die größte Naherholungsfläche im Kiez. 1998 wurde der imposante PamukkaleBrunnen eingeweiht. Wer Kreuzberg an schönen Tagen im „Freizeitzustand" erleben möchte, der ist hier richtig: Fußballspielen und Fahrradfahren, Trommeln und Musizieren, Radfahren und Flanieren, Hunde ausführen und Ziegen füttern, die Seele baumeln und Drachen steigen lassen, Lammkoteletts grillen und Salate zubereiten, Bier aus Büchsen 9 trinken und Joints aus der Wasserpfeife rauchen - der Görlitzer Park kennt dies alles auf einmal und auf engstem Raum. Das moderne „Spreewaldbad" mit der intelligenten AntiGraffito-Fassade ist vor allem im Winter ein Anziehungspunkt. Nebenan trainieren Kinder und jugendliche Artisten im Zelt des Cabuwazi-Zirkus'. Gegenüber vom Hallenbad zweigt die Ohlauer Straße von der Wiener Straße ab und führt zum Landwehrkanal. Auf der linken Seite (Nr. 5-11) steht die Stammfabrik des bekannten Klavier- und Flügelherstellers C. Bechstein, der Kreuzberg vor wenigen Jahren verlassen hat und jetzt in Thüringen produzieren lässt. Lohnenswert ist ein Blick in den sanierten Hof und in die im Vorderhaus untergebrachte Tauchschule! Das weiter südlich gelegene Hofgebäude Ohlauer Straße 39/41 war die erste städtische Desinfektionsanstalt in Deutschland, errichtet im Jahr 1886. Immer wenn ansteckende Krankheiten wie Diphterie, Cholera, Pocken, Typhus und Scharlach gemeldet wurden, rückten die Desinfektoren mit ihren „Effektenwagen" aus, um alles, was in den Wohnungen der Kranken nicht niet- und nagelfest war, abzuholen und im Wasserdampf der Desinfektionsanstalt zu desinfizieren. Die leeren Wohnungen wurden mit Formalin ausgeräuchert. Das Archiv des Kreuzberg-Museums (Adalbertstraße 95 am Kottbusser Tor) bewahrt einige der damals häufig eingesetzten Formalinverdampfer aus Messing auf. Allein in den Jahren 1894 und 1895 reinigten 93 Desinfektoren 4868 Wohnungen mit 10 372 Zimmern und 318 060 Einzelstücke. Hinter dem benachbarten ehemaligen Umspannwerk der BEWAG biegt ein beliebter Wander- und Radweg am Ufer des Landwehrkanals ab. Links gelangt man bald zu einem selbstorganisierten Boule-Platz, rechts zu den Gartencafes an der Kottbusser Brücke. An schönen Tagen lässt sich in der „Klassik-Bar" und im „Cafe am Ufer" kaum Platz zum Frühstücken finden, ebenso eng wird es abends in der gegenüberliegenden „Ankerklause". Ihr Name verweist auf die Anlegestelle der Reederei Riedel gleich nebenan (von hier gibt es Schifffahrten spreeaufwärts zum Müggelsee und weiter). An dem schon zum Bezirk Neukölln gehörenden Ufer des Landwehrkanals findet Dienstags und Freitags an Nachmittagen ein großer Wochenmarkt statt, der „Türkenmarkt" am Maybachufer. Die Kottbusser Straße überquerend gelangt man zu der 1913-16 von Alexander Beer entworfenen orthodoxen Synagoge am Fraenkelufer 10-16 (Gedenkstein). Das in der Pogromnacht 1938 von Nazis verwüstete und im Krieg schwer beschädigte Hauptgebäude wurde 1958 abgerissen. Es bot Platz für 2000 Männer und Frauen, die den Gottesdienst nach den traditionellen Riten feierten, wie sie vor allem von den sogenannten ,Ostjuden' gepflegt wurden, die vor den Pogromen in Russland und Polen seit dem späten 19. Jahrhundert nach Berlin geflohen waren. Die heutige Synagoge ist die frühere Jugend- und Wochentagssynagoge. Seit einigen Jahren wächst die Gemeinde, vor allem wieder durch Zuwanderung russischer Juden. Von der Admiralbrücke aus hat man einen schönen Blick auf den Urbanhafen - vor allem bei Sonnenuntergang. Vorn die Restaurantschiffe „Iskele" und „Theaterschiff Tau", dahinter das trotz hoher Leistungsfähigkeit abwicklungsgefährdete Urban-Krankenhaus, das einzige in Kreuzberg. Rechts, am Fraenkelufer 40-44 ein Beispiel für das „postmoderne" Kreuzberg: eigenwilliger sozialer Wohnungsbau, entworfen von dem Architektenehepaar Hinrich und Inken Baller als Projekt der Internationalen Bauausstellung 1984/87 - beachtenswert vor allem auch die Brandwandbebauung im Hof! Durch die Admiralstraße führt der Weg zurück zum Kottbusser Tor. Im vorderen Bereich der Straße sind einige phantasievoll restaurierte Altbauten erhalten, aber auch nur deshalb, 10 weil sie Anfang der achtziger Jahre widerrechtlich von jungen Leuten besetzt wurden. Sonst sähe es in der Admiralstraße heute überall so aus wie in ihrem nördlichen Abschnitt. Und der sich einmal stündlich drehende „Admiral mit Doppelgänger", ein humorvolles Kunst-am-Bau-Projekt der Bildhauerin Ludmila Seefried-Matejkova aus dem Jahr 1985, müsste mit seinem Fernglas vergeblich nach Resten der alten Admiralstraße suchen. 11