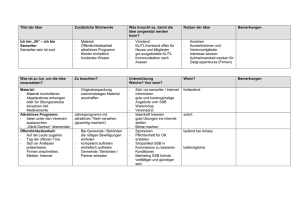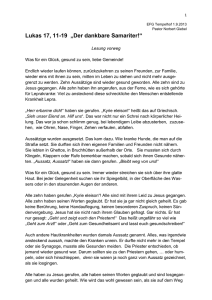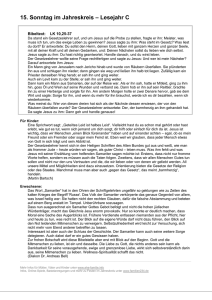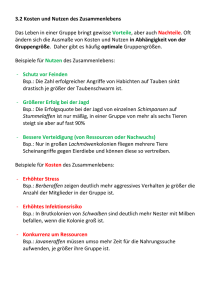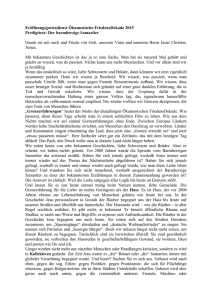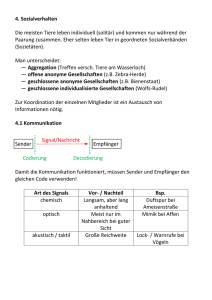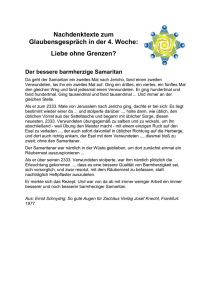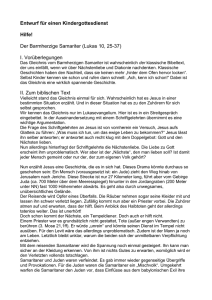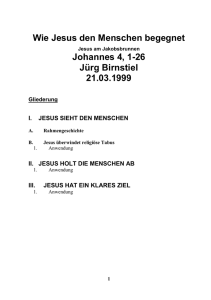Ich denke, wir alle kennen sie - die Geschichte vom barmherzigen
Werbung
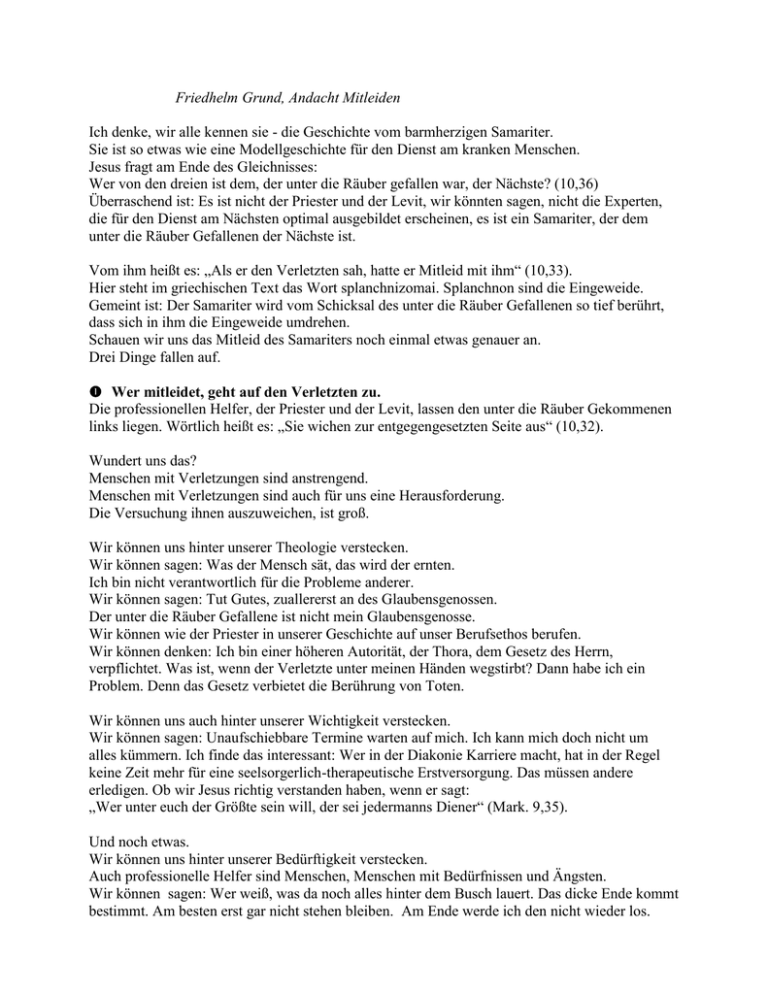
Friedhelm Grund, Andacht Mitleiden Ich denke, wir alle kennen sie - die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Sie ist so etwas wie eine Modellgeschichte für den Dienst am kranken Menschen. Jesus fragt am Ende des Gleichnisses: Wer von den dreien ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste? (10,36) Überraschend ist: Es ist nicht der Priester und der Levit, wir könnten sagen, nicht die Experten, die für den Dienst am Nächsten optimal ausgebildet erscheinen, es ist ein Samariter, der dem unter die Räuber Gefallenen der Nächste ist. Vom ihm heißt es: „Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm“ (10,33). Hier steht im griechischen Text das Wort splanchnizomai. Splanchnon sind die Eingeweide. Gemeint ist: Der Samariter wird vom Schicksal des unter die Räuber Gefallenen so tief berührt, dass sich in ihm die Eingeweide umdrehen. Schauen wir uns das Mitleid des Samariters noch einmal etwas genauer an. Drei Dinge fallen auf. Wer mitleidet, geht auf den Verletzten zu. Die professionellen Helfer, der Priester und der Levit, lassen den unter die Räuber Gekommenen links liegen. Wörtlich heißt es: „Sie wichen zur entgegengesetzten Seite aus“ (10,32). Wundert uns das? Menschen mit Verletzungen sind anstrengend. Menschen mit Verletzungen sind auch für uns eine Herausforderung. Die Versuchung ihnen auszuweichen, ist groß. Wir können uns hinter unserer Theologie verstecken. Wir können sagen: Was der Mensch sät, das wird der ernten. Ich bin nicht verantwortlich für die Probleme anderer. Wir können sagen: Tut Gutes, zuallererst an des Glaubensgenossen. Der unter die Räuber Gefallene ist nicht mein Glaubensgenosse. Wir können wie der Priester in unserer Geschichte auf unser Berufsethos berufen. Wir können denken: Ich bin einer höheren Autorität, der Thora, dem Gesetz des Herrn, verpflichtet. Was ist, wenn der Verletzte unter meinen Händen wegstirbt? Dann habe ich ein Problem. Denn das Gesetz verbietet die Berührung von Toten. Wir können uns auch hinter unserer Wichtigkeit verstecken. Wir können sagen: Unaufschiebbare Termine warten auf mich. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Ich finde das interessant: Wer in der Diakonie Karriere macht, hat in der Regel keine Zeit mehr für eine seelsorgerlich-therapeutische Erstversorgung. Das müssen andere erledigen. Ob wir Jesus richtig verstanden haben, wenn er sagt: „Wer unter euch der Größte sein will, der sei jedermanns Diener“ (Mark. 9,35). Und noch etwas. Wir können uns hinter unserer Bedürftigkeit verstecken. Auch professionelle Helfer sind Menschen, Menschen mit Bedürfnissen und Ängsten. Wir können sagen: Wer weiß, was da noch alles hinter dem Busch lauert. Das dicke Ende kommt bestimmt. Am besten erst gar nicht stehen bleiben. Am Ende werde ich den nicht wieder los. Ich habe in meiner Ausbildung viele kluge Dinge gelernt über gesundes Selbstmanagement, eine gesunde Helfer-Patient-Beziehung, die Bedeutung von Eigenverantwortung und Abgrenzung. Aber vielleicht muss ich wieder etwas ganz anderes lernen. Helfen beginnt nicht mit dem Weggehen - das Weggehen erfolgt irgendwann im Prozess des Helfens, nicht am Anfang. Helfen beginnt damit, dass ich erste Schritte auf den Verletzten zugehe. Der Samariter weiß: Der „unter die Räuber Gefallene” kann nicht mehr aufstehen. Da ist nicht mehr viel mit „Ressourcenaktivierung”. Man hat ihm nicht nur den Geldbeutel sondern auch alle Kraft geraubt. Menschen, die unter die Räuber gefallen sind, warten auf ein Zeichen der Zuwendung Der Samariter weiß das. Er schaut nicht im Lehrbuch für professionelle Lebenshilfe nach, was er tun darf. Er geht einfach auf den Bedürftigen zu. Und mehr noch. Er nimmt sich für ihn Zeit. Das ist das zweite, was mir am Mitleid des Samariters auffällt. Wer mitleidet, begleitet den Verletzten eine Zeit. Eine Zeit lang heißt nicht ein ganzes Leben lang. Jesus verlangt von uns nicht, dass wir Menschen, die unsere Hilfe brauchen, ein ganzes Leben lang mit uns herumschleppen. Aber wir können vielleicht „unter die Räuber Gekommene” bis zur nächsten Herberge tragen. Die Herberge ist für mich ein Bild für einen geschützten Raum, wo Gott heilend eingreifen kann. Als Helfer muss ich mir vor Augen halten: Ich kann einen wichtigen Beitrag zur Gesundung des Bedürftigen leisten. Ich kann Öl auf die Wunden gießen, was vielleicht das Gegenteil von dem ist, wenn ich Selbiges ins Feuer gieße. Ich kann erste Hilfe leisten und Wunden verbinden, jemanden ausreden oder weinen lassen, die Arbeit für einen Augenblick liegen lassen und zuhören. Ich kann ihn auf mein Reittier heben und ihn in die Herberge bringen, jemanden an einen sicheren Ort bringen, wo Heilung möglich ist. Ich kann all diese Samariterdienste tun, der Herbergsvater kümmert sich um den Rest. Die Herberge ist für mich der Ort, wo Wunden, die wir Menschen nicht heilen können, ausheilen dürfen. Jesus hat uns dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter ja erzählt, um deutlich zu machen: Er selbst ist der barmherzige Samariter. Er bringt uns dahin, wo wir heil werden können. Und noch etwas fällt mir auf. Wer mitleidet, macht sich selbst verletzlich. Der Samariter lässt das Leid des unter die Räuber Gefallenen ganz nah an sich ran. In ihm drehen sich die Eingeweide um. Eingeweide sind nach hebräischem Verständnis der Ort der verwundbarsten Gefühle. Der Samariter macht sich selbst für einen Verletzten verletzlich. Ist das nicht gefährlich? Muss der professionelle Helfer nicht Distanz wahren? Wie verwundbar darf er sich überhaupt zeigen in einem therapeutischen Settung? Paul Tournier hat einmal gesagt: „Ich habe ein Tagleben, wo ich dem Menschen als Arzt begegnet bin und ein Nachtleben, wo ich dem Menschen als Mensch begegnet bin.” Er nahm sich regelmäßig Zeit für Kaminfeuerabende mit seinen Patienten und teilte mit ihnen sein Leben. Kann man das zur Nachahmung empfehlen? Wir sind es gewohnt, uns als Helfer festlegen zu lassen auf die Rollen, die wir zu spielen haben. Der Geistliche predigt, der Arzt entscheidet über Medikamente, der therapeutische Mitarbeiter begleitet den therapeutischen Prozess. Aber ein Mitarbeiter in einem therapeutischen Setting ist mehr als das, was er tut. Er ist selbst ein verletzlicher Mensch. Wenn der bedürftige Mensch in mir mehr sieht als meine Funktion, meinen Job, dann kann ich mich mit ihm auf einer tieferen Ebene verständigen. Ich kann für ihn Person werden. In dem Wort Person steckt das Wort durch und das Wort Klang. In einer persönlichen Begegnung klingen wir durch, sind wir offen und transparent voreinander, ohne taktische Winkelzüge, ohne manipulierende Autorität. Ich habe es immer wieder erlebt: Begegnungen, die persönlich werden, haben etwas Heilendes. Jesus sagt: „Selig sind die geistlich Armen“ (Matth. 5,3). Er sagt nicht: Selig sind die, die sich um die geistlich Armen kümmern. Das ist auch nicht verkehrt. Aber das Himmelreich öffnet sich noch mal für uns in besonderer Weise, wo wir begreifen: Wir sind selbst arm. Der Samariter in unserer Geschichte ist in gewisser Hinsicht auch ein „unter die Räuber Gekommener”. Die Juden verachteten Menschen wie ihn. Samariter wurden mit ihrer Frömmigkeit nicht ernstgenommen, als Abweichler stigmatisiert. Ich bin der festen Überzeugung: Menschen, die Zugang zu ihrer eigenen Bruchstückhaftigkeit haben, helfen anders, setzen oft unbewusst heilende Wirkkräfte frei. Ich beschäftige mich schon länger mit der Frage: Was ist eigentlich gesund? Und was ist krank? Ich sehe so viel Krankes unter den Gesunden. Ich sehe, wie wir als die „Nichtkranken” gekonnt unsere gesunden Anteile inszenieren und dafür sorgen, dass Leben gelingen kann - bei anderen. Und was ist mit dem, was uns nicht gelingt? Müssen wir das hinter unserem professionellen Handwerk verstecken? Gleichzeitig staune ich, was in der Klinik, in der ich arbeite, durch kranke Menschen geschieht. Manchmal erzählen mir Patienten, dass sie sich das erste Mal in ihrem Leben richtig verstanden fühlen. Und wenn ich dann frage, wie es dazu kam, dann sagen erstaunlich wenige Patienten: Ihre Andachten oder der Rat meines Therapeuten oder die Ermutigung durch Mitarbeiter auf Station. Weitaus mehr sagen: Ein Mitpatient hat mit mir gebetet, Jemand ist mit mir durch den Park gegangen, Jemand hat mich in den Arm genommen. Ich sehe kranke Menschen in unserer Klinik, die anderen Kranken Samariterdienste tun. Sie sitzen oft da und hören zu, sie singen und beten mit ihnen. Oft ist die Theologie dieser Menschen genau so krank wie die Menschen selbst, aber das hindert Gott nicht, durch diese Menschen zu reden und zu wirken. Manchmal denke ich, dass diese Patienten die Welt Gottes und ihre spirituellen Geheimnisse tiefer erfasst haben, als ihnen das bewusst ist. Jesus sagt: „Selig sind die geistlich Armen.“ Gott segnet Menschen, die um ihre Bedürftigkeit wissen und sich von ihm in ihrer Gebrochenheit gebrauchen lassen. Wenn wir zusammenkommen in gemeinsamer Armut, in gemeinsamer Verletzlichkeit, dann können wir geben und empfangen, ganz sicher müssen wir uns auch an der ein oder anderen Stelle abgrenzen - keine Frage, aber wir bleiben füreinander Personen, Menschen, die nicht was anderes sein wollen, als sie sind. Und das hat immer was Heilendes. Amen.