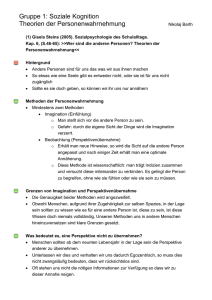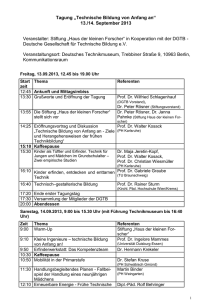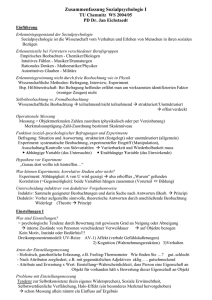Attraktivitätsforschung - Die Schönheit der Frau aus Sicht der Evolution
Werbung
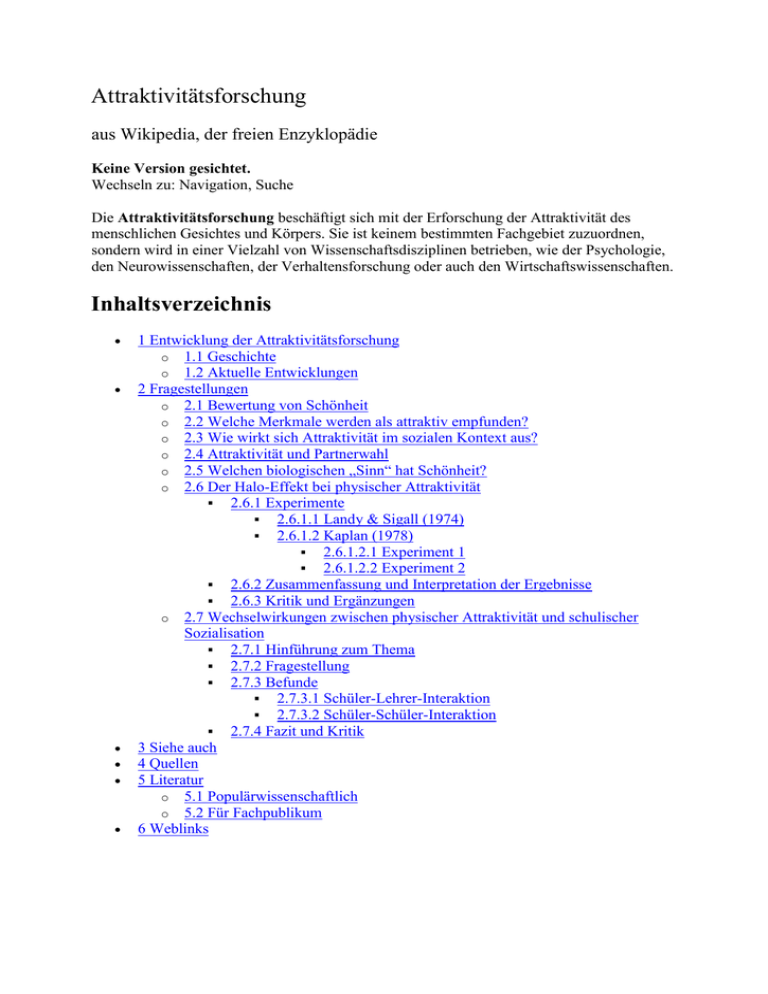
Attraktivitätsforschung aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Keine Version gesichtet. Wechseln zu: Navigation, Suche Die Attraktivitätsforschung beschäftigt sich mit der Erforschung der Attraktivität des menschlichen Gesichtes und Körpers. Sie ist keinem bestimmten Fachgebiet zuzuordnen, sondern wird in einer Vielzahl von Wissenschaftsdisziplinen betrieben, wie der Psychologie, den Neurowissenschaften, der Verhaltensforschung oder auch den Wirtschaftswissenschaften. Inhaltsverzeichnis 1 Entwicklung der Attraktivitätsforschung o 1.1 Geschichte o 1.2 Aktuelle Entwicklungen 2 Fragestellungen o 2.1 Bewertung von Schönheit o 2.2 Welche Merkmale werden als attraktiv empfunden? o 2.3 Wie wirkt sich Attraktivität im sozialen Kontext aus? o 2.4 Attraktivität und Partnerwahl o 2.5 Welchen biologischen „Sinn“ hat Schönheit? o 2.6 Der Halo-Effekt bei physischer Attraktivität 2.6.1 Experimente 2.6.1.1 Landy & Sigall (1974) 2.6.1.2 Kaplan (1978) 2.6.1.2.1 Experiment 1 2.6.1.2.2 Experiment 2 2.6.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 2.6.3 Kritik und Ergänzungen o 2.7 Wechselwirkungen zwischen physischer Attraktivität und schulischer Sozialisation 2.7.1 Hinführung zum Thema 2.7.2 Fragestellung 2.7.3 Befunde 2.7.3.1 Schüler-Lehrer-Interaktion 2.7.3.2 Schüler-Schüler-Interaktion 2.7.4 Fazit und Kritik 3 Siehe auch 4 Quellen 5 Literatur o 5.1 Populärwissenschaftlich o 5.2 Für Fachpublikum 6 Weblinks Entwicklung der Attraktivitätsforschung Geschichte Die systematische Erforschung der menschlichen Schönheit nahm ihren Anfang in den späten 1960-er Jahren. Zunächst waren daran vor allem US-amerikanische Sozialwissenschaftler beteiligt, die sich hauptsächlich für die Auswirkung von körperlicher Attraktivität auf die verschiedensten Arten der zwischenmenschlichen Beziehungen interessierten, etwa auf die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen. Während die ersten Attraktivitätsforscher noch davon ausgingen, dass Schönheit „im Auge des Betrachters“ liege, brachten die in den 1980er Jahren durchgeführten Untersuchungen zur Urteilerübereinstimmung die Erkenntnis, dass sich unterschiedliche Menschen in ihrem Schönheitsurteil durchaus ähneln. Damit rückte nun verstärkt die Frage ins Blickfeld, welche Merkmale attraktive Gesichter bzw. Körper auszeichnen. Seit Mitte der 80-er Jahre spielen in der Attraktivitätsforschung zunehmend evolutionspsychologische Ansätze eine Rolle, die nach dem biologischen „Sinn“ von Attraktivität fragen. Bis heute ist die Evolutionspsychologie das vorherrschende (wenn auch nicht unangefochtene) theoretische Paradigma der Attraktivitätsforschung geblieben. Aktuelle Entwicklungen [Bearbeiten] Mit der Einführung moderner bildgebender Verfahren in die Hirnforschung halten seit Mitte der 1990-er Jahre die Neurowissenschaften Einzug in die Attraktivitätsforschung. Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie werden die am Attraktivitätsurteil beteiligten Hirnstrukturen und die zugrundeliegenden neuronalen Prozesse erforscht. Die Suche nach den physiologischen Grundlagen des ästhetischen Empfindens geht dabei z.T. über die menschliche Schönheit hinaus und bezieht – unter der Flagge der „Neuroesthetics“ – alle Arten von ästhetischen Objekten und Erfahrungen wie etwa Kunstwerke oder Musik mit ein. Auch die Wirtschaftswissenschaften beteiligen sich neuerdings an der Erforschung der menschlichen Attraktivität. Mit Hilfe spieltheoretischer Ansätze gehen sie der Frage nach, wie soziale Austauschbeziehungen durch das Aussehen beeinflusst werden. Seit einigen Jahren erweitert sich insbesondere innerhalb der evolutionspsychologisch geprägten Attraktivitätsforschung das Konzept von „Attraktivität“ zusehends. Neben der visuellen Attraktivität von Gesicht und Körper sind nun auch der Körpergeruch, die Stimme oder auch Bewegungen zum Gegenstand der Forschung geworden. Dabei tritt zunehmend die Frage nach der Natur und Herkunft von interindividuellen Unterschieden in der Attraktivitätswahrnehmung in den Vordergrund. (Warum etwa können sich die einen Menschen gegenseitig „riechen“, die anderen nicht?) Fragestellungen [Bearbeiten] Die Attraktivitätsforschung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit folgenden Fragen: Inwieweit stimmen Menschen in ihrem Schönheitsurteil überein? Welche Merkmale des Gesichtes bzw. Körpers werden als attraktiv empfunden? Wie wirkt sich die Attraktivität eines Menschen im sozialen Kontext aus? Welche Rolle spielt Attraktivität bei der Partnerwahl? Welchen biologischen „Sinn“ hat Schönheit? Bewertung von Schönheit [Bearbeiten] Der Frage nach der Urteilerübereinstimmung bei der Attraktivitätsbewertung von Gesichtern haben sich vor allem deutschsprachige Attraktivitätsforscher (z.B. Ronald Henss) ausgiebig angenommen. Demnach ist unser Attraktivitätsurteil ungefähr zur Hälfte subjektiv, die andere Hälfte haben wir mit anderen Menschen gemeinsam. [1]. Dieser (relative) Konsens scheint kulturübergreifend zu sein, sofern die jeweiligen Beurteiler mit den in Frage stehenden Ethnien vertraut sind. Ein weißer Europäer stimmt beispielsweise bei der Bewertung eines japanischen Gesichtes weitgehend mit japanischen Bewertern überein – unter der Voraussetzung, dass er bereits „Erfahrung“ mit japanischen Gesichtern gemacht hat (also z.B. Japaner in seinem Bekanntenkreis hat). Männer und Frauen weisen in ihren Schönheitsurteilen zwar gewisse Unterschiede auf (Frauen beispielsweise sind mit guten Noten etwas zurückhaltender als Männer, insbesondere, wenn es um Männergesichter geht), im großen Ganzen stimmen beide Geschlechter aber recht gut überein (genauso wie das auch unterschiedliche Altersgruppen oder auch soziale Schichten tun). Welche Merkmale werden als attraktiv empfunden? [Bearbeiten] Dante Gabriel Rossetti, The Beloved (1866) Symmetrie, kindliche Gesichtszüge und makellose Haut werden universell als attraktiv wahrgenommen. Eines der für den Laien verblüffendsten Attraktivitätsmerkmale heißt Durchschnittlichkeit: Wenn mehrere Gesichter fotografisch oder computertechnisch (durch sog. „Morphing“) übereinandergelagert werden, so ist das resultierende Durchschnittsgesicht attraktiver als die Mehrzahl der Einzelgesichter, aus denen es hervorgegangen ist. Als einer der stärksten Attraktivitätsfaktoren ist die Makellosigkeit der Haut experimentell gut abgesichert – je glatter die Haut, desto attraktiver wird das entsprechende Gesicht beurteilt. Die Frage, ob ein Gesicht durch Symmetrie attraktiver wird, ist zwar ausführlich beforscht, die Ergebnisse sind jedoch nicht ganz eindeutig. In einigen Studien werden symmetrische Gesichter als attraktiver wahrgenommen, in anderen dagegen schneiden perfekt symmetrische Gesichter nicht besser – vereinzelt sogar schlechter - ab als weniger symmetrische. Konsens besteht allerdings darin, dass höhergradige Asymmetrien der Schönheit eines Gesichtes abträglich sind. Attraktive weibliche Gesichter weisen Merkmale und Proportionen auf, die auch die Gesichter von Kindern auszeichnen: große Augen, eine hohe Stirn, eine niedrige Kieferpartie. Ob die Attraktivität dieser Merkmale mit ihrer wahrgenommenen Kindlichkeit (sog. „Neotenie-Hypothese“) zusammenhängt oder ob sich in ihr die besondere Geschlechtstypizität des Gesichtes widerspiegelt (also der Gegensatz zum männlichen Gesicht, das sich durch eine kräftigen Kiefer, eine flache Stirn und kleiner wirkenden Augen auszeichnet), ist unter Forschern umstritten. Sog. „Reifezeichen“ (M. Cunningham) in Form von hohen, betonten Wangenknochen und schmalen Wangen machen Frauen- und z.T. auch Männergesichter attraktiver. Beim weiblichen Gesicht wirken volle Lippen attraktiv – möglicherweise, weil sie auf einen hohen Spiegel an weiblichen Geschlechtshormonen hinweisen (die Lippen werden in der Pubertät unter dem Einfluss von Östrogen voller). Die Faktoren, die ein Männergesicht attraktiv machen, sind weniger eindeutig zu definieren. Die „Männlichkeit“ eines Gesichtes (die sich in einem kräftigen, kantigen Kinn, hervorstehenden Wangenknochen und schmalen Wangen äußert) führt nicht in allen Experimenten zu höheren Attraktivitätswerten – möglicherweise, weil allzu viel Männlichkeit auch mit negativen Charaktereigenschaften wie Machismo, Aggressivität und Untreue assoziiert wird. Odalisque von Jules-Joseph Lefebvre Für die Figur werden folgende Attraktivitätskriterien diskutiert: Einer der wichtigsten (und kulturübergreifenden) Attraktivitätsfaktoren beim Mann ist die Körpergröße. Die Körpergröße einer Frau dagegen ist für ihre Attraktivität unerheblich. Das ideale Körpergewicht und die ideale Figur schwanken von Epoche zu Epoche und Kultur zu Kultur recht stark. Die heutige Bevorzugung sehr schlanker Frauenkörper ist im historischen und ethnographischen Vergleich eher die Ausnahme. In den 1990-er Jahren wurde die „Waist-to-Hip-ratio“, also das Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang von dem US-amerikanischen Evolutionspsychologen Devendra Singh als Attraktivitätsmaß in die Diskussion eingeführt. Ein Verhältnis von 0,7 galt demnach als optimal. Die Universalität dieser „Konstante“ wird jedoch von neueren Untersuchungen zunehmend in Frage gestellt. Zudem steht außer Frage, dass die Körperfülle (gemessen durch den Body-Mass-Index BMI) eine sehr viel wichtigere Rolle spielt als das Taille-Hüft-Verhältnis (Zusammenfassung: Swami & Furnham, 2008). Sämtliche Schönheitsideale sind dem Wandel von Geschmack und Mode unterworfen – die den Körper betreffenden Schönheitsnormen offenbar noch stärker als diejenigen, die sich auf das Gesicht beziehen. Das heißt jedoch nicht, wie oft behauptet, dass Schönheitsideale völlig beliebig wären – wie der Blick auf herausragende Schönheiten unterschiedlicher Epochen, wie etwa Nofretete oder Michelangelos David, zeigt. Wie wirkt sich Attraktivität im sozialen Kontext aus? [Bearbeiten] Attraktiven Menschen werden in weitaus höherem Maß positive Eigenschaften wie z.B. Gesundheit, Intelligenz oder gute Charaktereigenschaften zugeschrieben als weniger attraktiven. Offenbar neigen Menschen dazu, ästhetische („schön“) mit ethischen Kategorien („gut“) zu vermischen. Dieses sog. Attraktivitätsstereotyp führt dazu, dass schöne Menschen in praktisch allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens positiver behandelt werden. Hübsche Kinder etwa bekommen in der Schule bessere Noten. Attraktive Erwachsene können vor Gericht mit milderen Strafen rechnen, treffen in Notlagen auf mehr Hilfsbereitschaft, und erhalten – wenn man das Attraktivste mit dem am wenigsten attraktiven Drittel der Arbeitnehmer vergleicht - um ca. 10 Prozent höhere Gehälter. Auch ein Zusammenhang zwischen physischer Attraktivität und Wahlerfolg wird mittlerweile empirisch erforscht. So gut die Wirkung des Attraktivitätsstereotyps dokumentiert ist, so wenig sind die Gründe erforscht, die zu der Gleichsetzung des Schönen mit dem Guten führen. Eine entsprechende Sozialisation – wie sie von vielen Sozialwissenschaftlern als Erklärung angeführt wird – ist eher unwahrscheinlich, da sich das Attraktivitätsstereotyp bereits im Alter von sechs Monaten nachweisen lässt. Auch die Tatsache, dass sich die Vermengung des Schönen mit dem Guten in allen Kulturen, Sprachen und Mythen nachweisen lässt, spricht gegen eine rein kulturelle Tradierung des Attraktivitätsstereotyps im Sinne von Sozialisation. Die Suche nach den biologischen Wurzeln steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. Attraktivität und Partnerwahl [Bearbeiten] Bei beiden Geschlechtern gehört körperliche Attraktivität zu den wichtigsten Partnerwahlkriterien. Im Unterschied zu Männern sind Frauen allerdings eher bereit, beim Faktor „Attraktivität“ zugunsten anderer Qualitäten, insbesondere Status und Charaktereigenschaften, Abstriche zu machen. Männer dagegen lassen sich bei ihrer Partnerwahl in viel stärkerem Maß von optischen Kriterien leiten. Dieses Muster scheint sich im Zuge der stärkeren ökonomischen Gleichstellung der Frau zwar zu relativieren, ist auf dem aktuellen Partnermarkt jedoch noch weitgehend gültig. Bei Verbindungen zwischen Partnern mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen ist es in aller Regel die Frau, die ihrem Partner in Sachen Herkunft und Bildung unterlegen ist – dafür kann sie aber ihre höhere Attraktivität in die Waagschale werfen. Bei den heutzutage häufigeren Partnerschaften zwischen Partnern ähnlicher Herkunft und Bildung ähneln sich die Partner dagegen auch in ihrer Attraktivität: Schöne Menschen haben schöne Partner, weniger schöne Menschen dagegen auch weniger schöne Partner. Die Mechanismen, die zu dieser attraktivitätsmäßigen Schichtung des Partnermarktes führen, werden derzeit anhand des sog. Speed-Dating intensiv erforscht. Welchen biologischen „Sinn“ hat Schönheit? [Bearbeiten] Evolutionspsychologisch orientierte Attraktivitätsforscher sehen in gutem Aussehen ein biologisches Signal. Schönheit ist demnach ein Zeichen von „Partnerqualität“, insbesondere von Gesundheit und Fruchtbarkeit. Diese sog. „Gute-Gene-Hypothese“ kann sich auf verhaltensbiologische Erkenntnisse aus dem Tierreich stützen: In vielen Arten haben die am reichsten ornamentierten Individuen nicht nur eine höhere phänotypische Qualität sondern auch eine reichlichere und gesündere Nachkommenschaft. In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Symmetrie des Körperbaus eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Sie wird von vielen Forschern als Zeichen von sog. „Entwicklungsstabilität“ und damit als Hinweis auf eine gute genetische Ausstattung aufgefasst. Inwieweit auch die menschliche Schönheit als Indikator für biologische oder psychologische Qualitäten fungiert, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beantworten. Wohl lassen sich gewisse Zusammenhänge zwischen Attraktivität und anderen „Qualitäten“ feststellen – insbesondere im Bereich sozialer Fähigkeiten schneiden attraktive Menschen nach einer umfangreichen Meta-Analyse der bestehenden Literatur aus dem Jahr 2000 besser ab[2]. Bei den Faktoren „Gesundheit“ und „Fruchtbarkeit“ lassen sich jedoch klare und eindeutige Zusammenhänge bisher nicht feststellen. Was die biologische „Erklärung“ der menschlichen Schönheit angeht, steht die Attraktivitätsforschung trotz vielversprechender Ansätze erst am Anfang. Der Halo-Effekt bei physischer Attraktivität [Bearbeiten] Der Halo-Effekt (Thorndike, 1920; Wells, 1907) ist ein Urteilsfehler, bei dem Eigenschaften oder Merkmale einer Person, die de facto unabhängig oder nur leicht zusammenhängend sind, von der urteilenden Person als miteinander in einem direkten Zusammenhang stehend wahrgenommen werden. Experimente [Bearbeiten] Landy & Sigall (1974) [Bearbeiten] Landy und Sigall (1974) wollten herausfinden, ob die Beurteilung der Leistung einer Person abhängig von deren Maß an physischer Attraktivität ist. Sie ließen Studenten Aufsätze bewerten, von denen die Hälfte „schlecht“ und die andere Hälfte „gut“ waren. Zusätzlich war an ein Drittel der Aufsätze das Foto einer attraktiven Frau, an das zweite Drittel das Foto einer unattraktiven Frau und an das letzte Drittel gar kein Foto geheftet. Sowohl die Qualität der Aufsätze als auch die Attraktivität der Frauen wurden vor dem eigentlichen Experiment anhand von Voruntersuchungen überprüft. Bei einem guten Aufsatz gab es keinen signifikanten Unterschied in der Leistungsbewertung der attraktiven und der unattraktiven Autorinnen. War der Aufsatz jedoch von schlechter Qualität und die Autorin attraktiv, wurde er besser bewertet als der schlechte Aufsatz einer unattraktiven Autorin. Somit konnte in diesem Experiment der Halo-Effekt mit Einschränkung nachgewiesen werden. Zu kritisieren ist an diesem Experiment und der Interpretation der Ergebnisse, dass es ausschließlich männliche Versuchspersonen und weibliche Stimuluspersonen gab. Damit stellt sich die Frage, ob der Halo-Effekt im Zusammenhang mit physischer Attraktivität nur dann auftritt, wenn ein Mann die schlechte Leistung einer attraktiven Frau bewerten soll. Diese Frage stellte sich auch Kaplan (1978). Kaplan (1978) [Bearbeiten] Experiment 1 [Bearbeiten] Kaplan benutzte die gleiche Versuchsanordnung wie Landy und Sigall (1974) mit dem Unterschied, dass er sowohl männliche als auch weibliche Versuchspersonen die Aufsätze bewerten ließ. Damit wollte er herausfinden, ob es eine Interaktion zwischen dem Geschlecht des Bewertenden und der Attraktivität der Stimulusperson gab. Tatsächlich werteten die männlichen Versuchspersonen die Aufsätze der attraktiven Autorinnen auf, wohingegen bei den weiblichen Versuchspersonen eine Tendenz bestand, die Leistungen attraktiver Autorinnen abzuwerten, die allerdings nicht signifikant war. Im Anschluss an dieses Experiment stellte sich nun die Frage, ob es einen Unterschied mache, wenn die Stimuluspersonen, also die Autoren der Texte, männlich wären. Experiment 2 [Bearbeiten] Dies überprüfte Kaplan dann in einem zweiten Experiment, das wieder gleich aufgebaut war wie das von Landy und Sigall (1974), nur das jetzt nicht nur die Versuchspersonen männlich und weiblich waren, sondern die Autoren der Texte männlich waren. Heraus kam, dass männliche Attraktivität bei weiblichen Bewertenden nicht den gleichen Effekt erzeugt wie weibliche Attraktivität bei männlichen Bewertenden. Auch die männlichen Versuchspersonen, welche die Texte der männlichen Autoren bewerteten, wurden durch das Maß an Attraktivität der Stimulusperson nicht signifikant beeinflusst. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse [Bearbeiten] Aufgrund der Ergebnisse dieser Experimente kann man sagen, dass der Halo-Effekt dann auftritt, wenn Männer schlechte Leistungen von Frauen bewerten sollen; das bedeutet, dass attraktive Frauen bei schlechter Leistung von den männlichen Versuchspersonen besser bewertet werden als unattraktive Frauen, also das Maß an Attraktivität fälschlicherweise die Bewertung einer von der Attraktivität gänzlich unabhängigen Leistung beeinflusst sowohl Männer als auch Frauen durch männliche Attraktivität in diesen Experimenten nicht beeinflusst wurden weibliche Versuchspersonen in diesen Experimenten durch weibliche Attraktivität negativ beeinflusst wurden, da sie die Leistungen attraktiver Frauen tendenziell, wenn auch nicht signifikant, schlechter bewerteten als die von unattraktiven Frauen Kritik und Ergänzungen [Bearbeiten] Trotz der Ergebnisse dieser Experimente ist zu bezweifeln, ob es den Halo-Effekt im Bereich physische Attraktivität tatsächlich gibt. Zum Einen funktioniert er nach Kaplan (1978) nur, wenn Männer schlechte Leistungen von attraktiven Frauen bewerten, was den Geltungsbereich einschränkt, wobei die Frage, warum dies so ist, offen bleibt. Des Weiteren wurde das Experiment von Landy und Sigall (1974) von Schmitt (1992) in Deutschland repliziert, wobei der Halo-Effekt im Bezug auf die Leistungsbeurteilung der Stimulusperson nicht zu beobachten war, was die Ergebnisse von Landy und Sigall (1974) und Kaplan (1978) in Frage stellt. Somit kann man sagen, dass der Halo-Effekt im Bereich physische Attraktivität, wie unzählige andere Phänomene in der Sozialpsychologie, noch weiterer Forschung und Erklärung bedarf. Wechselwirkungen zwischen physischer Attraktivität und schulischer Sozialisation [Bearbeiten] Hinführung zum Thema [Bearbeiten] Auf Grundlage bisheriger Ergebnisse aus dem Bereich der Attraktivitätsforschung lässt sich eine nicht zu unterschätzende Auswirkung bislang erforschter Phänomene auch im schulischen Kontext erwarten. Diese können sowohl die Schüler-Lehrer-Interaktion, als auch die Schüler-Schüler-Interaktion betreffen. Physische Attraktivität gilt nach Elashoff & Adams et al. als eine der potentiellen Einflussvariablen bzgl. Lehrererwartungen. Außerdem wird von Determinanten ausgegangen, wie Geschlecht, Herkunft und sozialem Status, die u.a. die Leistungsbewertung bedingen. Darüber hinaus ist natürlich auch von Interesse, inwieweit der Wert, der physischer Attraktivität von Kindern und Jugendlichen beigemessen wird, durch den schulischen Sozialisationsprozess geprägt ist. Bisherige Forschungsergebnisse stammen überwiegend aus dem anglo-amerikanischen Raum, weshalb die Übertragbarkeit auf die Zusammenhänge o.g. Phänomene an deutschen Schulen z.T. problematisch ist. Sie belegen allerdings, dass „subjektive“ und „objektive“ Attraktivität von der Kindheit bis hin zur Adoleszenz überzufällig mit sozialer Wahrnehmung, mit der Ausbildung von Einstellungen und Werthaltungen, mit Persönlichkeitsfaktoren und mit Qualität und Quantität sozialer Interaktion kovariieren (Rost). Fragestellung [Bearbeiten] Der sogenannte Halo-Effekt und das damit verbundene Schönheitsstereotyp „Wer schön ist, ist auch gut.“ lassen vermuten, dass die Bewertungen schulischer Leistungen bzw. intellektueller Fähigkeiten der Schüler u.a. auch durch den Einfluss der physischen Attraktivität entstehen könnten. Ebenso könnte dieser Effekt dazu beitragen, dass attraktive Schüler bei Klassenkameraden ein höheres Ansehen genießen. Die Matching-Hypothese könnte insofern eine Rolle spielen, als die Notenvergabe durch Lehrer u.a. auch von der physischen Ähnlichkeit zwischen SchülerIn und LehrerIn geprägt sein kann. Freundschaften unter Schülern könnten dabei auch mit diesem Prinzip entstehen. Darüber hinaus kann man sich fragen, ob der Kontrast- und der Radiation-Effekt auch im schulischen Alltag Auswirkungen haben. Befunde [Bearbeiten] Schüler-Lehrer-Interaktion [Bearbeiten] Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum zu „subjektiver“ und „objektiver“ Attraktivität liefern folgende Ergebnisse: a) Einfluss des Geschlechts Kenealy et al. (1978) konnte nachweisen, dass Lehrer Mädchen signifikant attraktiver wahrnehmen als Jungen. Damit lässt sich die eindeutige systematische Tendenz erklären, dass Mädchen besser als Jungen beurteilt werden. Broody & Good (1974) weisen jedoch auf eine Überschätzung des Potentials und der Intelligenz der Mädchen hin. b) Einfluss des Halo-Effekts Mehrfach konnte die Hypothese bestätigt werden, dass der Halo-Effekt auch in der SchülerLehrer-Interaktion zu beobachten ist. Attraktive Schüler werden dementsprechend als intelligenter, sozialer und ehrlicher wahrgenommen (Kenealy, 1980; Dion, 1972). Zusätzlich zeigte sich, dass Lehrer von der Attraktivität des Schülers/ der Schülerin auf das Interesse der Eltern schließen. Sie gehen davon aus, dass attraktive Kinder Eltern haben, die sich mehr für das Wohlergehen und das Leben ihres Kindes interessieren, als Eltern von unattraktiveren Kindern. Unattraktive Kinder erfahren signifikant mehr neutrale bis hin sogar zu negativer Aufmerksamkeit. Aloia (1975) und Clifford (1975) bestätigten mit ihren Untersuchungen, dass Lehrer an unattraktive Kinder einen geringeren akademischen Anspruch haben sowie schwächere Leistungen erwarten. Attraktive Fotokinder erhalten i.d.R. in den Fächern Musik/Kunst und Sachkunde bessere Noten. Rost merkt hierzu an, dass in den oben aufgeführten Fächern ein Mangel an „harten Beurteilungskriterien“ vorliegt. Mehrfach bewiesen, beeinflusst Schönheit vor allem dann, wenn weniger konkrete Informationen über die Person vorliegen (in diesem Fall: leistungsbezogen). Schüler-Schüler-Interaktion [Bearbeiten] a) Einfluss der Schulzugehörigkeit Das Attraktivitätskonzept scheint sich bereits im Kindergartenalter relativ klar gefestigt zu haben. Schulkinder schätzen Attraktivitätsunterschiede bei anderen Kindern relativ zuverlässig ein; die Kriterien, die dazu genutzt werden, sind ähnliche wie bei Erwachsenen. Vagt und Mayert konnten 1979 an einer Stichprobe von 219 Hauptschülern und Gymnasiasten der 9. Jahrgangsstufe feststellen, dass die Einschätzung der eigenen Attraktivität nicht mit der Attraktivitätseinschätzung durch Peers (Gleichaltrige, Gleichgestellte) korreliert. Es ergaben sich jedoch Beziehungen zu anderen Variablen; abhängig vom sozio-ökonomischen Status und dem Alter der Eltern wurden die Kinder von ihren Peers als attraktiver beurteilt. Als attraktiv eingeschätzte Gymnasiasten scheinen darüber hinaus weniger Probleme mit Gleichaltrigen zu haben. Betrachtet man nur die subjektive Attraktivtät, so zeigen sich gerade bei Hauptschülern signifikante Korrelationen zu Variablen aus dem Bereich der Persönlichkeit, Sozial- und Leistungsverhalten; d.h. je positiver die eigene Attraktivität beurteilt wird, desto weniger scheinen soziale Ängstlichkeit, Nervosität, Erregbarkeit, Gehemmtheit und emotionale Labilität ausgeprägt zu sein. Vagt folgert aus diesen Befunden, dass v.a. bei Hauptschülern das Aussehen ein entscheidendes Wert- und Selbstwertkriterium darstellt, das aber ggfs. mit steigender Schulbildung durch andere Kriterien z.B. aus dem Leistungsbereich überlagert werden könnte. In anderen Arbeiten konnte dieser Befund zwar nur z.T. nachvollzogen werden, aber hypothesenkonform zeigte sich auch hier, dass Hauptschüler zufriedener mit dem eigenen Aussehen sind und mehr Aufwand (Zeit und Geld etc.) für gutes Aussehen betreiben als Gymnasiasten. b) Einfluss des Geschlechts Es zeigten sich in dieser Studie jedoch andere signifikante Befunde, die gerade auch in Bezug auf einen möglichen Geschlechtseinfluss von beurteiltem und beurteilendem Kind interessante Hinweise geben. So konnte gezeigt werden, dass attraktiv eingeschätzte Mädchen tendenziell aus Familien mit höherem sozio-ökonomischen Status stammen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, ob Eltern mit höherem Status v.a. bei Töchtern dem Aussehen einen höheren Wert beimessen, als Eltern mit niedrigerem sozio-ökonomischen Status. Die Alltagserfahrung, dass sich soziale Beziehungen u.a. auch über Attraktivität vermitteln, konnte von Rost insofern nachgewiesen werden, als attraktive Kinder, v.a. Mädchen, häufiger von Peers zum Übernachten eingeladen werden. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass attraktiv beurteilte Mädchen offenbar häufiger auch introvertierte Interessen (sammeln, zeichnen etc.) haben. Die Frage, ob schöne Mädchen sich weniger um Sozialkontakte kümmern müssen, kann durch diesen Befund allerdings nicht beantwortet werden. Insgesamt weisen verschiedene Befunde darauf hin, dass Mädchen die Attraktivität Gleichaltriger generell positiver beurteilen als Jungen, und auch, dass Mädchen selbst bzgl. ihrer Attraktivität positiver beurteilt werden als Jungen. c) Einfluss des Halo-Effekts Offensichtlich scheint sich auch oder gerade im Grundschulalter die Sympathie unter Kindern insbesondere durch das Aussehen zu vermitteln. Rost konnte zwischen verschiedenen Items, die den Kindern der Beurteilerstichprobe zur Bewertung Gleichaltriger vorgelegt wurden, signifikant positive Korrelationen feststellen. Ein besonders enger Zusammenhang, der für die Wirksamkeit des Halo-Effekts spricht, besteht zwischen den Items „Dieses Kind ist hübsch“ und „Ich mag dieses Kind“. Aber auch die Items, die sich auf die Intelligenz, die Anzahl der Freunde und die Glücklichkeit des beurteilten Kindes beziehen korrelieren eng untereinander. Fazit und Kritik [Bearbeiten] Wie die dargelegten Befunde zeigen, ist die Attraktivitätsforschung bei Kindern und Jugendlichen v.a. auch im Bereich Schule noch lange nicht am Ende angelangt. Z.T. widersprüchliche Befundlagen sprechen dafür, dass es keine eindeutigen Ergebnisse für Zusammenhänge zwischen Attraktivität und Variablen wie Intelligenz, Beliebtheit, Sozialverhalten etc. gibt. Vermutlich spielen gerade in diesem Forschungsbereich Interaktionen höherer Ordnung eine entscheidenende Rolle; hier bedarf es also noch weiterer Forschung. Ebenfalls nicht eindeutig beantwortet bleibt die Frage nach der Richtung bislang festgestellter Zusammenhänge zwischen Attraktivität und weiteren Variablen. Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass es generell fraglich ist, ob die in den Studien angewendeten Operationalisierungen – es wurde fast ausschließlich mit Fotos zur Bewertung gearbeitet – valide Ergebnisse liefern können, da doch vor allem im Schulalltag einem natürlichen Umfeld eine besondere Bedeutung zufällt. Siehe auch [Bearbeiten] Attraktivität Schönheit Ästhetik Schönheitsideal Evolutionspsychologie Lookism Quellen [Bearbeiten] 1. ↑ siehe z.B.: Ronald Henss: Spieglein, Spieglein an der Wand – Geschlecht, Alter und physische Attraktivität (Beltz Psychologie Verlags Union, 1992); Hönekopp, J (im Druck) Once more: is beauty in the eye of the beholder? Relative contributions of private and shared taste to judgments of facial attractiveness. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 2. ↑ Langlois, JH, Kalakanis, L, Rubenstein, AJ, Larson, A, Hallam, M & Smoot, M (2000). Maxims or myths of beauty? A meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin, 126, 390-423 Literatur [Bearbeiten] Populärwissenschaftlich [Bearbeiten] Ulrich Renz: Schönheit – eine Wissenschaft für sich, Berlin Verlag, 2006, ISBN 3827006244 Nancy Etcoff: Nur die Schönsten überleben, Diederich Verlag, 2001, ISBN 3720522229 Für Fachpublikum [Bearbeiten] Ronald Henss: Spieglein, Spieglein an der Wand – Geschlecht, Alter und physische Attraktivität (Beltz Psychologie Verlags Union, 1992). In dem Buch stellt der früher an der Universität des Saarlandes tätige Psychologe nicht nur seine eigenen Forschungen vor, sondern gibt auch einen sehr systematischen und klaren Überblick über die weltweite Literatur zum Thema Urteilerübereinstimmung. Ronald Henss: Gesicht und Persönlichkeitseindruck (Hogrefe, 1998). Dieses persönlichkeitspsychologische Fachbuch dreht sich um die Frage: Welche Rolle spielt das Äußere bei der Beurteilung des Inneren? Zunächst geht es um die Frage nach der Struktur des Persönlichkeitseindrucks, also nach der Korrelation zwischen den einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen, die der Beurteiler im Beurteilten zu erkennen meint. Dann die Frage nach der Urteilerübereinstimmung, und drittens die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Physiognomie und Persönlichkeitseindruck. Manfred Hassebrauck und Reiner Niketta (Hrsg.): Physische Attraktivität (Hogrefe, 1993). Dieser Sammelband zieht die Summe der deutschsprachigen empirischpsychologischen Attraktivitätsforschung - die international leider nicht im Geringsten wahrgenommen wurde. Eine Auseinandersetzung mit evolutionspsychologischen Ansätzen fehlt in diesem Band bedauerlicherweise völlig. Andreas Hergovich (Hrsg.): Psychologie der Schönheit – Physische Attraktivität aus wissenschaftlicher Perspektive (WUV-Universitätsverlag, 2002). Die einzelnen Beiträge in diesem Sammelband decken die wichtigsten Felder der psychologischen Attraktivitätsforschung ab. Das Werk unterscheidet sich von einem „richtigen“ Lehrbuch darin, dass die Beiträge von Studenten (am psychologischen Institut der Universität Wien) verfasst wurden und entsprechend in ihrer Qualität höchst unterschiedlich sind. Gillian Rhodes & Leslie Zebrowitz: Facial attractiveness. Evolutionary, Cognitive, and Social Perspectives (Ablex Publishing, 2002). Das Buch kann schon fast als Standardlehrbuch der Attraktivitätsforschung bezeichnet werden. Es zeigt das ganze Spektrum des Fachgebietes auf, von der Evolutionspsychologie (die unter anderem von dem Wiener Verhaltensforscher Karl Grammer vertreten wird) über die Theorie der Wahrnehmungsvorlieben bis hin zu sozialpsychologischen Ansätzen. Leslie Zebrowitz: Reading Faces: Window to the Soul? (Westview Press, 1997). In diesem „Ein-Frau-Lehrbuch“ der amerikanischen Wahrnehmungsforscherin geht es um die Signale, die unser Gesicht sendet, und wie wir sie empfangen und decodieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Wirken des Kindchenschemas und dessen Erklärung. Das Buch ist für ein Fachbuch ausgesprochen opulent illustriert und so verständlich geschrieben, dass es auch manchem Laien eine Freude sein wird. Schmitt, M. (1992). Schönheit und Talent: Untersuchungen zum Verschwinden des Halo-Effekts. Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie,475-492 Swami, V. & Furnham, A. (2008). The Psychology of Physical Attraction. London: Routledge. Allgemeinverständliche Zusammenfassung ausgewählter Themen der Attraktivitätsforschung. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der Attraktivität der Figur, das Gesicht wird hingegen nahezu ausgeblendet. Die Autoren machen insbesondere deutlich, dass die Bedeutung des Taille-Hüft-Verhältnisses maßlos überschätzt wurde. Kaplan, R. M. (1978). Is Beauty talent? Sex interaction in the attractiveness halo effect. Sex Roles, 4(2), 195-204 Landy, D., & Sigall, H. (1974). Beauty is talent: Task evaluation as a function of the performer's physical attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 29(3), 299-304 Weblinks [Bearbeiten] Attraktivitätsforschung im deutschsprachigen Raum Neuroesthetics - Mit seinem „Institute of Neuroesthetics“ geht der Großmeister der Neurobiologie, Semir Zeki, seinem Steckenpferd nach: der Erklärung der Kunst aus der Biologie. Online-Experimente: Experimente zur Gesichterbeurteilung - Online-Experimente zur Gesichterbeurteilung und Attraktivitätsforschung. Fachrichtung Psychologie, Universität des Saarlandes, Saarbrücken. PSYTESTS (deutsch) - Auf dieser Seite des Instituts für Psychologie der HumboldtUniversität zu Berlin findet sich eine Studie zu den individuellen Vorlieben bei der Wahrnehmung männlicher Gesichter. Faceresearch.org (deutsch) - Auf dieser Website von Forschern der Universität Aberdeen können Sie an kurzen psychologischen Experimenten teilnehmen, bei denen es um die Attraktivitätswahrnehmung von Gesichtern und Stimmen geht. Die Seite liegt auch in einer deutschen Version vor. Bodygenerator und Bodycontest - Zwei Experimente des Regensburger Psychologen Martin Gründl Männergesichter - In diesem Experiment von Victor Johnston stehen männliche Gesichter zur Bewertung. A Little Lab (engl.) - Auf dieser Seite von Tony Little finden Sie eine Vielzahl von Experimenten, bei denen es überwiegend um die Attraktivitätsbewertung und den Persönlichkeitseindruck von Gesichtern geht. Perception Lab (engl.) - Auf dieser Website von David Perretts Forschergruppe finden sich verschiedene online-Experimenten zur Attraktivität von Gesichtern. Hier können Sie auch Ihr Gesicht der Wissenschaft vermachen. Symmetrie (engl.) - Hier können Sie Ihr Gesicht online symmetrisieren lassen und Abweichungen von der perfekten Symmetrie in einem einzigen Zahlenwert berechnen lassen. Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Attraktivit%C3%A4tsforschung“ Kategorie: Sozialpsychologie NEWS - Druckversion drucken >> 10.05.2006 - Psychologie Vaterqualitäten stehen Männern ins Gesicht geschrieben Kinderliebe macht Männer für Frauen zumindest als Langzeitpartner attraktiv Frauen erkennen schon bei einem Blick in das Gesicht eines Mannes, ob er Interesse an Kindern hat oder nicht. Diese unbewusste Beurteilung der Vaterqualitäten prägt die männliche Attraktivität stärker als bislang angenommen, haben amerikanische Psychologen in einer Studie nachgewiesen: Je höher die Frauen das Interesse an Kindern einschätzten, desto attraktiver erschien ihnen der Mann als Langzeitpartner. Umgekehrt bevorzugten die Frauen als Partner für eine kurze Affäre eher Männer, die einen hohen Testosteronspiegel hatten – und auch den konnten sie den Männern am Gesicht ablesen. Vom Standpunkt der Evolution aus betrachtet spielen für die Wahl des richtigen Partners zwei Faktoren eine Rolle – die Qualität der Gene und die Bereitschaft, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Als Maß für die Qualität der genetischen Ausstattung gilt dabei der Testosteronspiegel, da er direkt Rückschlüsse auf die Qualität des Immunsystems zulässt. Da Testosteron außerdem die männlichen Gesichtszüge prägt, kann dieser Faktor relativ leicht beurteilt werden: Je maskuliner ein männliches Gesicht wirkt, desto höher ist die Hormonkonzentration. Ob einem Mann jedoch auch die Vaterqualitäten ins Gesicht geschrieben stehen, war bislang unklar. Um das zu testen, zeigten die Forscher um James Roney nun 39 Männern Bilder von Kinderund Erwachsenengesichtern und ließen sie entscheiden, welches Bild sie mehr ansprach. Anschließend nahmen die Wissenschaftler Speichelproben für eine Testosteronmessung und fertigten Digitalfotos der Teilnehmer an. Diese Bilder legten sie dann 29 Frauen vor und baten sie, verschiedene Eigenschaften der abgebildeten Männer auf einer Skala von 1 bis 7 zu beurteilen, darunter "wirkt maskulin", "mag Kinder" und "ist freundlich". In einer zweiten Runde sollten die Frauen zusätzlich einschätzen, welcher der Männer sie für eine kurze Affäre interessieren würde und welcher eher für einer langfristige Beziehung. Die Frauen konnten die Kinderfreundlichkeit der Männer überraschend gut bewerten, berichten die Forscher. Auch die gemessenen Testosteronspiegel und die Beurteilung, wie maskulin ein Gesicht wirkt, stimmten sehr gut überein. Beide Faktoren beeinflussten die Attraktivität der Gesichter, allerdings in entgegengesetzten Richtungen: Kinderliebe machte eine Mann attraktiv für eine Langzeitbeziehung und ein hoher Testosteronspiegel für eine kurze Affäre. Hormonstatus und Kinderliebe spiegeln sich also beide im Gesicht eines Mannes wider und können unabhängig voneinander beurteilt werden, schließen die Forscher. Sie wollen nun untersuchen, welche Gesichtszüge genau das Interesse an Kindern verraten. James Roney (Universität von Kalifornien, Santa Barbara) et al.: Proceedings of the Royal Society B, Online-Vorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rspb.2006.3569 ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel Attraktivität © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 08.11.2007 - Gesellschaft Was der Hüftschwung (nicht) verrät Frauen verändern Gang mit ihrem Zyklus Der Gang einer Frau wirkt auf Männer während ihrer fruchtbaren Tage am unattraktivsten. Das haben kanadische Wissenschaftler in Tests mit Männern herausgefunden, denen sie Videos gehender Frauen zeigten. Der meist als sexy empfundene Hüftschwung fiel bei Frauen in der fruchtbaren Phase des Zyklus überraschenderweise kleiner aus als in der unfruchtbaren, ergab die Auswertung der Wissenschaftler um Meghan Provost von der Queen's Universtity in Ontario. Die Forscher vermuten hinter dem Zusammenhang eine Strategie aus der menschlichen Evolutionsgeschichte, mit der sich Frauen einst vor unliebsamen Partnern schützten. Die Forscher statteten für ihre Untersuchung die Probandinnen zunächst mit Anzügen aus, die mit kleinen leuchtenden Markierungen versehen waren. So konnten sie mit Filmaufnahmen die Bewegungen beim Gehen genau analysieren. Frauen bewegen während ihrer fruchtbaren Tage ihre Hüften weniger und halten ihre Knie näher beieinander, beobachteten die Forscher. Als sie die Aufnahmen mehreren Gruppen von Männern zeigten, bewerteten diese den Gang während dieser fruchtbaren Tage als weniger attraktiv als den Gang in der unfruchtbaren Phase, der mit einem größeren Hüftschwung verbunden war. Dieses Ergebnis überraschte die Wissenschaftler, da sie genau mit dem Gegenteil gerechnet hatten, berichtet Provost. So hatten frühere Studien ergeben, dass Männer die Gesichter oder die Gerüche von Frauen in deren fruchtbarer Phase als attraktiver bewerten. Auch veröffentlichten US-Forscher erst vor wenigen Wochen eine Untersuchung, nach der Stripteasetänzerinnen in ihren fruchtbaren Tagen mehr verdienen - sie also unbewusst Signale an die Männer aussenden, die sie attraktiver machen. In dem vermeintlichen Widerspruch vermuten die Forscher ein Schutzprinzip aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen: Während der Gang auch aus großer Entfernung noch beobachtet werden kann, wirken die von Gesichtern oder Gerüchen ausgehenden Signale nur auf kurze Distanzen. Frauen haben daher die Möglichkeit, sich Männern ihrer Wahl gezielt zu nähern und diesen ihre Fruchtbarkeit zu signalisieren. Weniger interessante Männer halten sie hingegen auf Distanz. Durch den schwächer ausgeprägten Hüftschwung verbergen die Frauen ihre fruchtbaren Tage und schützen sich so vor Nachwuchs von ungewünschten Vätern. New Scientist, 10. November, Seite 14 ddp/wissenschaft.de – Ulrich Dewald © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 10.10.2007 - Psychologie Globalisierte Vorliebe: Symmetrie Menschen bevorzugen überall auf der Welt gleichmäßige Gesichter Symmetrische Gesichter finden Menschen aus allen Kulturen attraktiver als asymmetrische. Das haben Wissenschaftler bei Tests mit Menschen einer afrikanischen Jäger- und Sammlerkultur und mit Westeuropäern gezeigt. Für das Jäger- und Sammlervolk der Hadza in Tansania hat Symmetrie bei der Beurteilung der Attraktivität sogar eine größere Bedeutung, fanden die Forscher um Anthony Little heraus. Für die unter extremen Bedingungen lebenden Hadza könnte die Symmetrie eines Gesichts besonders wichtig sein, da sie als Maßstab genetischer Qualität dient, vermuten die Forscher. Menschen können anhand von Gesichtsmerkmalen Eigenschaften wie gute Gesundheit, Fruchtbarkeit, körperliche Dominanz oder auch sozialorientiertes Verhalten erkennen. Frühere Studien hatten bereits einen Zusammenhang zwischen Symmetrie und zum Beispiel Fruchtbarkeit und Überlebensfähigkeit gezeigt und ergeben, dass Menschen symmetrische Gesichter meist bevorzugen. Die Probanden hatten für die Studie Bildpaare von andersgeschlechtlichen Mitmenschen zu bewerten. Von jedem Bildpaar war ein Bild so verändert worden, dass die Gesichtsmerkmale symmetrisch erschienen. Sowohl die Hadza als auch die Briten zogen das symmetrische Gesicht dem asymmetrischen vor. Das eher isoliert lebende Volk der Jäger und Sammler, das kaum Zugang zu modernen Medien hat, war dabei von symmetrischen Gesichtern noch stärker angezogen als die Europäer. Diejenigen Hadza-Männer, die in ihrem Volk als gute Jäger und damit von Hazda-Frauen als attraktiv angesehen wurden, zeigten am deutlichsten den Hang zur Wahl symmetrischer Frauengesichter. Bei Frauen waren es schwangere und stillende, die eine sehr starke Neigung zu symmetrischen Gesichtszügen zeigten. Sie sind in dieser Phase mehr bedacht, Krankheiten zu meiden und legen besonders Wert auf Gesundheit ausstrahlende, symmetrische Gesichter. Anthony C. Little (Universität in Stirling) et al.: Proceedings of the Royal Society B, OnlineVorabveröffentlichung, DOI:10.1098/rspb.2007.0895 ddp/wissenschaft.de – Gesa Graser © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 26.09.2007 - Biologie Kinderreiche Bässe Auch die Stimmlage entscheidet über den Fortpflanzungserfolg eines Mannes Männer mit einer tiefen Stimme haben mehr Nachkommen. Das haben Wissenschaftler aus den USA und Kanada in einer Studie an einer Jäger- und Sammlergesellschaft aus Tansania nachgewiesen. Die Wissenschaftler um Coren Apicella von der Harvard-Universität in Cambridge sehen in diesem Zusammenhang die Erklärung dafür, warum Männer tiefere Stimmen haben als Frauen. Aus früheren Studien ist bekannt, dass die Menge des Botenstoffes Testosteron die Stimmhöhe entscheidend beeinflusst. In weiteren Studien fanden Frauen tiefere Männerstimmen attraktiver und beurteilten diese als dominanter, gesünder und männlicher als hohe Stimmen. Umgekehrt empfinden Männer höhere Frauenstimmen als attraktiver, jünger, gesünder und weiblicher. Zudem ist die Vorliebe von Frauen für tiefe Stimmen bei Männern in ihrer fruchtbaren Phase ausgeprägter. Das könnte darauf hinweisen, dass die Stimmlage neben anderen männlichen Eigenschaften als Qualitätskriterium bei der Partnerwahl dient. Bislang gab es jedoch noch keine Untersuchungen an Menschen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Stimmlage und Fortpflanzungserfolg zeigen konnten. Da in modernen Gesellschaften eine Untersuchung dieses Zusammenhangs wegen der praktizierten Verhütungsmethoden schwierig ist, haben die Wissenschaftler eine Volksgruppe von Jägern und Sammlern, die Hadza in Tansania, studiert. Diese leben in monogamen Beziehungen mit Partnern, die sie frei auswählen können. Es gibt also keine arrangierten Hochzeiten. Allerdings ist die Scheidungsrate ziemlich hoch, so dass viele Angehörige dieser Volksgruppe im Laufe ihres Lebens nacheinander mehrere feste Beziehungen haben. Für die Studie befragten die Forscher 49 Männer im Alter von 19 bis 55 Jahren und 52 Frauen im Alter von 18 bis 53 Jahren nach der Anzahl ihrer Kinder. Zudem zeichneten sie jeweils eine Sprachaufnahme des Wortes „hujambo“ auf, was übersetzt etwa „Hallo“ bedeutet. Bei den weiblichen Versuchsteilnehmern ergab sich kein Zusammenhang zwischen Stimmlage und Fortpflanzungserfolg. Die männlichen Probanden mit einer tiefen Stimme hatten hingegen signifikant mehr Kinder. In zukünftigen Studien möchten die Wissenschaftler untersuchen, ob Frauen bevorzugt Männer mit einer tiefen Stimme heiraten und ob diese Männer als bessere Jäger wahrgenommen werden. Außerdem interessiert die Forscher, ob es tatsächlich eine Verbindung zwischen Stimmlage und messbaren Eigenschaften wie beispielsweise dem Erfolg bei der Jagd gibt. Coren Apicella (Harvard-Universität in Cambridge) et al.: Biology Letters der britischen Royal Society, Online-Vorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rsbl.2007.0410 ddp/wissenschaft.de – Tobias Becker © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 GUT ZU WISSEN - Druckversion drucken >> 19.09.2007 - Psychologie Eifersucht macht schöne Menschen interessanter Leben Menschen in einer festen Beziehung, so wird deren Aufmerksamkeit von schönen Individuen ihres eigenen Geschlechts stärker angezogen als von attraktiven Menschen des jeweils anderen Geschlechts. Wer jedoch noch auf der Suche nach einem Partner sind, reagiert genau umgekehrt. Das hat ein Wissenschaftlerteam um Jon Maner von der Staatsuniversität von Florida in Tallahassee in einer Studie gezeigt. Für ihre Studie testeten die Psychologen in mehreren Versuchen insgesamt 442 heterosexuelle Männer und Frauen. Die Versuchsteilnehmer füllten im Vorfeld der Experimente einen Fragebogen aus, in der die Forscher die Motivation der Probanden abfragten, einen Partner zu finden. Während der Versuche zeigten die Forscher den Teilnehmern Bilder von sehr schönen sowie von durchschnittlich aussehenden Männern und Frauen auf einem Computermonitor. Nachdem ein Foto auf dem Bildschirm erschienen war, wurde die Zeit gemessen, die die Teilnehmer benötigten, um ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Stelle des Monitors zur richten. Bereits eine halbe Sekunde, nachdem die Versuchsteilnehmer eine attraktive Person sahen, fixierten sie ihre Aufmerksamkeit auf diese. Bei Bildern von schönen Menschen benötigten die Probanden generell mehr Zeit, um ihr Augenmerk auf etwas anderes zu konzentrieren. Die Wissenschaftler konnten dabei keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Welchem Geschlecht die Probanden bei den Versuchen mehr Aufmerksamkeit widmeten, hing jedoch davon ab, ob sie in einer festen Beziehung lebten oder nicht. Während sich Singles vor allem für das andere Geschlecht interessierten, blieb der Blick bei in einer Partnerschaft lebenden Probanden vor allem an Gesichtern von Geschlechtsgenossen hängen, beobachteten die Forscher. Wer einen Partner finden möchte, richtet seine Aufmerksamkeit sehr schnell und automatisch zu attraktiven Individuen des anderen Geschlechts, erklärt Maner diesen Zusammenhang. Sind wir hingegen in einer festen Beziehung, passiert dasselbe bei schönen Menschen unseres eigenen Geschlechtes, da wir diese als Konkurrenten empfinden. Dies ist verstärkt der Fall, wenn wir uns Sorgen um die Treue unseres Partners machen, konnten die Forscher zudem in einem der Versuche zeigen. Jon Maner (Staatsuniversität von Florida in Tallahassee) et al.: Journal of Personality and Social Psychology, Band 93, Ausgabe 3, Seite 389 ddp/wissenschaft.de – Tobias Becker © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 04.09.2007 - Psychologie Brautschau à la Steinzeit Forscher: Die Partnerwahl folgt immer noch den gleichen Regeln wie vor Tausenden von Jahren Bei der Partnerwahl gelten nach wie vor Regeln aus der Steinzeit – auch wenn die Selbsteinschätzung der meisten Menschen inzwischen eine völlig andere ist: Männer interessiert bei Frauen vor allem gutes Aussehen, während Frauen auf Sicherheit und einen hohen Status Wert legen. Das folgern Wissenschaftler aus einer Studie an knapp fünfzig Münchnern, die an einem "Speed Dating" teilgenommen hatten. Vor der Veranstaltung, bei denen sich Dutzende potenzielle Paare zu Kurzgesprächen von jeweils einigen Minuten treffen, hatten die Forscher die Teilnehmer zu ihren Kriterien bei der Partnerwahl befragt. Diese Kriterien bestätigten sich jedoch beim Dating keineswegs, berichten die Forscher. Vor dem Dating hatten die Männer angegeben, eine Frau zu suchen, die ihnen vom Status und vom Aussehen her ebenbürtig ist. Auch die Frauen gaben an, bezüglich Optik und Status eher ein Spiegelbild ihrer selbst zu suchen als den Traummann, zu dem sie aufschauen können. Nach den Treffen hatten die Teilnehmer in Fragebögen auszuwählen, welchen Mann oder welche Frau sie ein zweites Mal treffen wollten. Das Ergebnis entsprach keineswegs den zuvor angegebenen Kriterien, stellten die Forscher fest. Vielmehr schien die Partnerwahl nach einem Schema abzulaufen, das nach Ansicht von Entwicklungspsychologen ähnlich bereits in der Steinzeit galt: Männer legen Wert auf Attraktivität, da diese auf gute Gene der Frau schließen lässt. Frauen suchen bei Männern hingegen eine Kombination von gutem Aussehen, hohem Status und großer Fürsorglichkeit. Das stellte sicher, dass die Frau und ihr potenzieller Nachwuchs später gut versorgt sind. Frauen berücksichtigen in dieser Auswahl, wie attraktiv sie sich selbst einschätzen, und versuchen, eine dementsprechend möglichst gute Wahl zu treffen, erklären die Forscher. Wieviel wählerischer die Frauen bei ihrer Auswahl sind, zeigte sich darin, dass sie nur jeden dritten Mann nochmals treffen wollten, während die Männer bei jeder zweiten Frau an einem weiteren Date interessiert waren. Das decke sich mit Ergebnissen früherer Studien, nach denen sich Männer Frauen oberhalb einer gewissen unbewussten Attraktivitäts-Grenze generell als potenzielle Partnerinnen vorstellen können, so die Forscher. In weiteren Studien mit Teilnehmern von Speed Datings wollen sie nun die Kriterien der Partnerwahl noch genauer untersuchen. Peter Todd (Universität von Indiana, Bloomington) et al.: PNAS, OnlineVorabveröffentlichung, DOI: 10.1073/pnas.0705290104 ddp/wissenschaft.de – Ulrich Dewald © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 GUT ZU WISSEN - Druckversion drucken >> 29.08.2007 - Biologie Was Männer von jüngeren Frauen haben Österreichische Wissenschaftler glauben entdeckt zu haben, warum Männer jüngere Frauen und Frauen ältere Männer als Partner bevorzugen: Es verbessert ihre jeweiligen Chancen auf Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, möglichst viel Nachwuchs zu bekommen, ist nämlich bei Frauen dann am größten, wenn ihr Partner etwa vier Jahre älter ist als sie, zeigt die Auswertung einer Datensammlung von mehr als 11.000 Männern und Frauen. Für Männer ist der Fortpflanzungserfolg hingegen mit einer um sechs Jahre jüngeren Partnerin maximal. Warum gerade Beziehungen mit diesem Altersunterschied die fruchtbarsten sind, können die Forscher allerdings nicht sagen. Männer und Frauen wählen ihre Partner nach unterschiedlichen Gesichtpunkten aus, erklären die Forscher: Frauen suchen bei Männern – mehr oder weniger unbewusst – vor allem ein gesichertes Einkommen und einen hohen gesellschaftlichen Status, während Männer primär eine attraktive äußere Erscheinung wollen. Das spiegele sich in der weiblichen Vorliebe für ältere Männer genauso wider wie in der männlichen Neigung zu jüngeren Frauen, die in praktisch allen Kulturen zu finden sei. Ob dieses Faible für bestimmte Altersstufen aus Sicht der Evolution jedoch tatsächlich einen Vorteil bringt, sei bislang nicht bekannt, so die Wissenschaftler. Um das zu prüfen, durchforsteten die Forscher die Daten von 5.623 Männern und 5.999 Frauen, die zwischen 1945 und 1955 in Schweden geboren waren, und erfassten jeweils die Anzahl der Kinder, das Alter zum Geburtszeitpunkt der Kinder sowie das Alter des Partners. Ausgewertet wurden schließlich die Daten von Männern und Frauen getrennt. Das Ergebnis: Es gab in beiden Fällen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Altersunterschied der Partner und der Anzahl der Kinder. Männer hatten umso weniger Nachwuchs, je älter ihre Partnerin im Vergleich zu ihnen selbst war. Optimal war ein Abstand von knapp sechs Jahren. War die Frau noch jünger, fielen die Chancen auf Kinder wieder. Bei Frauen sah die Kurve ähnlich aus, wobei der Altersunterschied mit der maximalen Nachwuchswahrscheinlichkeit hier bei etwa vier Jahren lag. In der Realität komme ein Altersunterschied von sechs Jahren allerdings eher selten vor, berichten die Forscher. So wählen Männer nach früheren Erhebungen im Mittel Frauen, die nur etwa zweieinhalb Jahre jünger sind als sie selbst. Für interessant halten die Wissenschaftler besonders die Daten derjenigen Probanden, deren Partnerschaft nach dem ersten Kind auseinander ging: Sie entschieden sich anschließend durchgehend für jüngere Partner – möglicherweise, um ihren eigenen Fruchtbarkeitsverlust durch das zunehmende Alter zu kompensieren. Martin Fieder und Susanne Huber (Universität Wien) et al.: Biology Letters, OnlineVorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rsbl.2007.0324 ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 13.03.2007 - Psychologie Ansprechender Hüftschwung Studie: Bewegungen tragen stark zur Attraktivität eines Menschen bei Sexappeal lässt sich nicht auf Körpermaße wie breite Schultern oder eine Wespentaille reduzieren: Sich mit femininem Hüftschwung bewegende Frauen wirken attraktiver als solche, die machohaft ihre Arme bewegen, haben amerikanische Forscher in Tests mit geschlechtslosen Trickfilmfiguren gezeigt. Nach den Ergebnissen ist die Wahrnehmung von Attraktivität komplexer als bisher angenommen, denn den sozialen Informationen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Ein Mensch wirkt demnach besonders attraktiv, wenn seine Bewegungen und sein Verhalten zu seinem Äußeren und zu seinem biologischen Geschlecht passen. In einer Studie beurteilten freiwillige Teilnehmer die Attraktivität von computeranimierten Trickfilmfiguren. Die schlichten, menschenähnlichen Charaktere waren nicht als Frauen oder Männer zu identifizieren und unterschieden sich lediglich im Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang und in ihrer Art, sich zu bewegen. Als attraktiv bewerteten die Probanden einerseits Figuren mit enger Taille und breiter Hüfte, die sie beim Gehen seitlich schwangen, und andererseits Figuren mit gleichem Taillen- und Hüftumfang, die in stolzem Gang die Schultern vor- und rückwärts bewegten. In vielen westlichen Gesellschaften werden Frauen mit Wespentaille von Männern bevorzugt, wie frühere Forschungsarbeiten zeigten. Dieses Verhalten hat sich einer Hypothese zufolge in der Evolutionsgeschichte herausgebildet, weil die Körperform auf Gesundheit und Fruchtbarkeit der Frau hinweise. Das Schönheitsideal gilt jedoch nicht in allen Kulturkreisen, weshalb die Theorie stets umstritten war. Kerri Johnson und Louis Tassinary zeigen nun, dass sich Ideale nicht mit einfachen Formeln wie dem Taillen-Hüft-Verhältnis messen lassen. Zur Attraktivität trage auch bei, sich den kulturellen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechend zu verhalten, sagen die Wissenschaftler. Kerri Johnson (Universität New York) und Louis Tassinary (A&M-Universität, College Station): PNAS, Bd. 104, S. 5246 ddp/wissenschaft.de – Fabio Bergamin © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 17.01.2007 - Psychologie Wie ein Lächeln die Konkurrenz verschärft Weibliches Interesse macht Männer für andere Frauen attraktiver Wenn ein Mann von einer Frau angelächelt wird, erhöht das seine Attraktivität für andere Frauen. Gleichzeitig setzt dieses Lächeln seinen Wert in den Augen anderer Männer herab, haben schwedische Psychologen in einer Studie mit 56 Freiwilligen gezeigt. Demnach gibt es auch beim Menschen das, was Forscher "Kopieren bei der Partnerwahl" nennen – ein Effekt, der bereits aus dem Tierreich bekannt ist, denn auch bei Zebrafinken, Wachteln und einigen Fischarten verbessert das Interesse eines Weibchens die Chancen eines Männchens. Um zu untersuchen, ob soziale Faktoren einen Einfluss auf die Attraktivität potenzieller Partner haben, entschieden sich die Forscher für einen Test mit Blicken als Signal für eine vorhandene Vorliebe – schließlich vermitteln Blicke bei menschlichen Sozialkontakten einen Großteil der Informationen, so ihre Erklärung. Sie ließen also ihre je 28 weiblichen und männlichen Probanden Porträtfotos von jungen Männern ansehen und deren Attraktivität beurteilen. Anschließend bekamen die Testteilnehmer die gleichen Bilder vorgesetzt, wobei diesmal ein Frauengesicht einem der Gesichter zugewandt war und dabei entweder lächelte oder eine ernste Miene zeigte. Im letzten Teil der Studie sollten die Probanden dann noch einmal die Attraktivität der Gesichter einschätzen. Das Ergebnis: Die Gesichter, die von der Frau angelächelt worden waren, machten auf der Attraktivitätsskala der weiblichen Probandinnen im Vergleich zu vorher einige Punkte gut, während sie auf der Skala der männlichen Teilnehmer deutlich verloren. Der ernste Blick der Frau hatte dagegen genau den umgekehrten Effekt – er machte die Gesichter für die Frauen weniger anziehend und für die Männer attraktiver. Frauen werten also das Interesse einer Geschlechtsgenossin als Zeichen dafür, dass der entsprechende Mann begehrenswert sein muss und übertragen das auf ihre eigene Einschätzung, erklären die Forscher. Männer nehmen dieses gesteigerte weibliche Interesse ebenfalls wahr und betrachten das Objekt der Begierde folgerichtig als stärkere Konkurrenz, was wiederum die Attraktivität eines solchen Mannes in ihren Augen herabsetzt. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Interesse einer anderen Frau die sonst für die Partnerwahl herangezogenen Signale wie Anzeichen für Gesundheit oder Hinweise auf gute Gene ergänzt. Das sei besonders dann sinnvoll, wenn die Unterschiede zwischen potenziellen Partnern nicht sehr ausgeprägt sind oder es sehr viel Zeit und Energie kosten würde, die jeweiligen Qualitäten genauer unter die Lupe zu nehmen, so die Forscher. Benedict Jones (University of Aberdeen) et al.: Proceedings of the Royal Society B, OnlineVorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rspb.2006.0205 ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 GUT ZU WISSEN - Druckversion drucken >> 10.01.2007 - Psychologie Was Frauen immer schon begehrenswert machte Schönheit liegt wohl doch nicht nur im Auge des Betrachters: Eine schmale Taille gilt schon seit Jahrhunderten als Zeichen weiblicher Schönheit, unabhängig von kulturellen Unterschieden. Das sagen amerikanische Wissenschaftler, die englische, indische und chinesische Literatur aus mehreren Jahrhunderten analysiert haben. In allen Quellen wurde die schlanke Taille übereinstimmend als schön bezeichnet, auch wenn sich die Schilderungen weiblicher Attraktivität sonst nicht immer deckten. Damit haben die alten Schriftsteller intuitiv ein Merkmal von Gesundheit und Fruchtbarkeit beschrieben, erklären die Forscher. Für Sozialwissenschaftler ist die Beurteilung von Schönheit abhängig von subjektiven Vorlieben und kulturellen Standards. Das sehen Vertreter der so genannten evolutionären Psychologie anders, die das menschliche Denken und Verhalten mithilfe der Evolutionsgeschichte des Menschen erklären. Für sie ist Schönheit ein Zeichen für Gesundheit und Fruchtbarkeit, das dementsprechend universelle Geltung haben sollte. Um diese Theorie zu untermauern, durchforsteten die Psychologen nun die englische Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts nach Beschreibungen des weiblichen Körpers und konzentrierten sich dabei auf die Taille. Der Taillenumfang ist nämlich das einzige sichtbare Merkmal einer Frau, das nach modernem medizinischen Wissen verlässliche Aussagen über Gesundheit und Fruchtbarkeit vermittelt: Zuviel Fett am Bauch ist nicht nur ein Risikofaktor für Herzkrankheiten oder Diabetes, es verrät auch unabhängig vom Körpergewicht einen niedrigen Östrogenspiegel. Drei Körperteile wurden in der Literatur besonders oft als schön beschrieben, fanden die Forscher: die Brüste, die Taille und die Schenkel. Während es bei den Brüsten allerdings mehr auf die Form als die Größe ankam, priesen die Dichter immer nur schlanke Taillen. Obwohl auch oft mollige Frauen verehrt wurden, entdeckten die Psychologen keine einzige Erwähnung eines großen Taillenumfangs. Um die allgemeine Gültigkeit dieser Präferenzen zu überprüfen, analysierten die Wissenschaftler auch alte indische und chinesische Literatur aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Trotz kultureller Unterschiede in der Beurteilung weiblicher Attraktivität wurden auch in diesen Dichtungen immer nur schmale Taillen als schön beschrieben. Für die Autoren ist diese Übereinstimmung ein eindeutiger Hinweis auf ein allgemeines Verständnis von Schönheit. "Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei alte Kulturen dasselbe Schönheitsmerkmal allein durch Zufall hervorheben, ist äußerst klein", vermerken sie. Devendra Singh (Universität von Texas, Austin) et al.: Proceedings of The Royal Society B, Online-Vorabveröffentlichung, DOI:10.1098/rspb.2006.0239 ddp/wissenschaft.de – Annette Schneider © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 13.11.2006 - Psychologie Unterschiede machen treu Studie: Je unterschiedlicher das Immunsystem eines Paares, desto geringer ist die Neigung zum Fremdgehen Frauen neigen weniger zum Fremdgehen, wenn sich das Immunsystem ihres Partners deutlich von ihrem eigenen unterscheidet: Je unterschiedlicher die Gene, die das Immunsystem bestimmen, desto stärker fühlen sie sich vom eigenen Partner sexuell angezogen und desto seltener gehen sie fremd. Das hat ein Team aus amerikanischen Psychologen und Biologen jetzt herausgefunden. Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler 48 Paare, die in einer festen Beziehung lebten. Alle Teilnehmer gaben eine Speichelprobe ab, aus der die genetischen Informationen über das Immunsystem gewonnen wurden. Außerdem beantworteten sie in Fragebögen, wie sexuell attraktiv sie ihren derzeitigen Partner fanden und wie zufrieden sie mit dem Sex in der Beziehung waren. Beide Partner gaben außerdem an, wieviele Seitensprünge sie während der Beziehung hatten und wie stark sie sich trotz Partnerschaft auch zu anderen hingezogen fühlten. Diese Fragebögen wurden zu drei Zeitpunkten beantwortet: einmal zu Beginn der Studie, einmal während der fruchtbaren und einmal während der unfruchtbaren Tage der Frau. Waren die immunbezogenen Gene der beiden Partner ähnlicher, waren die Frauen weniger zufrieden mit dem Sex in der Beziehung und gingen öfter fremd, ergab die Untersuchung. Dieser Zusammenhang galt unabhängig von der Einstellung, die die Frauen generell zu Seitensprüngen hatten. Frauen mit ähnlichem Immunsystem wie ihr Partner fühlten sich außerdem mehr zu anderen Männern hingezogen als Frauen in Partnerschaften mit unähnlichem Immunsystem. Dies war insbesondere während der fruchtbaren Tage der Fall. Ein ähnliches Phänomen sei bereits aus dem Tierreich bekannt, schreiben die Forscher: Auch Mäuse, Vögel und Fische suchen sich bevorzugt Partner aus, die genetisch wenig mit ihnen übereinstimmen. Biologisch gesehen könnte dies dazu dienen, Inzucht zu verhindern und besonders fitte Nachkommen hervorzubringen, zum Beispiel mit einem besonders guten Immunsystem. Interessanterweise hatte in der aktuellen Studie die Ähnlichkeit der Gene auf die männlichen Partner keinerlei Einfluss. Dies könnte eine Folge davon sein, dass Frauen während der Evolution mehr Zeit damit verbrachten, den Nachwuchs aufzuziehen. Daher könnten gerade sie besondere Fähigkeiten entwickelt haben, um genetische Vorteile für ihre Nachkommen zu sichern, vermuten die Forscher. Christine Garver-Apgar (Universität von New Mexico, Albuquerque) et al.: Psychological Science, Bd. 17, S. 830 ddp/wissenschaft.de – Christine Amrhein © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 24.08.2006 - Psychologie Urteil im Schnellverfahren Menschen bewerten fremde Gesichter schon in Sekundenbruchteilen Menschen müssen Fremden nur eine zehntel Sekunde lang ins Gesicht blicken, um sich ein Bild ihres Charakters zu machen. Das haben amerikanische Psychologen gezeigt, indem sie Studenten Bilder von fremden Gesichtern beurteilen ließen. Die für den ersten Eindruck nötige Zeitspanne war dabei so kurz, dass es sich bei der Bewertung um ein rein intuitives Urteil handeln muss, schließen die Forscher. Trotzdem war die Einschätzung verblüffend genau: Selbst nach einer längeren Betrachtung der Gesichter verfeinerten die Probanden lediglich ihr Urteil, veränderten es aber nicht grundsätzlich. Die 117 Studienteilnehmer sollten insgesamt 66 Gesichter beurteilen, die für unterschiedlich lange Zeitspannen auf einem Monitor erschienen. Dazu wurden die Probanden in fünf Gruppen eingeteilt, von denen jede eine andere Eigenschaft der Gesichter bewerten sollte. So mussten die Studenten beispielsweise entscheiden, ob die gezeigte Person attraktiv, sympathisch, vertrauenswürdig, kompetent oder aggressiv war oder nicht. Anschließend sollten die Probanden angeben, wie überzeugt sie von ihrer Bewertung waren. Das Ergebnis: Für die grundsätzliche Beurteilung der verschiedenen Eigenschaften spielte es keine Rolle, ob die Probanden das Bild nur 100 Millisekunden lang gesehen hatten oder eine ganze Sekunde. Zusätzliche Zeit führte allerdings dazu, dass die Studenten sicherer wurden, das richtige Urteil getroffen zu haben. Auch konnten sie Nuancen besser erfassen als in den kürzeren Zeitspannen. Besonders schnell erkannten die Teilnehmer, ob eine Person vertrauenswürdig war oder nicht, schreiben die Forscher. Das lässt sich ihrer Ansicht nach auf die frühe Entwicklung des Menschen zurückführen: Damals sei es für das Überleben extrem wichtig gewesen, Freunde und Feinde möglichst schnell zu erkennen. Aus diesem Grund entwickelte sich ein System, das die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit ermöglicht, ohne dass sich das viel langsamere logische Denken einschalten musste. Welche Strukturen oder Eigenschaften eines Gesichts den schnellen Urteilen zugrunde liegen, wissen die Forscher bislang noch nicht. Das müsse nun in einer weiteren Studie geprüft werden, kommentieren sie. Janine Willis, Alex Todorov (Princeton-University): Psychological Science, Bd. 17, S. 592 ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 14.06.2006 - Gesundheit Kurven im Wechsel der Jahreszeiten Hormonschwankungen verändern die weibliche Körperform im Lauf des Jahres Wie ausgeprägt die Kurven einer Frau sind, hängt nicht zuletzt von der Jahreszeit ab: Die Verteilung des Körperfetts im Lauf eines Jahres verändert sich, haben kanadische Forscher entdeckt. So wandert Fett, das sich im Frühjahr auf den Hüften befindet, im Lauf des Sommers und des Herbstes in Richtung Taille und verwischt dabei die typisch weiblichen Konturen. Verantwortlich dafür sind nach den Ergebnissen der Wissenschaftler Schwankungen des Testosteronspiegels, der im Herbst deutlich höher liegt als im Frühjahr. Ob diese Figurveränderungen jedoch ausgeprägt genug sind, um ins Auge zu fallen, sei eher zweifelhaft, schreiben die Forscher. Für ihre Studie untersuchten Sari van Anders und ihr Team Speichelproben von 220 Frauen und 127 Männern auf das männliche Geschlechtshormon Testosteron. Außerdem bestimmten die Forscher bei den weiblichen Probanden das Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang. Je größer dieses Verhältnis dabei ist, desto weniger ausgeprägt sind die typisch weiblichen Rundungen mit schmaler Taille und runden Hüften. Das Ergebnis: Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen war der Testosteronspiegel im Herbst am höchsten und im Frühjahr am niedrigsten. Parallel dazu veränderte sich auch das Taillen-Hüft-Verhältnis bei den Frauen, entdeckten die Forscher. Im Frühjahr war es am kleinsten und nahm dann im Lauf des Sommers stetig zu, bis es im Herbst seinen höchsten Wert erreichte. Demnach erscheinen Frauen mit ihren ausgeprägteren Kurven im Frühling am weiblichsten und im Herbst am wenigsten weiblich. Da es bereits in früheren Studien Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Taillen-HüftVerhältnis und der Attraktivität einer Frau gegeben habe, sei es wahrscheinlich, dass die Frauen daher im Frühjahr attraktiver wirkten als im Herbst, erklären die Forscher. Auch wurden kurvige Figuren in verschiedenen Untersuchungen mit einem besseren Gesundheitszustand und einer besseren Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Ob die Veränderungen der Figur während der Jahreszeiten jedoch tatsächlich von Männern bewusst wahrgenommen würden oder ob sie einen unbewussten Einfluss ausüben, können die Forscher noch nicht sagen. Sie wollen nun untersuchen, ob auch andere Eigenschaften wie das Verhalten oder die geistige Leistungsfähigkeit von den jahreszeitlichen Testosteronschwankungen beeinflusst werden. Sari van Anders (Simon-Fraser-Universität, Burnaby) et al.: Psychoneuroendocrinology (Online-Vorabveröffentlichung, DOI: 10.1016/j.psyneuen.2006.03.002) ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel Körper © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 NEWS - Druckversion drucken >> 24.05.2006 - Psychologie Was eine schlechte Kindheit mit Frauengesichtern anstellt Studie: Stress in jungen Jahren macht weniger attraktiv und maskuliner Frauen aus zerrütteten Elternhäusern ist die schwere Kindheit auch mit Anfang zwanzig noch ins Gesicht geschrieben: Sie wirken weniger attraktiv, weniger gesund und maskuliner als Altersgenossinnen, die in einem intakten Elternhaus aufgewachsen sind. Das haben britische Psychologen in Tests mit mehr als zweihundert Studentinnen gezeigt. Der Stress durch häufigen Streit in der Familie präge das Aussehen ebenso wie hormonelle und genetische Faktoren, erklären die Forscher. Die Wissenschaftler fotografierten für ihre Untersuchung insgesamt 219 Psychologiestudentinnen und befragten sie nach ihrer Kindheit. Unter anderem wollten die Forscher wissen, ob und wann die Eltern sich getrennt hatten und ob es häufig Streit oder andere Schwierigkeiten in der Familie gegeben hatte. Aus den Teilnehmerinnen wählten die Forscher anschließend die 15 Probandinnen mit dem harmonischsten Elternhaus aus. Die zweite Gruppe bildeten die 15 Teilnehmerinnen, bei denen es am häufigsten Streit gegeben hatte. Als dritte Gruppe wählten die Forscher ebenfalls 15 Probandinnen aus, bei denen sich die Eltern schon vor der Pubertät der Mädchen getrennt hatten. Die 15 Fotos jeder Gruppe überlagerten die Forscher auf elektronischem Weg zu einem einzigen Portrait und ließen dieses von knapp fünfzig zufällig ausgewählten Versuchspersonen beurteilen. Die Betrachter stuften die Attraktivität des Portraits, das aus den Fotos der Frauen aus glücklichem Elternhaus zusammengesetzt war, als am höchsten ein. Dieses Gesicht wirkte zudem am gesündesten und am wenigsten maskulin. Hingegen wirkte das Portrait der Frauen, die in einem Elternhaus mit viel Streit aufgewachsen waren, am wenigsten attraktiv, weniger gesund und am maskulinsten. Das Bild aus den Fotos der Frauen getrennt lebender Eltern lag in der Beurteilung in den drei Kategorien etwa dazwischen. Jahrelanger Stress in der Familie beeinträchtige nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Aussehen, erklären die Wissenschaftler die Ergebnisse. Hier spiele nicht nur das Stresshormon Cortisol eine Rolle, sondern auch die Tatsache, dass verkrachte Familien häufig generell einen ungesünderen Lebensstil pflegen. Auch genetische Faktoren könnten hinter den Ergebnissen stehen, glauben die Forscher: Töchter besonders maskuliner Männer, die häufig auch schlechtere Familienväter sind, tragen ebenfalls bevorzugt maskuline Züge. Lynda Boothroyd (Universität von St. Andrews) und David Perrett (Universität von St. Andrews ): Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, OnlineVorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rspb.2006.3579 ddp/wissenschaft.de – Ulrich Dewald Aussehen © wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 2006 Im Folgenden finden Sie Links zu deutschsprachigen Forschern und Instituten, die sich schwerpunktm��ig mit Attraktivit�tsforschung besch�ftigen. Karl Grammer Karl Grammer ist wohl der international bekannteste deutschsprachige Attraktivit�tsforscher. Er leitet (zusammen mit Iren�us Eibl-Eibesfeldt) das Ludwig Boltzmann Institute for Urban Ethology in Wien und befasst sich - aus strikt soziobiologischer Perspektive - schwerpunktm��ig mit der Rolle von Attraktivit�t im menschlichen Paarungsverhalten. Karl Grammer ist der Autor des Buches �Signale der Liebe� (siehe B�cherliste). Ronald Henss Ronald Henss arbeitete bis 2004 an der Abteilung f�r Psychologie der Universit�t des Saarlandes. Zusammen mit Karl Grammer ist er einer der Pioniere der deutschsprachigen Attraktivit�tsforschung und wohl der weltweit beste Kenner in Sachen Urteiler�bereinstimmung (der jedoch international recht wenig wahrgenommen wurde, da seine B�cher (siehe B�cherliste) und ein gro�er Teil seiner Forschungsarbeiten auf Deutsch publiziert wurden). Manfred Hasssebrauck Manfred Hassebrauck ist Professor f�r Sozialpsychologie an der Bergischen Universit�t Wuppertal. Er besch�ftigt sich mit Fragen der Urteiler�bereinstimmung, Kontexteffekten und anderen Bedingtheiten des Attraktivit�tsurteils sowie mit Fragen der Partnerwahl (siehe auch B�cherliste) Martin Gr�ndl Martin Gr�ndl ist Psychologe an der Universit�t Regensburg und Experte im �Morphen� von Gesichtern. Er ist einer der Autoren der Studie Beautycheck, die sich mit der Frage nach den �Zutaten� zur Attraktivit�t von Gesichtern, insbesondere Durchschnittlichkeit, Symmetrie und Babyface besch�ftigt. Johannes H�nekopp Johannes H�nekopp ist Psychologe an der Technischen Universit�t Chemnitz und besch�ftigt sich mit Fragen der Urteiler�bereinstimmung, Symmetrie und der Wirkung pr�nataler Geschlechtshormone auf Attraktivit�tswahrnehmung und sexuelles Verhalten. Thomas Jacobsen Thomas Jacobsen ist Psychologe an der Universit�t Leipzig und besch�ftigt sich mit der Frage, was in unserem Hirn vor sich geht, wenn wir �Reize� als sch�n empfinden. Im Mittelpunkt seines Interesses steht dabei die �sthetik von Kunst und Musik, aber auch (zusammen mit seiner Mitarbeiterin Lea H�fel) das menschliche Gesicht. Eckart Voland Eckart Voland war urspr�nglich Primatenforscher und ist heute Professor f�r �Philosophie der Grundlagenwissenschaften� am Zentrum f�r Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft an der Universit�t Gie�en. Er besch�ftigt sich sehr intensiv mit dem Handicap-Prinzip (�Angeber haben mehr vom Leben�, siehe B�cherliste), sowie mit der sog. �Gro�m�tter-Hypothese�. Bernhard Fink Bernhard Fink ist Humanbiologe und Psychologe und arbeitet heute an der �G�ttinger Soziobiologie�. Der ehemalige Mitarbeiter von Karl Grammer am Institut f�r Human�kologie interessiert sich schwerpunktm��ig f�r Fragen von Symmetrie, sexuellem Dimorphismus und der Wirkung pr�nataler Hormone. Lars Penke Lars Penke ist Psychologe an der Humboldt Universit�t Berlin. Schwerpunkt seiner Forschungen sind evolutionspsychologische Fragen, haupts�chlich zu Partnerwahl und Partnerschaft. Tobias Greitemeyer Tobias Greitemeyer arbeitet am Department Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen und besch�ftigt sich haupts�chlich mit der Auswirkung von Attraktivit�t auf die Partnerwahl. Alexander Pashos Alexander Pashos ist Anthropologe an der Abteilung f�r Humanbiologie und Anthropologie an der Freien Universit�t Berlin. Er besch�ftigt sich mit Geschlechtsunterschieden bei den Partnerwahlkriterien. 09.10.2007 - Medizin Lukrative Fruchtbarkeit Stripteasetänzerinnen verdienen um die Zeit ihres Eisprungs herum mehr Während ihrer fruchtbaren Tage verdienen Stripteasetänzerinnen am meisten Geld. Das sagen amerikanische Wissenschaftler, die den Einfluss des weiblichen Zyklus auf die Verdienste der Tänzerinnen untersucht hatten. Wahrscheinlich nehmen Männer unbewusst wahr, wann eine Frau am fruchtbarsten ist, vermuten Geotfrey Miller und seine Kollegen. Über 60 Tage hinweg sammelten die Forscher Daten von 18 Tänzerinnen und zeichneten ihre Arbeitszeiten und Einnahmen sowie den Zeitpunkt ihrer Menstruation auf. In den Tagen um den Eisprung nahmen die Tänzerinnen während einer Fünf-Stunden-Schicht im Schnitt 335 US-Dollar ein, erklären die Wissenschaftler. In der sich daran anschließenden Gelbkörperphase, in der das Hormon Propesteron die weibliche Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet, verdienten die Tänzerinnen dagegen nur 260 Dollar pro Schicht. Während der Menstruation selbst waren es nur noch 185 Dollar. Tänzerinnen, die die Antibabypille einnahmen, verdienten meist weniger als ihre Kolleginnen. Anders als bei vielen Säugetieren ist bei Frauen die fruchtbare Phase im Monatszyklus nicht offensichtlich erkennbar. Trotzdem spüren Männer wohl unbewusst, wann eine Frau fruchtbar ist, erklären die Forscher. Wie Frauen dies jedoch mitteilen, etwa durch bestimmte Pheromone, wissen auch Miller und seine Kollegen nicht. Karl Grammer, Psychologe an der Universität Wien, vermutet dagegen, dass der erhöhte Ostrogenspiegel während des Eisprungs die Bewegungen der Frauen beeinflusst. Durch die veränderte Art zu tanzen würden so die Männer merken, dass die Stripteasetänzerin sich in der fruchtbaren Phase ihres Monatszyklus befindet. Science. Onlinedienst Originalarbeit der Forscher: Geoffrey Miller (Universität von New Mexico in Albuquerque) et al.: Evolution and Human Behavior, DOl: 10.101 6/j.evolhumbehav.2007.06.002 ddp/wissenschaft.de — Anja Basters 22.12.2005 - Psychologie Warum Frauen gute Tänzer lieben Forscher finden Zusammenhang zwischen Tanzbegabung und symmetrischem Körperbau Der Körper von guten Tänzern ist gleichmäßiger gebaut als der von Menschen, die sich auf der Tanzfläche eher ungelenkig bewegen. Das haben amerikanische Wissenschaftler gezeigt. Dieser Zusammenhang könnte erklären, warum Frauen gut tanzende Männer besonders anziehend finden, sagen die Forscher: Ein gleichmäßiger Körperbau wird häufig mit körperlicher Fitness in Zusammenhang gebracht. Die Wissenschaftler hatten zunächst mit einer so genannten Motion-captureKamera die Tanzbewegungen von jeweils zwanzig männlichen und weiblichen Jamaikanern aufgezeichnet, in deren Kultur Tanzen eine wichtige Rolle bei der Partnerwerbung spielt. Zuvor hatten Abmessungen verschiedener Körperteile wie Ellenbogen, Finger, Füße oder Ohren ergeben, dass die Hälfte der Frauen und Männer einen symmetrischen und die andere Halfte einen eher unsymmetrischen Korperbau aufwies. Die Forscher legten dann die Videoaufnahmen, die keine Rückschlüsse auf Geschlecht, Kleidung, Körpergröße oder Attraktivität der einzelnen Tänzer zuließen, 155 Frauen und Männern zur Beurteilung vor. Die Ergebnisse: Unabhängig vom Geschlecht des Beurteilers wurden Tänzer mit gleichmäßigem Körperbau generell besser bewertet als die Tanzkünste ihrer weniger symmetrischen Mitbewerber. Dasselbe Resultat ergab sich, als die Forscher das Geschlecht der urteilenden Testpersonen berücksichtigten, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Zwar bevorzugten sowohl Männer als auch Frauen Tänzer mit gleichmäßigem Körperbau, aber besonders deutlich war der Effekt bei den Frauen. Sie achten bei ihrem Urteil viel stärker auf einen ausgewogenen Körperbau der Tänzer als die Männer. Warum ein gleichmäßiger Körperbau mit ausgeprägten Tanzkünsten einhergeht, wissen die Forscher bislang nicht. Möglicherweise hänge die Symmetrie mit der neuromuskulären Koordination oder dem Gesundheitszustand zusammen, vermuten die Forscher. In weiteren Studien wollen sie nun klären, ob es auch einen Zusammenhang gibt zwischen der Tanzbegabung und dem Erfolg beim anderen Geschlecht. William Brown (Rutgers-Universität, New Brunswick) et al.: Nature, Bd. 438, S. 1148 ddp/wissenschaft.de — Martina Feichter Tanzen Aus Diverses Winter 2001/2002 Um Zeiten des Nahrungsmangels zu überstehen, konnte man entweder versuchen, Vorräte anzulegen, oder sich selber am Körper Reserven, z.B. in Form von Fettdepots, anzulegen. Um sich äußere Vorräte anlegen zu können, mußten aber folgende Bedingungen erfüllt sein: Man brauchte eine Nahrungsgrundlage, die sich auch dazu eignete, über längere Zeit haltbar gemacht zu werden, z.B. Nüsse, Getreide, Trockenfleisch, während dies z.B. bei Meeresfrüchten, Beeren oder Gemüse viel schwieriger ist. Man brauchte die entsprechende Technik und Erfahrung, um Lebensmittel längere Zeit aufbewahren zu können. In erster Linie war es aber wichtig, rechtzeitig zu wissen, wann eine Mangelsituation entstehen würde. um sich vorbereiten zu können. Mangel mußte also durch jahreszeitliche Veränderungen, z.B. im Winter in nördlichen Breiten, bedingt sein, oder zumindest mußten rechtzeitig darauf hinweisende Indizien zu sehen sein. Und der vorhersehbare Mangel sollte dann auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, bzw. Sicherheit eintreffen, um nicht zu oft unnötigen Aufwand treiben zu müssen. Vorratshaltung hatte aber immer den Nachteil, daß man die Vorräte erstens bewachen mußte, und auch bei bester Vorbereitung kam es immer wieder vor, daß mehr oder weniger viel verdarb, von Mäusen gefressen, oder von Insekten befallen wurde. Dafür hatte es aber den Vorteil, Vorräte für längere Zeiträume, für Wochen und Monate, anlegen zu können. Für körpereigene Fettdepots gilt dies nicht. Diese Vorräte reichen nur eine begrenztere Zeit. Dafür hatte es aber auch nicht all die oben erwähnten Nachteile. Körperliche Reserven waren also dann im Vorteil, wenn Nahrungsmangel immer wieder zeitlich unerwartet auftritt, und wenn die Mangelzeit nicht zu lange andauert. In Gebieten mit diesen Bedingungen könnten also Menschen mit Fettreserven deutlich im Vorteil gewesen sein. Dies könnte sich auch im herrschenden Schönheitsideal niederschlagen, daß also mollige Menschen als schön gelten. Am wichtigsten ist das Überbrücken von Notzeiten, auch wenn sie nur kurz andauern, für schwangere oder stillende Frauen, die ohne Vorräte ihren Reproduktionserfolg verringern würden. Damit müßten aber gerade vollschlanke Frauen in diesen Gebieten bevorzugt werden. Ein unvorhersehbarer Nahrungsmangel konnte entstehen, wenn durch Stürme, Hurrikans, Überschwemmungen, usw. die Fauna und Flora eines Gebietes stark betroffen wurde. Man müsste überprüfen, ob nicht in Gebieten, in denen es gelegentlich zu derartigen Erscheinungen kommt, sich nicht tatsächlich das Schönheitsideal der Üppigkeit entwickelt hat. Ähnliche Überlegungen dürften gelten, wenn in einem Gebiet die Möglichkeiten des Nahrungserwerbs ständig sich änderten, also wenn sich Zeiten des Mangels und des Überflusses abwechselten, ohne vorhersehbaren Rhythmus. Auch in diesen Gebieten sollte man das herrschende Schönheitsideal überprüfen. Fettdepots hatten aber immer den Nachteil, daß der Betreffende für körperliche Bewegungen mehr Energie brauchte, da er mehr Gewicht zu bewegen hatte. Also konnten sich in Gebieten, in denen man sich weiter bewegen mußte, und dabei auch noch Steigungen zu überwinden hatte, die körperlichen Fettdepots weniger bewähren, da sie mit mehr Nachteilen verbunden waren. In Bergvölkern konnte man sich also Fettdepots weniger leisten als z.B. auf einer Südseeinsel, die in der Regel flach sind und deren Bewohner kürzere Strecken zurücklegen mußten. Auch für die Beweglichkeit bei aggressiven oder kriegerischen Auseinandersetzungen waren Fettdepots hinderlich. Also konnten sie sich nur dann ausbilden, wenn eine Population relativ friedlich war oder nur bei dem Geschlecht, das weniger aggressive Handlungen verübte, also meist den Frauen. So konnte sich bei den vergleichsweise friedlichen Südseebewohnern bei beiden Geschlechtern körperliche Molligkeit als vorteilhaft erweisen, und auch das herrschende Schönheitsideal beider Geschlechter prägen, während z.B. für die kriegerischen arabischen Völker sich dies nur bei den weiblichen Mitgliedern ausbilden konnte, aber nicht bei den Männern. In vielen menschlichen Kulturen fand man nicht nur eine äußerliche Veränderung des menschlichen Körpers, z.B. durch Körperschmuck, Körperbemalung und Tätowierungen, sondern noch viel massivere Eingriffe in den Körper. Man könnte deshalb jeweils überlegen, welchen Einfluß diese Eingriffe auf die Reproduktion hatten. •In China wurden den weiblichen Kindern die Füße bandagiert und durch dieses Wickeln verkrüppelten die Fußknochen, da sie nicht mehr normal weiter wachsen konnten. Zum Einen führte dies zu einer besseren Uberwachung der Frauen, da sie sich nur noch unter erschwerten Bedingungen, wenn überhaupt, fortbewegen konnten. Und damit sank das Risiko ihres Partners, daß sie fremdgehen könnte, also stieg die Vaterschaftssicherheit. Nebenbei wird spekuliert, ob durch die Veränderung in der Fortbewegungsweise nicht bestimmte Beinmuskeln anders trainiert werden als unter normalen Wachstumsbedingungen. Und diese veränderte Muskelausbildung soll zu Veränderungen im Bewegungsablauf bei der Sexualität führen, und dadurch das Vergnügen für die Männer größer werden. Aber auf alle Fälle bedeutete eine Verkrüppelung der Frauen, dass deren Männer keinen zu niedrigen Rang haben konnten, um es sich überhaupt leisten zu können, eine Frau zu haben, die selber wenig zur Arbeitsleistung der Familie beitragen konnte und deshalb die anfallende Arbeit von anderen erledigt werden mußte. Damit wäre die Verkrüppelung der Ehefrau ein starkes Indiz für einen hohen Rang ihres Partners, also reproduktionssteigernd. •In einigen afrikanischen Gesellschaften wurden (und werden) die Mädchen beschnitten, indem ihnen operativ die Klitoris entfernt wurde. Dies führte bei den betroffenen Frauen zu einer deutlichen Verringerung der Genußfähigkeit beim Geschlechtsverkehr. Auch der weibliche Orgasmus wurde dadurch so gut wie unmöglich. Und wenn Frauen durch die Sexualität weniger Genuß empfinden, sinken die Risiken, daß sie fremdgeht, und dadurch steigt die Vaterschaftssicherheit. Also eine Strategie zur Steigerung der Reproduktion des Partners. •(Damit wäre zu überlegen, ob nicht auch andere kulturell geförderte Methoden zur Verringerung der weiblichen Libido nicht die Reproduktion ihrer Partner fördern. Damit wäre die kulturell geförderte oder begünstigte Frigidität von Frauen eine die Reproduktion maximierende Strategie der Männer.) •In ägyptischen und in aztekischen Kulturen wurde die Kopfform im Kindesalter durch massive Eingriffe verändert. Dies geschah vor allem bei hochrangigen Kindern. Mit Hilfe von Holzkonstruktionen wurde dabei der Schädel deformiert, mit dem Ziel, den Hinterkopf zu vergrößern. Damit scheint es vielleicht einen Zusammenhang von Schädelgröße oder Kopfform mit der Ranghöhe zu geben. •In afrikanischen Kulturen wurde mit Hilfe von Metallringen die Länge des Halses bei Frauen verändert. Und dies in einem Ausmaß, daß die betroffenen Frauen diese Ringe nie wieder entfernen konnten, ohne dadurch zu ersticken. Die Proportion des Halses könnte eine Aussagekraft für die Attraktivität einer Frau besitzen, und damit dient dieser Eingriff der Erhöhung der Reproduktionschancen der Frauen, und nicht ihrer Partner, wie in den oben angeführten Beispielen. •In europäischen und amerikanischen Kulturen wurden Frauen in der Taille geschnürt. Dadurch veränderte sich das optische Verhältnis von Hüfte zur Taille, um den Männern das Bild einer fruchtbaren, aber nicht schwangeren Frau zu vermitteln, also die Attraktivität der Frauen für die Männer zu erhöhen. Auch wenn dies zur Konsequenz hatte, daß die geschnürten Frauen unter chronischer Atemnot litten und wegen Sauerstoffmangel häufig ohnmächtig wurden und sich nur sehr begrenzt bewegen konnten. Aber diese Nachteile wogen weniger als die mögliche Erhöhung der Chancen der Reproduktion, denn je attraktiver man als Frau eingeschätzt wird, um so höher im Rang sind die Partner. Zusammenfassend läßt sich wohl sagen, daß alle körperlichen Veränderungen folgende Ziele verfolgen: 1.Steigerung der Reproduktionschancen des Individuums durch eine Steigerung der Attraktivität oder durch eine Erhöhung der Position in der Hierarchie 2.Steigerung der Reproduktionschancen des Partners des betroffenen Individuums durch seine Erhöhung in der Rangfolge oder durch eine Vergrößerung der Vaterschaftssicherheit. •Um die Attraktivität zu steigern, muss man beim eigenen Körper einen Eingriff erdulden. •Als Indizien für eine hohe Rangfolge können sowohl Eingriffe in den eigenen Körper als auch in den des Partners sinnvoll sein. •Um die Sicherheit der Vaterschaft zu erhöhen, musste man beim Körper des weiblichen Partners, und nicht bei sich selbst, einen Eingriff vornehmen. Damit wären die beiden ersten Punkte im Interesse der Fitness beider Partner, während die Manipulationen aufgrund der Vaterschaftssicherheit einseitige Interessen verfolgt, also im Sinne des männlichen Partners und gegen die Interessen des weiblichen Partners erfolgen. Und daher lassen sie sich nur praktizieren, wenn die beiden Geschlechter unterschiedlich hohe Möglichkeiten besitzen, die eigenen Interessen zu verfolgen.