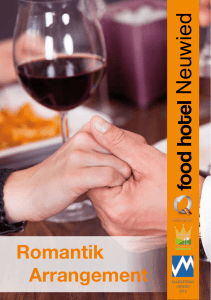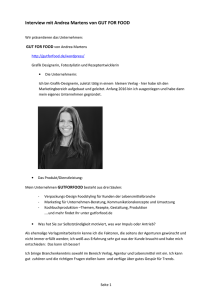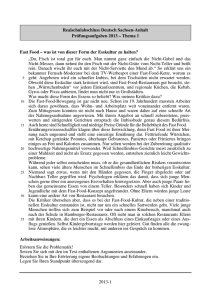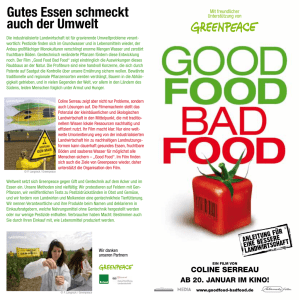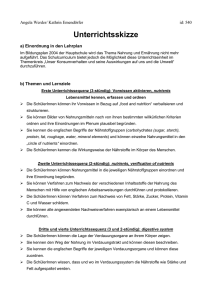Wie weit darf Essen reisen? TA_Das Magazin v. 21. 05. 2011
Werbung

Wie weit darf Essen reisen? Beim Essen stehen alle Zeichen auf lokal. Doch die Distanz zwischen Herkunft und Kochtopf sagt wenig aus über die Nachhaltigkeit eines Produkts. Von Guido Mingels Bild Florian Kalotay Einmal kaufte ich für ein Gelage in meiner Studenten-WG gedankenlos eine Lammkeule aus Neuseeland. Frühe Neunziger, lange her. Als das schöne Fleisch nach Stunden des Kochens endlich auf dem Tisch stand, setzte in der Runde eine ausführliche Diskussion über seine Herkunft ein. Schon verrückt eigentlich, ein Schaf aus Neuseeland zu essen. Wie viele tausend Kilometer das Tier wohl unterwegs gewesen sei bis hierher. Ob jemand eine Vorstellung davon habe, welche Schadstoffmengen Flugzeug oder Schiff produziert hätten beim Transport. Einer der Gäste, sehr grün im Herz, weigerte sich sanft, aber bestimmt, von dem weit gereisten Hammel zu essen. Es wurde ein verspannter Abend. Das waren nur Vorzeichen einer späteren gesellschaftlichen Bewegung, deren Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Heute stehen beim Essen alle Zeichen auf lokal. Zurück zu den Wurzeln, zum Regionalen, zur Eigenproduktion. Wer Wert auf ein reines kulinarisches Gewissen legt, kauft, so oft es geht, auf dem Biomarkt ein, drückt der Bäuerin aus der Region das Bargeld in die schmutzige Hand für die Birnen, die sie selbergepflückt hat. Beim Sonntagsausflug in die Provinz gehören die Schilder am Strassenrand — «FRISCHE HÄRD-ÖPFEL», «HIER EIER» —, die auf die zahllosen Bauernhofläden hinweisen, längst zum Landschaftsbild. Die Lebensmittelwerbung macht sich die neue Sehnsucht nach Selbstversorgung seit geraumer Zeit als Verkaufsargument zunutze. Kaum ein Produkt kommt mehr aus ohne den Hinweis auf die einheimische Herkunft oder wenigstens die Illusion davon. Das Migros-Huhn läuft persönlich vom Hof in die Stadtfiliale und legt seine Eier direkt in den Karton. Die CoopVerkaufsbroschüre «Verde» stellt einen pittoresken Kleinbauern und Schafzüchter aus dem Gürbetal vor, auf den Fotos sieht man die Kinder der Familie, wie sie auf der Wiese mit den Bio-Lämmern spielen; der Text besingt dann die pikanten Schafswürste, zu denen die Tiere werden. In den USA hat die «Local Food»-Bewegung bereits eine Art neuen Gattungsbegriff geprägt für die Anhänger ihrer Philosophie: «Locavores» nennen sich die «Lokal-Fresser», in Anlehnung an den biologischen Begriff der Karnivoren, der fleischfressenden Tiere. Lokal einzukaufen ist nicht mehr bloss ein schönes Zusatzvergnügen, es ist ein moralischer Öko-Imperativ geworden, ähnlich dem Gebot zum Recycling oder zum Fahren eines Hybrid-Autos. Währungseinheit dieser kulinarischen Correctness sind die «Food Miles», Essens-Kilometer, also die Distanz, die ein Produkt zurücklegt zwischen Herkunft und Teller. Der kritische Konsument zählt heute beim Shopping innerlich seine Food Miles wie Kalorien. Was den vermeintlichen Öko-Radius oder die Landesgrenzen überschreitet, kommt nicht in die Tüte. In verschiedenen Ländern gibt es Bestrebungen von Umweltschutzorganisationen, dass die zurückgelegten Food Miles auf jedem Produkt angegeben werden müssen. Die Gleichung der Lokalversorger geht so: je mehr Food Miles, desto mehr CO2-Ausstoss, desto verwerflicher die Ware. Aber: Food Miles sind ein schlechter Gradmesser für Nachhaltigkeit. Schadstoffbilanz Denn die Schadstoffbilanz eines Lebensmittels entsteht mitnichten nur bei dessen Transport zwischen den Ländern A und B. Will man realistisch einschätzen, wie gut oder schlecht das Lamm aus Neuseeland oder die Bohnen aus Kenia für die Umwelt sind, muss man unbedingt auch berücksichtigen, wie es um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen bestellt ist, die bei der Produktion dieser Güter im Herkunftsland entstehen. Andererseits dürfen auch jene Food Miles in der Rechnung nicht fehlen, die im importierenden Land selbst zurückgelegt werden: die Lastwagenfahrten zur Feinverteilung der Güter, die Einkaufstouren durch die Endverbraucher von zu Hause zum Laden und zurück. Eine Studie der englischen Umweltbehörde DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) führte zu einem überraschenden Ergebnis: Volle 82 Prozent der Wegstrecke, die von allen in Grossbritannien konsumierten Lebensmitteln gesamthaft zurückgelegt wird, waren im Land selber angefallen, nicht beim internationalen Transport. Dabei waren die Shoppingtrips der Konsumenten verantwortlich für 48 Prozent dieser Food-Meilen, inländische Lastwagenfahrten zur Distribution für 31 Prozent. Millionen kurzer Fahrten mit winzigen Mengen im Kofferraum führen eben zu einer grösseren Kilometerzahl als die vergleichsweise wenigen langen Fahrten mit riesigen Mengen durch die hocheffizienten Containerschiffe auf den Weltmeeren. Auf die ökologisch besonders bedenkliche Luftfracht entfielen sogar weniger als 1 Prozent aller Food Miles. Betrachtet man zudem den Lebensmitteltransport im Rahmen der gesamten Umweltbilanz Englands, so ist er für nur 1,8 Prozent des totalen CO2-Ausstosses verantwortlich. «Global-Fresser» Ergebnisse wie dieses kann man zum Beispiel nachlesen bei einem Mann, der sich anschickt, zum prominenten Feindbild aller Locavores zu werden. Das Wortspiel weiterführend, bezeichnet sich der kanadische Umweltgeograf Pierre Desrochers von der Universität Toronto selbst als «Globavore», «GlobalFresser», und sein neustes, für Herbst 2011 ange- 2 kündigtes Buch trägt den Untertitel «Eine Hymne auf das 10 000-Meilen-Menü». Desrochers hält den Trend zu einheimischen Zutaten für eine «romantische Verklärung» und einen «Marketing-Gag», der «die Konsumenten davon abhält, sich mit den wirklich wichtigen Fragen einer nachhaltigen globalen Landwirtschaft zu beschäftigen». Entscheidend sind laut Desrochers nicht die Transportwege, sondern die Anbaubedingungen, also die simple Frage: Wo kann welches Lebensmittel am effizientesten und umweltverträglichsten produziert werden? Nach diesem Prinzip hat sich die Landwirtschaft, so Desrochers, in den letzten paar Hundert Jahren von der lokalen Subsistenzwirtschaft wegbewegt zu einem globalen Wettbewerb, «und jetzt wollen FoodAktivisten zurückkehren zu Methoden, denen schon unsere Grossväter abgeschworen haben». Er zitiert eine amerikanische Untersuchung, wonach nur 4 Prozent aller in den USA durch den Lebensmittelsektor verschuldeten CO2-Emissionen auf Langstreckentransporte zurückgehen, 83 Prozent aber auf das Produktionsstadium dieser Güter. Zum Beispiel Äpfel Die bereits erwähnte DEFRA-Erhebung verglich beispielsweise die CO2-Bilanz einheimischer Tomaten mit aus Spanien importierten Artgenossen. 2,4 Kilo CO2 pro Tonne waren für die im Treibhaus gezogenen britischen Tomaten nötig, nur 0,6 Kilo pro Tonne für die an der spanischen Sonne gereiften — Transport inbegriffen. Besonders stark ins Gewicht fällt in der Statistik oft die lokale Lagerung und Kühlung von einheimischen Produkten. So ergab eine andere Studie, dass der Energieaufwand für die Lagerung britischer Äpfel pro Tonne höher ist als jener für den Export einer Tonne Äpfel aus Neuseeland. Weil die neuseeländische Erntezeit zeitlich zusammenfällt mit dem englischen Winter, wenn einheimische Äpfel bereits Monate im Lagerhaus verbrachten, ist es in der Wintersaison ökologischer, die Früchte aus Neuseeland zu kaufen. Eine andere Untersuchung verglich Schnittblumen aus Holland und Kenia für den englischen Markt: Die kenianischen Rosen, unter idealen klimatischen Bedingungen angebaut, aber per Luftfracht aus Afrika nach London transportiert, haben eine sechsmal bessere CO2-Bilanz als die holländischen, in Gewächshäusern produzierten Pflanzen. Warum eigentlich, fragt Pierre Desrochers an anderer Stelle, stört sich niemand an den vielen Tausend Kilometern, die andere Güter wie Computer oder Kleider zurücklegen? Warum zählt niemand T-Shirtoder Laptop-Meilen? Während nämlich Laptops vor allem in der Ersten Welt produziert werden, trifft der Konsumentenentscheid gegen importiertes Gemüse oder Früchte oft Entwicklungsländer. In Ländern wie etwa Burundi, Ghana, Malawi, Nicaragua und Panama, die ihre Spezialitäten mit einem Bruchteil des Energie-bedarfs produzieren, der in der westlichen Welt dazu nötig ist, machen Lebensmittel mehr als 75 Prozent der gesamten Exportwirtschaft aus. Der westliche Trend zur Stigmatisierung weitgereister Lebensmittel ist insofern nicht nur ökologisch sinnlos, sondern auch ökonomisch ungerecht. Es gibt gute Gründe, lokale Esswaren einzukaufen, aber sie sind nicht ökologischer Natur: Die Sachen schmecken oft besser und frischer, das Einkaufserlebnis ist angenehm, und der soziale Zusammenhalt wird gestärkt. Wer gar einen eigenen Gemüsegarten bewirtschaftet oder sich ein paar Hühner hält, kann daraus viel Zufriedenheit schöpfen. Und natürlich steht es Ernährungsextremisten frei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Biomarkt zu fahren, alle Pasta selber anzufertigen, niemals Reis zu essen und ausschliesslich saisongerechte Frischprodukte zu konsumieren, die möglichst von Betrieben stammen, die keine landwirtschaftlichen Subventionen bekommen, um den Markt nicht zu verfälschen. Das ist aber nicht nur ziemlich genussfeindlich,sondern auch zeitaufwendig und kostspielig. Und selbst wenn es ein paar Leute in der Ersten Welt schaffen, nach solchen oder ähnlichen Grundsätzen zu leben, so kann man von der Local-Food-Bewegung doch nichts lernen, was die realen Probleme des globalen Ernährungssystems lösen helfen würde. Historisch gesehen, war Selbstversorgung immer gleichbedeutend mit Armut. Noch mal zum Lammbraten aus Neuseeland: Für die Schweiz fehlen leider Zahlen, aber die englischen Werte geben einen guten Anhaltspunkt. Ein neuseeländisches Schaf, sagt die Statistik, verursacht auf seinem Weg nach London vier Mal weniger CO2 als eines aus Wales. •