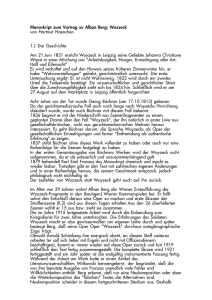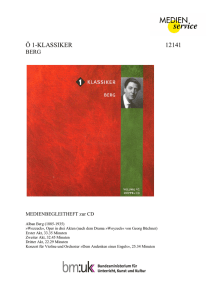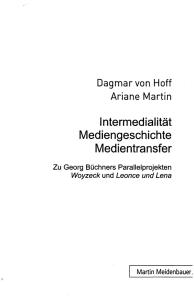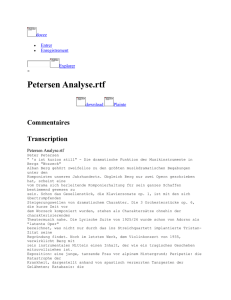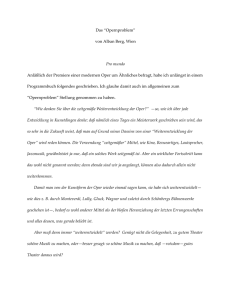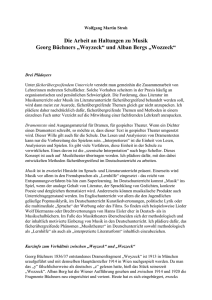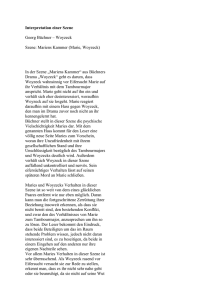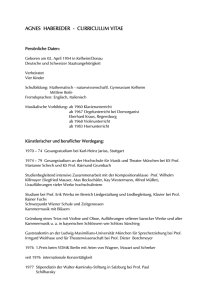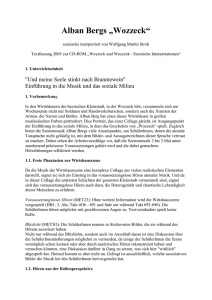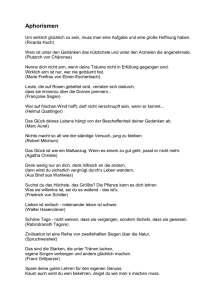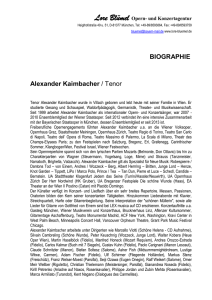Der letzte Faden
Werbung

Der letzte Faden Überlegungen zur Komposition des Wozzeck A. Der Fall Wozzeck Er sieht immer so verhetzt aus. Da fragt sich ein anständiger Bürger, was dahintersteckt. Er ist ja eigentlich ein guter Mensch, aber diese Getriebenheit macht einen doch wahnsinnig, denkt sich sein Vorgesetzter, der es gern gemütlich hat. Wozzeck hat es ungemütlich und das sieht man und das greift einen nervlich an. Auch wenn er wahrscheinlich nichts dafür kann. Er hat keinen Boden unter seinen Füßen, wie ein in Ohmacht Fallender. „Er macht mir ganz schwindlich!“ singt der Hauptmann. Geschichte “Er ist ein Phänomen, dieser Wozzeck!” ruft ihm auch der Doktor hinterher. Der Fall W. war ein historischer Gerichtsfall aus dem Jahr 1821, aber dadurch, dass der unbestechliche Büchner sich seiner angenommen hat, ist daraus ein allgemeiner Fall geworden. Büchner interessierte der Mensch hinter dem Einzelfall. Was er fand, war eine mythische Figur der Moderne, der Antiheld existentiell erlittener Ohnmacht. Weil Büchner früh starb und das Drama nicht vollenden und herausgeben konnte, dauerte es lange, bis es das erste Mal im Theater aufgeführt wurde. Das war in München, November 1913, am Residenztheater. Alban Berg sah die Aufführung ein paar Monate später in Wien. Er war gewiss nicht der Einzige, der den ungeheuren “Stimmungsgehalt” (Berg) und die mythische Prägnanz dieser Figur sofort wahrnahm, aber er war besonders geeignet, daraus eine große Oper in der mythologischen Tradition der europäischen Operngeschichte zu machen – vielleicht die letzte? Motiv Der Fall Woyzeck ist ein Fall im wörtlichen Sinne: ein Fallen aus der Gesellschaft, in die bodenlose Tiefe der Isolation. In Büchners Version ist es das Gleiche, Beziehungen zu verlieren oder den Verstand. Wer sozial aus dem Koordinatensystem fällt, fällt auch psychisch. Alban Berg hat genau das vertont. Gespeist aus eigenen Erfahrungen, schrieb er die vegetative Klangspur einer latent schwindelerregenden Panik, in die der Einzelne fallen kann, wenn der destruktive Druck von außen zu groß wird. Für einen feinsinnigen Menschen wie Alban Berg hielt der Waffendienst im Ersten Weltkrieg demütigende Erfahrungen in einem Umfeld bereit, in dem nicht die Sache das Gesetz schöpft, sondern die Willkür. Das hat ihn sicherlich in seinem Plan gestärkt. Da steckt, gut sublimiert, auch Wut in dieser Partitur. Material Einen Fallenden zu sehen greift an. Wie schnell rutscht man selbst aus auf dem Parkett der fremdgesteuerten Standards, wenn man aus irgendeinem Grund abhängig geworden ist. Wozzeck tut weh, weil seine Situation in der Tiefe jeden betrifft. Die Symptome der Demütigung stoßen ab. „Man schneidet sich an ihm.“ In der Wahrnehmung des Hauptmanns, läuft Wozzeck „wie ein offenes Rasiermesser“ durch die Gegend. Berg greift die Situation musikalisch auf, in die der fallende Mann geraten ist. Streicherglissandi, gläserne und knochige Xylophonakkorde, chromatisch schillernde Melodien und ein ständiger, blitzschneller Perspektivenwechsel, der wie ein Wind aus „Süd-Nord“ wirkt. Die Komposition gestaltet den Verlust der Fassung aus, statt ihn zu psychologisieren, sie physikalisiert den Fall Wozzeck. Genre Berg schuf mehr als die Illustration einer Lebenssituation. Er schrieb eine Oper über den Verlust der Tonalität, in die er alle denkbaren und undenkbaren Mittel des nicht-tonalen Zusammenhalts einflocht. Der Verlust der Tonalität ist selbst ein Fall, der Fall in einen schwerelosen Klangkosmos ohne organisierendes harmonisches Zentrum. Auch der heroische Ansatz des starken Komponierens, der Schöpfung erbaulicher sinfonischer Architekturen, fällt nach Mahler in sich zusammen wie der Turm von Babel. Der noch übrigbleibende Schritt in der europäischen Musikkultur um 1914 ist die mehr oder weniger systematische Vermeidung der althergebrachten musikalischen „Sprache“. Jedes Werk wird fortan seine eigene Sprache sprechen. Gerade weil der zehn Jahre nach dieser Zeitenwende uraufgeführte Wozzeck dennoch tonale Elemente enthält, kann er als eine Oper über die Auflösung der Tonalität betrachtet werden. Um die Auflösung der tonalen Beziehungen erzählen zu können, sind die Mittel dessen, was sich da auflöst, nötig. So kommt der eigenartig schillernde Charakter des Werkes zustande. Es ist auf einem Grat der Musikgeschichte angesiedelt, der auch im 21. Jahrhundert noch das Musikleben zerteilt und wahrscheinlich immer zerteilen wird. Hier die kollektiv nachvollziehbare, klassische Form, die immer vom ersten Ton an wie Öl durch unser Gehirn und unsere Nerven fließt. Dort die fragmentierte Sprache des einzelnen Werks, die man erst zu verstehen anfängt, wenn es ausgesprochen hat. Nur wenige Werke sind dazwischen angesiedelt. Das Werk Wozzeck hängt an einem letzten Faden und sein Protagonist genauso. Er ist „verhetzt“ wie ein Teilchen ohne jegliche Verknüpfung mit anderen Teilchen, ein Geisterfahrermolekül in den Bahnen der Gesellschaft. Aus der Isolation entstehen Panik, Schwindel, Hirngespinste. Klänge. Der Wahn wird materialisiert, wie es sich für eine Oper gehört. Das ist weniger „soziales Mitleid“, wie oft gesagt wurde, als die gekonnt präzise Abbildung nervlicher Zustände und kreist damit nach wie vor um das gleiche handwerkliche Thema wie die sogenannte Affektenlehre, die den Anfang der Operngeschichte begleitete. Berg vermeidet damit die moralische Bewertung des Falles Wozzeck. Den Zustand, aus dem heraus ein Kriminalfall entstand, gestaltet er musikalisch, und zwar mit den authentischen Mitteln seiner persönlichen Musiksprache. Das ist kein Zufall, sondern danach hat Berg sich den Stoff ausgesucht: dass es keinen Unterschied gäbe zwischen dem mythischen Drama und dem musikalischen. Nur dann kann die Partitur der Literatur etwas hinzufügen und aus Literatur Oper machen. Berg wollte nicht auf Umwegen eine Symphonie schreiben oder eine Orchesterstudie mit Gesang. Seine Definition von Oper ist die strengste die es gibt: das Genre, in dem sich Drama und Musik nicht unterscheiden lassen. Koinzidenz Wie Schubert in Wilhelm Müllers Gedichten über eine Winterreise eine Methode fand, seine ureigene Musik in Form von treuester Vertonung des Inhalts zu schreiben, so stieß Berg mit 29 Jahren auf die richtige Folie, um seine ureigene und zugleich historisch folgerichtige Musik zu schreiben. Dazu gehört einerseits das Glück, auf so einen Text zu stoßen, beziehungsweise das Glück im Unglück, dass dessen Editionsgeschichte ihn solange konservierte, bis einer wie Berg bereit stand; aber andererseits die Fähigkeit, sich als Komponist so einen Text anzueignen, ohne jemals aus musikalischer Trägheit die Führung zu übernehmen. Die Einsicht, dass einen die souveräne Unterwerfung unter einen erwählten Text zum eigenen Werk führen kann, mehr sogar als die völlige Freiheit von außermusikalischen Bezugspunkten, kann zu der dienenden Hingabe führen, wie sie im „Wozzeck“ zu sehen ist. Einige Grundmotive könnten Berg verführt haben, sich diesem Text zu verschreiben: Der Protagonist beziehungsweise das Protagonistenpaar ist in der gleichen Situation, in der sich die Musik als solche befindet, als Berg anfängt, seine Sprache auszubilden: Die Isolation des einzelnen Tones beziehungsweise Menschen. Beziehungen ohne verbindende Grundlage, kein Halt in Sicht, unter sich schwindelerregende Abgründe der Willkür und Kontingenz. Zugleich enthält diese Literatur schon in sich den Hinweis über sich selbst hinaus, das heißt die Grenzen der Sprache als Kommunikationsmittel werden thematisiert und das lädt die Musik als ergänzende Form geradezu ein, weil sie dort einspringen kann, wo die Sprache bewusst an ihre Grenze geführt wurde. Der Autor scheint außerdem auf ähnliche Weise die Auseinandersetzung mit dem Tod mit der ästhetischen Forderung nach Lebendigkeit im Werk in Verbindung zu bringen, als ginge das eine nicht ohne das andere. Aesthetik Bergs Partitur gibt der Lebendigkeit Vorrang vor der durchkomponierten, symphonischen Einheitlichkeit, oder der absoluten mathematischen Konsequenz. Lebendigkeit sei das „einzige Kriterium in Kunstsachen“, erklärt auch Büchner in seinem Lenz. Beide Autoren verbindet die oberste Priorität, dem Leben einen Raum zu schaffen, Figuren oder Gefühle im Werk leben zu lassen, die im realen Leben unerträglicherweise verdrängt werden. Da die Musik geradezu hautnah oder subkutan die Perspektiven der auftretenden Menschen mitverfolgt, gerinnt sie nie zu einer klassischen musikalischen „Form“. Sie wächst so unvorhersehbar linear und doch organisch wie das Drama selbst. Zugleich gelingt Berg das Kunststück, die einzelnen szenischen Momente in sich gerundet abzuschließen. Jeder Abschluss ist zugleich ein Übergang in etwas Neues, so wie auch die letzte Szene direkt wieder in den Anfang der Oper übergehen könnte. So wird selbst das Fragmentarische dieses Textes in der Komposition zum Kontinuum. So genau Berg all die einheitsstiftenden Prinzipien seiner Komposition erklärt hat, ist doch beim Hören ihre Offenheit und Heterogenität auffälliger, die kinetische und kinematographische Qualität der Musik, die stetige Bewegung, das stetige Weiterleben, wenn auch auf den Tod hin. Ohne diesen Zielpunkt wäre das Leben kein Leben, und diese Einsicht, dass formale Geschlossenheit und linearnarrative Offenheit keinen Widerspruch bilden, macht die Lebendigkeit dieser Musik aus. Sie gerinnt nicht. Dadurch kommt sie den inneren Vorgängen des einsamen Menschen näher, als die Sprache es kann. Das Verhältnis von innen und außen, von erfahrenem Gefühl und kollektiv behaupteter Normalität, wird in der Musik aufgegriffen, indem sie die Seelenvorgänge der Protagonisten in der Tat als Vorgänge verfolgt. Dabei gelingt es Berg, mehrere Personen gleichzeitig abzubilden, indem er das Orchester nach Gruppen aufteilt. Das Orchester wird nicht als „Apparat“ behandelt, sondern als Organismus mit vielen Gliedern, die gleichzeitig verschiedene Bewegungen vollziehen können. Während die Streicher mit Wozzeck fiebern, schnattern die Bläser dem Doktor nach. Das Orchester springt zeitweise zwischen den nervlichen Zuständen der Dialogpartner hin und her wie zwei Filmkameras; oder es kombiniert zwei Zustände zu einem Klangknäuel; oder es spaltet sich regelrecht auf in zwei Lager und sagt damit auch sehr viel. Insgesamt ist dadurch die Partitur sehr vielfarbig und lebendig, mal wie ein dicht leuchtendes Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, mal wie ein gestochener Kandinsky und mal wie ein wüster Pollock von extremer formaler Klarheit auf den zweiten Blick. Aber immer der Wozzeck, als zeitloses Gemeinschaftwerk von Büchner und Berg. Und als solches doch ein historischer Einzelfall. ? Mythos Parallel zu Bergs Arbeit am Wozzeck hat Schönberg bekanntlich ein neues kompliziertes Muster als Ersatz für die Tonalität geflochten. Doch Berg interessierte sich weniger für die Kraft eines neuen Musters an der Stelle des alten, als für die Zerbrechlichkeit und zugleich unberechenbare Gewalt eines sich auflösenden Bezugssystems. Genau darum geht es in Georg Büchners Text. Dennoch war Berg sich mit Schönberg in einem anderen wichtigen Punkt einig, nämlich der unbedingten Überzeugung, dass Musik nicht mehr nach den symmetrischen Prinzipien der klassisch-romantischen Musik aufgebaut werden sollte. Schönberg prägte den Begriff der „musikalischen Prosa“, um damit die lineare Erzählweise an die Stelle der zyklischen, „poetischen“, liedhaft geordneten des 19. Jahrhunderts zu setzen. Das Leben ist nicht vorhersehbar und überschaubar, die Musik sollte es daher auch nicht sein. Damit schuf er noch effektiver die Grundlage für die Neue Musik, als mit der Entwicklung der 12Ton-Komposition und der Reihentechnik, denn diese stellte ein neues Korsett an die Stelle des alten, das Prinzip der stabilisierenden Wiederholung wird eigentlich nur sublimiert, aber nicht verlassen. Kritische nachfolgende Komponisten wie Morton Feldman haben darin eine wesentliche Schwachstelle der durch Schönberg ausgelösten Musikkultur inklusive des Serialismus ausgemacht. ? Berg als engster Vertrauter von Schönberg ist dieser kritischen Haltung eigentlich erstaunlich nah. Berg hingegen schrieb Musik am Abgrund der Tonsprache ohne das Sicherheitsnetz eines Ersatzsystems, um des höchsten ästhetischen Wertes willen, der Lebendigkeit. Wen interessiert ein Tongeflecht, das stabiler ist, als das psycho-soziale Netz? Eine Gesellschaft hat so viel Würde wie ihr schwächstes Glied. So verband Berg den aktuellen Stand der Kompositionsmittel auf seine Weise mit der Erfahrung, dass jeder in kürzester Zeit in eine entwürdigende soziale Position geraten kann - es braucht dafür lediglich einen Weltkrieg oder einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Der verhetzte Wozzeck ist für Berg zu Recht der Status Quo der Gesellschaft, der Mythos schlechthin für die Beziehungslosigkeit, und damit großer Opernstoff. B. Die Oper I. Fünf Charakterstücke Die fünf Charaktere, mit denen der Soldat Wozzeck zu tun hat, werden im I. Akt Szene für Szene in „fünf Charakterstücken“ vorgestellt. Jeder Begegnung ist eine eigene musikalische Form zugeeignet, ohne dass man das direkt hören könnte. Sie bilden eine organisierende Folie für das wendige und reaktionsschnelle Komponieren am Text entlang, ohne dabei als formgebende Kraft stärker als dieser zu werden. 1. Zimmer des Hauptmanns. Frühmorgens. Der erste Akkord besteht eigentlich aus zwei Akkorden. Die Hände der Streicher gleiten über das Griffbrett von einem Ton zum anderen, eingefärbt von einem leisen Wirbel auf dem Tamburin. Wir befinden uns im militärischen Milieu - und etwas entgleitet. Das dauert circa anderthalb Sekunden und ist doch Kern für das Weitere. Von diesem ersten Akkord an treffen sich musikalische Technik und das innerste Thema des Dramas. Jeder Ton hat seinen Grund in dieser Koinzidenz. Die Komposition hält sich an keiner Stelle des Dramas länger auf als hier. Wozzeck ist eine urbane Oper, man kommt schnell zum Punkt. Das Glissando der Streicher ist der Zustand, in den der Hauptmann von Wozzeck versetzt wird. Wozzeck selbst ist schwindlig vor Überlebensdruck. Sein Leben ist ein Drahtseilakt ohne Netz geworden. Der einzige Draht, den er noch hat, ist der zu Marie, die er seit drei Jahren kennt und mit der er ein Kind hat. Eine Ehe kommt offenbar nicht in Frage. Ein nicht sehr stabiler Draht, an dem sein Leben hängt. Der Mann verhetzt, die Frau voller Sehnsucht nach einem anderen Leben. Dennoch eine relativ geschützte Privatsphäre abseits der sozialen Widersprüche – scheinbar. Wozzeck merkt überall, dass mehr von ihm verlangt wird, als er erfüllen kann, er spürt dabei eine gesellschaftliche Verlogenheit, ohne sie als solche zu erkennen, er weiß nicht, wie er den Widerspruch aufllösen soll und wird darüber langsam verrückt. Einzig das Vertrauen in Marie bewahrt ihn vor dem endgültigen Absturz in den Strudel dieses sozialen Drucks. Der Hauptmann ist von Wozzecks innerem Stress angestrengt, er würde sich einen ausgeglicheneren Charakter als Barbier wünschen. „Langsam, Wozzeck, langsam. Er macht mir ganz schwindlich!“ Die Streicher unterstreichen sein letztes Wort, indem sie von Akkord zu Akkord gleitend an jedem harmonischen Halt abrutschen. Nirgendwo ist Festland unter den Füßen. Die Tonalität, die sich über vierzig Generationen verfeinert hat, kann künstlerisch nicht mehr durchgreifen. Der Hauptmann will davon nichts wissen, für ihn zählt die alte Ordnung, denn sie stabilisiert seine sichere Ruheposition. Jede Lebendigkeit bedroht ihn. Er ist es nicht gewöhnt, dass ihm etwas unkontrollierbar aus der Hand gleitet. Alles Selbstbewegte macht ihn nervös. Sogar die Vorstellung, dass die Erde sich dreht. Ein Wind draußen auf der Straße macht ihm „den Effekt von einer Maus“. Wie hysterisch das ist, daran lässt Berg keinen Zweifel. Bei dem Wort Maus landet der Hauptmann auf dem zweigestrichenen a mit notiertem Tremolo. Wozzeck dagegen ist von Winden und Stürmen aus allen Richtungen umtost. Als der Hauptmann ihn spöttisch fragt, ob der Wind heute aus „Süd-Nord“ komme, bemerkt Wozzeck die Falle nicht, weil ein Wind aus Süd-Nord für ihn längst durchaus plausibel wäre. Wozzeck fällt das Sprechen schwer, weil die Wirklichkeit vor seinen Augen verschwimmt. Was in ihm und um ihn vorgeht, kriegt der Strauchelnde nicht zu fassen, weder in Worte, noch in eine andere Sprache. Alban Berg jedoch hat es komponiert. Die Musik kommt, durch ihre objektivierende Kraft als mythische Instanz, der Kreatur am Abgrund zur Hilfe. 2. Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Spätnachmittag. Sein Gegenüber in der zweiten Szene ist der Kamerad Andres, also diesmal eine Begegnung auf Augenhöhe. Das Orchester jedoch springt zwischen extrem unterschiedlichen Stimmungen hin und her. Wenn die Musik Wozzecks Verfassung zeigt, ist sie geprägt von großer Spannung und weit geöffneten Sinnen, sie plausibilisert seine Angstvisionen und vollzieht körperlich nach, was er den anderen mitzuteilen versucht. Wenn Wozzeck bei Büchner sagt: „Hörst du, es wandert was mit uns da unten“, fügt Berg dumpfe Basspizzicati hinzu, die unter der Erde hervorklingen und immer schneller werden. Die Posaunen im Text kommen ebenfalls in der Partitur vor, auch der angehaltene Atem, usw. Die andere Stimmung des Orchesters zeigt die Dimension, innerhalb derer sein Kamerad auf ihn eingehen kann. Er versucht die Stimmung durch Jagdlieder aufzulockern. Wie so oft in dieser Oper nimmt das Volkslied eine beschwichtigende Funktion ein, die misslingt. Es wird mit jeder Strophe jämmerlicher und verzerrter. Dass sich Wozzeck nicht beschwichtigen lässt, macht zu wesentlichen Teilen die mythologische Kraft dieses Antihelden aus. Er hat nicht die Mittel zum Widerstand, aber er lässt sich auch nicht mehr beschwichtigen. Das Streben nach irgendeiner Autonomie und Erklärung findet seine letzte Nische in Phantasien, die für Normalisierungsversuche und folkloristische, also einhegende Beschwichtigungen nicht mehr erreichbar sind. Wozzeck bebt der Boden unter den Füßen, während in der Stadt die Militärkapelle aufmarschiert. Vielleicht hört er einfach nur die Trommeln von weitem und ahnt die Gefahr, die sie für sein Leben bedeuten. Die Szene klingt sehr leise aus, als ob Berg hier endlich mal einen Augenblick der Ruhe einschieben wollte, wie einen persönlichen Kommentar zu Andres' letzten Worten: „Nacht! Wir müssen heim!“ Die Komposition überhöht den Satz zu einer Metapher, die dem Geschehen vorgreift, jedenfalls die Assoziation einer schwermütigen Perspektive auf die irdischen Auseinandersetzungen wirft. 3. Mariens Stube Abends An Maries Fenster zieht die prachtvolle Marschmusik vorbei. Komplementär zu Wozzecks Haltlosigkeit entwickelt Marie Sehnsucht nach Halt und ist entsprechend empfänglich für die ordnende Kraft der militärischen Parade, der choreopraphischen Tautologie aus Rhythmus und Bewegung – ein Effekt, der von den Nazis eingesetzt wurde und tatsächlich oft als ein Grund für ihre anfängliche Überzeugungskraft in den Wirren der Weimarer Republik beschrieben wurde. Insbesondere der Anführer der Rhythmusgruppe, der sogenannte Tambourmajor, der mit seinem Taktstock auf ansteckende Weise den Laden zusammenhält, ist ein Magnet für die Blicke. „Er steht auf seinen Füßen wie ein Löwe!“ So etwas würde sie über Wozzeck niemals sagen. Ein Tambourmajor gehört soziologisch eher in den Bereich von Marie und Wozzeck als in den des Doktors und des Hauptmanns; er hat trotz seines Namens mit dem Dienstrang des Majors nichts zu tun; aber er hat im Krieg und an Feiertagen eine wirkungsvolle Rolle als taktschlagender Anführer der Trommelgarde. Und ihm ist vor allem nicht schwindlig, sein Taktstock scheint die Lebensordnung zusammenzuhalten. Kein Wunder, dass Marie sich über ihre Wirkung auf ihn freut. Ihre Nachbarin bekommt es mit und beleidigt sie bösartig. „Sie guckt sieben Paar lederne Hosen durch! Das weiß jeder...“ Die Militärmusik wird abrupt unterbrochen. Die fiktive Gemeinschaft der Guten und Normalen wird – wie schon vom Hauptmann – eingesetzt, um Druck auf die Außenseiterin auszuüben. Das Orchester vollzieht – mit der Genauigkeit eines Filmschnitts dem präzisen Text folgend, aber zugleich musikalisch bereichernd als gestische Dissonanz - den Wechsel in Maries Innenleben, wobei Bergs erweiterte Regieanweisung mit Hilfe von Pfeilen genauso präzise in den Notentext platziert ist, wie der Einsatz eines Instrumentes. Marie: Luder! (schlägt das Fenster zu; bleibt allein mit dem Kind; die Militärmusik ist plötzlich – als Folge des zugeschlagenen Fensters – unhörbar geworden) Die Musik erwirkt den Bruch zwischen Innenwelt und Außenwelt schneller und effektiver, als jeder Bühnenumbau dazu in der Lage wäre, ohne auf musikalische Schlüssigkeit zu verzichten. Die erste gemeinsame Szene von Marie und Wozzeck ist also schon durch einen doppelten Bruch vorbereitet. Wozzecks verzerrte Wahrnehmung der Naturgewalten steckt ihm noch in den Knochen, er weiß aber nichts anderes darüber zu sagen als ein verzweifeltes und sich nach Trost sehnendes „Ach! Marie...“ In diesem Fall ist die Sprache nicht nur begrenzt, sondern sie trennt mehr, als sie verbinden kann. Wozzeck scheitert, wenn er versucht Marie seine Visionen zu beschreiben. Aber es erklärt, warum gesungen wird. 4. Studierstube des Doktors Sonniger Nachmittag In den ersten drei Szenen jagt Wozzeck erst dem Hauptmann, dann Andres, dann Marie Angst ein. Dem Hauptmann wird schwindlig, Andres wird furchtsam und Marie schauert es. Nur der Doktor freut sich in der anschließenden Begegnung eiskalt über den medizinischen Fall eines psychisch labilen, übernächtigten und überforderten Erwachsenen, der von fremden Dämonen der Moral terrorisiert wird und sich mit einem radikalem Eigensinn zu wehren versucht, der sich bereits verselbständigt hat. Der Doktor sieht den Fall, nicht den Menschen. Wozzeck hängt währenddessen noch nach, dass Marie ihn nicht verstehen konnte: „Ach, Marie, wenn es finster ist...“ Dass sie nicht anwesend ist, spielt keine Rolle, er kommt sowieso nicht mehr durch mit seinen Worten. „Ach, Marie!“ singt er daraufhin noch einmal, als ob er das Unglück ahnt, das beiden droht. Halte zu mir, halte mich, ich rutsche ab. Weder Marie noch der Doktor können ihn halten. 5. Straße vor Mariens Tür Abenddämmerung Nach dieser Passacaglia, formal in der Art einer langweiligen Medizin-Vorlesung in 21 Variationen das gleiche Thema wiederkäuend, wird endlich Wozzecks ungleicher Rivale mit einem Andante Affetuoso von nahem vorgestellt. Die Szene ist kurz und fatal. Der derbe Tambourmajor, der gekommen ist, Marie zu erobern, wird als eitel und kleingeistig dargestellt, er ist stolz auf seine weißen Handschuhe und den Federnbusch und das Kompliment seines Vorgesetzten, der ihn „einen Kerl“ nennt. Er will mit Marie eine „Zucht von Tambourmajors“ anlegen. Marie findet das zwar lächerlich, aber mit den Worten „Es ist alles eins!“ gibt sie sich ihm hin. Ihre Resignation ist dramatisch. Wozzeck ist von ihrer Treue abhängig, seine Ohnmacht wird durch ihre Ohnmacht verstärkt. Die folgenreiche Verführung ist bei Büchner konsequenterweise sehr lakonisch beschrieben, Berg fügt hier der Sprache mit seiner Musik einiges Explizite hinzu. II. Symphonie in fünf Sätzen Mariens Stube. Vormittag, Sonnenschein. Nach der Exposition aller Beteiligten durch die „fünf Charakterstücke“ wird deren dramatische Verstrickung in Form einer fünfsätzigen Symphonie durchgeführt. Auch hier hört man nicht, dass der II. Akt als „Symphonie“ organisiert ist und dennoch begegnen sich dadurch musikalische und dramatische Interessen besser. Sonatensatz Der Strudel hat nun auch Marie erfasst, auch ihre hoffnungslosen Autonomieversuche entfalten ihre Eigendynamik. Der Komponist nimmt sich ein paar Takte Vorspiel heraus, die man sich als Filmmusik für Hitchcocks „Vertigo“ vorstellen könnte. Doch der Dramaturg Alban Berg drängt zur Szene, ohne ausschweifende Orchestergenüsse. Das Hauptthema des Sonatensatzes wird vom Orchester vorgestellt, bevor Marie singend mit sich selbst spricht. Berg zeigt hier, wie virtuos er Farben oder Gesten in nur wenigen Sekunden etablieren kann, um etwa das Glitzern der Ohrringe, die Marie vom Tambourmajor bekommen hat, zu untermalen. Solch eine Untermalung ist aber immer an motivische Verdichtung gekoppelt. Das Motiv der Marie glitzert eben einen Moment lang durch die hohen Register der Geigen. Doch sofort gibt Büchners lakonischer Text wieder das Tempo vor. Für kontemplative Arien, die nonchalant die Handlung unterbrechen, ist hier keine Zeit. Das Kind wacht auf und verlangt Aufmerksamkeit. Im Orchestergraben wechselt augenblicklich der Wind vom Hauptthema zum energischen Überleitungsthema und ein paar Takte später landen wir beim Seitenthema, wenn Marie von ihren Drohungen übergeht in ein „Schlaflied“, ein Opium-für-das-Volkslied (sehr kühnes Wortspiel!!!;) ). („Mädel, mach's Lädel zu, 's kommt ein Zigeunerbu', Führt Dich an seiner Hand Fort ins Zigeunerland!“) Das Volkslied kommt auch hier in beschwichtigender Funktion vor. Als das Kind wenig später wieder aufwacht, müssen die Drohungen noch stärker ausfallen, damit es endlich schläft: „Still! Bub! Die Augen zu! Das Schlafengelchen, wie's an der Wand läuft! Mach die Augen zu! Oder es sieht Dir hinein, dass Du blind wirst...“ So perpetuiert die Mutter die Grundlage ihrer eigenen Ergebenheit in ihr soziales Schicksal mehr oder weniger freiwillig in der Erziehung ihres Kindes, indem sie schon früh das Prinzip der Ohnmacht gegenüber höheren Mächten als unhinterfragt installiert. Wozzeck betritt wie immer unvermittelt die Szene und wir sind in der Durchführung des Sonatensatzes. Das Orchester verschmelzt die Perspektiven von Wozzeck und Marie und beschreibt damit in seinem Gesamtgestus die Beziehung zwischen den beiden. Noch. Wozzeck drängt den in ihm aufkeimenden Argwohn zurück und fasst stattdessen mit jenen drei Worten, die wir schon kennen, alles zusammen, was er an Problemen vorfindet fremde Ohrringe, ausweichende Erklärungen Maries und das albträumende Kind - , indem er den Refrain der Oper aus tiefem Herzen intoniert: „Wir arme Leut“. Das Orchester unterstützt den Seufzer nach Kräften, dem komplexen Zustand hinter dieser einfachen Aussage folgend. nach Wozzecks Abgang, erklingen die Streicher bei der zweiten Reprise anders als beim Hauptthema am Anfang der Szene, sie greifen eine jenseitsbezogene Stimmung voraus, die Marie im III. Akt gänzlich erfasst haben wird. Sie erkennt die Illusion hinter ihrem scheinbar autonomen Eroberungserfolg, die verzweifelte Einsamkeit. „Ach! was Welt! Geht doch Alles zum Teufel: Mann und Weib und Kind!“ )) Hab' sonst nichts auf dieser Welt! Als zweiter Satz der „Symphonie“ folgt nun die eigentliche Buffo-Szene. Die Melodien in dieser Szene sind so dem Gestus der entsprechenden Sprechmelodie nachempfunden, dass sie überaus verständlich und trotz ihrer freitonalen Grundlage eben natürlich wirken; dadurch kommt der pointierte Text besser zur Geltung. Die Stimme kann auch innerhalb weniger Worte zwischen Sprechgesang und reinem Gesang wechseln, immer unter dem absoluten Primat, dem Text zu dienen. Berg hat seine Bearbeitung des Dramas als Inszenierung verstanden. Der Sprachduktus und damit die inszenatorische Interpretation, sowie die psychologische Arbeit an den Figuren ist schon ausgearbeitet und vorgegeben. Lieber ein Messer in den Leib Der Mittelsatz, das Largo, ist das Scharnier der ganzen Oper. Vorher sieben Szenen, hinterher sieben. Doch dort, wo in Wagners Tristan das Liebesduett untergebracht ist, passiert hier genau das Gegenteil. Der Faden reißt. Aus der verzweifelten, hilflosen Wehmut des „Ach, Marie...!“ im ersten Akt wird nun ein zerstörerischer Sog. Ihm bleibt nur noch eine Illusion autonomen Handelns übrig: Das letzte, was zu ihm gehörte, zu vernichten. „Der Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinunterschaut... Mich schwindelt...“. Der Faden zerreißt sowohl psychologisch als auch musikalisch in dem Moment, wo die letzte Beziehung zerstört ist, die Wozzeck noch zu irgendeiner Gemeinschaft blieb. Um das orchestral zu verdeutlichen, gebraucht Berg ein Mittel, das ungewöhnlich war: er zerteilt das Orchester in zwei räumlich getrennte Gruppen, eine für Wozzeck und eine für Marie. Zwei auseinandergeschnittene Seelen begegenen sich. Der fatale Riss durch ihr Leben wird endgültig in Maries Geständnis vollzogen: „Und wenn auch!“ Wozzeck geht auf Marie los, aber sie flüstert ihm seine letzte Tat und damit ihr eigenes Schicksal ein: „Rühr mich nicht an! Lieber ein Messer in den Leib, als eine Hand auf mich.“ Eine radikalere Abweisung ist kaum vorstellbar. Zugleich wird Wozzeck klar, dass damit der letzte Spielraum in seinem Leben definiert ist. Ab hier spult sich das Schicksal gnadenlos ab, die Würfel sind gefallen. Vorher sieben Szenen, nachher sieben Szenen. Wenn man Bergs Methoden kennt, wird man keinen Zufall vermuten in dieser Architektonik. Er konnte nicht genug heimlich bindende Elemente in seine Kompositionen einflechten. Aber seine festigende Architektonik hält die fließende, heterogene Komposition unhörbar oder ideell - zusammen; sie ist kein kompositorischer Alleingang, sondern Mittel zur Darstellung des Dramas. Immerzu, immerzu! Die vierte Szene der Peripetie ist ein Scherzo. Wieder drängt sich eine cineastische Perspektive auf. Nach einem Orchestervorspiel mit Ländler, das nach einem italienischen Film aus den 1960er Jahren klingt, landen wir in einer fellinesken Wirtshausszene. Ein trauriger Gesell, vom Alkohol nicht getröstet, singt über den Ennui des Lebens: „Meine Seele stinkt nach Branntewein.“ Auch die folkloristische Musik kann wieder nicht trösten. Sie muss ohne jegliche subversive Kraft auskommen, weil sie ja dem Beschwichtigen dient und wird daher als solche musikalisch dekonstruiert zu einer spukigen, hohlen Tanzmusik. Auch hier taucht natürlich in der Wahrnehmung des handfest ausgestoßenen Außenseiters das ohnmächtige Schwindelgefühl wieder auf. „Alles dreht sich, wälzt sich übereinander.“ Der Ekel überkommt Wozzeck, als er Marie engumschlugen mit dem Trommler tanzen sieht. Sein Leben hat hier ganz nüchtern gesehen bereits seinen „Sinn“ verloren: der Schwindel ist anstelle eines Richtungssinns getreten. Die musikalische Maßnahme, die nun erfolgt, ist ähnlich auffällig wie die räumliche Aufteilung des Orchesters in der vorhergehenden Scharnierszene. Eine angsteinflössende rhythmische Passage stoppt abrupt und die vier Bühnenmusiker der Wirtshausszene fangen an, ihre Instrumente zu stimmen. Dieses Stimmen ist komplett ausnotiert. Währenddessen setzt sich der Narr zu Wozzeck, eine Figur aus dem Nichts, die in dem Dramenfragment eigentlich keine klare Rolle hat. Aber da die Musiker ihre Instrumente stimmen, darf er auftauchen, in einer kurzen Pause der Oper. Dem Narr ist bereits das Spaßen vergangen. Während die Burschen und Soldaten singen „Ja lustig ist die Jägerei ...“ drängt er sich an Wozzeck heran. „Lustig, lustig... Aber er riecht... - Ich riech' Blut!“ Die Instrumente sind inzwischen umgestimmt, aus Geigen sind Fiedeln geworden, einen Ton höher gezogen, und die Bühnenkapelle spielt nun parallel zum Orchester die Tanzmusik in einer anderen Stimmung weiter, zu der alle wieder tanzen, auch Marie und der Tambourmajor. Der Narr taucht auf und verschwindet wieder, aber auch er treibt das Drama voran auf den Mord zu, wenn er geht, klingen die Fiedeln noch einen Tick schärfer. Der Schluss des Scherzos bildet den Nervenzustand Wozzecks ab. Fetzen der eben leidvoll gehörten Tanzmusik, als Inbegriff der Isolation, mischen sich mit schwindelerregenden Figuren. Das Ganze endet aber wie immer früher als erwartet und übergangslos, in einem leisen, unheimlichen Chor. Einer nach dem Andern! Wozzeck kann nicht schlafen. In der Isolation bleibt nur die Anrufung Gottes, übrigens fast in jeder Szene. Im Gegensatz zu dem moralisierenden Potential, das der Hauptmann aus der Religion zieht, wird in der Art der Anrufung Gottes, wie sie bei Marie und Wozzeck in ihren einsamsten Momenten zu sehen ist, der existentielle Zugang zur Transzendenz deutlich, als dem in jeder Hinsicht letzten Dialog. Die letzte Demütigung wartet zum Zeitpunkt seines letzten Hilferufs noch auf ihn. Marie tanzt die ganze Nacht begeistert mit ihrem neuen Schwarm. Als der betrunken in den Schlafssal der Kaserne kommt und laut von den körperlichen Vorzügen seiner neuen Eroberung prahlt, bleibt Wozzeck auch die Niederlage im Nahkampf nicht erspart. Blutend, schlaflos und isoliert sitzt er auf seinem Bett, verlassen von Marie und damit auch endgültig von allen Geistern. Hier taucht ganz leise der Ton H auf, der im III. Akt eine große Rolle spielen wird. Finster fasst Wozzeck einen Entschluss. Wozzeck: Einer nach dem Andern! (Er bleibt sitzen und starrt vor sich hin. Die anderen Soldaten, die sich während des Ringkampfes etwas aufgerichtet hatten, haben sich nach dem Abgang des Tambourmajors – einer nach dem andern – niedergelegt ... und schlafen nunmehr alle wieder.) III. Sechs Inventionen Dass der „Wozzeck“ auch eine Oper über musikalische Fragen mit Hilfe einer Textvorlage über den Verlust menschlicher Beziehungen ist, zeigt sich im III. Akt besonders deutlich. Seine fünf Szenen verarbeiten verschiedene musikalische Grundelemente, die ihre Selbstverständlichkeit verloren haben: das musikalische Thema, den Ton, den Rhythmus, den Akkord, die Tonart und die gleichmäßige Achtelbewegung. Auch das Scharnier zwischen Text und Musik - der Gesang, wird in seinen verschiedenen bereits aufgetauchten Formen nochmals durchgeführt: kunstvoll-melodiös in der zweiten Szene, folkloristisch in der dritten, in den verschiedenen Formen des Sprechgesangs in der vierten. 1. Mariens Stube Es ist Nacht. Kerzenlicht Das „Thema“ ist das erste musikalische Grundelement, das verarbeitet wird. Nach zwei Takten Generalpause (zwischen abgeschlossener Peripetie und anrollender Katastrophe) setzt der III. Akt mit einem neuen und auffallend „schönen“ Thema ein. Die berührende Trauer dieser Bratschenfigur wird verstärkt durch ihre Komplementarität zu Wozzecks gerade erlebter Verzweiflung und Erniedrigung. Das ist ein erzählerischer Effekt, aber auch ein emotionaler, auf den Berg als Schönberg-Schüler aus rein musikalischen Materialgründen verzichten hätte müssen. Er war autonom genug, den Unterschied der Oper zur abstrakten Instrumentalkomposition zu erkennen. Die richtige dramaturgische Einbindung legitimiert eine traditionell funktionierende Melodie auch für strengste Tonsetzer der Neuen Musik. So provoziert sie kein abgeschmacktes Schwelgen, sondern den lebendigen Schmerz. Emotion ist selbstverständlich legitim bei Berg, wenn sie als etwas verdrängtes Lebendiges einen Raum im Werk findet, auch in seinen Instrumentalkompositionen. 2. Waldweg am Teich Es dunkelt Das Schicksal formiert sich unterdessen in Form eines Tones, der immer präsenter wird, als Zielton von melodiösen Figuren, als subtiler Orgelpunkt. Die zweite Szene benennt ihn: „Invention über einen Ton (H)“. Gegen ihn ist kein Ankommen mehr. Nach ihren einsamen Dialogen mit Gott sind beide ein letztes Mal zusammen. Aber das seltene Glück, dem Schicksal noch eine Wendung geben zu können, ist dem Paar nicht gegeben. Das H steht sowohl für den Entschluss Wozzecks, der sich mehr und mehr verdichtet, indem es in der Partitur immer dichter vorkommt; als auch für den Tod Maries, die Endgültigkeit, das Schicksal. Wenn Wozzeck Marie ermordet, hat man durch die kompositorische Deutung das Gefühl, ein zu scharfes Bild zu sehen. Während sich einerseits thematische Rückgriffe auf das bisher Gehörte zusammenballen, setzt sich andererseits der eine Ton immer mehr durch. Die Gleichzeitigkeit von Leben und Tod, von vielschichtiger, variierender Entwicklung und eindeutiger Endgültigkeit, auf die das Leben hinausläuft, ist hier zusammenkomponiert. Die Motive, die bisher an Marie gezerrt haben, das Wiegenlied, die Ohrringe, Wozzeck, der Tambourmajor, sind im Sterben, dem Berg vier Takte einräumt, zu einem undurchhörbaren Knäuel verbunden. Dadurch entsteht weniger ein erzählerischer Effekt klassischer Leitmotivik, als ein unmittelbarer gestischer Effekt, der aber in der Tiefe die organisierende Funktion des Leitmotivs vollzieht. Auch das gläserne Xylophon kehrt wieder wie eine Erinnerung an das unerbittlich ablaufende Schicksal eines sozialen Strudels, der die Nerven in einen Extremzustand versetzt. Dann meldet sich das Schicksal zu Wort wie ein Gott vom Olymp, indem das gesamte Orchester einen einzigen Ton spielt, der zu einer physikalischen Gewalt anwächst. Wozzeck: Tot! (Er richtet sich scheu auf und stürzt geräuschlos davon.) (Orchester-Überleitung über den Ton H) Nacht, schwaches Licht Leitmotive verknüpfen bei Berg meist noch subtilere Bedeutungsschichten als bei dem Paten der leitmotivischen Musikdramaturgie, Richard Wagner. Nicht Personen werden verbunden, sondern Zustände, zum Beispiel die ängstliche Stimmung auf dem freien Feld mit der schlaflosen Nacht in der Kaserne. Auf der Oberfläche oft kaum wahrnehmbar, dienen solche Verknüpfungen musikalisch und narrativ als festigender Halt im Hintergrund, ähnlich wie der Einsatz von tonalen Strukturen, klassischen Formen und Volksliedern, oder die Illustration dramatischer Vorgänge durch das Orchester. Berg bezieht die künstlerische Aussage nicht alleine aus dem innermusikalischen Material, sondern aus der gestischen Summe, die auf der Bühne des Musiktheaters entsteht. Er verlässt sich auf die Wahrheit, die er in Büchners Figuren gefunden hat. Oper ist für ihn Erzählung mit musikalischen Mitteln und nicht Musik ergänzt um erzählerische Mittel. Mondnacht wie vorher So ist auch der orchestrale Epilog in d-Moll (sic) zu sehen, der sich an die vorletzte Szene anschließt. Die Perspektive dreht sich nach oben wie die Kamera, die von einem großen Kran in die Vogelperspektive geschwenkt wird. Das Orchester zieht ein Résumée, das stellenweise stark an Wagners Götterdämmerung erinnert, dann aber wieder in das angespannte 20. Jahrhundert zurücktaumelt, schmetternde Bläserfetzen, Trommelwirbel, Pauken, alles erhebt sich zum letzten Thema, um noch einmal deutlich zu machen, dass es hier um etwas Großes geht. Die Posaunen posaunen es heraus: Wir arme Leut. Heller Morgen. Sonnenschein Nach dem Résumée ist noch nicht Schluss. Büchner soll das letzte Wort behalten, beziehungsweise die Kinder. Erstmals im gesamten dritten Akt ist es nicht dunkel. Die Lebendigkeit entspringt dem Tod, Berg Die kurze abschließende Invention über eine gleichmäßige Achtelbewegung reflektiert den Kreislauf und zeigt zugleich seine Gebrochenheit. Sie stellt dabei einen musikalischen Raum her, was immer etwas Utopisches ist, ein Nicht-Ort, aber trotzdem eine physikalische und gestalthafte Realität. Die Nachricht von Maries Tod dringt zu den spielenden Kindern, unter anderem dem Waisenkind, dem eigentlichen Verlierer. Vielleicht hat es die Chance, selbst zu entscheiden, ob es Außenseiter sein wird oder nicht. In jedem Ende wohnt ein Anfang. Die Musik endet dünn, offen, lakonisch. Der Anfang der Oper, darauf hat Berg selbst hingewiesen, ließe sich musikalisch übergangslos an das Ende anschließen. Die narrative Linie ist in einen musikalischen Kreis zurückgebogen. Doch was man hört ist nicht der geschlossene Kreis, sondern die Offenheit, der Raum für das unerträglicherweise aus dem sozialen Leben Verdrängte. Moritz Gagern