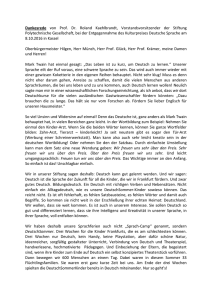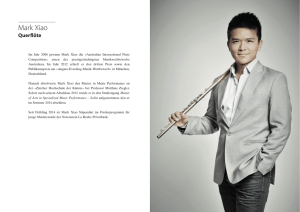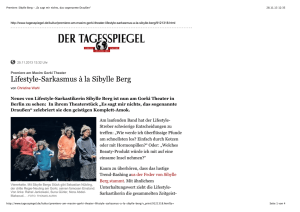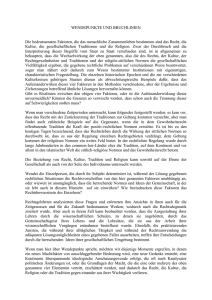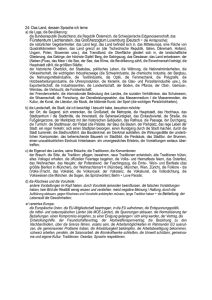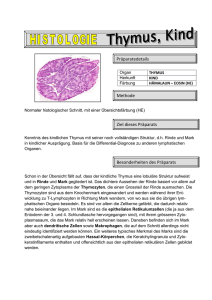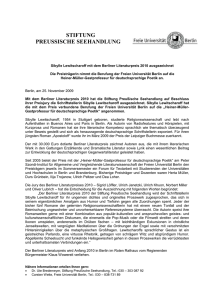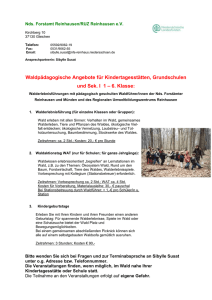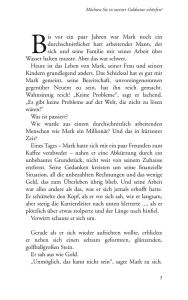Interview mit Sybille G und Mark S von Guenter
Werbung
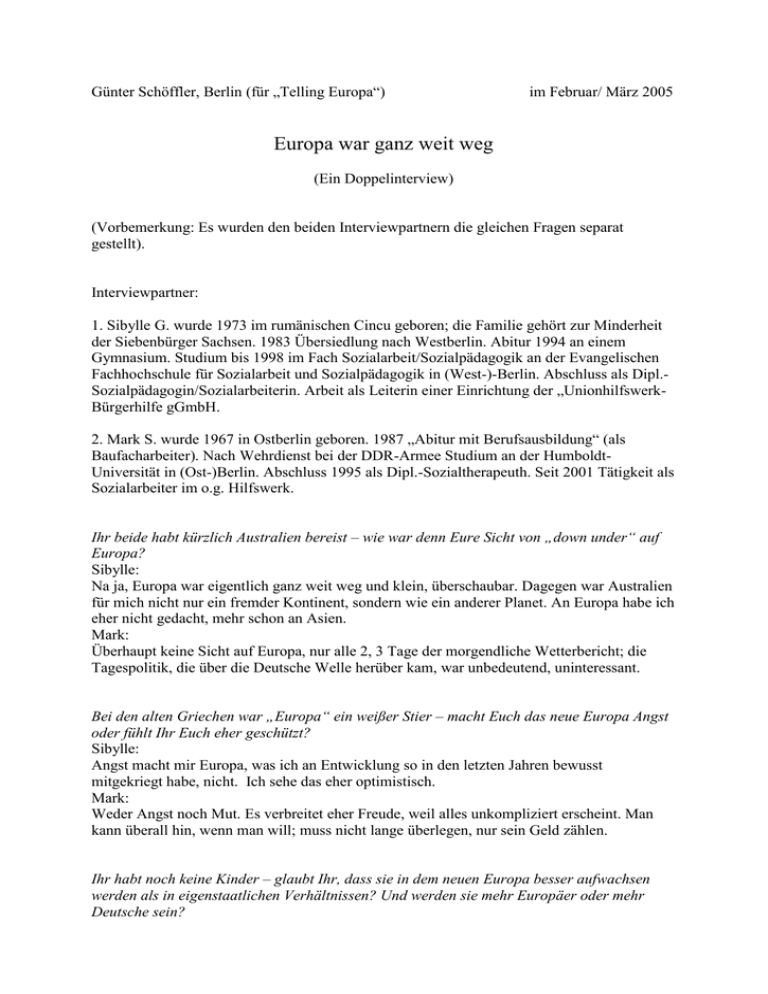
Günter Schöffler, Berlin (für „Telling Europa“) im Februar/ März 2005 Europa war ganz weit weg (Ein Doppelinterview) (Vorbemerkung: Es wurden den beiden Interviewpartnern die gleichen Fragen separat gestellt). Interviewpartner: 1. Sibylle G. wurde 1973 im rumänischen Cincu geboren; die Familie gehört zur Minderheit der Siebenbürger Sachsen. 1983 Übersiedlung nach Westberlin. Abitur 1994 an einem Gymnasium. Studium bis 1998 im Fach Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in (West-)-Berlin. Abschluss als Dipl.Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin. Arbeit als Leiterin einer Einrichtung der „UnionhilfswerkBürgerhilfe gGmbH. 2. Mark S. wurde 1967 in Ostberlin geboren. 1987 „Abitur mit Berufsausbildung“ (als Baufacharbeiter). Nach Wehrdienst bei der DDR-Armee Studium an der HumboldtUniversität in (Ost-)Berlin. Abschluss 1995 als Dipl.-Sozialtherapeuth. Seit 2001 Tätigkeit als Sozialarbeiter im o.g. Hilfswerk. Ihr beide habt kürzlich Australien bereist – wie war denn Eure Sicht von „down under“ auf Europa? Sibylle: Na ja, Europa war eigentlich ganz weit weg und klein, überschaubar. Dagegen war Australien für mich nicht nur ein fremder Kontinent, sondern wie ein anderer Planet. An Europa habe ich eher nicht gedacht, mehr schon an Asien. Mark: Überhaupt keine Sicht auf Europa, nur alle 2, 3 Tage der morgendliche Wetterbericht; die Tagespolitik, die über die Deutsche Welle herüber kam, war unbedeutend, uninteressant. Bei den alten Griechen war „Europa“ ein weißer Stier – macht Euch das neue Europa Angst oder fühlt Ihr Euch eher geschützt? Sibylle: Angst macht mir Europa, was ich an Entwicklung so in den letzten Jahren bewusst mitgekriegt habe, nicht. Ich sehe das eher optimistisch. Mark: Weder Angst noch Mut. Es verbreitet eher Freude, weil alles unkompliziert erscheint. Man kann überall hin, wenn man will; muss nicht lange überlegen, nur sein Geld zählen. Ihr habt noch keine Kinder – glaubt Ihr, dass sie in dem neuen Europa besser aufwachsen werden als in eigenstaatlichen Verhältnissen? Und werden sie mehr Europäer oder mehr Deutsche sein? Sibylle: Hallo, ich bin in der 9. Woche schwanger! Besser aufwachsen glaube ich schon in dem Sinne, dass das die Kinder mit einem anderen Bewusstsein tun. In dem ist Deutschland nicht mehr so ein Zentrum von Europa, nicht so isoliert, und das Thema Europa ist im Alltag schon selbstverständlich. Die Kinder werden es in der Schule thematisieren, und Reisen werden für sie noch einfacher. Ich denke also schon, dass es für die Kinder, so im Gefühl, wir sind eins, besser wird als wir es als Kinder erlebt haben. Allerdings kriege ich davon in meinem Alltag noch wenig mit und habe darauf kaum Einfluss, doch die Generation unserer Kinder wird sich eher mit Europa identifizieren. Dennoch wird es noch dauern, vielleicht mehrere Generationen, bis einer nicht mehr sagt: ich bin Deutscher, sondern ich bin Europäer. Mark: Das Europa, das ich zuerst kannte, war ja nur ein Teil von Europa, und so ein Teil vom Ganzen ist ja auch beträchtlich, und man lebte darin. Ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Die Möglichkeit, das ganze Europa kennenlernen zu dürfen, hatte ich erst als junger Erwachsener, und da wurde es für mich dann auch fassbar. Wie wird es nun mit den Kindern? .Ich war aus meiner Sicht weder Deutscher noch DDR-Bürger noch Bürger der BRD, sondern eher ein Erdenbürger mit Weltenpass - den ich aber nicht hatte! Ich glaube, dass ich, was meine Kinder betreffen könnte, einfach noch abwarten muss. In den Niederlanden nennt man das von Euch praktizierte Zusammenleben ohne Heirat „unter dem Besen getraut“ – was haltet Ihr von Traditionen wie z.B. der Ehe? Und wie werden sich Traditionen im neuen Europa verändern? Sibylle: Ich selber betrachte mich schon als traditionellen Menschen in dem Sinne, dass ich die Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin in Siebenbürgen, in Rumänien und in den 20 Jahren in Deutschland, lebe. Und so möchte ich eines Tages auch heiraten, weil ich die Ehe nach wie vor als gut empfinde. Ich habe die Vorstellung, dass, wenn man einen Menschen an der Seite hat, mit dem man alt werden möchte, den auch heiratet. Man kann natürlich auch glücklich sein ohne Trauschein, aber ich finde nicht, dass man, nur weil die Statistiken sagen, dass jede 2. Ehe geschieden wird, nicht heiratet. Da bin ich eher konservativ. Ansonsten glaube ich, dass in den einzelnen Ländern Europas, auch wenn dieses zusammenrückt, die Traditionen erhalten bleiben werden. Mark: Die Ehe hat für mich eher eine kirchliche Tradition, die in der DDR ja nicht groß gelebt wurde. Im übrigen wird sich das Althergebrachte nicht groß verändern; die Leute werden weiter mit solchen Traditionen leben. Ob ich heirate, weiß ich nicht. Da gibt es doch einen schlechten Beigeschmack, weil gerade in Deutschland der fiskalische Aspekt eine große Rolle spielt, während die kirchliche Tradition doch nicht so gelebt wird wie in vielen anderen Ländern. Ich weiß aber, dass solche Traditionen viel stärker in Sibylle drin sind - deshalb werden wir wohl heiraten. Überhaupt, denke ich, werden sich die nationalen Traditionen halten. Dabei entspringen doch viele große Konflikte wie z.B. auf dem Balkan aus nationalem Bewusstsein, aus Riten, weshalb die Menschen auch im alltäglichen Leben nicht miteinander klar kommen. Das alte Europa hat es nicht so richtig geschafft, das zu befrieden. Wenn ich nun die Entwicklung zum neuen Europa betrachte, z.B. damals, als Spanien und Portugal dazu kamen, und alle Angst hatten vor dem Armenhaus, weil es ja vor allem ein wirtschaftlicher Zusammenschluss war, da ist es gut, dass seit zwei Jahren eine EUVerfassung probiert, Richtlinien zu geben. Ich meine, dass durch sie das nationale Bewusstsein und damit auch die Traditionen eher gestärkt werden sollten in dem Sinne, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, um in gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Respekt eine befriedete europäische Ordnung zu haben. Letztendlich ist die Vielfalt der Traditionen ja gerade gut. Wir waren soeben schon mit kirchlichen Traditionen befasst – werden in einem neuen Europa die Unterschiede zwischen ihnen weniger oder tiefer, betrachtet am Zusammenleben mit den Muslimen? Sibylle: Ich glaube, dass der Islam gerade in den letzten Jahren durch die terroristischen Anschläge eine besondere Bedeutung gewonnnen hat, weil dabei in besonderem Maß die Verbindung zur Religion gesehen wird. Wenn jetzt Europa näher zusammenrückt, wird dieser Zusammenhang gerade bei der Türkei wichtig, aber bei ihr gibt’s noch tausend andere Themen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in die EU rein soll. Ich hoffe dennoch, dass sich Europa nicht abschottet, denn ich erlebe es eigentlich als offen und tolerant, eben auch bei den unterschiedlichen Religionen. Mark: Ich habe über die christlichen Religionen nur einen knappen historischen Überblick und weiß von den muslimischen Gebräuchen so gut wie nichts, weshalb mich diese Hysterie, die bei uns vorkommt, wenig tangiert. Ich denke, es ist ähnlich wie mit den nationalen Traditionen, aber doch noch eine Menge mehr, wenn Muslime hierher kommen, was ja den Prozess des Beitritts der Türkei so schwierig macht. Da stehen die unterschiedlichsten Interessen im Widerstreit. Dabei werden die wirtschaftlichen Interessen unter dem Mantel der Religionen verborgen; letztendlich will man die Türkei als Marktplatz haben und als militärischen Standort. In Deutschland hat sich das Zusammenleben deshalb so schwierig gestaltet, weil man die Leute einst nur zum Dreckputzen hierher geholt hatte. Die „Gastarbeiter“ konnten sich nicht ordentlich integrieren und hatten sich deshalb ihre Welt aus der Türkei mitgebracht, mit der wir Deutschen nicht richtig umgehen können. Doch wenn ich das richtig übersehe, haben alle den gleichen Gott und haben eigentlich auch das gleiche Interesse, zusammen zu leben. Es sind jedoch die Riten und Gebräuche untereinander so fremd, dass ein gemeinsames Regelwerk zu schaffen besonders schwer ist. Dadurch wird der Prozess immer weiter hinausgezögert, doch eigentlich wollen ihn doch alle. So lange die Wirtschaftinteressen, die Militärinteressen sich nicht beißen, kann man miteinander Pakte schließen .Man muss ja nicht unbedingt in einem Haus arbeiten, aber wenn die Leute solche Riten wie z.B. letzt den sog. Ehrenmord in Tempelhof so krass in die Öffentlichkeit reinbringen, dass die deutsche Bevölkerung schockiert ist, dann muss von der Politik schnell reagiert werden. Es ist daher, so schlimm das Ereignis auch ist, ein Katalysator, dass es schneller geht. Deshalb denke ich, dass solche schlimmen Auswüchse auch dafür dienlich sind, dass das Zusammenleben besser wird. Schließlich haben sich vor 500 Jahren oder so bei uns Katholiken und Evangelische bekriegt. Zurück zum Heute: die Leute, die kommen, sollten wissen, dass sie sich anpassen müssen, und die Leute, die da sind, müssen wissen, dass sich jemand anpassen will, ohne sich aber zu verrenken. Ihr beide seid jenseits bzw. diesseits der „Berliner Mauer“ aufgewachsen –hatte der Fall der „Mauer“ eine europäische Dimension? Und hat er vielleicht Euer Europa-Verständnis verändert? Sibylle: Sicher. In erster Linie war es aber wichtig für Deutschland, wo ein Volk, das so lange getrennt war, wieder zusammengeführt worden ist und vereinheitlicht wurde. Darüber hinaus war es bedeutsam für die Menschen, deren Familien zerrissen wurden, und die sich erst danach wieder in die Arme schließen konnten. Deutschland hat ja dadurch auch einen ganz anderen Stand den anderen Ländern, besonders den Nachbarn, gegenüber. Mark: Wichtig war es für Europa, und weltpolitisch war es ein entscheidender Schritt gewesen, weil die Berliner Mauer, auch symbolisch, die Welt von Nord nach Süd getrennt hatte. Auf der Landkarte sah man den roten Osten und den blauen Westen, so wie es wenigsten bei uns im Geographieunterricht war. Als die Mauer gefallen ist, was ja auch ein Zufallsprodukt war, da war der Prozess vom 9. November 89 bis 3. Oktober 1990, als der Anschluss der DDR offiziell passiert war, aus meiner persönlichen Sicht nicht gut für die Entwicklung Europas. Dass sich aber die vier Weltmächte hingesetzt haben, und die beiden deutschen Staat mehr oder weniger gleichberechtigt daneben sitzen durften und sich, auch mehr oder weniger gleichberechtigt, entscheiden durften, wir machen es so und so, und die Großen gesagt haben, o.k., wir lassen sie mal machen, das ist für mich ein Zeichen mehr weltpolitischer als europäischer Natur. Eine schlechte Folge des Mauerfalls war, dass bald danach auf dem Balkan, in Ex-Jugoslawien, die Probleme losgegangen sind, die vorher durch die Mauer flach gehalten waren. Es begannen Kriege. Dass die Karten durch den Fall der Mauer weltpolitisch neu gemischt wurden, das hat für mich und für Europa selbstverständlich auch Vorteile. Infolge dieser „Mauer“ waren Eure Freundeskreise „westlich“ bzw. „östlich“ zusammengesetzt – welche Rolle spielten darin europäische Ausländer? Sibylle: In der Grundschule hatte ich schon Ausländer in der Klasse. Ich bin mitten im Schuljahr in die 3. Klasse gekommen, damals aus Rumänien, und die Mitschüler haben schon gemerkt, dass die „Neue“ zwar Deutsch spricht, aber das R rollt und auch anders betont. Ich hatte auch andere Verhaltensweisen; bin z.B. immer aufgestanden, wenn ich angesprochen wurde oder etwas sagen wollte. Ich habe mich aber schnell integriert, und in der Oberschule war es gar kein Thema mehr, auch unterschwellig habe ich nichts gespürt. In meinem Freundeskreis waren keine Ausländer. Mark: Unbedeutend. Die über die Schule vermittelten Brieffreunde in Polen und in Moskau hat man nicht gesehen, und bei den wenigen Reisen nach Bulgarien oder in die Tschechoslowakei ist man als normaler Tourist nicht näher mit der Bevölkerung in Kontakt gekommen. Inwieweit sind heutzutage Euer „Westkreis“ und “Ostkreis“ miteinander vermischt? Und gab es dabei Probleme? Sibylle: Es gibt jetzt eine Vermischung, aber nur insoweit, dass ich mit einem Teil von Marks Freunden befreundet bin. Ich treffe mich allerdings nur punktuell, nicht so häufig, mit ihnen; meistens zusammen mit Mark. Er geht auch schon mal mit einem meiner Mädels frühstücken. Während des Studiums gab es eine größere Vermischung, denn von uns Studenten kam ein Drittel aus Westberlin, ein Drittel aus dem Osten und der Rest anderswo her. Damals, 1994, haben wir durchaus gemerkt, wo jemand herkam. Es haben sich zwar Cliquen gebildet, aber wir haben uns dennoch vermischt. Anders war es bei Freundinnen, die in Westberlin in anderen Berufen gearbeitet haben; die hatten keine Ostler im Freundeskreis. Wenn an meinem Geburtstag beide Freundeskreise zusammen kamen, hatten die „reinen Wessies“ nicht sofort was zu den anderen zu sagen, was aber auch damit zu tun hatte, dass wir Sozialarbeit studiert haben und dadurch aufgeschlossener waren. Mark: Über das Kennenlernen hinaus gab es keine Vermischung. Wenn ich mit meinen Leuten aus dem Osten zusammen bin, sind kaum die Westleute dabei. Ich bin zwar bei Sibylles Freunden und sie bei meinen, aber die untereinander eher nicht. Bei Parties gibt es schon Vermischungen, wobei allerdings zu beobachten ist, dass die Kreise doch mehr oder weniger unter sich sind. Das sehe ich jedoch nicht als problematisch an: man kennt sich halt nicht genug. Noch einmal zu „Wessies“ und „Ossies“ – hat es ein Westler leichter als ein Ostler, sich dem Gedanken des neuen Europa anzunähern? Sibylle: Nein, das glaube ich nicht. Man könnte es zwar meinen aus der Geschichte heraus, weil vielleicht ein Ossie die europäischen Länder nicht so gekannt hat, nicht so reisen durfte, irgendwie eingesperrt war, aber ich denke, das rein Geistige, sich damit auseinander zu setzen, besonders nach der Wende, was ja die Hoch-Zeit dafür war, das haben die Ossies genau so mitgekriegt wie die Wessies. Letztendlich ist sowieso die Persönlichkeitsstruktur entscheidend. Mark: Weiß ich nicht so genau. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es niemandem so richtig interessiert: das neue Europa / das alte Europa. Wenn auf westlicher Seite etwas exotisch vorkommt, dann ist ein kurzer Reiz da, zum Beispiel als wir damals aus der DDR gekommen sind. Ähnliches kann es jetzt auch passieren: du kommst aus den Masuren hierher? Oder aus Zypern, wo ja ein „interessanter“ Konflikt ist. Wenn überhaupt Interesse besteht, dann ist das kaum von politischer Natur. Fühlt Ihr Euch eigentlich selbst noch ein bisschen als „Wessie“ bzw „Ossie“? Und wie lange wird das noch so weitergehen? Sibylle: Ja, immer dann, wenn Mark sagt „ach Du mit Deinem Charlottenburg!“ (lacht). Irgendwie fühle ich mich schon noch als Wessie; die 20 Jahre dort in Westberlin haben mich doch geprägt, und die 9 Jahre in Rumänien haben mich sogar stark geprägt. Ich fühle mich aber auch im Osten wohl. Mark: Ich denke, dass ich immer ein Ossie bleiben werde, was damit zu tun hat, dass sich durch die künstliche Teilung der Welt infolge der„Mauer“ ein ganz anderer Lebensraum entwickelt hatte , der keinen großen Austausch ermöglichte. Es gab nur eine Art und Weise, sich zu entwickeln : in Form der Anpassung an das, was gerade ist. Dieses wird in mir immer drin sein. Durch den Anpassungszwang war man allerdings stets auch neugierig, weil man wusste, es muss ja noch etwas anderes geben. Auch diese Neugierde wird bei mir immer da sein. Allgemein gesagt ist mein Vorurteil gegenüber den Wessies so gestaltet, dass sie ein oberflächliches Bewusstsein haben; sie sagen „Hach, ist das aber interessant!“, doch sie fragen nicht nach Wieso und Warum. Ihr habt Eure gemeinsame Wohnung in Ostberlin eingerichtet – gab es dafür nur zweckmäßige oder auch andere Gründe? Sibylle: In diesem Friedrichshain hier hatte Mark ja seine Wohnung, und ich hatte meine in Charlottenburg. Da haben wir uns gedacht, am besten wäre Kreuzberg, weil das die Mitte zwischen unseren beiden Lieblingsbezirken ist, aber dort haben wir keine uns passende gefunden. Da sagte Mark: ok, ich würde auch nach Charlottenburg ziehen, und ich habe daraufhin gesagt, dass ich auch nach Friedrichshain ziehen würde. Dann kam die Zweckgeschichte, indem wir hier in Friedrichshain diese tolle Wohnung fanden. Mark: Formal sind wir in einem Mischbezirk aus dem westlichen Kreuzberg und dem östlichen Friedrichshain, also in einem Ost-West-Bezirk; insofern sind wir den Stapfen der Politik zur Durchmischung gefolgt. Wir hatten uns gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen Lebensraum, wo wir uns wohlfühlen. Das wäre Kreuzberg gewesen, wenn auch nicht gerade SO 36; es hätte auch Schöneberg sein können. Dass wir diese bezahlbare Wohnung, die nun in „meinem“ Bezirk liegt, gekriegt haben, ist eher ein Zufall. Sie liegt hier zum Glück etwas außerhalb des Szenebezirks um Boxhagener Platz und Simon-Dach-Straße; hätten wir solch eine schöne in Charlottenburg gekriegt, wäre ich auch dorthin gezogen. Apropos Wohnung, Michail Gorbatschow gebrauchte gegen Ende seiner Amtszeit gern die Metapher vom „gemeinsamen Haus Europa“, in dem die Länder ihre Wohnungen haben – sprechen Euch solche Bilder überhaupt an? Sibylle: Mir ist dieser Ausdruck nicht präsent. Mark: Mich spricht es insofern an, dass es Wohnungen gibt, in denen man sich, oder die Völker sich, wohl fühlen. Und wenn sich ein Volk in seiner Wohnung wohl fühlt, und man kommt zu Besuch, dann fühlt man sich dort auch wohl. Deshalb braucht ein Europa viele gute Wohnungen. In diesem Zusammenhang – benötigt Europa eine einheitliche Hymne und andere Symbole einer Gemeinsamkeit? Sibylle: Also europäische Nationalhymne nicht. Die Europafahne mit den Sternen finde ich dagegen gut. Gut ist auch das Europazeichen auf den Autokennzeichen; wenn man anderswo unterwegs ist, sieht man halt dieses vertraute Symbol wieder, und das erinnert dich daran, dass wir menschlich vereint sind. Die gleiche Währung ist auch verbindend und nicht nur erleichternd. Mark: Im Prinzip will ich keine einheitlichen Symbole. Dieses neue Europa ist von politischer, von wirtschaftlicher, von kultureller Art – welcher Anteil ist für Euch der wichtigste? Und wie sehen es die verantwortlichen Politiker? Sibylle: Das Geld! Ich denke, für die Politiker spielt die Wirtschaft eine ganz wichtige Rolle; sicherlich auch die Politik im Sinne: wir sind Europa und treten gegen die Weltmacht Amerika an. Es geht um Macht und um Geld. Für die Politik ist der kulturelle Hintergrund eben nur ein Hintergrund. Für mich? – eine spannende Frage. Es gibt das europäische Parlament, aber davon kriegt man wenig mit. Ich glaube auch, dass das mein Alltagsleben nicht wirklich beeinflusst. Allerdings beschäftige ich mich damit auch nicht genug, weil es für mich so weit weg ist. Ich denke, dass da zu wenig Werbung gemacht wird; außer zur Europawahl, wo mal ein paar Broschürchen kommen. Letztendlich wird durch das Nichtwissen von mir und vielen anderen unser Alltag deshalb nicht groß tangiert, weil wir nicht so richtig einbezogen werden. Mark: Zuallererst wird nur die Wirtschaft gesehen Das ist der enorme Nachteil in der heutigen Welt, dass jeder Entwicklungsprozess so eng mit der Wirtschaft verflochten ist. Das ist eben so, und das ist schade, aber man kann es nicht ändern. Weil das Wirtschaftliche nun für die meisten so wichtig ist, ist es für mich unwichtig, denn da kümmern sich die anderen eh darum! Wenn man z.B. alles über die Kultur machen würde, würde auch ich fragen: habt ihr überhaupt geguckt, ob das ökonomisch zusammen passt? Dennoch sind für mich Tradition, Brauchtum, die ganze Kultur wichtiger. Um noch einmal auf Eure Wohnung zurück zu kommen: bei der Sanierung dieses Hauses wurde von den Bauarbeitern wenig deutsch gesprochen – findet Ihr es richtig oder wenigstens vertretbar, dass EU-Ausländer unseren Leuten die Arbeit wegnehmen? Sibylle: Eine provokante Frage! Ich finde das ungerecht, auch wenn es erlaubt ist; wie auch, wenn z.B. Opel eine ganze Produktion woandershin verlagert. Das ist natürlich eine Flexibilität, die auch eine Chance sein kann, denn genau so gut kann ein arbeitsloser Berliner Arzt nach Polen gehen und macht da seine eigene Praxis auf. Und wenn ein Pole, der durch die dortigen Bedingungen seine Familie nicht ernähren kann, deshalb hierher kommt, dann finde ich das auch wieder gut. Dennoch kann ich die maulenden deutschen Bauarbeiter verstehen. Ich muss dazu noch sagen, dass wir in unserem Freundeskreis kaum darüber sprechen, weil wir nicht betroffen sind, aber ich denke, das wird auch noch anders werden. Mark: Das ist für mich kein Problem. Es hängt nicht nur mit preiswerten Waren zusammen, mit billigen Löhnen, mit niedrigen Steuern, sondern es hängt eher damit zusammen, dass die Leute hierher kommen, um für Zuhause zu arbeiten, möglichst viel Geld zu bekommen - und das ist ja doch das Prinzip unserer Gesellschaft. Man muss viel Geld scheffeln, um gut leben zu können, und das machen die, und das kann jeder Deutsche auch machen. Ihr beide arbeitet unter dem Dach eines großen Hilfswerkes für sozial schwache, oft kranke Menschen – könnt Ihr Euch ein in ganz Europa einsetzbares Sozialsystem vorstellen? Und kann das deutsche Sozialsystem dafür als Vorbild dienen? Sibylle: Mit der zweiten Frage beginnend, hat das deutsche System gezeigt, dass es nicht funktioniert: der alte Standard war nicht zu halten. Wir müssen schon einiges ändern, wo andere europäische Länder einfach besser sind, angefangen bei der Finanzierung, bis zur Drogenpolitik. Die skandinavischen Länder sind oft schon Vorreiter gewesen, punktuell auch die Niederlande. Zum ersten Teil der Frage: ich halte ein einheitliches System für Europa nicht für möglich aufgrund der unterschiedlichen Strukturen, der Problematik für die Menschen in den einzelnen Ländern. Sicherlich kann man aber in der Sozialpolitik bestimmte Dinge vereinfachen und vereinheitlichen. Mark: Das ist schwierig. Die unserem Sozialsystem zugrunde liegende Verwaltung ist eine Katastrophe. Ich weiß allerdings nicht, ob es irgendwo besser gemacht wird. Die Menschen, die wir betreuen, haben hauptsächlich Schwierigkeiten damit, die Verwaltungsvorschriften einzuhalten. Natürlich gibt es auch deren eigene Probleme, z.B. familiärer Art oder Drogen. Unser Sozialsystem hat leider nicht genügend Möglichkeiten, auf die individuellen Probleme einzugehen, sondern hat eine Matrix vorgelegt, die in sich schon schwer zu verstehen ist - wie wir es gerade erfahren mit der neuen Hartz IV-Gesetzgebung, die die Verwaltung selber nicht mehr versteht. So brauchen die Leute unsere Unterstützung, um wenigstens ihre Minimalansprüche durchsetzen zu können. Ich kenne allerdings kein anderes System in Europa, um Vergleiche anstellen zu können. Dabei sind die Gründe für soziale Hilfe immer die gleichen: Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Essen. Wie man jedoch den Leuten verständlich macht, dass dazu nicht Völlerei, Alkoholkonsum und vor allem nicht der Einsatz krimineller Energie zur Ausnutzung der Angebote gehören, das weiß ich nicht. Das wird es wohl immer geben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in 20, 30 Jahren ein einheitliches Sozialsystem existiert, als Richtlinie, vielleicht so wie bei der Weltgesundheitsorganisation für die Krankheiten. Zum Schluss zurück zu Eurer gemeinsamen Australienreise – kann das „Commonwealth of Australia“, in dem die einzelnen Bundesstaaten eigene Verfassung, Parlament und Regierung haben, aber auch zentrale Verfassung, Parlament und Regierung existieren, ein Vorbild für das neue Europa sein? Und was haltet Ihr von der dortigen Wahlpflicht? Sibylle: Dass eine zentrale Regierung für Europa kommen wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil die einzelnen Länder ihre Autonomie behalten wollen. Wie es in Australien wirklich funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Eine Zentralmacht birgt viele Gefahren in sich; könnte sich aber auch positiv auswirken, weil jetzt die europäischen Länder gern ihr eigenes Ding machen. Ich vermag nicht Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen. In Australien gibt es tatsächlich eine Wahlpflicht, und die hielte ich auch für Europa vertretbar, weil an der Europawahl unglaublich wenige Leute teilgenommen haben. Das lag aber auch an den mangelnden Informationen darüber, was die zu wählenden Abgeordneten dort überhaupt tun. Es müsste jeder seine Stimme abgeben, und wenn er die dann ungültig macht, ist das schließlich auch eine Meinungsäußerung. Mark: Zunächst zur Wahlpflicht: Diese Wahlpflicht in Australien hat den Hintergrund, dass die, sagen wir mal, weißen Australier Angst haben, von den asiatischen überflutet zu werden, weil die fleißiger zu den Urnen gehen würden, wenn die Wahlen freiwillig wären. Jetzt zu den zentralen Institutionen in Europa: das Konstrukt Europa muss ganz locker sein, weil sich jeder Part von Europa und dessen Menschen mit ihren Traditionen und Riten im Gefüge wiederfinden will. Aber es muss auch so stabil sein, dass es sich gegenüber außereuropäischen Einflüssen behaupten kann, im Sinne von positivem Streit. Wenn Europa sich nämlich nicht behaupten kann, gibt es wieder neue Konflikte. Noch einmal zu Australien: was die Zentralregierung in Canberra macht, das interessiert in den Bundesländern kaum jemand. Doch es gibt noch den Generalgouverneur, der bei prinzipiellen Angelegenheiten eingreifen kann. Für dieses Australien ist bezeichnend, dass seine Bürger Misstrauen gegen alle Politiker haben, und das finde ich gut. Deshalb erkennen sie auch die britische Königin als Staatsoberhaupt an, denn sie glauben, dass ihre Politiker nach der eigenen Brieftasche entscheiden. Es muss wohl immer ein Mischmasch sein: aus einem Regelwerk, in das auch die Traditionen einfließen müssen, und aus einzelnen Aktionen, die die Politiker ausführen müssen Für Europa würde ich es gut finden, wenn eine zentrale Institution bestünde, durch die sich der einzelne Bürger eines Landes vertreten fühlen kann, wenn er mit seiner Regierung nicht einverstanden ist. Wo der Einzelne sagen kann: das, was in meinem Land passiert, ist nicht in Ordnung, und das wird dann überprüft. Es sollte also oberhalb der einzelnen Regierungen ein Korrektiv da sein, das berät, das Richtlinien vorgibt. Europäische Fachminister brauchen wir aber nicht; insofern ist die EU-Kommission schon ganz in Ordnung. Ich bedanke mich bei Euch für die interessanten Gespräche.