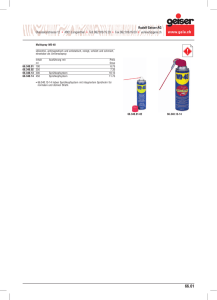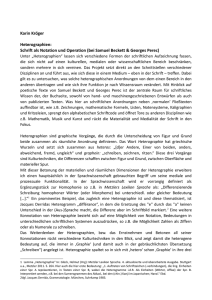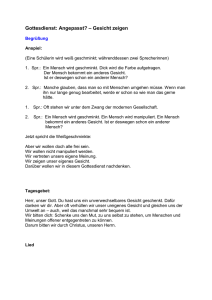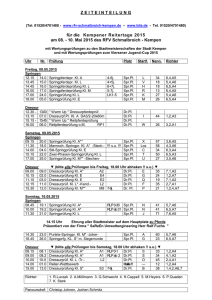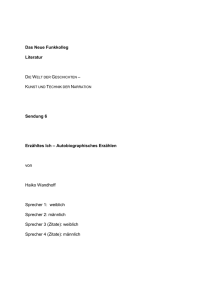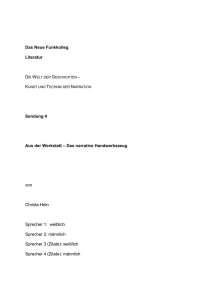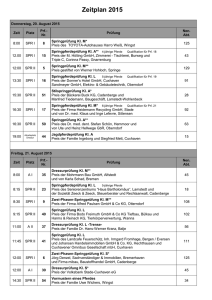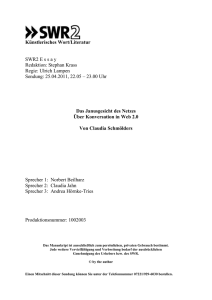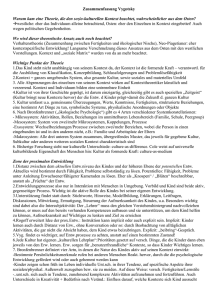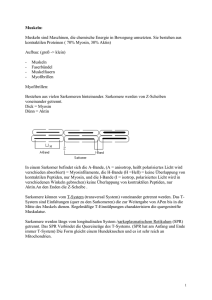File
Werbung
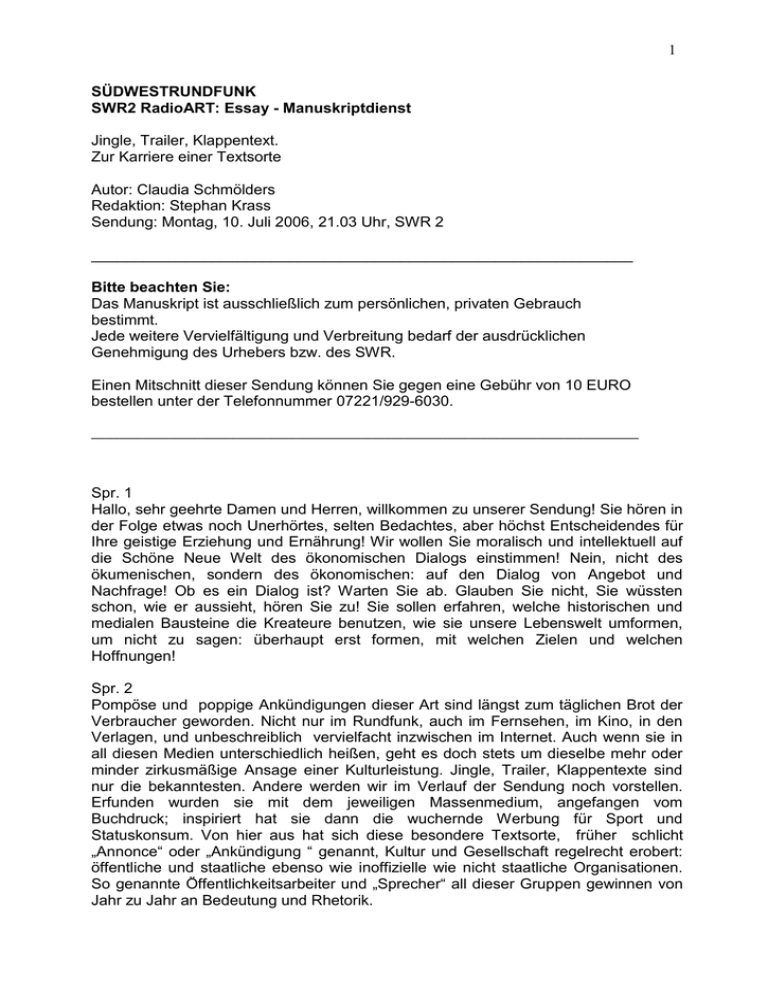
1 SÜDWESTRUNDFUNK SWR2 RadioART: Essay - Manuskriptdienst Jingle, Trailer, Klappentext. Zur Karriere einer Textsorte Autor: Claudia Schmölders Redaktion: Stephan Krass Sendung: Montag, 10. Juli 2006, 21.03 Uhr, SWR 2 _______________________________________________________________ Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Einen Mitschnitt dieser Sendung können Sie gegen eine Gebühr von 10 EURO bestellen unter der Telefonnummer 07221/929-6030. _____________________________________________________________________________________ Spr. 1 Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserer Sendung! Sie hören in der Folge etwas noch Unerhörtes, selten Bedachtes, aber höchst Entscheidendes für Ihre geistige Erziehung und Ernährung! Wir wollen Sie moralisch und intellektuell auf die Schöne Neue Welt des ökonomischen Dialogs einstimmen! Nein, nicht des ökumenischen, sondern des ökonomischen: auf den Dialog von Angebot und Nachfrage! Ob es ein Dialog ist? Warten Sie ab. Glauben Sie nicht, Sie wüssten schon, wie er aussieht, hören Sie zu! Sie sollen erfahren, welche historischen und medialen Bausteine die Kreateure benutzen, wie sie unsere Lebenswelt umformen, um nicht zu sagen: überhaupt erst formen, mit welchen Zielen und welchen Hoffnungen! Spr. 2 Pompöse und poppige Ankündigungen dieser Art sind längst zum täglichen Brot der Verbraucher geworden. Nicht nur im Rundfunk, auch im Fernsehen, im Kino, in den Verlagen, und unbeschreiblich vervielfacht inzwischen im Internet. Auch wenn sie in all diesen Medien unterschiedlich heißen, geht es doch stets um dieselbe mehr oder minder zirkusmäßige Ansage einer Kulturleistung. Jingle, Trailer, Klappentexte sind nur die bekanntesten. Andere werden wir im Verlauf der Sendung noch vorstellen. Erfunden wurden sie mit dem jeweiligen Massenmedium, angefangen vom Buchdruck; inspiriert hat sie dann die wuchernde Werbung für Sport und Statuskonsum. Von hier aus hat sich diese besondere Textsorte, früher schlicht „Annonce“ oder „Ankündigung “ genannt, Kultur und Gesellschaft regelrecht erobert: öffentliche und staatliche ebenso wie inoffizielle wie nicht staatliche Organisationen. So genannte Öffentlichkeitsarbeiter und „Sprecher“ all dieser Gruppen gewinnen von Jahr zu Jahr an Bedeutung und Rhetorik. 2 Spr. 3 „Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Rhetorik der Gegenüberstellung von Anbieter und Konsument, von Produzent versus Kunde, in nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens vorgedrungen. In den Sphären Kultur, Philanthropie, Erziehung und Politik sind diese Redeweisen fast omnipräsent. Marketing ist... offenbar ein allgemeines Instrument für die Strukturierung sozialer Beziehungen geworden. Regis McKenna gab 1991 die provokante Parole aus: „.marketing is everything and everything is marketing. “ Spr. 1 So heißt es in einer drittmittelwerbenden Tagungsankündigung zum Thema. Möglichst prägnant soll es aus- und vorgestellt werden, denn es geht um die Aufmerksamkeit von intellektuellen Passanten, von Leuten, die über Geld verfügen und solchen, die es gern hätten. Dazu zwingt inzwischen eben auch eine akademische Welt, die sich immer tiefer in die ökonomische einfädeln, wenn nicht sogar in ihr auflösen soll. Tagungen alten Stils hätten keiner Werbung bedurft; der Ordinarius oder das Institut hätten einfach Titel, Ort, Referenten benannt; alles Weitere hätte sich aus der Autorität des Professors oder dem Renommé der Sache ergeben. Aber was heißt Autorität oder Renommé? Spr. 2 Neuere Theorien zum marketing sehen schon Panik aufkommen. Adressaten und Konsumenten der Werbung wissen bald nicht mehr, wie sie als Verbraucher mit ihrer Aufmerksamkeit haushalten sollen. Andererseits entfalten sie selbst als Bewerber um diese Ressource unbeschreibliche Gier. Früher hätte man es Geltungssucht genannt; heute hängt die Volkswirtschaft davon ab. Aufmerksamkeit verbraucht Zeit; Aufmerksamkeit muß erzwungen werden, und dabei heiligt der Zweck inzwischen schon nahezu jedes Mittel. Andererseits gilt: je unheiliger die Mittel, desto unseriöser der Anbieter. Und desto törichter auch. Denn schließlich soll die Kundenbeziehung ja auch verstetigt werden. Jeder Verlag wünscht sich Leser, die seine Bücher generell lesen möchten; jeder Radiosender will seine Stammhörer, jede Zeitung ihre Abonnenten gewinnen, jeder Filmproduzent seine Fans. Spr. 1 Zwar ist nicht jedes Statement der Öffentlichkeitsarbeiter eine Ankündigung. Wohl aber soll der Eindruck, den diese Arbeiter beim Kunden hinterlassen, der Vertrauensbildung zwischen Kunde und Anbieter dienen. Denn ob eine Ankündigung – eines neuen Produkts, einer neuen Strategie, einer neuen Führungsfigur – ernst genommen wird, hängt ab vom Maß des Vertrauens und eben nicht nur von der Aufmerksamkeit, die sie erregt. Der Soziologe Anthony Giddens hat den Unternehmer mit einem versorgenden Vater verglichen, der eben nicht nur einmal, sondern immer wieder Nahrung heranschaffen soll. Spr. 3 „Der Glaube an die Zuneigung des Versorgers bildet das Wesen jenes Sprungs in die Bindung, den das Urvertrauen ebenso wie alle späteren Vertrauensformen voraussetzt ... ein grundlegendes Merkmal der Herausbildung des Vertrauens im Kindesalter ist das Vertrauen in die Rückkehr des Versorgers.“ 3 Spr. 2 Und nicht nur seine Verlässlichkeit, auch wie der Sprecher aussieht, wie er sich gibt, wie er redet, wenn er leibhaftig oder im Lichtbild auftritt, spielt dabei eine Rolle. Giddens spricht geradezu von „gesichtsabhängigen“ Vertrauenskontexten, in denen ein Manager oder Experte das Unternehmen persönlich repräsentiert. Ein unentbehrlicher semantischer Hof unserer Medienwelt für jede Ankündigung, sei’s von Entlassungen oder von Übernahmen oder von Einbußen und so fort. Spr. 1 Aber zurück zu den Anfängen aller Ankündigung, sehr geehrte Damen und Herren! Fangen wir noch mal an! Denn Ankündigungen leben vom Zauber des Anfangs. Da wir alle den Anfang mehr lieben als das bittere oder böse oder auch nur dicke Ende, ziehen Ankündigungen oft alles Interesse auf sich, je lauter und greller sie sind. Wer ein Kulturprodukt ankündigt, hat die Sache noch in der Hand. Er ist nicht verantwortlich für das Scheitern der Sache selbst. Noch liegt der Zauber des Spielerischen darauf, die Kunst der Andeutung, und umgekehrt beim Nutzer die Freiheit der Wahl. Noch kann er zurücktreten. Spr. 2 So mächtig verlockt die Magie dieses Anfangs, dass schon die erste Erwähnung Licht auf den oder die Erwähnten lenkt. Längst gelten in der Welt der Preisverleihungen schon Nominierungen als Auszeichnung. Zumal im Sport sind Ankündigungen inzwischen regelrecht eigene Festveranstaltungen; lebensformartige Kampagnen. Was für eine ungeheure Trommel wird für die Fußball- Weltmeisterschaft gerührt! Und wie tief hat das Marketing des Sports, ja der Sport selber die kulturellen Sphären durchdrungen! Aber um in die Kultursphäre einzutreten: auch Ankündigungen wie etwa in der Welt des Buches - die so genannten Klappentexte - bemühen sich um möglichst magische Ansagen. In der weltweiten Enzyklopädie Wikipedia werden sie, etwas unbeholfen, folgendermaßen beschrieben: Spr. 3 „Als Klappentext wird ein auf den Einschlagklappen eines Schutzumschlags stehender Text bezeichnet. Üblich sind eine kurze, werbende Zusammenfassung des Buchinhalts (meist auf der vorderen Einschlagklappe), eine Autorennotiz (meist auf der hinteren Einschlagklappe) und gegebenenfalls Hinweise auf weitere Bücher des Verlags. Bei Büchern ohne Umschlag (Paperbacks und Taschenbüchern) wird dieser Text in der Regel auf der Seite 2, direkt hinter dem Schmutztitel platziert.“ Spr. 2 Werbung muß sein, Ankündigungen müssen sich wie ein Rhizom verbreiten. Name und Titel sollen schließlich irgendwann auf den Bestsellerlisten erscheinen, nicht anders als ein Song in den charts. Spr. 3 „Neben dem eigentlichen Klappentext gibt es häufig weitere Texte auf der Rückseite des Schutzumschlags, der also auch bei geschlossenem Buch zu lesen ist. Er enthält bevorzugt kurze, die Neugier weckende Zitate aus dem Inhalt oder bei Nachauflagen aus positiven Rezensionen oder Testimonials.“ 4 Spr. 1 Wie ein Pferd auf der Rennbahn soll das Buch an die Spitze laufen. Und warum nicht? Schließlich hat dieser Wettbewerb unsere neue Kanondiskussion angestoßen, und damit die Frage nach der Substanz gestellt. Kann das Buch seine Ankündigung bewähren? Ist es ein flop? Auch wenn die Rankings ihre Inhalte gnadenlos quantifizieren – auch die Kanoniker unter ihnen zählen ja Stimmen aus – noch geht es hier um Qualität, noch um das Vertrauen des Käufers, noch um die Idee einer kritischen Instanz. Wie lange noch, ist die Frage. Längst schon verkehrt das Internet die Idee der qualifizierenden Rezension völlig ins Gegenteil und macht eine Annonce daraus, eine möglichst lobhaltige. Wer in amazon ein Werk annonciert, muß Freunde um „Rezensionen“ bitten oder sie selber schreiben, das heißt Lobeshymnen des eigenen Buches. Nicht anders als bei eBay die Verkäufer vom Käufer gelobt werden wollen, und sei es auch nur in Form von Sternchen. Auch Bücher erhalten bei amazon solche Sternchen, auf dass der huschende Käuferblick überhaupt keine Rezension lesen muß, um entscheiden zu können. Spr. 2 Bedenkt man die Rolle der Besternung etwa im gesamten Tourismus, bei Hotels und Restaurants, dann wird man die Ökonomie dieser Annoncenkultur bewundern. Schließlich muß, wer mit Sternchen arbeitet, nur bis fünf zählen können. Mit besternten Namen oder Titeln kündigt sich Qualität selber an; Vertrauen wird eingeworben. Welche Machenschaften dahinter stehen, wie es zu diesem bestirnten Warenhimmel kommt, ist eine andere Frage. Spr. 1 Nicht alle Annoncen entgleisen ihren Erfindern so wie der Klappentext dem Buchhandel im Internet. Eine echte, nämlich phantasievolle Kultur der Ankündigung kann man im Radio finden, in so genannten Jingles. Vielleicht waren sie überhaupt das Modell für alles Folgende? Jingles sind eine eigene radio-akustische Gattung der Ankündigung. Es gibt sie nicht nur für einzelne Sendungen wie etwa Kriminalhörspiele oder Features, sondern auch für den ganzen Sender, etwa mit seinem “Pausenzeichen“, seiner Erkennungsmelodie im Rausch der Frequenzen. Etwa so: [Hier die Sendermelodie des SWR] Spr. 2 Wie das Werbefeld insgesamt, so wachsen und wuchern die Jingles in sämtlichen Sendern. Viele verfügen schon über eigene Versatzstücke für jede Sorte von Nachrichten: für den Sport, für die Wirtschaft, für die Kultur, ja selbst fürs Wetter. Einfallsreicher sind aber die genuinen Programm-Jingles, die Eigenwerbung des Senders, wie etwa hier für das Berliner Info-Radio: [„Das Jahr hat 365 Tage...“] Spr. 1 Wie man hört: Auch radiophone Ankündigungen werben um das Vertrauen der Hörer. Und diese Werbung kann abgründig werden. Zeitzeugen des Dritten Reichs erinnern sich an das trügerische Pausenzeichen der Nazis nach der Melodie „Üb immer Treu und Redlichkeit“. Und unvergessen bleibt auch die Rolle der BBC als dem wichtigsten Feindsender, den man nur unterm Kopfkissen hören durfte und also im Dunkeln finden musste. Geradezu genial hat die BBC ihr Vertrauenskapital über die Zeiten 5 bewahrt und vermehrt; noch heute erinnert sie, in einem ihrer besten NachrichtenJingles, sogar ans vergangene Commonwealth. Aus aller Welt melden sich hier die Korrespondenten im O-Ton, und zuletzt wird dem Hörer der Eindruck vermittelt, er komme informationell nachhause, in eine Heimat. Das klingt dann so: [Nachrichtenjingle der BBC: „Wherever your are, wherever you listen, this is the BBC! Bushhouse London“] Spr. 2 Dabei war der Jingle gar keine europäische Erfindung. Einen europäischen Rundfunk gab es ja erst seit Anfang der zwanziger Jahre; aber die Tradition der massenmedialen Ankündigung begann in Amerika, und dort sogar fast zehn Jahre vorher im Kino als sogenannter „Trailer“. Im Jahr 1911, schreibt der Filmhistoriker Vinzenz Hediger, Spr. 3 „bezeichnete der Ausdruck Trailer noch einfach einen >Streifen Blankfilm, der ans Ende einer kurzen Filmrolle angeklebt war<, also das Gegenstück zum >leader<, der Allonge am Anfang der Kopie. Doch schon 1913 bezog sich der Ausdruck auf einen kurzen Film am Ende einer Rolle. In den späten 10er Jahren schränkte sich die Bedeutung ein auf die spezifische Funktion der Werbung für einen kommenden Film. Der Gebrauch des Begriffs hat sich seither kaum verändert.“ Spr. 1 Doch vielleicht haben Trailer und Jingles ihrerseits noch viel ältere Vorgänger? Stellen wir uns einen altmodischen Ball in einem englischen Schloß vor, sagen wir vor zweihundert Jahren, etwa aus der Zeit von Jane Austen, deren Roman „Stolz und Vorurteil“ mehrfach verfilmt wurde. Jeder ankommende Besucher wird in der entscheidenden Szene vom Zeremonienmeister in den Saal geführt: dieser stößt mehrmals, jingleartig mit dem Stock laut auf den Boden, bittet um Ruhe und kündigt den neuen Gast namentlich an. Dieses aufmerksamkeitsheischende Klopfen imitiert seinerseits natürlich das Klopfen an eine Tür. Man klopft, wenn man Eingang begehrt; aber im Unterschied zum Auftritt in einer Gesellschaft lässt sich der Klopfende vor einer Tür zunächst nicht erkennen, er könnte sogar auch weglaufen, bevor jemand öffnet; selbst vor dem Auge einer Kamera. Gerade diese Unsichtbarkeit hat wiederum auch die musikalische Phantasie angeregt: man denke an das Klopfen in Mozarts Oper Don Giovanni oder an das berühmte „PampampamPAAM“ in Beethovens Eroica- Sinfonie. In beiden Fällen klopfen höchst unerwünschte oder doch jedenfalls unheimliche Gäste an die Tür; bei Mozart ist es der „Steinerne Gast“, für Beethoven gar das Schicksal selber. Spr. 2 Die unheimlichste symbolische Variante dieser akustischen Ankündigung kennen wir aus der deutschen Geschichte, von Hitler, der sich mit Johannes dem Täufer verglich und als „Trommler“ dem eigentlichen Erlöser der deutschen Schmach vorangehen wollte. Wenig später übernahm er bekanntlich die Rolle des deutschen Messias selber - und wie zur Antwort darauf entwarf die BBC im Zweiten Weltkrieg einen Jingle für ihre Hörer aus eben jenen schicksalhaften Klopfzeichen der Beethoven-Sinfonie. [Einspielen des historischen Jingles] 6 Spr. 2 Wer weiß schon, daß das Anklopfen selber biblische Tradition hat? Im ersten Universallexikon deutscher Sprache, im berühmten, so genannten „Zedler“ aus dem 18. Jahrhundert, gibt es im ersten Band von 1731 einen eigenen Eintrag zu diesem Wort, das sich auf lauter Bibelzitate bezieht: Spr. 3 „Anklopfen: Matthäus VII, Vers 7 [klopfet an so wird euch aufgetan] ist sonst eine Tat, die mit den Händen geschehen muß, welches jedoch allhier nicht so zu verstehen ist, als ob man den Himmel mit den Händen berühren und da anklopfen könnte, sondern es will vielmehr den Ernst und den Eifer im Gebet anzeigen. Wie dann der Freund im Hohen-Liede eingeführt wird, als ob er vor der Tür seine Stimme hören lasse und anklopfte. Ja, er spricht auch selbst. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an: Da es den Eifer des Herrn anzeigt, wie er nicht bloß zum Scheine sondern mit Ernst sich mit den Seinigen zu vereinigen verlange....Außer diesem wird auch noch in der Hl. Schrift gelesen: anklopfen mit dem Hammer des Gesetzes; anklopfen mit dem Stabe des Evangelii; anklopfen mit der liebreichen Hand, welches uns alles Guten teilhaftig macht; anklopfen mit der Zuchtrute.“ Spr. 1 Und immer so fort. Der nächste Eintrag im Lexikon gilt dann dem Wort „Ankündigen“: aber darunter versteht der alte Zedler nur Kriegserklärungen. Das alles ist nicht fern von der heutigen Wirklichkeit. Schließlich gehören ökonomischen Ankündigungen zum Konkurrenzkampf. Aber kommen wir wieder zurück zur Textsorte namens Ankündigung. Zwar verbindet sie, wie man sieht, die unterschiedlichsten Lebenswelten und Medien. Daß es hier aber ein genuin literarisches Forschungsfeld gibt, hat vor vielen Jahren ein französischer Wissenschaftler plausibel gemacht, Gérard Genette. Sein Buch erschien 1987 unter dem Titel „Seuils“, zu deutsch „Schwellen“; aber die deutsche Ausgabe von 1989 hieß dann, nach dem wichtigsten Terminus dieser Theorie, „Paratexte“. Spr. 2 „Das Buch vom Beiwerk des Buches“ lautete der Untertitel; und gemeint waren damit all jene Aussagen, die einen Text umgeben wie eine Verpackung: also seine Ankündigung oder der Klappentext, der Titel, das Vorwort, die Fußnoten, das Nachwort, ja sogar spätere Interviews, Briefwechsel und so fort. Mit Paratexten erläutert der Autor oder sein Statthalter die eigentliche Absicht des Textes: Spr. 3 „Das hauptsächliche Anliegen des Paratextes, welche ästhetische Absicht auch immer hinzutreten mag, besteht nicht darin, im Umfeld des Textes hübsch zu wirken, sondern ihm ein Los zu sichern, das sich mit dem Vorhaben des Autors deckt. Zu diesem Zweck richtet er zwischen der idealen und relativ unwandelbaren Identität des Textes und der empirischen (soziohistorischen) Realität seines Publikums eine ... Art Schleuse ein, durch die sie auf gleicher Höhe bleiben können, oder, wenn man lieber will, eine Luftkammer, die dem Leser hilft, ohne allzu große Atemnot von einer Welt in die andere zu gelangen....“ Spr. 1 Mit dieser Beschreibung begründete Genette eine Theoriebildung, die erst in den letzten Jahren wirklich genutzt wurde. Erst 2004 gab es eine erste Tagung über den 7 Paratext in den verschiedenen Medien – mit dem Versuch, Klappentexte und Vorworte und Trailer vergleichend zu betrachten. Nicht zuletzt weil die Trailerkultur immer raffiniertere Bündnisse mit der Werbung eingeht, weil sie von dieser lernt wie auch umgekehrt, hat sich aber aus dem, was Genette noch „Schwelle“ nannte, längst eine eigenständige Gattung entwickelt. Ein „Format“, wie man heute sagen würde. Spr. 2 Erst in Jahre 2006 konnte ein ganzes Buch mit Klappentexten erscheinen, die der italienische Verleger Roberto Calasso im Verlauf von rund dreißig Jahren für den Adelphi Verlag selber geschrieben hat. Ein Stück Verlagsgeschichte und zugleich ein Lesebuch. „Briefe an einen unbekannten Leser“ nennt Calasso seine Texte, aber weil er ein Mann alter Schule ist, denkt er bei ihrer Abfassung noch nicht an die amerikanische „Promotion“, sondern eher an ein Gesellschaftsspiel aus dem Horizont von Jane Austens „Stolz und Vorurteil“: Spr. 3 „Eingesperrt in einen engen rhetorischen Käfig, der weniger faszinierend, aber ebenso streng ist wie der eines Sonetts, handelte es sich darum, einige wenige wirkungsvolle Worte zu sagen, so wie wenn man einem Freund einen Freund vorstellt und dabei die leichte Verlegenheit zu überwinden, zu der es bei jeder Vorstellung kommt, auch und vor allem unter Freunden. Und die Regeln der guten Erziehung zu beachten, die es verbieten, Fehler des vorgestellten Freundes zu erwähnen.“ Spr. 1 Alle Ankündigungen, so könnte man sagen, zielen auf die Vermittlung von Produkten und Projekten in unterschiedlichen medialen „Daseinsweisen in der Welt“. Jeder Werbemensch weiß, dass jede Kundengruppe in jedem Medium anders angesprochen werden muß. Im ökonomischen Idealfall verkehren sich freilich die Positionen ins Gegenteil. Nicht der Text, sondern seine Ankündigung bleibt unwandelbar: denken wir nur an die Trailer vom Tatort oder von James Bond Filmen, denken wir an die bleibenden Markenzeichen der alten Firmen. Wie alte Häuser unter Denkmalschutz werden sie innen völlig modernisiert und verwandelt, während draußen alles beim Alten bleibt. Spr. 2 Wandel hin oder her: Auch die bewegten Bilder oder Tonakkorde einer Ankündigung unterliegen der Zielform eines Textes. Sie alle spielen ja im Medium der Zeit und verweisen auf eine Zukunft. Alle Ankündigungen von Produkten sind somit Versprechungen. Etwas Zukünftiges wird hier versprochen; Angekündigtes soll sich einstellen, nachdem dies oder jenes gesagt, gespielt, gezeigt und schließlich freiwillig getan oder produziert wurde. Diese Freiwilligkeit unterscheidet das Versprechen von der schieren Prognose, die nur vorsagt, was zukünftig der Fall sein wird, die aber keinen freien Akteur benennt. „Frei“, also wahlfähig, nennen wir aber nur Handlungen von Menschen, nicht von Tieren - egal, was die neueste Neurologie dazu sagt. Und unter allen Figuren, welche die neuere Linguistik als „Sprechakt“ bezeichnet, ist das Versprechen die menschlichste. 8 Spr. 1 Kein Tier kann einem andern sagen: ich fresse dich nicht, auch wenn ich Hunger habe, und sich dann wirklich unter Schmerzen daran halten. Viel näher am Verhalten der Tiere ist das Gegenteil: das trügerische Versprechen, der Betrug über kommunikative Signale. Denken wir an die Spottdrossel, die alle möglichen Lieder von fremden Vögeln imitieren kann. Peter von Matt, der Literarhistoriker, hat eben ein eigenes Buch über die Kunst der Hinterlist verfasst und damit ein kapitales Vergleichsstück zwischen Mensch und Tier aufgegriffen. Spr. 2 Doch Menschen kommen nicht fertig zur Welt. „Das Tier, das versprechen darf, heranzüchten“ – so hat Nietzsche unser pädagogisches Hauptproblem beschrieben. Aber das ist eben nicht alles, die größere Arbeit wäre: wie erzieht man zum Einhalten von Versprechen? Doch wie dem auch sei - so gefährdet die Sache auch ist, die Ordnung des Handelns auf der Basis von Versprechen gilt mit Recht als unerhörte Errungenschaft sozialer Interaktion beim Menschen. Kein Wunder, daß sie von religiösen Konzepten umstellt ist. Werfen wir einen Blick auf die Tradition dieser abendländischen Sozialisierung! Spr. 1 Das Versprechen, der Eid, der Schwur, sie alle sind moralische Stammzellen von Verträgen, mit denen die Menschen ihr Zusammenleben seit Olims Zeiten regeln. Doch nur wenige Religionen haben sich auf das Schema von Versprechen und Einlösung als einer geschichtsmodellierenden Figur derart eingelassen wie die jüdisch-christliche Religion mit ihrer Idee, daß Gott mit den Menschen einen Vertrag geschlossen habe, oder sogar zwei Verträge: erst den alten Bund, dann, nachdem dieser mangelhaft schien, den neuen, auf der Basis des Menschenopfers, um mit dem Philosophen Girard zu sprechen. Spr. 2 So ist es kein Wunder, daß die Bibel von Ankündigungstexten nur so strotzt. Dicht unterhalb der Worte, die Gott selber in den Mund gelegt werden, rangieren die Propheten mit ihren unzähligen Prophezeiungen. Genau genommen sind Prophezeiungen keine Versprechen, weil sie ja nicht gebrochen werden können. Sie können nur falsch sein. Mit einer mythischen Instanz wie dem delphischen Orakel schloß man keine Verträge wie mit dem persönlichen und launischen Gott Israels. Das Besondere an der jüdischen Prophetie ist indessen diese Rückbindung an einen persönlichen Gott und an die Komposition der zwei biblischen Testamente, von denen das eine die Ankündigung des andern sein soll, obgleich doch beide auch einfach als Geschichtsbücher zu verstehen sind. Jedenfalls ist auch das Geschehen im Neuen Testament ganz beherrscht von allen möglichen uralten Ankündigungen und Versprechen und der immer wieder bezweifelten, dann aber mit aller Macht geglaubten Einlösung und Erlösung. Denken wir nur an die Anfänge des Neuen Testamentes, an die Ankündigungen der beiden überraschenden Geburten von Johannes und vor allem Jesus. Spr. 3 „Gegrüßet seist du, Holdselige! Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern! Da sie aber ihn sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebären, des 9 Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben.“ Spr. 1 Freudige Ankündigungen wie diese aus dem Lukas-Evangelium, die sich auf natürliche Abläufe in der Zeit beziehen, sind natürlich eher Vorhersagen als Angebote, die man auch ausschlagen könnte. Andererseits ist es vielleicht kein Zufall, daß diese fröhlichste aller frohen Botschaften erst einmal Naturgeschichte erzählen. So wirkt das Ganze plausibler. Daß dann beide Geburten, die des Johannes wie die des Jesuskindes biologisch eher unwahrscheinlich sind, diese Zumutung an den Zuhörer kommt dem Erzähler aber gleichfalls zupass; so wirkt, könnte er sich gesagt haben, die Geschichte wiederum um so wunderbarer. Schließlich sind Ankündigungen ja eine Zentraltechnik, ein Zaubertrick aller Erzähler, nicht nur der biblischen, auch wenn diese sich ihrer besonders gern bedient haben. Alle Erzählungen verlaufen ja in der Zeit wie die Sprache selbst, können also mit dem Rhythmus von Versprechen und Einlösung und der daraus bezogenen Spannung arbeiten. Die Erzähler schließen gleichsam einen Vertrag, einen Pakt mit dem Zuhörer. Freilich ist nicht jede literarische Ankündigung eine frohe Botschaft; man denke nur an die Rolle der Ankündigungen samt Einlösung in der griechischen Tragödie. Zu schweigen von den dramatisch negativen Prophezeiungen in der Bibel, die gleichfalls „der Fall“ werden, wie der Verrat des Judas oder das Leiden Christi. Spr. 2 Nicht in diesem negativen, wohl aber im dazugehörigen positiven Horizont stehen die ewig Frohen Botschaften der Warenwelt, die uns hier interessieren: die Ankündigung, das Versprechen einer Ware, die als wertvoll gelten soll. Ihre Geschichte wäre mindestens zweiteilig zu beschreiben, denn das Verfahren hat ja nicht nur ein textuelles, sondern auch ein beträchtliches, geradezu gierig visuelles Leben entfaltet. Denken wir nur an die Geschichte des Schaufensters. Auch im Schaufenster wird Ware angeboten und inszeniert, in der Hoffnung auf einen möglichst kleinen Zeitraum zwischen Angebot und Nachfrage, Wahrnehmung und Einkauf. Spr. 1 Diese visuelle Version der glänzenden Ankündigung bringt übrigens eine archaische, von der Wirtschaftswelt gern genutzte Dimension ins Spiel. Der Mann oder die Frau vor dem Schaufenster erblicken sich ja darin wie im Spiegel. Sie nutzen das Fenster zur Selbstbildgestaltung; richten sich die Frisur zurecht oder die Kleidung und arrangieren sich überhaupt bereits mit den sichtbaren Waren hinter der Scheibe. Ware im Schaufenster hat also einen narzisstischen Mehrwert. Auch der Mensch selber versteht sich in diesem Blick als Ware, sieht sich in eine Ausstellungs-Aura gehüllt, in einem Klappentext seiner selbst, in welchem er auftreten und empfangen werden will. Spr. 2 Denken wir noch einmal zweihundert Jahre zurück, an den Auftritt in Jane Austens Roman „Stolz und Vorurteil“, wo der Besucher mit mehrfachem Klopfen eingeführt wird! In diesem Gesellschaftsspiel geht es um eine andere Ankündigung von Menschen als jene durch Engel oder Teufel der Heils- oder Unheilsgeschichte. Sie ist identisch mit dem, was man noch heute einen „Auftritt “ nennt. Nicht jede Ankündigung ist ein Auftritt, aber jeder Auftritt ist eine Ankündigung, auf der Bühne wie in Wirklichkeit. Eine Person erscheint und wird taxiert. Kennt man den Namen? Ist sie schön? Hat sie Geld und Geschmack? Kann sie reden und zuhören? Hat sie 10 Beziehungen, gute Familie und Grundbesitz? Oder von alldem das Gegenteil? Dies alles wird von den Zuschauern abgefragt und erforscht, aber das erste, was jeder sieht, ist die ankündigende Außenhaut, die körperliche und modische Verpackung dieser Person, die gleichsam als Trailer ihrer selbst funktioniert. Sie, die Person, soll auf den ersten Blick zu erfassen sein, ganz wie ein bewegtes Bild. Selbst was man nicht sieht, was aber ganz entscheidend zur Wertigkeit der Person gezählt wird, wird seit dem Aufstieg der Werbung als Bild verstanden, nämlich als ein sogenanntes „Image“. Spr. 3 „Image ist ein in Termini sozial anerkannter Eigenschaften umschriebenes Selbstbild, aber ein Bild, das die andern übernehmen können.“ Spr. 2 So definiert der Soziologe Erving Goffman das innere Bild eines Menschen, mit dem dieser in der taxierenden Öffentlichkeit möglichst schon auf den ersten Blick wertvoll erscheinen möchte. Goffman meint sogar: Spr. 3 “Das Image eines Menschen ist etwas Heiliges und die zu seiner Erhaltung erforderliche expressive Ordnung deswegen etwas Rituelles.“ Spr. 1 Diese rituelle Praxis ist natürlich viel älter ist als das Image eines Einzelnen in einer Gesellschaft von lauter anderen Einzelnen. Sie gehört vielmehr zu einer Familiengesellschaft mit einer Art aristokratischem Jingle, einem eigenen Bildtypus, nämlich dem Wappen, einem bildlichen Wahlspruch des Handelns. Schon die alten Familienwappen umgeben den jeweiligen Träger mit Symbolen von sozial anerkannten Eigenschaften wie Mut oder Redlichkeit oder Frömmigkeit, die ihn als einen so oder so Handelnden ankündigen. Ludwig XIV., der französische Prachtkönig, wurde in der Devisenkunst seiner Zeit unendlich oft als aufgehende oder strahlende Sonne gezeichnet; wo er auftrat, wurde es gleichsam nach Gottes Wort „Licht“. Die Sonne war sein Markenzeichen. Spr. 2 Kaum anders operiert die Schöne Neue Welt des marketing heutzutage. Wäre nicht unsere Geschäftswelt verdeckt bis offen kriegerisch, würde sie nicht Menschen einzeln oder in Massen nach operativen Erwägungen aus- oder einsetzen, also immer wieder im Stich lassen, könnte man meinen, die großen Firmen von heute ersetzten die großen Familien. Nicht selten löst sich die eine Figuration in die andere auf und operiert dann mit dem Familiennamen, wie etwa die Rotschilds. Jedenfalls sind die Firmen inzwischen globalisiert wie alte Familien, werben um Kunden wie um Verwandte, und arbeiten fieberhaft am Erhalt eigener Wappen: dem sogenannten „Logo“ oder auch „Brand“, mit dem sie sich ankündigen – von der Haustür über das Briefpapier bis zum Werbefilm. Spr. 1 Was ist ein „Brand“? In seinem amüsanten Buch über englische Neubildungen hat der Wortdetektiv Paul McFedries „Brand“ aus dem Germanischen hergeleitet; angeblich war damit ursprünglich eine Holzfackel gemeint, dann aber auch das ins Fleisch der Tiere eingebrannte Besitzerzeichen. Später wurden daraus die bekannten 11 Stigmata für outlaws, wiederum später aber auch Warenmarkierungen wie etwa die „Punzen“ für Porzellan, Metall und ähnliches. Amerikanische Firmen kamen auf die Idee, diese Namen mit atmosphärischer Qualität aufzuladen, wie „Campbell“ - Andy Warhols Büchsensuppe - oder im 20. Jahrhundert „Camel“, wo schon der Name selbst atmosphärisch wirkt und das dazugehörige Tier wie ein Wappentier. Spr. 2 In einer Konsumwelt lebt längst nicht mehr nur, wer Markenartikel für primäre Bedürfnisse einkauft. Ebenso einschneidend und geheimnisvoll sind die Ankündigungs-Rituale im Bildungs- und Informationssektor. Seit geraumer Zeit gibt es in den USA das sogenannte „Mission Statement“, eine Art metaphysischer Ankündigung. Auf deutsch würde man vielleicht sagen: eine „Projektbeschreibung“, aber dann hätte man den missionarischen Sinn ebenso unterschlagen wie den institutionellen Hintergrund. Dabei könnte kaum etwas besser die These von den religiösen Wurzeln des Kapitalismus bestätigen als dieser Kult der jeweiligen Unternehmensmission, zu deutsch vielleicht „Berufung“ oder auch „Sendung“. Spr. 1 Aus Ankündigung wird hier nämlich Verkündigung. Da alle irgendwie agierenden Organisationen entweder von Spenden oder von zahlenden Kunden abhängig sind, müssen sie ihre Existenz nach Firmenart rechtfertigen und ihre Mission verkünden. Für werdende Unternehmer gibt es eigene Kurse dafür. Es ist eine Erbschaft aus dem Kampf um Political Correctness – aber höchst charakteristisch assoziiert mit Aspekten des strategischen Denkens. So etwa heißt es im Internet: Spr. 3 „Ein Mission Statement sollte eine klare und deutliche Vorstellung vom Daseinsgrund des Unternehmens liefern. Es sollte sozial sinnvolle und messbare Kriterien enthalten, in Auskünften über die moralisch-ethische Position der Firma, ihr öffentliches Image, ihre Zielgruppe, ihre Produkte und Dienstleistungen, ihren geographischen Geltungsbereich sowie die Erwartungen an Wachstum und Ertrag. Die Absichtserklärung eines Mission Statements sollte jedem Unternehmer als erstes am Herzen liegen, der eine strategische Entscheidung zu treffen hat. Das Statement kann von einer ganz einfachen bis zu einer sehr komplexen Verbindung von Ideen reichen.“ Spr. 2 Damit auch der geringste Mitarbeiter auf die Sendung des Unternehmens unverzüglich eingeschworen werden kann, und damit er die Grundsätze bei keinem Verkaufsgespräch vergisst, wird die Ideologie schließlich auf wenige Sätze eingedampft. So etwa gehören zum Sendungsbewusstsein bei Walt Disney die Devisen: Spr. 3 „Keinen Zynismus - Förderung und Verbreitung von gesunden amerikanischen Werten - Kreativität, Träume und Imagination - Äußerste Konsistenz der Geschichte und Sinn fürs Detail - Bewahrung und Kontrolle des ‚Disney-Zaubers“. Spr. 1 Was immer man unter dem Disney-Zauber versteht! Mit Mission statements als Image-Beschreibung schmücken sich in den USA auch die Universitäten, die um reiche Studenten konkurrieren. Denn reiche Studenten zahlen nicht nur hohe 12 Studiengebühren sondern werden später auch spendable Ehemalige, die mit Fleiß Geld geben, um dereinst ihren Namen samt der gespendeten Summe auf einer der Mauern oder Sitzbänke ihrer alten Universität lesen zu können. Hören wir die ersten Sätze des „Mission Statement“ der Harvard University von 1997: Spr. 3 „Das College ermuntert die Studenten, die freie Meinungsäußerung zu respektieren, sich innovatives und kritisches Denken zueigen zu machen, sich im Geist produktiver Kooperation zu qualifizieren und Verantwortung für die Folgen des eigenen Tuns zu übernehmen. Harvard will den Studenten volle Teilnahme ermöglichen, jeder Einzelne soll seine Fähigkeiten und Interessen erkennen und sein ganzes intellektuelles wie humanes Potential entwickeln.“ Spr. 2 Das sind Formulierungen aus dem Geist der „Political Correctness“, die sich juristisch einklagen lassen, wie etwa in den vielen Fällen von „sexual harrassment“, die es seither gegeben hat. Dennoch ist es auch eine ökonomische Absichtserklärung wie das zitierte Statement der Disney Corporation, man könnte auch sagen: sprachliche Tugendbasis einer akademischen Marke namens „Harvard.“ Spr. 1 Mission statements erzielen ihre größte Wirkung im Internet, also dort, wo der Weltkunde zuerst nachsieht, wenn er sich für etwas interessiert. Und hier steht nun das gesprochene Wort buchstäblich im Schaufenster. Jedes Mission statement ist auf der Unternehmens-homepage angesiedelt und soll von dort aus verbreitet werden; jede homepage verkörpert den „Auftritt“ der Firma, nicht anders als der eintretende Gast auf dem Ball oder der Party bei der sogenannt guten Gesellschaft. Spr. 2 Wie gerade diese altmodische Szene von der Warenwelt einverleibt wird, hat die Kunsttheoretikerin Isabelle Graw eindrucksvoll nachgezeichnet. Auch und gerade die Künstler müssen ja mit Images operieren und werden von ihren Agenten und Zwischenhändlern, von Museen, Galerien und Kunstmessen als lebende Ware oder Produzenten einer solchen gehandelt. Graw hat beobachtet, daß neuerdings Kunstmessen wie die Londoner „Frieze“ oder die „Art Miami Basel“ mit glamourösen Eröffnungspartys weniger die Kunst- als vielmehr die Modewelt anziehen. Kunstwerke werden hier noch nicht einmal auf der Ebene der Beschreibung gewürdigt, vielmehr feiert die Szene sich selbst in Form des gesellschaftlichen Auftritts. Das könne man bedauern oder auch nicht, meint Graw, aber: Spr. 3 „In Wahrheit sind diese Party- und Eröffnungsberichte ein Vorschein der Zukunft. Gegenüber kulturpessimistischen Lamenti haben sie den unbedingten Vorzug, daß sie Auskunft über die Rolle und Funktion geben, welche die Kunst in einer spektakulären Phase des Kapitalismus spielt. Bezeichnend ist etwa, daß die Kunst hier in Form von Künstlernamen auftritt, die wie Markennamen fallen, als sprächen sie für sich.“ Spr. 1 Jeder Künstlername ein „Brand“, jeder Künstler ein Unternehmen, und als so wird auch der Künstler im Internet präsentiert, um nicht zu sagen positioniert. Auch für 13 diese elektronischen Auftritte gibt es natürlich längst eigene Kurse und Programmiersprachen. Die erfolgreichste stammt aus Israel, heißt „Zend“ und wird mittlerweile von 22 Millionen homepages benutzt. Ihre Spezialität ist der sogenannte dynamische Auftritt, das heißt, die homepage baut sich erst vor den Augen des Betrachters auf, so daß dieser, auf der Jagd nach Bedeutung, länger gefesselt bleibt und sich die Firma besser einprägt. Spr. 2 Glaubt man den Nachrichten in der Zeitung, so hat die Internet-Werbung im letzten Jahr um mehr als vierzig Prozent zugenommen. Das liegt zum einen an der Vermehrung der Netzteilnehmer, zum andern aber auch an der Umbuchung von Werbebudgets auf die sowohl visuelle wie interaktive Welt des Bildschirms. Was man hier sieht, kann man eben sofort bestellen, im Unterschied zur Werbung aus Fernsehen oder Zeitung. Interessant ist, daß die Werbung im Internet dennoch mehr den „Brands“ und Marken gilt als den einzelnen Produkten. Der Käufer soll mit der Firma familiär werden – so wie diese, nach dem berühmten Witz von Heinrich Heine, „famillionär“. Strategien wie diese sind angesagt. In einer neueren Studie über die Wahrnehmung von Internetauftritten hat sich herausgestellt, daß deren Betrachter schon nach 50 Millisekunden ein Urteil gefällt haben – und dieses Urteil behalten sie auch nach längerem Nachdenken und Hinsehen. Nicht anders verfahren wir täglich im Umgang mit andern Menschen. Spr. 1 In der Geschichte hat sich für diese archaische Reaktion eine eigene Disziplin entwickelt, die sogenannte Physiognomik, die es nicht nur schon bei den alten Griechen, sondern in allen Kulturen gibt. Ihr Begründer in der neueren europäischen Geschichte war ein Pfarrer, also ausgerechnet ein Spezialist für die biblischen Ankündigungen. Ein Zufall? Johann Kaspar Lavater sammelte jedenfalls lebenslang Beispiele von Menschen und Menschendarstellungen in der Kunst, um zu beweisen, daß der physische Auftritt dem Menschenkenner alles Nötige und dies auch blitzschnell verrät. Spr. 3 „Warum gefallen uns gewisse Leute beim ersten Anblick – und immer mehr, je mehr wir sie ansehen? – Warum streben wir von gewissen Leuten auf den ersten Anblick zurück – und immer mehr, je mehr wir sie ansehen? Warum gefallen oder mißfallen uns gewisse Leute auf zehn Schritte, und nicht auf vier? Alles – um der Physiognomie willen...“ Spr. 2 ... schrieb der Pfarrer im Jahr 1775 und im Laufe der Zeit wurde er immer kühner mit seinen Vergleichen und immer ökonomischer, auch wenn er nie davon abließ, den Menschen als Gottes Ebenbild vorzustellen. Schließlich dachte er sich Personen sogar als Münzen, die der Käufer im 18. Jahrhundert doch ebenfalls täglich auf ihren Metallwert hin taxieren müsse: Spr. 3 „Beurteilt er sie anders, als nach ihrer Farbe? Ihrer Feinheit? Ihrer Oberfläche? Ihrer Äußerlichkeit? Ihrer Physiognomie? ... Warum nimmt er das eine Goldstück an, wirft 14 das andere weg? Warum wiegt er das dritte auf der Hand? Um seiner bleichern oder rötern Farbe, seines Gepräges, seiner Äußerlichkeit, seiner Physiognomie willen?" Spr. 2 Dieser Münzvergleich ist wahrhaft erschreckend modern und scharfsinnig. Er erkennt das Problem der Bewertung von Menschen – und degradiert diese zugleich zur Ware. Nicht als ob Lavater selber auch nur den Schatten von sozialem Zynismus an den Tag gelegt hätte. Im Gegenteil. Seine bisher noch unveröffentlichten abertausend Briefe zeigen ihn als unermüdlichen Seelsorger und Freund. Um so erstaunlicher ist dieser Satz. Man kann ihn sich nur erklären, wenn man den wissenschaftlichen Eifer des Physiognomikers bedenkt, seine lebenslange Ambition, aus der Physiognomik eine Naturwissenschaft zu machen, die Menschengestalt als etwas von Gott geschaffenes, aber doch zähl- und meßbares zu outen. Vielleicht hatte Gott doch ein besseres Verhältnis zur Zahl als zum Wort? Spr. 1 Ein ketzerischer Gedanke. Scharfsinnig ist der Münzvergleich jedenfalls, weil er das ganze biologische Problem überspringen will. Wer den Menschen als physiognomischen Trailer eines Charakters versteht, das heißt, seiner zukünftigen und zu erwartenden Handlungen und Reden, bezieht sich ja eigentlich auf den nackten Körper oder doch wenigstens auf nackte Körperteile wie das Gesicht oder die Hände. Nackte Körper haben aber nur Menschen, schließlich sind wir, nach einem Wort von Günter Anders, doch „pelzlos zum Ekel der Tiere.“ Spr. 2 Daher kann physiognomische Wahrnehmung als animalische Erbschaft gelten, die uns schnell irreführt. Denn Menschen sind Sprach- und Vertrags-, Gedächtnis- und Kultur-Geschöpfe. Fast alle Aufklärer haben Lavater deshalb widersprochen. Und noch 150 Jahre nach Lavater sah sich der Anthropologe Rudolf Bilz gezwungen, zu konstatieren: Spr.3 „Was wir als Blitz-Diagnostik bezeichnen, nämlich die Menschenkenntnis auf den ersten Blick, ist in unseren instinktiven Bereichen fundiert. Wir geben zu, daß es dabei grobe Fehldiagnosen geben kann, und zwar nicht nur deshalb, weil es bewußte Tarnung auf Seiten des Neuankömmlings gibt, wenn uns dieser entgegentritt, sondern auch insofern, als alte Reminiszenzen determinierend mit im Spiele sein können.“ Spr. 1 Rudolf Bilz sagt es nicht, aber Peter von Matt hat es ausgiebig besprochen: Wer auf biologische Ankündigungen reagieren will, gerät schnell in die Kampfzone des Betrugs und bedarf einer Kunst der Entlarvung. Anders gesagt: Unvermittelt befindet man sich in der Welt der Jäger, die jede Spur in der offenen Wildbahn als Ankündigung, als Information benutzen, wenn auch natürlich nicht als Versprechen oder gar als Vertrag. Mit großem Recht hat daher der Kulturhistoriker Carlo Ginzburg die ganze Physiognomik als eine Kunst der Jäger und Fallensteller erklärt, die sorgfältig erlernt werden müsse, auch wenn sie nicht kodifiziert wurde: Spr. 3 „Die Fähigkeiten, ein gebrechliches Pferd am Fersengelenk, ein kommendes Gewitter durch eine plötzliche Veränderung des Windes oder eine feindselige Absicht in der 15 Verfinsterung der Gesichtszüge zu erkennen... gründeten sich auf scharfsinnige Beobachtungen, die natürlich nicht formalisierbar und oft nicht einmal in Worte übersetzbar waren; sie konstituierten ein teils einheitliches, teils zerstreutes Bildungsgut von Männern und Frauen aller sozialen Klassen. Eine subtile Verwandtschaft vereinte sie; alle entstanden aus der Erfahrung, aus der Konkretheit der Erfahrung. Darin bestand die Stärke dieses Typs von Wissen; und seine Schwäche bestand in der Unfähigkeit, sich der mächtigen und schrecklichen Waffen der Abstraktion zu bedienen.“ Spr. 2 Die Geschichte der schrecklichen Abstraktionen haben wir seit Lavater erlebt und erlitten. Physiognomische Menschentaxierung wurde eine naturwissenschaftliche Erfolgsstory; nicht nur in der Medizin, wo sie ja schon längst und mit Recht geübt wurde, sondern in der Kriminalistik. Daß die Gestalt oder das Gesicht eines Kindes womöglich schon den späteren Mörder in ihm ankündigen könne, dieser Glaube an die Bedeutung des Körpers als mission statement der Seele, hat sich bis zur Verteufelung jüdischer Gesichter im letzten Jahrhundert dämonisch durchgesetzt. Spr. 1 Und was haben wir dagegen unternommen? Gewiß, eine Weile lang gab es nach 1945 Hemmungen, sich auf physiognomische Fragen einzulassen, jedenfalls in Deutschland. In den USA hingegen bewiesen schon bald wieder Experimente die Macht dieser Medien, vor allem der visuellen. Nur das schöne Gesicht, nur die herrliche Gestalt sind erfolgreiche Paratexte zu einem wirklich werthaltigen Text, das heißt zu einem moralisch guten Charakter und einem gesunden, fruchtbaren Körper. Eine Devise der antiken Ästhetik, die sich das 19. und das 20. und noch mehr unser eigenes, das 21. Jahrhundert, zueigen gemacht haben. Spr. 2 Dabei ergab sich aber ein merkwürdiges Paradox. Denn glaubt man den Medienpraktikern, so ist das Herzstück aller medialen Information nicht etwa die Frohe Botschaft, sondern im Gegenteil die Idee der schlechten Nachricht. Schlechte Nachrichten rütteln uns wach bis zur Panik, halten Aufmerksamkeit in Gang, werden besser memoriert und synchronisieren die soziale Lebenswelt. Sie klagen das Prinzip „Vorsorge“ ein, sie verlangen unmittelbare Maßnahmen. Aber wie verträgt sich das mit der Metaphysik unserer Frohen Botschaft? Mit den Evangelien der Aufklärung, mit all den Versprechen auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die unser demokratisches Lebens-, ja unser Geschichtsgefühl doch jahrhundertlang grundiert haben? Wie verträgt es sich mit der wachsenden Wirtschaftswelt froher und frohester Botschaften? Spr. 1 Niemand hat das Duell zwischen den beiden Sprechakten – der stets guten Verheißung und den schlechten Nachrichten – deutlicher konturiert als Peter Sloterdijk in einer seiner Reden aus dem Jahr 1993. Die informationelle Entwicklung der Weltverhältnisse, meinte Sloterdijk in einer seiner charakteristischen Wortschöpfungsspiele, zwinge uns dazu: Spr. 3 „...unsere Weltverhältnisse im ganzen vom eu-angelischen Prinzip auf das dysangelische Prinzip umzustellen – wobei unter eu-angelisch, im Sinne der griechischen Wortwurzeln, die Annahme verstanden werden soll, daß es möglich sei, 16 Welt und Weltsinn unter dem Eindruck guter und besserer Nachrichten zu reformieren, während dysangelisch die Unterwerfung der kommunizierenden Gattung unter das Gesetz schlechter Nachrichten bedeutet ... Das Realitätsprinzip des zeitgenössischen Informationsuniversums steht in der Tat unter dem Primat der besorgniserregenden Nachricht.“ Spr. 2 Tut es das wirklich noch heute, im Jahr 2006? Neoliberale Auguren meinen „nein“. Wie schon in den 1970er Jahren erkannt, tendiert die Sozialtechnik von Angebot und Nachfrage dazu, alle schlechten Nachrichten ebenso wie alle Kritik an ihr aufzusaugen und in ergiebigen Handel zu verwandeln. Sloterdijk sprach von der „gattungswirksamen informatorischen Glücksspirale“, die sich einstellen müsse, und das war 1993 verständlich, weil unter dem Eindruck vom Ende des Kalten Krieges gesagt. Freilich noch ohne den 11. September zu ahnen, und ohne zu wissen, welche Rolle das Internet einmal spielen würden. Spr. 3 „Die Modernisierung will ihrem Grundzug nach ein Glückskreislauf sein, ein circulus virtuosos, in dem aus Gekonntem weiteres Können, aus Gelungenem mehr Gelingen, aus Reichtum weitere Bereicherung entspringt. Die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung eines solchen Systems in seinem Nachrichtenwesen ist darum von sich selbst her eine Informatik des Gelingens.“ Spr. 1 So könnte man es tatsächlich heute sehen – in Zeiten, da das Internet den Typus der „eu-angelischen Botschaft“, der verheißungsvollen Werbung, vollständig an sich zieht, in ökonomischer, sozialer und physischer Hinsicht. In diesem interaktiven Medium lässt sich selbst noch die übelste Nachricht als Ware handeln, einfach weil man Anzeigen dazu schalten kann; hier ergibt sich ein ankündigungsübersättigtes, unendliches Feld von Kontaktaufnahmen; und schließlich treten hier Nutzer mit steigender Häufigkeit ein in das Feld der Spiele. Hier können die jugendlichen User – wie schon im Netz überhaupt – sogar die Last der Identität abwerfen, können moralisch wie physisch schwerelos werden, machtvoll und böse. Spr. 2 Was wird dabei, was kann dabei aus dem Prinzip kritischer Information werden? Wird es nicht aufgelöst unter dem Ansturm der übermächtigen Frohen Botschaft namens Werbung? Die Krise des Journalismus, die Krise der Kritik, die Krise der Medien und nicht zuletzt die Krise der Bilder in diesen Medien sind Tagesgespräch. Doch im Moment scheint es zugleich, als biete die kapitalistische Riesenmaschine auch ihr eigenes Heilmittel an. Seit geraumer Zeit wuchern im Netz die sogenannten „weblogs“: ein gigantischer Journalismus „von unten“; Tagebücher von einzelnen Menschen, von Beobachtern des Weltgeschehens, Kritiker von Projekten, selbstbewußten Verbrauchern und natürlich immer auch Selbstdarstellern. Die Nutzer des Internet als informationelle und immer kritischere Instanz – etwas Besseres könnte uns eigentlich nicht passieren. Nur die Zeit, um das alles zu lesen, haben wir nicht. Und ob die Medien als Institution den Ansturm von unten überhaupt aushalten, wissen wir nicht.