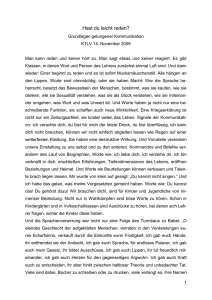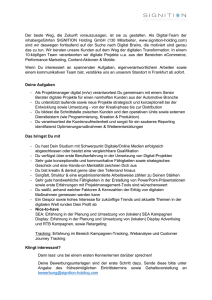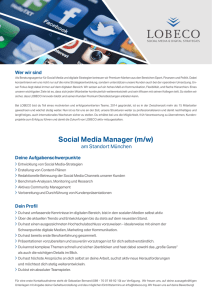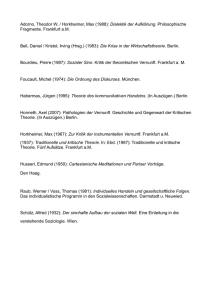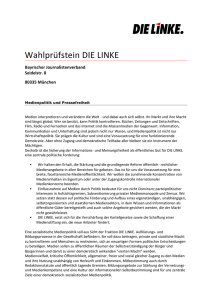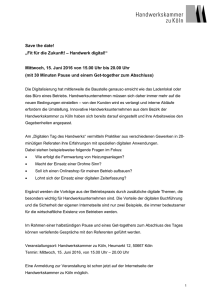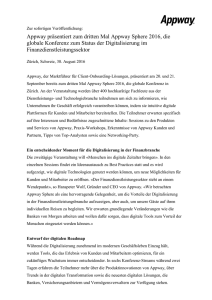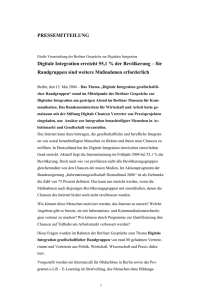Hochgeladen von
strelojo
Medienkompetenz im digitalen Zeitalter: Orientierungswissen

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE Wie können sich Menschen in der Welt der digitalen Medien orientieren? – Warum wir Medienkompetenz als Orientierungswissen vermitteln sollten. Name: Josias Strelow Matrikelnummer: 603084 E-Mailadresse: [email protected] Telefonnummer: 0176 729 136 34 Studiengang: B.A. Philosophie /Ethik Modul: 9b Schwerpunkt Praktische Philosophie Lehrveranstaltung: Digitalisierung und Ethik Semester: Sommersemester 2023 Dozent/in: Prof. Dr. Dr. h. c. Julian Nida-Rümelin und Dorothea Winter Abgabedatum: 29.03.24 Zeichen: 30700 Einleitung – Medienkompetenz und Orientierung Der Begriff der Medienkompetenz erfuhr durch Dieter Baacke im Laufe der 1970er bis 1990er Jahre eine Systematisierung, die ein scheinbar erstmaliges Aufleben der Diskussionen und pädagogisch-philosophischen Analysen des Begriffs einläutete. Obgleich die Medienkompetenz vor dem Kommunikationszeitalter in pädagogischen und philosophischen Auseinandersetzungen z. B. in Form von isolierter Medienkritik oder Diskussionen zur Nutzung von Massenmedien auftrat, gewinnt der Begriff durch die „digitale Revolution“ angeführt durch die Massenadaption des Internets und die Systematisierung der neunziger Jahre an höherer Relevanz für Forschung, Praxis und Lebensalltag. Wie die technologische Entwicklung der Medienlandschaft und die ökonomische Verflechtung der neuen digitalen Medien mit der Weltwirtschaft voranschritt, so wurde ebenfalls der Begriff der Medienkompetenz bzw. wurde das grundlegende Modell nach Dieter Baacke weiterentwickelt. Die Herausforderungen des Web 2.0s, mit unter anderem der Ausbreitung von Social-MediaPlattformen und vor allem technologischen Entwicklungen auf der Ebene der künstlichen Intelligenz, werden auch weitere Anpassungen der Konzepte und Modelle, die sich um die Medienkompetenz drehen, benötigen. In einer Zeit, in der algorithmische Desinformation die Grenzen zwischen Wahrheit und Unwahrheit verschwimmen und künstliche Intelligenzen visuelle und auditive Trugbilder entstehen lassen, erlebt die Frage; „Was machen die Medien mit den Menschen?“, eine Renaissance und mündet in die Frage: „Wie können sich Menschen in der Welt digitalen Medien orientieren?“ Die vorliegende Arbeit versucht, die Dimensionen der Medienkompetenz nach Baacke auf orientierungsschaffende Elemente in der digitalisierten Welt zu untersuchen. Dabei werden die Begriffe der Medienkompetenz und des Orientierungswissens inhaltlich analysiert und argumentativ miteinander verbunden. Es werden untergeordnete Fragen thematisiert, die zum einen die Notwendigkeit von Orientierungswissen für Orientierung und zum anderen den Zusammenhang zwischen praktischer Vernunft, Orientierungswissen und Medienkompetenz beleuchten. Meine Bemühungen innerhalb dieser Arbeit zielen darauf ab, argumentativ zu verdeutlichen, dass es Dimensionen in Baackes Modell gibt, die am besten dazu geeignet sind, um Individuen 2 Orientierung in ihrer digitalen Lebenswelt zu verschaffen. Zusätzlich werde ich argumentieren, dass im Zusammenspiel aus Verfügungswissen und Orientierungswissen zweiteres die höchste Relevanz für den Umgang mit digitalen Medien besitzt. Theoretische Grundlagen und strukturelle Argumentation Der folgende Abschnitt soll den theoretischen Rahmen der Schrift bilden. Hierbei wird das Modell der Medienkompetenz nach Dieter Baacke und der digitalen Bildung analysierend dargestellt, sowie verglichen und im Folgenden werden die Begriffe des Orientierungswissens und Verfügungswissens voneinander abgegrenzt. Eine Betrachtung des Orientierungsbegriffs wird anschließend die Argumentation einleiten. Medienkompetenz und Medienbildung Das sog. Bielefelder Medienkompetenzmodell nach Dieter Baacke teilt den Betrachtungsgegenstand in vier Dimensionen ein, die in mehrere Unterdimensionen unterteilt sind.1 Die erste Dimension der Medienkritik enthält die analytische und die reflexive Unterdimension, welche zusammen das ethische Betroffensein umfassen. Der analytische Aspekt der Medienkritik beschreibt ein Wissen über mediale-gesellschaftliche Prozesse, wie z.B., dass fast alle Social-Media-Plattformen ihre Gewinne durch personalisierte Werbung erzielen, was zu einer Ökonomisierung des Nutzers führt. Daraus folgend sollte das Individuum das analytische Wissen mit anderen Wissensformen verbinden und daraus auf der subjektiven Ebene Schlüsse für das eigene Handeln ziehen können. Auf die Ausbildung dieser Fähigkeit zielt die reflexive Unterdimension ab. Durch den beschriebenen Erkenntnis- und Verarbeitungsprozess kann das Individuum ein ethisches Bewusstsein entwickeln, welches wiederum im Kontext sozialer Verantwortung auf das analytische Wissen und den reflexiven Rückbezug rückkoppelt und diese definiert.2 Medienkunde stellt die zweite Dimension dar und unterteilt sich in die informative und die instrumentell-qualifikatorische Unterdimension. Sie beschreiben klassisches Fakten- und Methodenwissen3, welche ich im Folgenden als 1 Vgl. Baacke (2001): Medienkompetenz als pädagogisches Konzept. In: Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) (Hrsg.): Medienkompetenz in Theorie und Praxis. Broschüre im Rahmen des Projekts „Mediageneration – kompetent in die Medienzukunft (gefördert durch das BMFSFJ), S. 6-8. Abrufbar unter: https://dieter-baacke-preis.de/ueber-den-preis/was-ist-medienkompetenz/ [Stand:08.03.2024]. 2 Vgl. Ebd, Abschnitt Medienkritik 3 Vgl. Ebd. Abschnitt Medienkunde 3 Verfügungswissen betiteln werde. Wie weiter unten ausgeführt wird, verliert diese Dimension im Kontext der technologischen Entwicklung und der Verflechtung des Digitalen mit der Lebenswelt junger Menschen immer weiter an Bedeutung. Bei der Dimension der Mediennutzung wird in rezeptiv-anwendende und interaktiv-anwendende Unterdimensionen unterschieden. Ersteres stellt die passive Nutzung von Medien, wie einen Film auf Netflix schauen oder Tweets auf Twitter lesen, dar. Zweiteres entspricht einer aktiven Nutzung von Medien, wie das Absetzen eines Tweets oder das Kommentieren eines YouTube-Videos. 4 Die letzte Dimension ist die der Mediengestaltung, welche in eine innovative und eine kreative Unterdimension unterteilt ist. Dabei zielen beide Unterdimensionen auf die Weiterentwicklung von vorhandenen Medienstrukturen ab. Zum einen werden Mediensysteme innovativ von partizipierenden Individuen in Aspekten wie Benutzeroberflächen und effizienteren Übertragungstechnologien weiterentwickelt und zum anderen führt eine kreative aktive Partizipation zu einer Entwicklung der Möglichkeiten über die bestehenden Grenzen und übliche Kommunikationsmuster hinaus.5 Beispielsweise setzte Apple mit der Einführung ihres Betriebssystems für Smartphones neue Maßstäbe im Punkto Benutzerfreundlichkeit. Des Weiteren revolutionierte die Ausweitung von Videostreaming, als Teil der Unterhaltungsbranche hin zum Videostreaming als Kommunikationsmethode, das Arbeitsleben von Millionen von Menschen weltweit. Alle vier Dimensionen tragen dazu bei, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebaut werden, die eingesetzt werden können, um Probleme im Zusammenhang mit Medien zu lösen. Durch die rasante technologische Entwicklung in den letzten 30 Jahren sind Medien, die ohne binäre Verarbeitungsprozesse auskommen oder ohne auf dem Binärsystem basierende Darstellungsprozesse übermittelt werden, die Ausnahme geworden. Dementsprechend ist ein Großteil der Medienlandschaft den digitalen Medien zuzuordnen.6 Resultierend daraus würde ein zentraler Teil der Vermittlung von den Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Medienkompetenz bilden, der digitalen Bildung zuzuordnen sein. Digitale Bildung wird im Folgenden aufgefasst als: „Ein kontinuierlicher Prozess, der Menschen befähigt, ihr Leben und 4 Vgl. Ebd., Abschnitt Mediennutzung. Vgl. Ebd., Abschnitt Mediengestaltung. 6 Für eine genauere Einstufung betrachte die Definition von digitalen Medien nach dem Bpd.: Bundeszentrale für politische Bildung. (2021) Digitale Medien/Neue Medien. Abrufbar: https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/medienpolitik/500666/digitale-medien-neue-medien/. [Stand: 08.03.2024]. 5 4 Lernen in einer digitalisierten Welt aktiv zu gestalten.“ Dabei geht es nicht mehr um den Erwerb von Faktenwissen – viel bedeutender wird die Kompetenz, sich Wissen selbstorganisiert anzueignen, es anzuwenden und kreative Lösungen für Problemstellungen eigenständig entwickeln zu können.“7 Betrachtet man das Medienkompetenzmodell als Teil der Beschreibung der Kompetenzen, die durch digitale Bildung erlangt werden sollen, verdeutlicht sich der Anspruch des Modells: Die erlangten Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen das Individuum bemächtigen die eigene digitale Lebenswelt aktiv und selbstgesteuert zu gestalten. Tragend dabei, Baackes Anspruch folgend, dass Werturteile grundlegend mit dem Umgang mit Medien sind, ist eine adäquate ethischreflexive Rückkopplung mit sich selbst, die eine wertorientierte Bewertung und damit eine verantwortungsvolle Partizipation und Gestaltung an und von Medien ermöglicht. Wie im Verlauf argumentiert wird, kann das Individuum ohne vor allem die in der ersten Dimension beschriebenen Fähigkeiten und Fertigkeiten keine Deliberation vollziehen und damit innerhalb dessen Entscheidungen keine Kohärenz, in Bezug auf das eigene medienausgerichtete Handeln, erzeugen. Orientierung, Orientierungswissen und Verfügungswissen Zentral für die weitere Analyse wird der Begriff des Orientierungswissens bzw. der Orientierung sein. Der anschließende Abschnitt soll den komplexen Begriff der Orientierung erläutern und in Verbindung mit praktischer Vernunft setzen. Dazu wird eine Abgrenzung zum Begriff des Verfügungswissens vorgenommen und eine kurze Betrachtung ausgewählter orientierungsverschaffenden Einzelkompetenzen praktischer Vernunft vollzogen. Um sich dem Begriff der Orientierung zu nähern, ist eine intuitive Betrachtung des Begriffs sinnvoll. Spricht man im Allgemeinen von Orientierung, so meint man die mentale Fähigkeit, sich im Raum, in der Zeit und im Bewusstsein seiner eigenen Identität zurechtzufinden. Auf Basis von Informationen und ihrer Verarbeitung, Kontextualisierung und auch ethischer Bewertung erlangen Individuen für spezifische gesellschaftliche, soziale und strukturelle Konstellationen die Fähigkeiten, um sich in ihnen zu orientieren. Dementsprechend muss es Wissen geben, welches diese Fertigkeiten und Fähigkeiten 7 Netzwerk digitale Bildung (2016). Zwischen analog und digital. Lernen und Lehren an Schulen und Hochschulen. Abrufbar: https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/wpcontent/uploads/2020/12/NDB_Whitepaper_Zwischen_analog_und_digital_12Seiten.pdf. [Stand:08.03.24]. 5 impliziert. Dieses Wissen wird Orientierungswissen genannt. Es steht im Gegensatz zu dem sog. Verfügungswissen, welches „ein positives Wissen, ein Wissen um Ursachen, Wirkungen und Mittel“8 darstellt. Verfügungswissen ist im Kontext des Bielefelder Medienkompetenzmodells das analytische und auch methodische Wissen, welches in jeder Dimension eine Rolle spielt. Dass z.B. Social-Media-Konzerne den Nutzer:in als Produkt für Werbedienstleister:innen sieht und deshalb so viele Daten wie möglich über sie sammelt, stellt ein Wissen über Ursache und Wirkung dar, liefert aber noch keine Implikation für das Handeln des Nutzers. Genau darin liegt der Unterschied. „Es beantwortet Fragen nach dem, was wir tun können, aber nicht Fragen nach dem, was wir tun sollen. Also muß zum positiven Wissen ein handlungsorientierendes Wissen, eben ein Orientierungswissen hinzutreten, das diese Aufgabe übernimmt.“9 Es besteht zwangsläufig eine symbiotische, trotzdem nicht gleichberechtigte Beziehung zwischen dem Orientierungswissen und dem Verfügungswissen. Wenn ein Individuum über kein Wissen über bestimmte Umstände in sozialen und gesellschaftlichen Kontexten verfügt, können Entscheidungen über Handlungsoptionen selten Kohärenz erzielen. Eine adäquate Deliberation von Gründen bedarf Wissen über den vorliegenden Kontext. Anderenfalls basieren die Handlungen auf nicht rational zugänglichen Entscheidungen. Das Ablehnen der Nutzung von Social Media Produkten kann auftreten, ohne, dass man über deren Geschäftspraktiken oder jedes weitere verfügbare Wissen über den dahinterstehenden Konzern besitzt. Allerdings stellt dann die Ablehnung eine nicht rational nachvollziehbare Überzeugung dar, wenn ihre Begründung unter Umständen auf rein emotionalen und falschen Gründen basiert. Das Verfügungswissen stellt im metaphorischen Sinne einen Ankerpunkt dar, ohne den man das Orientierungswissen nicht ansetzen kann, um Ziele und Maßstäbe für und an die eigenen Handlungen fest- und anzulegen. Ohne Verfügungswissen fehlen die Ansatzpunkte des Orientierungswissens und ohne Orientierungswissen kann das Verfügungswissen nicht in kohärente Entscheidungen umgesetzt werden. In beiden Varianten fehlt die Orientierung. Wie im Abschnitt „Die Notwendigkeit des Orientierungswissens für das Leben mit digitalen Medien“ herausgearbeitet, ist zu bemerken, dass das Vorhandensein von Orientierungswissen notwendig für das Vorhandensein von Orientierung ist. Das gemeinsame Auftreten von Verfügungswissen und Orientierungswissen ist hinreichend für das Vorhandensein von 8 Mittelstrass (1989). Glanz und Elend der Geisteswissenschaften. Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, 19. 9 Mittelstrass 1989, 19. 6 Orientierung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Orientierung in Bezug auf die eigene Identität entsteht. Jedes menschliche Individuum interpretiert, bewertet und deliberiert Dinge aus dessen eigener Sicht und schafft somit für sich subjektive Orientierung10. Zusammenfassend entspricht Orientierungswissen den Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die erforderlich sind, „um sich in bestimmten Bereichen kohärent entscheiden zu können. Der Kern dieses Orientierungswissens ist in der Lebenswelt verankert.“ 11 Folglich kann man Orientierung als ein Produkt von Fähigkeiten und Fertigkeiten vorstellen, die aus dem Zusammenspiel von Orientierungswissen und Verfügungswissen entstehen. Ein konsistentes Resultat von Orientierung ist das Treffen von kohärenten Entscheidungen in dem zu orientierenden Bereich der Lebenswelt. Bevor weiter unten der Bereich der digitalen Medien, also die digitale Lebenswelt von Individuen genauer, in Bezug auf Orientierung, betrachtet wird, ist zu klären, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten durch die Ausbildung von Orientierungswissen erlangt werden. Eine Antwort auf diese Frage liefert meines Erachtens die Betrachtung des Deutschen Ethikrats bezüglich praktischer Vernunft. Diese zielt, genau wie das Orientierungswissen, auf ein kohärentes, verantwortliches Handeln ab, welches ein gutes Leben ermöglichen soll.12 Das Ziel geht über das Vorhandensein von wohlüberlegten praktischen Einzelurteilen hinaus, hin zu einem zeitlich konsistenten, möglichst richtigen und verantwortlichen Handeln, welches eine kohärente Ordnung der lebensweltlichen Praxis garantiert.13 Anders formuliert nutzen wir Menschen die praktische Vernunft, um als Individuen richtige Entscheidungen zu treffen, den >richtigen Weg< einzuschlagen, sprich uns im Leben zu orientieren. Der deutsche Ethikrat stellt in ihrer Stellungnahme „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz“ acht Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft vor14, die hier teilweise paraphrasiert und verkürzt dargestellt sind. 10 Vgl. Ebd. Nida-Rümelin, Weinfeld (2018). Digitaler Humanismus – Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Piper Verlag GmbH, München, 153. 12 Vgl. Deutscher Ethikrat (2023). Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz. Stellungnahme. Deutsche Ethikrat. Berlin, 130. 13 Vgl. Bormann (2021). Ist die praktische Vernunft des Menschen durch KI-Systeme ersetzbar? Zum unterschiedlichen Status von menschlichen Personen und (selbst-)lernenden Maschinen. In: Fritz et al. (Hg.) (2021). Digitalisierung im Gesundheitswesen. Anthropologische und ethische Herausforderungen der MenschMaschine-Interaktion. Freiburg im Breisgau, 41–64. 48-51 14 Vgl. Deutscher Ethikrat 2023, 131-133. 11 7 1. Verständnis von Moralsprache Moralisch relevante Güter, Werte und Haltungen verstehen und deontische Prädikate, wie richtig oder falsch angemessen auf verschiedene Situationen anwenden. 2. Unterscheidungs- und Einfühlungsvermögen in Bezug auf moralische Entitäten 3. Deliberatives Vermögen Praktische Vernunft beinhaltet die Fähigkeit zum Abwägen von konfligierenden moralischen Gütern und Werten. 4. Reflektierter Umgang mit moralischen Regeln Die Fähigkeit, moralische Regeln anzuwenden und ggf. weiterzuentwickeln, um kohärentes Handeln zu ermöglichen. 5. Intuitives Erfassen komplexer Handlungssituationen und Umstände 6. Urteilsvermögen 7. Begründung der eigenen moralischen Urteile Die Fähigkeit des Gründe Gebens und Nehmens sowie die Ausrichtung des eigenen Handelns danach. 8. Affekt und Impulskontrolle Diese hier aufgeführten Kompetenzen der praktischen Vernunft kann man als Blaupause für kohärente Entscheidungen und daraus resultierend ein reflektiertes, werteorientiertes und verantwortliches Handeln nehmen. Die Grundlage der kohärenten Entscheidung ist das Verstehen und das Differenzieren der moralischen Entitäten sowie das empathische Reagieren auf die Differenzen (1. und 2.). Um komplexe Handlungsstrategien zu entwickeln oder Konflikte zwischen moralischen Gütern aufzulösen und damit reflektierend moralische Regeln zu spiegeln oder zu erweitern, bedarf es der Fähigkeit, die unter Punkt 3. und 4. aufgeführt wurde. Je komplexer die Handlungssituationen und die zu beachtenden Kontexte und Umstände, desto besser muss die Fähigkeit des intuitiven Erfassens (5.) dieser und das Beurteilen der daraus resultierenden Handlungsalternativen (6.) sein. Eine Kohärenz im eigenen Handeln tritt dann ein, wenn die moralische Beurteilung reflexiv und unter Berücksichtigung verschiedener moralischer Standpunkte vollzogen wurde (7.). Für eine 8 dauerhafte Kohärenz ist eine Affekt- und Impulskontrolle unerlässlich.15 Wenn ein Individuum nicht über diese Einzelkompetenzen verfügt, basieren Entscheidungen auf emotionalen, affektierten und nicht volitionalen Zuständen. Sprich, ein rationaler Zugang zu Entscheidungen und den darauf basierenden Handlungen liegt nicht vor. Eine verantwortliche, reflektierte und kohärente Handlung ist nicht möglich. Dementsprechend sollten diese Einzelkompetenzen auch im Bielefelder Medienkompetenzmodell verortet sein. Die praktische Vernunft im Bielefelder Medienkompetenzmodell Um den angestrebten Zusammenhang zwischen dem Orientierungswissen und der Medienkompetenz darzustellen, werden im folgenden Abschnitt orientierungsverschaffenden Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft in das Bielefelder Medienkompetenzmodell eingeordnet. Die Basis der aufgeführten Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft ist ein rationaler Zugang zur Ethik. Dabei besteht ein allumfassender Anspruch, dass die Maßstäbe, die durch das rational moralische Fundament als Basis für kohärentes Handeln gesetzt werden, in allen Lebensbereichen gelten. Medienbezogenes Handeln als Teil der digitalen Lebenswelt bildet dabei keine Ausnahme. In welchen Dimensionen des Bielefelder Medienkompetenzmodells findet man also die Einzelkompetenzen wieder? Prädisponiert dafür ist die Dimension der Medienkritik. Diese enthält unter anderem eine reflexive und ethische Unterdimension. Letzteres wird als ethisches Betroffensein bezeichnet und umfasst, dass wir als vernunftbegabte Menschen unser Wissen und Reflexion hinsichtlich moralischer Entitäten abstimmen und diese definieren.16 Durch ethische, reflexive Betrachtungen wird ein soziales, verantwortliches, werteorientiertes und kohärentes Verhalten angestrebt. Für den handlungsvorbereitenden Prozess, der in erster Dimension beschrieben wird, sind die Kompetenzen 1.- 3. unerlässlich. Ohne Kenntnisse der relevanten moralischen Entitäten und deontischen Prädikate kann keine ethische Betrachtung vollzogen werden. Auch in Bezug auf Medien wird es moralische Entitäten geben, die konfliktäre Situationen hervorrufen, die es zu differenzieren und mittels Deliberation zu beseitigen gilt. Mit ansteigender Nummerierung der Einzelkompetenzen steigt auch die inhaltliche Nähe zu einer Handlung. Nichtsdestoweniger kann man auch die weiteren Kompetenzen in der ersten Dimension verorten. Der reflektierte Umgang mit moralischen 15 16 Vgl. Deutscher Ethikrat 2023, 131-133. Vgl. Baacke 2001. 9 Regeln ist notwendig, wenn eine deliberierte, differenzierte moralische Entität als Basis für eine Handlung gewählt wurde. Nur, wenn aus der Abwägung von moralischen Entitäten eine Bevorzugung einer den moralischen Regeln entsprechenden entsteht, dann kann eine verantwortungsvolle Partizipation und Gestaltung von Medien folgen. Anderenfalls entstehen Diskrepanzen und Konflikte mit anderen Partizipierenden. Zu bemerken ist, dass die Medienlandschaft einem ständigen Wandel unterliegt, sodass man ggf. eine Änderung der moralischen Regeln vollziehen muss. Der Fakt, dass Daten im Web 2.0 beliebig kopierbar sind, sollte eine Änderung von moralischen Regeln, beispielsweise in Bezug auf die Weitergabe von privaten Informationen zufolge haben, sodass es geboten ist, weniger private Informationen oder Informationen über andere Menschen online zu verbreiten. Tatsächlich scheint es so, dass durch geschickte PR- und Marketingstrategien eine gegenläufige Änderung der moralischen Regeln erreicht wurde, was ein Konfliktpotenzial birgt. Solche Konfliktpotentiale sollten in die Deliberation mit Ziel des verantwortlichen Handelns miteinfließen. Dementsprechend ist ein intuitives Erfassen von komplexen Handlungssituationen und verschiedenen Kontexten unerlässlich. In Rückkopplung mit sich selbst beurteilt das Individuum werteorientiert die erfassten Umstände und urteilt daraufhin. Durch den Anspruch der reflexiven Unterdimension, die Rückkopplung auf sich selbst immer wieder zu vollziehen, wird dieses Urteil und damit zwangsläufig die eigenen moralischen Urteile bewertet. Um sich nicht von den Urteilen abbringen zu lassen, bedarf es der Affekt- und Impulskontrolle. Genau die fehlende Impulskontrolle wird von medienkreierenden Menschen genutzt. Die Fusion von Social-Media und Videoplattformen, auf denen kurze Videos mit geringer Sekundenlänge das Hauptprodukt sind und die User:innen stundenlang beschäftigt, sind eindeutige Indizien für das Vorhandensein und das Ausnutzen von fehlender Impulskontrolle. Letztendlich zielt die ethische und reflexive Unterdimensionen der Medienkompetenz auf reflexive Entscheidungen ab, die in delebrierte Handlungen münden. Ohne die formulierten Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft ist dies nicht möglich. Dementsprechend gehören sie zu den Kompetenzen, die in der ersten Unterdimension angesprochen werden. Des Weiteren erkennt man den Einfluss der praktischen Vernunft ebenfalls in den handlungsnäheren Dimensionen drei und vier. Auch bei der Mediennutzung und Mediengestaltung kommen die ethischen Maßstäbe, die in der ersten Dimension festgelegt wurden, zum Tragen und somit auch die Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft. Der Unterschied besteht darin, dass die Kompetenzen in der ersten Dimension einen Prozess des Bewertens, des Abwägens und der 10 Reflexion beschreiben, der genauer ausdifferenziert die Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft darstellt und die dritte und vierte Dimension vornehmlich Handlungen beschreibt. Diesen Handlungen vorausgehend muss aber der Prozess des Bewertens, des Abwägens und der Reflexion vorangegangen sein, damit ein verantwortliches, reflektiertes und kohärentes Handeln auftreten kann. Die Kompetenzen, die dazu beitragen, ein Orientierungswissen zu bilden, sind also in Form von den Einzelkompetenzen der praktischen Vernunft in der ersten Dimension des Bielefelder Medienkompetenzmodells verortet. Aber warum sollten genau diesen Kompetenzen die höchste Relevanz zugeordnet werden? Dafür lohnt es sich, zwei Aspekte zu betrachten. Zum einen, welchen logischen Anteil Orientierungswissen an dem Vorhandsein von Orientierung besitzt und zum anderen, dass Individuen in der heutigen Gesellschaft ein hohes Maß an Orientierungswissen benötigen, um mit den rasanten Entwicklungen der digitalen Welt und sozial-ökonomischen Verflochtenheit zurechtzukommen. Die Notwendigkeit des Orientierungswissens für das Leben mit digitalen Medien Der folgende Abschnitt soll die beiden oben genannten Aspekte zu einem Argument verknüpfen, sodass die übergeordnete Relevanz des Orientierungswissens für das Leben und den Umgang mit digitalen Medien verdeutlicht wird. Für den Aspekt der Notwendigkeit des Orientierungswissens für Orientierung wird an dem Entstehungsprozess der Orientierung angesetzt. Durch die Analyse der orientierungsverschaffenen Kompetenzen wurde verdeutlicht, dass die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die einen Deliberations- und Reflexionsprozessermöglichen, der in verantwortliches, reflektiertes und kohärentes Handeln mündet, auf dem Orientierungswissen basieren. Darin ist zu erkennen, dass Orientierungswissen die Grundlage und damit eine Voraussetzung für kohärentes Handeln und damit für Orientierung ist. Um die Notwendigkeit zu verdeutlichen, betrachtet man das Vorhandensein von Orientierung. Ist ein Individuum in der Lage, sich einem Lebensbereich zu orientieren, d.h. reflektierte, verantwortliche und kohärente Entscheidungen zu treffen, die gleichgeartete Handlungen zu Folge haben, dann muss ein Prozess der Reflexion verschiedener Umstände und moralische Bewertung dieser vollzogen worden sein, sprich ein Prozess der Anwendung der praktischen Vernunft. Ohne 11 diesen würde man z.B. keine Kohärenz zwischen mehreren Entscheidungen erzeugen. Basieren Entscheidungen auf emotionalen Zuständen und nicht auf dem Geben und Nehmen von Gründen, so würden verschiedene, aber ähnliche Situationen, stark divergent zueinander bewertet werden. Die Frage, nach dem, wie man handeln soll, würde auf die Antwort, wie man sich fühlt, reduziert werden, was jeglichen rationalen Zugang erschwert bzw. unmöglich macht. Dementsprechend ist immer ein orientierungsverschaffender Prozess, getragen durch das Vorhandensein der Kompetenzen der praktischen Vernunft, dem Vorhandensein von verantwortlichen, reflektierten und kohärenten Handlungen, sprich dem Vorhandensein von Orientierung vorgelagert. Da das Wissen die notwendigen Kompetenzen impliziert, ist das Orientierungswissen notwendig für die Kompetenzen der praktischen Vernunft und damit notwendig für Orientierung. Für den Nachweis der höheren Relevanz des Orientierungswissens, im Vergleich zum Verfügungswissen, was die Bildungsziele im Bereich des Digitalen betrifft, wird an der symbiotischen Beziehung angesetzt. Wie bereits ausgeführt, stehen Verfügungswissen und Orientierungswissen in engem Zusammenhang. Das Orientierungswissen beantwortet die Frage, was wir tun sollen, auf Grundlage von bestimmten Umständen. Das Kennen dieser Umstände stellt das Verfügungswissen dar. Im Kontext der Medienkompetenz entspricht dies dem analytischen Wissen über Ursache und Wirkung, den methodischen und fachlichen Kenntnissen. Ohne das Wissen über Ursache und Wirkung kann kein adäquates Abwägen von Gründen stattfinden und damit keine ethische Bewertung vollzogen werden, ohne das Kennen der Gründe, kein Abwägen der Gründe. Logisch betrachtet sind beide Arten von Wissen zusammen hinreichend für Orientierung. Betrachtet man die Abgrenzung zwischen dem Orientierungswissen und dem Verfügungswissen, wird deutlich, dass das Verfügungswissen nicht alleinstehend notwendig und hinreichend für Orientierung sein kann. Ursache und Wirkungsbeziehungen zu kennen, beantwortet dem Individuum nicht, welche Handlung richtig oder falsch, geboten oder nicht geboten ist. Ohne Orientierungswissen keine Orientierung. Ist aber alleine Orientierungswissen hinreichend und notwendig für Orientierung? Auch hier stößt man auf Probleme. Es könnte durchaus sein, dass man auf Grundlage von abgewogenen Gründen Maßstäbe an das eigene Handeln angelegt hat, sodass ein verantwortliches und kohärentes Handeln entsteht, ohne für die Handlungssituation eine besondere Bewertung vorgenommen werden musste. So ist es denkbar, dass ein kohärentes Handeln in Bezug auf das eigene Datenmanagement auf Social-Media-Seiten vorliegt, ohne die Datenspeicherungs- und 12 Verarbeitungsprozess des dahinterstehenden Konzerns zu kennen. Allerdings basierte dann die Wahl der Maßstäbe auf einem Abwägungsprozess, in dem Gründe reflektiert abgewogen wurden und somit eine Art von Verfügungswissen in den Entstehungsprozess mit eingeflossen ist. In Bezug auf das genannte Beispiel kann ein Verständnis von ökonomischen Prozessen in Social-Media-Konzernen und die ökonomischen Kennzahlen Maßstäbe generieren, die Handlungen in Bezug auf Datenmanagement signifikant dauerhaft beeinflussen. Ohne Verfügungswissen geht es nicht. Dementsprechend ist logisch betrachtet Orientierung äquivalent zum Vorhandensein von Orientierungswissen gemeinsam mit Verfügungswissen. Warum sollte man also dem Orientierungswissen Vorrang gegenüber dem Verfügungswissen geben? Die Antwort ist in der digitalen Lebenswelt von einzelnen Individuen verankert. Begibt man sich in die individuelle digitale Lebenswelt einzelner Menschen, muss man selbstverständlich die subjektiven Lebensumstände betrachten. Legt man den Fokus auf die digitale Lebenswelt, gruppiert man Individuen in Digital Natives, Digital Immigrants und Digital Pioneers.17 Jede Gruppe besitzt andere Bildungsziele in Bezug auf den digitalen Bereich, aber betrachtet man die digitalen Medien isoliert, haben alle Gruppen eine Gemeinsamkeit: Durch die steigende Verflochtenheit der digitalen Welt mit allen anderen Lebensbereichen sind digitale Medien für fast alle Menschen allgegenwärtig. Alle Menschen, die am herkömmlichen sozialen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen, sind Konsumenten digitaler Medien. Eine Entziehung ist nur in äußersten Ausnahmefällen und mit gezielter Intention dahingehend möglich. Sieht man von den Ausnahmefällen ab, dann unterliegen alle Digital Natives, Immigrants und Pioneers der unaufhörlich fortschreitenden technologischen Entwicklung der Medien. Ob Metaverse oder KI-gesteuerter Journalismus, die neuesten technologischen Fortschritte finden Anwendung im Bereich der Medien. Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, muss eine ungemeine Menge an Verfügungswissen akkumuliert werden. So gibt es alleine im Bereich Blockchain und künstliche Intelligenz wöchentliche Fortschritte, die wieder neue Wissensaspekte zum möglichen Verfügungswissen hinzufügen. Der unaufhörliche Strom an Informationen ist unmöglich komplett in Kenntnisse umzuwandeln. Zusammen mit der stetigen Verfügbarkeit von Informationen besteht die größte Aufgabe darin, sich Informationen selbst zu ordnen und zu bewerten. Die Notwendigkeit, eigene Urteile zu fällen und divergierende Meinungen zu analysieren und an eigenen 17 Vgl. Nida-Rümelin, Weinfeld 2018,152-153. 13 Überzeugungen zu messen, erhöht sich mit der Digitalisierung der Medien konsequent.18 Genau hier liefert das Orientierungswissen Unterstützung. Legt man die Ausbildung von Orientierungswissen als Bildungsziel frühzeitig fest, so wird die Urteilskraft des lernenden Individuums gestärkt und es besitzt fundierte Überzeugungen über die relevanten deontischen Prädikate in Bezug auf Medien. Im digitalen Informationsdschungel sind orientierungsverschaffenden Fertigkeiten und Fähigkeiten, die auf dem Orientierungswissen basieren, genau diejenigen, die Informationen und Fachwissen ordnen, einordnen, abwägen und ein reflektiertes Urteil ermöglichen. Ohne Orientierungswissen gerät das Individuum in eine aussichtslose Situation. Im Takt des technologischen Fortschritts verliert es die Anbindung zu den Werten, Maßstäben und Handlungsprämissen, die am Ende ein gutes Leben ausmachen. Es lohnt sich, einen weiteren Aspekt zu betrachten, der vornehmlich die Digital Natives betrifft. Das Verfügen über Fachwissen und Kenntnisse über Ursache und Wirkung sind nicht die einzigen Medienkompetenzaspekte, die dem Verfügungswissen zugeordnet werden. Ein Teil der schulischen Medienkompetenzausbildung besteht dem staatlichen Anspruch nach aus dem Erlernen von methodischem und algorithmischem Vorgehen, durch das eine kompetente Partizipation und Gestaltung an und von Medien ermöglichen soll.19 Auch im Baackes Modell findet man die Gestaltung und Partizipation von und an Medien. Diese Kompetenzen werden erst durch das Verfügen über bestimmte Wissensbestände ermöglicht, dennoch scheint es plausibel, dass das methodische Wissen, welches ohne Zweifel benötigt wird, an Relevanz verliert, wenn man sich der Gestaltung und Partizipation zu wendet. Durch die Ökonomisierung der digitalen Lebenswelt sind den Individuen Gestaltungsmöglichkeiten und Teilhabe an digitalen Medien unheimlich erleichtert worden. Ob Videoproduktionen, Fotogeschichten oder schriftliche Reaktionen auf andere digitale Inhalte, für viele Digital Natives gehören die benötigten Fertigkeiten oder Fähigkeiten zu autodidaktisch erlernter Grundausstattung. Ein erleichterter Zugang garantiert noch kein reflektiertes, verantwortliches Handeln. Je weniger Individuen über methodische und anwendungsbezogene Aspekte lernen müssen, um an Medien teilzuhaben und diese mitzugestalten, desto mehr kann man und sollte man sich der Frage nach den ethischen Maßstäben und die soziale Verantwortung der Individuen widmen, sprich der 18 Vgl. Ebd. 159. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016 in der Fassung vom 07.12.2017. Strategie der Kulturministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“. Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Hg), Berlin. 16-19. 19 14 Ausbildung der Fertigkeiten und Fähigkeiten, die auf dem Orientierungswissen basieren. Ohne Orientierungswissen ist jedes noch so praktisch veranlagte Individuum ohne ethische Leitbilder und Maßstäbe ausgestattet, was insbesondere bei einer Partizipation an digitalen Medien weitreichende und nachhaltig negative Folgen für dessen eigenes und anderes Leben haben kann. Zusammenfassung und abschließende Betrachtung Die vorliegende Arbeit hat den Begriff des Orientierungswissens im Bielefelder Medienkompetenzmodell analysierend erläutert und argumentativ mit dem Begriff der praktischen Vernunft verbunden. Dadurch konnten Fertigkeiten und Fähigkeiten identifiziert werden, die es erleichtert haben, die orientierungsverschaffenden Dimensionen in Baackes Modell zu erläutern und die Notwendigkeit des Orientierungswissens für den adäquaten Umgang mit digitalen Medien zu verdeutlichen. Zusammenfassend ist Orientierungswissen notwendig für das Vorhandensein von Orientierung und mit dem Verfügungswissen zusammen hinreichend. Dennoch kann man durch die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Information, die fortschreitende technologische Entwicklung und die erleichterte Zugänglichkeit zur Mediengestaltung und -nutzung eine höhere Relevanz der Ausbildung von Orientierungswissen erkennen. Ziel der Vermittlung der Medienkompetenz sollte mit steigender Verflochtenheit des Digitalen mit anderen Lebensbereichen ein ethisch reflektierter und verantwortlicher Umgang mit Medien sein. Dahingehend ist die Vermittlung von Kompetenzen der praktischen Vernunft, spezialisiert auf Medienumgang, ein zu bevorzugendes Mittel. Diese findet man vornehmlich in der ersten Dimension des Bielefelder Medienkompetenzmodells. Vermittelt man Medienkompetenz mit einem Schwerpunkt auf die erste Dimension, fokussiert man sich auf die Ausbildung von orientierungsschaffenden Kompetenzen, die dem lernenden Individuum am Ende Orientierung in der digitalen Medienwelt ermöglicht. Insgesamt: Inhaltlich einwandfrei, klarer Aufbau, innovativer Ansatz, klare Forschungsthese/frage 1,0 Die Kommentare beziehen sich fast ausschließlich auf das Formale! 15