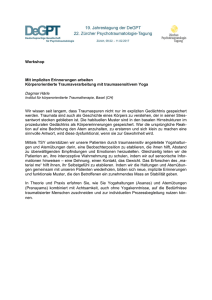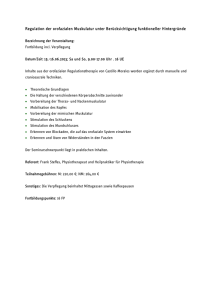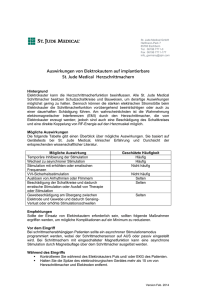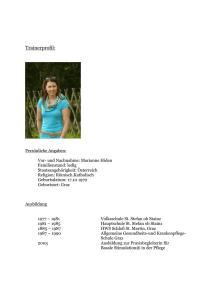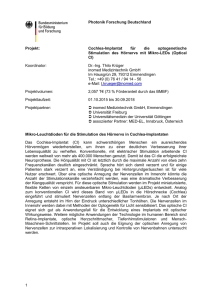Enhancing Interoceptive Abilities and Emotional Processing: Effects of HD-tDCS – Pollatos (2024) Zusammenfassung Titel & Abstract Titel: Verbesserung interozeptiver Fähigkeiten und emotionaler Verarbeitung durch HD-tDCS Fokus: Die Studie untersucht, ob anodale HD-tDCS über dem rechten somatosensorischen Kortex (S1) – in Kombination mit körperlicher Aktivierung – die Wahrnehmung innerer Körperzustände (Interozeption) und emotionale Reaktionen verbessern kann. Ergebnisse: Keine Verbesserung der interozeptiven Genauigkeit oder emotionalen Verarbeitung – aber eine signifikante Steigerung des kardialen interozeptiven Bewusstseins nach aktiver tDCS. 1. Einführung Theoriehintergrund: Interozeption ist zentral für emotionales Erleben. Sie umfasst drei Dimensionen: o Genauigkeit = accuracy (objektiv gemessen), o Bewusstsein = awareness (Vertrauen in die eigene Wahrnehmung), o Sensibilität = sensibility (subjektives Körperbewusstsein). Neuronale Grundlagen: Interozeptive Prozesse involvieren Insula & somatosensorischen Kortex (S1). Studien zeigen: S1 ist an kardialer Interozeption & Emotionsverarbeitung beteiligt. Neurostimulation: HD-tDCS kann gezielt Gehirnregionen modulieren. S1 ist wegen seiner Oberflächennähe ein praktikables Ziel. Ziel der Studie: Untersuchen, ob HD-tDCS über S1 die interozeptive Genauigkeit, Sensibilität und das emotionale Erleben verbessert. 2. Materialien und Methoden Teilnehmende: 36 gesunde Erwachsene (18–30 Jahre), zwei Sitzungen mit aktiver & Schein-tDCS, Reihenfolge randomisiert. Design: o tDCS: Anodale HD-tDCS (20 Min., 2 mA) über rechter S1 vs. ScheinStimulation. o Körperliche Aktivierung: Ergometertraining zur Aktivierung des interozeptiven Netzwerks. Messinstrumente: o Interozeptive Genauigkeit: Herzschlag- und Atemwahrnehmungsaufgaben o Interozeptives Bewusstsein: Vertrauen, emotionale Bewertung (Valenz, Erregung, Angst) o Interozeptive Sensibilität: Trait & State-Interozeption (Fragebögen) o Emotionale Reaktion: IAPS-Bilder (Valenz & Erregung) o Kontrollmaßnahme: Taktile Reizaufgabe zur Stimulationseffektivität Statistik: ANOVAs und MANOVAs mit Messwiederholung; Effektstärken als partielle Eta-Quadrate. 3. Ergebnisse Stimulation wirksam: Intensitätseinschätzung taktiler Reize nach aktiver tDCS signifikant erhöht → S1-Stimulation war effektiv. Interozeptive Genauigkeit: Keine signifikanten Veränderungen für Herz- oder Atemgenauigkeit. Interozeptives Bewusstsein: Keine Effekte auf Vertrauen oder emotionale Bewertung der Empfindungen. Interozeptive Sensibilität: o Trait-Bewusstheit: keine signifikanten Unterschiede o State-Bewusstheit: kardiales Bewusstsein signifikant erhöht nach aktiver tDCS (η²ₚ = 0,123) Emotionale Bewertung: Bilder wurden wie erwartet emotional bewertet (positiv/negativ), aber tDCS hatte keinen Einfluss darauf. Körperliche Aktivierung: Keine signifikanten Zusammenhänge mit interozeptiven Veränderungen. 4. Diskussion Kernaussage: HD-tDCS über S1 verändert nicht die objektive interozeptive Leistung, aber subjektives Bewusstsein für den Herzschlag. Mögliche Erklärungen für fehlende Effekte: o Einzelne Sitzung zu kurz o Fokale Wirkung begrenzt o Hohe interindividuelle Unterschiede in Ansprechbarkeit Wert der Studie: Erstmalige Kombination von S1-HD-tDCS & körperlicher Aktivierung zur Beeinflussung von Interozeption & Emotion. Ausblick: Potenzial für klinische Anwendung bei emotionalen Störungen, Bedarf an Langzeitstudien und Integration von interozeptivem Training. 5. Fazit Ergebnisse gemischt: Keine objektiven, aber subjektive Verbesserungen der Herz-Körperwahrnehmung nach tDCS. Implikation: HD-tDCS könnte gezielt interozeptives Bewusstsein modulieren. Zukunft: Kombinierte Ansätze (z. B. mit Achtsamkeitstraining) und LangzeitStimulationsprotokolle könnten effektiver sein. Übersetzung Zusammenfassung (Abstract): Hintergrund: Interozeption – die Verarbeitung und Integration körperlicher Signale – ist wesentlich für emotionale Erfahrungen und das allgemeine Wohlbefinden. Das interozeptive Netzwerk, zu dem auch die somatosensorischen Kortexbereiche gehören, ist für seine Rolle bei der interozeptiven und emotionalen Verarbeitung bekannt. Es wurde gezeigt, dass hochauflösende transkranielle Gleichstromstimulation (HD-tDCS) die Gehirnaktivität im primären somatosensorischen Kortex (S1) modulieren kann. Auf Basis dieser Erkenntnisse stellten wir die Hypothese auf, dass anodal angewandte HD-tDCS über dem rechten S1 die interozeptiven Fähigkeiten verbessern und die emotionale Wahrnehmung verstärken würde. Methoden: 36 gesunde Erwachsene nahmen an zwei Sitzungen teil, die durch mindestens eine Woche Abstand getrennt waren. In zufälliger Reihenfolge wurde jeweils eine 20minütige HD-tDCS-Stimulation (2 mA) und eine Schein-Stimulation angewendet. Beide Bedingungen beinhalteten eine körperliche Voraktivierung durch Ergometertraining vor der tDCS-Anwendung. Interozeptive Fähigkeiten wurden jeweils vor und nach beiden Sitzungen mithilfe einer HerzschlagWahrnehmungsaufgabe und einer respiratorischen Belastungsaufgabe gemessen. Die emotionale Wahrnehmung wurde anhand von vier abgestimmten Bildsets aus dem International Affective Picture System (IAPS) gemessen, die in zufälliger Reihenfolge präsentiert wurden. Ergebnisse: Die aktive HD-tDCS führte nicht zu einer signifikanten Verbesserung der interozeptiven Genauigkeit, der interozeptiven Emotionsbewertung oder der interozeptiven Sensibilität. Es wurde jedoch ein deutlicher Anstieg des kardialen interozeptiven Bewusstseins nach aktiver HD-tDCS beobachtet. Die erwartete Verbesserung der emotionalen Verarbeitung trat nicht ein. Schlussfolgerung: Diese Studie stellt den ersten Versuch dar, interozeptive und emotionale Verarbeitung durch HD-tDCS über dem S1 zu modulieren. Auch wenn keine durchgängig positiven Effekte nachgewiesen wurden, liefern die Ergebnisse wichtige Einblicke in die Modulierbarkeit interozeptiver und emotionaler Prozesse durch HDtDCS und eröffnen Ansatzpunkte für weitere Forschung. Zukünftige Studien sollten die differenzierten Effekte von Stimulationstechniken und das komplexe Zusammenspiel zwischen Interozeption und Emotion berücksichtigen. Schlüsselwörter: Herzschlagwahrnehmung; nicht-invasive Neurostimulation; körperliche Aktivierung; primärer somatosensorischer Kortex; transkranielle Gleichstromstimulation 1. Einleitung Wir neigen dazu, unsere Emotionen über körperliche Empfindungen zu beschreiben, wie dies durch Ausdrücke wie „einen Kloß im Hals haben“ bei Angst oder „Schmetterlinge im Bauch“ beim Verliebtsein veranschaulicht wird. Dies betont die Vorstellung, dass die Interpretation körperlicher Empfindungen eng mit dem Entstehen, der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Emotionen verknüpft ist. Die Idee, dass Emotionen auf körperlichen Veränderungen basieren, existiert seit über einem Jahrhundert. Sie wurde erstmals von William James vorgeschlagen [1] und hat die Emotionsforschung seither maßgeblich geprägt. Natürlich haben sich die Emotionstheorien seit der kontrovers diskutierten James-Lange-Theorie der Emotion [2] weiterentwickelt. Neuere Theorien, wie etwa die Zwei-Faktoren-Theorie von Schachter und Singer [3] oder Damasios somatische Marker-Hypothese [4], beziehen kognitive Bewertungen und andere Faktoren in die Emotionsverarbeitung mit ein – körperliche Veränderungen gelten aber weiterhin als zentral. Die Fähigkeit, solche körperlichen Zustände zu verarbeiten und zu integrieren – auch als Interozeption bezeichnet – hat sich auch als wesentlich für eine Vielzahl weiterer psychologischer und physiologischer Prozesse erwiesen [5,6]. Interozeptive Prozesse sind dafür verantwortlich, afferente Informationen über den Körper in bewusste körperliche Empfindungen zu überführen, und zwar durch mentale Repräsentation [6,7]. Menschen verlassen sich auf Interozeption, um körperliche Empfindungen wie Hunger oder Schmerz wahrzunehmen und zu verstehen – meist ohne sich dessen bewusst zu sein [5]. Dennoch sind wir in der Lage, interozeptive Prozesse bewusst wahrzunehmen, zum Beispiel durch gezielte Aufmerksamkeit auf den Herzschlag. Drei unterschiedliche Dimensionen der Interozeption wurden postuliert und empirisch belegt [8,9]. Garfinkel et al. [9] beschreiben diese Dimensionen wie folgt: 1. Interozeptive Genauigkeit: Die Fähigkeit, körperliche Empfindungen korrekt wahrzunehmen; messbar durch objektive Tests. 2. Interozeptives Bewusstsein: Eine metakognitive Fähigkeit, die Einsicht in die eigene interozeptive Genauigkeit erlaubt; messbar über das Vertrauen in die eigene Genauigkeit. 3. Interozeptive Sensibilität: Das subjektiv empfundene Ausmaß, in dem man sich auf innere Körperwahrnehmungen fokussiert und interne Signale erkennt; messbar durch Selbstauskunft. Die am häufigsten untersuchte interozeptive Fähigkeit ist die Herzschlagwahrnehmung, die meist mithilfe einer entsprechenden Wahrnehmungsaufgabe gemessen wird [10]. In jüngerer Zeit wurden auch interozeptive Fähigkeiten in anderen Modalitäten, etwa respiratorische oder gastrointestinale Empfindungen, untersucht. Diese Forschung legt nahe, dass interozeptive Fähigkeiten über mehrere physische Systeme hinweg miteinander verbunden sind [11–13]. - Interozeptive Fähigkeiten haben sich als wesentlich für die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit erwiesen [7,14–16]. Zwar unterscheiden sich interozeptive Fähigkeiten individuell, jedoch wurden Veränderungen in interozeptiven Prozessen mit geringerer kognitiver Leistungsfähigkeit, Angst, Depression, Essstörungen, Abhängigkeitserkrankungen und psychosomatischen Störungen in Verbindung gebracht [6,16–22]. - Glücklicherweise konnte auch gezeigt werden, dass sich interozeptive Fähigkeiten durch Training verbessern lassen [23]. So gewinnt z. B. die Integration von Achtsamkeit in der Depressionsbehandlung zunehmend an Bedeutung. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen dem Behandlungserfolg von Achtsamkeit und einem gleichzeitigen Anstieg des interozeptiven Bewusstseins beobachtet [24]. Eine Übersichtsarbeit zu interozeptiven Aspekten psychischer Gesundheitsinterventionen fand eine Symptomreduktion bei Angststörungen, Essstörungen sowie psychosomatischen und Abhängigkeitsstörungen [25]. Auch bei der Behandlung von Essstörungen [20] und bei der Reduktion von Angstsymptomen bei Autist:innen [26] konnten nach interozeptivem Training Verbesserungen festgestellt werden. Somit belegen zahlreiche Befunde, dass interozeptive Fähigkeiten grundsätzlich verbesserbar sind. - Auch für die emotionale Verarbeitung ist die vielfach postulierte Rolle körperlicher Veränderungen und damit interozeptiver Prozesse durch empirische Studien untermauert – sei es beim Erleben von Emotionen oder bei der Verarbeitung emotionaler Sprache [14,27,28]. Bei Menschen mit Alexithymie – einer Störung, die die Wahrnehmung und den Ausdruck von Emotionen betrifft – ist häufig auch die interozeptive Fähigkeit eingeschränkt [29]. Zudem besteht ein starker Zusammenhang zwischen hoher interozeptiver Fähigkeit und sowohl der Intensität emotionalen Erlebens als auch mit erhöhter neuronaler Aktivität bei emotionalen Aufgaben [14,30–32]. - Entsprechend hat die aktuelle Forschung begonnen, neuronale Grundlagen von Interozeption und Emotion genauer zu untersuchen [6,33]. Es gilt als gut belegt, dass der Insulakortex Teil eines neuronalen Netzwerks ist, das sowohl interozeptive als auch emotionale Verarbeitung umfasst [6,34–38]. Die Insula ist stark vernetzt mit dem präfrontalen und orbitofrontalen Kortex, dem Thalamus, der Amygdala, dem anterioren cingulären Kortex und dem somatosensorischen Kortex [6]. Eine Beteiligung des somatosensorischen Kortex an interozeptiven Prozessen wurde ebenfalls vielfach dokumentiert [34,35,39–42], was zur Annahme interozeptiver Pfade führt, die sowohl die Insula als auch den somatosensorischen Kortex einschließen [33,43,44]. - Ein wachsender Forschungsstand unterstützt außerdem die Annahme, dass der somatosensorische Kortex – aufgrund seiner Rolle bei der physiologischen Wahrnehmung – auch wesentlich an der emotionalen Verarbeitung beteiligt ist [45]. Empirische Studien zeigen somatosensorische Aktivierung bei der visuellen Emotionserkennung, dem tatsächlichen emotionalen Erleben und der Emotionsregulation [45–47]. Der primäre somatosensorische Kortex (S1) scheint dabei insbesondere an der kardialen Interozeption sowie an der Verarbeitung aversiver emotionaler Reize beteiligt zu sein [38,43]. - S1 umfasst die Brodmann-Areale 1, 2 und 3 und liegt im postzentralen Gyrus. Er repräsentiert den gesamten Körper und verarbeitet afferente Informationen über somatotopisch organisierte Neuronen [48,49]. Die Hauptfunktion von S1 besteht darin, auf somatosensorische Reize zu reagieren [48]. - Neben der dokumentierten kortikalen Aktivität im S1 bei interozeptiver und emotionaler Verarbeitung haben sich auch Neurostimulationsverfahren, die auf diesen Hirnbereich abzielen, als wirksam in der Modulation körperlicher Wahrnehmung erwiesen [50–52]. So konnten beispielsweise Veränderungen in der kardialen interozeptiven Genauigkeit durch transkranielle Magnetstimulation (TMS) über dem rechten somatosensorischen Kortex erzeugt werden [52], was die Rolle des somatosensorischen Kortex bei der Interozeption unterstreicht. Auch Veränderungen in der Schmerz- und Temperaturempfindung sowie in der taktilen räumlichen Wahrnehmung wurden nach transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) über dem S1 festgestellt [53–55]. Zudem wurde gezeigt, dass TMS über interozeptiven Netzwerken auch die emotionale Wahrnehmung beeinflussen kann [56]. Diese Befunde verdeutlichen sowohl die enge Verbindung zwischen interozeptiver und emotionaler Verarbeitung als auch deren Anfälligkeit für Modulation durch Neurostimulation. - tDCS ist eine nicht-invasive neurostimulative Methode, die zunehmend an Popularität gewinnt und zur Modulation der kortikalen Erregbarkeit beim Menschen eingesetzt wird [57–59]. Dabei unterscheiden sich die Effekte von positiver (anodaler) und negativer (kathodaler) Stimulation: Anodale tDCS erleichtert die spontane und ausgelöste kortikale Aktivität, während kathodale tDCS die kortikale Erregbarkeit nachweislich hemmt [51,57,60]. Klassischerweise wird tDCS durch Anbringen einer Ziel- und einer Referenzelektrode auf der Kopfhaut durchgeführt [57]. Über die Elektroden wird ein schwacher Gleichstrom ins Gehirn geleitet, der elektrische Felder erzeugt, die auf die Zellkörper und Axonenden der betroffenen Neuronen wirken [61]. - Traditionell werden Schwammelektroden zur Anwendung von tDCS verwendet [51]. In den letzten 15 Jahren wurde jedoch zunehmend der Einsatz von Ringelektroden untersucht, wobei sich zeigte, dass diese eine höhere räumliche Fokussierung ermöglichen als herkömmliche Schwamm- oder Scheibenelektroden [62,63]. Speziell das sogenannte High-Definition tDCS (HDtDCS), das solche Ringelektroden verwendet, hat sich als bevorzugte Methode der Gleichstromstimulation etabliert. HD-tDCS bietet Vorteile gegenüber konventioneller tDCS, darunter eine höhere räumliche Präzision und länger anhaltende Nachwirkungen [60,64–66]. HD-tDCS ist eine sichere, effektive und nicht-invasive Methode der Neurostimulation und hat sich in randomisierten kontrollierten Studien als wirksam erwiesen [66–68]. - Da interozeptive Fähigkeiten und emotionale Wahrnehmung veränderbar und miteinander verknüpft sind – ebenso wie die zugrunde liegende kortikale Aktivität –, stellt sich die Frage, ob sich interozeptive Fähigkeiten auch durch tDCS über die entsprechenden Hirnregionen beeinflussen lassen. Kürzlich wurde durch kathodale tDCS über dem Zungenmotor-Kortex eine wirksame Modulation des Hungergefühls erreicht [69]. Da der Zungenmotor-Kortex mit dem interozeptiven neuronalen Netzwerk verbunden ist [33,70] und Interozeption beim Hungergefühl eine wichtige Rolle spielt [71], stellt dies einen weiteren Hinweis auf das Potenzial von tDCS zur Modulation interozeptiver Prozesse dar. - Obwohl die Insula gemeinhin als das Zentrum interozeptiver Verarbeitung im Gehirn gilt, ist der S1 sowohl mit Interozeption als auch mit emotionaler Verarbeitung verbunden. Da der S1 näher an der Schädeloberfläche liegt als die Insula [6], bietet er zudem ein leichter zugängliches Ziel für Hirnstimulation als der Insulakortex. Bislang sind uns keine Studien bekannt, die versucht haben, interozeptive Fähigkeiten und emotionale Wahrnehmung mithilfe von HD-tDCS über dem somatosensorischen Kortex zu beeinflussen. - In der vorliegenden Studie versuchten wir, interozeptive Fähigkeiten und emotionale Wahrnehmung durch Anwendung von anodaler HD-tDCS über dem rechten S1 zu verbessern. Wir stellten die Hypothese auf, dass sich nach aktiver tDCS die interozeptive Genauigkeit, das interozeptive Bewusstsein und die interozeptive Sensibilität verbessern würden. - Zusätzlich führten wir eine körperliche Voraktivierung durch – bestehend aus Radfahren auf einem Ergometer –, um die Verarbeitung körperlicher Signale auf „bottom-up“-Weise anzuregen. Aufgrund der bekannten Verbindung zwischen interozeptiver und emotionaler Verarbeitung sowie der überlappenden neuronalen Substrate erwarteten wir zudem, dass das emotionale Erleben nach aktiver tDCS, jedoch nicht nach Schein-tDCS, intensiver ausfallen würde. 2. Materialien und Methoden 2.1 Teilnehmende Eine G*Power-Analyse ergab eine ideale Stichprobengröße von 34 Teilnehmenden für unsere geplante Analyse einer zweifaktoriellen, faktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung (ANOVA) für kontinuierliche abhängige Variablen. Wir erwarteten dabei einen kleinen bis mittleren Effekt (η = 0,25) und strebten eine Teststärke (Power) von 0,80 an. Es wurden 60 Erwachsene über lokale Aushänge an der Universität Ulm rekrutiert. Nach dem Screening auf Kontraindikationen für tDCS und aufgrund fehlender Rückmeldungen wurden 24 Personen ausgeschlossen. Die verbleibenden 36 gesunden, deutschsprachigen Erwachsenen (61,1 % weiblich) im Alter von 18 bis 30 Jahren (M = 23,5 Jahre, SD = 2,903) nahmen an der Studie teil. Ausschlusskriterien und der Einschlussprozess sind in Abbildung 1 dargestellt. Alle Teilnehmenden gaben vor Beginn der Studie schriftlich ihr Einverständnis. Nach Abschluss erhielten sie eine Aufwandsentschädigung von 45 € oder Versuchspersonenstunden, je nach Wunsch. Das Forschungsvorhaben wurde von der Ethikkommission der Universität Ulm genehmigt. Die Studie wurde in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki durchgeführt. 2.2 Studienprotokoll Das Experiment wurde im Rahmen eines Within-Subject-Designs mit Messwiederholung durchgeführt und folgte dem in Abbildung 2 dargestellten Protokoll. Die Teilnehmenden beantworteten zunächst zu Hause eine Online-Umfrage. In diesem ersten Studienteil wurden demografische Daten erfasst sowie folgende Skalen verwendet: die Edinburgh-Handedness-Inventory [72] zur Bestimmung der Händigkeit, das Beck-Depressions-Inventar II (BDI-II) [73] zur Erfassung depressiver Symptome, die Trait-Skala der State-Trait-Angst-Inventars (STAI-T) [74] zur Messung von Angstsymptomen und der Freiburger Fragebogen zur körperlichen Aktivität [75]. Zudem wurde die interozeptive Sensibilität in der Ausgangslage erhoben – mittels des Body-Perception-Questionnaire [76] und des Anxiety Sensitivity Index (ASI-3) [77]. Zusätzlich beantworteten die Proband:innen einen Fragebogen zur subjektiven Wahrnehmung verschiedener Körpersensationen (Herz, Atmung, Gastrointestinaltrakt, Zittern, Temperatur/Schwitzen) – die sogenannte Trait Interoceptive Awareness (TIA). Im zweiten Studienteil erfolgten zwei Labor-Sitzungen von jeweils ca. 2 Stunden, die mindestens eine Woche auseinander lagen. Der Ablauf war in beiden Sitzungen identisch, mit Ausnahme der jeweils veränderten tDCS-Bedingung. Jede:r Teilnehmende erhielt einmal eine aktive tDCS-Stimulation und einmal eine ScheinStimulation. Die Reihenfolge war randomisiert, und die Proband:innen wussten nicht, in welcher Bedingung sie sich befanden. Die Randomisierung erfolgte über das Software-Tool "Research Randomizer" (Version 4.0, https://www.randomizer.org) [78]. Zu Beginn jedes Messzeitpunktes – also vor und nach tDCS – wurde mit dem STAI-S (State-Skala) [74] die aktuelle Angstintensität erhoben. Im ersten Block (vor tDCS) wurde zusätzlich die Stimmung mit der Kurzversion des Profile of Mood States (POMS) [79] erfasst. Die State Interoceptive Awareness (SIA) – also die momentane interozeptive Sensibilität – wurde mit einem Fragebogen erfasst, in dem die Teilnehmenden ihre aktuelle Wahrnehmung von Herzschlag, Atmung, gastrointestinale Empfindungen, Zittern und Temperatur/Schwitzverhalten beurteilten. Interozeptive Genauigkeit wurde mithilfe von zwei Paradigmen erfasst: Herzschlag-Wahrnehmungsaufgabe (heartbeat perception task) [10]: Vier Intervalle (25, 35, 45 und 60 Sekunden) wurden in zufälliger Reihenfolge präsentiert. Die Teilnehmenden sollten in diesen Zeitfenstern ihre Herzschläge mental mitzählen – ohne ihren Puls zu tasten – und die gezählten Schläge am Ende jedes Intervalls angeben. Die Durchführung erfolgte nach einem etablierten Protokoll [80]. Atemlast-Schätzaufgabe (respiratory load task) [13,52]: Hierfür wurde ein POWERbreathe® K5 Trainingsgerät (Modell K5, POWERbreathe®, Großbritannien) verwendet. Es wurden sieben Inspirationswiderstände (3, 5, 7, 10, 13, 19 und 25 cm H₂ O) eingestellt. Die Teilnehmenden atmeten zunächst einmal durch jeden Widerstand, um sich daran zu gewöhnen. Anschließend wurden in zufälliger Reihenfolge sieben Durchgänge mit je einem dieser Widerstände durchgeführt. Nach jedem Atemzug beurteilten die Teilnehmenden die empfundene Schwierigkeit auf einer siebenstufigen LikertSkala. Die Reihenfolge wurde mithilfe des Random Allocation Software Tools (Version 1.0, Saghaei, Iran) randomisiert [81]. Die interozeptive Genauigkeit für Herz und Atmung wurde nach den Formeln von Pollatos et al. [52] berechnet, die Werte liegen zwischen 0 und 1 (je höher, desto besser die Genauigkeit). Interozeptives Bewusstsein wurde gemäß Pollatos et al. [52] erhoben: Nach jedem Versuch (Herz oder Atmung) bewerteten die Teilnehmenden auf einer 9-Punkte-Skala ihr Vertrauen in ihre jeweilige Antwort („kein Vertrauen“ bis „vollständiges Vertrauen“). Zusätzlich wurde nach jedem Versuch die emotionale Bewertung erhoben – für Herz- und Atemaufgabe getrennt – ebenfalls auf 9-Punkte-Skalen zu: Valenz („negativ“ bis „positiv“) Erregung („ruhig“ bis „nervös“) Angst („gar nicht“ bis „sehr“) Ergänzend wurde die Self-Assessment Manikin (SAM) Skala [82] zur Beurteilung von Valenz und Erregung verwendet. Für die emotionale Wahrnehmung nutzten wir das International Affective Picture System (IAPS) [83]. Es wurden vier Bildsets erstellt, bestehend aus je 10 positiven, 10 neutralen und 10 negativen Bildern. Die Mittelwerte der Valenz- und Erregungsbewertungen wurden zwischen den Sets so abgestimmt, dass sie vergleichbar waren. In jeder Laborsitzung sahen die Teilnehmenden je ein Bildset vor und ein weiteres nach der tDCS-Stimulation. Die Reihenfolge der Sets war ebenfalls randomisiert. Jedes Bild wurde für 2 Sekunden präsentiert, und die Teilnehmenden bewerteten es in Echtzeit auf SAM-Skalen zu Valenz und Erregung. Zur Kontrolle der Effektivität der tDCS-Stimulation des S1 führten wir eine taktile Reizaufgabe durch. Die Reizung erfolgte am oberen Brustbein, da sich die kortikale Repräsentation der entsprechenden Thoraxdermatome und das tDCS-Zielgebiet (beide in Brodmann-Areal 3, also S1) überlappen [49,84,85]. Die taktile Stimulation orientierte sich an etablierten Protokollen [86–89]: Mit einem weichen, 1 cm breiten Pinsel wurden 5 cm lange vertikale Bewegungen mit einer Frequenz von 2 Hz entlang der T2-T3-Dermatome durchgeführt. Die Reize wurden in zwei 30-SekundenIntervallen mit 10 Sekunden Pause appliziert. Danach bewerteten die Teilnehmenden: die wahrgenommene Intensität („überhaupt nicht intensiv“ bis „sehr intensiv“) und den empfundenen (Un)komfort („sehr angenehm“ bis „sehr unangenehm“) jeweils auf 9-Punkte-Skalen. Im aktiven tDCS-Zustand wurde eine 20-minütige anodale HD-tDCS über dem rechten postzentralen Gyrus (S1, Brodmann-Areal 3) durchgeführt. Die passende Elektrodenkonfiguration wurde mit der Software HD-Targets™ (https://soterixmedical.com/research/software/hd-targets) [90] berechnet. Es wurde ausschließlich anodale tDCS verwendet, um die kortikale Aktivität zu erhöhen. Abbildung 3 zeigt die Elektrodenanordnung und das durch HD-tDCS erzeugte elektrische Feld im Gehirn. Ringelektroden mit 1 cm Durchmesser und leitfähigem Gel wurden verwendet. Zur Vorbereitung wurde das Haar zur Seite gelegt und die Haut mit Wattestäbchen leicht aufgeraut. Im Schein-tDCS-Zustand wurde die gleiche Anordnung verwendet, die Stimulation jedoch nach 2 Minuten abgeschaltet – um identische Kopfhautwahrnehmungen wie bei aktiver Stimulation zu erzeugen, jedoch ohne tatsächlichen Effekt [91–95]. In beiden Bedingungen begann das Ergometertraining direkt mit Beginn der Stimulation. Die Teilnehmenden sollten mit 60 Umdrehungen pro Minute radeln, während die Belastung schrittweise erhöht wurde, bis eine Herzfrequenz von 150 bpm erreicht war. Die Herzfrequenz wurde mit einer Apple Watch Series 8 gemessen. Nach Erreichen der Ziel-HF wurde eine Minute lang bei konstanter Belastung weitergeradelt. Ziel dieser körperlichen Voraktivierung war es, die Stimulationseffekte zu verstärken – körperliche Aktivität mit HF > 150 bpm ist mit Insula-Aktivierung verbunden, die wiederum mit dem S1 zusammenarbeitet [39,96]. Da niedrigere Herzfrequenzen bei Belastung und schnellere Erholung nach Belastung mit höherer kardiovaskulärer Fitness zusammenhängen [97], erwarteten wir, dass fittere Teilnehmende länger brauchten, um 150 bpm zu erreichen, und sich danach schneller erholten. Der Post-Messzeitpunkt begann für alle Teilnehmenden exakt 12 Minuten nach Beginn der Stimulation. Dies ermöglichte, dass sowohl gut trainierte Personen die Zielherzfrequenz erreichten als auch untrainierte ausreichend Zeit zur Erholung hatten. Außerdem wurde damit sichergestellt, dass die Nachmessung während aktiver Stimulation erfolgte, gleichzeitig aber bereits Effekte der Stimulation auftreten konnten [50,51,60]. 2.3 Statistische Auswertung Die Daten wurden mit IBM SPSS Statistics Version 28.0.1.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) analysiert. Alle abhängigen Variablen wurden auf Ausreißer, Normalverteilung und Varianzhomogenität überprüft. Zweiseitige Tests wurden mit einem Signifikanzniveau von p < 0,05 durchgeführt. Die Interozeption wurde in drei Teilkomponenten getrennt analysiert: 1. Interozeptive Genauigkeit: – Herzschlag-Genauigkeit – Atemlast-Genauigkeit 2. Interozeptives Bewusstsein: – Vertrauen in die eigene Herz- und Atemwahrnehmung – Bewertung der Empfindungen auf den Dimensionen Valenz, Erregung und Angst 3. Interozeptive Sensibilität: – Trait-Interozeptive Bewusstheit (TIA) – State-Interozeptive Bewusstheit (SIA) Für die Analyse der interozeptiven Genauigkeit und des Bewusstseins wurde jeweils eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung durchgeführt: Faktor Zeit: vor vs. nach der tDCS Faktor Stimulation: aktiv vs. Schein Für die interozeptive Sensibilität wurde zusätzlich eine Multivariate Varianzanalyse (MANOVA) mit Messwiederholung durchgeführt, da hier mehrere Skalen simultan betrachtet wurden. Wurde in der MANOVA ein signifikanter Haupteffekt oder eine Interaktion gefunden, folgten post-hoc Einzel-ANOVAs mit Bonferroni-Korrektur. Die emotionale Bildbewertung wurde ebenfalls über eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung analysiert: Faktor Valenz des Bildes: positiv, neutral, negativ Faktor Stimulation: aktiv vs. Schein Zur Überprüfung der tDCS-Effektivität auf taktile Reize wurden zwei ANOVAs mit Messwiederholung (Intensität und Unkomfort) gerechnet, mit denselben Faktoren (Zeit × Stimulation). Die Stärke der körperlichen Aktivierung wurde über die Zeit zur Zielherzfrequenz (in Sekunden) und die Herzfrequenz-Erholung (HF-Wert 1 Minute nach Belastungsende) erfasst. Zusammenhänge mit interozeptiven Variablen wurden explorativ über Pearson-Korrelationen untersucht. Zur Abschätzung der Effektstärken wurden partielle Eta-Quadrate (η²ₚ) angegeben. Als Orientierung galten folgende Schwellenwerte [98]: η²ₚ ≈ 0,01 → kleiner Effekt η²ₚ ≈ 0,06 → mittlerer Effekt η²ₚ ≥ 0,14 → großer Effekt 3. Ergebnisse 3.1 Manipulationskontrolle: Effektivität der HD-tDCS-Stimulation Um zu überprüfen, ob die Stimulation über dem S1 wirksam war, wurden die Bewertungen taktiler Reize vor und nach der tDCS-Stimulation analysiert. Die ANOVA zeigte einen signifikanten Interaktionseffekt Zeit × Stimulation auf die wahrgenommene Intensität der taktilen Reize: F(1,35) = 5,01, p = 0,032, η²ₚ = 0,125 Post-hoc-Tests zeigten, dass nur in der aktiven tDCS-Bedingung ein signifikanter Anstieg der Intensitätsbewertung nach der Stimulation vorlag (p = 0,024), nicht jedoch in der Scheinbedingung (p = 0,639). Für die Bewertung des Unkomforts ergab sich kein signifikanter Interaktionseffekt: F(1,35) = 2,01, p = 0,165 → Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die HD-tDCS-Stimulation über dem rechten S1 erfolgreich die taktile Reizverarbeitung beeinflusste, was auf eine wirksame Stimulation hindeutet. 3.2 Interozeptive Genauigkeit Herzschlag-Wahrnehmung Für die Herzschlag-Genauigkeit ergab die ANOVA keinen signifikanten Haupteffekt der Zeit (F(1,35) = 1,62, p = 0,212) und keinen Haupteffekt der Stimulation (F(1,35) = 0,27, p = 0,609). Auch die Interaktion Zeit × Stimulation war nicht signifikant (F(1,35) = 1,91, p = 0,176). Atemlast-Wahrnehmung Analog zeigte die Analyse für die Atemlast-Wahrnehmung keine signifikanten Effekte: Zeit: F(1,35) = 1,49, p = 0,230 Stimulation: F(1,35) = 0,04, p = 0,849 Zeit × Stimulation: F(1,35) = 0,10, p = 0,754 → Keine signifikante Verbesserung der interozeptiven Genauigkeit durch HDtDCS. 3.3 Interozeptives Bewusstsein Vertrauen in die eigene Leistung Sowohl für die Herzschlag- als auch die Atemaufgabe zeigten sich keine signifikanten Effekte auf das Selbstvertrauen: Herz: alle p > 0,134 Atmung: alle p > 0,223 Emotionale Bewertung der Körperempfindungen Bei der Bewertung der Herzschlagwahrnehmung hinsichtlich Valenz, Erregung und Angst ergaben sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bedingungen oder Zeitpunkten (alle p > 0,094). Für die Atemaufgabe war der Effekt auf das Erregungsniveau grenzwertig (F(1,35) = 3,72, p = 0,062), jedoch nicht signifikant nach Bonferroni-Korrektur. → HD-tDCS beeinflusste das interozeptive Bewusstsein nicht signifikant. 3.4 Interozeptive Sensibilität Trait-Interozeptives Bewusstsein (TIA) Die MANOVA mit Messwiederholung für die TIA-Skalen ergab keine signifikanten Haupteffekte oder Interaktionen: Pillai’s Trace: F(6,30) = 1,12, p = 0,371 Einzelne Skalenanalyse zeigte lediglich einen deskriptiven Anstieg der wahrgenommenen Herzsensibilität nach aktiver Stimulation, jedoch keine Signifikanz (p > 0,1). State-Interozeptives Bewusstsein (SIA) Die MANOVA zu den momentanen Körperwahrnehmungen zeigte eine signifikante Interaktion Zeit × Stimulation: Pillai’s Trace: F(5,31) = 2,72, p = 0,038, η²ₚ = 0,305 Post-hoc-ANOVAs zeigten, dass insbesondere das Bewusstsein für den eigenen Herzschlag nach aktiver Stimulation signifikant zunahm (F(1,35) = 4,93, p = 0,033, η²ₚ = 0,123), nicht aber nach Schein-Stimulation. → HD-tDCS steigerte selektiv das momentane Bewusstsein für kardiale Interozeption. 3.5 Emotionale Bildbewertung Die emotionale Bewertung der IAPS-Bilder zeigte: Valenz: Erwartungsgemäß signifikante Unterschiede zwischen positiven, neutralen und negativen Bildern (F(2,70) = 221,19, p < 0,001) Erregung: Ebenfalls signifikante Unterschiede je nach Bildtyp (F(2,70) = 143,46, p < 0,001) Es gab jedoch keinen Haupteffekt der Stimulation und keine Interaktion mit dem Bildtyp (alle p > 0,16). → Die emotionale Reaktion auf affektive Bilder wurde durch HD-tDCS nicht verändert. 3.6 Korrelationen mit körperlicher Aktivierung Explorative Korrelationen zeigten keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Dauer bis zur Zielherzfrequenz oder der Herzfrequenz-Erholung mit interozeptiven Veränderungen (alle p > 0,05). 4. Diskussion In der vorliegenden Studie wurde erstmals untersucht, ob anodale HD-tDCS über dem rechten primären somatosensorischen Kortex (S1) die interozeptiven Fähigkeiten sowie die emotionale Verarbeitung beeinflussen kann. Zusätzlich wurde durch körperliche Aktivierung vor der Stimulation versucht, interozeptive Prozesse durch eine „bottom-up“-Modulation zu verstärken. Unsere zentrale Hypothese, dass die Stimulation die interozeptive Genauigkeit, das interozeptive Bewusstsein und die interozeptive Sensibilität verbessern würde, wurde nur teilweise bestätigt. Entgegen unserer Erwartungen führten HD-tDCS und körperliche Aktivierung nicht zu einer signifikanten Verbesserung der interozeptiven Genauigkeit oder des interozeptiven Bewusstseins. Es wurde jedoch eine signifikante Steigerung des momentanen Bewusstseins für den Herzschlag (State Interoceptive Awareness, SIA) nach der aktiven Stimulation festgestellt. Dies legt nahe, dass HD-tDCS zumindest kurzfristig in der Lage ist, kardiale Interozeptionsprozesse zu modulieren – wenn auch nur auf der subjektiven Ebene. Hinsichtlich der emotionalen Verarbeitung zeigte sich kein Effekt der Stimulation auf die Bewertung affektiver Bilder. Obwohl frühere Studien Verbindungen zwischen S1-Aktivität und emotionalem Erleben dokumentierten [45–47], konnte in unserer Untersuchung kein Einfluss der HD-tDCS über S1 auf affektive Reaktionen nachgewiesen werden. Dies könnte daran liegen, dass emotionale Bewertungen stärker durch höhere kortikale Netzwerke beeinflusst werden, insbesondere durch die Insula und präfrontale Strukturen [6,34]. Ein möglicher Grund für die ausbleibenden Effekte auf die interozeptive Genauigkeit und die emotionale Wahrnehmung könnte die limitiert fokale Wirkung von HDtDCS sein. Zwar erlaubt das Verfahren eine präzisere Stimulation als konventionelle tDCS, doch bleibt die tatsächliche neuronale Beeinflussung beschränkt. Zudem könnten interindividuelle Unterschiede in der Reagibilität auf tDCS die Wirkung abgeschwächt haben [91,92]. Ebenso ist denkbar, dass der Zeitraum der Nachmessung (innerhalb der 20-minütigen Stimulation) noch zu früh war, um volle Effekte zu beobachten – insbesondere im Vergleich zu Studien, die tDCS über mehrere Sitzungen hinweg anwenden. Die beobachtete Erhöhung des kardialen Bewusstseins nach aktiver tDCS deckt sich mit früheren Studien, die S1 mit kardialer Interozeption in Verbindung brachten [38,43]. Diese Befunde liefern erste Hinweise darauf, dass HD-tDCS über dem S1 geeignet sein könnte, subjektive Körperwahrnehmung im Bereich des Herzens kurzfristig zu verstärken. Trotz der Einschränkungen ist die vorliegende Studie von besonderem Wert, da sie: erstmals HD-tDCS über dem S1 zur Modulation interozeptiver und emotionaler Prozesse einsetzt, ein kombiniertes Protokoll aus körperlicher Aktivierung und Neurostimulation testet, und dabei mehrdimensionale Aspekte der Interozeption (Genauigkeit, Bewusstsein, Sensibilität) umfassend berücksichtigt. Zukünftige Studien sollten klären, inwieweit mehrfache HD-tDCS-Sitzungen nachhaltigere Effekte hervorrufen können. Zudem könnte eine gezieltere Kombination mit interozeptiven Trainingsprogrammen (z. B. achtsamkeitsbasiertes Training) das Potenzial zur Modulation körperbezogener Selbstwahrnehmung und emotionaler Regulation erhöhen. Auch die Erfassung neuronaler Veränderungen mittels bildgebender Verfahren könnte helfen, die genauen Wirkmechanismen zu verstehen. 5. Fazit Die vorliegende Studie stellt einen innovativen Ansatz zur Modulation interozeptiver Prozesse und emotionaler Verarbeitung durch anodale HD-tDCS über dem primären somatosensorischen Kortex (S1) in Kombination mit körperlicher Aktivierung dar. Obwohl die Intervention nicht zu signifikanten Verbesserungen in der interozeptiven Genauigkeit oder in der emotionalen Bewertung führte, konnte eine erhöhte kardiale interozeptive Sensibilität nach aktiver Stimulation festgestellt werden. Diese Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, dass HD-tDCS über dem S1 eine kurzfristige subjektive Steigerung der Körperwahrnehmung bewirken kann – speziell in Bezug auf Herzempfindungen. Die Ergebnisse unterstreichen die komplexe Beziehung zwischen Interozeption, Emotion und kortikaler Aktivität und legen nahe, dass gezielte Hirnstimulation ein vielversprechender, aber differenzierter Ansatz zur Modulation körperbezogener Wahrnehmungsprozesse sein kann. Weitere Studien sind notwendig, um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen und potenzielle klinische Anwendungen – etwa bei emotionalen Störungen mit interozeptivem Defizit – weiter zu erforschen.