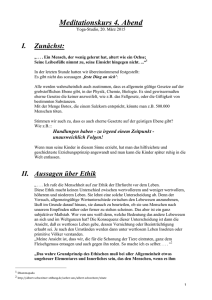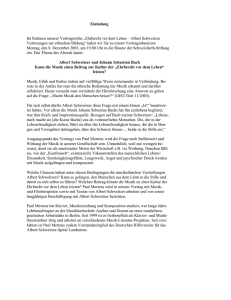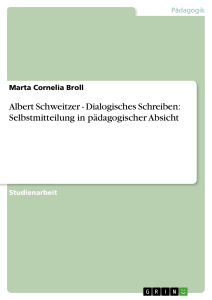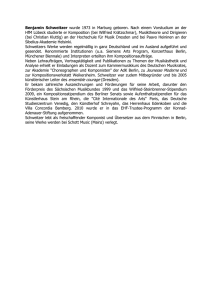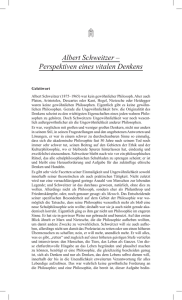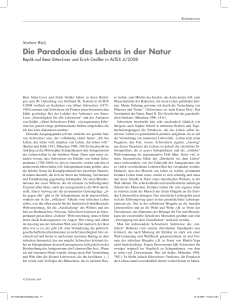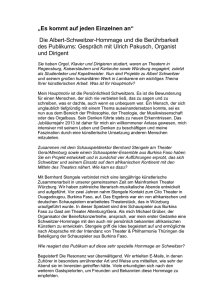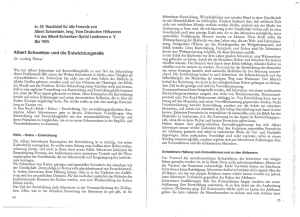Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Institut für Systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik Seminar [EvRel-MEd-GUG-S]: Bioethik. Überblick und Reflexion der Neuvermessung einer zentralen Disziplin der Gegenwart Dozent*in: Prof. Dr. theol. André Munzinger Wintersemester 2019/2020 Die Bedeutung des Begriffs „Leben“ in Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als Wegweiser für die Bioethik vorgelegt von Marek Kretschmann Matrikelnummer: 1021907 Master of Education: Biologie und Französisch (4. Fachsemester) Erweiterungsfach auf Masterebene: Ev. Religion (1. Fachsemester) Stadtfeldkamp 13 24114 Kiel E-Mail: [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ........................................................................................................... 1 2 Albert Schweitzer – eine Jahrhundertpersönlichkeit ....................... 2 2.1 Zur Biographie ................................................................................................ 2 2.2 Zum Werk ....................................................................................................... 3 3 Historischer und philosophischer Kontext Schweitzers ................... 5 4 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben................................................ 7 5 4.1 Die Grundzüge der Ehrfurchtsethik ........................................................... 8 4.2 Die Bedeutung des Lebensbegriffs ... Fehler! Textmarke nicht definiert. 4.2.1 Die verschiedenen Dimensionen des Begriffes „Leben“ ..................... 11 4.2.2 Der Begriff „Sein“ im Verhältnis zum Lebensbegriff .......................... 13 4.3 Der Wille zum Leben als Essenz der Ehrfurchtsethik ........................... 14 4.4 Lebensbejahung als Voraussetzung für die Ehrfurchtsethik ................ 17 4.5 Kritikpunkte an Schweitzer und seiner Ethik ......................................... 19 Schweitzer – ein Pionier der Bioethik? ................................................. 20 5.1 Eine Definition von Bioethik .................................................................... 20 5.2 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als Impuls für die Bioethik .. 21 6 Schlussbetrachtung und Ausblick .......................................................... 24 7 Literaturverzeichnis..................................................................................... 26 Einleitung 1 Einleitung Der Begriff des Lebens zeichnet sich durch seine Unbestimmtheit und seine große Assoziationsfähigkeit aus. Jede Person hat eine andere Wahrnehmung des Lebens und ein anderes Verständnis davon, was Leben bedeutet. Dadurch gewinnt der auf den ersten Blick vielleicht leicht verständliche Begriff an Tiefe, was es wiederum erschwert, ihn präzise zu definieren oder wenigstens zu umreißen. Das Leben bleibt damit geheimnisvoll und rätselhaft.1 Der Begriff „Leben“ spielt speziell für Albert Schweitzer in seinem ethischen Konzept der Ehrfurcht vor dem Leben eine besondere Rolle. Bereits seit seiner Kindheit hat er sich dafür eingesetzt, Leben zu schützen und die Menschen dazu aufzufordern, ihren Dienst an der Welt und seinen Geschöpfen zu leisten. In der vorliegenden Arbeit wird den Fragen nachgegangen, wie Schweitzer den Lebensbegriff in seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben versteht und inwieweit seine Vorstellung vom Leben und der rechte Umgang mit diesem als Wegweiser für die heutige Bioethik angesehen werden können. Zu Beginn wird sich mit der Biographie und dem Werk Schweitzers auseinandergesetzt. Der historische und philosophische Zeitkontext werden im Anschluss dargestellt, um das ethische Konzept der Ehrfurchtsethik besser verstehen zu können. Dieses wird zunächst in seinen Grundzügen präsentiert und erklärt, ehe sich dem unterschiedlichen Dimensionen der Begriffe „Leben“ und „Sein“ gewidmet wird. Angelehnt an Schweitzers Idee eines mehrstufigen Ethikkonzepts, werden hier aufbauend auf den Definitionen und Erklärungen zum Lebensbegriff der Wille zum Leben und seine Bedeutung dargelegt. Die Erläuterungen zur Lebensbejahung vertiefen dann die Vorstellung Schweitzers vom Leben sowie die inhaltliche Konzeption seiner Ethik. Das Kapitel endet mit kritischen Stimmen, die sich zu Schweitzer und der Ehrfurcht vor dem Leben äußern. Aufgegriffen werden einige der genannten Punkte im Kapitel zur Bioethik. Nach einer einführenden Definition wird der Mehrwert der Ehrfurchtsethik für den bioethischen Diskurs untersucht. In der Schlussbetrachtung werden die bisherigen Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick für weiterführende Arbeiten gegeben. Vgl. JURIĆ, HRVOJE, „From the Notion of Life to an Ethics of Life“, in: Synthesis Philosophica 59/1 (2015), 33-46, hier 33f. 1 1 Albert Schweitzer – eine Jahrhundertpersönlichkeit 2 Albert Schweitzer – eine Jahrhundertpersönlichkeit Albert Schweitzer kann zurecht als Jahrhundertpersönlichkeit bezeichnet werden, weil er durch sein Schaffen einen entscheidenden Beitrag zu den unterschiedlichsten Forschungszweigen leistete und sein Werk nach seinem Tod noch vielfach zitiert und diskutiert wird. 2.1 Zur Biographie Albert Schweitzer wurde 1875 als Sohn eines Pfarrers im Elsass geboren und wuchs in einem liberal geprägten protestantischen Pfarrhaus in Günsbach auf.2 1893 begann er nach dem Abitur sein Studium der evangelischen Theologie und Philosophie an der Universität Straßburg. Schwerpunkte seiner Arbeit und Studien bildeten die Leben-Jesu- und Paulusforschung. Er promovierte mit einer Arbeit über Immanuel Kants Religionsphilosophie zum Dr. phil. und arbeitete nach seiner Habilitation 1901 als Privatdozent und später Professor an der Theologischen Fakultät zu Straßburg.3 Nebenher befasste er sich mit der Musiktheorie, dem Orgelspiel und dem musikalischen Werk Johann Sebastian Bachs.4 Darüber hinaus fing Schweitzer ein Studium der Medizin an, welches er 1913 ebenfalls mit einer Promotion abschloss.5 Im gleichen Jahr bricht er nach 20 Jahren „intensivster theologischer, philosophischer und musik-wissenschaftlicher Studien zu dem großen Wagnis seines Lebens“6 auf. Zusammen mit seiner Frau Helene Bresslau begann er mitten im tropischen Urwald, in Lambaréné7 ein Hospital aufzubauen und dort als Arzt tätig zu werden.8 2 Vgl. OERMANN, NILS OLE, Albert Schweitzer, 1875-195. Eine Biographie, München 22010, 13f. 3 Vgl. ZAGER, WERNER, Art. „Schweitzer, Albert“, in: WiBiLex 2009/02 (PDF-Dokument, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/53957/), abgerufen am 15.07.2020, 1. 4 Vgl. ebenda. 5 Vgl. OERMANN (22010), „Schweitzer“, 97ff. 6 Siehe GRÄSSER, ERICH, Studien zu Albert Schweitzer. Herausgegeben von Andreas Mühling (BASF 6), Bodenheim 1997, 21. 7 Lambaréné ist eine Stadt im heutigen Gabun. 8 Schweitzers innere Überzeugung, Menschen helfen und dienen zu wollen und zu müssen, veranlasste ihn einen Ort zu suchen, an dem er seinem Willen zu einem rein-menschlichem Dienen ausleben und sich damit selbstverwirklichen konnte. „Das sollte da geschehen, wo es dringend nötig ist, wo man etwas dafür tun muß, Menschen zu einem menschlichen Leben zu verhelfen.“ Lambarene für ihn wurde damit zu einem Ort, der Raum für eine „Freiheit der helfenden Tat, Eigeninitiative und Selbstverantwortung“ schaffte, ohne durch jegliche Art von Behörden oder Institutionen des öffentlichen Lebens in seinem Handeln behindert zu werden. Vgl. Vgl. SPEAR, OTTO, Albert Schweitzers Ethik. Ihre Grundlinien in seinem Denken und Leben. Mit ausführlichem Literaturverzeichnis (EZS 80), Hamburg 1978, 43. 2 Albert Schweitzer – eine Jahrhundertpersönlichkeit Schweitzers weiteres Leben spielte sich fortan zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent ab: Immer wieder reiste er zwischen Europa und Afrika hin und her, um Konzerte und Vorträge zum Zweck der Geldbeschaffung für das Spital zu halten.9 In Lambarene wirkte er mehr als 30 Jahre. In dieser Zeit verfasste er sein größtes Werk, „Die Kulturphilosophie“, in der er sich in mehreren Bänden mit dem Verfall der Kultur auseinandersetzte und seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben formulierte.10 Sein praktisches Wirken in Afrika sowie seine wissenschaftlichen Beiträge brachten Albert Schweitzer weltweite Anerkennung und Auszeichnungen ein. Im Jahre 1953 wurde ihm für seinen humanitären Einsatz der Friedensnobelpreis verliehen.11 1965 starb er in Lambaréné und wurde dort neben seiner Frau beigesetzt. Schweitzer war ein Mensch, der aufgrund seiner vielen Facetten und Interessen das Bild des 20. Jahrhunderts als „Theologe, Philosoph und Prediger, als Tropenarzt, Bach-Forscher, Organist und Orgelbaufachmann, Baumeister, Entwicklungshelfer und Friedensmahner“12 prägte. 2.2 Zum Werk Das Werk Schweitzers ist aufgrund seiner vielfältigen Interessen sehr umfassend und breit aufgefächert. Bei Schweitzer treffen, wie bereits angedeutet, unterschiedlichste Bereiche der Geistes- und Naturwissenschaften, der Musik und der Theologie aufeinander, wodurch sich neue Anregungen für die jeweiligen Fachdisziplinen ergaben.13 Sein Hauptinteresse galt neben den Fremdreligionen Indiens und Chinas oder Goethes Werken, die er rezipierte und untersuchte, der Philosophie und Ethik.14 So flossen unter anderem unterschiedliche Aspekte des Jainismus15 und Vgl. ZAGER (2009), „Schweitzer“, 2. Vgl. OERMANN (22010), „Schweitzer“, 148-169. 11 Vgl. ZAGER (2009), „Schweitzer“, 2. 12 Siehe GÜNZLER, CARL, Albert Schweitzer: Einführung in sein Denken (BsR 1149), München 1996, 9. 13 Schweitzers Denken und Arbeit lösen damit die vorhandenen Grenzen zwischen unterschiedlichen Wissenschaften aus. Vgl. ebenda, 20ff.; 145f. 14 Vgl. ECK, STEFAN BERNHARD, Auf dem Prüfstand: Albert Schweitzer und die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, Herausgegeben von Arbeitskreis Tierrechte & Ethik, Saarbrücken 2002, 16. 15 Beim Jainismus handelt es sich um eine der drei großen Religionen Indiens. Ähnlich dem Buddhismus geht es bei dieser Heilslehre darum, „dem Menschen einen Weg aus dem unendlichen Kreislauf der Wiedergeburten aufzuzeigen“. Allerdings existieren hier unendliche viele Seelen, „die ewig sind und denen von Natur aus Erkenntnis und Vollkommenheit eigen sind.“ Diese stehen mit ihren Eigenschaften in verschiedenen Beziehungen zueinander und sind 9 10 3 Albert Schweitzer – eine Jahrhundertpersönlichkeit Buddhismus16 neben den Gedanken Schoppenhauers, Goethes und Nietzsches in die Entstehung der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ein, die er in seiner „Kulturphilosophie“ verschriftlichte.17 Er konzipierte dafür vier Bände mit weit mehr als 2000 Seiten, die sich jeweils mit einem anderen Schwerpunktthema auseinandersetzen. Ziel war es die gegenwärtigen Probleme der damaligen Zeit aufzuzeigen und entsprechende Lösungsansätze aufzuzeigen und zu illustrieren. Zu seinen Lebzeiten erschienen die ersten beiden Bände: „Kulturkritik: Verfall und Wiederaufbau der Kultur“ und „Kultur und Ethik: Ehrfurcht vor dem Leben“. Die verbliebenen Teile sollten die Titel „Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben“ und „Der Kulturstaat“ tragen, wobei die Ausarbeitung des letzteren nicht mehr begonnen wurde.18 Die einzelnen Bände der „Kulturphilosophie“ setzen sich wiederum aus unterschiedlichen Teilen zusammen und sind in größere Kapitel untergliedert. Dies ist dabei aber nicht auf einen inhaltlichen Sachzusammenhang, sondern auf die verschiedenen Entstehungsphasen zurückzuführen.19 In vielen Fällen sind es Neufassungen vorheriger Kapitel, die überarbeitet oder ergänzt wurden. Insgesamt kristallisiert sich bei Schweitzers Kulturphilosophie heraus, dass es ihm um eine tiefergreifende Veränderung der Kultur und Gesellschaft sowie des Menschen ging, weshalb er die zentrale Botschaft seiner Ehrfurcht vor dem Leben als ethischen Appell formulierte. 20 Mittelpunkt der spezifischen Karma-Lehre des Jainismus. Siehe DEEG, MAX, Art. „Jainismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 282f. 16 Die geistige Strömung des Buddhismus hat die Kultur und das Denken Asiens und der westlichen Welt mit ihrer Erlösungs- und Karma-Lehre geprägt. Teile dieser Lehre sind beispielsweise der „Edle achtfache Pfad“, der zum Nirvāna führt, und die vier „Edlen Wahrheiten“, die Grundeinsichten in das Wesen der Welt geben. Siehe DEEG, MAX, Art. „Buddhismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 86f.; Speziell die buddhistischen Ideale „der allumfassenden Güte, des Mitleids, der Mitfreude am Glück aller Lebewesen und des Gleichmutes, der aus dem Gefühl der Gleichheit erwächst“, waren für Schweitzer von Bedeutung. Vgl. ECK (2002), „Auf dem Prüfstand“, 16f. 17 Vgl. SCHWEITZER, ALBERT, Kulturphilosophie, Band I: Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Band II: Kultur und Ethik. Mit einem Nachwort von Claus Günzler, München 2007; Ders., Die Weltanschauung vor dem Leben. Kulturphilosophie III. und IV. Teil, Herausgegeben von Claus Günzler und Johann Zürcher, München 2000. 18 Vgl. ZAGER (2009), „Schweitzer“, 2. 19 Vgl. Ders., „Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben“. Einführung in den dritten Band der Kulturphilosophie von Albert Schweitzer, in: Ders. (Hg.), Ethik in den Weltreligionen: Judentum – Christentum – Islam (ThST 22), Neukirchen-Vluyn 2002, 95-108, hier 98. 20 Gleiches gilt für seine ethischen Predigten aus dem Jahre 1919, die sich bereits dem Grundprinzip seiner „Ehrfurcht vor dem Leben“ widmeten und mit den zentralen Ideen auseinandersetzen. Im Kern steht dabei „Du sollst Leben miterleben und Leben erhalten.“ Diese Aussage wird dahingehend erweitert, dass die Grenze der Unterscheidung zwischen Lebewesen aufgehoben werden soll und es daher gilt, alles Leben als solches wahrzunehmen und 4 Historischer und philosophischer Kontext Schweitzers 3 Historischer und philosophischer Kontext Schweitzers Um Schweitzers kulturkritisches Denken und Argumentieren besser nachvollziehen zu können, ist es notwendig, sowohl seinen kultur-historischen als auch philosophischen Zeitkontext genauer zu betrachten. Der Epochenumbruch vom 19. in das 20. Jahrhundert ging einher mit tiefgreifenden Veränderungen und Entwicklungen in der Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Literatur.21 Die technisch-industrielle Revolution des vorangegangenen Jahrhunderts bildete die Grundlage für die Veränderungen der elementaren Lebensgrundlagen und -verhältnissen in den Städten. Im Zuge dieser Revolution kam es zu einem in der europäischen Gesellschaft weit verbreiteten Fortschrittsoptimismus.22 Jedoch wurde das europäische Denken und Lebensgefühl aufgrund verschiedener Krisen wie dem 1. Weltkrieg oder wirtschaftlichen Notsituationen selbst in eine Krise gestürzt.23 Diese von führenden Persönlichkeiten ihrer jeweiligen Domäne, wie Philosophie oder Literatur, bezeichnete „Kulturkrise“ oder der „Kulturpessimismus“24 stehen im Widerspruch zum Fortschrittsgedanken und zeichnen sich durch die Erkenntnis aus, dass „die moralischen Fähigkeiten des Menschen mit seinen technischen Fertigkeiten nicht Schritt halten“ können.25 Man befand sich allgemein in einer „Atmosphäre der Auflehnung gegen erstarrte Formen“26. Schweitzers eigene Kritik zielt auf eine Veränderung der damaligen wertzuschätzen, was sich in einem dienlichem Verhalten und sorgsamen und verantwortlichen Umgang mit anderen ausdrückt. Vgl. SPEAR (1978), „Grundlinien“, 9f. 21 Vgl. NONN, CHRISTOPH, Das 19. und 20. Jahrhundert. Orientierung Geschichte (UTB 2942), Paderborn 22007, 13ff. 22 „Neben dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der in der gleichzeitigen Zunahme von Wissen und technischer Beherrschung der Natur besteht, soll sich der moralisch-politische Fortschritt in der Optimierung der sittlichen Anlagen des Menschen […] manifestieren.“ Siehe TESLAK, GERHILD, Art. „Fortschritt“, in: Handwörterbuch Philosophie (2003), 358. 23 Vgl. NONN (22007), „19. und 20. Jahrhundert“, 25ff. 24 Der Begriff des Kulturpessimismus meint die Abwendung von kulturellen Errungenschaften als dem Menschen zukommende Leistung, die es ihm gestattet, über seine Naturwesenhaftigkeit hinauszugelangen.“ Siehe PREUßNER, ANDREAS, Art. „Kultur“, in: Handwörterbuch Philosophie (2003), 438. 25 „Die Auffassung, dass die Kultur der Menschheit in allen Bereichen einen steten Fortschritt darstellt, fand schon früh ihre Kritiker. Dem Fortschrittsdenken, das durch den Glauben an die permanent wachsende Vervollkommnung der geistigen und sittlichen Fähigkeiten des Menschen geprägt ist und die Geschichte teleologisch interpretiert, stehen Theorien des Verfalls und zyklische Geschichtsbilder gegenüber.“ Siehe TESLAK (2003), „Fortschritt“, 358. 26 Diese Atmosphäre spiegelt sich in der Lebensphilosophie, „die völlig verbunden war mit und fundiert in einer metaphysischen Idee vom wahren Leben, das elementar, geheimnisvoll alles durchwaltet“, von verschiedenen Kunst- und Literaturschaffenden und Philosophen wider. Vgl. SPEAR (1978), „Grundlinien“, 12. 5 Historischer und philosophischer Kontext Schweitzers Kultur27 und damit verbunden der gesellschaftlichen Zustände ab.28 Die These seiner Zeitkritik war es, dass „ethisches Denken und Wollen ein Sichbestimmen-lassen durch ethische Ideale der Kern wahrer Kultur ist.“29 Sein philosophisches Denken und Argumentieren ist entscheidend von seinen Lehrern in Straßburg Theobald Ziegler, einem Vertreter des Historismus30 und Positivismus31, und Wilhelm Windelband, einem Wegbereiter des Neukantianismus und der Wertphilosophie32, geprägt worden.33 Durch den gedanklichen Austausch mit diesen Vorbilder entwickelte sich seine charakteristische Denkweise: pessimistisches Erkennen in Verbindung mit optimistischem Hoffen und Wollen.34 Er sieht im 1. Weltkrieg beispielsweise den Beweis für den Niedergang der menschlichen Kultur. Weiterhin beigetragen zu seiner Kulturkritik und skeptischen Haltung gegenüber der damaligen Gesellschaft haben die Philosophen Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant und „Kultur […] ist nach Schweitzer ,Fortschritt, materieller und geistiger Fortschritt der Einzelnen wie der Kollektivitäten. Kultur ist, wie Schweitzer ausführt ein Instrument des Menschen im Kampf ums Dasein, das dazu dient, den Selektionsdruck zu mindern.“ Siehe KÖRTNER, ULRICH, „Ehrfurcht vor dem Leben – Verantwortung für das Leben: Bedeutung und Problematik der Ethik Schweitzers“, in: ZThK 85/3 (1988), 329-348, hier 335. 28 „Die zeitkritischen Gedanken Schweitzers und Ideen, welche die Maßstäbe seiner Kritik sind, stehen in einer sehr positiven Beziehung zum Kulturwillen und ethischen Denken des 18. Jahrhunderts und besonders zu dessen Höhepunkten: dem Humanitätsgedanken, der Idee des andauernden Friedens und der Reich-Gottes-Idee der Religionsphilosophie Kants.“ Siehe SPEAR (1978), „Grundlinien“, 14. 29 Siehe ebenda, 49. 30 Als Historismus wird eine geisteswissenschaftliche Strömung bezeichnet, die sich mit der historischen Wirklichkeit als ein Ergebnis von Prozessen, Veränderungen und Entwicklungen befasst. „Zentral sind dabei […] die formulierten Kategorien der Individualität und der Entwicklung, die, zusammengenommen, die Menschheitsgeschichte als universelle Realisierung der Humanität verstehen lassen, in der dennoch jede Stufe eine unverwechselbare Selbstständigkeit besitzt.“ Siehe KAEGI, DOMINIC, Art. „Historismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 244. 31 Beim Positivismus handelt es sich um eine Überzeugung des erkenntnistheoretischen Grundsatzes des Faktischen und Nützlichen, der die Wissenschaft und ihre Beweisbarkeit als Prämisse hat und sich wissenschaftliche Methodik und Genauigkeit stützt. „Nützlich ist nur die Wissenschaft, die sich an die Tatsachen hält. Faktisches gibt den Bestimmungsgrund für Nützliches ab.“ Siehe PRECHTL, PETER, Art. „Positivismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 471 32 Bei dem Neukantianismus handelt es sich um eine philosophische Bewegung, die auf die transzendentale Logik und erkenntnistheoretischen Schriften Immanuel Kants beruft und sich der geltungstheoretischen Begründung der Geisteswissenschaften widmet. Ausschlaggebend war hierfür der Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Religion hinsichtlich der Unterscheidung und Gewichtung des Materiellen und Geistigen. Windelband teilte die Welt in zwei Bereiche ein, sodass Geistes- und Naturwissenschaft nicht mehr miteinander kollidieren, da sich die Methode der Erkenntnisgewinnung jeweils unterscheidet. Vgl. LEMBECK, KARLHEINZ, Art. „Neukantianismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 410f. 33 Vgl. GRÄSSER, ERICH, Albert Schweitzer als Theologe (BHTh 60), Tübingen 1979, 13f. 34 Vgl. ebenda, 16. 27 6 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Arthur Schopenhauer.35 Durch die Rezeption ihrer philosophischen Ansätze und Ideen gestaltete Schweitzer seine eigene Philosophie und theoretischen Konzepte weiter aus. So lässt er sich bei Schopenhauers Motiv des universalen Mitleids und Nietzsches Willensphilosophie inspirieren, um davon ausgehend seine Ideen und Überlegungen in ein eigenes ethisches36 Modell zu integrieren.37 Gleichzeitig äußert er an beiden Philosophen Kritik und versuchte durch seinen Ansatz, deren Modelle miteinander zu verbinden und fortzuführen.38 Schweitzers philosophischer Hintergrund lässt sich als das Ergebnis einer tiefergehenden Beschäftigung und Diskussion mit anderen Strömungen, Meinungen und Autoren auffassen. Das angestrebte Ziel war, eine Lösung für die Krise der Kultur zu finden. Diese fand er in dem von ihm neu formulierten ethischen Grundprinzip, das sich an wahrhaftigen und lebendigen Idealen orientiert und auf eine Gesinnungsänderung ausgerichtet ist.39 Hierfür müsse nach Schweitzer das Verhältnis des Menschen gegenüber anderen Kreaturen überdacht und überarbeitet und damit insgesamt die bisherige Weltanschauung des Menschen verändert werden. Als ausgearbeiteten Lösungsansatz präsentiert Schweitzer sein ethisches Konzept der „Ehrfurcht vor dem Leben“. 4 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Nachdem nun in Ansätzen der kultur-historische und philosophische Kontext, in dem Schweitzer lebte und wirkte, dargestellt worden ist, soll im nächsten Schritt seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben näher vorgestellt und ein Schwerpunkt auf seinen Lebensbegriff gelegt werden. Vgl. HÄRLE, WILFRIED, „Ehrfurcht vor dem Leben. Darstellung, Analyse und Kritik eines ethischen Programms“, in: MJTh 9 (1997), 55; „Methodisch bezieht er sich auf unübersehbar auf Kants vernunftkritischen Anspruch, inhaltlich hingegen auf Schopenhauers empirische Fundierung der Ethik.“ Siehe GÜNZLER (1996), „Einführung“, 59f. 36 „Ethik fragt nach Schweitzer nach der Möglichkeit einer Höherentwicklung und geistigen Vervollkommnung des Menschen. Sie ist ,die auf die innere Vollendung seiner Persönlichkeit gerichtete Tätigkeit des Menschen.‘“ Siehe KÖRTNER (1988), „Verantwortung für das Leben“, 335. 37 Vgl. KÖRTNER (1988), „Verantwortung“, 340f. 38 Vgl. ebenda, 143f.; Günzler meint in Schweitzer einen „Verfechter des nachmetaphysischen Denkens, der auf eine realitätsbezogene Ethik der Anerkennung fremder Lebensansprüche hinauswill und sich dabei auf Schopenhauers Modell des Vorrangs von Lebenswille und Leiberfahrung vor dem erkennenden Subjekt à la Kant beruft, zugleich aber dessen lebens- und weltverneinende Deutung des Seins ablehnt wie die der Brahmanen oder Buddhas,“ zu erkennen. Siehe GÜNZLER (1996), „Einführung“, 71. 39 Vgl. HÄRLE (1997), „Darstellung“, 56. 35 7 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben 4.1 Die Grundzüge der Ehrfurchtsethik Schweitzer bezeichnet die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als eine „elementare, unabweisbar Verwirklichung heischende Forderung menschlichen Lebens.“40 Ausgangspunkt für diese Forderung ist die individuelle Erfahrung.41 Bereits in Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend berichtet Schweitzer davon, dass er ein ausgesprochen großes Mitleid mit den Tieren hatte und versuchte, sie vor Unheil zu bewahren.42 Es handelt sich bei dieser Wahrnehmung der Welt um „eine grundlegende Werterfahrung, die in concreto, am einzelnen Lebewesen, gemacht wird und unmittelbar ins Normative hinein verallgemeinert und übertragen wird.“43 Eindrücklich beschreibt Schweitzer zudem die Begegnung mit einer Nilpferdherde auf einer Flussfahrt, die ihn zu seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben inspirierte.44 Durch dieses Erlebnis ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass Ethik, die sich nur auf das zwischenmenschliche Verhältnis konzentriert, unvollständig bliebe. Vielmehr müsse Ethik als die „extensiv und intensiv ins Grenzenlos gehende Verantwortlichkeit für alles in seinen Bereich tretende Leben“45 verstanden werden. Der Objektbereich der Ethik wird bei Schweitzer entsprechend seines Lebensbegriffs vergrößert. Auf diese Weise würde der Mensch zu einer neuen Einsicht und Haltung gelangen, die wiederum als Anlass zur Erneuerung des Individuums und der Kultur genommen werden könne.46 Zusammengefasst hat Vgl. SPEAR (1978), „Grundlinien“, 20. Schweitzers Ethikverständnis gründet nicht auf „rationale und auf Konsistenz bedachte Konstruktion“, sondern bekräftigt die ursprüngliche Erfahrung durch Erleben. Siehe HAUSKELLER, MICHAEL, „Verantwortung für alles Leben? Schweitzers Dilemma“, in: Ders. (Hg.), Ethik des Lebens, Albert Schweitzer als Philosoph (Die graue Reihe 46), Kunsterdingen 2006, 210-236, hier 213. 42 Ein markantes Beispiel hierfür ist das von Schweitzer beschriebene Gebet an Gott für alle lebendigen Wesen: „Lieber Gott, schütze und segne alles, was Odem hat, bewahre es vor allem Übel und laß es ruhig schlafen.“ Siehe SCHWEITZER, ALBERT, Die Ehrfurcht vor dem Leben. Grundtexte aus fünf Jahrzehnten. Herausgegeben von Hans Walter Bähr, München 82003, 13. 43 Entscheidend hierbei ist, dass die Leidensfähigkeit eines Lebewesens erkannt und daraus folgend die Verletzung oder Tötung als ungerecht bewertet wird. Siehe HAUSKELLER (2006), „Verantwortung“, 213f. 44 Schweitzer vergleicht diese Erfahrung mit einer Traumoffenbarung bzw. einem Geistesblitz. Vgl. SCHWEITZER (82003), „Grundtexte“, 20. 45 Vgl. SCHWEITZER (2007), „Kulturphilosophie I + II“, 305. 46 Vgl. SCHWEITZER (82003), „Grundtexte“, 21; Gansterer sieht in Beziehungsgeflecht der Begriffe „Ehrfurcht vor dem Leben“, „Humanität“, „Kultur“ und „Friede“ das zentrale Anliegen Schweitzers. Durch das Denken und Erleben des Willen zum Leben findet der Mensch zur Gesinnung der Ehrfurcht vor dem Leben, die es ihm ermöglicht, einerseits sich selbst als Individuum (Humanitätsgesinnung) und andererseits sich als Teil der Gesellschaft (Kulturgesinnung) ethisch zu vollenden und Prozesse der Veränderung anzustoßen, die letztendlich im friedlichen Miteinander zusammenkommen. Vgl. GANSTERER, GERHARD, Die 40 41 8 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Schweitzer seine Überlegungen in der folgenden Aussage: „Die fundamentale Tatsache des Bewußtseins des Menschen lautet: ,Ich bin leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.‘“47 Anhand dieses prägnanten Ausspruchs lassen sich die universale Dimension des Schweitzerschen Lebensbegriffs und der Kern seiner ethischen Gesinnung festmachen, indem er den natürlichen Dualismus zwischen Arten gewissermaßen gleichsetzt. Jedes Lebewesen ist wertvoll hat seine Berechtigung zu leben, die sich im Willen zum Leben manifestiert. Die Koexistenz des Individuums mit der Fülle an unterschiedlichen Lebewesen auf der Welt und die Kollision ihrer Interessen stehen über der Unterscheidung und Hierarchisierung von Lebensformen. Das Interesse jedes einzelnen Lebewesens, das einer Pflanze wie das eines Tieres, habe dabei den gleichen Wert.48 „Ethisch ist er [der Mensch] nur, wenn ihm das Leben als solches heilig ist, das der Menschen und das aller Kreatur.“ Der Begriff der „Ehrfurcht“ spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. Schweitzers Verständnis von Ehrfurcht spiegelt das ambivalente Verhältnis des Menschen als moralisches Subjekt zur Natur und Welt dar. „Ehrfurcht ist ein haltungsethischer Begriff, der das Verantwortungssubjekt gegenüber der leidenden Welt in die richtige Haltung bringt, nämlich für die Übernahme tätiger Verantwortung motiviert zu sein.“49 Abgeleitet aus dem Schweitzerschen Ehrfurchtsbegriff und Ethikverständnis, ergibt sich das „Grundprinzip des Sittlichen“50, das als Handlungsmaxime genommen werden soll: „Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern; böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen.“51 Es wird schnell offensichtlich, dass diese Forderung schwer umsetzbar ist, weil das einzelne Leben immer abhängig Ehrfurcht vor dem Leben: die Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes Albert Schweitzers in der theologisch-ökologischen Diskussion (Forum interdisziplinäre Ethik 6), Frankfurt am Main 1997, 128. 47 Siehe ebenda. 48 Vgl. GRÄSSER (1997), „Studien“, 72. 49 Siehe BARANZKE, HEIKE, „Was Bedeutet ,Ehrfurcht‘ in Albert Schweitzers Verantwortungsethik? Eine Begriffsanalyse im Vergleich mit Schwantje, Kant, Goethe und Nietzsche“, in: Synthesis Philosophica 53/1 (2012), 7-29, hier 24f. 50 Vgl. SCHWEITZER (2007), „Kulturphilosophie I + II“, 308ff. 51 Diese Formulierung findet man in unterschiedlichen Erweiterungen in seinen Werken. Neben den zentralen Elementen des Lebenserhalts und seiner negativen Entsprechungen lässt sich beispielsweise die Ergänzung des Steigerns bzw. Schädigens des Lebens als Differenzierungsmöglichkeit in manchen Werken wiederfinden. Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 98f. 9 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben von anderem Leben ist und das Überleben des einen zwangsläufig mit dem Sterben des anderen einhergeht.52 Um diesen Einwand zu entkräften, versucht Schweitzer durch zusätzliche Erläuterungen seines „Grundprinzips des Sittlichen“, dem Menschen Handlungsoptionen aufzuzeigen. Diese haben jedoch zur Folge, dass es wieder zu einer Unterscheidung zwischen menschlichem und nicht-menschlichem Leben kommt: „Alles, was in ,der gewöhnlichen ethischen Bewertung des Verhaltens der Menschen zueinander als gut gilt‘, läßt sich „zurückführen auf materielle und geistige Erhaltung oder Förderung von Menschenleben und das Bestreben, es auf seinen höchsten Wert zu bringen.“53 Der höchste Wert ist dabei für nicht-menschliches Leben nur von geringer Relevanz. „Die Hingabe an das Ideal (universales Verantwortungsbewusstsein) und das Ergriffensein bis ins Innerste im Miterleben und Mitleiden mit einzelnen Menschen und Tieren wirken bei Schweitzer trotzdem zusammen.“54 Ehe sich vertiefend mit den zentralen Elementen der Ehrfurchtsethik, dem Willen zum Leben und der Lebensbejahung, befasst wird, ist notwendig, sich vor Augen zu halten, was Schweitzer überhaupt unter dem Begriff „Leben“ versteht und wie er ihn gebraucht. Im Folgenden wird deshalb versucht, die verschiedenen Dimensionen des Schweitzerschen Lebensbegriffs zu definieren. 4.2 Die Bedeutung des Lebensbegriffs Schweitzers Ausdrucksweise ist geprägt durch seine äußerst vielfältige Nutzung von Begriffen und Termini.55 Diese Terminologie erschwert jedoch an manchen Stellen, seinen Gedankengängen und Argumentationen folgen zu können, weil viele Ideen und Begriffe nicht hinreichend erläutert werden. Sie bleiben daher meist vage und unscharf in ihrer Bedeutung, was eine hermeneutische Interpretation vor grundlegende Probleme stellt.56 Für den Begriff „Leben“ gibt es Vgl. HAUSKELLER (2006), „Verantwortung“, 211f. Siehe SCHWEITZER (2007), „Kulturphilosophie I + II“, 308. 54 Spear thematisiert in diesem Abschnitt das Werk von Helmut Groos zu Schweitzers Ethik. Siehe SPEAR (1978), „Grundlinien“, 63. 55 Siehe hierfür Kapitel 4.1 „Die Unschärfe der Begrifflichkeit Schweitzers“ in GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 129-131. 56 Die Besonderheiten Schweitzers Terminologie lassen sich wie folgt zusammenfassen: „1. Schweitzer stellt sein antithetisches Denken häufig durch die Doppeldeutigkeit von zentralen Begriffen dar. Er belegt ein und denselben Begriff einmal mit einem negativen und ein andermal mit einem positiven Bedeutungsgehalt. […] 2. Im Gegenzug dazu besetzt Schweitzer ganz unterschiedliche Begriffe mit ein und demselben Inhalt. […] 3. Einmal als antithetisch definierte 52 53 10 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben beispielsweise keine eindeutige Definition seitens Schweitzers.57 Allerdings ist dies von ihm auch nicht beabsichtigt. Vielmehr möchte er „diese Dimension des Wunderbaren, das staunend machende Rätsel des Lebens“58 hervorheben. Charakteristisch für Schweitzers wissenschaftliche Arbeits- und Vorgehensweise ist die „problemgeschichtliche Perspektive“, wonach „die geschichtliche Selbstentfaltung eines Problems den unabdingbaren Schlüssel zu dessen Lösung darstelle.“59 4.2.1 Die verschiedenen Dimensionen des Begriffes „Leben“ Wenn Albert Schweitzer über das Leben spricht, begegnen einem eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe, die von ihm synonym verwendet werden: „Wesen“, „Geschöpfe“, „Kreatur“, „Lebewesen“ beziehungsweise „lebendige Wesen“ und „alles Leben“ stellen hier nur eine Auswahl dar.60 Er verwendet diese allgemeinen Umschreibungen, um aufzuzeigen, dass es sich um „alle Erscheinungsformen“ des Lebens handelt.61 Dadurch weitet er seinen Lebensbegriff gleichzeitig auf unterschiedliche Formen von Leben aus. Diese sind einander ebenbürtig und lassen sich hinsichtlich ihres Wertes durch bestimmte Kriterien nicht unterscheiden.62 Eine solche Unterscheidung hätte zur Folge, dass die Tötung und Vernichtung spezieller Arten oder Lebensformen, die als wertlos eingestuft werden, unter Umständen erlaubt und möglich sei. Laut Günzler differenziert Schweitzer aber zwei Ebenen von Leben, die jeweils von ihrem Kontext abhängig sind: Wenn Schweitzer über konkrete ethische Forderungen spricht, meint er damit das organische Leben mit dem Fokus auf Mensch und Tier, wohingegen das anorganische Leben bei der Beziehung Begriffe werden später aus ungeklärten Gründen inhaltlich wieder völlig gleichgesetzt.“ Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 132. 57 Vgl. ebenda, 74. 58 Mit der Dimension des Wunderbaren stellt Gansterer einen Bezug zwischen Schweitzer und Ronald Dworkin her. Nach Dworkin sind klar abgegrenzte Kriterien nicht ausschlaggebend dafür, ob ein Leben vom Mensch respektiert werden sollte. Als Begründung führt er den Aspekt der Heiligkeit des Schöpfungsprozesses an, der vom Menschen aufgrund seiner Unergründlichkeit und Bedeutung für das Leben geachtet werden sollte. Siehe ebenda, 279. 59 Siehe GÜNZLER (1996), „Einführung“, 11. 60 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 138f. 61 Dem Begriff „Leben“ wird je nach verwendetem Kontext ein neuer Sinn zugeschrieben. Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 103. 62 Damit bezieht Schweitzer sich sowohl auf die Unterscheidung zwischen menschlichem und nicht-menschlichen Leben als auch zwischen „primitiven“ und „höheren“ Völkern und Rassen. Vgl. SPEAR (1978), „Grundlinien“, 19. 11 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben zwischen Mensch und den natürlichen Phänomenen miteinbezogen wird.63 Dies bedeutet, dass in einer ethischen Anwendungs- oder Handlungssituation speziell die Menschen als „Wesen, denen die Fähigkeit eines überlegenden und zielbewussten Sich-Betätigens“64 zu eigen ist, angesprochen werden. Im Unterschied dazu wird der umfassende Lebensbegriff von Schweitzer in Situationen benutzt, in denen es nicht um konkrete Handlungsanweisungen, sondern um das abstrakte Konstrukt der Beziehung zwischen Leben, Welt und Wirklichkeit geht. Die Verwendung des Begriffs in seinem umfassenden Sinn von verschiedenen Lebensformen zielt auf die universale Dimension des Lebens ab. Für Schweitzer spielt diese Universalität eine besondere Rolle in der Argumentationsstruktur seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Ausgehend von den naturwissenschaftlichen Forschungs- und Kenntnisständen zur damaligen Zeit argumentiert Schweitzer wie folgt: „Der neuesten Forschung zufolge ist das vermeintlich nicht mehr Zerlegbare selber etwas Zusammengesetzes. […] Jedenfalls sind sie (die Atome) nicht einfach kleinste Teile von Materie, sondern von einer ihnen eigentümlichen Bewegung belebte Sinneseinheiten. Wir haben die Atome als Individuen anzusehen.“65 In der Konsequenz bedeutet dies, dass sowohl alles Organische wie der Mensch, Tiere und Pflanzen als auch alles Anorganische wie Atome und Moleküle lebendig ist. Auf diese Weise wird die Dimension der Universalität des Lebens erneut verdeutlicht.66 Eine Abgrenzung des Lebendigen von dem Toten wäre bei solch einer Argumentation nicht zielführend und möglich, da es in Schweitzers Augen keine tote Materie existiere. Der Bedeutungsgehalt des Begriffs „Leben“ würde weiterhin eingegrenzt werden. Schweitzer will aber gerade dies verhindern, um die bisherige Enge der Ethik der Hingebung zu überwinden, die er als einschränkend betrachtet.67 Vgl. GÜNZLER, CLAUS, „Ehrfurcht vor dem Leben – Albert Schweitzers Ethik als Grundimpuls für die Umwelterziehung“, in: Ders. et al., Ethik und Erziehung, Stuttgart 1988, 171-199, hier 189. 64 Vgl. SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 182. 65 Siehe ebenda, 231. 66 Vgl. KÖRTNER, ULRICH, „,Ehrfurcht vor dem Leben‘ – Zur Stellung der Ethik Albert Schweitzers in der ethischen Diskussion der Gegenwart“, in: Angela Berlis et al. (Hgg.), Albert Schweitzer: Facetten einer Jahrhundertgestalt Berner Universitätsschriften 59), Bern 2013, 99136, hier 102. 67 Vgl. HÄRLE (1997), „Darstellung“, 74. 63 12 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Ebenso vergleicht er „Leben“ und „Kräfte“ miteinander: „Auch das, was wir als Materie bezeichnen, bleibt uns etwas Rätselhaftes. Wir wissen nur, daß es etwas in Raum und Zeit Gegebenes und eine Äußerung von Kräften ist.“68 Für Härle kommt es nun zu einem Interpretationsproblem. Wenn das „Leben“ unterschiedlichen „Kräften“ entspricht, ändert sich damit die Ausrichtung Schweitzers Ethik, deren Ziel es ist, Leben durch Hingabe zu erhalten. Bei einer Gleichsetzung der Begriffe würde der Fokus der Hingabe sich erweitern und praktisch jede Art von Kraft und Energie einbeziehen und als erhaltenswert betrachten. Damit würde „der Lebensbegriff kein universaler, sondern ein seinerseits begrenzter und in Richtung universale Hingebung an das Sein zu transzendierender Begriff“69 sein. Allerdings ist davon auszugehen, dass eine solche Interpretation seiner Aussagen von Schweitzer nicht intendiert war, sondern für ihn der Lebensbegriff in Koexistenz mit seinem Seinsbegriff zu stehen hat, und damit die universale Dimension von größerer Bedeutung ist.70 4.2.2 Der Begriff „Sein“ im Verhältnis zum Lebensbegriff Durch die Universalisierung des Lebensbegriffes verwischt die Grenze zum Seinsbegriff und es wird dadurch schwieriger, diese beiden Ausdrücke voneinander zu unterscheiden. Deshalb stellt sich die Frage, ob die Begriffe des Lebens und Seins äquivalent zueinander sind und deshalb gleichgesetzt werden können.71 Schweitzer beschreibt das Sein wie folgt: „Das Sein tritt in belebten Seinseinheiten in Erscheinung“.72 Für Schweitzer setzt sich das Sein also aus verschiedenen Komponenten zusammen, die jeweils leben können, weil er weiterhin sagt, dass es unterschiedliche Zustände von Sein gibt.73 In Bezug auf die bereits dargestellten Ebenen des Lebensbegriffes Schweitzers lässt sich bei dieser Definition des Seins eine Verbindung zur zweiten Ebene herstellen, bei der das Organische und das Anorganische miteinbezogen werden.74 „Da wir nun Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 38. Vgl. HÄRLE (1997), „Darstellung“, 75. 70 Vgl. ebenda. 71 Vgl. ebenda, 74. 72 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 232. 73 Vgl. ebenda. 74 Auffallend ist, dass der angesprochene Bereich des Anorganischen nur selten von Schweitzer in seinen Ausführungen berücksichtigt wird. Aber auch wenn der „Bereich des NichtLebendigen in Schweitzers Ethik keine nennenswerte Rolle spielt, will er sich offenbar die 68 69 13 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben für uns selber zugleich immaterielles (geistiges) und materielles Sein sind, ist es uns etwas Natürliches anzunehmen, dementsprechend auch von allem anderen Sein anzunehmen, dass es etwas Immaterielles sei, das als etwas Materielles in Erscheinung trete.“75 Folglich muss auf den Kontext geachtet, in dem Schweitzer die Ausdrücke „Sein“ und „Leben“ verwendet, weil das Sein ebenfalls auf zweierlei Weise unterschieden werden kann. „Alles Sein ist Leben, nur dass es in näherer oder entfernterer Analogie mit dem in mir vorhandenen ist.“76 Das Sein kann in diesem Fall mit dem Leben gleichgesetzt werden, wobei hervorzuheben ist, dass es unterschiedliche Einheiten gibt, die aber zueinander in Bezug gesetzt werden müssen. Gansterer beschreibt diese Ebene als „das Gesamt der sichtbaren Wirklichkeit“77. Schweitzer macht aber noch weitere Ebene auf: „Unser Sein ist in naturhafter Weise in dem unendlichen Sein enthalten.“78 Er ordnet folglich das sichtbare Sein einer weiteren Kategorie von Sein unter, die umfassender aber auch vager erscheint. Gansterer meint dazu, dass Schweitzer versucht, „eine Wirklichkeit zu umschreiben, die hinter der Welt des Sichtbaren verborgen scheint.“ 79 In solch einem Kontext ist es nun fraglich, ob man „Leben“ und „Sein“ noch äquivalent zueinander gebrauchen kann, weil eine Ebene der Seinsbestimmung hinzukommt, die übergeordnet und umgreifender ist und damit der Bedeutungsgehalt des Begriffs „Leben“ überstiegen wird. 4.3 Der Wille zum Leben als Essenz der Ehrfurchtsethik Bisher wurde sich noch nicht der Frage gewidmet, wie man zu der beschriebenen Erfahrung bzw. der Ehrfurcht vor dem Leben gelangt, um dann übereinstimmend mit dem „Grundprinzip des Sittlichen“ sich in seiner Umwelt ethisch korrekt zu verhalten. Eine Antwort besteht in dem Erkennen und Erleben des eigenen Möglichkeit einer Ausweitung der Ethik in diese Richtung offenhalten.“ Vgl. GÜNZLER (1988), „Grundimpuls“, 190. 75 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 38; Es ist anzumerken, dass in diesem Fall „materiell“ und „immateriell“ beziehungsweise „organisch“ und „anorganisch“ mit „belebt“ und „unbelebt“ korrelieren und dadurch die „Austauschbarkeit“ der Begriffe zustande kommt Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 104. 76 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 373. 77 Als Argument bringt Gansterer ein Zitat Schweitzers an, wonach das Ergriffensein vom Willen zum Leben als Ausdrucksform der Ehrfurcht vor dem Leben sich auf dem Sein gründet. Siehe GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 105. 78 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 232. 79 Siehe GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 105. 14 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Willen zum Leben und desjenigen, der einem in anderen Lebewesen begegnet: „Ich bin leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“80 Der Wille zum Leben wird von Schweitzer aufgrund seiner elementaren Bedeutung in den Vordergrund seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben gerückt und sein Lebensbegriff folglich konkretisiert: „Wir sind nicht nur Leben, sondern Wille zum Leben.“81 Daraus leitet sich eine sich bedingende Folge ab: Alles, was lebt, hat den Willen zu leben und umgekehrt lebt alles, was den Willen zum Leben in sich trägt. „Der Trieb, unser Leben zu erleben und auszuleben, gehört zu unserem Wesen.“82 Dieser Wille ist damit ein ureigener und essentieller Bestandteil, über den Menschen, Tiere und Pflanzen als Lebewesen verfügen.83 Man könnte den Willen zum Leben auch als eine Art von Instinkt beschrieben, die das Verhalten der Lebewesen zunächst unterbewusst steuert.84 Sie haben zwar ein Bedürfnis danach, sich ausleben, was ihnen bereits von Anfang gegeben ist. Das bedeutet, dass man nicht nur sein möchte, sondern auch am Leben bleiben möchte.85 Diesen Wunsch nach Leben kann ein Lebewesen auf der einen Seite aber nur durch das Erleben des Willens zum Leben bestätigen, woraus sich dann eine Erfahrung entwickelt.86 Auf der anderen Seite ist mit Wunsch nach Leben zwangsläufig wieder der Tod anderer Lebewesen verbunden.87 Schweitzer ist diese unumgängliche Tatsache durchaus bewusst und gibt daher als Handlungsimpuls, die unterschiedlichen Umstände und Alternativen voneinander abzuwägen.88 „Die Grunderfahrung der Ehrfurcht vor dem Leben ist das Erleben eines in uns und anderen Lebewesen wirksamen universalen Willens zum Leben.“ Siehe KÖRTNER (1988), „Verantwortung für das Leben“, 337. 81 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 31. 82 Siehe ebenda. 83 Der Wille zum Überleben eignet sich hingegen nur bedingt für einen Vergleich, weil das Konkurrenzdenken stärker betont wird, welches wiederum eine Unterscheidung zwischen den Lebewesen forciert. Vgl. Siehe KÖRTNER (1988), „Verantwortung für das Leben“, 341f. 84 Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 96. 85 Vgl. KÖRTNER (1988), „Verantwortung für das Leben“, 340f. 86 Vgl. ebenda, 342f. 87 „Denn Leben beruhe ja immer auf Vernichtung, dergestalt, daß alles Lebendige vom Tod anderer Lebewesen lebe, so daß immer, wenn wir Leben bewahren und fördern, wir damit unweigerlich dazu beitragen, daß anderes Leben gehemmt und vernichtet wird – durch jenes Leben nämlich, das wir bewahrt haben.“ Siehe SCHNEIDER, MANUEL, „Über Leben und Tod – zur konvivialen Ethik Albert Schweitzers“, in Günter Altner et al. (Hgg.), Leben inmitten von Leben. Die Aktualität der Ethik Albert Schweitzers, Stuttgart 2005, 15-26. hier 19. 88 Vgl. HAUSKELLER (2006), „Verantwortung“, 12f.; 20ff. 80 15 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben „Von unserem Lebenwollen aus verstehen wir das Leben um uns herum als Lebenwollen und das Sein der Welt als Seinwollen.“89 Zwei unterschiedliche Perspektiven werden dieser Erfahrung zum Ausdruck gebracht: die Erfahrung in einem selbst als Selbstreferenz und die Erfahrung um mich herum als Referenz der Wirklichkeit.90 Man überträgt dafür den eigenen Willen, den man selbst erlebt hat und achtet, auf andere Lebewesen und nimmt an, dass sie auf die gleiche Weise den Willen zum Leben erleben und sich auch verwirklichen wollen. „Zum völligen Erleben unseres Daseins gehört das Sich-Ausleben in dem Heraustreten aus uns selbst.“91 Man muss dafür, wie von Schweitzer beschrieben, über seine eigene Individualität hinausgehen und seine Beziehung zu anderem Leben begreifen und analog dazu den Willen zum Leben in anderen Lebewesen genauso behandeln und wertschätzen wie man es mit seinem persönlichen Willen zum Leben tut.92 Durch diesen Vorgang der Übertragung entwickelt sich das ethische Programm der „Ehrfurcht vor dem Leben“, nämlich die gleiche Behandlung und der gleiche Respekt gegenüber allen Lebewesen, weil das Leben in seinen verschiedenen Formen als ebenwürdig bewertet werden sollte.93 Schweitzer spricht dabei von einer gewissen „Nötigung, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen“, wenn seine ihm gegebenen Fähigkeiten anwendet.94 Die Erfahrung des Willen zum Leben, die als „unmittelbar“, „natürlich“, „intuitiv“ und „unbewusst“ in der Literatur beschrieben wird, kann aber nur durch den Prozess des Denkens und sich Auseinandersetzens mit dem Willen und dem Erkennen des Willen erzielt werden.95 Erreicht wird dies nur, wenn alle Kräfte und Fähigkeiten des Menschen miteinbezogen werden.96 Die Fähigkeit zu Denken ist bei Schweitzer das Ergebnis des Strebens von Lebewesen nach materieller und geistiger Vervollkommnung. Speziell dem Menschen als ethisch Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 31. Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 88. 91 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 182. 92 Vgl. LENK, HANS, Albert Schweitzer – Ethik als konkrete Humanität (Forum Humanität und Ethik 1), Münster 2000, 14. 93 Vgl. ebenda; GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 90f. 94 Vgl. ebenda, 96f; Vgl. KÖRTNER (1988), „Verantwortung für das Leben“, 338. 95 Vgl. ECKER, MANFRED, „Evolution und Ethik. Der Begriff der Denknotwendigkeit in Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben“, in: Claus Günzler et al. (Hgg.), Albert Schweitzer heute. Brennpunkte seines Denkens (BASF 1), Tübingen 1990, 51-81, hier 59. 96 Vgl. MÜLLER, CHRISTIAN, „Albert Schweitzers ethische Mystik der Ehrfurcht vor dem Leben“, in IZPP 1 (2010), 1-11, hier 1. 89 90 16 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben handelndes Lebewesen ist sie eigen.97 Daneben existieren weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die neben dem Mensch auch in Tieren Gestalt annehmen können und dementsprechend spezifisch und vielfältig sein können. Schweitzer schränkt aber ein: „Es ist nicht so, dass wir die Ideen, von denen wir leben und nach denen wir unser Leben gestalten wollen, erst im Denken entdecken. Sie sind in unserem Willen zum Leben gegeben. Wir tragen sie in uns. Im Denken tun wir nichts anderes, als dass wir von ihnen völlig Kenntnis nehmen und sie zu klären, zu entwickeln und zu vertiefen suchen.“98 Das Denken fungiert folglich als ein Hilfsmittel zum Erkennen des Lebenswillen und zur Ausgestaltung des Lebens. Das Erkennen des Willens zum Leben wandelt sich in das Erleben des Willens zum Leben um und wird deshalb auch als „denkendes oder erkennendes Erleben“ bezeichnet.99 Entscheidend hierfür ist, dass der Wille zum Leben aktiv bejaht wird, um vom Menschen bewusst wahrgenommen und erlebt werden zu können. 100 4.4 Lebensbejahung als Voraussetzung für die Ehrfurchtsethik Die aktive Lebensbejahung wird „durch das Bemühen, sich mit all seinen Gemütskräften auf das ihn umgebende Leben einzulassen“101 erreicht. Ansonsten könne der Wille zum Leben nicht realisiert werden bzw. würde verfallen. Dies wiederum würde bedeuten, dass das Leben selbst sein Sinn verliert und somit nichtig wird.102 „Das Leben ist [aber] die fundamentale Gegebenheit. Wir besitzen das Leben nicht, um uns davon abzuwenden oder es wegzuwerfen, sondern um es zu bejahen.“103 Schließlich ist aus unerklärlichen Gründen den Lebewesen der Wille zum Leben gegeben, die ihn bejahen und sich selbst dadurch als Teil der Welt bestätigen. Die Bejahung des Lebens ist damit integrativer Bestandteil der Ehrfurcht vor dem Leben. Wie bereits beschrieben, geht es dabei um die gleiche Wertschätzung von allem Leben und der daraus resultierenden gleichen Behandlung Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 90f. Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 27. 99 Vgl. GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 90. 100 Vgl. ebenda, 96. 101 Siehe MÜLLER (2010), „Mystik“, 3. 102 „Mein Leben trägt einen Sinn in sich selber. Er liegt darin, daß ich die höchste Idee lebe, die in meinem Willen zum Leben auftritt […] die Idee der Ehrfurcht vor dem Leben. Daraufhin gebe ich meinem Leben und allem Willen zum Leben, der mich umgibt, einen Wert, halt mich zum Wirken an und schaffe Werte.“ Siehe SCHWEITZER (2007), „Kulturphilosophie I + II“, 82. 103 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 377. 97 98 17 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben aller Lebewesen durch die „durch das Denken bewusst gemachte Anerkennung des vorrationalen Dranges zum Leben, den der Menschen in sich und außerhalb seiner selbst staunend beobachten oder miterleben kann.“104 Diese Theorie muss allerdings in die Praxis umgesetzt werden: „Lebens- und Weltbejahung kann nicht ohne Wirken sein. Weil wir unser Leben und anderes Leben als etwas an sich Wertvolles ansehen, vermögen wir nicht dabei zu verbleiben, nur so für uns dahinzuleben, sondern wir empfinden die Nötigung, die besten materiellen und geistigen Daseinsmöglichkeiten für uns und das andere Leben, das sich in dem Bereiche unserer Betätigung findet, zu schaffen.“105 Auf diese Weise wird dem Leben die Chance zur Selbstvervollkommnung gegeben, indem man sein Leben als Hingabe zu anderem Leben betrachtet und dadurch eins mit demjenigen wird.106 Im Endeffekt bedeutet diese Hingabe eine Selbstbejahung des eigenen Lebens. Auf dieser Idee aufbauend muss im Umkehrschluss das Leben aller anderen Wesen bejaht werden, wodurch alle Lebewesen nebeneinander auf die gleiche Stufe gestellt werden müssen.107 Schweitzer formuliert dies so: „Denn nun stellt sich die Frage, ob nicht auch eine Wesensverwandtschaft zwischen dem Menschen und den Geschöpfen bestehe. Sie zu bejahen und die Folgerung, dass es ethische Pflichten allen lebendigen Wesen gegenüber anzuerkennen hat, ist ein unvermeidbares Wagnis.“108 Dieses Wagnis steht für eine neue Möglichkeit der Betrachtung des Lebens und der Welt. Denn „die Natur bejaht das Leben als solches. Die Individuen kommen für sie nur als Repräsentanten des Lebens in Betracht.“109 Die geistige Verbundenheit aller Lebewesen muss erkannt, bejaht und erhalten werden, sodass eine Einheit aus individuellem und universellem Willen zum Leben entstehen kann.110 Eine Hierarchisierung von unterschiedlichen Werten, das Vorgeben von bestimmten Regeln oder Handlungsanweisungen seien nach Schweitzer nicht notwendig, um das leitende ethische Prinzip mit der Siehe GANSTERER (1997), „Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes“, 92. Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 31. 106 Vgl. NEUENSCHWANDER, ULRICH, Ethik der Lebensbejahung, in: Claus Günzler et al. (Hgg.), Albert Schweitzer heute. Brennpunkte seines Denkens (BASF 1), Tübingen 1990, 9-17, hier 14. 107 Diese Art der Begründung ist nach Günzler zwar nicht „denknotwendig“, aber doch „folgerichtig“. Vgl. GÜNZLER (1996), „Einführung“, 118. 108 Siehe SCHWEITZER (2000), „Kulturphilosophie III“, 139. 109 Siehe ebenda, 44. 110 Vgl. MÜLLER (2010), „Mystik“, 6. 104 105 18 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Lebenswirklichkeit zu vermitteln.111 Er setzt sein Vertrauen vielmehr in das verantwortungsbewusste Denken und Handeln des einzelnen Individuums, das sich selbst bejaht und sich dadurch ethisch verhält: „Dieses muß entscheiden, wie es seine konkrete Verantwortung unter dem Anspruch des Prinzips zu realisieren hat; normative Subsysteme können ihm dabei nicht helfen, ja würden die Verantwortung eher entschärfen.“112 4.5 Kritikpunkte an Schweitzer und seiner Ethik Wenn sich näher mit der Rezeption von Schweitzers Ethikkonzept in der akademischen Forschung befasst wird, fällt schnell auf, dass die Ehrfurcht vor dem Leben „weder zur moralischen Orientierung tauge, noch sich überhaupt in die Tat umsetzen lasse.“113 Von vielen wird diese fehlende Umsetzbarkeit und nicht vorhandenen konkreten Handlungshinweise für die Lebenswelt vermisst und bemängelt.114 Ebenso werden von Schweitzer „keine weiteren Urteilskriterien“ für Abwägungsprozesse in Konfliktsituationen genannt, sodass er „den ethischen Dauerkonflikt institutionalisiert.“115 Günzler charakterisiert die zentrale Schwäche der Ehrfurchtsethik, wie im Folgenden beschrieben wird: „Schweitzers im Letztbegründungsrationalismus verwurzelte Überzeugung, daß aus einem einzigen ethischen Prinzip heraus das gesamte Feld der sittlichen Entscheidungen zu erfassen sei, zeugt von einer verkürzten, weil rein naturphilosophischen Wahrnehmung der Realität und übersieht die soziale, vor allem die gesellschaftlich-institutionelle Wirklichkeit mit den ihr eigenen Konflikte.“116 Zudem wird Schweitzer angelastet, wenn es darum geht, Ehrfurcht vor dem nicht-menschlichen Leben zu empfinden, nicht unbedingt genau in der Ausführung zu sein. In Erinnerungen aus seiner Zeit in Lambaréné wird ersichtlich, dass das Töten von so mancher Tierart wie Spinne oder Leopard trotz fehlender Gründe nicht von Schweitzer missbilligt wird.117 Vgl. GÜNZLER (1996), „Einführung“, 129. Siehe ebenda. 113 Siehe HAUSKELLER (2006), „Verantwortung“, 210. 114 Insgesamt werden das Verständnis von Ethik im Sinne Schweitzers und sein „Grundprinzip des Sittlichen“ aufgrund widersprüchlicher Aussagen in Frage gestellt. Es kommt daher zu einer Dilemma: „Entweder wir wollen leben, dann müssen wir immer wieder das tun, was wir selbst als moralisch schlecht erkennen, oder aber wir wollen im Einklang mit Schweitzers Grundprinzip des Sittlichen handeln, dann können wir nicht leben.“ Vgl. ebenda, 210ff. 115 Siehe KÖRTNER (1988), „Verantwortung“, 343. 116 Siehe GÜNZLER (1996), „Einführung“, 129. 117 Siehe SCHWEITZER, ALBERT, Selbstzeugnisse. Aus meiner Kindheit und Jugend. Zwischen Wasser und Urwald. Briefe aus Lambarene, München 81988, 89; Es darf aber nicht vergessen 111 112 19 Schweitzer – ein Pionier der Bioethik? Schweitzer geht es konkret aber nicht darum vorzugeben, wie seine Ethik im alltäglichen Leben umgesetzt werden soll. Diese Fragestellung ist zunächst zweitrangig. Wichtiger ist für ihn die Frage nach den allgemeinen Ideen und Prinzipien zu stellen, die unser Denken und Handeln bestimmen.118 Hinzu kommt, dass für Schweitzer das erlebende Denken im Vordergrund steht. An dieser Stelle setzt dann seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben an, die als ethische Gesinnung das Handeln des einzelnen Menschen beeinflussen kann.119 5 Schweitzer – ein Pionier der Bioethik? Bevor der mögliche Mehrwert des Schweitzerschen Lebensbegriff und damit verbunden der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben für die Bioethik als Disziplin herausgestellt werden kann, muss zunächst geklärt werden, was unter dem Begriff der Bioethik zu verstehen ist. 5.1 Eine Definition von Bioethik Unter Bioethik ist die wissenschaftliche Analyse und Bewertung vom Umgang mit Leben.120 „Das thematische Spektrum der Bioethik erstreckt sich über das gesamte semantische Feld des Begriffs ,Leben‘“121, weshalb sie in verschiedene Disziplinen wie Tier- oder Naturethik zu untergliedern ist. Zurückzuführen ist die Bioethik auf die Hauptströmungen der zeitgenössischen Moralphilosophie, die da wären: „die Tugendethik, die deontologische bzw. kantianische Ethik und der Konsequentialismus.“122 Heutige Entwicklungen neigen dazu, Teile der werden, dass Schweitzer selbst nur ein Mensch ist. Er warnt davor, die Entscheidungen anderer Menschen zu verurteilen, nur weil man in der konkreten Situation anders gehandelt hätte. Die eigene Entscheidung müsse vor sich selbst gerechtfertigt werden können. Vgl. HAUSKELLER (2006), „Verantwortung“, 222f. 118 „Ethische Prinzipien können, auch wenn sie später Einfluss auf die Praxis haben sollen, nicht schon bei ihrer Bildung Rücksicht auf die Praxis nehmen. Man darf nicht vom Machbaren ausgehen und anhand dessen ableiten, was gut ist.“ Siehe Vgl. HAUSKELLER (2006), „Verantwortung“, 212. 119 Vgl. JURIĆ (2015), „Notion of Life“, 39f. 120 Der etymologische Hintergrund von „Bioethik“ ist für ihr allgemeines Verständnis durchaus relevant. Leben wurden von den Griechen mit zwei unterschiedlichen Termini beschrieben: βίος und ζωή. Letzter bezieht sich auf allgemein Lebendiges und Lebewesen, wohingegen der erste den Menschen und seine Lebensweise charakterisiert. Die heutige Bioethik würde demnach nur das menschliche Leben berücksichtigen, was in vielen Fällen zutrifft. Dieser Trend der Reduktion auf eine Ethik des βίος wird kritisiert und ein integrativer Ansatz bevorzugt. Vgl. ebenda, 34f. 121 Siehe STURMA, DIETER / HEINRICHS, BERND, „Bioethik – Hauptströmungen, Methoden und Disziplinen“, in Dies. (Hgg.) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE), Handbuch Bioethik, Stuttgart / Weimar 2015, 1-8, hier 1. 122 Diese drei Hauptmodelle nutzen jeweils unterschiedliche Begründungsformen, um ihre inhaltlichen Zielsetzungen zu erklären. Grob gesagt geht es der Tugendethik darum, den 20 Schweitzer – ein Pionier der Bioethik? verschiedenen Modelle zu neuen Theorien und Konzeptionen zusammenzuführen, da kein Ansatz an sich ausreiche, um Bioethik zufriedenstellend zu definieren.123 Die Diskussionen über bioethische Inhalte ziehen immer mehr das mediale und gesellschaftliche Interesse auf sich, weil Grundfragen des Lebens thematisiert werden, die für jede Person eine Relevanz besitzen. Durch den medizinischen und biotechnischen Fortschritt, der in den letzten Jahren gelungen ist, stellt sich nun die Frage nach der moralischen Bewertung solcher Möglichkeiten, speziell im Hinblick darauf, welchen Einfluss diese auf das Leben an sich haben und wie sie es verändern.124 5.2 Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als Impuls für die Bioethik Gerade in der heutigen Zeit, in der die Stimmen nach einem nachhaltigeren und sorgsameren Umgang mit der Natur und dem menschlichen Leben lauter werden, ist die Aktualität der Schweitzerschen Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben unbestritten.125 Sie bestätigt ihre Bedeutsamkeit, indem sie „die Grenzen des Wachstums und die global drohenden tödlichen Folgen der technisierten und anthropozentrischen modernen Zivilisation“126 wahrnimmt und auf sie überwindet. Denn gerade „das anthropozentrische Denken und seine tödlichen Folgen für Mensch und Natur“, das heutzutage immer noch stark den Umgang mit der Natur aus Gründen des eigenen Überlebens prägt, werden von Schweitzer eindeutig kritisiert.127 Trotz dessen wird Schweitzers Werk in der philosophischen Forschung und ethischen Debatten eher vernachlässigt, als dass es von Forschenden als Charakter des Menschen und seine Fähigkeiten und Kompetenzen zu bilden und zu fördern. Sie stellt die Frage „Wie werde ich gut?“. Im Gegensatz dazu kommt es bei deontologischen Ansätzen auf die gegenseitigen Verpflichtungen und moralischen Ansprüche an. Hier steht die Frage „Was soll ich tun?“ im Vordergrund, wohingegen im Konsequentialismus die Folgen des Handels stärker thematisiert werden. Vgl. STURMA / HEINRICHS (2015), „Bioethik“, 2f. 123 Beauchamp und Childress haben in ihrem Werk zur Medizinethik einen anerkannten Theorieansatz auf der Basis der vorgestellten moralphilosophischen Hauptströmungen formuliert. Dabei sind die von ihnen genannten Prinzipien „Autonomie“, „Wohltun bzw. Fürsorge“, „Nichtschaden“ und „Gerechtigkeit“ besonders hervorzuheben. Vgl. BEAUCHAMP, TOM L. / CHILDRESS, JAMES, F., Principles of Biomedical Ethics. Oxford 52001, 12ff. 124 Vgl. DABROCK, PETER, „Bioethik des Menschen“, in: Wolfgang Huber et al. (Hgg.), Handbuch der Evangelischen Ethik, München 2015, 517-583, hier 519. 125 „Die Förderung der Ehrfurcht vor dem Leben muss zu einem der Hauptelemente der globalen Ethik zählen. Ohne das denkende Bewusstsein, dass wir Leben sind, das auf Kosten des anderen existiert, kann sich keine Verantwortung für die Zukunft entwickeln.“ Siehe GLOBOKAR, ROMAN, „Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben als Grundlage für globale Ethik, in Synthesis Philosophica 53/1 (2012), 31-50, hier 48. 126 Siehe KÖRTNER (1988), „Verantwortung für das Leben“, 330. 127 Siehe Ders. (2013), „Stellung der Ethik“, 116. 21 Schweitzer – ein Pionier der Bioethik? Bezugspunkt für neue Überlegungen herangezogen wird.128 Schweitzer war mit seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, wonach allem, was lebt, der gleiche Wert zugesprochen wird, aber seiner Zeit weit voraus, wenn man bedenkt, dass die heutige Genetik und Mikrobiologie damals in ihren Kinderschuhen steckte.129 Man kann seine Ethik in gewisser Weise als revolutionär bezeichnen, weil sich die Ethik und Philosophie zur damaligen Zeit in weiten Teilen auf das Handeln von Menschen an Menschen beschränkt haben. Der umfassende Lebensbegriff spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, wenn er alles Lebendige auf der Welt einschließt und folglich dieses als wertvoll und schützenswert betrachtet wird.130 Daneben zählen „Ehrfurcht“ und „Verantwortung“ zu den weiteren Schlüsselbegriffen seiner Ethik, die universell von ihm geltend gemacht wird. Damit gilt er „in Einführungen zur Umweltethik immer als Paradebeispiel für den Biozentrismus“131, weil bei ihm sowohl das menschliche, tierische als auch pflanzliche Leben als Objektbereich der Ehrfurchtsethik angesehen wird.132 Besonders im Hinblick auf bioethische Fragestellungen bietet dieser biozentrische Zugang eine interessante Ausgangsposition. Die biologische Vielfalt wird als Ganzes in den Fokus des Interesses genommen, da dem ethischen Menschen nach Schweitzer das Leben als solches heilig sei und die Natur ihren eigenen Wert habe.133 „Die Ehrfurcht gilt also letztlich der sich erst im Staunen erschließenden Sichtbarkeit und Dankwürdigkeit des Geschöpfseins bzw. der Zeugnishaftigkeit der Lebewesen von . Vgl. KÖRTNER (2013), „Stellung der Ethik“, 99; Zurückzuführen ist dieser Umstand auf die recht späte Veröffentlichung der gesammelten Werke Schweitzers sowie der schwierige Zugang aufgrund des eher appellativen Charakters seiner Sprache. Vgl. POHL, SABINE, „Albert Schweitzers Ehrfurcht vor dem Leben und die Bioethik“; in: Robert Ranisch et al. (Hgg.), Selbstgestaltung des Menschen durch Biotechniken (Tübinger Studien zur Ethik 4), Tübingen 2015, 113-129, hier 113. 129 Vgl. KÖRTNER (2013), „Stellung der Ethik“, 101. 130 „Mit anderen Worten ist das Grundprinzip der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben das Prinzip einer universellen Verantwortung für das Leben, die Mitleid und Liebe einschließt, sich aber in beidem nicht erschöpft.“ Siehe Ders. (1988), „Verantwortung für das Leben“, 338. 131 Siehe GORKE, MARTIN, „Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als Wegbereiterin einer holistischen Umweltethik. Gemeinsamkeiten und Unterschiede“, in: Micheal Hauskeller (Hg.), Ethik des Lebens. Albert Schweitzer als Philosoph, Zug 2006, 259-278, hier 262. 132 Es sei an dieser Stelle anzumerken, dass bei dem Schweitzerschen Lebensbegriff, wie bereits beschrieben, auch das anorganische Leben, seien es Schneeflocken oder Kristalle, bedacht wird, sodass eine Verantwortungsethik im Sinne Schweitzers holistisch gedacht werden muss. Vgl. ebenda; Bei einer solchen Auffassung Schweitzers Ethik kann man von einer physiozentrischen Tendenz sprechen, bei der die gesamte Natur zum Objektbereich wird. Vgl. KÖRTNER (2013), „Stellung der Ethik“, 101. 133 Vgl. JURIĆ (2015), „Notion of Life“, 40. 128 22 Schweitzer – ein Pionier der Bioethik? ihrem Ursprung aus einer höheren Vernunft.“134 Dieser Lebensbegriff findet in bioethischen Debatten allerdings kaum beachtet, weil dort das Leben „einen übergeordneten Zusammenhang“ oder den Evolutionsprozess charakterisiert und es weniger um konkrete Lebensformen geht.135 Schweitzers Position der Gleichheit allen Lebens wurde im Laufe der Zeit immer stärker radikalisiert. So wird von Verfechtern dieser Position das Argument gebracht, dass alle Lebewesen aus bioethischen Gründen prinzipiell das gleiche Recht auf Leben hätten, weil sie dem Selbstzweck dienen würden. Einzuwenden sei jedoch, dass die Selbstzweckformel zur Begründung von Eigenwert und besonderer Würde alles Lebendigen nicht unbedingt überzeugend ist, da sich aus dem generellen Überlebens- und Fortpflanzungsinstinkt von Organismen keine moralische Forderung nach gleichem Lebensrecht ableite.136 Wie bereits angesprochen, wird bei Schweitzers Ethik die fehlende Realisierbarkeit der Handlungsmaximen kritisiert und ihm Willkür vorgeworfen. Bei genauerer Betrachtung findet sich allerdings ein Kriterium, dass in Einzelsituationen herangezogen werden kann, um zwischen verschiedenen Interessen abzuwägen und eine moralische Entscheidung zu treffen: das Kriterien der Notwendigkeit.137 „Mit der Notwendigkeit gibt uns die Natur das Recht, niederes Leben dem höheren zu opfern. Aber indem wir davon Gebrauch machen, haben wir uns unsere Verantwortung immer gegenwärtig zu halten. Nur da, wo es durch einen ausreichenden Zweck gerechtfertigt ist, dürfen wir eingreifen.“138 Grundsätzlich kann Schweitzer zugestimmt werden bei der Forderung nach einer gleichen moralischen Behandlung aller Formen des Lebens, obgleich die praktische Umsetzung seiner Ethik eher schwierig ausfällt.139 Es handelt sich 134 Vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz wird dem ethischen Konzept Schweitzers der Ehrfurcht vor dem Leben insofern eine Wichtigkeit beigemessen, als dass es „als ein Korrektiv und […] Gleichgewicht zum Interesse an der Verwertung nichtmenschlichen Lebens“ Beachtung erhält, die sich auf der Erkenntnis gründet, dass der Mensch Teil des Lebens um ihn herum ist und daher sich selbst und anderes Leben achten und schützen sollte. Vgl. HILPERT, KONRAD, „Religion in den bioethischen Diskursen Deutschlands“, in: Friedemann Voigt (Hg.), Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Berlin/New York 2010, 187215, hier 201f. 135 Vgl. KÖRTNER (2013), „Stellung der Ethik“, 103. 136 Vgl. KNOEPFFLER, NIKOLAUS, „Umwelt- und Tierethik (Bioethik I)“, in Ders. et al. (Hgg.), Einführung in die angewandte Ethik (Angewandte Ethik 1), 75-105, hier 78. 137 Vgl. Pohl (2015), „Bioethik“, 123. 138 Siehe SCHWEITZER, ALBERT, Wir Epigonen (Werke aus dem Nachlass Bd. 9), Herausgegeben von Ulrich Körtner und Johann Zürcher, München 2005, 195. 139 Vgl. KÖRTNER (2013), „Stellung der Ethik“, 119. 23 Schlussbetrachtung und Ausblick hierbei um kein allgemeingültiges Sittengesetz, das in jeder Situation gilt. Im Vordergrund steht die Forderung nach einer Reflexion des Verhältnisses mit der Umwelt, anderem Leben und der eigenen Verantwortung, auf deren Basis dann moralische Urteile getroffen werden können.140 Entsprechend handelt es sich bei dieser Wahl zwischen Handlungsalternativen um eine Güterabwägung. Für die einzelnen Disziplinen der Bioethik ergibt sich folglich ein Rahmen, der für Entscheidungen herangezogen werden kann. „So muss abgewogen werden, wer von den Ergebnissen einer bestimmten Anwendung profitiert, wie sich die Ausgangssituation darstellt und wie groß die Nachteile sind, die anderen durch die Forschung und Anwendung der Technologie entstehen.“141 Diese notwendige Reflexion kann als die eigentliche Stärke der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben verstanden werden. Indem sie keine konkreten Handlungsgebote vorgibt, bleibt ihr der Freiraum, auf unterschiedliche Situationen angemessen und flexibel zu reagieren.142 Die Ehrfurcht vor dem Leben ist eine ethische Gesinnung, „die das Denken und Handeln in eine Richtung lenkt, ohne zu beanspruchen, genau und für jeden einzelnen Schritt den Weg anzeigen zu können, den wir zu gehen haben.“143 Sie ähnelt damit einer Art Kompass, der bei bioethischen Fragestellungen ein Wegweiser darstellen kann. Der Mehrwert seines Lebensbegriffs und ethischen Konzepts lässt sich somit bestätigen, auch wenn die genannten Kritikpunkte ihre Berechtigung haben. Schweitzer zählt damit zu den Wegbereitern der heutigen Bioethik, indem er den Objektbereich der Ethik erweitert hat und versucht hat, eine brauchbare Antwort darauf zu geben, was Leben überhaupt ist. „Schweitzer war Bioethiker, Tierethiker, z. T. Ökoethiker avant la lettre, ohne die zentrale Humanität vernachlässigt zu haben.“144 6 Schlussbetrachtung und Ausblick Der „Urwalddoktor“ Albert Schweitzer hat mit seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ein Konzept geschaffen, das bestimmend für sein eigenes Leben und wegweisend für die heutige Bioethik war. Vgl. Pohl (2015), „Bioethik“, 125. Siehe ebenda. 142 Vgl. Hauskeller (2006), „Verantwortung“, 235. 143 Siehe ebenda. 144 Siehe Lenk (2000), „Humanität“, 31. 140 141 24 Schlussbetrachtung und Ausblick Die Begriffe „Leben“ und „Ehrfurcht“ sind dabei zentral für das Verständnis von Schweitzers Ethik. Trotz der oft synonymen Terminologie sind gerade beim Lebensbegriff zwei unterschiedliche Dimensionen zu differenzieren und eine Abgrenzung vom Seinsbegriff vorzunehmen. Einerseits gibt es die universelle Bedeutung, bei der es um die Erklärung der Welt geht, und anderseits diejenige, die das konkrete ethische Handeln an Lebewesen in den Blick nimmt. Dafür ist die Erkenntnis wichtig, dass Lebewesen über einen Willen zum Leben verfügen und dieser sich nicht nur im Menschen äußert. Die Fähigkeit des erlebenden Denkens ist aber nur letzterem eigen, wodurch Schweitzer dem Menschen eine größere Verantwortung zuspricht als Tier und Pflanze. Dieser muss begreifen, dass alles Leben schutzbedürftig ist, weil es den gleichen Wert hat: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Der Wille zum Leben ist schließlich in allem Lebendigen vorhanden und sollte entsprechend geachtet und respektiert werden. Daraus entwickelt sich der Anspruch seiner Ethik, alles Leben auf die gleiche Weise zu behandeln und es zu fördern und erhalten. In diesem ethischen Anspruch stecken wichtige Impulse für die Beantwortung bioethischer Fragestellungen. Wo fängt das Leben an und wo hört es auf? Was darf verändert werden und welche Grenzen gibt es im Umgang mit dem Leben? Entsprechend der Ehrfurchtsethik muss grundsätzlich reflektiert werden, ob die Handlungen wirklich notwendig sind oder ob es Alternativen gibt. Gerade vor dem Hintergrund von Tierversuchen oder Bioengineering bietet es sich an, zu untersuchen, inwieweit ethisches Handeln im Sinne der Ehrfurcht vor dem Leben möglich ist und ob die Versuche und Methoden der Naturwissenschaften sogar mittels Schweitzers Konzept gerechtfertigt werden können. Ziel sollte es sein, „eine Atmosphäre wirklich gewollten friedlichen Miteinanderlebens und auch miteinander und zugunsten allen Wirtschaftens [zu schaffen]. Wir alle müssen uns zusammentun, daß die Erde zu einem allen gedeihlichen Reich der Humanität werden kann.“145 Der Mensch muss sich folglich den globalen Herausforderungen seiner Zeit annehmen und ernsthaft versuchen, an den gegenwärtigen Zuständen etwas zu verändern. Schweitzers Ehrfurchtsethik bietet dabei ein mögliches Konzept, wie man ethisch handeln sollte. Es ist nicht ohne Makel, aber diese gehören zum Leben einfach dazu. 145 Siehe SPEAR (1978), „Grundlinien“, 39. 25 Literaturverzeichnis 7 Literaturverzeichnis Abkürzungen von Monographiereihen oder Zeitschriften sowie erfolgen nach dem Abkürzungsverzeichnis von Schwertner, Siegfried M., IATG3. Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin/New York 32014. Kurztitel wurden nach dem Muster Verf. (Publikationsjahr), „zentrales Titelsubstantiv“, Seite. gebildet. 1. Primärwerke SCHWEITZER, ALBERT, Selbstzeugnisse. Aus meiner Kindheit und Jugend. Zwischen Wasser und Urwald. Briefe aus Lambarene, München 81988. Ders., Die Weltanschauung vor dem Leben. Kulturphilosophie III. und IV. Teil, Herausgegeben von Claus Günzler und Johann Zürcher, München 2000. Ders., Die Ehrfurcht vor dem Leben. Grundtexte aus fünf Jahrzehnten. Herausgegeben von Hans Walter Bähr, München 82003. Ders., Wir Epigonen (Werke aus dem Nachlass Bd. 9), Herausgegeben von Ulrich Körtner und Johann Zürcher, München 2005. Ders.,, Kulturphilosophie, Band I: Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Band II: Kultur und Ethik. Mit einem Nachwort von Claus Günzler, München 2007. 2. Sekundärliteratur a) Monographien BEAUCHAMP, TOM L. / CHILDRESS, JAMES, F., Principles of Biomedical Ethics. Oxford 52001. ECK, STEFAN BERNHARD, Auf dem Prüfstand: Albert Schweitzer und die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, Herausgegeben von Arbeitskreis Tierrechte & Ethik, Saarbrücken 2002. GANSTERER, GERHARD, Die Ehrfurcht vor dem Leben: die Rolle des ethischen Schlüsselbegriffes Albert Schweitzers in der theologisch-ökologischen Diskussion (Forum interdisziplinäre Ethik 16), Frankfurt am Main 1997. GRÄSSER, ERICH, Studien zu Albert Schweitzer. Herausgegeben von Andreas Mühling (BASF 6), Bodenheim 1997. Ders., Albert Schweitzer als Theologe (BHTh 60), Tübingen 1979. GÜNZLER, CARL, Albert Schweitzer: Einführung in sein Denken (BsR 1149), München 1996. LENK, HANS, Albert Schweitzer – Ethik als konkrete Humanität (Forum Humanität und Ethik 1), Münster 2000. NONN, CHRISTOPH, Das 19. und 20. Jahrhundert. Orientierung Geschichte (UTB 2942), Paderborn 22007. 26 Literaturverzeichnis OERMANN, NILS OLE, Albert Schweitzer, 1875-195. Eine Biographie, München 2 2010. SPEAR, OTTO, Albert Schweitzers Ethik. Ihre Grundlinien in seinem Denken und Leben. Mit ausführlichem Literaturverzeichnis (EZS 80), Hamburg 1978. B) Aufsätze in Zeitschriften BARANZKE, HEIKE, „Was Bedeutet ,Ehrfurcht‘ in Albert Schweitzers Verantwortungs-ethik? Eine Begriffsanalyse im Vergleich mit Schwantje, Kant, Goethe und Nietzsche“, in: Synthesis Philosophica 53/1 (2012), 7-29. HÄRLE, WILFRIED, „Ehrfurcht vor dem Leben. Darstellung, Analyse und Kritik eines ethischen Programms“, in: MJTh 9 (1997), … GLOBOKAR, ROMAN, „Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben als Grundlage für globale Ethik, in Synthesis Philosophica 53/1 (2012), 31-50. JURIĆ, HRVOJE, „From the Notion of Life to an Ethics of Life“, in: Synthesis Philosophica 59/1 (2015), 33-46. KÖRTNER, ULRICH, „Ehrfurcht vor dem Leben – Verantwortung für das Leben: Bedeutung und Problematik der Ethik Schweitzers“, in: ZThK 85/3 (1988), 329-348. MÜLLER, CHRISTIAN, „Albert Schweitzers ethische Mystik der Ehrfurcht vor dem Leben“, in IZPP 1 (2010), 1-11. C) Ausätze in Sammelbänden und Festschriften ECKER, MANFRED, „Evolution und Ethik. Der Begriff der Denknotwendigkeit in Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben“, in: Claus Günzler / Erich Grässer / Bodo Christ und Hans H. Eggebrecht (Hgg.), Albert Schweitzer heute. Brennpunkte seines Denkens (BASF 1), Tübingen 1990, 51-81. GORKE, MARTIN, „Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als Wegbereiterin einer holistischen Umweltethik. Gemeinsamkeiten und Unterschiede“, in: Micheal Hauskeller (Hg.), Ethik des Lebens. Albert Schweitzer als Philosoph (Die graue Reihe 46), Zug 2006, 259-278. GÜNZLER, CLAUS, „Ehrfurcht vor dem Leben – Albert Schweitzers Ethik als Grundimpuls für die Umwelterziehung“, in: Ders. et al., Ethik und Erziehung, Stuttgart 1988, 171-199. HAUSKELLER, MICHAEL, „Verantwortung für alles Leben? Schweitzers Dilemma“, in: Ders. (Hg.), Ethik des Lebens, Albert Schweitzer als Philosoph (Die graue Reihe 46), Kunsterdingen 2006, 210-236. HILPERT, KONRAD, „Religion in den bioethischen Diskursen Deutschlands“, in: Friedemann Voigt (Hg.), Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Berlin/New York 2010, 187215. KÖRTNER, ULRICH, „,Ehrfurcht vor dem Leben‘ – Zur Stellung der Ethik Albert Schweitzers in der ethischen Diskussion der Gegenwart“, in: Angela Berlis / Hubert Steinke / Fritz von Gunten und Andreas Wagner (Hgg.), Albert 27 Literaturverzeichnis Schweitzer: Facetten einer Jahrhundertgestalt (Berner Universitätsschriften 59), Bern 2013, 99-136. NEUENSCHWANDER, ULRICH, Ethik der Lebensbejahung, in: Claus Günzler / Erich Grässer / Bodo Christ und Hans H. Eggebrecht (Hgg.), Albert Schweitzer heute. Brennpunkte seines Denkens (BASF 1), Tübingen 1990, 9-17. POHL, SABINE, „Albert Schweitzers Ehrfurcht vor dem Leben und die Bioethik“; in: Robert Ranisch / Sebastian Schuol / Marcus Rockoff (Hgg.), Selbstgestaltung des Menschen durch Biotechniken (Tübinger Studien zur Ethik 4), Tübingen 2015, 113-129. SCHNEIDER, MANUEL, „Über Leben und Tod – zur konvivialen Ethik Albert Schweitzers“, in Günter Altner / Ludwig Frambach / Franz-Theo Gottwald / Ders. (Hgg.), Leben inmitten von Leben. Die Aktualität der Ethik Albert Schweitzers, Stuttgart 2005, 15-26. ZAGER, WERNER., „Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben“. Einführung in den dritten Band der Kulturphilosophie von Albert Schweitzer, in:. (Hgg.), Ethik in den Weltreligionen: Judentum – Christentum – Islam (ThST 22), Neukirchen-Vluyn 2002, 95-108. D) Lexikonartikel und Handbücher DABROCK, PETER, „Bioethik des Menschen“, in: Wolfgang Huber / Torsten Meireis / Hans-Richard Reuter (Hgg.), Handbuch der Evangelischen Ethik, München 2015, 517-583. DEEG, MAX, Art. „Buddhismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 86-87. Ders., Art. „Jainismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 282-283. KAEGI, DOMINIC, Art. „Historismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 244-245. KNOEPFFLER, NIKOLAUS, „Umwelt- und Tierethik (Bioethik I)“, in Ders. et al. (Hgg.), Einführung in die angewandte Ethik (Angewandte Ethik 1), 75-105. LEMBECK, KARL-HEINZ, Art. „Neukantianismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 410-411. POHL, SABINE, „Albert Schweitzers Ehrfurcht vor dem Leben und die Bioethik“; in: Robert Ranisch / Sebastian Schuol / Marcus Rockoff (Hgg.), Selbstgestaltung des Menschen durch Biotechniken (Tübinger Studien zur Ethik 4), Tübingen 2015, 113-129. PRECHTL, PETER, Art. „Positivismus“, in Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen (2007), 471-472. PREUßNER, ANDREAS, Art. „Kultur“, in: Handwörterbuch Philosophie (2003), 438. STURMA, DIETER / HEINRICHS, BERND, „Bioethik – Hauptströmungen, Methoden und Disziplinen“, in Dies. (Hgg.) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 28 Literaturverzeichnis Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE), Handbuch Bioethik, Stuttgart / Weimar 2015, 1-8. TESLAK, GERHILD, Art. „Fortschritt“, in: Handwörterbuch Philosophie (2003), 358. 3. Elektronische Medien ZAGER, WERNER, Art. „Schweitzer, Albert“, in: WiBiLex 2009/02 (PDFDokument, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/53957/), abgerufen am 15.07.2020. 29 Literaturverzeichnis Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Erklärung (ab Sommersemester 2008 obligatorisch den Hausarbeiten beizufügen) Name, Vorname Kretschmann, Marek Matrikel-Nummer 1021907 Hiermit versichere ich, dass ich die Hausarbeit mit dem Titel: Die Bedeutung des Begriffs „Leben“ in Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als Wegweiser für die Bioethik selbstständig verfasst habe und alle von anderen Autoren übernommenen Gedanken wie auch Textstellen oder Passagen aus digital verfügbaren Dokumenten in der Ausführung meiner Arbeit gekennzeichnet sowie die Quellen korrekt zitiert habe. Ferner versichere ich, dass diese Arbeit noch nicht an anderer Stelle vorgelegen hat und ich die unten genannten Gesetzesgrundlagen zur Kenntnis genommen habe. Kiel, 26.07.2020 Ort, Datum, Unterschrift Bei Täuschungsversuchen finden die §§ 6, 7 12 und 21 der Studien- und Prüfungsordnung für Staatsexamens- und Magisterstudiengänge sowie § 21 der Prüfungsverfahrensordnung für Studierende der BA und MA-Studiengänge Anwendung.