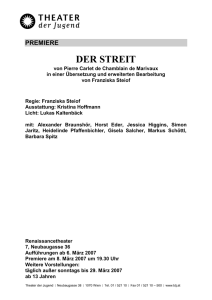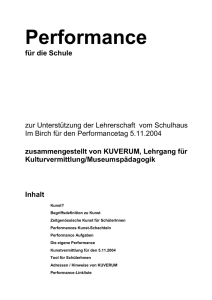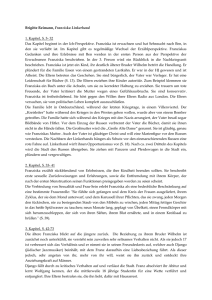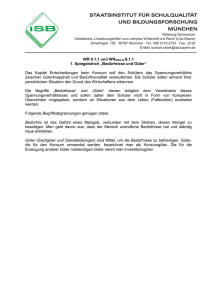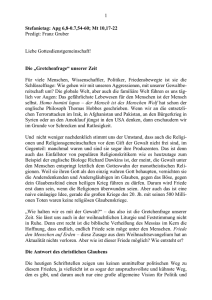Roland Müller Franziska von Westerholt Historischer Roman
Werbung
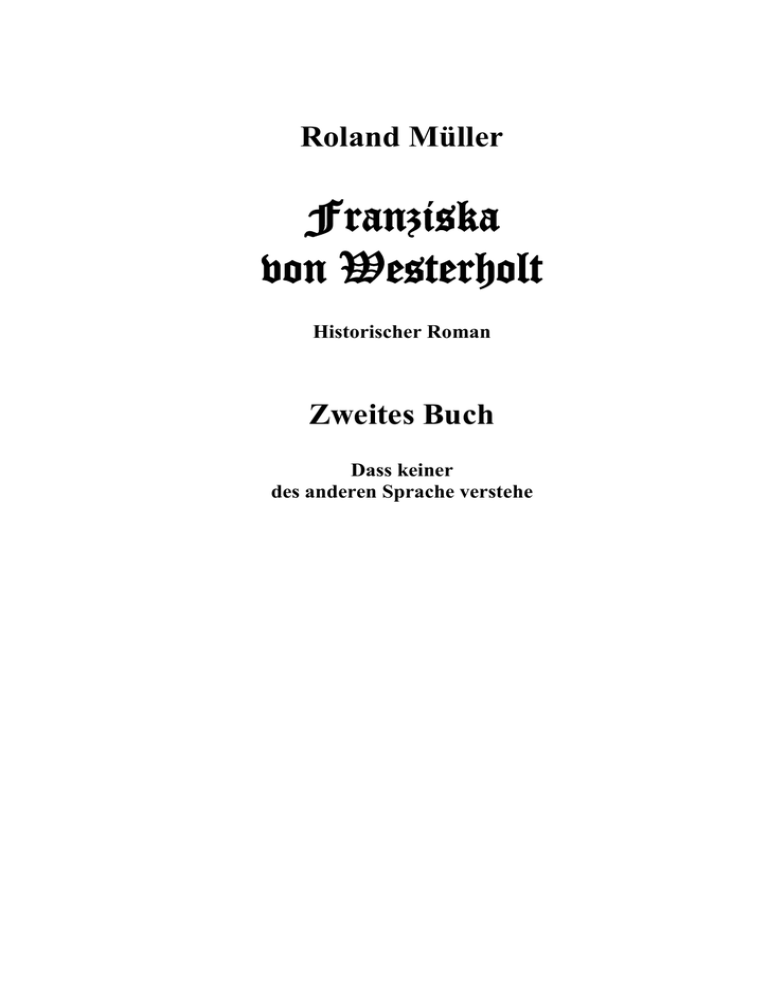
Roland Müller Franziska von Westerholt Historischer Roman Zweites Buch Dass keiner des anderen Sprache verstehe 2 Da sie nun zogen gegen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis in den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen! denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasset uns hernieder fahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe! Also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. (1.Mo. 11.2-8) 3 4 1.Kapitel I W ie weit bist du?" Der Fernhändler Benno schnaubte wie ein Pferd, denn der Sommer des Jahres 1228 war heiß, und beleibte Leute wie er litten besonders darunter. "Wenn wir den Wagen nicht bis heute Abend repariert haben, fahren die anderen ohne uns weiter, mitsamt dem Geleitschutz." "Die Hinterachse ist zersplittert. Wir brauchen einen Wagner." Eikes Stirnadern waren geschwollen, und das ließ einen seiner Jähzornsanfälle befürchten. Benno, der die wilde Vergangenheit seines Knechtes kannte, hätte gern einen anderen Gehilfen genommen, doch für so wenig Lohn wollte niemand sonst bei ihm bleiben. "Dir fällt gewiss etwas ein." "Warum, zum Teufel, soll ich mich abschinden, während Ole sich die faule Haut kühlt?" "Nenne nicht so leichtfertig den Namen des Bösen!" Eike hörte ihm schon nicht mehr zu. Er schleuderte den Hammer auf den Boden und verschwand. Benno ließ sich schwer auf einen Schemel fallen und blickte resignierend über den engen, mit den Wagen der Kaufleute völlig verstellten Marktplatz von Osnabrück. Alles störte ihn - die schmutzigen Rinnsale, das Geschrei der Stadtkinder, der üble Geruch, der schwer in der Luft lag, weil kein Wind ihn verwehte. Da plötzlich hörte er etwas, das ihn aus seinem Trübsinn riss, ein Satzfetzen nur, ein paar vertraute Laute. Er hob den Kopf und bemerkte ein bettelndes Mädchen. Ihrer Sprache nach musste sie an der Küste aufgewachsen sein. Auch Benno kam von dort, aus Bremen, und es tat ihm gut, wenn er auf seinen weiten Reisen ein Stück Heimat fühlte. Er begann, das Mädchen zu beobachten. Sie war noch jung, höchstens vierzehn, allerdings schon recht kräftig. Sein Blick glitt vom Kopf über die Wölbung ihrer Brüste hinweg bis zu den Füßen hinab. Sie hatte eine Figur wie eine Bauerntochter, war dabei aber ungewöhnlich anmutig. Sie gefiel ihm, und er wollte sie besitzen. Er wollte immer besitzen, was ihm gefiel. Als er sie zu sich heranwinkte und überlegte, was sie ihn wohl kosten würde, zitterten ihm vor Erwartung die Hände. "Wie heißt du?" "Mein Name ist Franziska." Wie hochfahren sie das sagte! Ganz sicher war sie kein elternloses Straßenmädchen, das für ein Stück Brot zu haben war. Ihre nun vom Wind zerzausten Haare hatte jemand vor kurzem frisiert. "Du bist nicht aus dieser Stadt?" "Nein." Auch ihr verstaubtes und an einigen Stellen eingerissenes Kleid hatte schon bessere Tage erlebt. "Woher kommst du?" "Das ist eine lange Geschichte ..." Woher nahm dieses Landstreicherküken den Mut, den Kopf so herausfordernd zurückzuwerfen, anstatt demütig den Blick zu senken? Das Geheimnisvolle an ihr reizte Benno jedoch schließlich so sehr, dass er ihr (gerade als sie wieder gehen wollte) in seine Dienste zu treten anbot. Sie überlegte einen Moment. "Nehmt Ihr mich auch, wenn ich Euch eine Bedingung stelle?" "Das kommt auf die Bedingung an." "Nein. Sagt es vorher!" 5 "Dir fehlt jemand, der dir deine Frechheit austreibt." "Nun, dann sucht Euch eine andere Magd!" "Nein, nein! Geh nicht fort! Ich bin einverstanden." "Die Bedingung ist meine Schwester Pentia." Sie wandte sich einem jüngeren Mädchen zu, das aus zehn Schritten Entfernung das Geschehen misstrauisch beobachtete. "Nun komm schon, du Feigling!" Das Mädchen schüttelte kaum merklich den Kopf. "So ist sie immer!" sagte Franziska lachend, zufrieden mit ihrem Streich. In diesem Moment kam Eike zurück. Neben ihm her trottete der zweite Knecht des Kaufmanns, ein unscheinbarer Bursche mit mattblondem Haar und müdem Gesicht. "Wer ist das? Kennst du die?" fragte Eike. "Nein. Is' mir auch egal." "Die ist doch viel zu jung für den Alten, fast noch ein Kind!" "Aber trotzdem schon heiratsfähig. Und allem Anschein nach auch gesund. Wenn sie mit zufasst und uns nicht zuviel weg frisst ..." "Fauler Sack! Fällt dir bei Weibern nichts anderes ein? ... Gehört der Fratz da etwa auch noch dazu?" Ole hob als Antwort missmutig die Schultern. "Das Ganze stinkt nach Ärger. Mit den beiden stimmt was nicht. Vertrau meinem Riechhaken!" Eike musterte Pentia. Sie hatte dieselben schwarzen Haare wie die große Schwester, sah ihr auch ähnlich, war aber feingliedriger, empfindlicher, sicherlich verwöhnter. "Der Wagner kommt vorbei, wenn er gegessen hat." Benno fuhr zusammen und drehte sich jählings um. "Der Wagner? ... Ach ja, unsere Achse!" Eike grinste unverschämt und weidete sich an der Verlegenheit seines Herrn. "Die schöne Jungfer ist wohl eine Verwandte?" "Nein ... Sie ist ... Nun, wenn wir in Köln sind, brauchen wir Hilfe. Ihr wisst doch, wie es uns vor zwei Jahren in Lübeck erging. Sie ist ab jetzt meine Magd." "Gewiss doch! Das verstehe ich. Ole wächst schon jetzt die Arbeit schier über den Kopf." "Ihr beiden wartet hier auf den Wagner und geht ihm zur Hand, wenn er kommt! Ich zeige Franziska ihre Arbeit." Als Benno mit den Mädchen verschwunden war, sagte Eike mit schiefem Grinsen: "Wetten, dass der Alte sie nicht als Jungfer kriegt!" Er war übrigens ein hübscher Bursche - groß, kaum dreißig Jahre alt, schmal in den Hüften und breit in den Schultern; lockige, verwegen bis in den Nacken wallende Haare. Viele Annehmlichkeiten des Lebens wären ihm von selbst zugefallen, die Frauen allemal. Doch auf solchen Gewinn legte er keinen Wert. Er hasste die glücklichen Umstände, schätzte nur das, was er sich mit Gewalt nahm. Er liebte niemanden, und er fürchtete nichts. Sonderbarer Weise verstand er sich mit Ole. Niemand wusste, was ihn ausgerechnet an diesen eigenwilligen Nordländer band. Oles Trägheit überstieg alles, und wenn ihn nicht Hunger oder rohe Gewalt trieb, tat er keinen Handschlag. Wer sein liederlich kurz geschnittenes, strähniges Haar sah, glaubte gern der Nachrede, dass er gar zum Kämmen zu faul war. Vielleicht brauchte Eike einfach jemanden, der ihm zuhörte, ohne jemals zu widersprechen. 6 "Möchte wissen, wo die herkommt. So was halst man sich nicht auf. Soll er sie sich meinetwegen in irgendeiner dunklen Ecke hernehmen, aber nicht gleich mitschleppen!" Benno führte unterdessen die Mädchen zu seinen anderen beiden Wagen. Von der Arbeit sagte er wenig. Er sprach von seinem Reichtum und zeigte seine Kostbarkeiten als Beweis. Und er beobachtete Franziska, wie sie dem allergrößten Schmutz auswich, wie sie voller Neugier alles untersuchte, was er ihr vorführte. Er hätte gern ihre Geschichte erfahren, ihr Geheimnis. "Ihr fahrt nach Köln, Kaufmann?" fragte sie. "Köln ist ein großer Handelsplatz und eine schöne Stadt, groß und bunt. Sie wird dir gefallen." Pentia folgte den beiden zunächst, blieb dann aber zurück, da niemand sie beachtete. So war Benno mit Franziska plötzlich allein im hintersten Winkel eines Wagens. Die Erregung brachte ihn fast um den Verstand. Im letzten Moment jedoch hielt ihn etwas zurück nicht die Furcht vor Folgen (Eine fremde Stadtstreicherin hatte immer Unrecht) eher eine innere Stimme, die ihn mahnte, dass es ihm keine Freude brächte, dieses Mädchen einfach zu vergewaltigen. "Wenn es nichts mehr gibt, was Ihr mir sogleich sagen oder zeigen müsst, würde ich mich gern noch einmal in die Stadt entschuldigen", riss sie ihn aus seinen Gedanken. Er beeilte sich zuzustimmen. In Wahrheit hatte Franziska keineswegs etwas zu erledigen. Boleke, ihr Freund und Beschützer, war sicherlich inzwischen fort. Sie kannte hier niemanden, wollte zu niemandem. Aber zugleich hatte sie Bedenken, ob sie sich diesem Benno tatsächlich anschließen sollte. Er war ihr nicht geheuer, nicht erst seit sie im Winkel auf dem Wagen seinen heftigen Atem bemerkt hatte. Ohne bestimmtes Ziel schlenderte sie umher. Die Innenstadt war von einer eigenen Mauer eingefriedet. Sie schützte den Dom und den Marktbereich und grenzte beides zugleich von den drei Vororten ab, die sich wie ein Halbmond davor hinzogen. Das Mädchen drängte sich durch das Tor. Dort hatte sich Boleke verabschiedet. Sie war tapfer gewesen dabei, hatte stolz erklärt, dass sie sich allein durchschlagen könne. Ob er ihr das glaubte? In Gedanken sah sie sich noch einmal mit Pentia und dem alten Diener vor der äußeren Mauer an der Lügenpforte stehen, hungrig und müde und mit zerschundenen Füßen. Die Wächter musterten sie misstrauisch und Boleke musste sich dem Namen der Pforte sehr würdig zeigen. In der Stadt verschlangen sie ihre letzten Vorräte und legten sich in einem Winkel zum Schlafen nieder. Am nächsten Morgen durchstreiften sie auf der Suche nach etwas Essbarem die Leischaften - dicht bewohnte Viertel mit engen, verwinkelten Gassen. Franziska vermisste den Blick in die Ferne und glaubte im Gestank zu ersticken. Zweimal wäre sie um ein Haar aus einem Fenster heraus mit Unrat übergossen worden. In der Gassenmitte floss träge ein braunes Rinnsal, das sich an einigen Stellen staute und breite Streifen verpesteten Morastes bildete. Franziska fühlte sich in Osnabrück einsam und verloren. Zwar hatte sie nicht wie Pentia geweint, als Boleke davon gehumpelt war, dennoch stiegen in ihrem Innern Erinnerungen auf an schreckliche Geschichten über das, was einem Mädchen ohne Beschützer in der Fremde geschehen könne. Sie hatte Angst - Angst vor Räubern mit zernarbten Gesichtern und schwarzen Masken, Angst vor dem Übernachten unter frei- 7 em Himmel, Angst vor allem vor den vielen ihr noch unbekannten Gefahren. Diese Angst trieb sie schließlich zu Benno zurück. Die Nachstellungen ei- nes lüsternen Kaufmanns waren immerhin etwas Abwägbares, etwas wogegen sie sich wehren konnte. II W ie eine riesige Schlange, ein einheitliches Gebilde, wand sich die Wagenkolonne die Berge des Teutoburger Waldes hinauf. Dabei waren die Wagen sehr verschieden. Große und kleine gab es, hohe und flache, solche mit grellbunt bemalten Planen und unscheinbar graue. Einige hatten gewaltige, eisenverstärkte Räder mit armdicken Speichen, andere ganz kleine, die unter der Last ächzten. Und auch die Pferde glichen einander nicht. Da gab es schwerfällige Ackergäule, die gehorsam und gleichmütig ihre Arbeit verrichteten, altersschwache Klepper, denen jeder Schritt zur Qual wurde, aber auch feurige Rappen, denen das Tempo zu langsam war. Manche trotteten mit gesenktem Kopf daher, als wollten sie sich für ihr Dasein entschuldigen, andere trabten stolz und mit aufgestellter Mähne. Benno reiste mit seinen drei Wagen mittendrin in der Schlange. Den ersten Wagen lenkte er selbst, den zweiten Eike und den letzten Ole. Um mit Franziska allein zu sein, hatte der Kaufmann die jüngere Schwester zu Eike geschickt. "Weißt du, warum ich dich als Magd in meine Dienste genommen habe?" fragte er sie rundheraus. "Ist es nicht darum, dass Ihr Hilfe brauchtet?" Er lachte wie über einen Scherz. "Da wäre mir ein kräftiger Bursche nützlicher gewesen." "Ich bin zwar ein Mädchen und erst dreizehn Jahre alt, aber ich werde mich sehr bemühen, dass Ihr Euren Entschluss nicht zu bereuen braucht." "Du verstehst nicht, was ich meine ... Du brauchst bei mir nicht schwer zu arbeiten. Es reicht mir, wenn du ..." "Seht doch", unterbrach sie ihn, "die Riemen sind lose geworden durch das Rütteln auf der schlechten Straße! Ich werde sie festziehen, damit kein Unheil geschieht." Unter der Plane war es heiß und stickig. Hier staute sich der Staub, den die Hufe der Pferde aufwirbelten, und der die Kolonne wie ein dichter Nebelschleier einhüllte. Die Stapel der Kisten und Ballen überragten Franziska. Im Wirrwarr der kreuz und quer gespannten Seile und Lederriemen war kein Anfang und kein Ende zu erkennen. Als sie einen lockeren Knoten nachziehen wollte, wurde sie von einem plötzlichen Stoß so derb gegen die hintere Wand geschleudert, dass sie für einen Augenblick keine Luft mehr bekam. So sehr sie sich auch bemühte, ihre Arbeit ordentlich zu erledigen, sie verlor immer mehr die Übersicht. Es erschien ihr, als vollführten die Gegenstände einen wilden Bauerntanz. Schwarze und braune Pelze aus Russland warben um duftende Frauenkleider mit kunstvoll gearbeitetem Spitzenbesatz. Ein besonders vornehmer silbergrauer Pelz war mit einer Samtjacke im Schwange. Dazwischen hüpften Schuhe aus Stoff wie lustige Winzlinge umher. Am Rande spendeten dicke Holzkisten mit riesigen Schlössern und geheimnisvollem Inhalt Beifall. Erst ein erneuter harter Stoß brachte Franziska wieder 8 zur Besinnung. Sie raffte sich auf und bemühte sich, wenigstens die schlimmsten Schäden zu verhüten. Das gelang ihr dann auch leidlich, wobei sie sich freilich die Hände blutig riss. Die Kolonne erreichte unterdessen den Kamm des Teutoburger Waldes. Damit war das schwerste Stück auf dem Weg nach Münster, dem Ziel für diesen Tag, geschafft. Zumindest glaubten die Kaufleute das - bis sie vor sich die Straße plötzlich in einem breiten Morastbecken verschwinden sahen. Bewaldete Hänge zu beiden Seiten vereitelten jeden Ausweichversuch. So blieb am Ende nichts anderes übrig, als mehrere Bäume zu fällen und einen Knüppeldamm zu bauen. Und obwohl alle dabei mit zupackten, kam die Kolonne im Tal der Ems erst kurz vor Sonnenuntergang an, als die Zugbrücken am Wassergraben schon hochgezogen waren. Benno gehörte zu denen, die im Auftrag aller mit den Wächtern verhandelten. Er kannte Münster, kannte den uralten Dom und die Bischofsburg und die Mauer um beides herum, kannte die Marktstraße, die an der Ems begann und endete und das Areal des Kirchenfürsten wie eine Schlinge umspannte. Und er kannte auch den Hochmut der Bürger, die sich etwas einbildeten auf ihr Münzrecht, das schon von Kaiser Otto dem Dritten herrührte. Dem Hauptmann, der dort oben auf dem Wall stand, flankiert von ein paar seiner Leute, schien es ein Vergnügen zu sein, die Fremden zu demütigen. Jedes an ihn gerichtete Wort war glatte Verschwendung. Franziska suchte unterdessen nach ihrer Schwester und fand sie völlig verstört allein auf Eikes Wagen. "Was ist los mit dir? Hat dir jemand etwas getan?" Statt eine Antwort zu geben, fiel sie ihr um den Hals und brach sofort in Tränen aus. "Hör auf! Du bist kein kleines Kind mehr. Erzähl mir, was geschehen ist!" "Der Knecht behauptet, dass der Kaufmann uns beide umbringen will", würgte sie hervor. "Er bringt alle Mägde um, weil er einem geheimen Bund angehört und Jungfrauenherzen für Zaubereien braucht." "Diesen Unsinn hat er dir eingeredet?" rief Franziska aufgebracht. "Und du glaubst das auch noch?" Gewiss gab es Menschen, die mit bösen Geistern oder gar dem Teufel selbst im Bunde standen. Dieser lüsterne Benno jedoch gehörte gewiss nicht zu ihnen. Der hatte etwas anderes mit ihr vor. Plötzlich hörte sie hinter sich jemanden brüllen: "Was faulenzt ihr hier herum? Die Verhandlungen sind gescheitert. Wir dürfen nicht mehr in die Stadt hinein und müssen eine Wagenburg aufbauen. Wollt ihr nicht helfen dabei?" Franziska drehte sich um und erkannte den Knecht Eike. "Ich kann noch nicht wissen, was zu tun ist, denn ich bin erst seit gestern Magd", antwortete sie so bescheiden sie konnte. "Ich werde es dir zeigen. Komm mit auf den Wagen!" Franziska folgte ihm zögernd. Zuvor überzeugte sie sich, dass in der Nähe noch andere Leute waren. Unter der Plane herrschte jetzt fast völlige Dunkelheit. Sie tastete sich ein paar Schritte vorwärts. Da plötzlich packte Eike sie am Arm und schleuderte sie auf etwas Weiches, einen Stapel Kleider oder Stoffe. "Wir brauchen dich hier für die Arbeit nicht. Verstehst du? Und weil das so ist, musst du dich auf andere Weise nützlich machen." Franziska riss sich mit einem Ruck los und schrie wütend: 9 "Wenn du das von mir willst, musst du mich erst einmal fangen. Dabei wirst du merken, dass ich so schwach gar nicht bin." "Du willst dich also widersetzen?" Franziska versuchte, ruhig und höflich zu bleiben. "Ich weiß, dass es sich für ein Mädchen geziemt zu gehorchen. Ich will auch gern ..." "Es geziemt sich, zu gehorchen", äffte er ihr nach. "Wo hast du denn so fein sprechen gelernt? Du glaubst wohl auch noch an den braven Ritter, der dich über den Bach trägt, damit deine Füßchen nicht nass werden." Mit diesen Worten stürzte er sich erneut auf sie, diesmal fest entschlossen, sie nicht wieder entkommen zu lassen. "Du bist mir ausgeliefert und es ist mir gleich, ob sich das, was ich jetzt mit dir mache, geziemt oder nicht." Nun aber dachte auch Franziska nicht mehr an die Lehren des Apostel Paulus und setzte sich mit aller Kraft zur Wehr. "Lass mich los, du stinkender Bock, und sieh dich vor! Ich habe schon so manchen Stockkampf ausgetragen, und meinen Gegnern ist das nicht immer gut bekommen." Eike war außer sich. Nie zuvor hatte er so entschlossenen Widerstand erlebt. Jetzt wollte er nicht mehr allein seine Lust befriedigen, jetzt ging es ihm um seine Ehre als Mann. Franziska jedoch verteidigt sich tapfer und gewandt wie eine Wildkatze und wäre sicher ohne Schaden davongekommen, wenn nicht am Ausgang ein Stoffballen im Weg gelegen hätte. Sie verlor das Gleichgewicht, prallte im Sturz mit dem Kopf gegen das Rad des Wagens und verlor für einen Moment das Bewusstsein. Als sie die Augen wieder aufschlug, stand Eike über ihr und schwang eine Lederpeitsche. "Zu mir sagt ein Weib nicht ungestraft 'stinkender Bock'. Dafür wirst du büßen." Sein Gesicht war wutverzerrt. "Ich peitsche dich, bis du aussiehst wie Jesus am Kreuz." Franziska brauchte eine Zeitlang, um sich wieder zurechtzufinden. Etwas rann ihr warm über die Stirn und die Wange. Sie tastete danach und merkte, dass es Blut war. Unterdessen mischten sich in das Gebrüll des Knechtes noch andere Stimmen. Der Lärm hatte eine Menschenmenge angelockt. "Was ist los? Warum willst du sie verprügeln?" "Sie bekommt ihre Strafe für Faulheit und Widerspenstigkeit", antwortete Eike. "Aber sie hat sich verletzt! Das ist Strafe genug." "Nur kein falsches Mitleid! Man weiß ja, wohin das führt." Pentia sah das alles mit an und zitterte am ganzen Leib. Dass keiner von den starken Männern in der Runde ihrer wehrlos am Boden liegenden Schwester helfen wollte, presste ihr das Herz zusammen. Sie stand ganz dicht bei Eike und hörte ihn keuchen. 'Er schlägt sie tot!' schoss es ihr durch den Kopf. Während sie sich vorstellte, plötzlich ganz allein in der Fremde zu sein, überkam sie der Mut der Verzweiflung, und sie fiel dem zwei Kopflängen größeren Rohling in den Arm. Das brachte Eike vollends aus der Fassung. Er wusste nicht recht, was er tun sollte, beruhigte sich plötzlich und ließ die Peitsche sinken. Dann wollte er sich davonstehlen. Zu seinem Schaden indes hatte auch sein Dienstherr den Auflauf bemerkt. Als Benno nun Franziska verletzt am Boden liegen sah und dazu seinen gewalttätigen Knecht mit der Peitsche in der Hand, verlor er jedes Maß. "Ich bringe dich an den Galgen, du Stück Vieh! Du weißt, dass ich das kann, wenn ich es will." 10 Dann nahm er eine abgebrochene Deichsel und ging damit auf ihn los. Eike sah zu, dass er davon kam, und ging zu Ole. Der hatte die ganze Zeit über von seinem Wagen aus wie von einer Tribüne das Geschehen verfolgt und nicht einmal den Mund verzogen. "Was geht vor in dem Alten?" ereiferte sich Eike. "Die Schwarzhaarige macht ihn ganz irre. Mir hat das von Anfang an gestunken. Und ich habe mich noch nie getäuscht, wenn ich jemanden nicht leiden konnte." Ole schwieg, sagte nichts dagegen, nichts dafür. Eike störte sich nicht daran. "Trotzdem muss sie dran glauben. Jetzt erst recht." Ole zuckte gleichgültig mit den Schultern, und das blieb seine einzige Erwiderung. Benno kümmerte sich derweil um Franziska. Er trug sie zu seinem Wagen, bettete sie dort auf Stoffballen und verband ihr die Wunde am Kopf. Dass dabei ein paar neue Kleider mit ihrem Blut verdorben wurden, kümmerte ihn nicht (so empfindlich er in dieser Hinsicht gewöhnlich war). "Warum bist du nicht sofort zu mir gekommen? Dieses Ungeheuer hat dir nichts zu sagen. Du brauchst keine Angst mehr vor ihm zu haben. Wenn ich nur vor der rechten Leute Ohren erzähle, was ich über ihn weiß, hängt er am Galgen." "Sorgt Euch nicht um mich! Ich fühle mich schon wieder recht gut. Ich war eben ungeschickt." "Mehr als vier Monate lang bin ich jetzt schon unterwegs", begann der Kaufmann zu erzählen. "Zuerst war ich in Polen. Dort gibt es billig Wachs und Talg. Auch ein paar Dutzend russische Pelze habe ich dort gekauft. Aber frage mich nicht, wie ich damit nach Lübeck gekommen bin!" Sie brauchte nicht zu fragen, denn er erzählte es ihr auch un- aufgefordert. Er merkte schnell, dass sie für Unbekanntes zu begeistern war. "In Bremen hatte ich wenig Glück. Die Leute zahlen nicht mehr wie früher. Es ist ein Jammer. Übrigens wohnt dort meine Familie. Aber frage mich nicht, wie selten ich meine Kinder sehe!" Franziska fürchtete, dass er sich im Selbstmitleid verlieren würde, und versuchte, ihn auf andere Gedanken zu bringen. "In Köln werdet Ihr bessere Geschäfte abschließen." "Gott steh mir bei! Ich will dort meine ganze Ware eintauschen gegen Kölnische Tuche und dann über die Alpen nach Italien ziehen. Kennst du Italien?" "Nun ... Der Papst ist dort und ..." "Italien übertrifft alle anderen Länder an Reichtum und Schönheit. Mailand, Pisa, Genua, Cremona. Herrliche Seide kann man dort kaufen. Gewürze, wie du sie hier in Deutschland nur an den Höfen der Fürsten siehst, gibt es dort auf einem gewöhnlichen Markt." Er sonnte sich im Staunen des Mädchens. "Eines aber wirst du mir niemals glauben, obwohl es so wahr ist, wie ich hier sitze die sonderbaren Dinge, die es in Sizilien am Hofe des Kaisers Friedrich zu sehen gibt: Tiere mit so langen Hälsen, dass sie mühelos über ein Bauernhaus blicken, und solche, auf denen fünf Menschen zugleich reiten können und denen die Nase bis auf den Boden reicht, riesige Löwen ..." Plötzlich ab brach er ab und fiel zurück in seine Niedergeschlagenheit. "Aber was kann das alles gegen die Einsamkeit ausrichten? Die Einsamkeit ist eine giftige Schlange. Das kannst du mir glauben." Franziska ahnte allmählich, worauf er in Wahrheit hinauswollte (nämlich auf dasselbe wie Eike, nur auf eine andere Art). Bennos nächsten Worte bestätigten ihre Vermutung. "Bei den alten fränkischen Königen gab es einen besonderen Brauch. Die 11 mussten (wie wir Kaufleute) oft herumreisen. Und weißt du, was sie taten? Sie nahmen sich neben ihrer Ehefrau eine oder gar mehrere Friedelfrauen. Niemand fand damals etwas Schlechtes dabei. Diesen Brauch gibt es sogar heute noch zuweilen, wenn auch manche Priester ..." "Was redet Ihr da? Während Eure Frau mit Euren Kindern in Bremen auf Euch wartet, wollt Ihr Euch mit einer anderen vergnügen und findet nicht einmal etwas Schlechtes dabei?" Franziska sprang in heller Empörung auf und lief ungeachtet ihrer Verletzung davon. "Du hast mich falsch verstanden!" rief er ihr noch nach, doch sie ließ sich nicht mehr aufhalten. Da warf er in einem unvermittelten Anfall wilder Zerstörungswut seine Stoffe durcheinander. Die beiden Mädchen versteckten sich in einem Winkel, wo sie hoffen konnten, dass sie niemand fand. Dort waren sie nun zwar für ein paar Stunden sicher, doch wurden sie nicht viel fröhlicher dadurch. Pentia flüsterte: "Hier gibt es nicht einmal einen Priester." Franziska war kaum weniger beklommen zumute, doch wenn sie ihre Schwester trösten musste, fiel ihr immer etwas ein. Sie kniete nieder und sagte: "Lass uns zusammen beten! Der Herr Jesus sieht vom Himmel her ganz genau, wie es uns geht. Er wird uns zuhören, auch wenn kein Priester bei uns ist." "Glaubst du das?" "Ich weiß es." So kniete sich auch Pentia nieder und legte die Hände gegeneinander. Dann sprach Franziska vor: "Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns den Weg zu einem Beschützer gezeigt hast. Gib uns nun die Geduld, unserem Dienstherrn in Demut zu dienen! Zugleich bitten wir dich aber, ihn und seine Knechte von ihren bösen Gelüsten abzulenken, so dass wir wohlbehalten die Stadt Köln erreichen. Amen." "Amen", sprach Pentia nach. Wenig später wiegten die laue Nacht und der Gedanke an den Schutz durch Christus, den Herrn, die Mädchen in den Schlaf. III A m nächsten Tag ereignete sich nichts Außergewöhnliches. Franziska erwirkte, dass Pentia nicht mehr auf Eikes Wagen fahren musste. Im Übrigen erreichte der Wagenzug Dortmund, wo die Kaufleute im Schutz der Stadtbefestigung die Nacht verbrachten. Einige trennten sich von den anderen, denn auch hier wurde ein Markt abgehalten. Südlich von Düsseldorf kamen die Reisenden an den Rhein. Der Graf von Berg, dem der Ort und die Gegend gehörten, hatte hier eine gewinnträchtige Fähre eingerichtet. "Früher fuhr ich mit dem Schiff den Fluss entlang nach Köln", erzählte Benno. "Aber das lohnt sich nicht mehr." Franziska sah ihn erstaunt an. "Macht Ihr keine guten Geschäfte mehr?" "Ich habe kein Glück." "So dürft Ihr nicht reden. Gott vergisst Euch nicht." Er belächelte ihre kindliche Zuversicht, aber zugleich tat sie ihm gut. Am späten Nachmittag sah Franziska am Horizont die Zinnen einer gewaltigen Mauer auftauchen, die am Rhein 12 begann und nach rechts so weit reichte, dass sie sich nicht überblicken ließ. Das Mädchen, das nie etwas Ähnliches gesehen hatte, erinnerte sich der Berichte aus der Bibel über das himmlische Jerusalem mit seinen zwölf Toren und reckte sich aufgeregt hoch auf ihrem Sitz. Benno verkündete: "Wir sind am Ziel. Das ist Köln. Meine Freunde wohnen aber ganz im Westen im Stadtteil der Friesen." Er lenkte die Pferde kurz vor der Mauer von der Straße herunter hinein in einen Weg entlang des Grabens. Der war sandig und ließ sich nur schwer befahren. Franziska kam das gerade recht, denn so konnte sie sich all das Unbekannte, das ihr zu beiden Seiten auffiel, in Ruhe ansehen. An einem langen Abschnitt der Befestigung wurde noch gebaut. Transportarbeiter schafften auf besonderen Wagen mächtige Gesteinsblöcke vom Rhein her heran. Steinmetze zerteilten und behauten sie in Zelten und leichten Holzhütten. Träger brachten die fertigen Mauersteine mit Körben zum eigentlichen Bauplatz hin. Franziska entdeckte eigenartige Gefährte mit Rädern auf der einen und zwei Griffen auf der anderen Seite. Sie wunderte sich, dass diese einfache Erfindung in Bremen noch niemand kannte. "Das ist die letzte große Lücke in der Stadtmauer", erklärte Benno. "Bald wird alles fertig sein, nach mehr als einem halben Jahrhundert. Ich kenne junge Leute, deren Großväter der Mauer schon ihr täglich Brot verdankten." Der schlechte Weg hatte freilich auch einen Nachteil - sie erreichten das Tor zum friesischen Stadtteil spät. "Müssen wir wieder vor der Mauer übernachten?" fragte Franziska, und der Gedanke daran war ihr nicht angenehm. Benno indes beruhigte sie lachend: "Das hier ist Köln und nicht Münster! Die Haupttore bleiben offen, bis es fast ganz dunkel geworden ist. Eines davon, das Hahnentor, werden wir gleich hinter der Biegung sehen." Manch kleine Burg hätte nicht bestehen können gegen dieses Tor, das doch in Wahrheit nur Teil einer Mauer war. Vor dem Graben schützten zwei noch unvollendete, kleinere Türme die Zugbrücke. Dahinter hatte man den breiten, kahl geschlagenen Streifen, der zwischen Graben und Hauptmauer die ganze Stadt umspannte, mit niedrigen Mauern nach links und rechts abgesperrt, so dass ein Hof entstand, in welchem die Wagen der Kaufleute untersucht wurden. Dann kam die eigentliche Torburg. Zwei dicke, runde Türme flankierten einen weiten, überbauten Bogen. Schmale Schießscharten auf vier Ebenen und ein Zinnenkranz als Bekrönung mussten jeden Feind gründlich abschrecken. Franziska fielen aber auch die zierlichen Doppelfenster über dem Bogen auf, und sie dachte bei sich, dass sich die Kölner wohl nur aus Notwendigkeit so kriegerisch gaben und in Wirklichkeit von ganz anderer Lebensart waren. Das Hahnentor stand an einer Straße, die über Aachen bis nach Frankreich führte, und auf der auch am Abend noch Händler in die Stadt hinein fuhren. Die meisten von ihnen steuerten ihre Wagen aber geradeaus auf eine wie ein Berg über die Bürgerhäuser hinausragende Kirche zu, während Benno nach links in eine Gasse einbog. "Jetzt möge uns Gott helfen, dass uns nicht so kurz vor dem Ziel noch ein Wagen kippt!" Trotz der Trockenheit war der Untergrund morastig, und die Bohlen, mit denen man ihn zu befestigen versucht hatte, gaben bedenklich nach, sobald ein Rad auf sie drückte. "Wie kann das sein?" wunderte sich Franziska. "Das war früher einmal der Graben. Jetzt ist er zugeschüttet und heißt Ve- 13 nuspfuhl. Siehst du diese Mauer dort vorn links? Die gehört zum Benesishof. Der lag damals noch außerhalb der Stadt und musste von der Familie aus eigener Kraft vor Feinden geschützt werden. Aber die ist reich genug dafür." Franziska blickte sich neugierig nach allen Seiten um und begeisterte sich für alles. "Es gibt wohl viele reiche Herrn hier in Köln?" "Mancher, der hier wohnt, führt ein besseres Leben als die meisten Grafen ... Dort rechts, an diesem Tor biegen wir ab. Gleich dahinter wohnen meine Freunde. Übrigens ist das kein gewöhn- liches Tor sondern ein Kettenhaus. Manchmal rottet sich hier auf dem Venuspfuhl zwielichtiges Gesindel zusammen. Dann lassen die Wachleute die Ketten herunter und versperren den Durchgang." Franziska wurde so fröhlich gestimmt, dass sie leise ein Lied summte. Auf der Reise hatte sie sich oft verlassen und schutzlos gefühlt. Dort bei Bennos Freund aber, hinter der mächtigen Mauer und hinter dem Kettenhaus, wird sie gewiss wieder Geborgenheit finden. Im Stillen dankte sie dem Herrn Jesus, dass er ihr Gebet auf der Wiese vor der Stadt Münster erhört hatte. 14 2.Kapitel I W o willst du jetzt so spät am Abend noch hingehen?" fragte die Mutter, eine kleine Frau Anfang Vierzig mit leichtem Ansatz zum Fülligwerden. "Bleibst du wieder über Nacht fort? Du weißt doch, dass wir uns um dich sorgen ..." Hans antwortete nicht. Er zog sich einen grauen Kittel über, einen eigenartigen Kittel, der entfernt an eine Mönchskutte erinnerte, auch eine Kapuze hatte, aber nur bis zu den Knien reichte, und legte sich andächtig eine eiserne Kette mit einem Kruzifix um den Hals. Diese Kleidung wirkte ein wenig sonderbar bei ihm, denn er war ein ungewöhnlich großer und kräftiger Bursche, der eher in einen Steinbruch oder auf eine Baustelle passte als in ein Kloster. "Was sind das für Freunde, mit denen du ganze Nächte verbringst?" begann die Mutter von neuem. "Gute Freunde sind es, Mutter, sehr gute Freunde, solche die sich aufeinander verlassen können, überall und in jeder Lage." "Wie du das sagst! Kannst du dich denn auf uns nicht verlassen? Haben wir nicht alles getan, damit es dir besser geht als uns, als wir so alt waren wie du?" In diesem Moment kam der Vater herauf. Seine von wenigen grauen Haaren umstandene Glatze sah vor Erregung rot aus. Er stellte sich dem Sohn in den Weg und schrie unbeherrscht: "Du gehst heute Abend nicht aus dem Haus! Ich verbiete es dir. Und ich verlange, dass du mir dieses Kreuz gibst." Er griff danach, doch Hans hielt ihm die Hand fest. "Wenn Ihr es wagt, Euch an diesem heiligen Zeichen zu vergreifen, werde ich vergessen, dass Ihr mein Vater seid und dass ich Euch deshalb ehren muss." "An diesem heiligen Zeichen! Du bist nun einundzwanzig Jahre alt und glaubst, eigene Wege gehen zu können. Aber was hast du denn erreicht im Leben? Du taugst nicht für das Geschäft. Du findest auch keine Frau. Manchmal glaube ich, dass der Teufel in dir verkehrte Gelüste entfacht hat." Die Mutter verschloss ihm erschrocken mit der Hand den Mund. "Ludwig, sag nichts, was du später bereust! Um Gottes Willen!" Und zu Hans gewandt, fast beschwörend: "Dein Vater muss viel arbeiten. Er denkt ganz anders, als er jetzt spricht. Du darfst ja zu deinen Freunden gehen, nur wollen wir ein wenig mehr über sie wissen." Hans drängte sich ohne eine Antwort an den Eltern vorbei. Der Vater konnte ihn nicht aufhalten, denn er war kleiner als sein Sohn und auch nicht so kräftig wie er. "Wir hätten ihn als Kind öfter verprügeln sollen." Gundula seufzte. "Es ist ein Jammer, zu sehen, wie das einzige Kind so fremd wird. Wer soll denn den Handel weiterführen, wenn du alt bist?" Beide gingen ins Kontor und beobachteten vom Fenster aus, wie Hans in Richtung Stadtmitte davonging. Das Kontor war ein großer, heller Raum mit einem Eichentisch und mehreren schönen, lederbezogenen Stühlen. Hier empfing der Kaufmann Ludwig Jever seine Geschäftspartner. Der Raum hatte allerdings den Nachteil, dass er sich nicht heizen ließ und im Winter lediglich durch den Kamin der schräg darunter gelegenen Guten Stube ein wenig Wär- me bezog. Im angrenzenden schmalen, fast schlauchförmigen Zimmer wohnte und schlief der Sohn. Breiter war das Haus nicht. Die Schlafkammer der Eltern und ein für Gäste vorbehaltener Raum befanden sich hinten jenseits des Korridors. Mit den Patriziern der Stadt konnten sich die Jevers nicht messen. Das Haus gehörte ihnen auch nicht, sondern sie hatten es mitsamt dem Hof gegen einen Jahreszins von zwei Mark Silber zur Erbpacht. Doch sie waren mit viel Arbeit und ein wenig Glück zu gewissem Wohlstand gelangt, und das erfüllte sie mit Genugtuung. "Im Herzen ist er ein guter Junge", murmelte Gundula mehrmals wie eine Beschwörungsformel. "Er will jetzt dies und jenes versuchen, aber er wird immer wieder zu uns zurückkehren." Ludwig zuckte als Antwort nur mit den Schultern. Plötzlich aber wurde er wieder lebhaft. "Sieh mal, Gunda, wer da zu uns kommt!" "Wahrhaftig, das ist der Benno!" Ludwig stieg eilig die Treppe hinunter, um dem alten Freund ein Stück entgegen zu gehen. Er half ihm, vom Bock zu klettern, und umarmte ihn dann. "Ich kann kaum glauben, dass du es bist. Wie lange willst du bleiben? Erzähl, wie es dir ergangen ist! Erst einmal aber komm herein und fühle dich wohl bei uns!" Er geleitete seinen Gast ins Haus hinein. Von einem kleinen Vorraum gingen zwei Türen ab. Geradezu gelangte man in eine große Küche, in die auch die Holztreppe zum Obergeschoss hineingebaut war, nach links in die Gute Stube. Ludwig öffnete die linke Tür und ging voran. In der Guten Stube sammelten die Jevers all ihre Schätze. Gegenüber der Tür stand eine Truhe aus französischer Werkstatt mit spiralförmigen Metallbeschlägen als Verzierung auf allen Seiten. Sie enthielt Wäsche und Kleider, die allenfalls zu den hohen Festtagen benutzt wurden. Und weil man sie so selten öffnete, war sie mit einem bestickten Tuch bedeckt. Auf dem Kamin rechts in der Ecke waren silberne Kannen und Becher zu einer Gruppe zusammengestellt, und Benno konnte sich nicht erinnern, sie jemals anders als blitzblank geputzt gesehen zu haben. Ludwig ließ seinem Freund Zeit, sich umzusehen. Bald aber kam Gundula mit einem Krug Wein und zwei Bechern. Sie begrüßte den Freund ihres Mannes und versprach, auch etwas zum Essen zu bereiten. "Du musst doch hungrig sein nach der Reise!" "Oh, so arg ist es nicht mit dem Hunger. Du solltest dich lieber zu uns setzen und dich mit uns unterhalten." Davon aber wollte sie nichts wissen. Vielmehr rief sie die Magd herbei, und schon bald roch es im ganzen Haus nach gebratenem Fleisch. "Ein Zuhause, in das man Abend für Abend zurückkehren kann, das lässt sich nicht mit Gold aufwiegen", seufzte Benno. "Es ist wie der Hafen für ein Schiff, wenn am Horizont der Sturm aufzieht. Der Herr hat dich reich beschenkt." "Nun ja, so ein Wanderleben, wie du es führst, hat immerhin auch so seine Vorteile", entgegnete Ludwig mit Verschwörermiene, doch der Fernhändler ging auf die Anspielung nicht ein, sondern fuhr fort zu klagen. "Ich irre umher wie der Geist eines Erhängten. Mein Sohn ist jetzt fünfzehn, und ich müsste ihn als Nachfolger einweisen, aber ich sehe ihn kaum viermal im Jahr. Die Tochter redet kaum noch mit mir. Ich weiß nicht, warum sie mir so sehr grollt. Sie hat Geheimnisse mit Clara. Ich möchte nur 16 wissen, was Clara treibt, wenn ich nicht da bin. Als wir noch Brautleute waren ..." Allmählich verlor Ludwig die Geduld. Schließlich sagte er ziemlich direkt: "Du hast schon anders geredet, vor allem wenn du in der Schwalbengasse warst." Benno zuckte zusammen. Er wollte erwidern, dass ihn weder die Häuser der schönen Frauen noch seine Friedelehen wirkliches Glück brächten, dachte mit besonderem Gram an seine neue Magd, die sich ihm verweigerte wie einem Ungeheuer, zog am Ende aber zu schweigen vor. Wie Ludwig es mit der Moral tatsächlich hielt, hatte er nie herausgefunden. Einerseits gab er Verständnis selbst für die üppigsten Ausschweifungen vor, andererseits führte er selbst offenbar ein äußerst ehrbares Leben. Gundula Jever hatte ihren ersten Mann früh verloren und dadurch im Alter von nicht einmal siebzehn Jahren eine Seidenweberei geerbt. Zunächst übernahm ihre Schwiegermutter die Anleitung der drei Lehrmädchen und besetzte auch die frei gewordene Meisterstelle in der Innung. Als die junge Witwe dann Ludwig heiratete, gab es einige bösartige Auseinandersetzungen darum, wem denn nun in dieser neuen Lage der Betrieb gehöre. Schließlich einigte man sich auf eine Lösung, die sich bald als sehr geschickt erwies. Das Jeversche, vor drei Generationen von einem friesischen Einwanderer gegründete Handelsunternehmen und Gundulas Seidenweberei wurden zu einem Seidenamt vereinigt. Von diesem Tage an hatte Ludwig die Rohstoffe besorgt und die fertigen Tuche verkauft, die erfahrene Meisterin wie vor der Neuvermählung ihrer Schwiegertochter die Weberei geleitet und Gundula die Verbindung aufrecht erhalten. Die harten Worte von einst waren längst vergessen. Angesichts guter Geschäfte, die inzwischen einen gewissen Luxus erlaubten, herrschten Zufriedenheit und Einvernehmen. Der Aufstieg besaß allerdings auch ein paar weniger angenehme Seiten. Die Jevers wurden beachtet und auch beneidet, und manch einer wartete nur darauf, ihnen einen Makel nachzuweisen. Nicht zuletzt deshalb hütete sich Ludwig sorgsam, sich jemals in zwielichtigen Straßen sehen zu lassen. Benno fühlte sich ihm gegenüber mitunter wie einer jener Sünder, die als abschreckende Beispiele in Kirchenportale gemeißelt waren. So wechselte er lieber das Gesprächsthema. "Hast du immer noch so viele Abnehmer für das Seidentuch deiner Frau wie vor einem Jahr?" "Mehr noch als damals. Vor genau acht Monaten bin ich mit dem Domkapitel ins Geschäft gekommen und setze seitdem mehr ab, als wir selbst herstellen können. Ich verkaufe jetzt auch für zwei andere Seidenwebereien. Ja, und wenn sich so ganz nebenbei noch etwas ergibt ... Ich kann wirklich nicht klagen. Jetzt aber musst du erzählen. Wie war 's in Polen?" "In Polen lief 's noch recht gut, aber dann in Lübeck und in Bremen ... Die Leute zahlen nicht mehr wie früher und das Risiko ist groß. Wie viel Schiffe versinken im Sturm! Wie viel Wagenzüge werden von Räuberbanden ausgeraubt! Wie viel Ladungen verderben durch zu viel Sonne oder zu viel Regen!" "Was soll dieses Gejammer? Bist du ein Weib? Wenn ein Fernhändler hier in Köln keinen Gewinn macht, muss er ein arger Tölpel sein." Eigentlich lag Ludwig noch sehr viel mehr auf der Zunge. In seinen Augen war Benno einfach zu ungeschickt, zu kleinlich und vor allem zu ängstlich, um 17 so reich zu werden wie viele Seinesgleichen. Gewiss musste ein Fernhändler mit dem Verlust seiner Ware rechnen, doch gab es genügend Möglichkeiten zur Vorsorge. Die Kaufmannsgilden versicherten ihre Mitglieder gegen fast alle Unglücksfälle. Die Mutigsten borgten sich von reichen Witwen große Summen Geld, um den Handel im großen Stil zu betreiben, so dass ein kleiner Raubüberfall keine Rolle mehr spielte. In diesem Moment war es Ludwig jedoch peinlich, so satt und zufrieden vor seinem aus irgendeinem Grund bekümmerten Freund zu sitzen und ihm Ratschläge zu erteilen. "Lass uns endlich auf unser Wiedersehen trinken!" rief er aufgeräumt, hob den Weinkrug und begann, unverfängliche Klatschgeschichten aus der Stadt zu erzählen. Unterdessen mussten Eike, Ole und die beiden Mädchen die Wagen von der Straße holen, die Pferde versorgen und zumindest einen Teil der Waren in den Keller bringen. Ludwigs Knecht half ihnen dabei. Zwischen dem schmalen Wohnhaus und einem flachen, lang gestreckten Wirtschaftsgebäude bildete eine enge Durchfahrt den Zugang zum Hof. Ole, der sich nicht vorsah, stieß mehrmals mit seinem Wagen an der Wand an. Hinter dem Wohnhaus lagen die Ställe. Die Jevers hielten sich für den Eigenbedarf eine Kuh und zwei Schweine, dazu ein paar Hühner. Pferde besaßen sie nicht. Da aber gelegentlich Kaufleute bei ihnen übernachteten, gab es auch Pferdeboxen. Das Wasser allerdings musste vom Nachbargrundstück geholt werden. Drei Familien hatten sich zu einer Brunnengemeinschaft zusammengeschlossen. Ludwigs Knecht war ein ruhiger, freundlicher Bursche, mit dem sich Franziska sofort gut verstand, und der ihr alles zeigte, wonach sie fragte. Hin- ter dem Hof aus festgestampftem Lehm lag der Garten mit Obstbäumen, Sträuchern und Beeten. Das Wohnhaus, das Wirtschaftsgebäude, die Ställe, die Häuser des rechten Nachbarn sowie eine Hecke hinter dem Garten schlossen das Anwesen nach allen Seiten ab und ließen es unantastbar erscheinen. Entladen konnten die fünf nur noch wenig, denn schon bald brach die Dunkelheit herein. Im Wirtschaftsgebäude waren mehrere Räume den Dienstleuten zum Wohnen vorbehalten. Im größten davon bauten sie aus zwei Böcken und einer langen Eichenholzplatte einen Tisch auf, legten eine nicht mehr ganz saubere Decke darauf und aßen dann daran. Es gab eine Krautsuppe mit Fleisch, dazu reichlich Brot. Jeder füllte sich seine Schale aus der großen Schüssel, und dann war lange nur das Klappern der Holzlöffel zu hören. Franziska sah mehrmals heimlich zu Eike hinüber. Seit dem Zwischenfall in Münster war er ihr nie wieder zu nahe getreten. Jetzt schien er sogar ausgesprochen guter Stimmung zu sein. Nachdem er seine Suppe gegessen hatte, unterhielt er die ganze Runde mit seinen derben Späßen und prahlte zudem damit, am nächsten Tag drei Krüge voll guten Wein besorgen zu können. Trotzdem wollte sie sich weiterhin vor ihm in Acht nehmen. Daran dachte sie auch, als nach dem Abendessen der Hausherr zu ihnen kam, um jedem der Neuankömmlinge einen Schlafplatz zuzuweisen. Ludwigs Knecht hatte eine große Kammer, in der auch für Eike und Ole noch genügend Platz war. Die Magd hingegen schlief in einem für drei Menschen viel zu engem Verschlag. Deshalb stellte es der Kaufmann den beiden Mädchen frei, ob sie in den Strohspeicher neben der Knechtskammer oder lieber in den Keller unter dem Wohnhaus gehen wollten. Franziska entschied sich für den Keller. 18 Der hatte nur einen einzigen Zugang. Vom Hof aus führte eine bedenklich wankende und knarrende Holztreppe hinunter. Die Mädchen tasteten sich im Schein einer kleinen Kerze langsam vorwärts. Das Lager hatte als Ganzes fast denselben Grundriss wie das Haus. Die wahre Ausdehnung fiel allerdings nicht sofort auf, weil es von Mauern in sechs kleine Räume unterteilt wurde. Allem Anschein nach brauchte Ludwig diesen ungewöhnlich großen Keller tatsächlich, denn bis zur Decke gestapelte Ballen und Kisten verwandelten ihn in ein Labyrinth mit nur engen Gängen dazwischen. Franziska fragte sich, wie Bennos Wagenladungen hier noch Platz finden sollten. Für jemanden, der sich wie die beiden Mädchen möglichst gut verstecken wollte, konnten die Räume freilich nicht voll gestellt genug sein. Franziska baute für sich und ihre Schwester im hintersten davon eine Höhle, tarnte sie so gut wie möglich und sorgte zusätzlich noch für einen Fluchtweg. Nur um die niedrigen Fenster, die auf die Straße führten, kümmerte sie sich nicht, denn die waren mit Gitterstäben gesichert. Nach einem Dankgebet für die glückliche Ankunft schliefen die beiden ein. II A m nächsten Morgen wollte sich Benno schon zeitig auf dem Markt umsehen, um sich einen guten Platz zu sichern und mit dem die Aufsicht führenden Marktherrn die amtlichen Fragen zu klären. Ludwig begleitete ihn als Berater. Die Mädchen sollten mitkommen, um ihre Aufgaben kennen zu lernen. Eike und Ole schlossen sich unaufgefordert an, weil sie die Wagen nicht allein abladen wollten. Der Markt war nicht weit entfernt. Die Sechs erreichten ihn nach nicht einmal einer viertel Stunde, indem sie von Ludwigs Hof aus der Ährenstraße bis zu den Resten der alten Römermauer folgten und dann nach rechts abbogen. "Es gibt mehrere Märkte in Köln", erklärte Benno. "Dieser ist nicht der vornehmste, aber hier kommen die Kaufleute vorbei, die in Frankreich waren." "Außerdem haben wir Friesen unseren besonderen Stolz", ergänzte Ludwig. "Wir sind Kölner und Friesen zugleich." An diesem Tage allerdings blieb der Platz einem Viehmarkt vorbehalten. Von allen Seiten her trieben Männer in der dunklen Arbeitskleidung der einfachen Leute ihre Rinder, Schafe und Ziegen heran. Auch einige Pferde wurden zum Verkauf gebracht. Die begehrtesten Plätze waren im Schatten der Bäume und in der Nähe der von einem Pumpenhaus gespeisten Tränke. Der Marktherr saß in einer besonderen Hütte genau in der Mitte des Platzes. Solange Benno und Ludwig mit ihm verhandelten, hatten die Knechte und Mägde frei. Franziska und Pentia schauten sich ein wenig um. Am meisten beeindruckte sie die gewaltige Kirche hinter der Römermauer, die ihnen schon am Tag zuvor aufgefallen war. Sie entdeckten eine Lücke in der Mauer, durch die sie auf einen hofähnlichen Platz gelangten. "Eine für Gott gebaute Burg!" meinte Pentia. Tatsächlich wölbten sich drei Chöre wie ein Schutzwall kleeblattförmig um den Altar. Zwischen je zwei von ihnen ragten schlanke Türme in den Himmel (wie geschaffen, um nach Feinden Ausschau zu halten). In der Mitte wie auf 19 einem Felsen erhob sich wuchtig ein achteckiger Aufbau. "Sicher können hundert Menschen gleichzeitig darin beten!" Eine dicke Frau in einem braunen, grobleinenen Kleid, die das hörte, lachte laut und rief: "Das würde den Chorherren nicht gut gefallen. Denen nämlich gehört die Kirche. Der Pfarrgemeinde haben sie nur einen kleinen Teil abgegeben, dort hinten, am anderen Ende. Andere Stiftsherren lassen die Bürger nur an besonderen Festtagen zu sich kommen. Du bist noch nicht lange in Köln?" "Nein", sagte Pentia. "Merk dir, Kleine: Köln ist eine Stadt voller Gefahren und voller Wunder zugleich." "Wie soll ich das verstehen?" Nun trat auch Franziska hinzu. Die dicke Frau genoss die Aufmerksamkeit der unverhofften Zuhörer und sagte geheimnisvoll: "Kommt mit! Ich zeige euch etwas." Dann ging sie mit den Mädchen um die Kirche herum auf die Westseite, wo ein Turm über dem Portal die Choranlage noch überragte. "Erkennt ihr die dunkle Stelle dort an der Wand?" "Das sieht aus, als ob dort einmal ein Haus stand." "Dort stand eine Hütte, die einer Witwe gehörte. Als sie vor ein paar Jahren starb, riss man sie ab. Jeder hier in Köln aber weiß noch von dem Wunder." Jetzt flüsterte sie nur noch, und den Mädchen fröstelte, obwohl die Sonne brannte. "Vor dreißig Jahren geschah es, dass das ganze Viertel in hellen Flammen stand. Die Menschen schrieen und liefen um ihr Leben. Nur jene Witwe blieb mit ihrer Tochter in ihrem Haus. Das Feuer kam näher und näher, doch sie fürchtete sich nicht, denn sie meinte, der Herr werde seine Apostelkirche nicht niederbrennen lassen. Indes, die Kirche brannte bald heller als alles ringsum. Am Ende blieb nur eine kleine Hütte weit und breit verschont - die Hütte der Witwe." In die Augen der Frau trat ein heller Glanz, und auch die Mädchen wurden angerührt von der Geschichte. Franziska trat ehrfürchtig an die Wand heran und betastete die dunkle Fläche. Sie wollte auch noch etwas fragen, doch plötzlich stand Benno neben ihr und zog sie mit sanfter Gewalt am Arm fort. "Warum darf ich mich nicht noch einen Moment mit der Frau unterhalten?" protestierte sie. "Was findest du Gutes an diesem Geschwätz?" "Sie hat uns eine schöne Geschichte erzählt." "Glaubst du, dass ich das nicht kann? Möchtest du, dass ich dir etwas erzähle?" Sie nickte zögernd, und er begann. "Vor vielen Jahren starb ein Erzbischof mit Namen Heribert. Und dieser Heribert sagte auf dem Totenbett voraus, dass ein Peligrimis, ein Fremdling also, sein Nachfolger sein werde, worüber alle, die davon hörten, sehr beunruhigt waren. Wenig später besuchte der Kaiser die Stadt, um selbst einen Nachfolger zu bestimmen, was damals sein gutes Recht war. Hier in St.Aposteln verweilte er, um sich eine Messe anzuhören. Die sprach ein sehr hässlicher Mensch, den er zuerst gering schätzte. Doch als er das Wort vernahm 'Gott hat uns gemacht, nicht wir selbst' gestand er sich beschämt ein, dass es schlecht ist, jemanden nur nach seinem Aussehen zu beurteilen. Er erkundigte sich nach dem Priester, und als er nur Gutes über ihn erfuhr, nahm er ihn mit und bestimmte ihn zum neuen Erzbischof. Sein Name war Pilgrim. Man hatte den heiligen Heribert nur falsch verstanden." 20 Franziska wusste nicht recht, was sie sagen sollte, als er schwieg und ihr forschend ins Gesicht sah. Eigentlich gefiel ihr die Geschichte, doch ahnte sie, warum Benno sie ihr erzählt hatte. Zu ihrem Glück kam Ludwig hinzu, und sie konnte sich beiseite stehlen. Benno hatte dank der Fürsprache seines Kölner Freundes vom Marktherrn einen guten Platz zugewiesen bekommen - nahe der Römermauer genau an jener Einmündung, durch die alle Kaufleute kamen, die zum Hahnentor in die Stadt gelangt waren. Allerdings musste er sich noch bis zum Ende des Viehmarktes gedulden. Es gab also nichts mehr zu tun, und Ludwig drängte, nach Hause zurückzugehen. Dabei merkte er, dass die beiden Knechte fehlten. "Habt ihr sie irgendwo gesehen?" fragte er die Mädchen. Franziska hob die Schultern, erklärte sich aber schnell bereit, nach ihnen zu suchen. Das war einfacher gesagt als getan, denn der weite Platz hatte sich mit Menschen und Tieren gefüllt und ließ sich kaum noch überblicken. Sie irrte ziellos von einem Ende zum anderen, bis sie die beiden zufällig in einer Seitenstraße entdeckte. Eike unterhielt sich mit drei jungen Männern. Das Sonderbare dabei war, dass diese Männer alle einen grauen Kittel von gleichem Schnitt trugen. Vielleicht gehörten sie einer Bruderschaft an. Während Franziska noch so dastand und beobachtete, wurde Eike auf sie aufmerksam und verabschiedete sich rasch. "Was willst du?" fragte er verärgert. "Herr Jever schickt mich, dich zu holen. Die Wagen müssen noch abgeladen werden." "Als ob das nicht noch Zeit hätte!" brummte er, folgte dem Mädchen dann aber. III V on der Guten Stube des Jeverschen Hauses gingen drei Türen ab. Die erste führte zum Vorraum und damit zum Ausgang, die zweite zur Küche, die dritte zu einem schmalen Gang, über den man die Viehställe und den Hof erreichte. Fensterlos wirkte er zu jeder Tageszeit düster wie ein Kellergewölbe. Umso erstaunlicher war, dass man an seinem Ende, kurz bevor er ins Nebengebäude mündete, noch auf den Eingang zu einem Zimmer stieß, einem großen und schönen Zimmer sogar, dem Hofzimmer. Hier durften nur besonders willkommene Gäste der Jevers wohnen. Dieses Privileg wurde auch Benno gewährt. Er kannte das Zimmer gut und ergriff auch diesmal wieder mit fast kindlicher Freude Besitz davon. Geschäftig räumte er seine Sachen ein und stellte alle Gegen- stände wieder an den Platz, an dem sie nach seiner Erinnerung zu stehen hatten. Pentia sollte der Magd zur Hand gehen. Die konnte sich nicht genug wundern über das drollige Geschöpf, das man ihr da zur Seite gestellt hatte. "Wie alt bist du?" fragte sie die Kleine, als sie mit ihr in der Küche Gemüse putzte. "Elf Jahre." "Und da stellst du dich noch so ungeschickt an? Musstest du nicht wie jedes Mädchen von sieben Jahren an arbeiten? Was hast du getan den ganzen Tag?" "Auch ich habe mit sieben Jahren schon gearbeitet!" verteidigte sie sich. "Aber anders ..." "Wie, anders?" Pentia wollte etwas erwidern, besann sich aber und presste die Lippen aufei- 21 nander, um nichts Unbedachtes auszuplappern. "Was soll diese Geheimnistuerei? Musstest du etwa auch nicht zum Einkaufen auf den Markt?" "Ich darf darüber nicht reden. Meine Schwester ..." Abermals brach sie ab und war nun dem Weinen nahe. "Ist ja gut! Aber komisch find' ich das schon. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal allein auf dem Markt stand, so als kleines Würmchen unter den vielen Leuten. Da musst du aufpassen wie ein Fuchs. Die Händler wollen dich betrügen und die Diebe dir deinen Korb wegnehmen. Die merken gleich, wenn du dich noch nicht auskennst. Und wenn ich nach Hause kam und hatte keinen Korb mehr, gab es eine Ohrfeige, dass mir der Kopf summte." Pentia hörte ehrfürchtig zu, und ihr war anzusehen, dass sie sich das alles nicht recht vorstellen konnte. Eike, Ole, Franziska und der Knecht luden unterdessen Bennos Wagen ab. Wieder war es Eike, der dabei das große Wort führte. "Mit dem Wein geht alles seinen Weg. Morgen feiern wir. Die Mägde und Knechte der Nachbarn sollen auch kommen. Es wird genug da sein für alle." Offenbar wollte er den Knecht beeindrucken. Der kümmerte sich freilich nicht um ihn, sondern suchte stattdessen Franziskas Nähe. "Kennst du diesen Eike schon lange?" fragte er sie leise. "Nein, ich bin erst den fünften Tag Magd." "Ich habe kein rechtes Zutrauen zu ihm." "Ich auch nicht. Ich möchte nur wissen, was das für Freunde sind, die er hier in Köln hat." "Vielleicht ist es besser, wenn wir es so genau gar nicht erfahren." Der nächste Tag war ein Sonntag. An Sonntagen durfte in Köln niemand arbeiten. Die Leute holten ihre besten Kleider aus den Truhen und Schränken und gingen zum Gottesdienst. Auch bei den Jevers war die besondere Stimmung zu spüren. Gundula kämmte wieder und wieder die Wellen ihres dunkelblonden Haares, das zu ihrem Leidwesen zu weich war, um sich zu einer guten Frisur legen zu lassen. Ludwig lief kreuz und quer über den Hof und beaufsichtigte die Vorbereitungen zum Aufbruch wie ein Feldherr, der sein Heer in die Schlacht führt. Nur Hans, seinem Sohn, ging er aus dem Wege, denn er wollte sich vor dem Gottesdienst nicht durch ein unbeherrschtes Wort versündigen. Für Franziska und Pentia war der Kirchgang ein sicheres Zeichen, dass sie wieder in ordentlichen Verhältnissen lebten. Die Kirche des Viertels lag stadteinwärts am Ende der Ährenstraße und war dem heiligen Aper geweiht, dem Schutzpatron der Schweinehirten. Die trieben einmal in der Woche ihre Tiere auf der dahinter liegenden Straße zum Neumarkt. Von der Drift auf dem verschütteten Graben der Römermauer stieg (besonders im Sommer) betäubender Gestank auf. Gegenüber standen graue, windschiefe Gebäude. Sie waren zum Teil Herberge, zum Teil Hospital. Die Pilger, die zu den Reliquien der Heiligen Drei Könige in den Dom gehen wollten und in der Herberge abstiegen, blieben meist nur eine Nacht und fragten nicht nach irdischen Gütern. Die Mittellosen und Kranken im Hospital mussten zufrieden sein mit dem, was sie bekamen. Wegen der ärmlichen Umgebung traute ein Fremder der St.Apern-Kirche von außen kaum zu, dass sie drinnen den anderen Pfarrkirchen an Schönheit durchaus Konkurrenz bieten konnte. Die friesischen Kaufleute aus dem Vier- 22 tel hatten sie mit etlichen Spenden bedacht. Es gab keinen Pfeiler, der nicht durch ein Epitaph oder eine Heiligenfigur geschmückt war. Franziska und Pentia vermochten bei ihrem ersten Besuch noch gar nicht all diese Schönheit zu erfassen. Freilich hatten sie auch wenig Zeit dafür, denn mehr noch fesselten sie die Leute um sie herum. Hier in der Kirche kamen sie Woche für Woche alle zusammen - die Kaufleute mit ihren Mägden und Knechten, die Schweinehirten, die Handwerker, arme wie reiche, die Bettler aus dem Hospital, die Schlächter und Bäcker, die Tagelöhner. Sie alle standen dicht beieinander, denn es war viel zu eng hier, um einander auszuweichen. Hier tauschte man auch die Neuigkeiten aus. Ein paar junge Mädchen kicherten. Zwei heißblütige Burschen stritten miteinander über den Ausgang eines Ringkampfes. Es war ziemlich laut, ohne dass sich jemand daran störte. Die Leute fühlten sich geborgen und vom Alltag erlöst, und da konnten sie nicht ehrfürchtig sein wie die Mönche und Kanoniker in den vornehmen Klöstern und Stiften. Sie ehrten Gott, indem sie sich benahmen, wie ihnen gerade zumute war. Der Priester musste energisch werden, um mit dem Gottesdienst beginnen zu können. Am Abend trafen sich auf dem Hof des Jeveranwesens die Mägde und Knechte aus dem halben Viertel, nicht weniger als dreißig Leute insgesamt. Eike hatte Wort gehalten und soviel Wein herangeschafft, dass er auch bei fünfzig Gästen nicht in Verlegenheit gekommen wäre. Gundula fühlte sich etwas unbehaglich angesichts dieses Gelages der Dienstleute. Ludwig aber spielte sich, wenn es ihn nichts kostete, gern als gütiger Herr auf, und so hatte er sein Einverständnis gegeben. Mit am Tisch saß übrigens auch Hans, der Sohn des Hofherrn. Aller- dings fiel er kaum auf in dieser Runde. Er redete nicht anders als die Knechte und wäre vielleicht ein passabler Handwerker geworden, hätte er die Möglichkeit dazu gehabt. Er war (anders als sein Vater dachte) durchaus ehrgeizig und beharrlich. Nur der Handel, eben das wozu Ludwig ihn zwingen wollte, der lockte ihn nicht. "Jeder Handel ist eine Betrügerei. Diese Krämerseelen treffen sich eines Tages alle in der Hölle wieder", rief er, und es hörte ihm kaum noch einer zu, weil jeder hier diese Meinung von ihm schon ein Dutzend Mal gehört hatte. Franziska saß in seiner Nähe und sah ihn sich an. Etwas an ihm fiel ihr auf. Sie wusste aber lange nicht, was es war und woran es sie erinnerte. Dann, ganz plötzlich, kam sie darauf - die Kette an seinem Hals, diese eiserne Kette mit dem Kruzifix daran! Solche Ketten hatten die drei Männer vom Neumarkt getragen. Wenn Hans aber derselben Bruderschaft angehörte und Eike dort ein und aus ging (wahrscheinlich sogar krügeweise guten Wein von dort bekam), warum sprach er dann mit ihm den ganzen Abend über fast kein Wort? Offensichtlich mochten die beiden einander nicht. Franziska wollte gern mehr von Hans erfahren und spitzte die Ohren, während er sich mit seinem Nachbarn unterhielt. Leider verstand sie nur Satzfetzen, da der Wein die Stimmung lockerte und der Hof von Lachsalven dröhnte. "... die Alten merken nicht, was los ist ... habe ja versucht, mit ihnen zu reden ... Denen geht ihr Hausfrieden über alles. Was denen nicht ins Weltbild passt, das gibt es eben nicht. So eine Arschruhe muss man haben. Ha! ... Mit der Organisation geht es gut. Wir sind schon ..." Es hatte keinen Zweck. Sie wurde nicht schlau aus dem, was sie verstand. So fiel es ihr leicht, ihrer Schwester 23 nachzugeben, die müde war und gehen wollte. IV I rgendwo auf dem Wege von der Kirche nach Hause blieb Gundula Jever, ohne es zu merken, mit ihrem Kleid hängen. Als sie es zurück in den Schrank hängen wollte, sah sie bestürzt, dass in die kunstvolle Stickerei am Saum ein fingerlanger Dreiangel gerissen war. Nun saß die Magd damit in der Guten Stube und bemühte sich redlich, den Schaden zu beheben. Franziska beobachtete sie eine Weile dabei. Dann trat sie kurz entschlossen an sie heran und nahm ihr das Kleid vorsichtig aus der Hand. "Lass mich das machen! Dazu braucht man eine Nadel mit einem kleinen Haken. Habt ihr so eine im Haus? ... Nun, vielleicht geht es auch mit zwei dünnen Holzstäben." Die Magd beeilte sich, alles heranzuschaffen, was sie an Nähzeug hatte, und beobachtete dann erleichtert und verwundert zugleich, wie sich der Riss unter Franziskas Händen allmählich wieder schloss. "Wie geschickt du bist! Das hätte ich dir niemals zugetraut." "Ich bin nicht geschickt bei solcher Arbeit. Wirklich nicht! Aber ich hab's eben mal gelernt." "Bist du in einem Kloster erzogen worden?" Franziska lächelte. "Mach dir keine Gedanken darüber! Brauchst es auch der Herrin nicht zu sagen. Sagst einfach, dass du dir viel Mühe gegeben hast!" Die Magd war aber eine zu ehrliche Seele, um mit der Wahrheit hinterm Berg zu halten. Gundula kam noch am selben Abend zu dem jungen Mädchen und dankte ihr überschwänglich: "Es ist nichts mehr zu sehen von dem Schaden. Dich hat der Himmel geschickt. In der Truhe liegt so vieles, was nicht mehr ganz in Ordnung ist. Möchtest du dich darum kümmern?" "Gern!" "Wir können dich gar nicht wieder fortgehen lassen ..." Gundula sprach sofort mit Benno. Der sträubte sich nur kurz, und so brauchte Franziska ihren Dienstherrn nicht auf den Markt zu begleiten, sondern saß stattdessen mit Handarbeiten im Haus. Dabei musste sie schmunzelnd zurückdenken an die Tage im Palas des Wildeshausener Schlosses unter der Aufsicht der Burgvogtsfrau, die sie zutiefst gehasst hatte. Noch immer fiel ihr schwer, die vor Ungeduld zitternden Hände zu bezwingen. Dennoch hatte sie nun Spaß daran. Von den Jevers wurde sie für das, was sie mit Mühe und Not zustande brachte, nicht gerügt oder ausgelacht, sondern ausschließlich gelobt. Gundula schwärmte sogar vor den Nachbarn davon. Ungerechter Weise gelangte Pentia, die der großen Schwester bei allen schwierigen Stellen helfen musste, nicht zu solchem Ansehen. Niemand wollte glauben, dass die stille, schüchterne Kleine weit begabter war. Benno wurde durch seine Geschäfte jetzt häufig auf dem Markt festgehalten und sah Franziska selten. Wenn er aber kam, denn suchte er sofort ihre Nähe, meistens unter einem Vorwand. Er kam wie zufällig in die Gute Stube, fragte nach Ludwig, blieb dann neben dem jungen Mädchen stehen, sah ein wenig beim Sticken zu und begann ein Gespräch. 24 "Es ist immer noch so heiß. Wenn nicht bald Regen fällt, gibt es eine Missernte." Franziska versuchte weiterzuarbeiten. Doch wenn sie abgelenkt wurde, widerfuhr ihr fast immer ein Missgeschick. So auch diesmal. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, legte sie die Decke, die sie gerade in den Händen hielt, seufzend beiseite und war nun gezwungen, sich ihrem Dienstherrn zuzuwenden. "Was sagtet Ihr?" "Ach, nichts Wichtiges! Ich will nur sehen, wie es dir geht." Er setzte sich neben sie. Jetzt spürte sie seinen Atem auf ihren Wangen, wenn er mit ihr sprach, und unterdrückte mühsam den Drang, sich abzuwenden. Im Grunde hatte sie sich schon etwas an ihn gewöhnt. Er tat ihr Leid in seiner Einsamkeit, und sie hatte sich manches Mal vorgenommen, ihm als Magd ein guter Kamerad zu sein. Doch wenn er sich ihr so aufdrängte, stieg unbezwingbarer Ekel in ihr auf, und alle Vorsätze waren dahin. Sie wurde einsilbig und wartete ungeduldig ab, bis er sie wieder in Frieden ließ. Als sie zwei Wochen später auf Gundulas Bitte hin eine Altardecke zu sticken begann (als Spende für die Kirche von St.Apern bestimmt) missfiel ihm das sehr. Den Gesetzen nach durfte er sich als fremder Kaufmann nur sechs Wochen in der Stadt aufhalten, während die Decke wohl wenigstens drei Monate Arbeit erforderte. Pentia lernte unterdessen bei der Magd, wie man einkauft und Essen zubereitet. Eike und Ole gingen ihrem Dienstherrn auf dem Markt zur Hand und trieben sich in ihrer freien Zeit irgendwo in der Stadt herum, allem Anschein nach nicht gemeinsam. 25 3.Kapitel I D er Keller, in welchem Franziska und Pentia nach wie vor die Nächte verbrachten, war kaum übersichtlicher geworden, seit Benno einen großen Teil seiner Waren verkauft hatte. Die Barrieren von Kisten und Ballen, die den Schlafplatz wie Burgmauern abschirmten, weckten nicht mehr nur angenehme Gefühle in ihnen. Seit sie nicht mehr um ihr Leben fürchteten, fühlte sie sich manchmal eingeengt. Sie konnten nicht mehr übers weite Land blicken, wie sie das gewohnt waren. Sie kannten (nach einem ganzen Monat) sogar von Köln nur den Neumarkt, die Kirche St.Apern und die wenigen Straßen dorthin, wusste nicht einmal, wo sich Gundulas Seidenweberei befand. Bei Einbruch der Dunkelheit stellte Franziska sich oft an eines der vergitterten Fenster. Die untere Kante befand sich nur eine Handbreit über der Straße, die obere bildete einen lang gestreckten Bogen. Wo mochten die Leute tagsüber gewesen sein, deren Füße dort vorübereilten? War der Keller Zuflucht oder Gefängnis? Nach besonders langweiligen Tagen sehnten die Schwestern sich nach ein wenig mehr Abwechslung, einen unverhofften Zwischenfall. Als ihnen ihr Wunsch dann aber vom Schicksal unvermittelt erfüllt wurde, bereuten sie ihn schon wieder. Etwas Merkwürdiges ging plötzlich vor im Keller. Pentia hörte es zuerst und sprang sofort auf. "Das ist nur eine Maus", versuchte Franziska zunächst zu beschwichtigen. "Nein, das sind Schritte. Hör doch! Da schleicht jemand hinter den Ballen entlang." "Also gut, ich werde nachsehen, damit du dich beruhigst." Dabei stieß sie auf etwas Ungeheuerliches. In einem der Fenster fehlten zwei der eisernen Stäbe! Sie hatten sich so sicher gefühlt in ihrem Versteck, und dabei konnte jeder, der sich auskannte, ohne Mühe zu ihnen einsteigen! Nun begann auch Franziskas Herz zu klopfen. Jemand außer ihnen war im Keller. Soviel stand fest. Aber was wollte der Einbrecher? Wusste er, dass hier zwei Mädchen ihr Nachtlager hatten? Und vor allem: Wo war er? Erst einmal trat Franziska vom Fenster weg, denn dort war sie im Vollmondlicht gar zu gut zu erkennen. Dann schlug sie, ihre Ortskenntnis nutzend, ein paar Haken im Labyrinth der Durchgänge und wartete still in einer dunklen Nische ab. Der Einbrecher aber wartete auch. Sekunden vergingen und erschienen dem Mädchen wie eine Ewigkeit. Endlich wieder ein Geräusch! Ganz leise. Oh, das war ein schlauer Bursche, der nicht so rasch einen Fehler beging! In Franziska indes erwachte der ritterlich Mut der Westerholts. Langsam glitt sie immer näher heran an jene Stelle, wo sie ihn vermutete. Nun war sie ihm ganz nah, hörte sein Atmen. Er musste ahnen, dass sie ihn entdeckt hatte. Dennoch floh er nicht. Er war sich offenbar seiner Sache sehr sicher. Franziska zögerte lange und wusste nicht, was sie tun sollte. Dann aber kam ihr plötzlich eine Erkenntnis. Nein, der Einbrecher war sich seiner Sache nicht sicher. Im Gegenteil! Er versteckte sich und hatte mehr Angst als sie. Er wusste doch, dass sie ein Mädchen war, seit er sie im Mondlicht gesehen hatte! Sie nahm also ihr Herz in beide Hände, sprang auf wie eine Katze und stürzte sich auf den Eindringling. Tatsächlich hatte sie ihn mit ihrem wilden Angriff blitzschnell überwältigt und ins Licht gezerrt. Vor ihr stand zitternd ein zierliches Mädchen mit vom Hunger ausgezehrtem, spitzen Gesicht und mattblonden Haaren, die kurz und wirr wie von der Sonne vertrocknete Grasbüschel nach allen Seiten abstanden. Die Arme hielt sie vor dem Körper, weil sie erwartete, geschlagen zu werden. Mit ihren unnatürlich großen Rehaugen suchte sie verzweifelt nach einer Möglichkeit zum Entkommen, ohne sich aber an Franziska vorbei zu wagen. "Was hast du hier unten zu suchen?" "Ich ... ich habe Hunger und ... und dachte ... Bitte dem Herrn Jever nichts sagen! Ich ... ich werde ..." Franziska führte sie schließlich, von Mitleid überwältigt, behutsam zu ihrem Versteck. "Wir verraten dich nicht. Du kannst uns vertrauen. Morgen besorge ich dir etwas zum Essen. Hier unten gibt es leider nur Stoffe, Kleider und Gerümpel ... Aber sage mir, woher du weißt, wie man hier reinkommt. Du hast die Gitterstäbe bestimmt nicht herausgesägt." "Ich breche nicht wieder hier ein!" "Schon gut! ... Wie heißt du eigentlich?" "Anne." "Und wie alt bist du?" "Vierzehn." Franziska blickte sie erstaunt an. Anne war ein Jahr älter als sie und trotzdem fast einen Kopf kleiner! Und nicht nur das. Alles an ihr schien schlecht gewachsen oder verkümmert zu sein, wie bei einem Strauch im Schatten eines großen Baumes. Zweifellos gehörte Franziska zu den kräftigsten und reifsten Mädchen ihres Alters, doch einen solchen Unterschied erklärte das nicht. "Erzähl mir ein wenig von dir!" "Ich komme aus dem Waisenhaus. Meine Eltern sind aussätzig geworden. Vielleicht leben sie noch draußen im Melatenhospital vor dem Hahnentor. Wahrscheinlich aber sind sie längst tot." Franziska erinnerte sich, dass Benno ihr die Häuser und die hohe Mauer darum beiläufig gezeigt hatte. Damals aber, unter dem Eindruck der gewaltigen Torburg, hatte sie nicht an Krankheit und Tod denken mögen, schon gar nicht an die unglücklichen Menschen dort, die (von ihren Familien fortgerissen) nun nur noch von Gestank und Elend umgeben waren. Die Prüfmeister kannten kein Erbarmen. Bei wem die Anzeichen gefunden wurden, der verschwand für immer hinter den Mauern eines der Leprosehäuser, ohne die Verwandten ein letztes Mal umarmen zu dürfen. "Hast du sonst keine Angehörigen in Köln?" "Nein. Jedenfalls kenne ich keine. Im Waisenhaus ging es mir noch gut. Aber dort durfte ich dann nicht mehr bleiben ..." Franziska fragte sich (mit ein wenig schlechtem Gewissen) warum Gott die Menschen so ungleich behandelte. Mit sieben Jahren war die Kindheit überall zu Ende. Aber während die einen Handarbeit, gute Sitten und feine Künste lernten (oder fechten und reiten) und sich um ihr Essen nicht zu sorgen brauchten, wurden die anderen auf die Straße gestoßen, obwohl die Schwestern in den Waisenhäusern wussten, dass die meisten dort zu Grunde gingen. Es dauert lange, bis Anne sich beruhigte und vertrauensvoller wurde. Franziska musste sie fast zwingen, die Nacht über im Keller zu bleiben. Erst als die Mädchen nebeneinander liegend die mattsilberne Mondscheinbahn anstarrten, weil sie nicht schlafen konnten, begann sie von sich und ihrem Bettlerleben zu erzählen. Für die Schwestern von der Wardenburg war das ein Blick in eine ihnen völlig fremde Welt mit 27 ganz eigenen Regeln. Schließlich antwortete Anne auch noch auf die Frage nach den Gitterstäben. Sie steckten schon seit Monaten nur lose in der Verankerung. "Ich weiß nicht, wer sie heraus gebrochen hat. Ich weiß nur, dass der Sohn vom Herrn Jever mit seinen Freunden manchmal am späten Abend dort einsteigt." "Der Hans? Warum nimmt der seine Freunde nicht mit auf sein Zimmer?" "Im Frühjahr jedenfalls habe ich ihn hier beobachtet. Jetzt nicht mehr." "Weil meine Schwester und ich jetzt hier sind!" Franziska dachte an das eiserne Kruzifix und an die Gesprächsfetzen von der großen Feier im Hof. Vermutlich hatte die sonderbare Bruderschaft den unübersichtlichen Keller für geheime Versammlungen genutzt. Das war ein beunruhigender Gedanke, zumal sie nicht einfach zu Ludwig gehen und ihm den Schaden zeigen konnte. Sie hätte damit auch der Bettlerin den Zugang versperrt. II A nne kam von nun an jeden Abend und verschwand am nächsten Morgen bei den ersten Sonnenstrahlen. Das Gefühl, nicht mehr allein zu sein, war schon eine große Hilfe für sie. Zudem aber bekam sie auch noch genügend Brot und zuweilen etwas Wurst und Käse. Franziska fand immer wieder Wege, etwas vom Essen abzuzweigen, ohne dass es auffiel. Aus Barmherzigkeit entwickelte sich Freundschaft. Die kleine Bettlerin war glücklich in dieser Zeit, glücklich soweit ihr Misstrauen dem Leben gegenüber dieses Gefühl zuließ. Allerdings hatte Franziska den Eindruck, als wisse sie etwas, das sie vor sich selbst verdrängte und vor ihren neuen Kameradinnen verbarg, ein Geheimnis, das mit irgendeiner dunklen Gefahr zusammenhing. In manchen Nächten war ihr Schlaf so leicht wie der eines Vogels. Einmal verhielt sie sich besonders merkwürdig. Diesmal bedrängten die Schwestern sie so lange, bis sie zumindest sagte: "Sie trinken wieder." Mehr allerdings war ihr nicht zu entlocken. Mitten in der Nacht erwachte Franziska plötzlich. Sie hörte Männerstimmen und sah den rötlich flackernden Schein einer Fackel. Erklären konnte sie sich das nicht. Sah Ludwig mit dem Knecht nach dem Rechten? Sie tastete nach Anne. Ihre Hand stieß auf ein leeres, noch warmes Nachtlager. "Sie sind durch das Fenster gekommen", flüsterte Pentia. "Fünf Männer! Ich habe sie vorbeigehen sehen." "Durch das Fenster sind sie gekommen? Dann kann es nicht Ludwig sein ... Versteck dich dort in der Lücke zwischen den beiden Ballen!" "Und du?" "Ich werde die Männer beobachten." Wo war Anne? Der Widerschein der Fackeln an den Wänden schuf einen solchen Wirrwarr von Irrlichtern, dass Franziska nie wusste, wo genau sich die Eindringlinge gerade aufhielten. In welcher Weise sie ihrer Freundin würde helfen können, darüber dachte sie nicht nach. Sie hoffte, ihr fiele im entscheidenden Moment etwas Gutes ein. Plötzlich drang Lärm zu ihr herüber. Schreie, schnelle Schritte, das Krachen einer herabstürzenden Kiste, Anzeichen einer Hetzjagd. Sie wollte sofort loslau- 28 fen, blieb dann aber doch in der sicheren Deckung. Aus den Stimmen erkannte sie die von Eike und Hans heraus. Ersterer gebärdete sich als Anführer. Allerdings hörte offenbar niemand auf ihn, als er schrie: "Das ist sie nicht! Was findet ihr denn an einer Bettlerin? Ihr werdet euch was wegholen bei der! Oh, verflucht! Wir hatten uns vorgenommen, dieser hochmütigen Zicke von Magd eine Lehrstunde zu geben, damit sie lernt, vor einem Mann die Augen niederzuschlagen ... Ach, leckt mich doch am ...!" Hans redete unterdessen auf jemanden ein, dessen Ausdrucksweise auf einen brutalen Dummkopf schließen ließ. Auch er hatte wenig Erfolg. Nachdem der andere ihn drohend gefragt hatte, ob er seine Brüder im Stich lassen wolle, verstummte er. Ein Vierter übergab sich gerade. Der fünfte, ein Halbwüchsiger im Stimmbruch, redete mit seiner krächzenden Stimme immerfort, ohne eine einzige Antwort zu erhalten. "Ich muss ihr helfen! Ich muss ihr helfen!" hämmerte es in Franziska. Ihr war, als würden dicke Ketten sie am Boden festhalten. Dann aber gellten ihr spitze Schreie in den Ohren und sie wurde tollkühn. Blitzschnell sprang sie auf, rannte zur Treppe, riss die Tür auf. Mit einem dicken Knüppel, den größten den sie in der Eile fand, schlug sie gegen ein eisernes Gestell. Der Lärm schallte durchs ganze Haus und hätte wohl Tote aufgeweckt. Dazu brüllte sie, wieder und wieder, bis ihr die Stimme versagte: "Einbrecher! Einbrecher! Einbrecher im Haus!" Endlich hörte sie, wie die Männer flüchteten. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie sie durchs Fenster zurück auf die Straße kletterten. Der brutale Dummkopf erwies sich als ein ungewöhnlich kräftiger Mann Mitte Zwanzig mit einer langen Narbe am Arm. Ihm folgten Eike und Hans. Dann kam ein Bursche von siebzehn oder achtzehn Jahren, der in seiner Statur dem Ersten ähnelte, aus dem der Wein jedoch einen schwankenden, lallenden Koloss gemacht hatte. Ein Junge mit noch zarten Gesichtszügen trottete hinterdrein. Sie alle trugen die grauen, halblangen Kutten, nicht aber das eiserne Kruzifix. Vielleicht glaubten sie, Christus auf diese Weise verheimlichen zu können, was sie taten. Dann waren die Männer verschwunden. Im Keller hatten sich wieder Dunkelheit und Stille ausgebreitet. Irgendwo tropfte Wasser. Vor den Fenstern rauschte der Wind. Franziska tastete sich zur Guten Stube hinauf, wo ständig eine Öllampe brannte. Daran entzündete sie eine Fackel und eilte zurück. Anne lag mit geschlossenen Augen am Boden. Ihre Kleider waren noch etwas mehr zerrissen als ohnehin. Ob sie Verletzungen erlitten hatte, ließ sich nicht erkennen. "Anne, hörst du mich?" sprach Franziska sie besorgt an. Die Bettlerin schlug die Augen auf und lächelte verkrampft. "Du hast mir das Leben gerettet. Warum?" "Das ... das war doch selbstverständlich." "Das verzeihen sie dir nie. Und sie sind gefährlich ... Bei den ersten Sonnenstrahlen werde ich von hier verschwinden und nie zurückkehren ... Das solltet ihr auch tun." Franziska blickte sie bestürzt an, erst jetzt begreifend, dass das Unheil dieser Nacht auch sie selbst betraf. "Herr Jever wird uns doch beschützen! ... Und mein Herr, der Kaufmann Benno. Er liebt mich insgeheim. Der würde nie zulassen, dass ich ..." Annes trauriges, wissendes Lächeln ließ sie verstummen. Sie fühlte sich diesem erbarmungswürdigen Mädchen 29 plötzlich ganz und gar unterlegen. Was wusste sie schon - von Köln, von dem was draußen vorging, außerhalb des Jeverschen Grundstücks, von der Bruderschaft, deren Angehörige in grauen Kitteln umherliefen? "Wir sollten zusammenbleiben." "Nein. Ich bringe euch kein Glück." "Sag so etwas nicht!" "Es ist aber so." Von der Treppe her waren Schritte zu hören - zweifellos die von Herrn Jever, der (durch Franziskas Rufe aufgeschreckt) die vermeintlichen Einbrecher vertreiben wollte. Anne versetzte das in panische Angst. "Ich muss fort!" flüsterte sie und rannte zum offenen Fenster hin. Franziska zögerte einen Moment und fand dann keine Gelegenheit mehr, sie zurückzuhalten. Später machte sie sich Vorwürfe deswegen. Wie mochte es Anne mitten in der stockdunklen Nacht ergangen sein? War sie womöglich den Graukitteln noch einmal durch bösen Zufall in die Arme gelaufen? Warum hatte ihr Ludwig Jevers Auftauchen solche Angst eingejagt? Sie erfuhr die Antworten auf diese Fragen nie, denn sie bekam die kleine Bettlerin Zeit ihres Lebens nicht wieder zu Gesicht. Zunächst musste sich Franziska überlegen, wie sie dem Hausherrn den Lärm erklären sollte. Von den Einbrechern war nichts mehr zu sehen (von den heraus gebrochenen Gitterstäben im Fenster abgesehen). Es fehlte auch nichts, was auf die Anwesenheit von Räubern hätte hindeuten können. Als Herr Jever vor ihr stand, brachte sie keinen sinnvollen Satz über die Lippen. Sie murmelte etwas von einem Alptraum, übergab dann die Fackel und schlich sich zurück zu ihrem Lager, wo Pentia sich schon schlafend stellte. Ludwig betrachtete eine Zeitlang kopfschüttelnd die Fackel und begab sich dann zurück in seine Schlafkammer. III W o bleibt sie nur?" Gundula begann sich ernsthaft zu sorgen, denn es war schon heller Tag und die sonst immer so zuverlässige Franziska saß noch immer nicht an ihrer Altardecke. "Soll ich in den Keller gehen und nach ihnen sehen?" bot die Magd sich an. "Auch Pentia ist noch nicht da. Vielleicht sind die beiden krank." Nach einer ganzen Weile kam sie sichtlich verwirrt zurück. "Ich verstehe das nicht. Es ist ein Rätsel." "Was verstehst du nicht? Was ist ein Rätsel?" "Sie sind weg! Verschwunden!" Ludwig und Benno traten hinzu. "Du hast nur oberflächlich nachgesehen. Zwei Menschen verschwinden nicht so einfach." Dann stiegen die Männer selber hinunter in den Keller. Ole, der gerade auf den Hof kam, gähnend und verschlafen wie immer, schloss sich ihnen an. In den vergangenen beiden Wochen hatte seine Trägheit ein solches Maß erreicht, dass es selbst bei ihm auffiel. Er tat wirklich keinen nützlichen Handschlag mehr. Ludwig entdeckte die aus dem Fenster gebrochenen Gitterstäbe, die herab gerissene (und zersplitterte) Kiste, die Unordnung am Ort der Hetzjagd - und war sich dann seiner Schlussfolgerungen ganz sicher: "Einbrecher sind eingedrungen. Franziska hat sich also nicht geirrt. Wegen 30 ihrer mutigen Rufe sind diese Halunken ohne Beute geflohen. Wann wird endlich etwas gegen solches Gezücht unternommen? Man kann im eigenen Hause ermordet werden!" Ole schlenderte zwischen den Ballen und Kisten umher, als langweile er sich. Niemand achtete auf ihn. Dann aber meldete er sich ganz gegen seine Gewohnheit plötzlich zu Wort. Er grinste überlegen und sagte zu Ludwig: "So weit, so schlecht! Doch wo sind die Mädchen geblieben? Haben die Einbrecher sie entführt? Nein, sicherlich nicht! Ihr habt mit Franziska gesprochen, als jene Bösewichte schon geflohen waren. Euch scheint der Blick ein wenig getrübt, Herr. Ich meinerseits denke, hier unten fand schon oft Sonderbares statt. Seht Euch die Stäbe an! Die hat man nicht erst gestern heraus gebrochen." Ludwig lagen grobe Erwiderungen auf der Zunge. Wenn ein fauler Knecht zudem noch unverschämt wird, ist das Maß wahrhaftig voll. Die Verblüffung indes ließ ihn schweigen. Er fragte sich, wo dieses Stück Holz solche klugen Gedanken hernahm, und ließ ihn reden. Auch Benno wunderte sich. Er hatte sich längst daran gewöhnt, den kleinen, unscheinbaren Burschen mit den kurzen, strähnigen Haaren für strohdumm zu halten. Jetzt hoffte er auf ihn. "Weißt du, wo die Mädchen sind?" Ole verstärkte sein breites Grinsen. "Nein. Wahrscheinlich sind sie geflüchtet. Wer auch immer hier unten (ohne des Hausherrn Wissen und Erlaubnis) ein und aus geht, er hat den beiden einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Sie wollten keine Nacht mehr hier sein." "Sie leben also noch ..." "Für Euch sind sie tot, Herr. Ihr werdet sie wohl nicht mehr wieder sehen so wie mich." "Was willst du damit sagen?" "Dass ich fortgehe. Bei Euch ist nichts zu gewinnen. Ihr werdet es nie zu etwas Großem bringen. Euch hängt das Unglück an wie ein Fluch." Ludwig fragte sich, warum sein Freund sich solche Reden gefallen ließ. Er selbst hätte sich eine Strafe einfallen lassen, Benno war eben zu weich. Vielleicht hatte dieser Ole sogar ein wenig Recht mit seiner Behauptung. "Übrigens gibt es jemanden, der vielleicht viel besser über die vergangene Nacht Bescheid weiß als ich. Eike nämlich ist erst heute früh zurückgekehrt woher auch immer ..." Bei diesen Worten stand er schon auf der Treppe. Sie waren der letzte Hieb seiner Rache. Ja, es war eine Rache, eine lange geplante, lange undurchführbare, hundertmal aufgeschobene Rache. Es gab vieles, wofür er sich rächen wollte. Benno hatte ihm die schmutzigsten und eintönigsten Arbeiten gegeben, Eike ihn als Handlanger für seine Gaunereien benutzt, Franziska ihn einfach übersehen. Für sie alle war er nicht mehr als ein Stück Holz. Niemand hatte auch nur in Erwägung gezogen, dass er mehr konnte, als nur nach Bennos Kommandos zu springen gleich einem Hund, den man einen Stock apportieren lässt. Er war nicht gefühllos. Er hatte gelitten und auf seine Stunde gewartet. Nun endlich war diese Stunde gekommen, und er genoss sie. Sichtlich zufrieden ging er davon. Benno starrte ihm wortlos nach, ohne einen Versuch, ihn zu halten, während ihm ganz andere Gedanken durch den Kopf gingen. Was war mit dem Hinweis auf Eike gemeint? Er erinnerte sich des Zwischenfalls vor den Toren von Münster. Erstaunlich behände für seine Statur, lief er die Treppe hinauf, überquerte den Hof und stürmte in die Kammer der Knechte hinein. Eike lag auf seiner Bank. In der Luft stand ein widerlich säuerlicher Gestank. 31 "Hoch mit dir, du Hund!" Er rüttelte ihn, bis er trotz seiner Betrunkenheit wach war. "Was hast du mit Franziska gemacht?" "Ich weiß gar nicht, wovon Ihr redet, Herr." "Du hast sie umgebracht, und dafür wirst du büßen. Für dein ganzes verfluchtes Leben wirst du büßen. Ich weiß alles von dir. Mit sieben Jahren warst du ein Taschendieb. Dann hast du in Bremen eine Bande von Straßenräubern angeführt. Auch von dem Mord am Hafen weiß ich ..." Ludwig kam hinzu und verfolgte verwundert Bennos Zornesausbruch. Was hatte das Verschwinden der beiden Mägde mit Eikes Vergangenheit zu tun? Gewiss war er einer, dem man nicht blind vertrauen durfte. Musste er aber deshalb gleich Franziska auf dem Gewissen haben? "Du wirst die Mädchen wieder finden", redete er beschwichtigend auf den Freund ein. "Sie sind davongerannt, kommen aber wahrscheinlich bald zurück." Er wollte noch mehr sagen, wurde aber von seiner eigenen Magd gestört. "Da ist eine Frau, die sagt, dass sie Euch unbedingt sprechen will." "Was für eine Frau? Weshalb will sie mich denn sprechen?" Eine krumme Gestalt schwer bestimmbaren Alters kam hereingeschlichen und blieb demutsvoll an der Tür stehen, hin und her gerissen zwischen lähmender Furcht und dem Vorsatz, ihr Anliegen um jeden Preis vorzubringen. "Ich komm' der Abrechnung wegen, und damit ich neue Aufträg' erhalt ..." Ludwig wandte sich ihr zu, und es schien, als würde er zu einem Riesen wachsen. "Abrechnen willst du also? Nun gut! Warum hat das eigentlich so lange gedauert diesmal?" "Viele Leut' geh'n lieber auf'n Markt, als dass sie ..." "Ha, das möchte ich gern glauben!" Ludwig trat ganz dicht an die Käuflerin heran, tastete ihr zerschlissenes Kleid mit den Blicken ab und verzog das Gesicht, als ekle er sich zu Tode. "Trotzdem habe ich da einen Verdacht: Du verleihst die Kleider, die ich dir gebe, bevor du sie verkaufst." "Um Gottes Willen! Nein! Ich schwör's Euch, gnäd'ger Herr: Ich bin immer ehrlich gewesen." "Ich sollte dir den unrechtmäßigen Gewinn von deinem Anteil abziehen." "Oh nein! Das dürft Ihr nicht tun, gnäd'ger Herr! Wir müssen ja so schon Hunger leiden." Die arme Frau war nahe daran, auf die Knie zu sinken. Ludwig unterdessen genoss seine Macht. Nach einer langen Pause sagte er leutselig: "Gut, ich will für diesmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber mein Mitleid hat Grenzen. Ihr brauchtet keinen Hunger leiden, wenn dein Mann wie jeder anständige Bürger arbeiten würde anstatt zu trinken, und wenn dein Sohn kein nichtsnutziger Herumtreiber wäre." Wieder kam die Magd herein. "Verzeiht mir, dass ich erneut störe! Da ist noch ein Mann ..." "Ich habe keine Zeit!" schrie Ludwig unbeherrscht. "Er trägt am Hals eine goldene Ziernadel mit einem Kruzifix. Vielleicht solltet Ihr ..." "Eine goldene Ziernadel mit einem Kruzifix? Gott steh mir bei! Das ist der neue Mittelsmann des Domkapitels. Wie konntest du ihn warten lassen!" "Bringe ich die Leut' herein, ist's verkehrt, halt ich sie auf, ist's auch verkehrt", brummte die Magd und stapfte davon. "Du sollst dir die Leute ansehen!" rief Ludwig ihr nach. 32 Dann lief er diensteifrig zum Eingang hin. Wie er wenige Augenblicke zuvor gewachsen war, schrumpfte er jetzt in sich zusammen. Eine Persönlichkeit, die so viel Ehrerbietung verdient, wollte auch Benno sehen. Er vergaß seinen Knecht und folgte dem Freund. Diese Gelegenheit nutzte Eike. Nachdem er sich hastig angezogen hatte, lief er an seinem verdutzten Dienstherrn vorbei quer über den Hof davon. Was er zurücklassen musste, war nicht viel wert, und seinem Herrn trauerte er erst recht nicht nach. 33 4.Kapitel I U do war zeitig aufgestanden, zu zeitig, um schon zu Bruder Theobaldus gehen zu können. Auf der Baustelle trafen gerade die ersten Arbeiter ein. Zwischen den jetzt knapp mannshohen Pfeilern des künftigen Chors hing noch der Morgennebel. Der eher kleine, aber äußerst kräftige Fünfunddreißigjährige lief zwischen den wie mutwillig verstreut überall auf dem Platz liegenden, noch unbehauenen Blöcken umher und verfolgte ungeduldig, wie um ihn herum allmählich der neue Tag erwachte. Das Geviert gehörte ursprünglich dem Gelehrtenstift St. Andreas, dessen Kirche auf der anderen Straßenseite (ein wenig hinter Häusern versteckt) stand. Ein Brand hatte sie vor ein paar Jahren schwer beschädigt, doch war sie inzwischen mit erzbischöflicher Hilfe wieder aufgebaut worden - in alter Pracht und mit einem noch höheren Vierungsturm. Einen Teil seines Reichtums verwendete das Stift seit Jahrzehnten für sein großes Hospital. Es diente vor allem Studenten und Pilgern als Unterkunft, aber auch weiblichen Obdachlosen, die in Gefahr standen, ein sündiges Leben zu beginnen. Die Werke der Barmherzigkeit gaben der Einrichtung den Namen St. Maria Magdalena, und sicherten den Stiftsherren den Dank der Stadt. Die Baustelle hing allerdings nicht mit dem benachbarten Hospital zusammen. Die Gelehrten von St.Andreas hatten einen Teil des Geländes abgetreten an die Brüder des DominikanerPredigerordens, von denen seit 1221 immer mehr aus Bologna und Paris nach Köln kamen. Sie besaßen in der Stadt inzwischen einen eigenen Konvent. Heinrich, ihr (kürzlich verstor- bener) erster Prior, hatte den Bau einer Kirche energisch vorangetrieben. Große Teile des einst weitläufigen Gartens waren freigelegt worden. Dort wuchs der Bau nun allmählich aus den Grundmauern heraus. Udo hatte zu ihm eine besondere Beziehung. Er versinnbildlichte für ihn etwas Erhabenes, das er schwer in Worte zu fassen vermochte. Obwohl er kein Fremder in der Stadt war und auch noch kein Dominikaner, durfte er in einem den neuen Mönchen zur Verfügung stehenden Teil des Hospitals wohnen. So konnte er Tag für Tag die Fortschritte verfolgen. Der Grundriss und damit die Ausmaße der künftigen Kirche ließen sich bereits erkennen. Sie würde St.Andreas in dieser Hinsicht noch übertreffen. Alles hier erinnerte an Aufbruch. Alles war noch bescheiden, behelfsmäßig und trug dennoch schon den Keim künftiger Macht in sich. Udo besaß ein Gespür für künftige Macht. Diese Fähigkeiten hatte er anderen voraus. Er unterwarf sich den Starken, ehe es alle taten, in der Hoffnung, dass diese ihm das später danken würden. Inzwischen war die Gemeinschaft der Mönche seine Familie. Um ein vollwertiges Mitglied werden zu können, musste er sich allerdings erst noch bewähren. Darauf hatte er sein ganzes Leben ausgerichtet. Dies war das Wichtigste für ihn. Dennoch musste er sich an diesem Morgen vor Theobaldus verantworten. Im Grunde wusste er nicht, was er hätte anderes tun sollen. Er war an der Affäre nicht beteiligt gewesen, hatte erst nachträglich davon erfahren. Doch das zählte nicht vor Bruder Theobaldus und vor den ehernen Geset- zen der Gemeinschaft. Wie auf der Stadtmauer jeder wehrfähige Kölner beim Heranrücken von Feinden auf einem bestimmten Platz seine Pflicht erfüllen musste, so trug auch in der Gemeinschaft jeder seine besondere Verantwortung. Die Canes hatten Schande gebracht über die Gemeinschaft - und zwar gerade Udos Gruppe. Endlich kamen die Mönche zurück von der Morgenandacht. In strenger Formation überquerten sie gemessenen Schritts den Hof und wirkten außerordentlich würdig dabei. Das weiße Habit gab ihnen im scharfen Kontrast zum schwarzen Mantel einen Hauch Unfehlbarkeit. Die tief in die Stirn hineinreichende Kapuze nahm dem Einzelnen seine Besonderheit. Dort schritt nicht eine Gruppe von Männern, dort schritt ein Teil des Ordens. Udo wartete eine angemessene Zeit ab, dann folgte er Theobaldus auf dessen Zimmer. Eigentlich war das Zimmer nur eine Kammer, deren einziger Schmuck in einem Kreuz aus dunkel gebeiztem Holz bestand. An Mobiliar gab es nichts außer einer breiten Bank, die am Tage zum Sitzen, bei Nacht zum Schlafen diente. Dennoch war die Kammer ein Privileg. Gewöhnliche Mönche schliefen in den zwei großen Sälen. Als Udo an die Tür klopfte, hatte Theobaldus gerade seine Bibel zur Hand genommen. Mit einer Antwort ließ er sich Zeit. Er wusste, wer dort stand, und das Wartenmüssen sollte die erste Strafe sein. Während er über den Hintersinn eines bestimmten Verses angestrengt nachdachte, vergaß er den Mann vor der Tür beinahe. Dann endlich rief er ihn herein mit einem kurzen, harten "Ja!" Trotz seiner breiten Schultern und den Armen, die Gerüchten nach ein Pferd anheben konnten, erinnerte Udo in diesem Moment an ein Kind, das vor dem Vater zittert. Theobaldus war einen Kopf größer als er, dabei allerdings schlank. Rings um seine Tonsur wuchs ihm ein Streifen kräftigen, fast grauen Haares. Dadurch wirkte er älter als er war. Gerade erst Vierzig geworden, zählte er unter den Geistlichen durchaus noch als jung. Sein eher unauffälliges Äußere war es nicht, was ihm Macht über den Hünen gab. "Was hast du zu berichten?" Er sah ihn aus seinen grauen Augen scharf an. Udo hob kurz den Kopf und senkte ihn sofort wieder, als er diesem Blick begegnete. "Seit einigen Wochen gehört ein Neuer zu unserer Gruppe, einer aus dem Norden. Er zieht die anderen hinab." "Du hast ihn aufgenommen?" "Ja." "Was hast du getan, ihn im Sinne der Gemeinschaft zu erziehen?" "Nicht genug." "Du siehst ein, dass du Strafe verdient hast?" "Ja." "Gut. Wir werden heute Abend vor den Brüdern darüber befinden." Er wandte sich ab und blickte zum Kruzifix an der Wand hinauf, als sei, was er nun sagte, für den gekreuzigten Christus bestimmt und nicht für Udo, der enttäuscht hatte. "Die Dominikaner sind die Hirten, die Canes aber die Hütehunde. Beide halten sie gemeinsam die Herde beieinander. Nichts ist schlimmer für den Hirten, als wenn seine Hütehunde seinen Befehlen nicht gehorchen, während Wölfe die Herde umkreisen. Nur über den Gehorsam führt der Weg in den Himmel." Er wandte sich wieder Udo zu und sprach nun mit solchem Nachdruck, dass jedes Wort anmutete wie ein Schlag: "Über vollständigen, bedingungslosen Gehorsam!" 35 "Bedingungslosen Gehorsam", bestätige Udo. "Es wird über die Canes geredet in der Stadt, über die Canes und über deren Verbindungen zu uns, den Brüdern vom Orden der Prediger. Nicht über deine unselige Gruppe. Was sie getan hat, fällt auf die heilige Sache zurück. Fünf Verworfene betrinken sich in einer Schankstube, bedrohen die übrigen Gäste und werden hinausgeworfen. Damit nicht genug, schlagen sie sich mit den Knechten eines angesehenen Kaufmanns und zerstören das Hebewerk eines Brunnen, dass man es bis heute noch nicht wieder benutzen kann. Und selbst damit nicht genug, dringen sie in den Keller eines Hauses ein, das einem angesehnen Bürger gehört, einem Zulieferer des Doms. Das alles fällt auf Christus zurück, der für euch Verfluchten am Kreuz gestorben ist!" Jetzt brüllte er, dass Udo zusammenfuhr und bis an die Wand zurückwich. "Ich habe nachgedacht, ob ich euch alle aus der Gemeinschaft ausschließen lasse." "Oh, Bruder Theobaldus, gebt uns eine letzte Gelegenheit, uns von unserem Fehler zu reinigen!" "Ihr werdet die Gelegenheit erhalten. Vor allem aber müsst ihr eure Treue zur Sache beweisen. Die Bürger glauben durch eure Schuld, die Canes seien eine Bande von Wegelagerern, Räubern und Trunkenbolden." Wieder wandte er sich dem Kruzifix an der Wand zu und verharrte davor einige Zeit wie im Gebet. Dann begann er in der Kammer auf und ab zu laufen, wenn auch nur zwei, drei Schritt, weil der Platz für mehr nicht ausreichte. Anders vermochte er die plötzlich in ihm aufsteigende Erregung nicht zu bezwingen. "Wir dürfen nicht schwach werden, an keinem Ort und in keinem Augenblick, denn wir sind Ritter in einer Schlacht gegen ein gewaltiges Heer von Ketzern, denen die hinterhältigsten und grausamsten Mittel gerade recht sind, um den christlichen Glauben und die römische Kirche zu vertilgen. Der Teufel und seine Dämonen flüstern ihnen tausend Schliche ein. Sie sind gefährlicher als Schlangen und grimmiger als Wölfe." Mehr und mehr sprach er nur noch zu sich selbst. "Aber sie werden uns nicht schwach finden. Rechtzeitig haben wir unsere Scharen gegen sie gesammelt. Erst wenige Jahre gibt es den Orden der Prediger und dennoch fürchten sie uns schon wie der Teufel das Kreuz. Ihre Macht schwindet. Niemand wird uns aufhalten können!" Sein Körper spannte sich, als gelte es, in einen Krieg im Wortsinn zu ziehen. "Auch von euch wird es abhängen, wie schnell wir die Welt von den Ketzern befreien", wandte er sich wieder an Udo. "Und nun geh und ermahne die dir Anvertrauten!" Udo verneigte sich ehrfürchtig und verließ rückwärts die Kammer. II N icht mit jedem konnte Theobaldus so umspringen. Die Prediger hatten Erstaunliches erreicht seit dem bescheidenen Anfang vor nunmehr sieben Jahren, aber sie besaßen noch längst nicht die selbe Macht wie in Frankreich, wo der König auf ihrer Seite stand. Die Kölner waren leicht zum Schwärmen zu bringen. Aber sie waren auch stolz, stolz auf ihren Reichtum, stolz auf ihren Einfluss auf die Politik, stolz und eigensinnig. Man 36 konnte sich ihrer niemals sicher sein. Die Dominikaner brauchten die Canes, ihre Hunde. Sie gaben das nicht zu, durften es nicht zugeben, aber es war so. Anders als die Frauen, die einer vergänglichen Leidenschaft frönten, waren jene jungen Burschen bereit, sich Befehlen zu unterwerfen. Für Udo empfand Theobaldus gleichermaßen Geringschätzung und Zuneigung. Er fühlte sich ihm überlegen wie ein Herr gegenüber seinem Knecht, wusste aber dabei, dass er sich auf ihn mehr als auf jeden anderen verlassen konnte. Er demütigte ihn nicht aus Unzufriedenheit, sondern um ihn immer noch mehr in seine Abhängigkeit zu ziehen. Kurz nachdem er ihn entlassen hatte, begab er sich zum Palast des Erzbischofs. Das Domareal mit seinen zahlreichen Gebäuden unterschiedlicher Art und Bestimmung begann unmittelbar hinter St. Andreas. Wer dorthin ging, tat es mit Ehrfurcht. Was hier entschieden wurde, betraf nicht allein die Stadt Köln, nicht nur das Rheinland, sondern oft das gesamte Reich. Deutschland hatte keine Hauptstadt im eigentlichen Sinne und auch kein dauerndes Machtzentrum. Zu unruhig waren die Zeiten und zu dicht lagen Aufstieg und Fall beieinander. Und doch meinten viele, das Herz Deutschlands schlüge in Köln - im Kölner Domareal. Die Nordgrenze bildete die hier noch gut erhaltene Römermauer. Einer ihrer Türme barg die erzbischöfliche Bibliothek. Eingequetscht und zugleich geschützt zwischen Mauer und Dom standen die Sakristei und die Goldene Kammer, von deren Schätzen man sich Unglaubliches erzählte. Im Westen umschlossen die zweistöckigen Klausurbauten des Domstifts einen großen, rechteckigen Hof. Auf der Rheinseite verband ein altes Atrium mit Säulengängen den Dom mit der Kirche des hochadligen Herrenstifts St. Maria ad Gradus. Im Süden waren dem Dom zwei Atrien vorgelagert. Zwischen ihnen führte ein breiter Durchgang auf das Hauptportal des Doms und die Nikolauskapelle zu. Bei gutem Wetter bauten zahlreiche Krämer zu beiden Seiten dieses Durchgangs ihre Stände auf. Das kostete sie ein Pfund Pfeffer Miete im Jahr zu Gunsten des Domkustos, doch lohnte es sich für sie trotz allem. Noch weiter südlich schloss sich ein ausgedehnter Hof an, der gewissermaßen das Geistliche und das Weltliche sowohl trennte als auch verband. Den weltlichen Dingen, der Politik, widmete sich der Erzbischof in seinem gewaltigen Palast. Rainald von Dassel, der Freund und Berater Friedrich Barbarossas, hatte ihn vor einem halben Jahrhundert auf dem Gipfel seiner Macht errichten lassen. Dreistöckig und breit wie eine ganze Häuserzeile, barg er eine unübersehbare Anzahl von Räumen und übertraf an Pracht die meisten Kaiserpfalzen. Er war nicht nur glanzvolle Residenz sondern auch Sinnbild eines Anspruchs. An den schmalen Seiten des Platzes befanden sich Werkstätten sowie das Hospital Zum Heiligen Geist. Zwischen Hospital und Palast klaffte eine mit einer Mauer gesicherte Lücke, in deren Mitte ein Tor als öffentlicher Zugang diente. Zu besonderen Anlässen, wenn das Volk Einlass in den Dom erhielt, strömten hier Hunderte Menschen herein. Aber auch ohne besonderen Anlass war der Platz nie menschenleer. Pilger warteten geduldig, zum Schrein der Heiligen Drei Könige vorgelassen zu werden. Kaufleute strebten dem Palast zu, um mit dem erzbischöflichen Hof vielleicht das Geschäft ihres Lebens abzuschließen. Auch Juden (zu erkennen an ihren Schläfenlocken) waren unter ihnen. Übrigens fielen sie hier 37 weniger auf als anderswo - wegen der Gesandten aus fernen Ländern, die ebenso fremd erschienen. Stumm wie Schatten schritten Mönche der verschiedensten Orden dahin. Hochrangige Adlige oder kirchliche Würdenträger ließen sich zuweilen von einem Gefolge begleiten, um ihren Reichtum oder ihr Amt zur Schau zu stellen. Theobaldus nahm dies alles kaum noch wahr. Es musste sich schon etwas Außerordentliches ereignen, um ihn zum Aufsehen zu veranlassen. Ohne durch lasterhafte Neugier Zeit zu verschwenden, wandte er sich hinter dem Tor scharf nach rechts, erreichte auf dem kürzesten Wege die Stufen des Palastportals und betrat die Eingangshalle. Die bewaffneten Wächter kannten ihn und hielten ihn nicht auf. Über eine Wendeltreppe erreichte er das erste Obergeschoss. Dort klopfte er an eine Tür. Ein großer, sehr schlanker Mann Mitte Fünfzig, Dominikaner wie er selbst, empfing ihn. "Gott sei mit Euch, Bruder Maginulfus!" begrüßte er ihn. Das Zimmer war groß und hell. An der Wand hing, auf eine Holztafel gemalt, ein Marienbildnis. Der Teppich stammte vielleicht aus dem Orient. Theobaldus vermochte sich schwer an diese Pracht zu gewöhnen - weil sie den, der den Raum nutzte, geradezu verhöhnte. Es gab selbst unter den Mönchen nicht viele, die den Äußerlichkeiten so wenig Wert beimaßen wie Bruder Maginulfus. Theobaldus kannte ihn seit über zwanzig Jahren. An die Anfänge erinnerte er sich oft und gern. Als blutjunger, unerfahrener Mann war er unter den Schirm einer Benediktinerabtei getreten und hatte bereits in der ersten Woche seinen Lehrer gefunden. Schon damals galt Maginulfus als ein Mann mit besonderen Fähigkeiten und (das wohl vor allem) besonderer Frömmigkeit. Über seine Eltern und Verwandten sprach er nie. Vielleicht hatte er sie längst aus seinem Gedächtnis getilgt. Siebenjährig kam er ins Kloster, wo er gemeinsam mit zwanzig Jungen seines Alters bei einem strengen Novizenmeister die Härten des Mönchsdaseins kennen lernte. Doch während seine Schicksalsgefährten sich in Heimweh verzehrten und sich angewöhnten, an die Rute zu denken, wenn jemand von der Bibel sprach, fiel er durch seinen Eifer auf. Wie die anderen wurde auch er verprügelt, und zu den Schlägen des Meisters kamen bei ihm noch die Hiebe der Mitnovizen, die ihn nicht mochten. Das aber konnte die Glut in ihm nicht löschen, fachte das Feuer eher noch an. Der Zeit der Prügel folgte ein schneller Aufstieg. Als Theobaldus ihm zum ersten Mal begegnete, war er als künftiger Abt im Gespräch. Später ergab sich aber, dass man ihn zu einem Studium an die Universität von Paris schickte, wo er sich bei den Professoren den Ruf eines streitbaren Parteigängers des Papstes erwarb. In Paris trat er dann dem Dominikanerorden bei. Theobaldus war seinem Lehrer nach einem Jahr an die Universität gefolgt. Er hatte es dort niemals zu vergleichbarem Ansehen gebracht. Dafür war es ihm aber gelungen, als praktisch denkender Mensch und treuer Anhänger seinem Lehrer unentbehrlich zu werden. Daran hatte sich seither nichts geändert. Im Unterschied zu Theobaldus empfand Maginulfus sein Arbeitszimmer im Palast nicht als Verhöhnung. Für ihn war es ein notwendiges Zugeständnis, das er (als enger Vertrauter des Erzbischofs) für Verhandlungen brauchte. Nachts schlief er im Hospital St. Maria Magdalena in einer Kammer, die jene seines Mitbruders an Dürftigkeit noch übertraf. Er verachtete Irdisches so sehr, dass ihn sogar der Reichtum, mit dem er 38 sich umgeben musste, nicht anfechten konnte. "Ist etwas geschehen, wovon ich wissen sollte?" "Eine Gruppe unserer Canes hat sich schlecht betragen. Es gab Gerede. Ich werde in Zukunft für mehr Gehorsam sorgen." Maginulfus winkte beschwichtigend ab. "Breche mir unseren jungen Wölfen nicht die Zähne aus! Sie sind verbittert und zornig. Dabei haben sie noch nicht gelernt, ihre Kraft in rechter Weise einzusetzen." "Ich fürchte, dass uns entgleiten könnte, was wir heraufbeschwören." "Du bist ein Ritter im Mönchsgewand, Bruder Theobaldus. Du möchtest unsere Heerscharen in vorbildlicher Schlachtordnung sehen und hast zu einem Teil recht damit. Schon unter den Regeln des heiligen Benediktus war das Gebot unbedingten Gehorsams das wichtigste. Doch ist nicht die höchste Form des Gehorsams der Gehorsam gegenüber Gott? Wer hat diesen heiligen Zorn in die Herzen dieser jungen Leute gepflanzt wenn nicht ER?" Maginulfus redete nicht mehr, er predigte. Seine Augen bekamen jenen sonderbaren Glanz, der nur Eiferern eigen ist. "Der Teufel ist ein schrecklicher Feind. Ich sah ihn zum ersten Mal als siebenjähriger Knabe im Kloster und vertrieb ihn mit einem armdicken Knüppel. Später wagte er sich nicht mehr in seiner wahren Gestalt vor mein Angesicht. Dafür aber kam er als Hund oder als schwarze Katze oder als Spin- ne, ja er kroch sogar in die Körper der Mitbrüder hinein." Theobaldus hatte das alles schon ein Dutzend Mal gehört. Dennoch war er fasziniert. Es gab etwas an Maginulfus, das den Zuhörer fast unabhängig vom Inhalt der Worte in seinen Bann zog. "Oh, wie gut ich den Zorn der Leute verstehe! Der Teufel schickt ihnen die Ketzer, um sie in Versuchung zu führen und zu bedrängen. Sie erleben, wie die Juden mit ihren Wucherpfennigen Äbte wie wohlfeile Dirnen kaufen. Sie dürsten nach Trost und Hoffnung, fordern Gerechtigkeit. Doch sie hören nur Hohngelächter als Erwiderung." Manchmal wunderte sich Theobaldus, dass vor allem die Frauen in Köln solchen Predigten voller Hingabe lauschten, ohne sich an der Gewalttätigkeit darin zu störten. Vielleicht gehören Schwärmerei und Gewalt in einer geheimnisvollen Weise zusammen. "Ein Sturm wird losbrechen. Nach Gottes Willen, nicht nach unserem. Wir sind nur Werkzeuge. Vergleiche unsere Canes nicht mit einem Ritterheer, Bruder Theobaldus! Vergleiche sie mit einem Fluss, der sein Bett noch nicht gefunden hat! Vergleiche sie mit dem erhabenen und zugleich schrecklichen Rhein!" Allmählich wurde Maginulfus wieder ruhiger und erinnerte sich, weshalb er seinen Mitbruder zu sich bestellt hatte. Er kam auf organisatorische Fragen zu sprechen, Alltäglichkeiten, die ihm lästig waren, die aber nun einmal einer Abstimmung bedurften. Nach knapp einer Stunde begab sich Theobaldus zum Hospital St. Maria Magdalena zurück. 39 III L udwigs Behauptung, die Mädchen würden wiederkommen, wenn sie ihren Schreck verwunden hätten, war der Strohhalm, an den Benno sich klammerte. Statt zum Markt zu gehen, wartete er - zuerst im Kontor am Fenster, dann vor der Haustür. Schließlich lief er die Ährenstraße auf und ab. Seine Hoffnungen gaukelten ihm Trugbilder vor. Er folgte fremden Mädchen durch mehrere Straßen und Gassen, bis sie sich beunruhigt nach ihm umdrehten und er seinen Irrtum bemerkte. Zugleich sprach er die Nachbarn an, ob sie die beiden irgendwo gesehen hätten oder Genaueres wüssten über jene Nacht. Hörte er von einem Verbrechen reden, erkundigte er sich voller Angst nach den näheren Umständen. Doch er erfuhr nichts, was ihm nutzte. Das Verschwinden seiner Mägde blieb ein Geheimnis. Einerseits hatten sie sich bei den Jevers bis zuletzt wohl gefühlt, andererseits waren sie offenbar freiwillig davongegangen (wie der verbitterte Ole). Warum hatte sich Franziska nicht einmal von Gundula verabschiedet? Warum hatte sie nicht einmal eine Botschaft, irgendein Zeichen hinterlassen? Benno geriet in immer größere Verzweiflung und benahm sich (zu Ludwigs Entrüstung) immer auffälliger. In der Kirche St.Apern bemühte er den Priester, für Franziska zu beten. Zugleich ging er zu einem Zauberer, der in Gefahr stand, von den Waffenknechten des Erzbischofs wegen gottlosen Treibens ergriffen zu werden. In der Nacht versuchte er, den Stand der Sterne zu deuten. Nach einer Woche aber gab er plötzlich auf. "Sie wird nicht zurückkommen", versicherte er jetzt ohne jeden Zweifel. Dabei klagte er sich selbst an, warf sich vor, sie in entehrender Weise beobachtet, mit seinem Gerede belästigt, mehrmals unschicklich angefasst zu haben. Er zerfleischte sich, ähnlich den Mönchen, die im Kloster den Verstand verloren, weil sie sich einen sündigen Gedanken nicht verziehen. Ludwig vermochte seinen Ärger kaum noch zu zügeln. Er hatte auf Gundulas Drängen hin etwas für seinen Freund getan, was gegen seine Prinzipien verstieß. Als Bennos sechswöchiges Aufenthaltsrecht auslief, aber einige lohnende Geschäfte noch offen standen, nutzte er seine Beziehungen zum Rat, um eine Verlängerung zu erwirken. Nun sah er, wie aus den Geschäften nichts wurde, weil andere schneller und entschlossener zugriffen. Er ahnte auch, worum Bennos Gedanken kreisten, während er abwesend vor sich hin starrte. Doch das entschuldigte ihn in seinen Augen nicht. Dass man die eigene Magd begehrte, das kam vor. Er selbst hatte seine Frau zweimal betrogen. Aber er war dabei seiner Arbeit nachgegangen. Er hatte sich mit jenen Mädchen vergnügt, ohne sich närrisch in sie zu verlieben. Gundula dachte zunächst anders. Ihr tat Benno aufrichtig Leid. Während ihr Mann ihm aus dem Wege ging, kümmerte sie sich mit fast rührender Sorge um ihn. Sie kochte ihm seine Lieblingsspeisen, erzählte ihm aufmunternde Geschichten, ließ die Magd sein Zimmer verschönern. Sie konnte damit freilich nicht verhindern, dass er sich weiter mit Selbstanklagen quälte. Schließlich hatte auch sie keine Lust mehr, sich in seiner Nähe aufzuhalten. Sein Missmut verwandelte das Haus in einen Trauerort, obwohl dafür gar kein Anlass bestand. 40 Eines Tages hatte die Magd den erlösenden Einfall: "Wenn er nicht zum Markt geht und auch nichts im Hause tut, dabei aber immerfort an Franziska denkt, so soll er doch nach ihr suchen - nicht nur hier im Friesenviertel sondern in der ganzen Stadt. Vielleicht findet er sie und bringt sie zurück. Dann wäre auch uns geholfen." Benno, neue Hoffnung schöpfend, ging sofort darauf ein. Den Neumarkt überquerte er mit langen Schritten. Seinen ehemaligen Platz nahe der Einfahrt würdigte er keines Blickes. Dort hatte ein anderer seinen Stand aufgeschlagen. Kunden drängten sich davor. Die Geschäfte gingen gut. Benno indes strebte, am Pumpenhaus vorbei, der Schildergasse zu. Da man auf diesem Weg zum eigentlichen Marktviertel gelangte, quoll sie von morgens bis abends geradezu über von Passanten, zwischen denen sich polternd größere und kleinere Wagen ihren Weg bahnten wie Schiffe im Meer. Fliegende Händler boten ihre minderwertige Ware an. In den Winkeln spielten Musikanten. Bessergekleidete zogen ganze Trauben von Bettlern und auch Dieben hinter sich her. Benno brannten die Augen, so sehr bemühte er sich, in diesem Durcheinander seine Mägde zu entdecken. Mehrmals glaubte er, sie gefunden zu haben, aber es war jedes Mal eine Täuschung. Zum Leidwesen jener Kaufleute, die mit größeren Wagen von Westen her kamen, führte die Schildergasse nicht direkt zum Altmarkt. Von dort, wo sie endete, mussten sie eine Schlangenlinie durch mehrere kleine Straßen bewältigen. Die erste hieß (aus einem selbst den Anwohnern nicht mehr verständlichen Grund) In der Höhle. Hier befand sich einst die erzbischöfliche Pfalz. Davon erhalten geblieben war ein Turm, der die umliegenden Häuser überragte. Er gehörte inzwischen einer Familie griechischer Abstammung, die ihn und das Anwesen rundherum mit viel Geld und noch mehr Sinn für Schönheit nach Patrizierart ausgebaut und mit dem (durchaus berechtigten) Namen Domus bellica versehen hatte. Benno fiel ein, dass Franziska inzwischen vielleicht einen neuen Herrn gefunden hatte. Sie war jung und hübsch und zu alledem noch fleißig und gutwillig. Vielleicht hatte sie das Herz jenes Winrich erobert, welcher der Familie zurzeit vorstand, und unterhielt sich gerade mit einem seiner Söhne. In Köln, wo die Standesunterschiede durch das Auf und Ab des Handels leicht durcheinander gerieten, kam so etwas durchaus vor. "He! Hast du keine Augen im Kopf?" Benno drehte sich erschrocken um und konnte gerade noch beiseite springen. Er hatte die von den Kaufleuten am meisten gehasste Stelle erreicht. Vor einer Zeile an die alte römische Stadtmauer gelehnter Häuser mussten die Wagen scharf nach links einbiegen. Nur wenige Schritt später bereits führte ein ebenso enger Bogen wieder nach rechts zu einem schmalen Tor. Die notwendigen Manöver erforderten einiges Geschick. Ging man an der zweiten Kurve geradeaus weiter, gelangte man in die Judengasse. Verstohlen warf Benno auch dort einen Blick hinein. Aber er mochte nicht glauben, dass die Mädchen hier gestrandet waren. Obwohl er noch keine schlechten Erfahrungen mit Juden gesammelt hatte, empfand er vor ihren Vierteln doch immer ein heimliches Grauen. Sie waren ihm fremd, diese Leute. Sie riefen Gott mit einem anderen Namen an, feierten andere Feste, trugen andere Kleider und andere Frisuren, hatten andere Moralvorstellungen. Übrigens wohnten hier nur die armen Juden, die kleinen Krämer und Pfandleiher zum Beispiel. Wer es zu etwas 41 gebracht hatte, kaufte sich woanders ein Haus. Die Familie Jude, die seit drei Generationen zur Riecherzelle der Patrizier gehörte, besaß im Süden ein gro- ßes Anwesen mit Baumgarten, Backhaus und Tavernen, dazu vor den Mauern Ländereien und Weinberge. IV Gaukler führten mitten im Gedränge die erstaunlichsten Kunststücke vor. Musikanten waren an manchen Tagen so zahlreich, dass sie sich gegenseitig störten und darüber in Streit gerieten. Und wollte jemand ein seltenes Tier vorführen, tat er es hier, da er nirgends sonst ein dankbareres Publikum fand. Zwei Marktherren in schmucker Uniform beaufsichtigten die Händler. Sie waren Mitglieder des Rates, und ihr Stolz auf die Amtswürde ließ sich kaum übersehen. Vier ebenfalls uniformierte Dienstleute halfen ihnen. Zwei von ihnen bedienten die städtische Waage, mit deren Hilfe jedermann die Waagen der Händler überprüfen konnte. Der Pranger, ein Käfig wie für ein Tier, der in der Nähe des Brunnens stand, war leer. Wegen der strengen Aufsicht wurde hier weniger betrogen als anderswo. Dafür verlangte man in der Regel etwas höhere Preise. Benno lief fast zwei Stunden lang kreuz und quer über den Platz. Franziska und Pentia fand er nicht. Stattdessen hörte er plötzlich eine Stimme, die ihm in gar nicht guter Erinnerung war. An einem langen Tisch saß Ole in einem neuen Rock aus gutem Stoff neben einem dicken, schnurrbärtigen Geldwechsler. "Alte Krämerseele, kennst du mich nicht mehr? Komm her du Geizkragen und sieh, was aus mir geworden ist, seitdem ich dir nicht mehr diene!" Das Prägen und Wechseln von Münzen und überhaupt der Handel mit Edelmetallen war in Köln das Privileg von vierzig Männern, den Münzhausge- O bwohl er überall suchte, glaubte Benno, dass er Franziska und Pentia (wenn überhaupt) auf dem Altmarkt finden würde. Nirgends sonst gab es so vieles zu sehen, was die Neugier junger Mädchen wecken konnte. Da sie zudem hungrig waren und fremd in der Stadt, musste auch der Duft nach den verschiedensten Lebensmitteln sie magisch anziehen. Gleich vorn, am Ende der Marktpfortengasse, gab es Äpfel und Birnen. Dahinter boten Bauern aus dem Vorgebirge Kraut und Rüben feil. Ein besonderer Bereich war den Getreidehändlern vorbehalten. Gegenüber, auf der Rheinseite, gab es Butter in großer Auswahl Kölnische Butter, Bergische Butter, Jülicher Butter. Die Verkäuferinnen, dicke Frauen mit roten Köpfen, schrieen so laut, dass man sie sogar aus dem allenthalben herrschenden Lärm noch heraushörte. Fische wurden am Brunnen verkauft - Hechte, Krebse, Schollen und Karpfen, auch Salzheringe aus großen Fässern. Die Metzger hatten eine ganze Kette von Ständen aufgebaut, denn jeder von ihnen durfte nur eine bestimmte Fleischsorte feilbieten - nur Schwein, Schaf und Hammel der eine, nur Rind ein anderer, nur Kalb ein dritter. Dann gab es noch Stände für Gewürze, für Sämereien, für Lederwaren. Auch alles, was die Frauen an Geräten im Haus benutzten, war zu kaufen - Tontöpfe, Zinnkrüge, Drechslerwaren. Selbst eine Apotheke fehlte nicht. Aber man handelte auf dem Altmarkt nicht nur mit Waren zum Anfassen. 42 nossen, die unmittelbar in den Diensten des Erzbischofs standen. Sie gehörten nicht zu den vornehmsten unter den Ministerialen, hatten sich aber einige besondere Vorrechte gesichert. Wenn zum Beispiel einer ihrer Mitglieder starb oder wegen Unehrlichkeit ausgeschlossen wurde, wählten sie ohne Einfluss des Kirchenfürsten einen Nachfolger. Das Prägen und Umtauschen der Münzen erledigten sie sicherheitshalber im Gaddemen neben dem Münzhaus. Auf dem Mark halfen sie den Marktherren bei Kontrollen, die mit Geld zusammenhing. Ole war bei einem von ihnen in den Dienst getreten. Dafür, dass es ihm dort besser ging als bei seinem früheren Herrn, sprach sein neuer Rock. Benno ertrug den Anblick nicht und flüchtete. Domus bellica! dachte er. Wenn Franziska nicht bei Winrich dem Griechen war, dann gewiss bei einem anderen Vornehmen der Stadt. Wie sollte es auch anders sein, wenn Ole, dieses Stück Holz, zu einem Münzhausgenossen hatte gehen können? Sie war zu Höherem geboren. Hatte er nicht ihre Art zu Sprechen, zu Essen und zu Laufen bewundert? Warum war ihm niemals eingefallen, dass einer wie er ihr vom ersten Tage an zuwider sein musste? Domus bellica! Zu einem Patriziersohn gehörte sie, nicht zu ihm! Ohne es bewusst wahrzunehmen, gelangte Benno ins Martinsviertel. Man konnte sich kaum noch vorstellen, dass dies einst eine Insel gewesen war. Jetzt standen dort die Häuser besser gestellter Familien. Die Mühlengasse verband den Altmarkt mit dem Fischmarkt. Rechts ragte hinter den Bürgerhäusern der Baukran des erst zur Hälfte gediehenen Turms von St.Martin auf. Benno empfand die Kirche als Symbol des Unheils. Mitte des vorigen Jahrhunderts brannte sie mitsamt dem Viertel nieder. Die reichen Benediktinermönche nahmen dies zum Anlass, einen neuen, prächtigen Chor erbauen zu lassen. Dreizehn Jahre später aber brannte ihr stolzes Gotteshaus erneut nieder. Diesmal kam ihnen das nicht gelegen. Manch einer munkelte, Gott habe die Mönche, die von Klausur und Demut nichts mehr wissen wollten, für ihre Ausschweifungen bestraft. Ein Menschenalter lang mahnte St.Martin als Ruine an die Allmacht des Schicksals. Seit zwanzig Jahren wurde nun immerhin wieder gebaut. Für wie lange? "Wir können nichts festhalten!" flüsterte Benno. Durchdringender Geruch zeigte ihm an, dass er den Fischmarkt erreicht hatte. Er musste hier darauf achten, wohin er seine Füße setzte, um auf dem schlüpfrigen Boden nicht auszugleiten. Eine Verkäuferin brüllte ihm etwas zu. Ein Karren versperrte ihm den Weg. Es war dies der Marktalltag, den er kannte, der ihm an diesem Tage aber unbeschreiblich lästig fiel. Hastig überquerte er den Platz und stieg hinter dem weit geöffneten Tor in der Stadtmauer die Stufen zum Fluss hinunter. Der Rhein führte Niedrigwasser. Träge wälzte er sich dahin, unbeeindruckt von allem, was an seinen Ufern geschah, wie seit vielen Jahrhunderten. Ein dunkler Abwasserstrom verteilte sich in ihm. In der Flussmitte trieben Flöße. Schiffen mit hohen Bordwänden blähte der Wind die Segel, und zwischen ihnen hindurch drängte sich der Fährmann mit seinem Kahn. Benno wusste nicht, was er beginnen sollte. In die Stadt zurückgehen, mochte er nicht. Die Bürgerhäuser, die ihre spitzen Giebel über die Mauerkrone reckten, schienen ihn zu verhöhnen, und die Vielzahl der Kirchtürme erinnerte ihn daran, wie groß diese Stadt war. Er konnte Franziska hier nicht finden, nicht an diesem Tag und nicht an den folgenden. 43 5.Kapitel I D as gewaltige Freskenbild des heiligen Christophorus war das erste, was man beim Betreten der Pfarrkirche sah. Es reichte fast bis hinauf zur hölzernen Flachdecke und wurde vom Licht des hohen Fensters über dem Eingang beleuchtet. Das Kunstwerk wies darauf hin, dass das Gotteshaus diesem Heiligen geweiht war, bewahrte aber zugleich (einem alten Glauben nach) einen jeden, der hier betete, für diesen Tag vor dem plötzlichen Tod ohne Sterbesakramente. Franziska und Pentia versäumten diese Vorsichtsmaßnahme nie. Der Riese besaß mächtige Arme, und der Fluss, durch den er das Christuskind trug, reichte ihm kaum bis zu den Waden. Sein Gesicht strahlte Güte und Sanftmut aus. Bei den Mädchen vertrieb er die Erinnerungen an die Nacht der Angst, zumindest zeitweilig. Völlig verdrängen ließ sich die Erinnerung natürlich nicht. Immerhin hatte ihr Schicksal eine dauerhafte Wendung zum Schlimmen genommen. Oft fragten sie sich, ob ihre Entscheidung richtig gewesen war - und auch ob sie sie zurücknehmen konnten. Manchmal sprachen sie flüsternd darüber, nachdem sie sich einen Platz für die Nacht gesucht hatten. Sie sahen sich wieder im stockdunklen Keller. Ludwigs Schritte entfernten sich. Der Hausherr legte sich, fürs erste beruhigt, ins Bett. Nur ganz schwach hob sich das aufgebrochene Fenster ab. Die Mädchen fassten sich bei den Händen und starrten lange Zeit reglos dorthin. Dabei stieg die Angst immer höher auf in ihnen. Irgendwann wurde ihnen klar, dass sie in diesem Haus keine Ruhe mehr finden würden. Es war Annes Angst, die auf sie übersprang. Dieser Keller hing zusammen mit einem finsteren Geheimnis, von dem die kleine Bettlerin eine Ahnung hatte. Welche Teufelei es auch sein mochte, Franziska und Pentia waren nicht begierig, sie näher kennen zu lernen. Sie mussten fort, so schnell wie möglich, noch vor dem Anbruch des neuen morgens. Die Finsternis auf der Straße war so vollkommen, dass sie nur an den Wänden entlang, Schritt für Schritt vorwärts kamen. Häufig stolperten sie über Hindernisse. Eher zufällig liefen sie stadtauswärts. Die Mühseligkeit des Weges verzerrte das Entfernungsgefühl. Als sie an das Kettentor gelangten, waren sie überrascht, denn sie hatten geglaubt, schon fast an der äußeren Stadtmauer zu sein. Franziska erinnerte sich des ersten Tages und versuchte sich vorzustellen, wie sie damals auf Bennos Wagen in die Ährenstraße eingebogen war. "Von hier aus würde ich mich vielleicht zum Hahnentor finden", flüsterte sie. "Was wollen wir denn dort? Die Wächter würden uns festnehmen und einsperren." "Ja. Du hast Recht." So wandten sie sich an der Kreuzung nach rechts. Dort waren sie allerdings noch nie gewesen und verloren neben dem Gefühl für Zeit und Entfernung auch noch den Richtungssinn. Völlig erschöpft, seelisch wie auch körperlich, gaben sie schließlich auf und ließen sich zu Boden gleiten, wo sie gerade standen. Am nächsten Morgen bemerkten sie erschrocken, dass sie die Kreuzung noch erkennen konnten, sich folglich noch nah am Jeveranwesen befanden. Also liefen sie sofort weiter, noch ehe die Sonne sich über den Häusern zeigte. Vor ihnen endete die Straße. Links gelangte man zur Stadtmauer, rechts in eine dicht bebaute Gasse. Sie entschieden sich für Letzteres. Während sich südlich die Reihe der Häuser fortsetzte, gab nach Norden zu bald ein Gartenareal den Blick frei auf einen gewaltigen Kuppelbau - eine weitere Kirche, wie das goldene Kreuz auf dem Dach anzeigte. "Das ist ein reiches Kloster oder Stift", sagte Franziska mit Überzeugung. "Dort bekommen wir etwas zum Essen." So waren sie an den Gärten entlang auf den Kuppelbau zugelaufen und hatten schließlich jenen Platz erreicht, auf dem sie nun seit knapp einer Woche lebten. Das Stift, an dessen Fuß sie gestrandet waren, hieß St. Gereon und folgte dem Rang nach unmittelbar dem Dom. Sein Reichtum fand in Redewendungen und Sprichwörtern Eingang. Die verschwenderisch große Freifläche vor der Kirche diente allein dem Zweck, die prächtige Ostseite mit dem aus der Umfassungsmauer vor gewölbten Chor und den beiden Türmen zur vollen Geltung zu bringen. Die von den Kanonikern für die Bürger errichtete Christophoruskirche erinnerte (rechts neben ihr am Rand des Platzes) an einen Diener, der demutsvoll im Hintergrund auf die Anweisungen seines Herrn wartet. Anfangs hatte den Mädchen das Glück zur Seite gestanden. Aus ihnen unbekanntem Grund verteilten Dienstleute des Stifts jeden Morgen eine Schale voll dünner Suppe an alle Bedürftigen. Das war nicht viel, wenn man sich damit begnügte, doch mehr als nichts. Eines Tages aber hörten die Almosen der Stiftsherren auf, und die beiden mussten sich ihr Essen auf andere Weise beschaffen. Nun wurde der Hunger quälend. Pentia verlor allen Mut und sah mit jedem Tag elender aus. Franziska hingegen raffte sich auf. Sie wusste inzwischen bereits einiges über das Stift. Es gab vierunddreißig Kanoniker, die alle wenigstens vierzehn adlige Vorfahren besaßen und über ausgedehnte Güter innerhalb und außerhalb Kölns verfügten. Ohne dabei in Verlegenheit geraten zu sein, hatten sie binnen zweier Generationen ihre altehrwürdige Kirche von Grund auf umbauen lassen. Dabei war auch die Kuppel entstanden, die größte im Kaiserreich. Wie leicht musste es so unermesslich reichen Leuten fallen, zwei Mädchen ohne Heim vor dem Hunger zu bewahren! Leider wohnten die Kanoniker ziemlich abgeschieden in großen Häusern hinter der Kirche. Dort gingen sie, von zahlreichen Dienern umgeben, ihren (nicht immer frommen) Geschäften nach und mochten nicht gern gestört werden. Mönche waren sie nur siebenmal am Tage. Dann trugen sie die einheitliche Kanonikerkleidung und trafen sich zum Gebet in ihrer Kirche. Um von ihren Häusern aus dorthin zu gelangen, brauchten sie den Stiftsbereich nicht zu verlassen. Einige von ihnen taten es dennoch. Nach der Andacht schlenderten sie ein wenig über den weiten Platz oder setzten sich an den Rand, um das Treiben der Leute zu beobachten. Franziska überlegte lange, bei wem sie ihr Glück versuchen sollte. Die besondere Menschenkenntnis des Bettlers besaß sie noch nicht. Am Ende entschied sie sich für den ältesten Kanoniker, den sie zu sehen bekam, einen Greis mit knochiger Nase, der sich mühsam mit einem Stock vorwärts schleppte und jeden Nachmittag für einige Zeit auf einem Stein vor der Chorrundung verweilte. An diesem Tag rannte sie auf ihn zu und stützte ihn, noch bevor sich ein Diener seiner annehmen konnte. Er ließ es sich gefallen 45 und forderte sie sogar auf, sich neben ihn zu setzen. "Bist du oft hier?" Sie zögerte, um nichts Falsches zu sagen. Er fragte sofort weiter: "Weißt du vom heiligen Gereon und von Gregor Maurus, seinem Gefährten?" Sie kannte weder den einen noch den anderen, doch sie litt Hunger und hatte noch nichts bekommen für ihre Gefälligkeit. So sagte sie, nicht ohne Hintersinn: "Das waren heilige Männer, die uns Vorbild sein sollen. Meine guten Eltern erzählten mir von der ungarischen Königstochter Elisabeth, die in der großen Hungersnot vor zwei Jahren alles Korn an die Armen verteilte. Gott selbst füllte ihr die Speicher wieder auf, so dass ihr kein Schaden entstand." In die Augen des Alten trat ein Leuchten. "Du bist ein kluges Mädchen und deine Eltern haben dich gut erzogen." "Gewiss haben sie das - bis eine Sturmflut sie umbrachte, unten am Meer in Friesland." Er ging gar nicht ein auf ihre Geschichte, sondern fragte wie ein Novizenmeister: "Weißt du auch von den Römern und von den Schrecken, die sie den Christen angetan?" Franziska nickte leicht. Der Kanoniker lächelte zufrieden. "Dem heiligen Gereon, dem unsere Kirche geweiht ist, schlugen sie den Kopf ab, obwohl er ein tüchtiger Hauptmann war. Mit ihm starben an einem einzigen Tag alle seine Gefolgsleute." Dann erzählte er von dem grausamen Kaiser Diokletian, von dessen Mitregenten Maximilian, von der christlichen Legion aus dem fernen Thebais, von deren Ankunft am Rhein, von der Weigerung den römischen Göttern zu huldi- gen, vom blutigen Ende mit allen Einzelheiten schließlich. Franziska hing an seinen Lippen, weil er offenbar Wert darauf legte. Zugleich aber verstand sie kein Wort. Die Märtyrer aus uralter Zeit waren ihr in diesem Moment so gleichgültig, dass es an Sünde grenzte. "Meine Mutter sagte einmal, dass die Römer niemals einem Bedürftigen ein Stück Brot gaben ..." "... Die Leichen warf man vor der Mauer in einen Brunnen, wo sie blieben, bis die heilige Helena ihnen jene Kirche errichten ließ, die wir nun zu neuem Glanz haben wiedererstehen lassen." Er sprach noch von Helenas Sohn, dem Kaiser Konstantin, der den Christen die ersehnte Freiheit gebracht hatte, doch Franziska verlor die Geduld. "Ich und meine Schwester, wir haben Hunger. Versteht Ihr? Wir brauchen ..." Der Kanoniker brach ab und schaute verwirrt auf. Seine Stirn umwölkte sich. "Was redest du da? Denkst du an die nichtigen Bedürfnisse deines vergänglichen Leibes, wenn du von Gereon und seinen Taten hörst?" "Ich habe sehr wohl verstanden, dass ..." "Geh mir aus den Augen! Du hast mich enttäuscht!" Franziska bebte vor Zorn. Warum hatte sie mit dem Schwätzer so viel Zeit verschwendet? Gern wäre sie mit einem Schwall derber Beschimpfungen über ihn hergefallen und dann einfach davongerannt. Doch sie zügelte sich, um es sich nicht mit den anderen Kanonikern zu verderben und trollte sich wie ein mit einem Schwall Wasser verscheuchter Hund. Sie hatte eine Niederlage erlitten, zugleich jedoch eine Erfahrung gesammelt. Allmählich bekam sie einen Blick für die Gebefreudigkeit der Leute. Auch verbesserte sie ihr Vorgehen. Als Erfolg versprechend erwies sich, den Kanoni- 46 kern einen Dienst anzubieten und sie dabei mit einer endlosen, rührseligen Erzählung zu bedrängen. Die frommen Chorherren fühlten sich unbehaglich, wenn sie mit dem Elend in Berührung kamen, wollten aber andererseits ein arbeitsames Mädchen nicht einfach davonjagen. Ihre milde Gabe war dann so etwas wie ein Sichfreikaufen. Je sicherer sie sich fühlten, desto mehr erkunden Franziska und Pentia die Umgebung des Gereonsplatzes. Wenn sie um die Pfarrkirche herumliefen, ka- men sie auf die Christophorusstraße, die an der nördlichen Begrenzung des Stiftsbezirks entlang führte und an der Gereonstorburg endete. Rechts dehnten sich Wiesen aus - unkultiviertes, als Weidefläche genutztes Land. Die nächsten größeren Häuser gehörten schon zu einem anderen Viertel. Nur eine Straße durchschnitt die Wiesen - die Seckengasse, an der das Propsteianwesen mit seinem Palast lag. Hier bettelte Franziska am erfolgreichsten. II D er Arglose hat den Vorteil, dass er die mit einer Sache verbundenen Gefahren nicht fürchtet (weil er sie nicht kennt), jedoch den Nachteil, leicht geradewegs in eine Falle hineinzulaufen. Franziska hätte sich längst fragen müssen, warum andere Straßenkinder ihren vortrefflichen Trick nicht gleichfalls anwendeten. An einem Sonntagvormittag Ende September wurde sie von zwei Dienstleuten des Stifts ergriffen und grob gegen eine Wand gedrückt. "Warum behelligst du die Chorherren?" knurrte einer von ihnen. "Weil Barmherzigkeit eines jeden Christen Pflicht ist und die ehrenwerten Kanoniker doch ganz besonders ..." Eine Ohrfeige, die ihr den Kopf gegen die Mauer schleuderte, schnitt ihr das Wort ab. "Von heute an wollen wir dich nicht mehr hier sehen, nicht auf dem Platz und nicht in der Christophorusstraße. Halte dich daran! Sonst sperren wir dich in den Turm der Propstei und lassen dich hungern, bis du Schaben und Asseln isst." Franziska sah nicht ein, wieso sie, selbst wenn sie die Kanoniker in Ruhe ließe, nicht auf dem Platz bleiben durf- te. Ehe sie aber etwas erwidern konnte, belehrte sie eine Serie weiterer Ohrfeigen, dass die Drohung ernst gemeint war. Andererseits wusste sie inzwischen aus belauschten Gesprächen, dass trotz allem noch manche Möglichkeit bestand für sie und ihre Schwester. Fremde konnten in Köln leichter als anderswo die Bürgerrechte erwerben, sogar unabhängig von ihrem Geschlecht. Sie mussten dafür das Beitrittsgeld und die jährlichen Steuern entrichten sowie ihren Verpflichtungen für die Verteidigung der Stadt nachkommen (was auch auf das Ausrüsten und Besolden eines Vertreters hinauslaufen konnte). Das erforderliche Vermögen aufzutreiben, war natürlich eine ernsthafte Schwierigkeit. Franziska zum Beispiel besaß lediglich zwei Vierteldenariusmünzen. Doch ein Ziel in weiter Ferne ist immerhin mehr als gar keine Hoffnung. War ein Anfang gefunden, würde sich alles weitere vielleicht ergeben. Kleinhändlerinnen zum Beispiel unterlagen keinem Innungszwang und durften ihre Geschäfte ohne Bürgerrechte betreiben, wenn auch nur an bestimmten Stellen. Dann gab es noch die Möglichkeit, sich von einer Meisterin als 47 Lehrmädchen einstellen zu lassen und allmählich hochzuarbeiten. Als sie ihre Schwester neben sich schluchzen hörte, wurde Franziska aus ihren trotzigen Gedanken gerissen und daran erinnert, dass sie erst einmal für sie beide eine neue Bleibe suchen musste - sofern ein paar vertraute Gassen mit gnädig gestimmten Leuten diese Bezeichnung verdienten. "Sie werden uns auch anderswo verjagen!" würgte Pentia hervor, völlig verstört. "Sei, verdammt noch mal, still! Ich muss nachdenken." brauste Franziska auf, heftiger als gewollt. Es begann ihr Leid zu werden, dass sie in ihr keine größere Hilfe hatte. "Du bist elf Jahre alt und bald heiratsfähig. Du müsstest genug wissen und können, um Kinder zu erziehen. Statt dessen lässt dich selbst verhätscheln wie ein Kind." Sie schimpfte mit ihr, obwohl sie sich in Wahrheit um sie sorgte. Manchmal erweckte Pentia den Eindruck, sie würde den baldigen Tod für unvermeidlich halten und als Erlösung aus dem Elend geradezu herbeisehnen. Wie konnte sie ihr wieder Lebensmut einhauchen? Im Moment war freilich keine Zeit dazu. Die beiden Stiftsknechte standen noch immer in der Nähe. Es wurde höchste Zeit, ihnen aus den Augen zu gehen. Franziska entschied sich nach kurzem Zögern für die breite Straße, die gegenüber der Gereonskirche in Richtung Stadtmitte führte. Auf einem Mittelstreifen standen Bäume. Auf dem Gras darunter schritt man dahin wie auf einem Teppich. Etwas überraschend endete jene prächtige Straße nicht vor einem ihr angemessenen Portal sondern an einer Zeile dürftiger Häuser. Offenbar hatte sie jemand rasch und so billig wie möglich bauen lassen. Keines war auch nur halb so breit wie das der Jevers. Die grauen Fassaden wirkten trostlos, weil nicht einmal die Türen und Fensterläden sich farblich abhoben. Wer hier wohnte, konnte sicherlich an Bettler nicht viel abgeben. Durch einen Torbogen gelangten die Mädchen ins nächste Viertel. Bäume gab es hier keine mehr, statt dessen schmale, schmutzige Gassen mit Dutzenden spielender Kinder. Die schrieen, dass es in den Ohren gellte. Manche hetzten hinter einem Ball aus Leder mit eingenähten Stoffresten her, andere benutzten Rinderzehenknochen als Kegel. In einer Nische waren fünf Jungen über einem Klickerspiel in Streit geraten. Franziska und Pentia liefen immer weiter geradeaus dorthin, wo sie den Rhein vermuteten. Eine Bleibe fanden sie dabei allerdings nicht. Außerdem hatten sie noch nichts gegessen an diesem Tage. Da sahen sie eine Gruppe von Pilgern in ein großes Eckhaus gehen - ein Hospital vermutlich, und zwar ein vornehmeres als das bei St. Apern. In der Hoffnung, wenigstens eine Suppe zu bekommen, folgten sie den Männern. Im Vorraum aber stand Franziska plötzlich einem Mann in weißer Kutte gegenüber. "Was willst du hier?" fragte er streng und musterte sie unangenehm aufmerksam. "Ich und meine Schwester, wir sind Fremde in der Stadt und haben kein Obdach." "Wo genau kommt ihr her?" Franziska fühlte sich wie bei einem Verhör, ohne recht zu wissen, welcher schlechten Tat der Mönch sie beschuldigte. "Dazu müsste ich Euch viel erzählen ..." "Ihr habt immer viel zu erzählen, wenn ihr bettelt. Anstatt euch Geschichten auszudenken, solltet ihr mit euren Händen nützlich arbeiten." "Das würden wir gern tun, nur ..." "Ihr könnt es tun! Kommt mit!" 48 Franziska wollte ihm bereits folgen, da hielt eine innere Stimme, ein verborgenes Misstrauen, sie zurück. Der Mann war ihr plötzlich unheimlich - so wie der Gang, der vor ihr begann und sich im Dunkeln verlor. Die Männer, die daraus auftauchten und wieder verschwanden, passten nicht zu einem Hospital. Von Angst überwältigt, nahm sie ihre Schwester beim Arm und flüchtete, ohne überhaupt nach der Art der in Aussicht gestellten Arbeit zu fragen. Dass sie die erhoffte Mahlzeit nicht bekommen hatten, vergaßen die Mädchen, als sie sich unversehens auf einer breiten Straße wieder fanden, wo der Verkehr dahin quoll wie das Wasser in einem Hochwasser führenden Fluss. Sie wurden mitgerissen bis zu einer mehrbogigen Pforte, welche (obgleich weit geöffnet) die anbrandenden Massen von Menschen, Pferden, Karren und Wagen aufhielt wie Buhnen die Wellen des Meeres. Dort zogen sie sich, um dem Gedränge zu entgehen, nach rechts in eine Querstraße zurück. Dabei stießen sie zufällig auf ein weiteres Hospital diesmal eines, das sich tatsächlich der Armen annahm. Aus einem Fenster, vor dem sich ein paar Dutzend Bedürftige drängten und stritten, wurden gerade kleine Stücken Brot verteilt. Gestärkt und mit neuem Mut kämpften Franziska und Pentia sich nun durch die Pforte. Danach hatten sie zu ihrer Linken den Dom mit den ihn umgebenden Gebäuden und zu ihrer Rechten ein paar Häuser, deren Größe und Schönheit wohl selbst den Kanonikern von St. Gereon Anlass zum Neid geben konnten. Einmal mehr erkannten sie, dass sie wohl noch in mehreren Wochen nicht annähernd alles entdeckt haben würden, was diese Stadt an Erstaunlichem zu bieten hatte. In ihrer Heimat errichteten sich die reichen Herren ihre Wohnburgen inmitten ihres Grundbesitzes und wünschten keine Nachbarn in der Nähe. Hier legten es die allervornehmsten Leute darauf an, sich mit zumindest einem ihrer Anwesen auf engem Raum zu drängen. Um wen scharten sie sich mit solchem Eifer? Es konnte nur der Dom sein! Für einen Moment erschauerte Franziska beim Gedanken an jene unermessliche Macht, die dort irgendwo auf dem erzbischöflichen Areal in einem geheimnisvollen Tabernakel zusammengeballt sein musste. "Hier bleiben wir", raunte sie ihrer Schwester zu. Das war zunächst leichter gesagt als getan, denn der Strom hatte sie wieder gepackt und schien sie geradewegs aus der Stadt hinausspülen zu wollen. Dann aber mündete links eine weitere breite Straße ein und das Gedränge ließ nach. Der Platz gefiel Franziska auf Anhieb. Anders als vor St. Gereon boten viele Leute ihre Dienste an und zugleich gab es auch genügend Bedarf dafür. Hier war Gepäck zu befördern, dort schnellstmöglich ein Schaden auszubessern. Fremde suchten nach Ortskundigen. Auch Bettler sah man überall. Sie belagerten vor allem die Pilger, welche die Heiligen Drei Könige anbeten wollten und in ihrer Hochstimmung gebefreudig waren. Die erzbischöflichen Waffenknechte, die mit ihren langen Spießen allenthalben auf dem Platz posierten, sahen dem Treiben ruhig zu und ergriffen nur die, welche sich respektlos betrugen oder die Fremden zu bestehlen versuchten. Letzteres bedeutete übrigens nicht, dass jeder sich seines Besitzes sicher sein konnte. Die Gegend war vielmehr Tummelplatz der gerissensten und kühnsten Diebe, die es in der Stadt gab. Selbst Dirnen kamen hier besser als anderswo zu ihren Kunden, so sehr man sich auch bemühte, sie (der heiligen Reliquien wegen) zu vertreiben. Im Laufe der nächsten Tage und Wochen lernte Franziska den Platz immer 49 besser kennen und nutzen. Das Haus an der Einmündung war das prächtigste von allen (nach dem Palast des Erzbischofs) und gehörte dem Herzog von Brabant. Am anderen Ende hatten rechts die Goldschmiede ihre Werkstätten. Von links dröhnten von früh bis spät die schweren Hämmer der Waffenschmiede. Das Tor zum eigentlichen Domhof war nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Dann allerdings durfte jedermann bis zum Portal des Palastes gehen. Franziska erkannte inzwischen auch die ranghöchsten Dienstherren des Kirchenfürsten und wusste, wann sie sich mit ihrem Gefolge zeigten. Der Vogt erschien, wenn zu Gericht gesessen wurde. Der Kämmerer tauchte vor den großen kirchlichen Feiertagen auf, um die Vorbereitungen für das Zeremoniell zu überwachen. Der Marschall führte bei den Paraden für besonders bedeutende Gäste die ihm unterstellte Ritterschaft an. An diese drei kamen gewöhnliche Bettler selten heran. Anders verhielt es sich mit dem Schenk und dem Truchsess, die sich gern unters Volk mischten und empfänglich waren für Schmeicheleien. Der Kepler, ein blasser, immer missvergnügter, von der Arbeit in der Kanzlei krumm gedrückter Mann, rief manchmal nach den Waffenknechten, gab an seinen guten Tagen aber so viel wie niemand sonst. Franziska hatte gegenüber den anderen Bettlern einen wichtigen Vorteil sie benahm sich nach der Art der Adligen und redete auch in ihrer Weise. Die hohen Dienstleute und noch mehr die Grafen und Herzöge stimmte das mitunter nachdenklich, glaubten sie doch unwillkürlich, einer der Ihren stünde da im Bettlergewand vor ihnen. Jäh an die Vergänglichkeit irdischer Güter erinnert, verweigerten sie die Bitte des rätselhaften Mädchens selten. Geistlichen ging Franziska aus dem Wege. Das Erlebnis vor St. Gereon hatte ihr eine fast abergläubische Furcht vor ihnen eingeflößt. Mit Pentia war es anfangs noch weiter bergab gegangen. Jämmerlich abgemagert (obwohl an Nahrung inzwischen kein Mangel mehr bestand), schien ihr Tod nahe zu sein. Ganz plötzlich aber (und ohne einen erkennbaren Anlass) kehrte der Lebenswille zurück. Von da an begann sie (erstaunlich gereift) ihre Schwester zu unterstützen. Schon nach wenigen Tagen hatte sie beim Betteln beträchtliches Geschick entwickelt. Es nutzte ihr, dass sie weniger stolz war als Franziska. So konnte sie das zierliche Benehmen eines gut erzogenen Mädchens verbinden mit der hündischen Unterwürfigkeit eines Waisenkindes. Diese Mischung setzte die vornehmen Herren unter solchen Gewissensdruck, dass es schon an Erpressung grenzte. Während vor St. Gereon und vor den Hospitälern fast ausnahmslos Lebensmittel und alte Kleidungsstücke verteilt wurden, bekamen die Bettler in der Umgebung des Erzbischofspalastes auch kleine Münzen. Geld ließ sich in einem Versteck für schlechtere Zeiten aufbewahren und man konnte sich dafür kaufen, was man mochte. Freilich gab es auf dem Platz kaum jemanden, der sich Leckereien leistete. Die Verkaufsbude der Bettler war die Kotzenbank am Eingang zum Altmarkt. Dort gab es zu guten Preisen Hirn, Euter, Kehle und Innereien. An den Gestank gewöhnte man sich im Laufe der Zeit. Das Fleisch wurde in den späten Abendstunden mitten auf dem Platz über kleinen Feuern gekocht oder gebraten. Die beiden Mädchen waren mit ihrem Leben nicht gerade glücklich, angesichts der Umstände aber auch nicht unzufrieden. Durch eiserne Sparsamkeit legten sie nach und nach einen Schatz von immerhin dreiundzwanzig Denaren an. Allerdings litten sie zunehmend unter dem Wetter. Es war Mitte Oktober 50 geworden, und der Herbst zeigte sich von seiner unangenehmen Seite. Es regnete fast täglich und um die wenigen trockenen Nachtquartiere entbrannten Abend für Abend erbitterte Kämpfe. Dabei hatten Franziska und Pentia einen ernsthaften Nachteil - ihnen fehlten Freunde und Beschützer. In der Domgegend waren sie leider unbeliebt, weil viele Vagabunden ihnen die Erfolge neideten. Gegen Banden von bis zu zehn Männern waren sie machtlos. III E s kam öfter vor, dass plötzlich große Aufregung auf dem Platz vor dem Palast ausbrach. Das konnte zum Beispiel daran liegen, dass der Erzbischof mit seinem Wagen ausfuhr und ein Dutzend Waffenknechte ihm den Weg bahnten - was sie gewöhnlich so rücksichtslos taten, dass sich in weitem Umkreis wellenförmig Geschrei und Gedränge ausbreiteten. Manchmal wurden in Prügeleien, deren Anlass durchaus nichtig sein konnte, zwanzig oder dreißig Menschen hineingezogen. Auch wenn es etwas Besonderes zu sehen gab, entstand leicht ein wildes Durcheinander. Franziska und Pentia kümmerten sich um dergleichen nicht. In der Regel mieden sie jede Art von Gedränge. Auch an jenem Tag, als plötzlich auf der Seite der Waffenschmiede ohrenbetäubender Lärm aufbrandete, blickten sie kaum hoch. "Da sind sich wieder mal ein paar Saufnasen gegenseitig im Weg", sagte Franziska und schüttelte verständnislos den Kopf. Doch die Unruhe ebbte nicht wieder ab wie sonst, sondern schwoll immer mehr an. Jetzt sahen die Mädchen genauer hin. Vom Rhein her drängte irgendetwas auf den Platz und zwar mit unglaublicher Gewalt. Menschen hetzten voller Angst in die Nebenstraßen hinein. Blitzschnell übertrug sich die Panik von einem zum anderen. Wer nicht schnell genug aufsprang, wurde umgerissen und niedergetrampelt. Fran- ziska dachte an die Sturmfluten in ihrer Heimat. Niemals sonst hatte sie ähnliches Entsetzen gesehen. Dann wurde die Ursache klar. Etwa fünfzig junge Männer in jenen kurzen, grauen Kutten, die ihr nur allzu gut bekannt waren, rollten, zu einem Block vereint, über den Platz. Zu einer einzigen Macht geballt, glichen sie tatsächlich einer Sturmflut, die alles mit sich hinweg reißt. Ihr Angriffsziel war jener Streifen direkt vor dem Palast, der von jeher den Vagabunden als Ausgangsbasis und Beobachtungsstandort beim Betteln diente. Franziska und Pentia saßen eigentlich weit genug von diesem Streifen entfernt nahe dem Haus des Brabanter Herzogs. Unglücklicherweise aber ergoss sich der Strom der Flüchtenden genau in ihre Richtung, was wiederum bewirkte, dass sich auch die Verfolger dorthin wandten. Unmittelbar danach gerieten sie in ein Inferno. Sie schlossen sich den Flüchtenden an, waren aber nicht schnell genug, wurden eingefangen und sofort brutal geschlagen. Franziska versuchte, wenigstens ihre Schwester entkommen zu lassen, musste aber einsehen, dass es dafür längst zu spät war. Durch immer neue Schläge und Tritte ins Gesicht und in den Magen schon halb besinnungslos, nahm sie die Beschimpfungen, die wohl so etwas wie eine Begründung für die Misshandlungen sein sollten, nur noch wie durch eine Nebelwand wahr. 51 "Gib zu, dass du eine Judensau bist, du schwarzhaariges Miststück! Krepier, du dreckige Schlampe!" Um sich herum sah sie Köpfe, aber keine Gesichter. Diese hassverzerrten Masken konnten keine Gesichter sein. Das waren Grimassen von Dämonen ohne menschliche Züge. Jenseits dieser Eindrücke gab es nur noch einen einzigen, unbestimmten, jeden Gedanken erstickenden Schmerz. Sie hatte das Gefühl, in einen Bottich mit kochendem Blut einzutauchen. Als sie wieder aufwachte, erschien ihr alles fremd. Statt auf Steinen oder hart gestampftem Lehm lag sie auf weicher, feuchter Erde. In der Luft hing ein ekelhafter Geruch nach Fäulnis und Moder. Das konnte unmöglich der Platz vor dem Palast des Erzbischofs sein. Wo war das tagsüber niemals abreißende Stimmengewirr, wo das Geschrei der Kutscher? Ganz in der Nähe plätscherte Wasser. Enten schnatterten. Irgendwo zankten sich Kinder. Fremd war Franziska sogar ihr eigener Körper. Sie tastete nach ihrem Gesicht. Gehörte dieses geschwollene, verschmierte Gebilde zu ihr? "Kannst du mich hören?" Wo kam diese Stimme her? Was war das für eine Stimme? Auch sie gehörte zu dieser sonderbaren fremden Welt. "Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Sie sind fort." Wer ist fort? Franziska weigerte sich, die Augen aufzuschlagen und diese fremde Welt anzunehmen. Sollte diese Stimme doch reden, solange sie mochte! "Deine Schwester hat es zum Glück nicht so schlimm erwischt." Schwester? Pentia! Was ist mit Pentia? Franziska durfte sich dieser Welt nicht verweigern, wenn Pentia darin war. So schlug sie die Augen schließlich doch auf - und blickte in das hübsche, auffallend zarte Gesicht eines höchstens sechzehnjährigen Jungen. Da er sich über sie beugte, kitzelten einige Spitzen seiner langen, hellblonden, seidig-weichen Haare ihre Nasenspitze, bis sie niesen musste. Dabei wurde ihm bewusst, dass sie sich von ihm vielleicht belästigt fühlte, und rückte ein wenig von ihr fort. Jetzt sah sie ihn ganz. Er war schlank, aber nicht schwächlich, mittelgroß - eher unauffällig also, was seine Figur betraf. Aber es ging etwas Rätselhaftes von ihm aus, etwas das Franziska sofort in den Bann zog. "Wir gehören hier beide nicht hin!" sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln. Wie kam sie darauf? Woher wollte sie wissen, ob es etwas gab, was sie mit diesem blonden Jungen verband? Konnte sie überhaupt schon wieder klar denken oder träumte sie noch? "Vor dem Palast konnte ich leider nicht viel ausrichten", sagte er. "Gegen die ganze Bande, das ist Selbstmord. Als sie aber nur noch zu dritt waren, habe ich laut gepfiffen und ein paar Namen gerufen." Er lachte über seinen listigen Einfall. "Die dachte, es kommen gleich ein Dutzend Leute, und feige, wie sie nun mal sind ..." "Das hast du für mich getan?" Ihre Bewunderung war aufrichtig. "Du bist sehr mutig." "Ich fürchte, da täuschst du dich. In diesem Moment aber ... Konnte ich denn zusehen, wie sie dich totschlagen?" "Du kennst mich nicht einmal ..." "Das muss nicht so bleiben." Plötzlich trat jemand von hinten an ihn heran und flüsterte ihm etwas zu. Er schüttelte energisch den Kopf und deutete auf Franziska. Der andere aber ließ nicht locker, redete immer wieder auf ihn ein, zog ihn am Ärmel. Schließlich gab er nach, beugte sich aber noch einmal zu ihr herab: 52 "Ich muss fort. Sei mir bitte nicht böse! Wir werden uns bestimmt einmal wieder sehen." Dann verschwand er, verschwand so plötzlich wie er kurz zuvor aufgetaucht war. Franziska wollte ihn noch so vieles fragen, doch sie konnte ihm nicht folgen und erfuhr nicht einmal seinen Namen. 53 6.Kapitel I K öln war eine reiche Stadt, und Arme gehören nicht zu einer reichen Stadt. Die besser gestellten Bürger schämten sich ihrer, wollten sie nicht sehen, hätten sie am liebsten bis vor die Mauern getrieben. Doch das Vertreiben ging nicht so leicht. Die Bürger waren stolz auf ihre modernen, freiheitlichen Gesetze. Zudem brauchten sie die Armen für einige besonders schwere und schmutzige Arbeiten. So entstanden besondere Viertel, in denen das Elend zu Hause war und die jeder anständige Kölner mied. Eine dieser Gegenden war der Entenpfuhl, eine Straße, die einem Stück alter Stadtbefestigung folgte. Die Mauer stand hier noch, wurde sogar regelmäßig ausgebessert - allerdings nicht mehr zum Schutz der Bürger vor feindlichen Heeren sondern zur Abschirmung gegen Bettler und Vagabunden. Der Graben hatte die Verbindung zum Rhein verloren und war zu einem flachen, lang gestreckten Teich voll stinkender, undurchsichtiger Brühe herabgesunken. Trotzdem diente er noch Dutzenden Enten als Lebensraum. Eine Zeile Weiden und Pappeln grenzte Teich und Weg voneinander ab. Doch der Pfuhl begann, die Barriere zu überwinden. Unaufhaltsam verwandelte sich der Teich in einen von der Mauer bis zu den Häusern reichenden Sumpf. Die Grundstücke entlang der Straße hatten jeden Wert verloren. Wer sie besaß, musste sie behalten, da niemand sie kaufen wollte. Die darin wohnten, zahlten keinen Zins, weil sie zu arm dafür waren, durften aber auch nicht hinausgeworfen werden, damit sie nicht wieder durch die Stadt vagabundierten. Nur noch aus Trotz reichten die Eigen- tümer Jahr für Jahr Schadenersatzforderungen beim Rat ein (erfolglos natürlich). Weil sie sich (verständlicher Weise) um die Häuser nicht mehr kümmerten, verfielen sie rasend schnell. Durch kopfgroße Löcher in den Dächern und Wänden drangen Wind und Regen ein - was aber keineswegs verhinderte, dass ganze Familien darin unterkrochen und noch beneidet wurden, weil sie nicht unter freiem Himmel schlafen mussten. Zwischen den Häusern, in den ehemaligen Höfen und überhaupt überall, wo sich Platz dafür fand, hatten sich die Obdachlosen aus alten Brettern und Balken, zerbrochenen Ziegeln, Zweigen, Lehm und Stoffbahnen winzige Hütten gebaut - nützlich wenigstens gegen Regen und Schnee, wenn auch nicht gegen Kälte und Schmutz. Eine solche Hütte war keine Selbstverständlichkeit. Franziska und Pentia hatten Glück, dass sie schon zwei Tage nach ihrer Ankunft beobachteten, wie man aus einer davon einen Toten heraus trug. Sie überwanden das Grauen, das sie zunächst beschlich, und nutzten die Gelegenheit. Dass sie sogar doppelt Glück hatten, erfuhren sie erst später. Die neue Bleibe wurde ihnen nur deshalb von niemandem streitig gemacht, weil die Leute jenen blonden, offenbar aus guter Familie stammenden Jungen für einen ihrer Bekannten hielten und sie mehr als gewöhnliche Neulinge respektierten. Trotz des glücklich gewonnenen Nachtquartiers war Franziska allerdings keineswegs bereit, sich mit der neuen Lage abzufinden. Einen Augenblick lang zog sie in Erwägung, zu den Jevers zurückzukehren. Gundula würde sie und ihre Schwester mit offenen Armen empfangen und ohne jeden Vorwurf wieder aufnehmen. Doch gleich fiel ihr ein, dass jene Graukittel, die auf dem Platz vor dem Palast des Erzbischofs Angst und Schrecken verbreitet hatten, dort im Haus (zumindest im Keller) ein und aus gingen und dass Hans, Gundulas Sohn, einer von ihnen war. Und auch an Eike musste sie denken, der sich an ihr rächen wollte und der ebenfalls mit den Graukitteln in Verbindung stand. Denkbar erschien auch eine Rückkehr zum Haus der Herzöge von Brabant. Allerdings wusste am Entenpfuhl niemand zu sagen, was sich dort gerade abspielte. Von den zusammengeschlagenen und eingeschüchterten Vagabunden hatte sich noch niemand wieder in die Nähe des Doms gewagt. Franziska gehörte (auch aus Unerfahrenheit) zu den Mutigsten. Nachdem ihre Verletzungen verheilt waren, entschloss sie sich zu einer Erkundung. Im Osten mündete der Entenpfuhl in eine Hauptstraße, die auch am Domareal vorbeiführte. Nahe der Stadtmauer trug sie den Namen Eigelstein. Vorsichtshalber wählte sich Franziska für ihren Vorstoß die Abenddämmerung ohne zu ahnen, wie unheimlich die Gegend war, wenn Kaufleute sie nicht mehr bevölkerten. Dunkle Gestalten huschten aus Eingängen hervor und verschwanden lautlos irgendwo. Berittene Nachtwächter kamen gemächlich von der Torburg her vorüber, ohne sich darum zu kümmern. Nachdem Franziska (all ihren Mut zusammennehmend) noch ein Stück in Richtung Stadtmitte gepirscht war, kamen ihr in großer Hast fünf Vagabunden entgegen. Diesmal zögerte sie nicht so lange wie eine Woche zuvor. Sofort drehte sie sich um und flüchtete, noch vor den anderen, zurück zum Entenpfuhl. Später erfuhr sie, dass sie gut daran getan hatte. Die Graukittel wollten das Domviertel und seine Um- gebung für immer und ewig von Gesindel aller Art säubern. Sie überwachten die Straßen und wurden, von vielen Bürgern dazu ermutigt, immer brutaler. Einen Freund der fünf hatten sie mit einer Eisenstange erschlagen. Nun verstand Franziska die Angst der Anwohner des Entenpfuhls vor dem Eigelstein. Es gab offenbar kein Entrinnen aus diesem verfluchten Viertel. Hier gediehen nicht einmal jene wundersamen Geschichten vom unerwarteten Reichtum, die sich Bettler gewöhnlich so gern erzählten. Die meisten, die hier gestrandet waren, hatten die Hoffnung auf ein besseres Leben in dieser Welt aufgegeben. Mit Franziska war es immerhin so weit noch nicht gekommen. Sie grübelte noch, warum das Schicksal sie an diesen Ort geführt hatte, ob ein besonderer Sinn dahinter steckte. "Jesus Christus, lieber Herr, gib mir ein Zeichen, was ich tun soll, damit du mir wieder gnädig bist!" betete sie. "Hast du mich meines Stolzes wegen bestraft? Weil ich von den Bürgerrechten geträumt habe? Warum aber muss Pentia ebenso leiden? Was kann sie für meine Sünden?" Ihre größten Hoffnungen in diesen Tagen, bezogen sich auf den fremden, blonden Jungen. Einige Male glaubte sie, ihn die Straße entlang kommen zu sehen. Doch davon wurde sie nicht satt. Betteln brachte hier nichts ein, denn niemand besaß genug, um anderen etwas abgeben zu können. Wären die beiden Mädchen ein paar Wochen früher angekommen, hätten sie sich noch an der Plünderung der Gärten beteiligen können. Die ungepflegt wuchernden Bäume und Sträucher trugen zwar nur noch kleine, saure Früchte (und wurden viel zu früh abgeerntet), halfen aber dennoch gegen den schlimmsten Hunger. Den Spätherbst und den Winter musste jeder mit seinen Vorräten über- 55 stehen und wehe dem, der keine angelegt hatte. Nur einen Steinwurf entfernt hinter der Mauer lag das reiche Damenstift St. Ursula. Über die Dächer schmucker Häuser ragte der Kirchturm, den man gerade um ein Stockwerk erhöhte. Dort drüben irgendwo wurde sicherlich von langen Tafeln köstlicher Braten gegessen. Manchmal hätte Franziska schwören mögen, den Geruch davon selbst durch den Gestank des Morasts hindurch wahrzunehmen. Du darfst an so etwas nicht denken! sagte sie sich dann, doch kam sie in Wahrheit nicht los davon. Eine einzige Pforte verband das Stift mit dem Entenpfuhl. Sie war immer geschlossen und zerteilte dadurch einen ursprünglich belebten, aus der Stadt hinausführenden Fahrweg. Das andere Ende bildete nunmehr die einzige echte Straße, die vom Entenpfuhl abging. Als sei sie eben dafür angelegt, führte sie genau auf das Anwesen der Familie Clingelmann zu - ein großes Anwesen, das einen Haupthof, zwei Nebenhöfe, einen Gemüsegarten, einen Obstgarten sowie mehrere Felder umfasste und bis an die neue Stadtmauer reichte. Das Herrenhaus spreizte sich an der Nordostecke und erinnerte mit seinem zinnenbewehrten Turm an eine Burg. Der dahinter liegende Haupthof barg jenen Schatz, welcher der Familie zu ihrem Reichtum verholfen hatte - den einzigen Brunnen mit sauberem Wasser weit und breit. Den Clingelmannspütz kannte man sogar in anderen Stadtvierteln. Die Clingelmanns waren angesehene Leute, doch ihre Hartherzigkeit war sprichwörtlich. Bei ihnen um ein Almosen zu betteln, galt als völlig hoffnungsloses Unterfangen. Allerdings brauchten sie Arbeitskräfte. Als zweite Einnahmequelle (neben dem Verkauf des Brunnenwassers) stellten sie neuerdings Tuche her. In lang gestreckten, flachen Holzhäusern beschäftigten sie über hundert Frauen als Wollkämmerinnen, Spinnerinnen und Nopperinnen sowie ein Dutzend Männer als Tuchbereiter und Tuchglätter. Als Franziska davon hörte, sprach sie gemeinsam mit Pentia dort vor. Zwei mürrische Dienstleute empfingen sie. Nie gab sich ein Mitglied der Familie persönlich mit den angeheuerten Leuten ab. Durch Mauern und Hecken war das Anwesen ebenso wie die Stadt in vornehme und niedere Bezirke unterteilt. Die Mädchen schämten sich bei der Begutachtung, die sie über sich ergehen lassen mussten. Mit solchen Blicken schätzte man sonst nur Pferde oder Kühe ab. Schließlich wurde Franziska als Wäscherin eingestellt. Der schüchternen Pentia traute man nichts zu und schickte sie wieder fort. Noch nirgends war Franziska bisher so gedemütigt worden wie bei den Clingelmanns. Dass sie mit Gerten geprügelt wurde wie ein störrischer Esel, empfand sie nicht einmal als das Schlimmste. Weit weniger ertrug sie die Beschimpfungen. Sie wohnte am Entenpfuhl, weil Graukittel sie dorthin verschleppt hatten. Das gab niemandem das Recht, mit ihr wie mit einer Dirne zu reden. Sie kochte innerlich vor Wut und durfte doch nichts erwidern, weil vor dem Tor zwei Dutzend Frauen darauf warteten, sie zu ersetzen. Erst abends, wenn sie zu Pentia zurückkehrte, brach es aus ihr heraus. Obwohl sie vom hundertfachen Auswringen der Wäsche ihre Arme kaum noch spürte, nahm sie einen Knüppel, drosch damit am Ufer auf die erstbeste Pappel ein und brüllte Verwünschungen in die anbrechende Nacht hinaus, bis die Leute erschrocken angelaufen kamen und meinten, es sei jemand toll geworden. Völlig erschöpft setzte sie sich schließlich zu ihrer Schwester, noch immer nicht beruhigt. 56 "Nein, das ist zuviel! Bei Benno oder bei den Jevers zu arbeiten, dafür brauchten wir uns nicht zu schade zu sein. Das Betteln danach war schon nicht mehr ehrenvoll. Aber dies übertrifft alles. Muss ich mir das gefallen lassen? Ich weiß, aus welcher Familie ich stamme." Sie hatte schon wieder zu schreien begonnen und die Fäuste geballt. Jetzt aber rückte Pentia dicht an sie heran, schmiegte sich an sie wie ein Kätzchen und streichelte ihr übers Haar. "Es wäre besser gewesen, wenn sie mich dort genommen hätten. Ich ärgere mich nicht so sehr, wenn mich jemand beschimpft. Außerdem müsste ich mich nicht schämen, weil du für uns beide arbeitest, und ich hier faul herumsitze." Tatsächlich wurde Franziska sofort sanfter gestimmt. "Du brauchst dich nicht zu schämen. Du bist tapfer, beklagst dich nicht, hältst unsere Höhle in Ordnung ... Und überhaupt - ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde." Als die Wut verflogen war, kam die Müdigkeit. Die harte Arbeit forderte ihren Tribut. Franziska schlang die von ihrer Schwester gekochte Kohlsuppe und ein paar Bissen Brot herunter und schlief unmittelbar danach ein. Pentia blieb länger wach. Sie ließ sich Zeit für ihr Abendbrot und starrte dabei durch eine der Ritzen schräg zum Himmel hinauf. Dann träumte sie sich hinweg aus diesem Viertel zurück in ihre frühe Kindheit und lächelte versonnen die Sterne an. Sonntags gingen die Mädchen zum Gottesdienst in eine Kapelle nahe ihrer Behausung. Das war ein baufälliges Holzhaus mit einem Priester, der offenkundig wenig Lust verspürte, vor einer Gemeinde aus Vagabunden zu predigen. Vielleicht verbüßte er eine Strafe. Aber Gott, der Barmherzige, kam zweifellos auch in eine dürftige Kirche wie diese. Wenn Franziska es sich recht überlegte, dann spürte sie Seinen Beistand noch immer. Er schickte ihnen harte Prüfungen (warum auch immer) doch Er wies ihnen zugleich immer noch einen Ausweg. Bisher brauchten sie nicht einmal ernsthaft Hunger zu leiden. Die Sonntage gaben Zuversicht. Jede Prüfung müsste doch einmal vorübergehen, jede Sünde irgendwann gesühnt sein! II D er Dezember kam und mit ihm der erste Schnee. Pentia besserte die Hütte aus und besorgte Fetzen aus Fell und Tuch, aus denen sie sehr geschickt Decken gegen die Kälte anfertigte. Doch all diese Vorkehrungen verhinderten am Ende nicht, dass Franziska erkrankte. Sie fühlte sich eines Morgens schlaff, hatte Kopfschmerzen und eine heiße Stirn. Einige Tage schleppte sie sich noch mit eisernem Willen zu den Clingelmanns, fest entschlossen, die Krankheit in sich niederzuringen. Aber sie wurde immer schwächer und musste schließlich aufgeben. Eigenartigerweise litt sie an jenem Morgen, als sie nicht mehr aufstehen konnte, am meisten unter der Sorge um Pentia. In ihrer Angst, sie mit in ihr Unglück hineinzureißen, fasste sie einen Entschluss. "Du darfst jetzt nicht bei mir bleiben", sagte sie so fest, wie es ihr noch möglich war. "Kümmere dich um dich selbst!" Pentia jedoch drückte sie mit sanfter Gewalt auf ihr Lager zurück und erwiderte: "Was redest du da nur für einen Unsinn! Wenn du nicht mehr für uns beide 57 sorgen kannst, dann muss ich es eben tun. Ich lass mir etwas einfallen. Du wirst schon sehen!" Wäre Franziska nicht vom Fieber umnebelt gewesen, hätte sie sich über diese Rede ihrer kleinen Schwester sehr gewundert. Erst recht hätte sie nicht verstanden, dass sie am Abend tatsächlich etwas Brot brachte. Auch am nächsten Tag besorgte sie welches, dazu ein wenig Hafer und Buchweizen für einen Brei. Wie jemand, der einer geregelten Arbeit nachgeht, verschwand sie frühmorgens und kehrte am Nachmittag mit dem Lohn zurück. Dann half sie Franziska, sich zu waschen (soweit man das hier konnte), kühlte ihr die Stirn, fegte den eingedrungenen Schnee aus der Behausung. Leider erholte die Kranke sich trotz dieser Fürsorge nicht. Ihr Körper war glühendheiß, und immer öfter phantasierte sie im Fieber. Manchmal hatte sie das Gefühl, ein eiserner Reifen ziehe sich um ihre Brust langsam zusammen. Dann erschienen ihr die Stunden, die ihre Schwester fort war, wie eine Ewigkeit. Der Tod schlich um die Behausung. Jederzeit konnte er hereinkommen. Am Abend versuchte Pentia, sie mit Geschichten aufzumuntern. Beim Erzählen bekam ihre Stimme einen eigenartigen Klang - fast so, als würde sie ein Lied singen. "Im fernen Britannien lebte einst eine Königstochter. Die wollte nicht heiraten, um ihr Leben lang als Jungfrau allein Gott zu gehören. Eines Tages aber kam ein schöner Jüngling, der sich nicht abweisen ließ. Sie wusste nicht, was sie tun sollte - bis ihr ein Engel erschien und ihr riet, sich drei Jahre Zeit bis zur Hochzeit auszubitten und nach Rom zu pilgern. Der Bräutigam sollte sich unterdessen im Christentum unterweisen lassen, denn er war noch ein Heide." "Hast du dir das ausgedacht?" fragte Franziska verwundert. "Nein, das ist die wahre Geschichte der heiligen Ursula, deren Kirche wir dort drüben sehen." "Aber woher kennst du diese Geschichte?" "Ich kenne sie eben! Hör zu, was weiter passierte! Die Königstochter suchte sich zehn Jungfrauen als Begleiterinnen aus und dazu viele Dienerinnen und Ritter. Ihr Vater rüstete für sie eine große Flotte, und dann fuhr die Schar den Rhein hinauf bis hierher nach Köln." Franziska war eingeschlummert. Sie konnte nur kurze Zeit zuhören. Pentia deckte sie zu und freute sich, ihr für ein paar Stunden Erleichterung verschafft zu haben. Am nächsten Tag setzte sie fort, wo sie aufgehört hatte: "In Köln kam wieder der Engel zu ihr und sagte, dass sie in dieser Stadt zur Märtyrerin werden würde. Sie erschrak heftig, vergaß die Worte aber bald auf dem weiteren Weg. In Rom wurden die Pilger von Papst Cyriakus empfangen und in der ganzen Stadt jubelten ihnen die Leute zu." "Wer erzählt dir nur das alles?" fragte Franziska. Sie hätte gar zu gern erfahren, was die kleine Schwester trieb, wenn sie fort war. Pentia wich aber auch diesmal aus. "Du würdest dich unnötig sorgen. Ich sag's dir später. Leg dich wieder hin! ... Zwei römische Jünglinge verliebten sich in die schöne Ursula und warben um sie. Sie hatte sich ja aber schon jemandem versprochen und wies sie ab. Die beiden waren darüber so zornig, dass sie die wilden Hunnen gegen die Pilger aufhetzten ..." Am nächsten Tag hörte Franziska im Fieberdämmer wie Pentia draußen vor der Hütte mit jemandem verhandelte und ihn leidenschaftlich an etwas zu hindern versuchte. Wenig später tauchte ein kahlköpfiger Mann mit einem en- 58 gen, schlauchähnlichen, braunen Gewand am Eingang auf. Franziska erschrak und war sofort hellwach. Das konnte kein anderer sein als der Leproseprüfmeister. Sie erinnerte sich, was sie von Benno und Anne vom Melatenhospital am Hahnentor wusste. Lieber wollte sie sterben, als für immer dort hinter diesen Mauern zu verschwinden. Beklommen kroch sie nach draußen. Ein höchstens vierzehnjähriger Junge mit großen Augen, aus denen er die Kranke ängstlich anstarrte, trug eine Schale mit sauberem Wasser. Der Meister ließ sie ihn auf die Erde nieder stellen und ging mit ausdruckslosem Gesicht an die Arbeit. "Ihr dürft mir meine Schwester nicht wegnehmen!" flehte Pentia. "Ich betreue sie doch schon seit fast zwei Wochen und habe mich noch nicht angesteckt." Der Meister beachtete sie gar nicht. Er erledigte seine Pflicht, und das tat er so korrekt und ernst, dass es fast unmenschlich war. Nach einer langen Begutachtung, während der er kein einziges Wort redete, gab er dem Jungen das Zeichen, ihm die Schüssel zu reichen. Er wusch sich die Hände, schüttelte sie trocken. "Werdet Ihr sie mitnehmen?" Pentia zitterte. Über ihr Gesicht liefen Tränen. Den Prüfmeister kümmerte es nicht. Er hatte schon zu viele Tränen gesehen in seinem Amt, war abgestumpft dagegen. Fast teilnahmslos sagte er nur: "Sie kann hier bleiben. Es ist kein Aussatz." Vor Freude umarmte Pentia ihre Schwester derart ungestüm, dass sie mit ihr unfreiwillig durch den Schnee kugelte. "Nun kann ich dir wenigstens die Geschichte zu Ende erzählen." Sie lächelte verschmitzt, während sie sich die Tränen abwischte. "Als die Pilger auf dem Rückweg wieder am Rhein waren und mit ihren Schiffen auf Köln zufuhren, warnten viele sie vor den heimtückischen Barbaren. Ursula aber fiel ein, was ihr der Engel gesagt hatte. Wenn Gott sie in seinem unerforschlichen Willen als Märtyrerin sehen wollte, so durfte sie sich nicht widersetzen." Pentia vermochte sogar den Tod in einer Art zu beschreiben, dass er seinen Schrecken verlor. Auch Franziska unterlag diesem Eindruck, und ihr Gesicht verklärte sich unwillkürlich ebenso wie das der Erzählerin. "Ursulas Bräutigam hatte inzwischen das Königreich seines Vaters geerbt und kam ihr mit einer eigenen Flotte entgegen. Beide feierten Hochzeit und zogen dann gemeinsam in Köln ein. Da plötzlich brachen die Hunnen mit dem grimmigen Etzel an der Spitze aus ihren Verstecken hervor und durchbohrten die Pilger mit ihren Pfeilen. Keiner überlebte. Die Seelen der Ermordeten jedoch wurden von einer Schar Engel in den Himmel hinauf getragen." Leider musste Pentia bald einsehen, dass sie ihrer Schwester zwar Mut zusprechen konnte, gegen die Krankheit selbst hingegen machtlos war. Drei Tage vor Weihnachten ging es Franziska so schlecht wie nie zuvor. Sie erwachte nur noch selten aus ihren Fieberträumen. Bleich und ausgezehrt glich sie schon mehr einer Toten als einer Lebenden. Pentia ging nun nicht mehr fort. Wozu auch? Wenn ihre Schwester nichts zum Essen mehr annahm, dann wollte auch sie nichts mehr haben. Sie warf sich über sie, krallte sich in ihren Kleidern fest, rüttelte sie. "Du musst wieder aufwachen", schluchzte sie. "Bitte wach wieder auf! Du weißt doch noch nicht, wie Ursula und die Jungfrauen ihres Gefolges von den Kölnern hierher gebracht und begraben worden sind, und wie man eine Kirche für sie gebaut hat, eine ganz kleine zuerst, und später eine zweite, größere ..." 59 Sie erzählte alles, was ihr gerade einfiel über Ursula, ihre verschiedenen Kirchen und ihr Stift. Ganz laut erzählte sie es sich selbst, schrie es geradezu, um ihre Angst zu betäuben. III D rei Tage und drei Nächte lag Franziska in tiefer Bewusstlosigkeit. Jede Stunde konnte ihre letzte sein. Pentia kniete neben ihr und betete fast ohne Unterbrechung für sie. Dann schlug die Kranke plötzlich die Augen auf und fragte unvermittelt: "Ist heute der Heilige Abend?" "Ja! Woher weiß du das? Du warst doch ..." "Ich fühle es." Sie starrte mit glasigem Blick geradeaus, doch ihre Gedanken waren erstaunlich klar. "Ich möchte heute Abend im Dom sein. Vielleicht ist das heute mein letztes Weihnachtsfest. Ich will es nicht in dieser elenden Hütte verbringen." "Aber du kannst doch gar nicht laufen!" "Doch, ich kann." Sie führte es vor. Zwar stand sie sehr unsicher auf den Beinen und musste sich auf einen Stock stützen, doch sie kam ein paar Schritt voran. Pentia traute ihren Augen nicht und war zugleich unschlüssig, ob sie sich freuen durfte oder nicht. Hatte Gott ein Wunder vollbracht, oder war alles nur eine letzte törichte Laune vor dem Zusammenbrechen? Trotzdem bereitete sie alles vor, um ihrer Schwester den Wunsch zu erfüllen. Franziska hatte den sonderbaren Eindruck, nur noch Beobachter zu sein. Sie lief, auf Pentia gestützt, mitten auf dem Eigelstein in Richtung Dom und fürchtete sich nicht. Ganz ruhig dachte sie an die Graukittel, bedauerte sogar, keinen von ihnen zu sehen. Da sie alles, was sie kannte, noch einmal erleben wollte, gehörten sie nun einmal dazu. Bald kamen die beiden zu jener Pforte, hinter der das Domareal begann. Die reichen Anwohner hatten ihre Häuser prächtig geschmückt. In den Fenstern standen zahllose Kerzen und Öllämpchen. An anderen Wintertagen strebte um diese Zeit jeder nur noch seinem Haus zu. An diesem Abend aber drängten sich auf der Straße Hunderte fröhlicher Menschen - Männer, Frauen und sogar kleine Kinder. Alle hatten dasselbe Ziel - den Dom. Franziska und Pentia ließen sich einfach treiben. Es war abzusehen, dass viele die Christvesper draußen auf dem Hof würden erleben müssen. Die beiden Mädchen aber hatten Glück. Sie wurden zunächst in die Nikolausvorhalle und dann weiter bis in den Hauptraum gespült. Als sie sich dem Druck der Nachdrängenden wieder entwunden hatten und sich umsehen konnten, fühlten sie sich zurückversetzt in jenes Alter, als für sie noch alle Dinge groß und beeindruckend waren. Wie Zwerge wirkten die Menschen in der riesigen Kirche. Da die Vesper am Marienaltar im Ostchor gelesen wurde, fürchtete Franziska, von ihrem Platz unter dem Lettner aus zu wenig zu sehen. Deshalb stürzte sie sich noch einmal ins Gedränge. Pentia konnte ihr kaum folgen und begriff nicht, wieso die kranke Schwester plötzlich so viel Kraft hatte. In der Mitte des Doms stand der Schrein der Heiligen Drei Könige. Ihre Reliquien allein hätten gereicht, Christen aus aller Welt nach Köln zu ziehen. Darüber hing ein gewaltiger Kron- 60 leuchter mit hundert Kerzen. Doch es wäre auch ohne ihn taghell gewesen. Zwei Dutzend Öllampen hingen von der Decke der Seitenschiffe herab. Ebenso viele standen zwischen den Säulen auf der Erde. Vor den Altären und Epitaphen brannten Kerzen. Das meiste Licht freilich kam von vorn, wo die goldenen Reliquienkästchen und der siebenarmige Kandelaber auf dem Marienaltar glänzten und blitzten. Der Strahlenkranzheiland darüber wurde von fünf ungewöhnlich großen, in Kreuzform aufgehängten Lampen angeleuchtet. Der Gottesdienst begann, aber Franziska drängte sich immer noch weiter nach vorn, ohne das gelegentliche Murren der Leute zu bemerken, wie im Traum, magisch angezogen vom Licht. Als der Priester einen neuen Teil des Rituals einleitete, geriet sie plötzlich in eine Bewegung hinein, die sie bis unmittelbar vor den Chor führte. Später bemerkte sie, dass die Leute an einer Wiege vorüber zogen. Wer das Glück hatte, in ihre Nähe zu kommen, brachte sie kurz zum Schaukeln und ging weiter. Dann nahm der Priester das "Jesuskind" heraus und trug es zum Altar. Franziska wusste nicht, ob sie noch auf der Erde weilte oder schon im Himmel war, so fern allem Kummer und Schmerz fühlte sie sich. Unterdessen drängten Kirchendiener, große kräftige Männer in roten Mänteln, die Menschen ein paar Schritt zurück, um Platz zu gewinnen für eine Gruppe von Tänzern. Die Tänzer, Jungen von dreizehn oder vierzehn Jahren, knieten kurz vor dem Altar nieder, bekreuzigten sich und begannen mit ihrer Vorführung. Nachdem sie verschiedene Figuren gemeinsam gebildet hatten, trat einer von ihnen mehr und mehr in den Vordergrund, bis er die Aufmerksamkeit ganz allein auf sich zog und die anderen ihn nur noch umringten. "Der Christkindtänzer!" flüsterten eine Frau in Franziskas Nähe ergriffen. Es gab wohl kaum jemanden im ganzen Dom, der keine Regung in sich fühlte, gleich ob er reich oder arm war, redlich oder unehrlich, gesund oder krank. Ein Gesang aus Hunderten Kehlen stieg zum Gewölbe auf, und mancher glaubte, die Schar der Engel mit ihren Harfen und Posaunen von hoch oben antworten zu hören. Nach dem Gottesdienst kehrten die beiden Mädchen nicht zum Entenpfuhl zurück. Franziska war, kaum dass der Priester den Segen erteilt hatte, entkräftet zusammengebrochen. Pentia brachte sie ins Freie (halb tragend, halb zerrend) und schimpfte dabei: "Warum bist du bis zum Altar gelaufen? Wer krank ist, muss sich schonen! Wie kann man so dumm sein?!" Franziska aber schmunzelte trotz der Erschöpfung. "Was ist nur in meine kleine Schwester gefahren? Vor ein paar Wochen noch hast du dich keinen Schritt ohne mich zu gehen getraut und heute zankst du mit mir wie mit einem Kind." "Habe ich deswegen Unrecht?" "Nein! Trotzdem werde ich dich morgen gleich noch einmal ärgern. In der Kirche haben die Leute erzählt, dass ganz in der Nähe eine Gauklertruppe auftritt. Wenn Gott mir heute die Christvesper nicht versagt hat, warum soll er mir dann nicht auch noch dieses Vergnügen gönnen?" "Du forderst das Schicksal heraus und das ist Sünde!" Pentias Sorge war auf den ersten Blick berechtigt. Die Entscheidung über Leben und Tod fällt jedoch nicht nach einleuchtenden Regeln. Licht und Finsternis führen einen geheimnisvollen, unsichtbaren Kampf. Niemand weiß, wann und woher die eine oder die andere Seite jene Unterstützung erhält, welche die Waage des Schicksals sich nei- 61 gen lässt. Auf dem Höhepunkt der Krise stehen beide Kräfte einander gegenüber wie zwei ausgeblutete Heere. Eine Winzigkeit, ein Zufall vielleicht, kann von endgültiger Bedeutung sein. Aber fast immer ist der Kranke dem Leben umso näher, je entschlossener er mit seinem eigenen Willen in diesen Kampf einzugreifen versucht. Die Nacht verbrachten die Mädchen in einem der Verstecke, die sie hier noch kannten. Am nächsten Morgen schlief Franziska so lange, dass Pentia Angst um sie bekam. Doch sie war keineswegs tot, hatte sich vielmehr von den Anstrengungen des Vortags erholt und bestand auf ihrem Plan. Die Gaukler sollten auf dem Forum feni zu sehen sein, einem Markt irgendwo nördlich des Doms nahe am Rhein. Um ihn zu suchen, liefen die beiden an den Werkstätten der Waffenschmiede vorbei bis zum Ende des Platzes und bogen dann nach rechts in eine Gasse ein. Gewöhnlich war hier nur mühsam hindurch zu kommen, weil Händler, welche Becher aus Metall, Holz und Leder anboten, den Durchgang versperrten. Weil aber an Weihnachten niemand arbeiten durfte, gab es kein Gedränge. Sogar der Altmarkt, der sonst von Menschen überquoll, schlummerte jetzt friedlich unter einer Schneedecke. In der Straße, die gegenüber begann, waren die Mädchen noch nie gewesen. Sie wussten nur, dass dort regelmäßig Kleidungsstücke aller Art aus großen Kisten verkauft wurden. "So wie der Mann den Weg beschrieben hat, müssten wir bald am Ziel sein", sagte Franziska. Tatsächlich öffnete sich vor ihnen bald ein Platz von enormer Ausdehnung, was vor allem dadurch auffiel, weil weder Bäume noch Verkaufsbuden ihn gliederten. "Man könnte denken, vor einem zugeschneiten See zu stehen", fasste Pentia ihre Eindrücke zusammen. Menschen waren nur in der südöstlichen Ecke zu sehen. Dort standen fünf Wagen im Halbkreis. Zwei waren vorn und hinten offen. Über die morschen Seitenbretter wölbte sich eine löchrige Plane. Die übrigen hatten einen geschlossenen Aufbau, doch es schien, als könnte ihnen das nächste Schlagloch zum Verhängnis werden. Auch die Leute, die darin wohnten, sahen ärmlich und schmutzig aus, was sie freilich nicht hinderte, frohgemut zu sein. Mehrere Erwachsene saßen um ein Feuer und unterhielten sich. Drei Kinder jagten einander kreuz und quer über den Platz und vollführten dabei ein Spektakel, als wären sie ihrer dreißig. Franziska hatte das Gefühl, den größten Wagen schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Sie war jedoch im Augenblick zu erschöpft zum Nachdenken. "Ich werde mich noch ein wenig ausruhen", sagte sie. "Wenn es losgeht mit dem Auftritt, dann weck mich bitte!" Pentia nickte, und Franziska verkroch sich in ein kleines hölzernes Pumpenhäuschen, wo sie sofort einschlief. "Leute, kommt her! Ihr werdet kein zweites Mal erleben, was ihr heute seht! Kommt her! Wir treten in jeder Stadt nur einmal in zehn Jahren auf! Kommt! Euch werden Kunststücke gezeigt, die sonst keiner zeigt auf der ganzen Welt." Franziska schreckte hoch, noch ehe Pentia sie wecken konnte. Der Platz hatte sich bevölkert. Die Leute kamen vom großen Vormittagsgottesdienst und führten nun ihre besten, eigens für das Fest aus den Schränken und Truhen geholten Kleider vor. In Schlangenlinie um die Spaziergänger herum kurvten im Gänsemarsch fünf seltsame Gestalten in grellbunten Kostümen und mit geschminkten Gesichtern. Voraus lief eine junge Frau mit einer durchdringenden, 62 schrillen Stimme, die mit hanebüchenen Versprechungen für die Gaukler warb. Die anderen unterstützen sie mit Schellen und Rasseln. Zumindest erregten sie auf diese Weise Aufmerksamkeit. Der Auftritt begann, wie die Ankündigung hatte befürchten lassen, mit ohrenbetäubendem Lärm und billigen Kunststücken. Das Publikum aber war gutmütig gestimmt, lachte über die dümmsten Witze, steuerte selbst mit lustigen Zwischenrufen bessere bei. Erst als sich die Vorführung in die Länge zog, ohne dass Aufsehen erregendes geschah, kam ein wenig Unmut auf. Dem hielten die Gaukler entgegen: "Ist es nicht so, dass das beste Gericht immer am Ende gereicht wird? Ihr geht ganz gewiss nicht enttäuscht nach Hause. Der Höhepunkt versöhnt selbst den Verwöhntesten." Ein etwa dreißigjähriger Südländer jonglierte mit kleinen Steinen, Reifen und Stöcken. In den Pausen, die er zwischen seinen Nummern ließ, tanzte eine junge Frau. Sie war schwarzhaarig wie er und feurig, wie man es fast nur bei fahrendem Volk erlebte. Die beiden fanden mehr Anklang als die Schreihälse zuvor und verhinderten, dass die Stimmung umschlug. Dennoch wollten die Leute endlich den Höhepunkt erleben. "Seid ihr nun Nachfolger der großen Beldinis oder nur Betrüger?" rief ein alter Mann. "Was ihr bis jetzt gezeigt habt, kann jeder Vagabund." Franziska beschwerte sich nicht, aber auch sie hatte sich mehr versprochen. Der Auftritt ermüdete sie. Die Augen fielen ihr zu. Traum und Wirklichkeit vermischten sich. Das Stimmengewirr um sie herum erschien ihr wie das Tosen der Brandung in ihrer Heimat. Der Name Beldini löste in ihr ein Wohlgefühl aus, wie wenn warmer Regen über die Haut rieselt. Als der Beifall jedoch anschwoll und echte Begeisterung sich ausbreitete, war sie in eine tiefe Ohnmacht geglitten und kein Eindruck drang mehr bis zu ihr durch. 63 7.Kapitel I F ranziska träumte vom Fliegen. Es dauerte lange, bis sie sich von der Erde losgerissen hatte, ähnlich einem Schwan, der zum Starten fast die ganze Länge eines Sees benötigt. Dann aber schwebte sie, und die Häuser unter ihr wurden kleiner und kleiner. Sie erreichte die Wolken, stieß durch sie hindurch und jagte immer schneller dem Firmament entgegen. Plötzlich fühlte sie, dass sie im Himmel war. Vor ihr schwebte die Jungfrau Maria, von der sie allerdings nur die Augen sah, mitten in einem Kranz von Licht - eigentümliche blaugraue Augen, die ein wenig starr blickten. Für einen Moment wurde ihr beklommen zumute, denn sie glaubte, dass dieser Blick bis in ihre Seele dringe und dort jeden bösen Gedanken erspähe. Doch bald überwog wieder die Überzeugung, dass Maria sie retten würde, trotz des Schlechten in ihr. Sie widerstand dem Blick, versenkte sich in ihm und wurde gleichsam neu geboren zu einem besseren Leben. Da erschienen ihr die Augen wie Brunnen voll kristallklarem Wasser. Plötzlich packte sie von hinten eine Hand und riss sie zur Erde zurück. Noch ganz benommen von ihrem Traum, schlug sie die Augen auf und erschrak so heftig, dass sie gerade noch einen Aufschrei unterdrücken konnte. Umkränzt von einer Flut rotblonder Haare anstelle des Lichtes sah sie die blaugrauen Augen der Maria wieder vor sich. Sie gehörten einem jungen Mädchen, das neben ihr saß. Dann war sie völlig wach und erkannte Ramira, die Artistin, die Freundin ihres ermordeten Bruders. "Wie kommst du hierher? Gott selbst muss uns wieder zusammengeführt ha- ben, hier in Köln, nach elf Monaten und gerade rechtzeitig, um mich vor dem Tode zu retten?" Das Gauklermädchen musterte Franziska ein wenig verwundert. "Ich habe dich nicht gerettet. Du warst schon über das Schlimmste hinweg. Jetzt musst du dich nur noch ausruhen und essen, damit du wieder zu Kräften kommst." "Wir sind uns auf der Burg meines Vaters begegnet und treffen uns jetzt im fernen Köln wieder ..." "Hier triffst du innerhalb von ein paar Jahren die halbe Welt. Wer im Lande herumzieht, den verschlägt 's irgendwann mal hierher, ob er nun Gaukler ist, König oder Bettelmönch." "Glaubst du nicht an Gottes Fügungen?" "Gott ... So viele Menschen beten zu ihm. Alle wollen etwas von ihm. Allen gleichzeitig aber kann er nicht helfen. Mag sein, dass er zumindest alle hört. Mag sein, er hilft zuerst denen, die ihn am nötigsten brauchen. Aber wie viele Leute brauchen ihn gerade jetzt viel mehr als wir?! ... Wie war das bei deinem Vater, wenn er einen Gerichtstag abhielt? Ich bin mir sicher, auch er konnte niemals alle zufrieden stellen, so sehr er sich auch darum bemühte." Franziskas Gedanken wanderten unwillkürlich zur Wardenburg zurück, ins kleine Land zwischen den Sümpfen, zu ihrem Vater Wilhelm, ihrer Mutter Martha, ihrer stolzen Schwester Agnes und ihrem ungebärdigen Bruder Rotbert. Doch das aufkeimende Glücksgefühl wurde rasch erstickt von anderen Erinnerungen - die Burgvogtsfrau in Wildeshausen, die mit dem Rohrstock droht, die heimtückischen Höflinge und deren hochnäsigen Kinder, der jähzornige, zu jeder Untat fähige Graf Burchard. Schließlich fielen ihr die Bilder des Mordes in der Schatzkammer wieder ein und sie versank in tiefe Traurigkeit. "Auch ich muss noch immer häufig an ihn denken", sagte Ramira, die ihre Gedanken erriet. Franziska fuhr erschrocken zusammen. "Ja ... Das sind wir ihm schuldig. Wir dürfen ihn niemals vergessen." Sie schwiegen eine Zeitlang - bis das Gauklermädchen eine Frage stellte, die sie schon seit dem Beginn ihres Wiedersehens beschäftigte. "Du und Pentia, ihr seht nicht so aus, als wäret ihr zusammen mit euren Eltern hier in Köln. Was ist geschehen?" "Ich war dabei, als Burchard ihn umgebracht hat. Ich weiß, dass der Graf lügt." "Ich verstehe." Wieder fielen sie in Schweigen. Diesmal war es Franziska, die zuerst wieder zu reden anfing. "Wie ist es dir inzwischen ergangen?" Ramira zuckte mit den Schultern. "Da gibt's nicht viel zu erzählen. Seit dem Tod meines Vaters bin ich wieder eine richt'ge Artistin. Es mag sein, dass viele Leut' uns Gaukler verachten, doch ich bin stolz drauf dazuzugehören. Ich bedaure die Bauern, die nie aus ihrem Dorfe rauskommen. Wir sind heut' hier, morgen dort, keinem Herrn untertan, frei wie Vögel am Himmel. Uns gehört, was sonst keinem gehört - die Sterne, die wilden Wiesen, die versteckten Quellen und Bäche." Später dann fand Franziska Gelegenheit, sich umzusehen. Sie lag auf dem Fußboden eines ziemlich engen, mit Möbeln und Hausgerät hoffnungslos verstellten Raumes. Neben ihr stand ein eiserner, rostroter Ofen. Der Tisch gegenüber unter dem Fenster ließ nur ei- nen engen Gang zu einem doppelstöckigen Bett. Ein zerschlissener Stuhl mochte einstmals eine Bürgerstube geziert haben. Die Krüge, Töpfe und Schüsseln stammten hingegen eher von einem Bauernhof. Der metallisch glänzende Kerzenständer auf dem Tisch war beinahe vornehm. Nichts passte zueinander. Über Franziskas Lager wölbte sich eine runde, von armdicken Rippen gestützte Holzdecke. An den Rippen hingen Bündel von Kräutern und Netze mit Hackfrüchten, dazu ein Vogelbauer. Eine Woche lang waren das ihre wichtigsten Eindrücke. Sie schlief viel, aber nicht mehr ohnmachtähnlich wie in der Krise sondern ruhig und tief. Dabei kam sie wieder zu Kräften. Bald blieb sie nur noch liegen, weil Ramira das so wollte, und langweilte sich. Eine willkommene Abwechslung waren da die gelegentlichen Besuche ihrer Schwester. Seit der Krankheit sah sie Pentia mit anderen Augen. Sie war nicht mehr das kleine Mädchen von früher. Es gab nunmehr Geheimnisvolles in ihrem Wesen. Eines ihrer Rätsel interessierte Franziska besonders brennend. "Wie hast du uns beide am Entenpfuhl vor dem Verhungern gerettet? Verrätst du es mir?" "Kannst du es dir nicht denken?" Pentia strahlte vor Stolz übers ganze Gesicht. "Die Kanoniker von St.Gereon haben uns versorgt." "Aber die darf doch niemand anbetteln!" "Ich stand unter dem Schutz des alten Geschichtenerzählers." "Meinst du diesen Geizhals, der mich weggejagt hat?" "Das ist ein Kauz, aber kein Geizhals. Du warst damals zu ungeduldig mit ihm." Eine andere Art von Abwechslung waren die Unterhaltungen vor dem Wagen, von denen Franziska manchmal jedes Wort verstand. Bald konnte sie die 65 Stimmen zuordnen. Das Lager vereinigte mehrere Truppen fahrenden Volkes, die sich zufällig gefunden hatten und nur zeitweilig zusammenbleiben wollten. Zu Ramiras Gauklerfamilie gehörten außer ihr nur noch Mario (der Südländer), seine Frau Melanie (die Tänzerin) und Alexander (dem alle voller Ehrfurcht begegneten). Die Frau mit der schrillen Stimme und ihre Freunde bildeten eine bunt zusammen gewürfelte Schar ziemlich sorgloser Leute. Keiner von ihnen konnte irgendetwas besonders gut, keiner hatte Lust, sich anzustrengen, alle aber verstanden meisterhaft, andere hinters Licht zu führen. Mal traten sie mit viel Geschrei und wenig Einfällen als Gaukler auf, mal lebten sie vom Handeln mit wertlosem Zeug oder einfach vom Diebstahl. Zwischen den Gauklern und ihnen gab es seit dem gemeinsamen Auftritt auf dem Forum ständig Streit. "Ihr vergrault die Zuschauer anstatt sie anzulocken", hatte Alexander festgestellt und sie damit schwer beleidigt. Dann wohnten noch zwei Familien mit mehreren Kindern im Lager, entflohene Dienstleute eines hartherzigen Grundherrn auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Damit, dass Franziska sie durch die Wand des Wagens verstehen konnte, rechneten die Gaukler übrigens nicht. Sie redeten ganz unbefangen auch über die beiden Mädchen aus dem Norden. Meistens begann Melanie damit. "Sie sind keine Gaukler wie wir. Sie können keine Kunststücke, nutzen uns nichts, essen aber aus unseren Schüsseln." "Solange diese Franziska krank ist ..." entgegnete Mario zaghaft und wollte zu einem Vorschlag ansetzen. Seine Frau unterbrach ihn jedoch sofort heftig. "Das ist es ja gerade! Sie ist krank und wird uns alle anstecken." Damit konnte sie ihm fast immer Angst einjagen. Freilich hätte er auch ohne dem nicht lange widersprochen. Obgleich auch er ein hitziges Temperament besaß, ließ er sich auf einen Streit mit Melanie allenfalls ein, wenn ihm eine Sache wirklich sehr am Herzen lag. Die im Vergleich mit ihm viel stillere Ramira hingegen ließ sich nicht so einfach nieder reden. "Es ist kein Aussatz. Der Prüfmeister hat sie untersucht. Und der kennt sich aus mit den Krankheiten,." "Du bist jung, hast von der Welt noch nicht viel gesehen." Trotzdem verhielt sich Melanie zu ihr respektvoller als zu ihrem Mann. Franziska fand das erstaunlich. Zwar beruhte der Erfolg der Truppe auf Ramiras außergewöhnlichem Talent, doch war die Artistin erst fünfzehn Jahre alt. Es spielte wohl eine Rolle, dass nur sie und Alexander als echte Beldinis galten. Das war unter Gauklern so etwas wie ein Adelstitel. Folglich hätte allein das Wort des Alten die Meinung Ramiras entkräftet. Der aber schwieg hartnäckig und so blieb vorläufig alles wie es war. II E s kam der Tag, an dem Franziska auch nach Ramiras Urteil wieder kräftig genug zum Aufstehen war. Als sie hinaustrat und die Stufen der kleinen Treppe hinunter stieg, fühlte sie sich wie zum zweiten Male geboren. Sie war glücklich, obgleich das, was sie sah, kaum dazu beitrug. Mitten im Winter hatte es bei ungewöhnlich mildem Wetter zu regnen begonnen, und das Forum, auf dem nun kein Schnee mehr lag, wirkte öde wie eine Brache. Der 66 Getreide- und Heumarkt hatte verrottete Halme hinterlassen, der Viehmarkt von Anfang November den Dreck der Schweine und Rinder, Schafe und Ziegen. Die Gewandschneider sowie die Salz- und Gewürzverkäufer, die den Platz jetzt nutzten, zogen sich an die Ränder zurück. Wohl fühlten sich allem Anschein nach nur die Leute aus der Wagenburg. Die Kinder spielten mitten im größten Unrat - was wohl schon gereicht hätte, sie für die Bürger minderwertig erscheinen zu lassen. Dass sich Ramiras Familie im guten Sinne abhob, beachtete niemand. Der glanzvolle Auftritt geriet in Vergessenheit. Die Fremden wurden zunehmend zum Ärgernis. Doch Franziska mochte in diesem Moment an nichts Unangenehmes denken. Melanies wütenden Blick übersah sie einfach. Sie war ja wieder gesund und konnte niemanden mehr anstecken. Und sie hatte wieder genügend Kraft, für sich und ihre Schwester zu sorgen. Zuversichtlich, alle Missverständnisse mit einem Gespräch aus der Welt zu schaffen, ging sie auf die junge Frau zu. "Ab heute werde ich mich nützlich machen. Ich weiß, dass ich euch Dankbarkeit schulde." Melanie indes entgegnete schroff: "Wir brauchen weder dich noch deine Schwester." Dann wandte sie sich ab, Franziska völlig ratlos zurücklassend. Warum grollte ihr die Gauklerin? Es gab im Lager einige zwielichtige Gesellen, die auf Kosten der anderen lebten, ohne dass eine Krankheit sie am Arbeiten hinderte. Mit denen aber fühlte sich Melanie brüderlich verbunden. Franziska blickte an sich herunter. Ihr Kleid war durch die Graukittel zerfetzt und vom Schmutz des Entenpfuhls durchtränkt worden, so dass es sich kaum noch unterschied von dem der gewöhnlichen Vagabunden. Am Nachmittag richtete sie es so ein, dass sie mit Ramira allein sprechen konnte. Die Freundin spielte beim Zuhören zerstreut mit einem Stock und einem kleinen Stein. Dann sagte sie nur: "Du darfst dir das nicht zu Herzen nehmen", und lenkte sofort auf ein anderes Thema. "Weißt du, dass Köln für uns Beldinis eine Schicksalsstadt ist?" "Nein. Warum?" "Vor ungefähr fünfundzwanzig Jahr'n war uns're Sippe noch groß. Dreizehn Erwachsene und fünf Kinder gehörten dazu. Die Beldinis zogen im ganzen Rheinland umher, hatten Schutzbriefe, war'n beliebte Leute. Sie durften sogar an vornehmen Höfen auftreten. Aber dann kam der Krieg." "Der Krieg, bei dem die Hohenstaufer und die Welfen um die Königskrone kämpften?" "Vielleicht. Ich versteh' wenig von den Angelegenheiten der großen Herren. Nur die Geschichte der Familie, die kenn ich. Die weiß ich von Alexander. Später muss ich sie an meine Kinder weitergeben. Eine alte Sitte bei uns." Franziska hatte geglaubt, Gaukler würden über ihre Herkunft gar nicht nachdenken, und schämte sich nun insgeheim ihres Irrtums. "Damals hatte ein gewisser Adolf die Macht über den Dom. Der war vom Papst längst abgesetzt, hatte seinen Nachfolger aber einfach gefangen genommen. Es gab indes nicht nur zwei Erzbischöfe sondern auch zwei Kön'ge. Philipp, der eine von beiden, stand eines Tags mit einem Heer vor den Toren. Adolf hätt' ihn gern rein gelassen, doch die Bürger verhinderten es. Ein'ge Wochen später gewann Philipp mit seinem Heer eine Schlacht. Da bekamen 's die Kölner mit der Angst, öffneten rasch die Tore und bettelten um seine Gunst, damit sie ihre Privilegien nicht verlieren." "Was hatten deine Vorfahren damit zu schaffen?" 67 "Eines musst du wissen: Wenn's Unfrieden gibt irgendwo, gleich aus welchem Grund, haben Rechtlose wie wir Gaukler immer etwas damit zu schaffen." Franziska nickte, ohne recht verstanden zu haben. "Damals lebte noch Genevieve. Sie war ein Mensch, wie's nur ganz wen'ge gibt. Vielleicht erzähl' ich dir ein andermal mehr davon. Sie hatte zwei Söhne, Zwillinge mit Namen Simon und Daniel. Simon ähnelte seiner Mutter. Vor allem Ruhe und Klugheit hatte er von ihr. Daniel war ein Hitzkopf und Schwärmer, sein Sohn Martin ebenso. Trotz aller Warnungen mischten die beiden sich in den Streit der Bürger ein, hielten Reden auf dem Marktplatz gegen den Erzbischof während der Belag'rung. Als König Philipp in die Stadt kam, warf man sie ins Gefängnis. Später wurden sie zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Bürger opferten natürlich lieber ein paar Fremde als einen der Ihren." Franziska spürte ein Würgen im Hals. Diese Geschichte war nicht so schaurigschön wie die von der heiligen Ursula. "Hatten sie denn keine Freunde? Hat niemand versucht, sie zu retten?" "Während der Unruhen hatten sie viele Freunde, nachher keine mehr. Es kam für die Beldinis sogar noch schlimmer, denn eines Tags sagten die Leut', dass nicht nur Daniel mit seinem Sohn sich gegen Philipp verschworen hätt' sondern auch seine Verwandten. Da blieb nur die Flucht." Ramira seufzte. "Die alte Genevieve ist bald darauf gestorben. Daniels Frau Regina hat sich aus Kummer das Leben genommen. ... Seine Tochter Barbara lebt vielleicht noch in Köln. Sie wollte sich verstecken und das Ende der Anfeindungen abwarten." Franziska erfuhr noch, dass Ramiras Großvater und Alexanders Vater Brüder waren und dass es schwarze und rote Beldinis gab - benannt nach der vorherrschenden Haarfarbe. Ramira hatte das Bedürfnis zum Erzählen, und so vergaßen beide die Zeit. Plötzlich aber stand Melanie bei ihnen. "Hier also hast du dich versteckt! Wir wollen über den Auftritt auf dem Neumarkt sprechen." Sie schimpfte und fand kein Ende dabei, wandte sich dabei allerdings ausschließlich an Ramira. Franziska strafte sie durch Nichtbeachten. III D ie Spannung wurde zunehmend unerträglich. Ein Machtwort von Alexander hätte die Gemüter beruhigt. Sein Schweigen indes konnte alles Mögliche bedeuten. Bei den Auftritten ließ er sich von Ramira beeinflussen. In dieser Hinsicht konnte die Fünfzehnjährige ihren Kopf fast immer durchsetzen. Der Streit um Franziska und Pentia aber war etwas ganz anderes, und das nährte Melanies Hoffnungen. Die Artistin litt mehr, als sie zugab. Sie lebte am liebsten in ihrer eigenen Welt. Zwischen den Auftritten übte sie stundenlang wie eine Besessene, erfand immer neue Kunststücke, spielte auf der Leier, sang selbst erdachte Lieder. Darüber vergaß sie alles, selbst das Essen. Im Grunde war sie auf Melanie angewiesen, ließ sich an manchen Tagen von ihr betreuen wie ein Kind. Franziska wusste das, und es tat ihr weh, dass sie, wenn auch ohne Absicht, die beiden gegeneinander aufgebracht hatte. Sie 68 wäre von selbst fort gegangen. Der Platz vor dem Erzbischofspalast wurde inzwischen wieder wie eh und je von Vagabunden, Bettlern und Dirnen bevölkert. Die Graukittel hatten sich seit Wochen nicht mehr sehen lassen. Ramira jedoch wollte das nicht. "Du brauchst nicht betteln zu gehen", beharrte sie starrsinnig. Franziska indes ließ sich nicht täuschen. "Ramira, du weiß so gut wie ich, dass es auf Dauer wie bisher nicht weitergehen kann", sagte sie eines Tages eindringlich. "Wenn du meinen Vorschlag nicht magst und dir ein besserer einfällt, dann soll er mir recht sein. Doch ganz sicher werde ich nicht länger hier tatenlos herumsitze." Ramira dachte so angestrengt nach, dass sie schlechte Träume davon bekam. Dennoch fand sie keine Lösung, mit der sie zufrieden war - bis ein Zufall ihr zu Hilfe kam. Wenn sie von der Südostecke des Forums, wo die Wagen standen, auf direktem Weg zum Rhein hinunter stieg, gelangte sie zu einem großen Lagerplatz für Baumaterial, vor allem für Dachschiefer. Die noch unbearbeiteten, unterschiedlich großen Platten lagen mehr oder minder geordnet auf großen Haufen. Dazwischen verliefen Gänge, die gerade breit genug für die als Transportmittel verwendeten Karren waren. Am Ufer gab es drei Anlegestellen für die schweren Schiffe, die den Schiefer von den Steinbrüchen am Mittelrhein heranschafften. Vor den Stegen standen Bretterbuden. Es gab auf diesem Gelände keine Stelle, von der aus es zu überblicken war. Bei Tageslicht, wenn die Arbeiter die Schiffe entluden und die großen zweiachsigen Wagen in die Stadt rumpelten, konnte man glauben, auf einem gewöhnlichen Bauplatz zu sein. Sobald sich aber die Dämmerung herabsenkte, wurde es hier unheimlich. Dann eroberten Katzen und Ratten den Platz. Dem Reden der Leute nach trieben sogar Geister ihr Unwesen. Die Kräne am Ufer hoben sich schwarz gegen den dunkelblauen Himmel ab und glichen Ungeheuern mit riesigen Armen. Nach dem Dachschiefer, den man auch Leyen nannte, hieß das Gelände Leystapel. Ramira gehörte zu den wenigen Menschen, die den Ort auch noch liebten, wenn die Arbeiter nach Hause gegangen waren. Sie zog sich dorthin zurück, wenn sie um jeden Preis allein sein wollte. Inzwischen hatte sie sogar schon einen Lieblingsplatz - unmittelbar am Ufer in der Nische zwischen einer Bretterbude und einer Trennmauer. Dort konnte sie auf den Fluss blicken und war zugleich nach allen anderen Seiten hin geschützt. Zumeist nahm sie ihre Leier mit. Sie spielte darauf ganz ausgezeichnet, obwohl sie für diese Kunst von ihrem Vater fast nichts gelernt hatte. Vielleicht liebte sie das Instrument gerade deshalb so sehr. Es war ihr fast heilig, so heilig, dass sie von den Liedern, die sie sich ausdachte, die schönsten niemals öffentlich sang. Allein der Rhein hörte sie, und der bewahrt jedes Geheimnis. Dass sie sich weniger fürchtete, lag keineswegs daran, dass sie nicht abergläubisch war. Ohne es recht begründen zu können, hatte sie einfach das Gefühl, dass die Geister, die hier umgehen mochten, ihr nichts zuleide tun würden. Eine Grunderkenntnis ihrer noch jungen Lebenserfahrung besagte, dass etwas, das für andere galt, für sie (und ihre Gauklergefährten) noch lange nicht gelten musste, im Guten wie im Bösen. An jenem Tage war sie (wie fast immer, wenn sie geborgen in ihrer Nische saß) tief in ihr Spiel versunken und unempfänglich für andere Eindrücke. So merkte sie zunächst nicht, dass sie diesmal einen Zuhörer hatte, einen un- 69 freiwilligen allerdings. Es war ein Mann von außergewöhnlicher Statur und Größe, ein Riese mit welligen Haaren, die in ihrer Üppigkeit an eine Mähne erinnerten, und einem nicht minder dichten Bart. Die stürmische Zeit seines Lebens hatte er wohl hinter sich. Von seinem sonnengegerbten Gesicht war abzulesen, dass er kaum jünger als fünfzig sein konnte. Seine Bewegungen aber hatte er sich geschmeidig gehalten und seine Muskeln strotzten von urwüchsiger Kraft. Ramira störte ihn. Sie versperrte ihm den Weg zu einem geheimen Ort. Verärgert darüber, legte er das Bündel, das er auf der Schulter trug, auf einem Schieferstapel ab und warf Steine in Richtung Fluss. "Bist du taub, du dumme Gans?!" fluchte er dabei vor sich hin. "Die Geister murmeln mit Totenköpfen! Na los! Hab Angst und verschwinde endlich!" Da sie mit keiner Bewegung reagierte, gab er schließlich auf, setzte sich auf einen Balken und wartete. Unterdessen musste er zuhören. Zuerst tat er es unwillig und fand wenig Anziehendes an dem Gesang. Die Stimme erschien ihm rau und unmelodisch wie das Krächzen einer Krähe, der Anschlag der Saiten zu hart. Allmählich aber gewöhnte er sich daran und begriff plötzlich, dass er diese Lieder gerade wegen der eigenartigen Stimme und der sonderbar groben Art, mit der Leier umzugehen, so schnell nicht würde vergessen können. Jetzt hörte er (ohne sich dessen bewusst zu sein) andächtig zu. Nach einiger Zeit hielt Ramira inne. Als ihre Aufmerksamkeit nicht mehr gänzlich auf ihrem Spiel ruhte, fühlte sie den Fremden in ihrer Nähe. Beunruhigt sprang sie auf, und ehe der Mann sich verbergen konnte, hatte sie ihn entdeckt. Es war noch nicht völlig dunkel, so dass sie sogar sein Gesicht wahrnahm. Für Sekunden spiegelte sich da- rin noch der Eindruck des Gesangs wider - bis der Fremde sich gefasst hatte und eine Drohgebärde annahm. "Was willst du hier?" fragte er grob. "Ich habe dasselbe Recht hier zu sein wie Ihr", antwortete sie ruhig. Trotz seiner Größe fürchtete sie sich auch vor ihm nicht. Vor jemandem, dem ihre Lieder gefielen, fürchtete sie sich nie, wie immer er sich benahm. "Zwei Menschen, die sich um diese Zeit an einem solchen Ort treffen, sind miteinander in irgendeiner Weise verwandt. Wir sollten uns nicht streiten. Es ist Platz hier für uns beide." Der Mann setzte zu einer groben Erwiderung an, überlegte es sich dann aber kurz entschlossen anders. Er baute sich mitten auf dem Weg auf und sagte mit leutseligem Unterton: "Ich bin ein Kölner Bürger und wohne ganz hier in der Nähe. Vielleicht hast du mich schon einmal auf dem Forum gesehen. Du lebst doch dort mit deinen Leuten?" "Ja, so ist es." "Weil du fremd hier bist, weißt du wahrscheinlich nicht, dass sich hier auf dem Leystapel des Nachts übles Gesindel herumtreibt. Diese Gesellen brechen in unsere Häuser ein. Heute nun habe ich mich auf die Lauer gelegt, um wenigstens einen von ihnen zu fangen. Vielleicht schreckt es die anderen ab, wenn die ersten am Galgen baumeln." "Ich bin eine Gauklerin und keine ..." "Ich weiß, ich weiß! Trotzdem kannst du hier nicht bleiben. Der Leystapel ist um diese Zeit kein rechter Ort für ein junges Mädchen." Ramira musste sich fügen und stand auf. In eben diesem Moment kam ihr jener Einfall für Franziska. Ohne lange zu überlegen und ohne Übergang, begann sie, ihren spontanen Plan zu verwirklichen: "Ich glaube, ich kenne Euch. Ihr seid doch jener vornehme Herr, der ganz 70 allein in dem alten Patrizierhaus am Anfang der Rheingasse wohnt?" "Warum fragst du das?" "Nun, ich denke, dass Ihr, da Ihr auf Euch allein gestellt seid, vielleicht eine Gehilfin gut gebrauchen könntet." Der Mann wurde ungeduldig und fiel unvermittelt in seinen groben Tonfall zurück. "Hör mal, du Gänslein - es geht dich wenig an, ob ich auf mich allein gestellt bin" "Meine Freundin, ein gesundes und ehrliches Mädchen mit guten Manieren, könnte Euch die Hausarbeit besorgen", fuhr sie unbeirrt fort. "Sie ist erst drei- zehn aber schon ziemlich stark und zäh." Die Antwort war schallendes Gelächter. "Ich lasse niemanden in mein Haus. Hat sich das bis zu dir noch nicht herumgesprochen? Gewiss nehme ich kein Gauklerbalg bei mir auf. Verschwinde endlich!" "Ich weiß, dass Ihr ein gutes Herz habt." Während sie davonging, hörte sie ihn noch rufen: "Ich habe kein gutes Herz! Merk dir das und wage dich nie wieder hierher!" IV R amira war ihrem Gefühl gefolgt, und solange das Gefühl sie beherrschte, hegte sie auch keinen Zweifel an ihrem Plan. Erst als sich plötzlich ihr Verstand meldete, überfielen sie die Bedenken. Hatte er wirklich ein gutes Herz? Ihr fiel etwas ein, das sie aus eigener, schmerzhafter Erfahrung kannte - Einsamkeit erzeugt Ungeheuer. Ein Mann braucht nicht unbedingt eine Frau und eigene Kinder, aber er darf kein einsamer Wolf werden, kein Wesen, das nur noch für sich selbst lebt. Ihr Vater, der Graukopf, wäre sicherlich ein anderer Mensch gewesen wäre, hätte Gott ihm nicht die Frau genommen. Oder war es nicht Gottes Wille gewesen sondern ihre Schuld? Jahrelang hatte sie aus Schuldgefühl schlimmste Misshandlungen stumm erduldet. War sie nun gewillt, abermals Sünde auf sich zu laden, indem sie Franziska, ihre Freundin, ebenso ins Unglück stieß, sie einem durch Einsamkeit zum Ungeheuer gewordenen Mann auslieferte? Sie beschloss, den Einfall für sich zu behalten - rechnete dabei aber nicht mit Fran- ziskas Beobachtungsgabe. Die Freundin sprach sie geradezu darauf an und ließ nicht eher locker, bis sie alles wusste. Im ersten Moment war Franziska begeistert von dem Vorschlag, glaubte sie doch, darin einen Fingerzeig Gottes zu erkennen. Dieser vornehme Kölner Bürger war (wie Ramira ihn beschrieb) sicherlich ein zuverlässiger Beschützer. Dann aber fielen ihr Geschichten ein, die man ihr in Wardenburg erzählt hatte. In großen Städten wurden fremde, leichtgläubige Mädchen oft an Dirnenhäuser verkauft. Von dort gab es für sie dann kaum noch ein Entrinnen, denn der Bordellbesitzer und seine Knechte bewachten sie wie Gefangene, sogar beim Kirchgang. Lange wusste Franziska nicht, was sie tun sollte. Am Ende aber vertraute sie auf Gottes Schutz und Ramiras Erfahrung mit Kupplern und Mädchenhändlern. Sorgen bereitete ihr nur die Frage, was aus Pentia werden sollte. Zwei Tage lang zögerte sie, ihrer Schwester überhaupt von dem Plan zu erzählen lange genug, dass diese davon schließlich auf anderem Wege erfuhr. Wieder 71 einmal saßen die Gaukler abends am Feuer beieinander, und wieder einmal begann Melanie mit ihrem Lieblingsthema. "Sie würde doch bestimmt irgendwo in der Stadt eine Anstellung finden ..." Da verlor Ramira die Beherrschung. Obwohl sie Franziska Stillschweigen versprochen hatte, rief sie aus: "Du weißt, dass nur Bürgerstöchter eingestellt werden dürfen, brauchst dich aber trotzdem nicht länger aufzuregen, denn sie wird bald ..." Sie brach ab, als sie Pentia jäh aufblicken sah. Aber es war zu spät, etwas zurückzunehmen. Sie musste nun alles erzählen und dabei auch auf Franziskas kleine Schwester zu reden kommen. "Warum geht sie nicht einfach dorthin mit?" bemerkte Melanie ohne Mitgefühl. "Sie geht nicht dorthin, weil sie bei uns bleibt." Alle drehten sich verwundert um. Der alte Alexander hatte gesprochen. Endlich! Freilich beließ er es bei dem einen Satz und erzeugte ein peinliches Schweigen, das anhielt, bis sich Mario zu sagen aufraffte: "Sie ist jung, kann noch manches Kunststück lernen und wird ihren Platz bei uns finden." Diesmal widersprach Melanie ihm nicht. Alexanders Wort war nun einmal das Gesetz in der Sippe. Dass sie sich auch innerlich mit dem neuen Mitglied der Truppe abzufinden vermochte, hieß das freilich noch längst nicht. Am nächsten Morgen verabschiedete sich Franziska von ihrer Schwester. Etwas, das sich nicht vermeiden ließ, wollte sie nicht unnötig aufschieben. Ein wenig beklommen war beiden zumute - Franziska, weil sie nicht wusste, was sie erwarten würde, und Pentia, weil sie es wusste. "Melanie wird sich irgendwann beruhigen. Bis dahin hast du Ramira und vielleicht auch Alexander als Beschützer. Na ja, und ich besuche dich natürlich, so oft ich kann. Ich wohne ja ganz in eurer Nähe." Die kleine Schwester nickte stumm. Um das Unglück nicht zu beschreien, sprach sie nicht aus, was sie dachte. Überhaupt tat sie alles, um ihren wahren Kummer nicht zu zeigen. Sie begriff, dass ihre Schwester das schwerere Los gezogen hatte, und dass sie es ihr allein durch ihre Tapferkeit erleichtern konnte. "Ich bin gut versorgt. Du musst jetzt an dich denken." Dann umarmten sich beide, und Franziska lief mit einem kleinen Bündel unterm Arm zu dem von Ramira beschriebenen Haus an der Rheingasse. 72 8.Kapitel I F ranziska hatte wenig Mühe, das alte Patrizierhaus zu finden, denn es fiel auf - erstens, weil es frei stand (durch je einen schmalen Weg links und rechts von den Nachbarhäusern getrennt); zweitens, weil im Erdgeschoss trotz des längst angebrochenen Tages die Fensterläden verschlossen waren (seit längerem, den verrosteten Schlössern nach zu urteilen); drittens, weil der Hof (soweit er sich von der Straße einsehen ließ) ungenutzt und verwildert wirkte. Das Mädchen fragte sich, wovon dieser sonderbare Mann lebte. Jetzt noch umzukehren, verbot ihr allerdings der Stolz. Die Vorstellung von Melanies Schmähreden bei ihrer Rückkehr trieben sie an, beherzt an die Tür heranzutreten und mit der Faust gegen die dicken Eichenbretter zu klopfen - erst zaghaft, dann (weil sich drinnen nichts regte) mehrmals sehr kräftig. "Bei dem wirst du kein Glück haben, Mädchen! In seinem Haus handelt der mit niemandem." Franziska drehte sich um und blickte in das freundliche Gesicht einer Frau, einer Dienstmagd der Kleidung nach. "Ich will ihm nichts verkaufen. Ich will bei ihm arbeiten." "Wie kommst du darauf, dass er jemanden braucht?" "Nun, so wie das Haus aussieht ..." Die Frau lächelte nachsichtig, setzte eine geheimnisvolle Miene auf und zog sie am Arm ein paar Meter beiseite. "Du bist nicht von hier. Darum weißt du noch nichts von dem Herrn Stefanus. Mit dem hat es nämlich eine besondere Bewandtnis." Sie begann zu flüstern, obwohl weit und breit kein Lauscher zu sehen war. "Er ist ein mächtiger Graf und besitzt in Bayern riesige Güter. Niemand aber kennt seinen wahren Namen. Hier in Köln hält er sich seit fast genau vier Jahren im Auftrage des Kaisers auf." Franziska hörte ehrfurchtsvoll zu und fragte sich, ob ein so bedeutender Mann sie für würdig befinden könnte, ihm dienen zu dürfen. Zaghaft fragte sie: "Und er braucht wirklich niemanden, der ..." Die Frau zuckte mit den Schultern. "Versuche dein Glück! Meine guten Wünsche hast du. Ich weiß aber von niemandem, der je sein Haus betreten durfte." Wieder allein, klopfte das Mädchen noch einmal gegen die Tür. "Hallo, Herr Stefanus! Ich will nicht betteln und auch nichts zum Kauf anbieten." Es hatte wohl keinen Zweck. Sie blieb unschlüssig stehen und überlegte. Sollte sie zurück zum Forum gehen? Nein, das auf keinen Fall! Auch die Bettelei war keine wirklich gute Aussicht. Mit dem Mut der Verzweiflung rüttelte sie an der Tür. Und siehe da, diese gab nach. Vor ihr lag ein dunkler Flur. Sie trat einen Schritt hinein, dann einen zweiten und dritten. Plötzlich wurde sie von einer Urgewalt zu Boden geschleudert. Die Tür fiel ins Schloss, und ehe sie wieder klar denken konnte, saß sie mit auf den Rücken gefesselten Armen auf einer Bank in einem der (durch die geschlossenen Fensterläden) nahezu dunklen Erdgeschossräumen. Vor Schreck wie gelähmt, fragte sie in die Finsternis hinein: "Was wollt Ihr von mir?" Aus dem schwarzen Nichts antwortete ihr ein tiefes, dröhnendes, wirklich unheimliches Lachen. "Ich gebe dir gleich zwei Antworten. Zum einen: Nur ich habe ein Recht, diese Frage zu stellen, denn du bist bei mir eingedrungen. Zum anderen: Was wird ein Mann schon wollen von einem Mädchen, das so dumm ist, sich ihm auszuliefern?" Wenigstens hatte das unsichtbare Wesen eine Stimme, eine dunkle, kräftige, menschliche Stimme. "Ihr beobachtet mich schon einige Zeit?" "Allerdings." "Und warum habt Ihr mir nicht geantwortet?" "Ich weiß, was du willst - und ich brauche dich nicht." "Meine Freundin hat ..." "Das Gänslein hat dir von meinem guten Herzen erzählt? Ein vortrefflicher Scherz! Hat sie mich gar als Lehrmeister empfohlen? Du wirst dich wundern, was es bei mir zu lernen gibt." Wieder lachte er in der ihm eigenen dröhnenden Art und Franziska hielt plötzlich die Hohnreden Melanies und das Bettlerleben gleichermaßen für verlockender als dieses unheimliche Haus mit seinem unheimlichen Bewohner. "Da Ihr keine Magd braucht, werde ich mich woanders umsehen. Verzeiht mir, dass ich ..." "Leider kann ich dich jetzt nicht mehr gehen lassen." "Warum nicht?" "Weil ich nicht weiß, was du gesehen hast. Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten - entweder ich bringe dich um oder ich nehme dich tatsächlich in meine Dienste - wie du das nennst." Franziska war sich keineswegs sicher, welcher der Möglichkeiten er mehr zuneigte und beruhigte sich erst wieder, als er nach persönlichen Dingen zu fragen begann. "Du bist keine Gauklerin. Du stammst aus besserer Familie." Das klang mehr wie eine Feststellung als wie eine Frage. Zudem war unklar, ob es bei diesem Menschen Vorteile brachte, Tochter eines Lehnsritters zu sein. Ramiras Eindruck, die Behauptungen der Magd und ihre eigenen Empfindungen, das alles passte nicht zusammen. Nachdem Stefanus eine Öllampe geholt hatte, konnte sie ihn wenigstens sehen. "Folge mir!" befahl er. "Wohin?" "Das wirst du gleich sehen." Mit der Lampe in der Hand ging er voran. In einem winzigen Zimmer auf der Hofseite schlug er einen abgewetzten Teppich zurück und öffnete eine Klappe im Fußboden. Eine Stiege führte hinab zu einem Kellerraum, der wohl zum Lagern verderblicher Vorräte gedacht war, jedoch leer stand. Lediglich ein altes Regal gab es darin. Damit allerdings hatte es eine besondere Bewandtnis. Es ließ sich vermittels eines Scharniers bewegen und verdeckte eine Tür, hinter der ein abschüssiger Gang begann. "Wohin gehen wir?" wiederholte Franziska ihre Frage. Diesmal bekam sie gar keine Antwort. Nach etwa zwanzig Schritten mündete der enge Gang in einen größeren. "Wir sind am Ziel." "Wie meint Ihr das?" "Wie ich es sage. Das hier ist mein Königreich." Das Mädchen blickte sich um. Der Gang war sorgfältig mit Ziegeln ausgemauert, mit einem Tonnengewölbe abgedeckt und erlaubte sogar sehr großen Menschen, aufrecht darin zu laufen. Eine Funktion indes besaß er offenbar nicht. "Ein vergessener Abwasserkanal der Römer", erklärte Stefanus, der ihre Gedanken erriet. "Vor ein paar hundert 74 Jahren wären wir hier buchstäblich im Dreck gewatet." "Ihr seid König über einen Abwasserkanal?" Einen Augenblick fürchtete sie, er würde ihr die vorlaute Frage verübeln, doch er lachte nur. "Mein Reich besteht nicht nur aus diesem Kanal. Es ist in Wahrheit so groß, dass du es nie wirst ganz kennen lernen." Bei diesen Worten öffnete er mit einem langen Schlüssel eine eiserne Tür. Nun nahm für Franziska das Staunen kein Ende mehr. Dieser geheimnisvolle Mensch besaß unter der Erde ein ganzes Labyrinth aus verschieden großen Räume und Gänge. Drei der unterirdischen Kammern hatte er sogar mit Möbeln, Teppichen und allerlei Schmuckstücken ausgestattet. Wie war ihm gelungen, die großen Stücken über die Stiege und durch den engen Gang hierher zu bringen? Wahrscheinlich besaß das Labyrinth noch andere Ausgänge. Fraglich war auch, weshalb Stefanus überhaupt all diese Kostbarkeiten gesammelt hatte, denn die Möbeln ließ er verstauben, die Teppiche von Motten zerfressen und die Intarsien eines Schrankes durch herabtropfendes Wachs verderben. Es sah so als, als legte er es direkt darauf an, die sonst nur Patriziern und Adligen zustehenden Gegenstände in einer völlig unpassenden Umgebung so lächerlich wie möglich erscheinen zu lassen, sie gewissermaßen stellvertretend für die Mächtigen der Stadt zu demütigen. "Nun, wie gefällt es dir hier?" Während das Mädchen noch nach einer ungefährlichen Erwiderung suchte, setzte er hinzu: "Du wirst dich schon dran gewöhnen. Ich muss dich für zwei Tage hier unten einsperren." "In dieser Gruft?!" Er zuckte mit den Schultern. "Nur so kann ich verhindern, dass du mir davonläufst, wenn ich nicht im Haus bin. Übrigens hast du genügend Essen und Trinken hier unten. Auch das Öl für die Lampe müsste reichen, wenn du sparsam damit umgehst." Jede weitere Unterredung lehnte er ab. Er ging einfach und schloss die Tür hinter sich ab. II F ranziska begriff, dass sie eine Gefangene war, und argwöhnte, dass dieser undurchschaubare Einzelgänger von Raub, Diebstahl oder Wilderei lebte. An die Geschichte von seiner geheimen Mission im Auftrage des Kaisers glaubte sie jedenfalls nicht mehr. Obwohl sie eigentlich kein Hasenfuß war, schlug ihr das Herz bis zum Halse. Sie lauschte auf jedes Geräusch, das sie sich nicht erklären konnte, und davon gab es genug in dieser Behausung. Ihrer Freundin Ramira grollte sie trotzdem nicht. Sie hätte sich auf ihren Vorschlag ja nicht einzulassen brauchen. Nach mehreren Stunden lähmender Angst wurde sie wieder etwas ruhiger. Unmittelbar drohte ihr wohl keine Gefahr. Also nahm sie die Öllampe und begann, das unterirdische Reich zu erkunden. Im hintersten der drei eingerichteten Räume fand sie in der Decke einen Riss, der das Tageslicht hereinließ. Das steigerte ihre Zuversicht, auch wenn sie durch den engen Spalt nicht nach draußen gelangen konnte. Im Übrigen tröstete sie sich mit ein wenig Selbstbetrug. Hieß es nicht, dass oft gerade die unfreundlichen Menschen ein weiches Herz besitzen? In Wildeshausen hatte sie oft den Schmieden, 75 Maurern und Zimmerleuten zugesehen. Schon immer waren ihr die Heuchler unangenehmer gewesen als die Grobiane. Als Stefanus zurückkehrte, brachte er sie (nach einer Begrüßung die eher ein Brummen war als ein verständlicher Satz) wieder nach oben in sein Haus, genauer: in einen auf der Hofseite gelegenen, verhältnismäßig großen Raum, der als Küche und Wohnzimmer gleichermaßen diente. Dort packte er (ohne sie anzublicken, ganz so, als wäre er allein) bedächtig einen Sack aus. Vor allem Lebensmittel holte er daraus hervor - einen Laib Brot, ein halbes Dutzend Käseecken, ein stattliches Stück Schinken, Butter, Gemüse, anderes mehr. Das meiste davon verstaute er in einem Loch unter dem Fußboden, um es kühl zu halten. Gegen Ungeziefer schützte eine Steinplatte als Abdeckung. Franziska, deren Augen sich noch nicht umgewöhnt hatten, empfand den Raum als hell. In Wahrheit schien die Sonne nur frühmorgens hinein und selbst das lediglich im Sommer. Immerhin aber waren tagsüber die Fensterläden geöffnet, da Stefanus auf dieser Seite des Hauses nicht mit neugierigen Blicken zu rechnen brauchte. Das Mädchen nahm die vermeintliche Helligkeit und den Duft der frischen Lebensmittel als Bestätigung ihrer Zuversicht und versuchte, ein Gespräch zu beginnen. "Wart Ihr weit fort?" "Das geht dich nichts an!" Immerhin wies er ihr mit einer kurzen Handbewegung einen Platz am Tisch zu und schob ihr ein rundes Holzbrett hinüber. Dann schnitt er eine dicke Scheibe Brot ab, bestrich sie reichlich mit Butter und nahm sich mit der Spitze eines langen Dolches aus einer Schüssel ein mächtiges Stück kalten Braten. Franziska, die kein Messer bei sich trug, bediente sich mit den Händen. Der ersten Scheibe folgten eine zweite und dritte. Das Mädchen musste lange zurückdenken, um sich an eine ähnlich reichhaltige Mahlzeit zu erinnern. Am Essen mangelte es bei Stefanus auch in der Folgezeit nie - neben dem Schutz vor Kälte und Wind, Regen und Schnee ein großer Vorzug. Ansonsten jedoch gab es für Franziska wenig Ursache zum Wohlfühlen. Vor allem litt sie darunter, dass sie tatsächlich nicht gebraucht wurde. Der Sonderling erledigte all jene Arbeiten, die gewöhnlich zu den Aufgaben der Frauen gehörten, mit dem verblüffenden Geschick des Einzelgängers selbst. Und was er für überflüssig hielt, sollte auch kein anderer für ihn tun. Beim Zubereiten der warmen Mahlzeiten bediente er sich eines verschwenderisch großen Herdfeuers. Fleisch briet er nach Art der Ritter im Feld an einem Spieß, alles andere kochte er in einem eisernen Kessel. Allerdings legte er fast nur auf die Menge wert. Mit Gewürzen konnte er nicht umgehen, Rezepte kannte er nur wenige. So schmeckten seine Gerichte ziemlich eintönig, obwohl die Zutaten gut genug für die Tafel eines Adligen gewesen wären. Franziska langweilte sich derart, dass sie eines Tages aufbegehrte, so sehr sie sich auch vor ihm fürchtete. "Warum lasst Ihr mich nicht wenigstens kochen?" Er musterte sie lange, dann fragte er zurück: "Kannst du denn kochen?" Sie wurde verlegen, und er begann, ohne eine Antwort abzuwarten, höhnisch zu lachen. "Du kannst es nicht. Du bist eine Tochter aus besserem Hause. Man hat dir Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Sicherlich sprichst du ein wenig Lateinisch und Französisch. Du weißt auch, wie man sich in Gegenwart eines Kirchenfürsten benimmt. Aber du 76 würdest ohne Mägde und Knechte auf Dauer nicht überleben." Sie wollte ihm entgegenhalten, dass sie ein paar Monate sehr wohl auf sich allein gestellt überlebt hatte. Doch sie ließ es bleiben, weil sie begriff, dass er sie einfach nicht mochte, weder als Mädchen noch als Gefährtin. Dass er ihr so unverhüllt zu verstehen gab, wie lästig sie ihm war, kränkte sie sehr und sie schwor sich, bei der nächsten Gelegenheit zu fliehen, um sich woanders nach einer Bleibe umzusehen. Allerdings erwies sich Stefanus als ungewöhnlich aufmerksam. Selbst wenn er allem Anschein nach fest schlief, merkte er sofort, wenn sie aufstand und sich anzog. Folglich blieben ihr nur jene Stunden, in denen sie in seinem unterirdischen Reich allein war. Im festen Glauben an einen zweiten Zugang, begann sie (seiner Verbote zum Trotz), den vom hintersten Raum abgehenden Gang zu erkunden. Mit der Öllampe in der Hand (und mit weichen Knien) drang sie in die Finsternis vor. Von den Wänden lief in dünnen Rinnsalen Wasser herab. Mäuse huschten an ihren Füßen vorüber. Spinnweben streiften ihr Gesicht. Die Schauergeschichten, die Stefanus ihr erzählt hatte, um sie von den Gängen fernzuhalten, taten ein Übriges. Dreimal kehrte sie, von ein paar Tropfen oder ihrem eigenen Schatten genarrt, in heller Panik um. Der tonnegewölbte Gang, dem sie anfangs folgte, begann sich nach etwa hundert Schritten zu verästeln. Manche Wege verloren sich im Grundwasser, andere waren eingestürzt. Immer wieder aber blieb wenigstens einer, der in neue Teile des unterirdischen Reiches führte. Franziska fand Räume, deren Decke fremdartig verzierte Säulen stützten, und solche, in denen heidnische Figuren aus bleichem Gestein standen. Das alles mutete an wie eine versunkene Stadt. Was hatten die Bewohner dieser Stadt verbrochen, dass ihre Häuser nun unter der Erde standen? Hatte womöglich der Teufel sie mit all ihrer Habe in die Tiefe gezogen? Aus Furcht, sich zu verlaufen und auch, weil es ihr des Grauens genug war, brach sie die Erkundung schließlich ab - ohne einen Ausgang gefunden zu haben (und argwöhnend, ein bedeutsames, womöglich furchtbares Geheimnis noch nicht zu kennen). III Z wei Wochen vergingen, ohne dass etwas Besonderes geschah, dann aber erlebte Franziska eine Überraschung. "Weißt du eigentlich, wovon ich lebe?" fragte Stefanus unvermittelt beim Frühstück. "Es heißt, Ihr wäret ein Graf aus Bayern." "Glaubst du das?" "Nein." "Es stimmt auch nicht. Allerdings habe ich etwas gemeinsam mit den Adligen. Ich lebe von dem, was andere Leu- te sich erarbeitet haben. Unterschiedlich ist allein, dass jene mit Billigung der Kirche und des Kaisers rauben, ich hingegen ohne einen solchen Freibrief. Wenn du willst, kannst du mich auf meinem nächsten Beutezug begleiten." Franziska war so verblüfft über diese Wendung, dass sie zunächst nicht wusste, was sie davon halten sollte. Wieso schenkte er ihr plötzlich so viel Vertrauen? Wollte er sie an einen einsamen Ort führen und dort ermorden? Und was erwartete er von ihr, falls sein Angebot aufrichtig war? Letztlich aber fühlte sie 77 sich auch geehrt. Sie wurde sich bewusst, dass sie ihn nicht nur fürchtete, sondern in gewisser Weise auch bewunderte. Mitten in der Nacht holte er sie aus dem Bett und kletterte mit ihr zum Abwasserkanal der Römer hinab. Dort verband er ihr die Augen, damit sie das Labyrinth nicht gar zu gut kennen lernte. Erst als er mit ihr nach einem langen, verwirrenden Weg nahe dem Rhein aus der Tiefe hinaufgestiegen war, nahm er ihr die Binde wieder ab. Nun schlichen sie am Ufer entlang bis zu einem verborgen bereitliegenden Floß. Stefanus sprach kein Wort und erwartete, dass Franziska von selbst das Richtige tat. Erriet sie etwas nicht sofort, lenkte er sie mit schmerzhaften Rippenstößen. Die Strömung trug sie zwischen der Stadt auf der linken Seite und den dicken Türmen der römischen Festung Deutz auf der rechten dahin. Durch leichte Steuerbewegungen mit einer Planke erreichten sie ein gutes Stück hinter der Kunibertstorburg (dem nördlichsten Turm der Mauer) das andere Ufer. Dort verwarnte Stefanus das Mädchen: "Verhalte dich lautlos wie eine Katze! Ich erwürge dich, wenn du mich durch deine Tollpatschigkeit verrätst." Da sie fürchtete, dass er seine Drohung wörtlich meinte, war sie von nun an aufmerksam wie ein Luchs. Vor ihnen hoben sich schwach die Umrisse einer Siedlung vom Nachthimmel ab. Zuerst schlichen sie sich gebückt an, dann, als die ersten Hunde anschlugen, warfen sie sich auf den vom Schneeregen durchnässten, eisig kalten Erdboden und krochen wie Eidechsen bis zu einer mannshohen Hecke, die das gesamte Dorf einfriedete. Stefanus entdeckte mit geübtem Blick trotz der Finsternis einen Durchschlupf im dichten Gezweig. Freilich war das Loch so eng, dass die Dornen ihnen die Haut zerrissen, als sie sich hindurchzwängten. Im ersten Gehöft gab es offenbar wenig zu holen. "Hinter dem Strauch entlang! Dann nach rechts!" raunte der Räuber. Franziska glitt gehorsam in die befohlene Richtung. Als sie sich dabei an einer spitzen Luftwurzel eine tiefe, blutende Wunde in den Arm schnitt, biss sie sich in den Daumen, um einen Schmerzenslaut zu unterdrücken. Am Anger stand das Haus des Schultheißen, ein großes Haus mit einem ausgedehnten, durch eine eigene Hecke vom übrigen Dorf abgegrenzten Garten. Stefanus kletterte über das Tor, Franziska folgte ihm. Plötzlich hörten sie ein Knurren, und mit gefletschten Zähnen sprang ihnen ein Wachhund von der Größe eines Kalbs entgegen. Der Räuber hatte damit wohl gerechnet, riss blitzschnell ein Schwert heraus und schnitt ihm die Kehle durch. Im nächsten Moment brach der Hund zusammen, ohne noch einmal bellen zu können. Franziska stand daneben, sah wie das Blut hervorspritzte und glaubte in seinen Augen die Frage zu lesen, warum dieser fremde Mensch ihn für seine Treue umbrachte. Zitternd vor Schreck und Grauen, musste sie sich abwenden. "Was stehst du herum?" fauchte Stefanus und stieß sie hinter einen Holzstapel. "Oh! Die Prinzessin ist zart besaitet und würde sich lieber von so einer Bestie zerreißen lassen, als sie zu töten!" Aus der Deckung beobachteten beide das Haus. Nichts rührte sich. Nun begann der Räuber, wahllos Hühnern und Gänsen den Kopf abzuschlagen, während Franziska die toten Tiere einsammeln musste. Viel Zeit blieb ihnen dafür nicht, denn das wilde Schnattern weckte den Schultheiß und seine Knechte. Bald waren Männerstimmen zu hören. Fackeln erleuchteten den Garten. Stefanus und Franziska jedoch krochen bereits 78 wieder dem Schlupfloch entgegen. Und dann rannten sie auch schon, so schnell ihre Füße sie trugen, den Uferhang hinab zu ihrem Floß. Während sie stromaufwärts zurück in die Stadt ruderten, fielen Franziska ihre Fluchtpläne wieder ein. Sie fühlte, dass sie (wenn überhaupt) nur während eines Raubzuges Gelegenheiten zum Entkommen haben würde. Als sie sich dem Ufer näherten, war sie fest entschlossen. Kurz nach dem Anlegen kam tatsächlich die erhoffte Situation. Stefanus hantierte am Floß, ohne auf sie zu achten. Sie hätte nur davonzulaufen brauchen, doch - sie tat es nicht, wartete stattdessen auf ihn und ließ sich dann ohne Zwang wieder die Augen verbinden. Obgleich er es nicht aussprach, war Stefanus beim ersten gemeinsamen Streifzug offenbar mit Franziska zufrieden gewesen. Er gab ihr Ratschläge, erklärte ihr seine nächsten Pläne, nahm sie immer häufiger bei seinen Unternehmungen mit - kurz: er nahm sie ernst. Ihr wiederum begann dieses Leben zu gefallen. Abends auf ihrem Lager besann sie sich manchmal mit Erschrecken darauf, dass sie mindestens einmal in der Woche nichts Geringeres als den Galgen riskierte. Doch ihr fielen jedes Mal Ausreden ein. Stefanus war für sie so etwas wie ein Vormund und sie musste ihm gehorchen. Zudem beraubten sie (allein schon der zu erwartenden Beute wegen) ausschließlich die Reichen, die ihr Geld und Gut meistens auch nicht auf gottgefällige Weise zusammengerafft hatten. Wenn Stefanus einen Beutezug plante, bereitete er sich sorgfältig vor. Hatte er beispielsweise das Haus eines reichen Bürgers im Auge, beobachtete er es tagelang und prägte sich jede Kleinig- keit ein. Niemals ließ er sich auf ein unsicheres Unternehmen ein. Seit er durch eine Unvorsichtigkeit von der Gauklerin Ramira an einem verdächtigen Ort in Verlegenheit gebracht worden war, hüllte er sich beim Rauben in einen weiten Kapuzenmantel. Wenn Franziska ihn begleitete, musste sie sich in ähnlicher Weise verkleiden. Die Beutestücke verkaufte er auf geheimnisvolle Weise an einen geheimnisvollen Hehler, den das Mädchen niemals zu sehen bekam. Dabei spielten verschiedene Verstecke eine Rolle. Eines davon befand sich mitten im Gewirr des Leystapels, ganz in der Nähe jener Stelle, wo Ramira ihn gesehen hatte. Mit dem Geld, das er dabei einnahm, ging er auf den Markt und besorgte sich wie ein ehrbarer Bürger, was ihm beliebte. Ein wenig wunderte sich Franziska, dass Stefanus nicht mit ihr anzubändeln versuchte. Er behandelte sie wie einen Kumpan und schien gar nicht zu bemerken, dass sie ein Mädchen war. Sie gewöhnte sich deshalb an, in ihm eine Art Vater zu sehen. Nur wegen zwei Dingen grämte sie sich - dass sie nicht in die Kirche gehen und nicht ihre Schwester sehen durfte. Als sie den Räuber deshalb ansprach, begann er zu fluchen: "Was liegt dir an den Pfaffen? Willst du Absolution von ihnen? Glaubst du, dass diese Hurenböcke dich mit dem lieben Gott aussöhnen können? Vielleicht beten sie für dich, während sie einer Dirne zwischen den fetten Schenkeln liegen! Diese Aasgeier!" Für ihre Sehnsucht nach Pentia brachte er mehr Verständnis auf. Er richtete es fortan so ein, dass sie gelegentlich auf dem Weg zu einem der Märkte am Gauklerlager vorbeikamen. 79 IV E s war Mitte März geworden. Der Winter hatte seine Kraft verloren, doch gänzlich zog er sich noch nicht zurück. An manchen Tagen schien die Sonne, an anderen schneite es. In den Nächten gefroren die Pfützen des getauten Schnees. Ähnlich widersprüchlich sah es auch in Franziska aus. Stefanus behandelte sie wieder fast so grob und geringschätzig wie am Anfang, ohne dass sie herausfand, weshalb er ihr grollte. Immerhin nahm er sie weiterhin auf seine Streifzüge mit. Unterwegs freilich kränkte er sie häufig mit gehässigen Bemerkungen. "Ich warte noch ein wenig, damit du die Heilige Jungfrau um Erlaubnis fragen kannst", sagte er einmal, "Dein Gewissen zieht dich herunter, als würde dir ein Mühlstein am Hals hängen", ein andermal. Manchmal trug er ihr eine Arbeit auf, bei der er annahm, dass sie sich ungeschickt anstellen würde, und verhöhnte sie, wenn sich seine Vermutung als zutreffend herausstellte. Sie biss die Zähne zusammen, wollte sich den Ärger nicht anmerken lassen, wollte vor allem beweisen, dass er sie ganz falsch einschätzte. Doch sie kam an die Grenzen ihrer Geduld. Als er sie den Kessel säubern ließ und sie dabei ununterbrochen reizte, warf sie schließlich den Wischlappen in eine Ecke und ging trotzig davon, ohne Rücksicht auf die zu erwartende Strafe. Abermals schmiedete sie Fluchtpläne und abermals geschah etwas, das sie letztlich hinderte, einen davon auszuführen. Stefanus brachte ihr ein Geschenk mit, einen lang gestreckten, in ein Stück Leinwand eingehüllten Gegenstand. Sie wickelte ihn aus und hielt ein Schwert in der Hand. Es hatte eine verhältnismäßig kurze Klinge und war dadurch nicht allzu schwer. Der Steg lief auf beiden Seiten in kleine, als Fratzen gestaltete Knäufe aus. Der Griff war mit Draht umwickelt und endete mit einem Gebilde, das an die Flügel eines Schmetterlings erinnerte. Das alles wirkte ein wenig verspielt und verschleierte den eigentlichen Sinn als Waffe. Andererseits war sie aus gutem Stahl gefertigt. Die Klinge zeigte keine einzige Roststelle. "Wie für dich geschaffen!" rief er begeistert. "Geschaffen, um jemanden damit umzubringen", murmelte sie, etwas beklommen. "Du bist dafür verantwortlich, was du damit anstellst, nicht der Schmied." "Dann will ich es nicht haben." "Und wie verteidigst du dich, wenn du überfallen wirst?" "Ihr müsst mich verteidigen! Ihr seid ein Mann, ich bin ein Mädchen. Der Apostel Paulus hat gesagt ..." "Lass mich mit deiner Frömmelei in Frieden!" schrie er ernstlich aufgebracht. "Ich werde dich nicht verteidigen. Ich zeige dir, wie du dich selbst wehren kannst, nicht mehr und nicht weniger." "Jeder sagt mir etwas anderes. Der Priester ..." "Prinzessin! Ich schlage dich tot, wenn du noch ein einziges Wort deines elenden Priesters wiederholst. Ansonsten ist es deine Sache, ob du dir von mir das Fechten beibringen lässt oder nicht. Nur vergiss nicht: Dort draußen werde ich dir nicht beistehen, niemals, was auch geschieht." Franziska dachte an den Einbruch der Graukittel im Keller der Jevers und an den Angriff vor dem Erzbischofspalast. Stefanus hatte wohl Recht. Schon am nächsten Tag erteilte er ihr unten im Labyrinth die ersten Lehrstunden. "Ich greife dich an, und du versuchst, meine Schläge abzuwehren." Sie nickte und gab sich redlich Mühe. Schon nach kurzer Zeit aber schmerzten ihr die Unterarme und vor allem die Handgelenke so sehr, dass sie das Schwert kaum noch anheben, geschweige denn damit fechten konnte. "Im Ernstfall wärst du jetzt tot", sagte er lakonisch. "Ich bin eben ein Mädchen und hab nicht so viel Kraft." "Unsinn! Wenn du das Schwert wie eine Stricknadel hältst, brauchst du dich nicht zu wundern, dass dir die Arme lahm werden. Sieh her! Du musst die Ellebogen durchdrücken und den Griff mit beiden Händen packen. Will dir nun jemand den Kopf halbieren, holst du Schwung, indem du die Klinge nach hinten führst. Du lässt die Füße, wo sie sind, und verdrehst den Körper, so weit du kannst. Das ist so, wie wenn du ein Bündel Gerten verbiegst." Er führte es ihr mehrmals vor. "Hast du's begriffen? Gut! Morgen üben wir das. Und binde dir Lederriemen um die Handgelenke - so fest, dass du sie nicht mehr bewegen kannst!" Franziska verstand schnell, was Stefanus ihr zeigte. Sie lernte, dass Angriffe von oben sehr wirksam sind, weil dann das Gewicht der Waffe hilft, dass ihnen aber, wenn man nicht trifft, ein Verteidigungsschlag von unten folgen muss. Sie lernte, bei den Attacken zwischen rechts und links zu wechseln, dies aber auf keinen Fall regelmäßig zu tun. Und sie lernte, die Füße richtig zu setzen, um immer im günstigsten Winkel zum Gegner zu stehen. Von ihrem Rhythmusgefühl war ihr Lehrmeister so begeistert, dass er sie manchmal (ganz gegen seine Gewohnheit) dafür lobte. Nach zwei Wochen verstand sie bereits, an den Schwüngen eines Angreifers zu erahnen, was er plant. Sie übte nun, wie man Treppen und Möbelstücke im Kampf ausnutzt, sich aus einer Ecke befreit, aus einem Versteck heraus angreift. Ihre Hiebe wurden unterdessen (ohne dass sie es merkte) immer wuchtiger. Als Stefanus ihr einmal statt seines Schwertes einen armdicken Ast entgegenhielt, sah sie erschrocken, dass das frische Holz zersplitterte. Die schnellen Erfolge entfachten ihren Ehrgeiz und riefen unterdrückte Veranlagungen wach. Als Kind hatte sie sich mit den Söhnen der Bauern wilde Stockgefechte geliefert und damit die Missbilligung der Eltern zugezogen. In beiden Fällen aber waren diese Übungen für sie nur ein Spiel - was ihrem Lehrmeister selbstverständlich nicht entging. Eines Tages tadelte er sie: "Ich habe dir dein Schwert aus der Hand geschlagen und du lachst darüber. Du strengst dich nicht an." "Das ist nicht wahr!" "Doch! Es ist dir gleichgültig, ob du siegst oder verlierst." "Was soll ich ausrichten gegen einen Mann wie Euch?!" "Du würdest auch gegen einen Schwächling verlieren. Wenn du fechtest, schaust du drein wie eine Nonne, die gerade Waisenkinder versorgt. Dein Gesicht muss aber einer Dämonenfratze gleichen. Es darf nichts anders darauf zu sehen sein als der Wille zu töten kein Schmerz, keine Angst, kein Mitleid. Dein Herz muss stark sein, nicht dein Arm. Ist es im Kampf hart wie dein Schwert, wirst du jeden besiegen." Franziska erwiderte nichts. Stefanus redete wie jemand, dem Glaube und Ehre nichts bedeuten, und sie fragte sich (zum hundertsten Mal wohl schon) ob er ein Knecht des Teufels war (vor dem sie sich in Acht nehmen musste) oder ob vielmehr sie (wie er behauptete) 81 nichts von der Welt verstand. Ihre Zweifel änderten freilich nichts daran, dass sie weiterhin mit ihm fechten übte, dass sie seine Hinweise gelehrig beher- zigte und dass sie bald so manchen Knappen hätte bedenkenlos herausfordern können. V A m ersten Sonntag im Juni wollte der Herzog von Brabant in seinem Kölner Anwesen ein Fest geben und hatte einige der reichsten Patrizier der Stadt mitsamt ihren Familien dazu eingeladen. Nun galt es als Zeichen besonderer Würde und Bedeutung, mit einem großen Gefolge zu erscheinen, was einen der Geladenen zu dem Einfall trieb, seine gesamte Dienerschaft mitzunehmen und sein Haus für mehrere Stunden leer stehen zu lassen. Stefanus erfuhr durch Zufall von diesem Plan und gedachte, sich die gute Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Kurz vor Sonnenuntergang jenes Tages brach er gemeinsam mit Franziska auf. Nördlich des Forum feni floss der Duffesbach, der von Westen nach Osten die ganze Stadt durchschnitt und mehrmals die Farbe wechselte, ehe er den Rhein erreichte. Hinter der Bachpforte führte er noch sauberes Wasser und konnte von den Wäschern und Bleichern genutzt werden. Rot sah er aus, nachdem die Gerber ihre Rinderhäute darin behandelt hatten, blau hinter den Werkstätten der Waidfärber. Schließlich eignete er sich nur noch zum Antreiben von Mühlen und für die bescheidenen Bedürfnisse der Hutmacher. Am unteren Ende wurde er gar nicht mehr genutzt. Hier schlängelte er sich durch Anwesen einiger sehr vornehmer Kölner Familien, die sich gegen den schmutzigen Bach mit soliden Mauern abgrenzten. Jene Gegend war selbst für Stefanus zu gefährlich. Patrizier dieses Ranges leisteten sich eine Bewachung wie Ad- lige. Nordwestlich davon aber schloss sich das Viertel um das Stift St.Georg an. Die hier wohnten, waren zwar gleichfalls steinreiche Kaufherren, konnten aber eine Winzigkeit weniger für ihre Sicherheit tun. Das genügte, sie zu Opfern der kühnsten und gerissensten unter den Räubern werden zu lassen. Der Vollmond erleichterte den beiden den Weg zu ihrem Ziel, zwang sie aber zugleich zu besonderer Vorsicht. Stefanus ging voran. Nach einer halben Stunde blieb er plötzlich stehen und flüsterte: "Dort ist es." Franziska spannte sich innerlich, wurde aufmerksamer. Er zeigte ihr eine leicht zu erklimmende Stelle an der Umfassungsmauer. Sie nickte und kletterte hinauf. In wenigen Sprüngen durchquerten beide den Vorgarten. Er brach fast lautlos einen Fensterladen auf. Sie reichte ihm das Handwerkszeug zu. Beide verstanden einander blind und ohne Worte. Sich ohne Licht in einem fremden Haus zurechtzufinden, ist nicht einfach. Stefanus besaß allerdings auch dabei seine Erfahrungen. Als sie die drei besten Räume der Herrschaftsfamilie gefunden hatten, verhängten sie alle Fenster mit dunklen Tüchern und entzündeten eine Kerze. Nun konnten sie sich in Ruhe umsehen und vom Wertvollsten soviel in die mitgebrachten Säcke stopfen, wie sie zu tragen vermochten. Der Raubzug gelang vorzüglich - bis plötzlich Schritte zu hören waren. Beide hielten inne, lauschten. Sie hatten sich nicht geirrt. Jemand näherte sich der 82 einzigen Tür, durch die sie hätten fliehen können. Stefanus zog sein Schwert und bedeutete Franziska, sich hinter einem Schrank zu verstecken. Eine Gestalt trat ins Zimmer. Der Räuber hatte schon die Waffe zum Angriff gehoben, da sah er, dass es eine Frau war. Offenbar noch völlig arglos, untersuchte sie kopfschüttelnd die auf dem Tisch stehende Kerze. Stefanus erkannte die junge Frau des Patriziers wieder. Warum sie ihren Mann nicht zum Empfang des Herzogs begleitet hatte, wusste er nicht, und es beunruhigte ihn, dass es einen Fehler gab in seinem Plan. Er fragte sich, ob womöglich auch noch ein paar Knechte zurückgeblieben waren, und durchdachte blitzschnell alle Möglichkeiten, die ihm offen standen. Dann steckte er leise sein Schwert in die Scheide, zog stattdessen seinen Dolch, verhüllte sein Gesicht mit einem Tuch und stürzte sich von hinten auf die Frau. Indem er ihr mit seiner breiten Hand den Mund zuhielt, hinderte er sie am Schreien. "Ein Laut von dir und ich bringe dich um!" raunte er und zeigte ihr den Dolch. Sie starrte ihn aus großen Augen an, war völlig verängstigt. "Warum bist du nicht auf dem Fest des edlen Herzogs?" "Eines von unseren Kindern ist krank geworden." "Wer ist außer dir noch hier?" "Das kranke Kind - ein sechsjähriger Knabe. Sonst niemand." "Du lügst." Er holte die Kerze vom Tisch, stopfte der Frau ein Stück Stoff als Knebel in den Mund und ließ das heiße Wachs in ihren Busen tropfen. Sie versuchte verzweifelt, sich ihm zu entwinden, doch er hielt sie an den Haaren fest. Als er glaubte, dass es genug sei, zog er ihr den Knebel wieder aus dem Mund und fragte: "Habe ich dich überzeugt?" "Zwei Diener sind noch da. Sie schlafen unten in der Laube." "Ich wusste, dass wir uns einigen. Jetzt will ich nur noch eine kleine Gefälligkeit von dir, und schon bist du mich wieder los." Mit diesen Worten riss er ihr das Kleid auf und schleuderte sie auf den Boden. "Bitte nicht!" flehte die junge Frau, doch das nutzte ihr wenig. Stefanus sprang auf sie drauf und befriedigte an ihr seinen Trieb wie ein Tier. Anschließend, als sei nichts gewesen, sagte er zu Franziska: "Wir verschwinden durch den Garten hinter dem Haus. Es ist fast ein Wunder, dass uns die Diener nicht gehört haben, als wir vorhin direkt an der Laube vorbeigegangen sind!" Das Mädchen nickte, nahm ihre zwei Beutesäcke und folgte ihm wie eine Traumwandlerin. Sie hatte schon Schlimmeres gesehen, seit sie in Köln angekommen war. Dass aber Stefanus, an dessen Seite sie monatelang gelebt, den sie als Vaterersatz anerkannt, dem sie vertraut hatte, dass er sich kaum anders benahm als die Graukittel, das konnte sie nicht verwinden. "Ihr müsst Buße tun", sagte sie, als sie mit ihm wieder im Versteck angekommen war. Noch hoffte sie, ein böser Geist sei plötzlich über ihn gekommen, ein Dämon, der sich mit Gebeten und einem geweihten Kreuz vertreiben lässt. Er aber war weit davon entfernt, etwas zu bereuen. "Warum soll ich dir das erklären? Du wirst es nicht begreifen. Ich hatte das Recht mir die Frau zu nehmen - ich war stärker als sie. Die Welt gehört den Wölfen, und wenn du nicht selbst ein Wolf wirst, musst du dich fressen lassen." 83 VI F ranziska hielt nun endgültig nichts mehr bei dem Räuber, und sie war fest entschlossen, die nächste Gelegenheit zur Flucht tatsächlich zu nutzen. Das wusste aber auch Stefanus. Er nahm sie nicht mehr zum Markt mit (was zur Folge hatte, dass sie ihre Schwester nicht sah), unternahm seine Raubzüge wieder ausschließlich allein und sperrte sie, wenn er das Haus verließ (und sei es nur kurz) in sein unterirdisches Reich ein. Sie hatte wieder viel Zeit zum Grübeln. Dass er sie im Grunde nicht brauchte, beunruhigte sie. Sie traute ihm neuerdings durchaus zu, sie einfach zu ermorden, um sie loszuwerden und gleichzeitig als Mitwisser zum Schweigen zu bringen. Freilich besaß sie inzwischen ein Schwert, mit dem sie umzugehen verstand. Ob ihr das gegen einen Mann wie Stefanus helfen würde, das wusste sie nicht, aber sie nahm sich vor, um ihr Leben zu kämpfen. Die Waffe lag immer griffbereit in ihrer Nähe. Tatsächlich packte er sie eines Tages unten im Labyrinth und drückte sie gegen eine Wand, freilich nicht, um sie zum Schweigen zu bringen, sondern allem Anschein nach um sie als Frau zu nehmen. Das verblüffte sie, denn schließlich hatte er sie monatelang ganz wie einen Jungen behandelt. Dann kam es zu einem erbitterten Kampf. Sie riss sich los, nahm ihr Schwert in die Hand und ging damit auf ihn los. Er wich geschickt aus, angelte sich ihren rechten Arm und entwaffnete sie. Sie griff nach seinem rechten Ohr und drehte mit aller Kraft daran. Er befreite sich mit einem Fausthieb. Sie taumelte zurück, gab sich aber nicht geschlagen. "Willst du mich totschlagen oder als Frau benutzen? Ich werde dir in beiden Fällen die Augen auskratzen." Sie war so von Hass erfüllt, dass sie keinerlei Angst hatte. Nachdem sie sich ein Stück in den Gang hinein abgesetzt hatte, sammelte sie faustgroße Steine. Er verzichtete dann allerdings darauf, sie zu verfolgen. Erst am nächsten Morgen kam sie wieder hervor. Wortlos begleitete sie Stefanus, der sie abholte, nach oben, setzte sich zu ihm an den Frühstückstisch und bediente sich, wobei sie ihn ständig im Auge behielt. Er war offenbar gut gelaunt. "Ich bin stolz auf dich. Du hast viel gelernt." "Wollt Ihr mir einreden, dass Ihr mich nur prüfen wolltet?" "Du warst mutig und entschlossen. Das alles hätte dir aber nichts genutzt. Ich werde dir heute zeigen, wie du dich wirklich retten kannst." Gleich nach dem Essen befahl er ihr, das Schwert zu holen, und ging mit ihr nach unten. "Zeige nicht sofort, dass du bewaffnet bist! Trag dein Schwert unter den Kleidern oder verstecke es unter einem Strauch oder einer Decke! Du musst es blitzschnell greifen können, aber es darf nicht zu sehen sein." Franziska hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Sie glaubte ihm nicht, dass er ihr wirklich helfen wollte. Er war ohne Zweifel ein Ungeheuer. Was konnte sie von ihm erwarten? "Stell dich am Anfang furchtsam! Männer mögen es, wenn Frauen vor ihnen Angst haben. Sie weiden sich gern daran. Aber das macht sie auch unaufmerksam. So kannst du dich unauffällig zurückziehen bis zu jener Stel- le, wo dein Schwert versteckt ist. Kommt er dann wie ein brünstiger Bulle auf dich zu galoppiert, hältst du die Klinge hin und spießt ihn auf, als ob du ihn überm Feuer braten willst." "Um Gottes Willen!" "Du traust dich nicht? Nun gut! Ich werde es mit dir üben, bis du dich traust. Wir sparen uns das Possenspiel am Anfang. Stell dich dort an die Wand! Zurückweichen kannst du nicht, aber du hast hinter deinem Rücken das Schwert in der Hand. Jetzt beobachte mich!" Sie stellte sich an die befohlene Stelle. Er wartete einen Moment, dann sprang er sie an. Sie reagierte praktisch überhaupt nicht. "Was soll das? Hast du mir nicht zugehört?" "Ich kann doch nicht ..." "Was kannst du nicht, Prinzessin? Woher weißt du, dass es Spaß ist, was wir hier treiben? Du hältst mich doch für einen Dämon. Du erzählst es fast jede Nacht im Traum. Vielleicht stimmt es ja." Franziska zitterte, hatte Todesangst. Als er sie zum zweiten Mal angriff, war sie dennoch zu langsam. Sie brachte es einfach nicht fertig, die Klinge gerade vor ihren Körper zu halten, so dass er hineinlaufen musste. "Fang nur nicht auch noch zu heulen an! Wir versuchen es ein drittes Mal, und diesmal ist es ernst." Sie sah ihn auf sich zuspringen. Instinktiv riss sie das Schwert nach vorn und - kniff die Augen zu. Ein gewaltiger Stoß schleuderte sie gegen die Wand. Er war hineingelaufen. Sie hatte ihn umgebracht. Halb irrsinnig ließ sie die Waffe fahren, warf sich auf den Boden und schlug die Hände vors Gesicht. Da plötzlich hörte sie seine Stimme. "Na bitte! Wenn du 's nicht getan hättest, wäre dir das allerdings auch verdammt schlecht bekommen!" Sie schlug die Augen auf und sah, wie er seelenruhig ein dickes Holzbrett unter seinem Hemd hervorzog. "Ich werde das niemals, niemals wieder tun! Beim nächsten Mal lasse ich mich lieber umbringen." Er antwortete nicht. 85 9.Kapitel I G undula saß in der inzwischen völlig finsteren Guten Stube und wartete. Es war sehr unwahrscheinlich, dass er um diese Zeit noch käme, doch sie klammerte sich fest an ihre vage Hoffnung, weil sie die Wahrheit einfach nicht ertrug. Dass er ab und an eine Nacht nicht zu Hause verbrachte, daran hatte sie sich gewöhnt, und sie stellte ihn längst nicht mehr zur Rede deswegen. Sie wusste, dass er dann bei einem seiner neuen Freunde schlief und redete sich ein, dass er dort gut aufgehoben sei. Diesmal aber war er zwei Nächte hintereinander fort geblieben und eine dritte Nacht hatte gerade begonnen. "Ihm ist etwas zugestoßen!" dachte sie und erinnerte sich, manchmal Spuren einer Prügelei an ihm gesehen zu haben. In diesen Wochen erzählte man sich in der Stadt viel von Straßenschlachten zwischen jungen Leuten, die sich entweder zum Erzbischof oder zum Rat bekannten. Da sie Diplomatie und Geduld für Feigheit hielten, trugen sie jene Kämpfe im Kleinen aus, welche ihre Väter im Großen noch vermieden. Sie gingen nicht mit scharfen Waffen aufeinander los, doch gefährlich war das trotzdem. Faustgroße Steine warfen sie mit Handschleudern durch die Luft, und nicht selten wurden einzelne Mitglieder der einen Partei von ganzen Gruppen der anderen hinterhältig überfallen und mit Knüppeln gnadenlos zusammengeschlagen. Der Hass auf beiden Seiten war groß. Gundula hatte dafür kein Verständnis. Räuber und Diebe waren gottloses Gesindel, gegen das man sich schützen musste. Was aber trieb Söhne aus ehr- baren Familien zu solchen Gräueltaten? Was trieb Hans dazu, der doch nichts zu entbehren brauchte? Sie wusste auch nichts mit den Losungen anzufangen. Was hatten Juden, Gaukler und Bettler mit dem Streit zwischen Erzbischof und Rat zu schaffen? Die Juden hatten nicht den rechten Glauben und lebten vom Wucher, die Gaukler waren Schmutzfinken und stahlen wie die Raben, die Bettler setzten sich zumeist nur deshalb an den Straßenrand, weil ihnen die Lust zur Arbeit fehlte. Es gab Grund genug, ab und an dazwischenzuschlagen. Was aber ging Hans das an? Gab es dafür nicht die Waffenknechte? Auf das Geld der Juden waren die Jevers nicht angewiesen, die Gaukler hielten sich fast nur in der Innenstadt auf, die Bettler ebenso. Leider konnte sie mit ihrem Sohn darüber nicht reden. Dabei verstand sie sich noch sehr viel besser mit ihm als Ludwig. Für den gab es Hans nicht mehr. Irgendwann in den letzten Monaten hatte er sich mit dem Verlust abgefunden. Der Erbe und Nachfolger war in seinen Gedanken und Gefühlen gestorben. Wenn ihm dieser große, kräftige, blonde Mann im Haus begegnete, zog er die Stirn in Falten, senkte den Blick und ging rasch weiter. Er sah einen Fremden in ihm, einen Störenfried, den er nur der Nachbarn und seiner Frau wegen nicht vor die Tür zu setzen wagte. Die Ehe der Jevers hatte Risse bekommen. Nicht zuletzt deshalb mochte Gundula nicht nach oben gehen. Ihr Mann war ihr keine Hilfe in ihrem Kummer. Was sollte sie im Bett zu ihm sagen? Die Wahrheit, um dann seine Befriedigung zu spüren, seine Hoffnung, dass der Unglückssohn tatsächlich verschwunden bliebe? Dass Hans ganz aus freien Stücken fortblieb, konnte sie noch immer nicht denken. Lieber stellte sie sich vor, dass er von einem Stein getroffen, blutend bei seinen Freunden lag. Hätte sie gewusst oder wenigstens geahnt, wo diese Freunde zusammenkamen, wäre sie mitten in der Nacht aufgebrochen, um zu ihm zu gehen. Wie viele junge Männer hatten schon Helden sein wollen und dann in der größten Not doch nach ihrer Mutter geschrieen! Ganz sicher brauchte er sie jetzt, und sie konnte nichts für ihn tun, außer zu beten. II A uch Benno fand in dieser Nacht keinen Schlaf. Ein ganzes Jahr war vergangen, und er lebte noch immer bei den Jevers. Handel treiben durfte er in Köln nicht mehr, und auch eine andere Arbeit bekam er nicht. Als Fremder wurde er in der Stadt nur geduldet. So half er seinem Freund ein wenig. Um aber Scherereien mit dem Rat zu vermeiden, bestand Ludwig darauf, dass dies im Rahmen des Erlaubten geschah. Damit sank der Fernhändler auf die Stufe eines Knechts herab, zumal er längst sein gesamtes Geld als Ausgleich für die Beherbergung hergegeben hatte. Allerdings wurde er sich seiner Lage allmählich bewusst. Seine Sehnsucht nach Franziska begann zu verblassen und er fand die Kraft zu einem Entschluss. Er wollte nach Bremen reisen, seine Niederlage eingestehen und mit dem Geld seiner Frau einen Neubeginn wagen. Ein leichter Gang würde das nicht sein, doch entwürdigender als hier in Köln konnte es für ihn kaum noch kommen. Ludwig verachtete ihn immer offener. Er hatte den Tag der Abreise festgelegt und seinen inneren Frieden wieder gefunden. Aber dann war ihm auf dem Altmarkt Pentia über den Weg gelaufen. Wie vom Himmel herab gefallen, stand sie plötzlich vor ihm. Sie trug die typische Kleidung der Gaukler, war etwas verlegen am Anfang, dann allerdings erstaunlich selbstbewusst. Er erkannte sie kaum wieder. "Geht es dir gut?" fragte er sie, um irgendetwas zu sagen. Sie nickte und beantwortete ihm unaufgefordert die Frage, an der allein ihm wirklich gelegen war: "Meine Schwester ist nicht bei uns. Sie besucht mich manchmal am Abend, aber nicht an jedem Abend." Dann wurde sie gerufen und verschwand im Gewühl. Diese kurze Begegnung warf all seine Pläne wieder über den Haufen. Er verschob die Abreise, um Franziska wenigstens Lebewohl zu sagen. Abend für Abend ging er zum Forum und wartete. So aufmerksam er die Wagen aber auch beobachtete, er entdeckte sie nicht. Entweder sie war ausgerechnet jetzt für längere Zeit gehindert, zu ihrer Schwester zu gehen, oder die beiden trafen sich heimlich an einem ganz anderen Ort. Vielleicht hatte die Kleine ihn sogar angelogen. In jener denkwürdigen Nacht nun rang Benno sich dazu durch, dennoch abzureisen. Nur noch einmal wollte er zum Forum gehen. Um sich die herablassenden Blicke der Jevers zu ersparen, versuchte er, sich unbemerkt nach draußen zu schleichen. Aus der Guten Stube vor ihm drangen jedoch Stimmen. Die eine gehörte Gundula, die andere Hans. Durch die Tür verstand Benno nichts, merkte aber, dass sie sich stritten. In der Hoffnung, dass sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt seien, um auf ihn zu achten, schlüpfte er hinein. Er gelangte jedoch nicht auf die Straße, denn Hans 87 versperrte ihm unabsichtlich den Weg, so dass er unfreiwillig Zeuge der Auseinandersetzung wurde. "Überlege es dir doch noch einmal!" bettelte Gundula mit rot geweinten Augen. "Du weiß doch, wie sehr du uns fehlen wirst!" "Vor allem dem Herrn Kaufmann Jever, den ich einmal meinen Vater nannte, werde ich fehlen. Auf wen wird er in Zukunft seine Misserfolge schieben? Wen brüllt er an, wenn ihm gerade nach Brüllen zumute ist? Mit wem ..." In eben diesem Moment kam Ludwig herein. Die letzten Sätze hatte er wohl mit angehört. Dennoch wirkte er gefasst wie bei einer Verhandlung. Er trat langsam auf seinen Sohn zu und sagte nur ein Wort: "Raus!" Die Kälte, die ihm da entgegenschlug, verwirrte Hans. Er wollte seinen Eltern eigentlich noch einiges aus seiner Kindheit vorhalten, wollte sich gewissermaßen davon frei reden, doch das ging jetzt nicht mehr. Man wies ihn hinaus wie einen Eindringling. Nicht einmal für ein Abschiedswort war jetzt noch Raum. Als er ging, ließ er beklemmendes Schweigen zurück. Gundula weinte leise, Ludwig lief von einer Wand zur anderen auf und ab. Wie zum Hohn stieg beiden dabei der Duft von der festlich gedeckten Tafel in die Nase. Unberührt dampfte in einer großen Schüssel Schaffleisch mit Zwiebeln. Auf den guten Zinntellern lag helles Weizenbrot, wie es sonst nur zu den hohen Festtagen gegessen wurde. Sogar die fein gefertigten Daubenschalen, die wie winzige Fässchen aussahen, hatte Gundula aus der Truhe geholt, nur um die Rückkehr des verloren geglaubten Sohnes zu feiern. Nun war alles vergebens. "Er hätte uns vielleicht noch das Haus über dem Kopf angezündet!" rief Ludwig. Eigentlich wollte er seine Frau damit trösten, erreichte aber nur, dass sie noch heftiger schluchzte, was wiederum in ihm die Wut steigerte. In dieser Stimmung sah er den noch immer verstört an der Tür stehenden Benno und fuhr ihn an: "Darüber freust du dich, nicht wahr? Ein wenig Unterhaltung, da du ja nichts zu tun hast, außer nach deiner Hure zu suchen." Endlich konnte er sich an jemandem abreagieren. "Dein Anblick wird unserem Sohn auch nicht gerade angenehm gewesen sein. Du bist ein Nichtsnutz, der das Unheil ins Haus lockt. Seit du hier wohnst, folgt ein Schlag dem anderen. Gestern misslang mir ein sicheres Geschäft im letzten Moment. Heute geht Hans fort ..." Benno hielt sich die Ohren zu. Er wusste nicht, wann sein Freund ihm so fremd geworden war, nicht einmal, ob er sich nicht vielleicht vom ersten Tag an in ihm getäuscht hatte. Er wusste nur, dass er gehen musste, erst einmal für diesen Tag, und dann so bald wie möglich für immer. Über dem Neumarkt schien die Sonne und in der Luft lag Blütenduft. An diesem Tag gab es keinen Markt, sondern es wurden Wettkämpfe mit Bogen und Armbrust ausgetragen. Nirgends sonst in Köln konnte man dergleichen gefahrlos tun. Benno sah eine Weile dem Treiben zu, ehe er sich durch das Gewühl der Schildergasse drängte, bis zum Turm der Domus bellica. Dort fragte er sich (wie damals, als er zum ersten Mal nach ihr gesucht hatte), ob sich Franziska gerade mit dem Sohn Winrichs des Griechen unterhielt. Sehr wahrscheinlich war das allerdings nicht mehr, denn Winrich hätte auch Pentia zu sich genommen. Am Judenviertel wich Benno in abergläubischer Furcht drei Männern mit langen Schläfenlocken aus. Eine Zeitlang lief er dann kreuz und quer über den Altmarkt, von den Obstverkäu- 88 fern zu den Fischhändlern, von den Gewürzständen zu den Apotheken. Nur die Ecke der Geldwechsler mied er, um Ole nicht zu begegnen. Gegen Mittag begab er sich schließlich hinüber zum Forum feni. Jetzt im Juni war der Platz nicht mehr leer und öde wie im Winter. Vom Schmutz der herbstlichen Getreide- und Viehverkäufe gereinigt, ließ er sich wieder von den verschiedensten Händlern als Ganzes nutzen. Dort, wo Benno ihn betrat, wurden Zwiebeln und Salz feilgeboten. Rechts hatten Gewandschneider ihre Stände aufgebaut. Von der Mitte her drang der Geruch der Fleischbänke herüber. Links konnte man Gemüse, Käse und Gewürze kaufen. Hinten aber, wo sich Leute vor mehreren Garküchen und Weinzapfen drängten, standen noch immer die Wagen der Gaukler. Benno wollte wenigsten mit Pentia sprechen, traf jedoch nur einen alten Mann und ein paar Kinder an. Da die anderen vor dem Abend nicht zurückkehren würden, ging er gleich weiter auf den Duffesbach zu. Jetzt wartete er nur noch, dass die Zeit verging. Doch ausgerechnet, als er nicht mehr ernsthaft nach ihr Ausschau hielt, meinte er, Franziska gesehen zu haben, und zwar in der Plektrudisgasse, die hinauf zum Plateau der Marienkirche führte. Er lief ein Stück in diese Richtung und überzeugte sich, dass er sich nicht getäuscht hatte. Allerdings war sie in Begleitung eines außergewöhnlich großen, bärtigen Mannes. Benno schlich sich immer näher heran, bis er sich in Hörweite in eine Nische drücken konnte. "Allein schon meines Seelenheils wegen werde ich Euch nicht folgen. Ihr seid vor Gott verflucht!" vernahm er dort Franziskas wütende Stimme. "Seit wann bestimmst du, wen Gott verflucht?" versetzte der Bärtige nicht minder aufgebracht. "Nimm das Bündel und komm!" "Oh nein! Ich verlasse Euch, und Ihr könnt mich jetzt nicht mehr daran hindern. Ich hasse Euch! Ihr seid ein gemeiner Schurke, wahrscheinlich sogar ein Mörder." "Überlege dir, was du sagst! Ich habe dich aus Mitleid wieder zum Markt mitgenommen, weil du bleich aussiehst wie ein Gespenst. Ist das dein Dank dafür?" "Warum sehe ich so bleich aus? Ist es nicht, weil Ihr mich eingesperrt habt?" Sie drehte sich um und wollte davonlaufen. Er indes sprang ihr nach und bekam sie am Kleid zu packen. "Wenn du im Guten nicht hören willst, muss ich dich zwingen!" Er brüllte nicht, weil er auf der Straße kein Aufsehen erregen durfte, die Drohung aber war unüberhörbar. Trotzdem riss Franziska sich los. "Du kommst nicht weit!" fauchte der Bärtige. Sie schüttelte den Kopf und über ihr Gesicht huschte der Anflug eines höhnischen Lächelns. Da nahm der Riese bebend vor Zorn einen dicken Holzknüppel. "Ich warne dich zum letzten Mal." Benno wurde in seiner Nische hin und her gerissen zwischen seiner Liebe und seinem Verstand. Verzweifelt suchte er nach einem Weg, der zwischen Feigheit und Tollkühnheit lag, fand jedoch keinen. Und als der bärtige Riese den Knüppel hob, als wolle er im nächsten Moment zuschlagen, gewann das Gefühl die Oberhand über den Verstand. Stefanus war von dem jähen Angriff in seinen Rücken völlig überrascht. Er hatte in der Plektrudisgasse weit und breit keinen dritten Menschen gesehen. Dennoch reagierte er schnell und wirkungsvoll. Er griff nach einem Arm des Angreifers, zog kräftig daran und beugte sich dabei mit einem Ruck nach vorn. 89 Benno verlor den Boden unter den Füßen und rollte über den Rücken des Riesen. Nun staunte Stefanus zum zweiten Mal. Dieser kleinwüchsige Mann mit dem vor gewölbten Bauch eines Genießers war weder ein Räuber noch ein Waffenknecht. Was in aller Welt hatte ihn zu diesem Überfall veranlasst? "Bist du des Lebens müde oder vom Wahn besessen? Pack dich, ehe ich dich durchprügle!" Der sonderbare Fettwanst war ihm lästig. Womöglich entwischte ihm Franziska mitsamt dem Bündel, während er sich gerade mit ihm abgab. So versuchte er, ihn zu vertreiben wie eine aufdringliche Katze. Benno indes raffte sich noch einmal auf. "Ist das noch in Worte zu fassen? Du musst wahrhaftig wirr im Kopfe sein!" Stefanus kämpfte halbherzig. Nur, als Benno ihm an den Hals sprang und ihm die Luft abdrückte, setzte er sich etwas heftiger zur Wehr. Er schloss seine Hände wie zwei eiserne Zangen um die Oberarme des Angreifers und befreite sich mit einem derben Fluch. Der Kaufmann wirbelte wie eine Strohpuppe durch die Luft, prallte gegen einen Pfahl und sackte dann in sich zusammen. Franziska hätte fliehen können. Sie ahnte, dass ihr ehemaliger Dienstherr ihr genau dazu verhelfen wollte. Doch sie vermochte sich nicht loszureißen von der sonderbaren Szene. Niemals hätte sie dem behäbigen Benno solchen Mut zugetraut. Übrigens fand sie ihn dabei trotz seiner hoffnungslosen Unterlegenheit keineswegs lächerlich. Als sie ihn reglos auf der Straße liegen sah, lief sie zu ihm hin und beugte sich über ihn. Nachdem sie ihn auf den Rücken gedreht hatte, flüsterte sie: "Ihr habt ihn umgebracht." Stefanus war verwirrt, was selten vorkam bei ihm. "Es war ein Unglücksfall! Was sollte ich denn tun gegen diesen Verrückten?" "Ihr seid nie um eine Entschuldigung verlegen." Sie warf ihm das Bündel vor die Füße und kehrte ihm den Rücken zu. "Was weiß du denn vom Leben?" rief er ihr noch nach. "Was weiß du von mir? Prinzessin!" Sie hörte ihm nicht mehr zu, ging einfach davon. III H ans kam zu der großen Versammlung im Hospiz St.Maria Magdalena weit vor der Zeit. Der Türhüter musterte ihn verwundert, ließ ihn aber ein, weil er ihn kannte. Den ganzen Tag über war er durch die Stadt gelaufen, ohne Pause und ohne Essen. Das hatte ein wenig den Hass in ihm gedämpft, zugleich aber eine Leere hinterlassen, die er auch jetzt noch spürte, als er den Saal betrat. Bis die Dominikaner kamen, waren hier Kranke versorgt worden, manchmal (wenn schwere Epidemien in der Stadt wüteten) über hundert Menschen zu- gleich, zusammengepfercht dicht an dicht. Hans glaubte manchmal, noch immer das Stöhnen der Sterbenden von damals zu hören. Ein Dominikanerbruder steckte gerade Kerzen in die Halterungen an den Wänden und rückte die Stühle und Bänke zurecht. Dabei sprach er kein Wort, hob nicht einmal den Blick zu dem jungen Mann an der Tür. Hans war schon oft hier gewesen, noch nie aber hatte er sich so elend und verlassen gefühlt wie an diesem Abend. Niemand füllte die Leere in ihm aus, niemand kam, mit ihm zu sprechen, ihm zuzuhören, auf ihn zu zählen. Als der 90 Mönch fast lautlos hinausgegangen war, blieb er allein mit dem gekreuzigten Jesus, der ihn von der kahlen, weißen Wand herab so durchdringend anblickte, dass er erschauerte. Noch vor drei Tagen hatte er hier als Sohn eines Kaufmanns gesessen. Er trug keinen der bekannten, wohl aber einen anständigen Namen. Jetzt war er ein Stadtstreicher. Er schreckte hoch, als er Schritte auf dem Gang hörte. Christian kam, Christian der Judenhasser, Jüdenkrischan. Sein Gesicht verriet, dass er sich kaum besser fühlte als Hans. Aber wann fühlte er sich schon gut, seit sein Vater nichts anderes mehr tat, als sich zu betrinken, und das Geld, das die Mutter als Käuflerin verdiente, gerade reichte, um nicht vor Hunger zu verrecken. Als Kind hatte Krischan noch die guten Zeiten der Familie miterlebt. Der Vater führte einen Krämerladen in guter Lage nahe am Altmarkt. Das Geschäft brachte keine Reichtümer ein, wohl aber einen halbwegs sicheren Lebensunterhalt. Eines Tages tauchte in der Nachbarschaft ein findiger Jude auf, der nicht nur bessere Waren zu geringeren Preisen anbot, sondern wegen seiner Freundlichkeit auch persönlich beliebt war. Krischans Eltern blieben die Käufer aus, was der Vater niemals verwand. Er wurde mürrisch und unbeherrscht, womit er schließlich noch die letzten seiner Kunden vergraulte. Bald reichte das Geld nicht mehr für die Miete. Der Pächter ließ die Familie gegen einen monatlichen Strafzins von zwölf Denarien noch ein Jahr lang sein Verkaufsgewölbe nutzen, dann forderte er es zurück. Nun geriet der Vater völlig auf Abwege. Er kaufte zwar eine kleine Bude aus Holz, empfand es aber als entehrend, wenn ihn seine Bekannten darin stehen sahen, trank immer häufiger und vernachlässigte das Geschäft. Schließlich konnte er nicht einmal mehr die Steuern und Wehrbeiträge entrichten. Allein die Innung, die noch zu ihm hielt, bewahrte ihn und die Seinen vorerst vor dem Schlimmsten, indem sie die Steuern zahlte und zinsfreie Kredite gewährte. Krischans Vater jedoch sank noch tiefer. Wenn er betrunken aus der Schankstube kam, grölte er politische Parolen und ließ sich auf Handgreiflichkeiten ein. Einmal musste er sich sogar vor einem Richter verantworten. Die Innung sah sich nun zur Wahrung ihres Ansehens gezwungen, ihn auszuschließen. Zugleich ging die Verkaufsbude verloren, und die Familie geriet endgültig ins Elend. "Was ziehst du für 'ne Grimasse? Bei mir ist das normal, aber bei dir ... Wolltest du nicht mit deinem Alten ..." "Halt den Mund!" brüllt Hans und sprang auf, als wolle er mit den Fäusten auf den so ungeduldig erwarteten Freund losgehen. "Reg' dich nicht auf! ... Es hat also Stunk gegeben!" "Rausschmiss und zwar für immer." "Scheiße! Was machst du jetzt?" "Keine Ahnung." "Verdammt, wir dürfen uns nich' unterkriegen lassen von den bürgerlichen Arschkriechern. Verstehst du?" Er ließ sich schwer auf eine Bank fallen und starrte das Kruzifix an. "Ich möcht' auf was stolz sein. Dieses Scheißleben muss doch 'n Sinn haben! Gestern war mein Alter wieder so voll gedröhnt, dass er unter 'n Tisch gerollt ist. Vorher gab's Senge für Mutter! Da stehst du daneben und könntest gleich kotzen. Ist doch normal, dass du irgendwann selber säufst." "Hab' vorige Woche deine Mutter gesehen", sagte Hans. "Sie sieht aus wie der Tod, und mein Vater, das fette Schwein, hat sie behandelt wie ..." Krischan hörte ihm gar nicht zu. Er träumte. 91 "Wenn uns dieser Dreckjude damals nicht alles kaputt gemacht hätt', würd' ich jetzt im Verkaufsgewölbe stehen. 'Bitte schön, gute Frau!' 'Hat der Herr noch einen Wunsch?' Vorbei! Vergessen! ... Oh, wie ich diese Itzigs hasse!" "Wem sagst du das?!" "Wenn ich genau wüsste, dass die uns hier wirklich brauchen, verstehst du, dann höre ich auf mit dem Gesaufe." "Klar brauchen die uns! Kannst drauf schwören." "Uns hängt das mit dem Keller an. Gestern hat mich wieder einer angeödet. Dabei weiß ich von nichts. War viel zu voll." "Höre nicht drauf! Vielleicht bekommen wir heute einen großen, gefährlichen Auftrag, einen bei dem wir zeigen können, wozu wir taugen." Allmählich hatte sich der Saal mit jungen Männern in kurzen, grauen Kitteln gefüllt. Mit einer größeren Gruppe, die durch ihr lärmendes Auftreten die feierliche Ruhe des Dominikanerklosters störte, kam Michael, der Erzengel. Seine Eltern, seine Geschwister und auch er selbst arbeiteten gemeinsam auf dem Grundbesitz eines reichen Bürgers. Ein Vogt beaufsichtigte sie dabei, und so standen sie rechtlich kaum über den Leibeigenen in den Dörfern. Allerdings gestattete ihr Herr ihnen großzügig eine Reihe von Freiheiten, so dass sie sich beinahe wie Grundeigentümer gebärden konnten, wenngleich in einer nicht eben vornehmen Gegend. Michael gehörte zu jenen Menschen, die sich nicht schämten, am Stadtrand zu wohnen, und denen jeder ihr Herkommen ansah. Sein breites Gesicht mit der von einer Wirtshausschlägerei verunstalteten Nase, seine Angewohnheit, lauthals über Dinge zu reden, von denen er nichts verstand (als wolle er seinen Mangel an Bildung geradezu zur Schau stellen), seine Grobheit in fast jedem Wort und fast jeder Bewegung, das alles gehörte zu ihm wie sein Name. Selbstverständlich mochte er nicht als Knecht gelten, doch reichte ihm, wenn die Kaufmannssöhne ihn aus Furcht vor seinen von schwerer körperlicher Arbeit gestählten Fäusten den Worten nach achteten. Hinter ihm her trottete wie ein Schatten der Rächer. So wie dem einen der Schweinemistgeruch des Stadtrandes anhaftete, so stand dem anderen die gute Erziehung im Gesicht geschrieben. Seine Eltern dienten dem erzbischöflichen Hof. Der Vater war Schreiber, die Mutter half bei der Ausgestaltung der Säle und Salons für die zahlreichen Feste, bei der Betreuung der Gäste, beim Aufräumen. Beide Ämter galten nicht als ehrenvoll und auch die Bezahlung schuf keine Neider. Wer jedoch tagtäglich Umgang mit den einflussreichsten Männern der Stadt hat, für den fallen trotzdem kleine Vorteil ab. Freilich spezialisiert sich niemand ungestraft auf das Aufsammeln der Krumen unter dem Tisch der Mächtigen. Ohne dass sie es noch selbst merkten, waren bei dem Paar Treue und Ehrbarkeit (ihr Stolz und ihr Selbstverständnis) zu Speichelleckerei und kleinlicher Sittenstrenge verkommen. Ihr innig geliebter, gegängelter und verzärtelter einziger Sohn träumte unterdessen von Heldentaten (wie jenen, die man sich von den Palästinakreuzfahrern erzählte). Er selbst hatte sich den Spitznamen Rächer des Herrn zugelegt. Zu seinem Leidwesen tat ihm bei den Canes niemand den Gefallen, ihn auch so zu nennen. Fast alle riefen ihn Söhnchen, wie seine Mutter es tat. Um zur Gruppe gehören zu dürfen, musste er tun, was der Erzengel, Jüdenkrischan und Hans von ihm verlangten. "Die Blödköpfe werden nicht fertig mit der Kirch'", behauptete der Erzengel, als er sich zu Hans und Jüdenkrischan setzte. "Wühlen Löcher, als 92 wie um Satanas auszugraben. Das seh'n wir nicht mehr, dass die mal steht." Die beiden antworteten nicht, begrüßten ihn nur kurz mit Handschlag. "Möcht' wissen, warum Theobaldus heut' alle Gruppen bestellt hat. Alle! Da muss irgendwas sein." "Hoffentlich machen wir endlich mal was gegen die Judenschweine", forderte Krischan verbittert. "Mutter hat sich bei ihnen fünfzig Denare geliehen. Wisst ihr, wie viel sie zurückzahlen muss? Achtzig! Und zwar innerhalb der nächsten drei Monate, sonst werden 's hundert." "Gegen die Juden?" rief der Erzengel mit unverkennbarer Begeisterung. "Mir soll's recht sein. So 'n Pogrom is' was Großartiges. Außerdem gibt's beim Wucherjuden was zu holen. Nur leider verstecken die Mistsäcke ihre Reichtümer und jammern dir dann vor, nicht mal was zum Fressen zu haben. Vor ein paar Jahren nahmen wir uns mal einen ran, der die Kirche beschissen hatte. Der Kerl war unglaublich zäh. Kein Wort, was wir auch mit ihm anstellten. Zum Glück konnten wir dann seine Tochter schnappen, ein hübsches Mädel, noch Jungfrau. Die zogen wir aus und bestiegen sie einer nach dem anderen." Söhnchen wurde ganz aufgeregt, und seine Augen wirkten noch größer, als sie ohnehin waren. Der Erzengel bemerkte es, konnte sich vor Lachen kaum halten und schlug ihm seine Pranke schmerzhaft auf die Schulter. "Was das für'n Gefühl ist, wenn du so einer Hure einen reinrotzt, davon hat dir deine Mama wohl nichts erzählt?! ... Jetzt wird er auch noch rot! Was soll man mit einem wie dem bloß anfangen? ... Dieser elende Jude jedenfalls schwieg noch immer. Da mussten wir leider sein Töchterchen ein bisschen rösten." Hans empfand ein leises Unbehagen, nicht nur der Geschichte wegen sondern mehr noch wegen der Art, mit der sein Freund sie erzählte. Aber er beruhigte sich innerlich damit, dass die Wucherjuden Verdammte vor Gott wären und es nicht besser verdient hätten. "Seid gegrüßt Brüder! Ich habe eine Neuigkeit für euch." Die vier drehten sich um und gewahrten Eike. Selbstsicher und offenbar gut gelaunt stand er da, und um seinen Mund spielte ein leichtes Lächeln, das sich durchaus als hochmütig und spöttisch deuten ließ. Über der Nase des Erzengels gruben sich zwei Falten ein. Anfangs hatte er den Norddeutschen bewundert, zeitweilig fast verehrt. Mehr und mehr aber fühlte er sich gering geschätzt. Bei Hans hatte die Abneigung andere Gründe. Für ihn war Eike ein Verbrecher. Er kannte nicht seine ganze Vergangenheit, aber was er wusste, erschien ihm des Schlimmen mehr als genug. Er wünschte sich die Organisation sauber, würdig der großen Verpflichtung, für den Erzbischof, den Orden der Prediger und die römische Kirche einzustehen. Das hieß für ihn vor allem, dass es Regeln gab. Diese konnten einmal Härte fordern, ein andermal Bescheidenheit und Zurückhaltung. Ketzer, Juden und arbeitsscheue Stadtstreicher zu misshandeln, war erlaubte Härte, Diebstahl und Raub dagegen etwas Verabscheuenswürdiges. Sonderbarerweise aber stand Eike mit einigen Führern nach wie vor auf freundschaftlichem Fuß und wusste oft mehr als die meisten anderen. "Bruder Maginulfus wird predigen, unten am Rhein vor St.Maria ad Gradus." Bei Hans und dem Erzengel siegte die Neugier über das Misstrauen. "Aus welchem Anlass? Worüber?" "Was Genaues weiß ich auch noch nicht, aber soviel steht fest: Ihr könnt 93 euch einrichten auf eine Predigt, die in die Chroniken eingeht." "Und unsere Aufgabe dabei?" "Wir werden Hütehunde sein, Hütehunde, so wie immer." Das war eine Anspielung, von der keiner wusste, ob er sie abwertend oder ehrfürchtig gemeint hatte (wobei Eikes spöttischer Gesichtsausdruck für ersteres sprach). Die Mitglieder der Organisation wurden Canes genannt, was aus dem Lateinischen übersetzt Hunde bedeutet. Andererseits bezeichneten die Brüder des Predigerordens sich zuweilen selber (durchaus mit Stolz) als Domini canes, also Hunde des Herrn - ein Wortspiel mit dem zweiten Namen des Predigerordens: Dominikaner (nach dem Gründer Dominikus von Caleruega). Mithin stand Canes ursprünglich nicht für eine Beschimpfung sondern für eine Auszeichnung. IV W arum geht es nicht los?" murrte der Erzengel. Niemand konnte das verstehen. Von den höheren Führern war noch keiner im Saal. Immerhin erschien dann wenigstens Udo. "Worauf müssen wir warten?" erkundigte sich Jüdenkrischan. Der Gruppenführer wurde ein wenig verlegen, denn ihn band noch eine Schweigepflicht. Doch der Erzengel half ihm. "Bruder Theobaldus lässt uns nicht grundlos warten. Wenn es befohlen wird, bleibe ich hier die ganze Nacht." Er war ein völlig anderer Mensch, seit Udo vor ihm stand. So gern er Schwächere unterdrückte und quälte, so sehr brauchte er auch jemanden, der ihm Anweisungen gab. Oft reichten ihm ein Blick oder eine Geste. Nach Sinn und Zweck fragte er nie. Dem Gruppenführer wiederum gefiel das. So waren die Regeln. Theobaldus musste er gehorchen, über den Erzengel (und die anderen aus der Gruppe) konnte er herrschen. Auf Herrschen und Beherrschtwerden beruhte die gesamte Struktur der Canes. Die Sorge um seinen Respekt hinderte Udo allerdings, je über sich selbst zu sprechen. Er war ältester Sohn eines Kupferschlägers, hatte sich mit der Ar- beit in der dunklen, engen Werkstatt jedoch nie anfreunden können. Aus Mangel an einem Ausweg war er zunächst noch ein recht gelehriger, nicht ungeschickter Geselle gewesen. Dann aber hatten ihm die Dominikaner eine andere Zukunft versprochen, und seitdem lockerten sich die Bindungen zu seiner Familie. Der Vater fand sich inzwischen mit dem Verlust ab, und der zweitälteste Sohn nahm die Stellung des Erstgeborenen als Nachfolger des Meisters ein. Udo grollte seinen Eltern nicht, hatte sich mit ihnen auch niemals so bösartig gestritten wie Hans mit seinem Vater. Sie waren ihm einfach gleichgültig geworden. Seit er im Hospital wohnte, seit er bei den Canes sein Organisationstalent entfalten, seine kräftige Stimme gebrauchen und sein Machtbedürfnis ausleben konnte, seitdem fühlte er sich wie ein zweites Mal zur Welt gekommen. Sein Dasein hatte nun ein Ziel, das er für lohnenswert hielt. Die Ansichten der Prediger waren auch die seinen geworden. Seine Autorität sah der Gruppenführer übrigens nicht nur in Gefahr, wenn er sich zu vertrauensselig zeigte sondern auch, wenn er vor seinen Gefolgsleuten längere Zeit schwieg und somit nicht im Mittelpunkt stand. Deshalb nahm er die Pose eines Lehrmeisters ein und fragte: 94 "Was wisst ihr von den Albigensern?" "Sind das diese Franzosen, die sich selbst Katharer nennen?" fragte Hans. "Richtig." "Ich weiß nur, dass der Papst gegen sie zum Kreuzzug hat predigen lassen und dass die meisten von ihnen auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, wo sie auch hingehören." "Die meisten, aber leider nicht alle." "Erzähl uns von ihnen", forderte Jüdenkrischan. Der Erzengel und Söhnchen nickten zustimmend. "Immer wieder schickt der Teufel Kreaturen durchs Land, damit sie unter leichtgläubigen Leuten Verderben bringende Lehren verbreiten. Werden die falschen Propheten schnell gefangen und dem Richter übergeben, lassen sich die verlorenen Schafe leicht zur Herde zurückführen. Wehe aber, wenn solches nicht gelingt wie vor einem Menschenleben in Frankreichs Süden, wo die Verführer so zahlreich wurden, dass Priester und Bischöfe keine Macht mehr über sie hatten. Es kam so weit, dass Grafen und Herzöge vom rechten Glauben abfielen, dass die Ketzer sich unbehelligt zu einem eigenen Konzil zusammenfanden und dass sich hohe Geistliche zu einem Disput über Glaubensfragen herabließen." Udo sprach nicht mehr mit seinen eigenen Worten sondern mit denen des Theobaldus, seines Führers und Lehrers. Während er sich gewöhnlich keineswegs durch überragende Klugheit auszeichnete, war sein Gedächtnis beachtlich. Er behielt sogar längere Texte in fremder Sprache. Ob er vom Inhalt etwas verstand, spielte dabei keine Rolle für ihn. "Um dem Satansspuk ein Ende zu bereiten, sandte der Papst den Zisterzienserbruder Peter von Castenau nach Frankreich. Das war ein entschlossener Mann, der die nachlässigen und feigen Bischöfe absetzte und die Grafen in Christi Namen streng ermahnte. Raymund von Toulouse, den mächtigsten und uneinsichtigsten unter den Fürsten, die den Ketzern Schutz gewährten, exkommunizierte er. Mehr zu tun, war ihm jedoch nicht vergönnt, denn er wurde hinterhältig ermordet." Niemanden störte es, dass Udo plötzlich viel gelehrter sprach als sonst, nicht einmal den Erzengel. Berichte dieser Art gehörten zum Ritual der Gruppe. Nicht anders als der Erzähler bemühten sich auch die Zuhörer kaum darum, alle Zusammenhänge zu begreifen. Wichtig war allein, zwischen dem Lager des Teufels und dem Lager Gottes zu unterscheiden. "Der Papst beauftragte nun den Abt des Klosters Cîteaux, gegen die Ketzer den Kreuzzug zu predigen. Der Legat Amalrich übernahm die Leitung, Simon de Montfort sammelte ein Heer. Nach erbitterten Kämpfen wurden mehrere Burgen und Städte erobert und die Ketzer, die man darin fand, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Graf Raymund musste sich öffentlich demütigen und das Lande verlassen. Doch waren die Ketzer damit noch längst nicht endgültig geschlagen." Jüdenkrischan vertiefte sich so sehr in die Geschichte, die er hörte, dass er vorübergehend seinen betrunkenen Vater und das ruinierte Geschäft vergaß. Ihm war, als kämpfe er selbst mit in den Schlachten gegen die Ketzer, und er konnte sich gut vorstellen, dass auch die Canes einmal Teil eines Heeres wie das des Simon de Montfort sein könnten. Oh, seine Feinde würden nichts zu lachen haben! Seinen ganzen Hass würde er in seine Hiebe hineinlegen. Und gemessen am Ausmaß dieses Hasses würde sein Schwert wohl selbst durch das Eisen der besten Rüstungen dringen wie durch dürres Gezweig. 95 "Als sich das Heer der Kreuzfahrer zu zerstreuen begann, schöpfte Graf Raymund neuen Mut, verbündete sich mit König Peter von Aragonien und kehrte zurück. In der Schlacht bei Muret jedoch wurden die Ketzer abermals besiegt." "Das wird den Ketzern gewiss eine Lehre gewesen sein!" "Nicht so sehr, um nicht einen dritten Waffengang herauszufordern. Als der große Papst Innozenz starb, nahmen das die von den falschen Lehren noch immer besessenen Bürger von Toulouse zum Anlass, um Simon de Montfort aus der Stadt zu vertreiben. Graf Raymund kehrte ein zweites Mal zurück und eroberte sich in kurzer Zeit das ihm abgesprochene Lehen zurück. Der Krieg tobte erbitterter als je zuvor. Nicht einmal ein frisch aufgestelltes Heer des Königs von Frankreich vermochte etwas auszurichten." "Also sind die Ketzer immer noch nicht wirklich besiegt?" fragte Jüdenkrischan mit unverkennbarer Hoffnung. "Ja und nein. Raymund starb vor einigen Jahren. Sein Sohn unterwarf sich zu ehrenvollen Bedingungen der französischen Krone und gelobte, den Feinden der römischen Kirche keinen Schutz mehr zu geben. Die Ketzer haben sich aber in Höhlen und Burgen verschanzt und treiben von dort aus nach wie vor ihr Unwesen." "Warum erobert man die Burgen nicht?" "Das Land dort ist schroff und die Burgen stehen fast uneinnehmbar auf hohen Felsen. Ich weiß von einer, die ist dreifach geschützt durch ..." In diesem Augenblick betrat Theobaldus den Saal. Udo bemerkte ihn sofort, so eifrig er auch von den Albigensern erzählte. Er hatte ein besonderes Gefühl dafür, wann sein Führer sich in seiner Nähe aufhielt. Wie von einem unsichtbaren Mechanismus in Bewe- gung gesetzt, brach er mitten im Satz ab, sprang ruckartig auf und brüllte: "Gelobt sei Jesus Christus!" Die jungen Männer in den grauen Kitteln sprangen daraufhin ebenso mechanisch auf wie er. Die Gruppen lösten sich auf und gingen ein in einen einheitlichen Körper. "Wir schwören der Heiligen Römischen Kirche, dem Papst als Nachfolger Petri, dem Kölner Erzbischof als seinem getreuen Gefolgsmann sowie dem Orden der Prediger ewige Treue bis in den Tod hinein", klang es wie aus einem Munde. Die einzelnen Worte waren kaum zu verstehen. Der Sprechchor erinnerte an ein Donnergrollen und ließ die Mauern des ehemaligen Hospitals erzittern. Theobaldus lächelte leicht. So gefielen ihm seine Canes am besten, in Reih und Glied beieinander stehend wie ein Heer und einem Kommando gehorchend ohne Widerrede und ohne Zögern. Auf sein kurzes Nicken hin lösten sich alle aus der verkrampften Körperhaltung, blieben aber stehen. Er überzeugte sich noch kurz, dass jeder ihm die gebührende Aufmerksamkeit widmete, und verkündete dann mit schneidender, eher einer Strafpredigt angemessener Stimme: "In einer Woche wird Bruder Maginulfus gegen die Ketzerseuche in der Stadt predigen. Eine Gemeinde der verfluchten Albigenser hat sich in unseren Mauern eingenistet. Wir wissen noch nicht, wer ihr angehört, und wir wissen auch nicht, wo sich ihr Unterschlupf befindet. Die unheilvolle Saat ihrer Irrlehre aber beginnt schon aufzugehen. Wenn wir das Unkraut nicht ausraufen, solange es niedrig und vereinzelt wächst, überwuchert es bald die guten Pflanzen und erstickt sie. Bruder Maginulfus wird die Bürger zur Wachsamkeit mahnen. Die Ketzer indes fürchten ihn und seine Wortgewalt und trachten 96 ihm nach dem Leben. Mitten in der Predigt wollen sie ihn ermorden, um ihn so vor allen Leuten zum Schweigen zu bringen und behaupten zu können: 'Sein Tod beweist, dass er lügt, denn sonst hätte Gott ihn besser geschützt.'" Er ließ eine Pause entstehen und stellte befriedigt fest, dass die Canes noch immer mit gläubigen Blicken an seinen Lippen hingen und so bestürzt und empört waren, wie sie es sein sollten. "Ihr müsst dafür sorgen, dass den Ketzern ihr teuflisches Vorhaben misslingt. Von euch wird abhängen, ob das heilige Köln in die Hände des Satans gerät oder nicht." Die jungen Männer hielten den Atem an angesichts der Erhabenheit der ihnen zukommenden Aufgabe. Viele von ihnen bekreuzigten sich und murmelten Gebete. "Aber euch ist nicht allein das Leben des Bruder Maginulfus anvertraut. Wenn die Ketzer merken, dass ihr Mordplan scheitern muss, werden sie andere Schliche ersinnen, um die Predigt zu stören. Mischt euch also unter das Volk und gebt Obacht, dass kein Feind das Haupt zu erheben wagt." Am Schluss steigerte er seine Stimme noch einmal zu einem Brüllen. "Habt ihr verstanden, was euch aufgetragen ist?" Ein Chor tiefer Stimmen schmetterte ihm ein "Ja!" entgegen. "Ihr könnt jetzt gehen, bis auf die Gruppenführer." Die jungen Männer drängten zur Tür, bis nur noch sieben von ihnen übrig blieben, unter ihnen Udo. Sie stellten sich im Halbkreis vor den Dominikaner, unter dessen forschend von einem zum anderen wanderndem Blick sie sich um einen Eindruck besonderer Entschlossenheit bemühten. "Über das, was ich euch jetzt anvertrauen will, habt ihr Stillschweigen zu bewahren." "Jawohl!" antworteten die Sieben fast zugleich, und zwar viel lauter als erforderlich. "Unter den gewöhnlichen Canes sind viele innerlich noch nicht gefestigt genug, um die ganze Wahrheit mit all ihren scheinbaren Widersprüchen zu verstehen. Ihr werdet also mehr wissen als sie und müsst in geschickter Weise Einfluss auf sie nehmen, ohne sie aufzuklären." Er hielt inne und musterte abermals jeden von ihnen. "Ich verlasse mich auf euch. Die Predigt des Bruders Maginulfus wird sich nicht nur gegen die Albigenser in der Stadt richten und wird folglich nicht nur diesen missfallen. In Köln herrscht Aufruhrstimmung, nicht offen auf den Straßen und selten erkennbar deutlich, im Untergrund aber umso verderblicher. Der Rat und eine Gruppe einflussreicher Patrizier wollen den Erzbischof vertreiben und selbst die Macht übernehmen. Dafür hetzen sie die Bürgerschaft auf, und zwar mit wachsendem Erfolg. Alle Missstände lasten sie dem Stadtherrn an. Aber unsere Stadt wird bald sauber sein (ohne die heuchlerische Hilfe des Rates) und die Bürger müssen schon jetzt spüren, dass da eine Kraft ist, die aufzuräumen versteht. Die einen werden das mit Befriedigung beobachten, die anderen mit Furcht, je nachdem auf welcher Seite sie stehen. Ihr sollt also nicht still beobachten, sondern euch zu erkennen geben. Verleiht den Worten des Maginulfus zusätzlich Gewalt!" Den sieben jungen Männern war nicht anzusehen, was sie dachten, denn sie hatten ihre Gesichtszüge zu beherrschen gelernt. Im Innern aber versuchte jeder von ihnen, den tieferen Sinn der Worte des Theobaldus zu verstehen. Die meisten gaben schließlich auf, die politischen Hintergründe erfassen zu wollen, und nahmen lediglich zur Kenntnis, dass sie die Bürger einschüchtern soll- 97 ten (während der Predigt und auch noch danach) und dass es wohl eine zweite Säuberung geben würde, eine Säuberung, die sich vielleicht nicht nur gegen die Bettler in der Dom- und Palastgegend, sondern zum Beispiel auch gegen das Judenviertel oder gegen die Gauklertruppen richten würde. Als der Dominikaner sie fragte: "Kennt ihr jetzt all eure Pflichten?" antworteten sie mit einem kurzen "Ja!" Was noch zu sagen blieb, war rein organisatorischer Natur. Welche Gruppe beschützt den Prediger? Wie verteilen sich die anderen Gruppen über den Platz? Welche Zeichen werden zur Verständigung vereinbart? Welche Mittel sind am geeignetsten, um die Bürger zu beeindrucken? Was ist zu vermeiden, um sie nicht gar zu sehr zu verschrecken? Was soll am Ende der Predigt geschehen? Theobaldus hatte sehr präzise Anweisungen für jede Situation. 98 10.Kapitel I S tefanus starrte unverwandt auf das Bündel zu seinen Füßen wie auf etwas Fremdes, Verdächtiges. Er konnte sich nicht entschließen, es an sich zu nehmen und damit zu verschwinden, obgleich die Vernunft ihm das (angesichts des Toten) dringend anriet. Etwas ging in ihm vor, das er seit Jahren nicht mehr bei sich beobachtet hatte. Es schnürte ihm den Hals zu, lähmte ihn. Und es ließ sich nicht abschütteln. Die letzten Tage mit Franziska waren hässlich gewesen. Vor allem an ihr Schweigen erinnerte er sich, und an ihre Art, ihn zu mustern, aufmerksam aber kalt. Stumm hatte sie beim Essen am Tisch gesessen, stumm die ihr aufgetragenen Arbeiten erledigt. Wortlos war sie frühmorgens aufgestanden, wortlos am Abend ins Bett gegangen. Sie hatte ihn offenbar nicht einmal mehr gefürchtet, vielleicht im Vertrauen darauf, dass Gott stärker ist als der Teufel. Weil bei den Raubzügen jedes überflüssige Wort Gefahr heraufbeschwor, waren beide an eine Zeichensprache gewöhnt. Sie beherrschten diese Art der Verständigung so gut, dass sie im Alltag fast alles damit ausdrücken konnten. Nicht selten hatten sie, ohne sich dessen gewahr zu werden, in der Höhle ohne Notwendigkeit ebenfalls auf Worte verzichtet. Franziskas Schweigen in diesen Tagen aber war damit nicht zu vergleichen. Sie schwieg aus Trotz und Verachtung. Stefanus wollte ihr von seinem Leben erzählen. Ein fast unbezwingliches Bedürfnis drängte ihn dazu - etwas Neues, das ihn beunruhigte. Bisher hatte er sein Schicksal als sein größtes Geheimnis sorgsam gehütet, selbst wenn er mit anderen seines Schlages Bündnisse eingegangen war. Warum wollte er es ausgerechnet diesem Mädchen enthüllen, der Prinzessin, die sicher ohnehin nichts mit der Geschichte anzufangen wüsste? Aber er kam nicht los davon und litt darunter, dass sie ihm keine Gelegenheit ließ. Oben, am Ende der Treppe zur Marienkirche, kreischte eine Tür. Stefanus wurde aus seinen Gedanken gerissen, griff das Bündel und ging rasch (aber ohne sichtbare Hast) zu seinem Haus in der Rheingasse. Wenn er sich auf solche Weise rettete, tat er das Notwendige so sicher und unbewusst wie er atmete. Dann aber überfiel die Trauer ihn erneut. Mit nichts konnte er sich überzeugend einreden, dass er nicht brauchte, was er verloren hatte. Franziska war inzwischen zum Duffesbach hinab gelaufen. Hier, an der Grenze zwischen dem Mühlenviertel und den Anwesen der Patrizier, verflog ihre anfängliche Angst, Stefanus würde ihr folgen, um sie wie Benno zu erschlagen. Es war heller Tag und an der kleinen Brücke drängten sich die Menschen. Unermessliche Freude stieg in ihr auf. Sie blinzelte in die Sonne und begriff, dass der Sommer begonnen hatte. In der Gefangenschaft war ihr das Gefühl für die Zeit fast verloren gegangen. Die Gottesdienste an den Sonntagen und an den kirchlichen Festen gaben dem Leben einen Rhythmus vorausgesetzt man besuchte sie regelmäßig und mit innerer Anteilnahme. Zeiten der Mühen wechselten mit Zeiten der Freude. Der Klang der Glocke teilte auch den Tag ein. Ohne sie geriet alles aus dem Takt. Es gab nichts mehr, worauf es sich zu freuen lohnte, und das Dasein verlor Ziel und Sinn. Franziska fühlte sich wie aus dem Vorhof der Hölle gerettet. Wieder mutig geworden, ging sie zurück zur Gasse an der Marienkirche. Rund um den toten Benno hatten sich etliche, schreiend gestikulierende Leute versammelt. Die einen behaupteten, er sei vom Huf eines durchgegangenen Pferdes getroffen worden, andere sprachen von Raubmord. Franziska blieb nur kurz stehen. Sie wollte zum Forum, um Pentia und Ramira wieder zu sehen, überlegte es sich dann aber anders, drängte sich an der Menschentraube vorbei und stieg am Ende der Gasse die breite Treppe zur Marienkirche hinauf. Sie hatte nur ihre Neugier befriedigen wollen, doch nun, oben auf dem östlichen Vorplatz, war sie plötzlich bis ins Innerste beeindruckt. Mächtig und lieblich zugleich wölbten sich die drei Teile eines Kleeblattchores, und es gab nichts, was die Harmonie störte, nichts, woran der Blick nicht ungestört vorüber gleiten konnte, keine spitzen Giebel, keine sich in den Himmel reckende Türme. Die Gebäude, die sich links und rechts an die Seitenchöre anschlossen, gaben allem zusammen das Aussehen eines riesigen Engels, der mit ausgebreiteten Flügeln das Stift schützt. Ziemlich lange stand Franziska regungslos staunend auf dem menschenleeren, links und rechts mit Mauern und kleinen Toren begrenzten Platz vor jener Kirche, von der die Kölner mit fast ebenso viel Stolz sprachen wie vom Dom - Sankt Maria im Kapitol. Könige und Kaiser hätten sie ihres Besuches gewürdigt, hieß es, einmal sogar der Papst höchstselbst mit vielen Bischöfen als Begleitung. Die vierunddreißig hochadligen Damen, die dem Stift angehörten, standen im Mittelpunkt vieler Legenden und regten durch ihre Lebensart die Phantasie der einfachen Gemüter täglich aufs Neue an. Auch Franziska geriet ins Träumen. Ihre Vorstellungen vom Leben mit einem Gelübde waren noch recht verschwommen. Vom unbedingten Gehorsam gegenüber der Äbtissin oder Priorin hatte sie gehört, aber auch von erstaunlichen Freiheiten. Durch ihren Bruder kannte sie Gedichte einer gewissen Roswitha von Gandersheim. In Köln war die gewaltige Predigt einer fremden Äbtissin mit Namen Hildegard von Bingen noch nach über sechzig Jahren in aller Munde. Bald allerdings wurde Franziska sich wieder bewusst, dass sie in der Stadt als Vagabundin galt. Und selbst wenn sie durch ein Wunder einen glaubwürdigen Zeugen fände für ihre wahre Herkunft, würde ihr das kaum nutzen, denn als Tochter eines unbedeutenden Ritters war sie für ein Stift wie dieses noch lange nicht vornehm genug. Zurückgekehrt in die Wirklichkeit, durchdachte sie ihre Möglichkeiten. Ein besonderer Weg stand sogar den Ärmsten offen. Sie konnten sich selbst der Kirche schenken. Danach entrichteten sie einen Zins in Form von Wachskerzen, bekamen bestimmte Arbeiten zugewiesen und genossen als Ausgleich einen besonderen Schutz. Doch letztlich bedeutet dies eine Preisgabe der persönlichen Freiheit und das kam für Franziska nicht in Frage, selbst wenn ihre Lage noch verzweifelt werden mochte. Allerdings war die Aussicht, bei einer Rückkehr zu den Gauklern wieder Melanies Gehässigkeit ausgesetzt zu sein, auch nicht erquicklich. Um Zeit zu gewinnen, verschob sie alle anstehenden Entscheidungen auf den nächsten Tag und richtete sich am Fuße der Kirche für die Nacht ein. Am nächsten Morgen erwachte sie zeitig. Nach den Monaten in den düsteren Zimmern des Hauses an der Rheinstraße und im unterirdischen Labyrinth des Räubers freute sie sich über den Sonnenaufgang wie ein kleines Kind. In 100 dieser Stimmung ging sie geradewegs zum Forum. "Endlich bist du wieder einmal hier!" freute sich Pentia, die gerade die Treppe des Wohnwagens herunterkletterte. "Das ist schön! Bleibst du diesmal länger bei uns?" Sie umarmte und herzte die Schwester. "Wo ist Stefanus?" Gerade wollte Franziska zu einer Erklärung ansetzen, da traten Mario und Melanie heran. "Wir dachten, du bist krank, weil du so lange fort warst." "Ich bin gesund, nur ..." "Darfst du neuerdings allein umherlaufen? Dieser kauzige Kerl hat dich bewacht wie eine Gefangene! Nun ja, wenigstens schlägt er dich nicht." Franziska staunte, dass Melanie ihr gegenüber so gesprächig war, brachte es nun aber erst recht nicht über sich, die Wahrheit zu gestehen. Sie ließ alle in dem Glauben, nach wie vor bei Stefanus zu leben, blieb ein paar Stunden und schlenderte dann kreuz und quer durch die Stadt in der schwachen Hoffnung, dank eines glücklichen Zufalls eine An- stellung oder wenigstens eine kostenlose Herberge zu finden. Das Schicksal verwöhnte sie an diesem Tage jedoch nicht. Müde und verzagt setzte sie sich schließlich in der Nähe des Buttermarktes an den Rhein. Nur einen Steinwurf entfernt lagen zwei halb verrottete Kähne auf dem Trocknen. Die hatten sich Obdachlose als Nachtquartier ausgebaut. Als die Stadtstreicher von ihrer Betteltour auf den Märkten zurückkamen, konnte Franziska ihre Gesichter sehen - graue, zu Stein erstarrte Gesichter mit glanzlosen Augen darin. Da waren sie wieder, die Bilder vom Entenpfuhl! "Herr Jesus, was soll ich nur tun?" flüsterte das Mädchen. "Ob ich mich im Vertrauen auf deinen Schutz auf eigene Faust durchzuschlagen versuche oder ob ich mich einem Stärkeren anvertraue, am Ende lauert immer ein Unglück. Bitte gib mir ein Zeichen!" Das Forum im großen Bogen umgehend, kehrte sie zur Marienkirche zurück und verbrachte eine zweite Nacht an ihrem Fuß. II A m nächsten Tag erlebte Franziska eine Überraschung, denn auf dem sonst so stillen Vorplatz blieb sie diesmal nicht lange allein. Einzeln oder in kleinen Gruppen strömten Menschen herbei und drängten sich vor einer Seitentür. Es musste einen besonderen Anlass geben, dass man das Volk herein ließ, denn gewöhnlich war für Bürger die Pfarrkirche Klein Sankt Martin vorgesehen. Das Mädchen wollte sich das Ereignis (was auch immer es sein mochte) nicht entgehen lassen. Ehe sie aber den Leuten folgen konnte, musste sie ihr Schwert (das sie noch verborgen unter ihrem Umhang bei sich trug) irgendwo verstecken. Als geeigne- ter Ort dafür erschien ihr ein Gestrüpp am Duffesbach (etwas abseits von der Brücke und von dort aus nicht einzusehen). Auf dem Rückweg benutzte sie, um nicht zu spät zu kommen, eine Abkürzung durch ein Tor in der Römermauer. Von diesem hieß es übrigens, dass eben hier (in der Glanzzeit des Erzbischofs Reinald von Dassel nach dem zweiten Italienzug Kaiser Barbarossas) die Gebeine der Heiligen Drei Könige in die Stadt gebracht worden seien. Noch immer strömten die Leute in die Kirche hinein. Während sie vorwärts geschoben wurde, dachte das Mädchen an die Christvesper im Dom - damals, 101 als sie geglaubt hatte, sterben zu müssen. Ähnlich wie dort gab es auch hier einen Vorraum mit einem kleinen Altar. Was sie dann aber sah, war ganz anders. Zunächst gelangte sie in einen breiten, den gesamten kleeblattförmigen Chor umspannenden Gang. Mächtige Säulen trennten ihn vom Altarraum, wo die noch leeren Stühle der Stiftsdamen wie Throne standen und angesichts der Weite und Höhe ein wenig verloren wirkten. Das Volk sammelte sich in den Seitenschiffen. Franziska durchströmte ein beinahe wollüstiges Wohlbehagen. Nicht nur außen, auch innen war die Kirche geprägt von Ebenmäßigkeit und Harmonie. Im Chor wölbten sich über anmutigen, schlanken Säulen runde, braun und weiß gestreifte Bogen, während im Langhaus dicke Pfeiler ein Gefühl vollkommener Geborgenheit vermittelten. Durch die Fenster fiel sanftes Licht. Die Altäre der Kanonissen träumten im Dämmerschlaf. Auch die Bemalung der Decke und der Wände kündete von Frieden. An der Grenze von Chor und Langhaus war ein Deckenbogen so kühn gespannt, als wäre er an die Gesetze der Natur nicht gebunden. Am Hauptaltar, so erzählten sich die Leute, wache unsichtbar Tag und Nacht ein Engel. Franziska glaubte seine Nähe in diesem Moment unmittelbar zu spüren. Sie wollte nie wieder von hier fortgehen. Eine Frau in ihrer Nähe bemerkte ihr andächtiges Staunen, lächelte unwillkürlich und sprach sie dann an: "Das ist noch gar nichts! Du müsstest hier sein, wenn am Plektrudistag an jedermann Wein aus dem großen Pokal gespendet wird." "Plektrudis?" "Du kennst die heilige Plektrudis nicht? Sie hat hier das erste Kloster gegründet." "Welch wunderschöne Kirche!" "Eine ganz besondere Kirche. Sie sieht aus wie die Geburtskirche unseres Herrn Jesus in Bethlehem. Deshalb wird am Heiligen Abend der erste Gottesdienst nicht im Dom gefeiert sondern hier. Das Fenster zur Empore hin erinnert wiederum an den Dom zu Aachen, wo die deutschen Könige gekrönt werden. Die Krypta schließlich ist fast so groß wie jene der Kaiser im Dom zu Speyer." In diesem Moment stieg ein Gesang zur hohen, hölzernen Decke hinauf und in feierlichem Zug betraten (vom westlichen Haupteingang her) die Stiftsdamen die Kirche. Ihre prächtigen Kleider und ihr blitzender, schillernder Schmuck aus Gold, Silber und Edelsteinen löste ein leises Raunen aus, obgleich den Menschen, die hier standen, der Anblick längst hätte gewohnt sein müssen. "Vor hundert Jahren war Sankt Maria ein Kloster", flüsterte die Frau. "Viele Gebäude von damals stehen noch heute." Nachdem die adligen Stiftsdamen auf ihren Stühlen im Chor Platz genommen hatten, durfte das Volk auch das Mittelschiff nutzen, so dass das Gedränge nachließ. Franziska, noch immer trunken von ihren Eindrücken, vermochte kaum den Worten des Priesters zu folgen. Wieder stieg die Sehnsucht nach dem Kloster in ihr auf, viel stärker noch als zwei Tage zuvor und unabhängig von der Frage, inwieweit sie sich befriedigen ließ. Wie viel Unglück hatte Benno seine Jagd nach dem Geld gebracht! Wie verbittert war Stefanus geworden trotz seiner zusammen geraubten Schätze! Ramira dagegen strahlte durch Gottes Gnade von tief innen her Mut und Freude aus. Nur wer alles gibt, kann alles gewinnen, nur wer sich erniedrigt, wird aufgehoben werden. Nach dem Gottesdienst lief sie ganz benommen durch die Stadt, so dass 102 mancher sie wohl für eine Närrin hielt. In gewissem Sinne war sie tatsächlich närrisch - närrisch wie eine Verliebte. Leider war ihr Geliebter nicht von Fleisch und Blut sondern namenlos, unsichtbar, nicht fassbar. Am ehesten meinte sie ihn in der Marienkirche finden zu können. Als sie die Seitentür zwei Tage später zufällig offen fand, schlüpfte sie hindurch. Im nunmehr leeren Chor ließ sie sich vor dem Altar auf die Knie sinken und betete. In ihrer Verzücktheit glaubte sie, den wachenden Engel als hauchfeinen Schleier zu erkennen. Allerdings blieb sie nicht lange ungestört. Eine Hand packte sie derb am Kleid und zerrte sie hoch. Sie gehörte einer Frau mit strengem Gesicht in der Ordenstracht der Benediktinerinnen, die wohl einen wichtigen Dienst für die Stiftsdamen verrichtete. Jedenfalls sprach sie von der Kirche wie von ihrer eigenen. "Willst du uns bestehlen? Geh freiwillig, ehe ich dich greifen und einsperren lasse!" Franziska sah die Frau an und konnte lange nicht begreifen, was sie von ihr wollte, denn sie war sich im Herzen keinerlei Schuld bewusst. "Warum sind die Engel, die uns begegnen, immer nur die Cherubine, die uns aus dem Paradies vertreiben?" sagte sie schließlich traurig. "Willst du Gott lästern an diesem Ort?" schrie die Frau. Das Mädchen dachte bei sich, dass man in dieser Kirche nicht schreien sollte, erwiderte aber nichts mehr und trollte sich. III A m Abend besuchte sie die Gaukler und verbrachte bei ihnen auch die Nacht. Am nächsten Morgen aber begab sie sich beizeiten auf den Weg, etwas zum Essen aufzutreiben. Am Rhein trennte die mit Häusern überbaute, längst ihrer Funktion enthobene Stadtmauer zwei Straßen voneinander, wobei mehrere Tore einen bequemen Übergang ermöglichten. Die eine (unmittelbar am Ufer) bildete den Stapelplatz für mehrere aufeinander folgende Häfen, die andere verband eine Kette von Märkten. Über den Turmmarkt, den Knitmarkt, den Eisenmarkt und den Buttermarkt gelangte Franziska zur Einmündung der Salzgasse, wo man gerade ein Dutzend Weinfässer vorbeirollte. (Wein durfte grundsätzlich nur an der Salzgassenpforte eingeführt werden, wo der Weinsteuermeister saß.) Auf dem Fischmarkt packte sie ein solcher Heißhunger, dass sie das letzte verbliebene Geld aus den Taschen zusammensuchte und sich einen Hering braten ließ. Dann ging sie über die Mauthgasse, an der das Marktviertel endete, weiter in Richtung Dom. Mehrmals hatte sie das Gefühl, verfolgt zu werden. Zweimal glaubte sie, als sie sich kurz umdrehte, eine Gestalt schattengleich hinter einer Hausecke verschwinden zu sehen. Später aber sagte sie sich, dass sie sich wohl geirrt habe. Am alten Bollwerk, wo große Lagerhäuser für Fisch standen, versuchte sie, wenigstens für ein paar Stunden eine Arbeit zu finden, doch leider waren an diesem Tage nur kräftige Männer gefragt. Enttäuscht setzte sie sich am Kai auf einen Anlegepflock und beobachtete ein paar Stunden lang das Entladen der Schiffe im Fischereihafen. Am Nachmittag schlenderte sie zurück auf dem Weg, auf dem sie gekommen war. Unterwegs fiel ihr auf, dass etliche Menschen einem bestimmten Ziel zustrebten. Zunächst meinte sie, dass deren 103 Ziel die Samstagabendmesse im Dom wäre. Warum aber bogen sie gegenüber dem neuen Torturm am Hafenviertel in die Trankgasse ein? Diese ruhige, vornehme Straße führte an der Nordseite des Doms vorbei. Und warum tuschelten so erregt miteinander? Als sich Franziska aus Neugier anschloss, merkte sie bald, dass der Strom sich auf den Platz vor der Stiftskirche Sankt Maria ad Gradus ergoss, welcher an Ausdehnung den nahe gelegenen Altmarkt übertraf, aber im Gegensatz zu diesem kaum genutzt wurde. Die wohlhabenden Anwohner überquerten ihn mit feierlichem Ernst. Ab und an erschütterten ihn die Räder eines Wagens. Ansonsten harrte er darauf, dass die dreißig hochadligen Chorherren sich anlässlich frommer Prozessionen seiner erinnerten. Nichts sollte den hier beerdigten heiligen Bischof Agilolf in seiner ewigen Ruhe stören - und nichts die Kanoniker in ihrer Andacht. So erschien es beinahe unerhört, dass sich ausgerechnet hier eine schreiende, gereizte Menschenmenge zusammenfand. Franziska fühlte sich unwohl, doch zum Umkehren war es zu spät. Wie ein Sandkorn im Sturm wurde sie bis dicht vor die Mauern der Kirche geschleudert, wo sich ihr Unbehagen weiter steigerte, als sie eine Gruppe junger Männer in kurzen grauen Kitteln entdeckte. Plötzlich ging ein Raunen durch die Menge. Franziska reckte sich hoch und sah zwei Mönche in weißer Ordenstracht. Die Kirche stand an einem zum Rhein hin abfallenden, durch steinerne Stufen befestigten Hang - ein Umstand, der den beiden ermöglichte, von erhöhter Position aus zu den Leuten zu reden. Der eine war ein großer, stattlicher Mann und erinnerte in seiner Haltung mehr an einen Ritter als an einen Geistlichen. Der andere musste jener Prediger sein, den die vielen Leute auf dem Platz hören wollten. Da seine Kutte im Wind um ihn herum schlotterte wie bei einer Scheuche, hätte man ihn (an einem anderen Ort und weniger symbolträchtig gekleidet) für einen wunderlichen, armen Alten gehalten. Als er jedoch die Stimme erhob, zerstob dieser erste Eindruck schnell. Franziska mochte kaum glauben, dass ein so dürftiger Körper eine so gewaltige Predigt hervorbringen konnte. "Das Böse geht um. Der Teufel schickt seine Dämonen aus, und die Dämonen nehmen siebenmal sieben verschiedenerlei Gestalt an. Als schöner Sukkubus sielen sie sich in den Betten der Männer und pflanzen in ihre Herzen den Hass wider die christliche Kirche. Als Inkubus erscheinen sie nächtens den Weibern und zeugen Ungeheuer mit neun Schwänzen und dem Kopf eines Salamanders. Ich sah Trolle mit lüsternem Blick durch die Gassen streunen. Eulen fliegen um die Häuser. Es gibt der Zeichen so viele, dass niemand sie leugnen kann, wenn er nicht schon der Verführung erlegen und dadurch blind geworden ist." Maginulfus sagte nichts, was nicht jeder seiner Zuhörer schon in der eigenen Pfarrkirche gehört hatte, denn kein Priester versäumte, seine Gemeinde vor den Verlockungen des Teufels zu warnen. Die Worte gewannen jedoch aus dem Munde des Ketzerjägers eine solche Kraft, dass sie bis ins Herz der Leute trafen. Völlig verstört meinten manche, die dämonischen Heerscharen seien schon mitten unter ihnen, und bekreuzigten sich hastig. Auch Franziska blieb nicht ungerührt. Ihre Angst galt aber nicht nur den Unholden aus der Predigt sondern auch (sogar vor allem) dem Prediger selbst. Sie hatte plötzlich die Vision, er reite auf einem grässlichen Ungeheuer, welches ihr zuvor als Reittier des Antichristen an einer Kirchentür aufgefallen war, wo es mit seinen riesigen Krallen gera- 104 de einen Löwen in Stücke zerriss. Erschrocken fragte sie sich, was da in sie gefahren sei, dass sie in einem Dominikanerprediger den Antichristen zu erkennen glaubte. Hatte sie etwa die Dämonen schon in sich? "Wollt ihr erkennen, wer sich mit des Teufels Bestien abgibt, so schaut auf die Taten eines jeden! Zuvorderst Habgier und Verschwendungssucht unterscheiden die Diener des Bösen von rechtgläubigen Christen. Ich habe Weiber gesehen, die in ihrer Eitelkeit Kleid um Kleid kauften, ohne jede Notwendigkeit. Der Glanz ihrer goldenen Ketten und Ringe überstrahlt beim Gottesdienst das Tabernakel. Bei rauschenden Festen wird gesoffen und gefressen wie in Babylon, als die Schrift an der Wand erschien. Unzucht wird in so abscheulicher Weise getrieben, dass keine Worte sie beschreiben können." Plötzlich wurde klar, gegen wen die Predigt sich richtete, und auf diesen Moment hatten die Leute offenbar gewartet. Sie schrieen Verwünschungen gegen den Rat und gegen bestimmte angesehene Familien. Franziska vermutete, dass schon seit Tagen bösartige Gerüchte umgingen und dass dieser Mönch, der fromme Leidenschaft vorspiegelte, in Wahrheit einen Plan verfolgte und die Bürger mit Vorbedacht aufhetzte. "Woher stammt der Reichtum, den diese Leute verprassen? Durch Betrug haben sie ihn zusammengescharrt. Der Herr lehrte uns, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Diese Teufelsjünger aber betrügen ihren Nächsten und mästen sich dabei." Jetzt begannen die Canes, den Prediger mit Zwischenrufen zu unterstützen. Die Handwerker und Straßenhändler, welche die Mehrheit auf dem Platz bildeten, ließen sich leicht anstecken. Es waren aber auch Anhänger des Rates anwesend, die sich in den Pausen zwi- schen den Sprechchören nicht viel weniger lautstark gegen die Anschuldigungen verwahrten. "Ihr sprecht vom Erzbischof und von den Festen in seinem Palast! Bürger! Wer ist es, der Euch betrügt? Ist es der Kaufmann, der von weither unter unzähligen Gefahren all das heranschafft, was ihr längst für selbstverständlich haltet, obwohl ihr es selbst nicht herstellen könnt - Salz, Eisen, Gewürze - oder ist es der Pfaffe, dem ihr alles hingebt, damit er für euer Seelenheil betet, und der so sündhaft lebt, dass sein Gebet nichts bewirkt?" Durch solche Reden wurde mancher, der gerade noch ganz im Banne der Predigt stand, wieder schwankend. Maginulfus jedoch ließ nicht zu, dass die Stimmung umschlug. Unvermittelt begann er von den Ketzern zu reden - dabei geschickt den Anschein erweckend, dass diese etwas mit dem Rat zu tun hätten, ohne diese ungeheuerliche Anschuldigung offen auszusprechen. "Wen kann es angesichts all dieser Gräuel noch wundern, dass die widerwärtigste aller Sekten, die der Katharer nämlich, sich abermals in der Stadt ausbreiten konnte, nachdem sie unter dem großen Erzbischof Reinald von Dassel für alle Zeit von hier verbannt zu sein schien? Bei ihren Zusammenkünften weilt unter ihnen ein schwarzer Kater, größer als ein Kalb, und seine Augen glühen. Der Kater aber ist niemand anderer als der Teufel. Er hebt den Schwanz, damit jedermann sein stinkendes Hinterteil sehen kann und seine Jünger es küssen können. So bekennen sie ihren widerwärtigen Glauben. Dieser Kater gab ihrer Sekte auch den Namen." Die Canes nahmen die Wende in der Predigt zum Anlass, mit dem Ruf: "Schlagt die Ketzerfreunde tot!" gewalttätig gegen die Gegner des Erzbischofs vorzugehen. Abermals rissen sie dabei viele der Handwerker und Straßenhänd- 105 ler mit, so dass an verschiedenen Stellen des Platzes Schlägereien entbrannten, und (in deren Folge) ein unbeschreibli- ches Gedränge entstand. Gellende Schreie zerrissen die Luft. Die Begeisterung ging über in Panik und Entsetzen. IV F ranziska wurde gegen die Kirchenmauer gequetscht und suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, dem Inferno zu entkommen. Dabei entdeckte sie plötzlich mitten in der Menge ein bekanntes Gesicht. Zuerst sah sie es nur für einen winzigen Moment und glaubte an eine Täuschung. Dann aber fand sie es ein zweites und drittes Mal. Der blonde Junge, der ihr schon einmal das Leben gerettet hatte, kämpfte sich Schritt für Schritt durch das Gewühl hindurch zu ihr hin. Er erschien ihr wie ein Schutzengel, und sie wäre nicht erstaunt gewesen, hätte er plötzlich Flügel ausgebreitet, um durch die Luft zu ihr zu gelangen. Ein neuer Stoß riss sie jedoch wenig später aus seiner Nähe fort. Hilflos konnte sie nur noch Acht geben, dass sie nicht stürzte. Zu ihrem Glück wurde sie in die Nähe des Ausgangs an der Trankgasse gespült und konnte sich aus dem schlimmsten Gedränge befreien. Wo aber war der blonde Junge geblieben? War er in eine der Schlägereien hineingeraten? Warum sorgte sie sich eigentlich so sehr um ihn? Weil er ihr damals geholfen hatte, aus Dankbarkeit also, oder weil sie noch irgendetwas von ihm erwartete? Warum musste sie in dieser ohnehin so verwirrenden Woche nun auch noch ihm begegnen? Bennos Tod, die endgültige Trennung von Stefanus, der Gottesdienst in der großen Marienkirche, das herrliche Gefühl, als sie sich dem Stift schenken wollte, und die bittere Enttäuschung, als sie vom Altar weggerissen und aus der Kirche hinausgeworfen worden war, die Predigt, bei der sie in einem Dominikaner den Teufel zu erkennen geglaubt hatte. Warum ließ Gott das alles auf sie herabstürzen, ohne ihr Zeit zu geben, über den Sinn nachzudenken? Sie wollte endlich zur Ruhe kommen, musste aber in einer Nische ausharren, während Massen fremder Menschen mit wutverzerrten Gesichtern an ihr vorbei rannten. Plötzlich fasste sie jemand am Arm. "Komm mit! Es ist besser, wenn wir von hier verschwinden." Er war es. "Wie ... wie hast du mich gefunden?" Er lachte hell und klar. "Das war nicht besonders schwer. Es sieht ja fast so aus, als ob du auf mich gewartet hättest." "Nein, das ist nicht wahr. Ich konnte überhaupt nicht weg von hier. Wie kannst du nur denken, dass ..." Sie merkte, dass sie sich ganz unsinniger Weise so sehr empörte und brach ab. Ohne noch länger zwecklos zu versuchen, Ordnung in ihre Gefühle zu bringen, folgte sie dem Jungen mit der Zutraulichkeit eines Kindes. "Du beobachtest mich schon den ganzen Tag über. Habe ich Recht?" Er stutzte. "Aber nein. Ich dachte, du bist längst nicht mehr in der Stadt und war wirklich erstaunt, dich bei der Predigt plötzlich zu sehen." "Aber du musst das doch gewesen sein! Der einzige, der so etwas außer dir hätte tun können, der ist tot. Mich kennt kaum jemand hier in Köln." "Vielleicht bist du gar nicht verfolgt worden." Sie erwiderte nichts mehr, ließ sich innerlich aber von ihrem Einfall nicht 106 abbringen. Die Vorstellung, dass er schon seit dem Morgen, vielleicht seit Wochen in ihrer Nähe gewesen sei und sie unerkannt beschützt habe, durchrieselte sie so angenehm wie heiße Milch mit Honig. Des Grübelns überdrüssig, empfand sie nur noch tiefe Dankbarkeit, dass sie da jemand sanft und dennoch entschlossen einfach bei der Hand nahm und führte. Beide folgten einer langen Straße mit schmucken Bürgerhäusern auf beiden Seiten, die in leichtem Bogen vom Dom weg nach Norden in ein dem Mädchen noch völlig unbekanntes Viertel führte. An ihrem Ende weitete sie sich zu einem kleinen Platz. Dort sagte der Junge: "Warte hier auf mich! Ich habe etwas für meinen Vater erledigt und muss ihm kurz berichten. Es dauert nicht lange." Dann verschwand er nach rechts, wo Franziska eine große Kirche über die Giebel der Wohnhäuser ragen sah. Neugierig folgte sie ihm ein Stück, verlor ihn aber bald aus den Augen und kehrte um. Ringsherum sah sie großzügig angelegte Grundstücke mit schmucken Häusern, ausgedehnten Gärten und mehreren Nebengebäuden. Die Straßen waren ungewöhnlich sauber und gepflegt. Nach links zum Beispiel führte eine, an deren Rand Wacholdersträucher wuchsen. Franziska schloss das Viertel sofort ins Herz, nicht nur weil er hier wohnte. Übrigens kannte sie noch immer seinen Namen nicht! Das sollte sich ändern. Als er wiederkam, fragte sie ihn sofort danach. "Raimund", antwortete er. "Raimund Cranboim." "Raimund ... ein merkwürdiger Name." "Oh, in Frankreich heißen viele so." "Du bist Franzose?" Er musste lachen, wobei seine Gesichtszüge noch zarter wirkten als ohnehin. Dabei war er ganz sicher drei Jahre älter als sie und galt somit den Sitten nach schon als ein Mann. "Ich bin ein echter Kölner. Der Großvater meiner Mutter allerdings ist als Kind mit seinen Eltern aus Frankreich hierher gekommen, und der hieß eben Raimund. Aber nun musst du auch was erzählen. Oder nein! Lass mich raten! Du kommst aus dem Norden, vielleicht aus Hamburg. Deine Eltern waren reiche Kaufleute. Dann ist etwas Schlimmes passiert. Sie sind Bankrott gegangen ..." "Hör auf! Du kommst ja doch nicht drauf. Ich bin nämlich eine Adlige. Ja! Ich heiße Franziska von Westerholt, mein Vater hat eine Burg nahe bei Bremen." Raimund sprang vor sie hin, kniete vor ihr nieder wie in einer Posse und rief feierlich: "Können Eure Hoheit mir mein ungebührliches Betragen entschuldigen und so gnädig sein, hiermit - wenn auch viel zu spät - meine Huldigungen entgegenzunehmen?" Er vermochte dabei derart ernst zu bleiben, dass sie vor Lachen kaum noch Luft bekam. "Was bist du nur für ein seltsamer Kerl! Übrigens kannst du getrost wieder aufstehen. Mein Vater ist kein Graf sondern nur ein Lehnsmann, ein Ritter." "Warum sagst du 'nur'? Lehnsritter zu sein, ist eine Ehre, für die manch reicher Bürger sein halbes Vermögen hergegeben hat." "Nun ja. Das mag schon sein. Aber mir nutzt das im Moment leider wenig. ... Ach, lass uns über etwas anderes reden!" Die Ausgelassenheit war jedoch ein wenig verflogen. Schweigend gingen sie nebeneinander die Straße mit den Wacholdersträuchern entlang. Auf den Ästen der Sträucher saßen unzählige Krähen. 107 "Immer, wenn ich hier vorbeikomme, frage ich mich, warum ich ausgerechnet so heiße wie diese schwarzen Viecher. Es ist aber nun einmal so. Die Bäume nennt man 'Krähenbäume', die Straße hier entsprechend 'Unter den Krähenbäumen', und den Urgroßeltern meines Vaters, die dort drüben einst das erste größere Anwesen unserer Sippe kauften, fiel nichts besseres ein, als sich selbst 'von den Krähenbäumen' zu taufen." "Auf den Namen kommt es doch nicht an! Zum Glück siehst du ja nicht so aus wie die Krähen." Franziska sah ihn verstohlen immer wieder an. Seine Augen waren blau, und es spiegelte sich etwas darin wieder, das sich am besten mit dem Wort fröhlich beschreiben lässt. So wie Ramiras Blick immer ein wenig beklommen stimmte, vermittelten Raimunds Augen von Natur her Fröhlichkeit. Mindestens ebenso aber hatten es Franziska seine nackenlangen, hellblonden Haare angetan. So weich und seidig waren sie, dass sie das Verlangen, über sie hinweg zu streichen und sie durch die Finger gleiten zu lassen, nur mit Mühe unterdrücken konnte. Wer sie beide sah, hielt sie gewiss für ein schönes Paar. Mit ihrem tiefschwarzen Schopf stellte sie das ideale Gegenstück zu ihm dar. Dass sie vielleicht ein wenig zu kräftig war als Braut eines Patriziersohnes, fiel da nicht mehr ins Gewicht. Da gebot sie sich erschrocken Einhalt. Was dachte sie da bloß für wirres Zeug! Wie kam sie darauf, dass er ein Patriziersohn sei? Wieso sollte er sie heiraten wollen? Unerfahren und hungrig nach Liebe und Zärtlichkeit, war sie völlig durcheinander geraten. Nachdem sie sich von Raimunds Anblick endlich losgerissen hatte und umsah, stellte sie nicht ohne Erschrecken fest, dass sie sich am Ende der Straße unter den Krähenbäumen mitten auf dem Eigelstein wieder fand und zwar ausgerechnet gegenüber der Einmündung des Entenpfuhl. Genau hier hatten die Canes auf Bettler gelauert. Raimund bemerkte ihre zwiespältigen Gefühle und beruhigte sie lächelnd. "Du glaubst doch nicht, dass ich mit dir jetzt zu den Enten gehen will?!" Tatsächlich mündete unmittelbar neben dem Entenpfuhl eine zweite Straße ein, die sich im spitzen Winkel schräg nach rechts von ihm entfernte. Sie war auf beiden Seiten bebaut, wobei es zwischen den Häusern größere Lücken gab. In ihnen wuchsen Sträucher und Bäume, vor allem Weiden. "Das ist die Weidengasse", sagte Raimund. "Leider verkommt sie ein bisschen - wegen der Stadtmauer. Seit ein paar Jahren kommt man vorn nicht mehr durch, und die besser gestellten Leute verschwinden nach und nach. Aber ein Hauch alter Würde steckt noch drin in der Gegend." Vor einem Eckhaus blieb er stehen und öffnete die Tür zum Keller. "Nur vorübergehend", entschuldigte er sich. "Hier hast du ein Dach über dem Kopf, bis ich eine bessere Bleibe für dich finde. An den Mietshäusern der Herren von Klockring in der Nachbarschaft darfst du dich nicht stören. Die Leute, die da wohnen, sehen zwar nicht sehr Vertrauen erweckend aus, sind aber anständig, arme Leineweber zumeist." Franziska erwartete einen Lagerraum (ähnlich dem der Jevers) und staunte, als sie eine Wohnstube betrat (wenn auch eine etwas merkwürdige). Drei Bänke standen darin, breit genug, um darauf zu schlafen, dazu ein Tisch und zwei unterschiedlich große, einfache Truhen. Das alles sah sauber aus, und in der Luft lag (ganz leicht, aber doch unverkennbar) der Geruch von Gebratenem. Wer wohnte hier (oder hatte es bis vor kurzem getan)? Später fiel ihr noch auf, dass fast jeglicher Schmuck fehlte. 108 Wer nicht wusste, wo er die Nacht verbringen sollte, fand alles vor, was sein Herz begehrte. Auf Dauer hingegen konnte sich hier niemand wirklich wohl fühlen. Diente der Raum vielleicht anspruchslosen Pilgern als Unterkunft? Raimund diese Fragen zu stellen, erschien Franziska jedoch unschicklich. Es wäre vielleicht der Eindruck entstanden, sie wolle sich beschweren. Zudem lag ihr etwas anderes noch viel mehr auf dem Herzen. "Was hat dieser Dominikaner eigentlich gepredigt? Ich meine: Was wollte er wirklich sagen? Die Leute auf dem Platz waren alle so wütend, als ob ... ein böser Geist umgegangen sei." Raimund, der sich gerade damit beschäftigte, Brot, Käse und ein wenig Fett auf den Tisch zu stellen, hielt inne und sah das Mädchen ernst, vielleicht sogar ein wenig erschrocken an. Für einen Moment verlor sich die Fröhlichkeit in seinen Augen, kehrte aber schnell zurück. "Maginulfus ist ein Irrer. Er sieht überall den Teufel, körperlich mit Schwanz, Hörnern und Schwefelgeruch. Irgendwann werden das die Leute hier hoffentlich merken und sich sein Gefasel nicht mehr anhören." "Vorhin haben sie ihn angehört wie einen Propheten." "Sie hätten jeden angehört, der irgendetwas über den Rat oder den Erzbischof oder alle beide erzählt. Die Stimmung in Köln ist schlecht. Die Geistlichen und die Bürgerlichen sind einander spinnefeind. Vielleicht wird Blut fließen wie damals, als der zweite Anno nur mit Mühe und Not sein Leben behielt." "Es gab schon einmal einen Aufstand?" "Mehr als einen! Der gegen Anno aber war der größte. Damals kamen die Bürger sogar für ein paar Tage an die Macht. Wahrscheinlich würden die Patrizier sofort wieder losschlagen, wüss- ten sie die Handwerker und Knechte sicher auf ihrer Seite. Die aber werden vom Erzbischof und von den reichen Kaufherren gleichermaßen drangsaliert." "Und jetzt versucht jede Partei, ihnen einzureden, dass sie nur unter den jeweils anderen zu leiden hätten." "Genauso ist es." "Und was hat das alles mit den Ketzern zu tun?" "Gar nichts." "Trotzdem hat der Dominikaner davon gesprochen! Warum?" "Er ist ein Irrer. Wie soll ich dir erklären, was im Kopf eines Irren vorgeht?" Franziska überzeugte das nicht, doch sie wollte ihn nicht mit einem ihm offenbar unangenehmen Thema verärgern und sagte beiläufig: "Ich bin seit genau achtzehn Tagen vierzehn Jahre alt." "Du bist erst vierzehn? Ich habe dich viel älter geschätzt." "Viele halten mich für älter", erwiderte sie und fühlte sich geschmeichelt. "Aber es ist gut, dass ich erst vierzehn bin. Sonst müsste ich mich schon bald sorgen, keinen Mann zu bekommen." Er hob verständnislos die Schultern. "Willst du dich einem beliebigen Mann hingeben, nur weil es die Sitte vorschreibt? Es gibt viele schlechte Sitten. Manche davon sind sogar eine Sünde vor Gott." "Du hast Recht." Sie aßen miteinander, lachten und scherzten. Raimund legte es allerdings nicht darauf an, sie in Verlegenheit zu bringen. Seine Späße waren niemals zweideutig. Durch nichts wurde der Anstand verletzt, so verfänglich die Situation an sich auch war. In ihrer Verwirrung empfand Franziska zunächst Dankbarkeit für diese Zurückhaltung, denn durch sie blieb sie vor einer denkbaren Unüberlegtheit 109 bewahrt. Später freilich, als sie allein in der fremden Stube saß und das Hereinbrechen der Nacht abwartete, grollte sie ihm ein wenig, dass er nicht wenigstens den Versuch unternommen hatte, sie zu verführen. 110 11.Kapitel I D ie Predigt des Maginulfus auf dem Platz vor St.Maria ad Gradus hatte die Stadt in Aufruhr versetzt. Angesehene Bürgerfamilien wurden öffentlich verdächtigt, zu den Katharern oder einer anderen Sekte von Teufelsanbetern zu gehören. Es kam zu Morddrohungen, sogar zu Anschlägen. Die Anhänger des Rates ließen mit einer Antwort nicht lange auf sich warten und beschuldigten Persönlichkeiten aus der Umgebung des Erzbischofs, bei perversen Orgien junge Mädchen aus der Stadt zu schänden und anschließend bestialisch zu ermorden. Die jungen Burschen, die sich zu den verschiedenen Parteien bekannten, lieferten sich mehr denn je blutige Straßenschlachten. Bei den Canes wuchs das Selbstbewusstsein, denn sie fühlten sich bestätigt - auch in ihren Gewalttätigkeiten. Das war keine gute Stimmung für Rechtlose wie die Gaukler. Fast immer entlud sich der Volkszorn am Ende auf sie, gleichgültig ob sie sich auf die Seite eines der Gegner geschlagen hatten oder neutral geblieben waren. Wo aber gab es überhaupt einen Ort, wo sie sich ganz ohne Furcht aufhalten konnten? Auf einsamen Straßen lauerten ebenso viele Gefahren. In der reichen Stadt Köln brauchten sie zumindest nicht zu hungern, verdienten sogar genug, um Vorräte für Notzeiten anzulegen. Es war Sommer. An manchen Tagen barst der Altmarkt vor Menschen. Besonders der Zugang zum Dom, die für ihre Enge berüchtigte Bechergasse, wurde oft zum Schauplatz wilden Gedränges. Zwischen Brunnen und Pranger aber fanden die Gaukler meistens noch genug Platz für ihre Vorführun- gen. Außer den Frischfischhändlern, die das Wasser brauchten, mieden die Kaufleute dieses Areal. Vielleicht rief der Schandkäfig ihr schlechtes Gewissen und damit ihre heimlichen Ängste wach. Sobald die Gaukler auftraten, lockten sie einen dichten Ring von Zuschauern an. Hatte die Begeisterung den Höhepunkt erreicht, gingen Ramira und Pentia durch die Reihen und sammelten ein, was die Bürger zu geben bereit waren. In den vergangenen Jahren hatte es in der Gegend keine Kriege, keine Seuchen und keine schweren Unwetter gegeben. Die Speicher waren gefüllt und die Leute sprachen nur noch von Luxusdingen, weil ihnen das zum Überleben Notwendige als selbstverständlich galt. Es hätte sie mithin nicht schmerzen dürfen, ein paar Künstlern für ihre gute Vorstellung den gebührenden Lohn zu geben. In Wahrheit aber erwachte plötzlich die Sparsamkeit in ihnen, und sie fanden hundert Argumente beim Feilschen mit sich selbst. ("Die kriegen von den vielen anderen schon mehr als genug!"; "Die haben ganze Truhen voll Schmuck aus Gold und Silber in ihren Wagen versteckt."; "Die haben ihren Lohn längst bei uns gestohlen.") Der letzte Vorwurf war übrigens nicht ganz unberechtigt. Für fahrendes Volk gehörte alles, was unbeaufsichtigt herumlag, demjenigen, der es fand und an sich nahm. Allerdings stahlen sie (anders als marodierende Waffenknechte) niemals gewalttätig. Die Hartherzigkeit der Leute zu durchbrechen, war Ramiras Aufgabe. Sie hatte ein Gespür für den Charakter desjenigen, vor dem sie stand, und stellte sich ganz auf ihn ein. Dem Machtbesessenen unterwarf sie sich, dem Einge- bildeten gab sie sich hochachtungsvoll, dem Lüstling schenkte sie ein aufreizendes Lächeln. Wie in einem Zauberspiegel hätte jeder an ihrem Gebaren seine Laster ablesen können. Niemand jedoch verstand diese Botschaft - zum Glück. Pentia war beim Geldeinsammeln ebenfalls durchaus geschickt, jedoch niemals ganz so erfolgreich. Da sie zudem bei den Auftritten nach wie vor nur zu Hilfestellung eingesetzt wurde, fühlte sie sich ein wenig unwohl, und so hatte sie auf eigene Faust Kunststücke zu üben angefangen - zumeist in der Nähe des Lagers auf dem Forum, mitunter auch mitten auf dem Altmarkt. Dabei kam sie zu völlig unerwarteten Erfolgen. Gerade weil ihr so vieles misslang, fanden die Leute sie drollig und blieben, belustigt (und auch ein wenig mitfühlend), vor ihr stehen. Sie war ein hübsches Kind - zierlicher als ihre Schwester, schüchtern, aber immer zu einem freundlichen Lächeln bereit; das ebenmäßige Gesicht umrahmt von den kurzen, sehr dichten, leicht welligen schwarzen Haaren. Jeder mochte sie ihrer offenkundigen Friedfertigkeit wegen, und nicht wenige gaben ihr ein Almosen als Lohn für ihre Unverdrossenheit. Mit ihrem ersten selbst verdienten Geld, hatte sie sogar Melanie überzeugt. Wie es deren Wesen entsprach, übertrieb sie die Zuneigung nun ebenso wie die Abneigung zuvor. Sich mit Melanie gut zu stehen, war übrigens vorteilhaft, denn sie herrschte nahezu unbeschränkt über die Vorräte. Auch beim Kochen, Waschen und Putzen, den Verrichtungen des Alltags, die auch anderswo den Frauen zufielen, ließ sie sich von niemandem hineinreden. Die Bürgerinnen pflegten allerdings die Nase über sie zu rümpfen. Gaukler zogen umher und lebten unter freiem Himmel. Ihre Wagen nutzten sie als Schutz vor Kälte, Wind und Regen. Sie fühlten wie kaum jemand sonst, dass alles im Fluss ist und nichts sich halten lässt. Folglich sahen sie keinen Grund, wieder und wieder zum Glänzen und Blitzen zu bringen, was durch Gottes Willen offenbar nicht zum Glänzen und Blitzen geschaffen war. Auf Wanderschaft fiel das nicht auf, weil es sich aus den Umständen erklärte. In der Stadt freilich war das anders, und so konnten die Bürgerinnen ihren Töchtern am Beispiel jener Gauklerin verständlich machen, was eine schlechte Hausfrau ist. Melanie war mit den Vorurteilen aufgewachsen und im Laufe der Jahre unempfindlich dagegen geworden. Es gab aber neuerdings noch einen anderen Grund für ihre gute Stimmung selbst angesichts gröbster Beschimpfungen sie erwartete von Mario ihr erstes Kind. Schon im fünften Monat schwanger, fiel ihr die Arbeit allmählich schwer. Aber sie legte Wert darauf, weiterhin ihren vollen Anteil für die Gemeinschaft zu leisten. Das Lager auf dem Forum feni bestand inzwischen aus sieben Wagen, in denen zusammen fünfzig Menschen lebten. Das Verhältnis der Beldinis zu den Nachbarn war unterschiedlich. Mit einigen von ihnen traten sie gelegentlich auf, mit anderen sprachen sie kaum. Melanie betreute häufig die kleineren Kinder, wofür andere Frauen ihr beim Tragen des schweren Waschzubers halfen. Am Abend nach der letzten Mahlzeit ging jeder seine eigenen Wege. Alexander saß oft an einem einsamen Platz am Rhein. Melanie und Mario genossen die wenigen gemeinsamen Stunden, scherzten miteinander, sprachen über die Zukunft zu dritt. Pentia und Ramira zogen sich meistens in den Wagen zurück. "Stimmt es, dass der Stammvater aller Beldinis aus Italien nach Deutschland gekommen ist?" fragte Pentia, während sie sich auf dem Bett aus- 112 streckte und hinaufblickte zu dem Vogelkäfig an der Decke. "Ja. Alexander sagt, dass er ein großer Künstler war. Einmal hat ihm ein Herzog vor allen Leuten einen silbernen Teller geschenkt. Aber das ist lange her. Es heißt, dass er als Kind noch die Ritter zum ersten Kreuzzug aufbrechen sah. Seine Frau Fatima kam aus dem fernen Arabien. Mit ihr hatte er drei Söhne, die allesamt Gaukler geworden sind wie er - Giorgio, Antonio und Gioseppo." "Und von welchem der drei stammst du ab?" "Von Gioseppo." "Das war gewiss eine glückliche Zeit damals." "Aber mit einem bösen Ende. Als der Papst zum zweiten Mal das heil'ge Grab wollt' befreien lassen und allenthalben bewaffnete Männer durchs Land zogen, wurden (wieder einmal) viele Juden erschlagen, weil die ja schuld sind am Tod von unser'm Herrn Jesus. Ein Erzbischof mit Namen Arnold aber schützte die Kölner Juden, indem er sie in seine Burg ließ. Aus Ärger darüber haben die Kreuzritter sich an die Bettler und Gaukler gehalten." "War auf der Burg kein Platz mehr für sie?" "Die Juden haben dem Erzbischof Geld gegeben. Die großen Herren machen nichts für umsonst." "Was ist geschehen mit den Beldinis?" "Giorgio entkam mit denen Seinen über die Alpen nach Italien. Antonio verlor seine ganze Familie, konnte selbst aber fliehen. Später heiratete er ein zweites Mal. Gioseppo schließlich wurde in der Gefahr zu einem richt'gen Helden. Er stellte sich den Angreifern entgegen, kam um dabei, rettete aber seine Frau und seine beiden Kinder." II E ines Abends erschienen zwei junge Männer im Lager und verlangten, den Sippenältesten zu sprechen. Niemand wusste so recht, wen sie damit meinten. Schließlich schickte jemand sie zu Alexander. Den fragten sie geradezu: "Dieses rothaarige Mädchen, das jeden Tag auf dem Altmarkt am Brunnen ihre Kunststücke vorführt, gehört das zu deinen Leuten?" Der Alte nickte zögernd und fragte sich, was die beiden im Schilde führten. "Unser Dienstherr schickt uns im Namen der Bürger vom Stadtteil Niederich." "Dort sind wir noch niemals gewesen!" behauptete Alexander sicherheitshalber. Dass sie sich ausdrücklich nach Ramira erkundigten, beunruhigte ihn. "Nun, das ist es ja eben. Die Bürger aus Niederich wollen eine Vorführung von euch erleben, und zwar auf einem besonderen Platz, wo sie alle zusehen können, ohne sich drängen zu müssen." Der Alte konnte nur mit Mühe seine Freude unterdrücken. Im Gegensatz zu seiner Behauptung kannte er das reiche Viertel sehr gut, und wusste, welch gute Gelegenheit sich ihnen bot. Solange jedoch der Preis nicht feststand, spielte er Gelassenheit vor. "Unser Dienstherr ist überzeugt, dass ihr euch über die Einladung sehr freuen werdet." Alexander wiegte den Kopf. "Wir sind zufrieden. Die Leute auf dem Altmarkt mögen uns. Was wir verdienen, genügt uns. Übermut kommt vor dem Fall." 113 "Gibt es nichts, was euch umstimmen könnte?" Der Alte zierte sich lange, betonte immer wieder, dass er eigentlich nicht viel von der Sache halte, nannte schließlich aber doch seine Bedingungen. "Für einen solchen Auftritt müssen wir manches vorbereiten. Unterdessen können wir nicht auf den Altmarkt gehen und haben Verlust. Es wäre also recht und billig, wenn uns die Bürger im Voraus vier Solidor geben." "Vier Solidor, achtundvierzig Denare? Dafür bekommt man ein halbes Schwein. Du machst dir einen Spaß mit uns." "Außerdem wollen wir, dass wir in Niederich ein Lager aufschlagen dürfen, und dass man uns das mit Brief und Siegel bestätigt." Die beiden Knechte seufzten und erklärten sich überfordert mit einer solchen Entscheidung. Beim Abschied versprachen sie aber, am nächsten Abend wiederzukommen, was sie dann auch taten. "Nun, was hat euer Dienstherr zu unserer bescheidenen Bitte gesagt?" erkundigte sich Alexander. "Dass ihr ein unverschämter Kerl seid. Drei Solidor könnt ihr bekommen und keinen Denar mehr." "Drei Solidor? Das ist ja gerade die Hälfte von dem, was wir verlieren würden!" "Die Hälfte? Gestern hast du Halunke von vier ..." "Niemals! Sechs Solidor verdienen wir auf dem Altmarkt an einem einzigen Tage. Der Herr danke den guten Leuten ihre Freigebigkeit!" "Du wirst deinen Starrsinn noch bereuen." "Habt ihr auch an unseren Lagerplatz gedacht?" "In Niederich ist nirgends genug Raum für so viele Wagen." "Auch nicht für zwei?" "Denke darüber nach! Du wirst die Bürger verärgern und nie wieder ein so gutes Angebot bekommen", drohten die Knechte, doch Alexander gab nicht nach. So mussten die beiden ein drittes und viertes Mal kommen. Schließlich erklärte sich der Alte mit dreieinhalb Solidor und einem Lagerplatz für zwei Wagen einverstanden. Vor Mario hatte Alexander die Gespräche geheim gehalten - zum einen, weil er dessen überschäumendes Temperament bei den Verhandlungen für gefährlich hielt, zum anderen, weil er beweisen wollte, dass er längst noch nicht überflüssig in der Truppe war, nur weil er viele Kunststücke mit seinen steifen Knochen nicht mehr zeigen konnte. Als er nun alles erzählte, blieb der Streit über seine Eigenmächtigkeit nicht aus, doch überwog natürlich die Freude. Wenige Tage später verließen die Beldinis das Lager auf dem Forum feni, und zwar zusammen mit einer Gauklerfamilie, die erst seit zwei Wochen in Köln weilte, mit der sie sich auf Anhieb gut verstanden hatten und mit der zusammen sie nun auch das Programm in Niederich gestalten wollten. Die Fahrt durch die Stadt war schwierig. Um das Gedränge auf den Märkten zu vermeiden, brachen sie erst am Abend auf, als die Händler ihre Stände abgebaut hatten. Sie verließen das Forum über die Kästnergasse. Kurz vor dem Altmarkt bogen sie nach rechts in die Lintgasse ein, die mit schleimigem Wasser bedeckt war, weil hier tagsüber Fische verkauft wurden. Auf gefährlich abschüssigem Weg erreichten sie schließlich die Straße an der alten Stadtmauer, die (dem Rhein folgend) bis nach Niederich führte. Hinter dem Frankenturm (nahe dem Platz vor dem Stift St.Maria ad Gradus), wo es keine Häfen mehr gab, konnten sie dann selbst mit ihren großen Wagen mühelos 114 fahren. Allerdings brach da auch schon die Dunkelheit herein. "Da seht ihr, was diese graukitteligen Hohlköpfe mit ihrer Krakeelerei erreichen!" rief Mario. "Wir sind Künstler. Die Leute wollen uns sehen und werden deshalb dafür sorgen, dass wir unseren Frieden haben." "Was erwartest du von den Leuten? Mit Gott musst du deinen Frieden schließen! Wisst ihr nicht mehr, wie er die schwarzen Beldinis für ihren Hochmut bestraft hat? Habt ihr vergessen, dass gestern ..." Alexander sagte das, und sein Alter und seine Würde als echter Beldini verboten eigentlich, ihm einfach das Wort abzuschneiden. An einem so glücklichen Tage aber wollten sich Mario und Melanie nicht einmal von ihm die Laune verderben lassen. "Hör auf! Du bist trübsinnig, weil du alt wirst." "Gerade weil ich alt bin, solltest du dir überlegen, was du zu mir sagst. Übrigens bist du mir mehr schuldig als nur die Achtung vor meinem grauen Haar." Pentia zupfte Ramira am Kleid und flüsterte: "Was meint er?" "Melanie ist eigentlich die Frau von Alexander. Dann kam Mario." "Und Alexander ist freiwillig zurückgetreten?" "Melanie wollt gern ein Kind, und Alexander ... nun er hatte auch mit seiner ersten Frau keines. Außerdem weiß er natürlich, dass er zu ihr nicht passt." "Und was meint er mit dem Hochmut der schwarzen Beldinis?" "Wir, die roten Beldinis, sind die Nachkommen von Gioseppo, die schwarzen stammen ab von Antonio und Djalila, seiner zweiten Frau. In der einen Sippe gibt's nur Rothaarige, in der anderen nur Schwarzhaarige, ohne eine Ausnahme. Die einen sind nach dem alten Beldini geraten, die anderen nach Fatima aus Arabien. Nachdem Antonio aus Köln geflohen war, gründete er in Lübeck seine zweite Familie. Zwei Kinder wurden geboren, ein Junge und ein Mädchen. Dann ging er mit den Seinen nach Hamburg, wo die von ihm geleitete Truppe so berühmt wurde, dass Herzog Heinrich der Löwe (der viel Verständnis für Künstler hatte) sie zu sich nach Braunschweig an seinen großen Hof holte." "Aber das ist doch etwas sehr Gutes? Warum sagt Alexander, dass Gott sie bestraft habe?" "Ich weiß nicht, ob Gott sie wirklich bestraft hat. Vielleicht richtete sich Sein Zorn wen'ger gegen sie als gegen ihren neuen Herrn. Mit dem Herzog nämlich nahm's kein gutes Ende. Als er sich gegen den Kaiser Barbarossa auflehnte, zogen von überallher Ritter gegen ihn ins Feld. Und weil Antonio wusste, was Krieg für Gaukler bedeutet, ist er mit der Sippe aus Braunschweig geflohen." Ramira unterbrach ihre Erzählung, weil einer der Wagen in einem Loch stecken geblieben war und jeder zupacken musste, ihn wieder herauszuheben. "Immerhin gab's danach noch einmal eine richtig gute Zeit. Als Kaiser Barbarossa seine beiden Söhne zu Rittern machte, ließ er auf den Wiesen vor den Toren der Stadt Mainz ein gewalt'ges Fest veranstalten. Mehrere Tage dauerte es. Bei den Turnieren wurden unzählige Lanzen zerbrochen. An den Abenden wetteiferten Künstler aus aller Herren Länder miteinander. Die meiste Ehre heimsten natürlich die Dichter ein. Aber auch die Artisten bekamen Beifall und Lohn." Wieder unterbrach Ramira, diesmal ohne ersichtlichen Grund. Pentia spürte, dass sie zu dem, worauf Alexander angespielt hatte, noch gar nichts gesagt hatte - wohl weil auch sie plötzlich davor zurückschreckte, den glücklichen Tag mit einer traurigen Erinnerung zu 115 stören. Schließlich brachte sie die Geschichte mit ein paar Sätzen beinahe hastig zum Ende. "Zwei Jahre später suchte eine Seuche das Land heim. Dabei sind ein'ge aus der Truppe gestorben. Die anderen verloren die Freude am Gauklerleben. So war das." Vorn tauchten die Türme von St.Kunibert auf. In den letzten Strahlen der Sonne glich die Ostfassade der Stiftskirche mit den dicken, viereckigen Türmen und dem sich zwischen ihnen massig vorwölbenden Chor einer riesigen schwarzen Katze, die sich zum Schlafen niedergelegt hatte. Davor erstreckte sich ein weiter, wenig genutzter Platz bis zum Rhein. Da sie bis zur völligen Dunkelheit mit der Errichtung eines Lagers nicht mehr fertig werden konnten, stellten die Gaukler ihre beiden Wagen erst einmal an der nächst besten Stelle ab und legten sich zum Schlafen nieder. Am nächsten Morgen erwachten sie vom Geschrei und Stimmengewirr der ersten Leute, die neugierig die Gäste ihres Viertels umringten. Die meisten wussten, was es mit ihnen auf sich hatte und begegneten ihnen wohlwollend, wenn auch mit der typischen Scheu des braven Bürgers vor jeglichem Fremden. Es gab allerdings auch einige, denen der geplante Auftritt mit allem, was damit zusammenhing, unverkennbar ein Dorn im Auge war. ("Bald wird's hier auch so aussehen wie auf dem Forum!"; "Und das vor der Kirche des heiligen Kunibert! Pfui!"; "Unsere Söhne und Töchter können genauso gut musizieren und tanzen! Da braucht man sich nicht solche wie die da herzulocken.") Zum Glück bildeten diese Störenfriede eine Minderheit und wurden mit missbilligenden Blicken schließlich vergrault. Am Nachmittag allerdings, als das Lager bereits aufgeschlagen war, und Melanie über dem Feuer das erste Essen am neuen Platz kochte, wurden die Gaukler abermals darauf gestoßen, dass es in Niederich zwei Parteien mit grundverschiedenen Meinungen über sie gab. Wie aus dem Boden gewachsen, tauchten Jugendliche auf. Sie brüllten zuerst aus etwa zehn Schritten Entfernung gemeine Beschimpfungen und begannen dann, kleine Steine zu werfen. "Verschwindet von hier! Wir wollen euch hier nicht!" Aber auch diesmal hatten die Gaukler am Ende Glück. Männer der Stadtwache bemerkten den Angriff, packten drei der Jugendlichen, verprügelten sie mit Holzknüppeln und drohten ihnen mit dem Gefängnis in der gefürchteten Kunibertstorburg. Mario sah zu und lachte. Es kam nicht alle Tage vor, dass sich Waffenknechte so energisch für ein paar Gaukler einsetzten. III F ranziska wollte sich den Auftritt ihrer Freundin auf keinen Fall entgehen lassen, denn seinerzeit auf dem Forum feni hatte sie, mehr tot als lebendig, kein einziges ihrer Kunststücke gesehen. Die Bürger hatten für die Gaukler eine kleine Bühne aufgebaut. Die dahinter stehenden Wagen sollten zum Umkleiden dienen. Zwi- schen zwei fest verankerten Pfosten war ein Seil gespannt. Für die reichsten und vornehmsten Bewohner des Viertels gab es Bänke. Franziska war ziemlich zeitig gekommen und das erwies sich als klug, denn offensichtlich ging der Wunsch der Niedericher, unter sich zu sein, nicht in Erfüllung. Die Beldinis hatten inzwi- 116 schen etliche Freunde in der ganzen Stadt gewonnen. Endlich ging es los. Zuerst traten Artisten auf, die zu der befreundeten Sippe gehörten. Aber anders als zu Weihnachten auf dem Forum bestand niemals die Gefahr, dass die Zuschauer schon vor dem Höhepunkt vergrault wurden. Zwei Männer, eine Frau und drei Kinder führten eine turbulente Komödie mit vielen geschickt in die Handlung eingebauten Kunststücken vor. Es gab viel zu lachen und es fehlten auch die stets beliebten frechen Anspielungen nicht. Die Leute forderten zweimal eine Zugabe. Nun kam für die Beldinis ein schwieriger Moment. In einer Vorführung sollte auf Gutes nicht Schlechtes folgen, doch Melanies Schwangerschaft war schon zu weit fortgeschritten, als dass sie hätte mit Mario auftreten können. Deshalb musste die unerfahrene Pentia einspringen. Mario spielte den Meister, das Mädchen im Kostüm eines Harlekins den eifrigen aber untalentierten Schüler. Aber die Verlegenheitslösung erwies sich als hervorragend. Von den Lachsalven der Zuschauer vorangetrieben, blieben die beiden viel länger auf der Bühne als geplant. Mario war gut aufgelegt und hätte wohl auch allein reichlich Beifall geerntet, Pentia mit ihrem treuherzigen Blick und ihrem einfach liebenswerten Wesen jedoch sorgte erst für die wahre Stimmung. Übrigens probierte sie am Ende viele Tricks tatsächlich zum allerersten Mal. Nach einer Pause, in der Pentia durch die Reihen ging, um zum ersten Mal an diesem Abend Spenden einzusammeln, kam Ramira an die Reihe. Um die Spannung zu steigern und auch um die Dämmerung noch ein wenig mehr hereinbrechen zu lassen, dehnten die Gaukler die Pause aus, ohne sich von Zwischenrufen beeindrucken zu lassen. Franziska wurde derweil immer unruhiger. Zwar kannte sie das Programm, wusste also, dass bisher alles so gut verlaufen war, wie irgend möglich, wusste, warum es diese lange Pause gab, wusste auch, dass ihre Freundin noch niemals versagt hatte, doch wünschte sie sich dennoch von Herzen, dass alles schon vorbei sein möge. Die Bühne und ihre nähere Umgebung wurden von zahlreichen Fackeln in rötliches Licht getaucht und wirkten geheimnisvoll, als Ramira darauf erschien. Sie trug ein enges Kleid, das ihre Beine bis übers Knie sehen ließ und unter anderen Umständen anstößig gewirkt hätte. Doch als Gauklerin stand sie in gewisser Hinsicht außerhalb der gesellschaftlichen Normen. Freilich gelangen ihr viele Kunststücke überhaupt erst dank dieser Narrenfreiheit. Sie wirbelte in atemberaubenden Sprüngen und Überschlägen von einem Ende der Bühne zum anderen - manchmal sogar darüber hinaus, wie um zu beweisen, dass ihre Kunst jeden Rahmen sprengte. Dann verharrte sie plötzlich, um Proben ihrer Biegsamkeit zu zeigen, bis mancher wohl glaubte, sie habe keinen einzigen Knochen im Leib. Niemals wusste man, was sie im nächsten Augenblick tat, und genau das half ihr, immer wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Später huschte sie einem Eichhörnchen gleich einen der beiden Pfosten hinauf und balancierte mehrmals auf dem Seil hin und zurück. Aber plötzlich zögerte sie. Auf der schmalen Plattform an der Spitze des einen Pfostens nahm sie Schwung, fing sich ab, probierte es ein zweites, schließlich ein drittes Mal. Die Zuschauer hielten den Atem an. Dieses nächste Kunststück war zweifellos gefährlicher als alle vorherigen, da selbst sie sich offenbar davor fürchtete. "Nun mach schon, du Angsthase!" rief jemand. Da nahm die Artistin ein weiteres Mal Schwung, vollführte einen Salto 117 und versuchte dann, mit den Füßen auf dem Seil Halt zu finden. Dabei rutschte sie jedoch ab. Ein paar Frauen kreischten gellend auf. Das Mädchen stürzte aber nicht ab, sondern kam auf dem Seil zu sitzen, die Beine zu beiden Seiten herunterhängend. Aus dieser Stellung sprang sie blitzschnell wieder auf und balancierte sicher zum anderen Pfosten hinüber. Selbst Franziska, die genau wusste, dass ihre Freundin sowohl die Furcht als auch den Unfall nur vorgespielt hatte, weil die Leute dergleichen sehen wollten, und dass sie dieses Kunststück mit traumwandlerischer Sicherheit beherrschte, war ganz heiß vor Aufregung. Inzwischen kletterte Ramira wieder herunter vom Seil, schmückte sich mit einem hölzernen, schnitzereiverzierten Diadem sowie einem durch aufgenähte Metallplättchen vielfarbig schillernden Gürtel und nahm in jede Hand eine Fackel. Sie spielte jetzt eine Prinzessin aus einem fernen Land und drehte sich anmutig in einem verwirrenden Tanz. Jetzt war das kurze Kleid nicht mehr ohne Sinnenreiz wie zuvor, als alle nur auf die Sprünge und Überschläge achteten. Die Fackeln wirbelten um ihren Körper herum und zeichneten geheimnisvolle Leuchtspuren. Mario trommelte unsichtbar einen fremdartigen Takt. Die Spannung hätte größer nicht sein können. Franziska fühlte das wollüstige Schnauben der Männer um sich herum, und dachte an die Zeichnung eines Drachen mit einem Dutzend Köpfen, dampfenden Nüstern und feurigem Atem. Sie ahnte, was in diesen widerwärtigen Kerlen vorging, wie sie gerade davon träumten, diesem (ihrer Vermutung nach noch unschuldigen) Mädchen das Kleid vom Leib zu fetzen. Am liebsten hätte sie ihr ein Zeichen gegeben und sie angefleht, dieses Spiel mit dem Feuer abzubrechen, ihre Haare wieder in Unordnung zu bringen und sich mit ihrem zerschlissenen, unsauberen Alltagskleid zu schützen. Ramira indes steckte die Fackeln in den Boden und tanzte um sie herum. Dabei legte sie ganz langsam unter Marios Trommelwirbel zuerst das Diadem und dann auch den Gürtel ab. Sie stand nun so da wie am Anfang und dennoch wirkte sie nackt. Es war gerade so, als ob Holzdiadem und Flittergürtel sie zuvor in magischer Weise verhüllt hätten. Die Zuschauer tobten, gerieten ganz außer sich. Der nicht mehr zu übertreffende Höhepunkt der Vorstellung war erreicht. Pentia stürzte sich mutig in den brodelnden Kessel, um Geld einzusammeln. Für Ramira wäre das jetzt lebensgefährlich gewesen, aber auch das kleinere, offensichtlich noch nicht heiratsfähige Mädchen wurde festgehalten und belästigt. Der Wahn der Leute hatte indes auch seine nützlichen Seiten, denn er verdrängte den Geiz. In der unklaren Hoffnung, sich die schöne Artistin auf der Bühne damit kaufen zu können, gaben einige Männer so viel wie sonst wenigstens zwanzig von ihnen. Als sich der Platz endlich leerte, war es schon tiefe Nacht. Ramira hatte sich umgezogen und in ein Versteck am Rhein gerettet. Franziska kannte das Versteck und folgte ihr dorthin. "Du glaubst nicht, welche Angst ich um dich hatte." "Ach was! Ich weiß ganz genau, wann ich aufhören muss, sonst hätte mir schon längst irgendein abartiger Kerl den Bauch aufgeschlitzt." "Wenn ich mir nur sicher wäre, dass du es wirklich immer weißt!" "Gauklerleben ist nun einmal gefährlich. Je mehr wir das Schicksal herausfordern, desto größer der Gewinn." "Ich habe Schmierereien dieser Canes gesehen. Die wollen nicht, dass eure Wagen vor einer großen Stiftskirche stehen." 118 "Wir haben die Erlaubnis des Rates, hier zu wohnen, und der Rat muss uns jetzt auch beschützen wie jeden anderen Bürger der Stadt." Franziska seufzte und war noch längst nicht überzeugt, sagte aber nichts mehr. Natürlich freute sich Ramira und zwar mit recht. Die Vorstellung hätte nicht besser enden können. Der Erlös machte die Beldinis und ihre neuen Freunde (für Gauklerverhältnisse) geradezu reich. 119 12.Kapitel I Z wei Wochen lang hatte sich Franziska in ihrer neuen Bleibe sehr wohl gefühlt und ausgiebig genossen, noch einmal ganz so zu leben wie vor Jahren in der Burg ihres Vaters, geschützt und wohl versorgt. Raimund brachte ihr jeden Abend ihr Essen, manchmal leckere Dinge wie Hasenbraten oder mit Korinthen angerichteten Schinken. Aller Sorgen ledig, konnte sie den ganzen Tag über treiben, was sie wollte. Doch mit der Zeit begann sie sich zu langweilen und war immer häufiger schlecht gelaunt. "Warum tust du das eigentlich alles für mich?" fragte sie eines Abends, als Raimund zu ihr kam, scheinheilig. "Vielleicht weil ich dich nett finde." "Das kann nicht sein", entgegnete sie. "Wenn man jemanden nett findet, spricht man mit ihm und lässt ihn nicht den ganzen Tag über allein." "Du weißt doch, dass ich für meinen Vater ..." "Ach, dein Vater!" fiel sie ihm ins Wort. "Schön für dich, dass dich dein Vater Besorgungen erledigen lässt! Dadurch brauchst du nicht so wie ich herumzusitzen." "Was ist heute nur los mit dir?" fragte er verwirrt. Sie sah ein, dass sie sich nicht so an ihm abreagieren durfte, und sagte, nun viel freundlicher: "Du brauchst mich nicht zu füttern wie ein Kind, denn ich bin alt genug, um für mich selbst zu sorgen. Willst du mir einen wirklichen Dienst erweisen, dann verschaffe mir Arbeit. Es muss doch Wege geben, das Fremdengesetz zu umgehen." "Ich weiß vielleicht eine Möglichkeit", sagte er zögernd. "Kannst du mit Leder umgehen?" "Ich habe es bei meiner Erzieherin in Wildeshausen ein bisschen gelernt." Franziska war begeistert, obgleich sie sich eigentlich hätte erinnern müssen, dass das Ledernähen von allen Handarbeiten zu den anstrengendsten und undankbarsten gehörte. In ihrer Lage aber hasste sie nichts mehr als das Müßiggehen. Übrigens erledigte sich bei dieser Gelegenheit ganz nebenbei noch eine andere Unstimmigkeit. Zweimal in der Woche, immer am Sonntag und am Mittwoch, hatte sich Franziska aus ihrer Bleibe vertreiben lassen müssen. Sie durfte sich dann nicht einmal in der Nähe aufhalten und Raimund legte größten Wert darauf, dass sie sich an das Gebot auch hielt. Ganz sicher hätte sie ihn früher oder später zur Rede gestellt und sich nicht mit durchsichtigen Ausflüchten abspeisen lassen. Die neue Arbeit aber war mit einem Umzug verbunden, und somit entfiel der Anlass. Schon am nächsten Tag brachte er sie zu einem gleichfalls in der Weidengasse, jedoch dichter an der Stadtmauer gelegenen Haus. An der Tür stand eine große, schlanke Frau mit kurzen, glatten, dunkelblonden Haaren. Man hätte sie für eine Dreißigjährige gehalten, wäre nicht eine gewisse Strenge von ihrem Wesen ausgegangen - ein Eindruck, der von der altmodischen Frisur und dem dünnen Mund herrührte. Franziska kostete es Überwindung, ihr freundlich und offen entgegenzugehen, zumal sie in ihren unverwandt auf sie gerichteten Augen ein stummes Misstrauen zu lesen glaubte. "Das ist Ursula", stellte Raimund sie eine Spur zu hastig vor. "Sie wird dir das Haus zeigen und alles erklären." Letzteres tat sie freilich nicht. Ohne ein Wort zu reden, nahm sie die Neue beim Oberarm und zog sie hinter sich her durch einen großen, das gesamte Erdgeschoß einnehmenden Raum. Vier Bänke waren darin zu einem lang gestreckten Karree zusammengestellt und dienten als Arbeitsplatz für zehn Frauen unterschiedlichen Alters. Sie fertigten Geldbeutel, kleine Umhängetaschen und ähnliche kleine Gebrauchsgegenstände. Vor ihnen standen kleine Tische, auf denen Messer und Nadeln lagen und an die auch Hilfsvorrichtungen für besonders komplizierte Nähte angebracht waren. Hinter ihnen türmten sich Lederhäute und fertige Produkte. Die Stille im Raum erstaunte Franziska, denn in den Werkstätten auf Schloss Wildeshausen hatten es sich die Frauen niemals nehmen lassen, sich bei der gemeinsamen Handarbeit lustige Geschichten zu erzählen und zu lachen. Vielleicht gehörte das Haus zu einem Beginenkonvent. Dafür sprach, dass Raimund an der Tür stehen geblieben war wie an der Pforte eines Klosters. Die Beginen legten zwar kein Gelübde ab und unterstanden keinem geistlichen Orden, nahmen es mit den für Nonnen üblichen Geboten jedoch oft außerordentlich genau. Franziska waren diese kleinen Konvente, die es in Köln fast auf jeder Straße gab, stets ein wenig unheimlich gewesen. Da Ursula aber mit forschem Schritt schon die Treppe zum Obergeschoß hinaufstieg, konnte sie darüber nicht lange nachdenken. Auch in diesem Stockwerk reichte ein einziger Saal von einer Außenwand zur anderen. Allem Anschein nach war das Gebäude erst vor kurzem umgebaut worden, wobei man die Trennwände entfernt und an ihrer Stelle die Decke durch Balken gestützt hatte. Der obere Raum diente zweifellos als Schlafsaal. Ursula indes stieg noch eine halsbrecherische Treppe hinauf bis ins Dachgeschoß, wo sie das Mädchen zu einer Kammer mit schräger Wand führte. Franziska gefiel diese Aussonderung überhaupt nicht. "Ist unten kein Platz mehr für mich?" fragte sie vorsichtig. Die Antwort war ein kurzes, hartes "Nein", das ihr die Lust zu weiteren Fragen nahm. Es kam sogar noch schlimmer. Sie durfte nicht einmal mit den anderen gemeinsam arbeiten. Ursula brachte ihr Lederstücken, dicke Fäden und Nadeln hinauf auf die Kammer, zeigte ihr, was sie zu tun hatte, und ließ sie dann allein. Schweren Herzens blieb ihr nichts anderes übrig, als sich mit ihren Pflichten abzulenken und den Rufen der Bauarbeiter an der Stadtmauer zu lauschen. Am Anfang verglich sie Ursula mit Melanie, stellte aber bald fest, dass die Feindseligkeit beider von gänzlich anderer Art war. Ursula sagte mit keinem Wort, dass sie das Mädchen nicht mögen oder auf ihre Hilfe keinen Wert legen würde. Sie war auch nicht launisch und niemals wirklich unfreundlich. Wenn Franziska etwas nicht verstand oder gar durch Unkenntnis und Ungeschicklichkeit etwas verdarb, erwies sie sich als geduldige Lehrmeisterin. Sie tat aber alles nur irgend Mögliche, um sie von den anderen Hausbewohnern zu trennen - gerade so, als wolle ein besorgter Abt sie an der Verführung der ihm anvertrauten Mönche hindern. Es fiel ihr schwer, eine Bezeichnung für ihre sonderbare Stellung zu finden. Sie war keine Gefangene, denn sie durfte sich frei bewegen, wurde auch nicht erniedrigt, hatte sogar einige besondere Vorrechte. Sie war aber auch kein geachtetes Mitglied dieser Gemeinschaft, denn es fehlte jedes Zeichen von Wert- 121 schätzung. Und bis auf Ursula ging ihr jeder aus dem Wege. Am ehesten sah sie sich als eine Geduldete. Immerhin aber durfte sie umsonst wohnen und essen. Darüber hinaus bekam genügend Geld, um sich schon bald neue Kleider leisten zu können. Und nicht zuletzt traf sie sich an jedem Sonntag mit Raimund, um ausgedehnte Spaziergänge mit ihm zu unternehmen. II W ie geht es dir?" fragte er sie, als er sie abholte. "Diese Ursula eine nette Frau zu nennen, wäre wohl eine Lüge ..." "Du darfst dir das nicht zu Herzen nehmen. Sie ist nicht nur zu dir so streng." "Dazu müsste ich sie mal mit anderen zusammen sehen, aber leider darf ich nicht einmal beim Essen aus der Kammer raus." "Mach die Augen zu!" unterbrach er sie. Etwas widerstrebend tat sie es, und er streifte ihr etwas über den Arm. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, dass es ein Armreif war, ein breiter, nicht echter aber mit einer schönen Gravur verzierter Reif. "Als Entschädigung", sagte er - und sie vergaß sofort ihren Verdruss. "Das muss teuer gewesen sein!" Er zuckte mit den Schultern. "Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie." "Du hast mir noch nie etwas von deiner Familie erzählt." "So aufregend ist das nun auch wieder nicht. Ich habe einen älteren, ungewöhnlich tüchtigen Bruder, zwei jüngere, ungewöhnlich hübsche Schwestern, einen ungewöhnlich erfolgreichen Vater und eine ungewöhnlich fürsorgliche Mutter. Ich bin der einzige, der nichts Außerordentliches an sich hat, sieht man von den außerordentlich vielen Fehlern bei Diensten für meinen Vater ab." "Gehört dein ungewöhnlicher Vater etwa sogar dem Rat an?" "Um in den Rat gewählt werden zu können, genügt es nicht, reich, klug und erfolgreich zu sein. Dafür muss man einer alteingesessenen Familie angehören. Die haben die Schöffenbruderschaft gegründet und lassen da keinen Fremden rein." "Was wird aus dir, wenn dein Bruder von deinem Vater das Geschäft übernimmt?" "Soweit ist es noch lange nicht. Wahrscheinlich wird sich mein Bruder die Arbeit mit mir teilen. Mein Vater will das so." "Ich dachte schon, du musst auf Wanderschaft gehen oder Mönch werden." So miteinander plaudernd, schlenderten sie die Weidengasse entlang stadteinwärts. Links von ihnen zog sich ein altersschwacher Zaun mit zahlreichen Löchern dahin. Durch eines dieser Löcher krochen sie hindurch und gelangten auf einen schmalen Weg zwischen hohen Sträuchern und Obstbäumen. Der Eigentümer kümmerte sich um den Garten schon seit Jahren nicht mehr, so dass er allmählich verwilderte. Franziska aber liebte ihn gerade so, wie er war. "Versuch mich zu fangen!" rief sie und war im nächsten Augenblick im Dickicht verschwunden. Er jagte ihr nach, verlor sie aus den Augen, fand sie dann doch wieder, weil sie sich durch ihr Kichern selbst verriet, und angelte sich ihren Arm. Besiegt hatte er sie damit freilich noch lange 122 nicht, denn nun begann sie mit ihm eine wilde Rauferei. Um sich vor ihr als Junge keine Blöße zu geben, kämpfte er so verbissen, dass sie sich vor Vergnügen kaum zu halten wusste. "Ich ergebe mich", sagte sie schließlich. "Was forderst du, damit ich mich erlösen kann?" "Ein wahrer Ritter fordert nichts vom besiegten Gegner." "Schade!" maulte sie. "Ich dachte, du willst einen Kuss." Sie liefen weiter, erreichten den Eigelstein, überquerten ihn schräg und kamen zu einem eingezäunten Areal mit mehreren kleinen Feldern. Das konnten sie durch ein gewöhnliches Tor betreten, denn es gehörte den Cranboims und deren weit verzweigter Verwandtschaft. An Wochentagen arbeiteten hier Mägde und Knechte. Jetzt am Sonntag aber waren Franziska und Raimund ganz für sich allein. "Ich würde deine Familie gern einmal kennen lernen." "Warum?" "Was ist daran so sonderbar?" "Eigentlich nichts, nur ... Meine Eltern sollen nicht denken, dass ... Ich stelle dich ihnen später einmal vor." Sie verstand das nicht, war sogar ein wenig enttäuscht, weil sie argwöhnte, er würde sich ihretwegen schämen, drängte ihn aber nicht zu einer Erklärung und wollte auch nicht lange darüber nachdenken. Auf dem freien Gelände wehte ein frischer, in der heißen Julisonne sehr angenehmer Wind. Franziska beobachtete, wie Raimunds weiches, seidiges Haar zerzaust wurde, und spürte wieder wie vor einem Monat unter den Krähenbäumen und wie noch einige Male danach ein tiefes Verlangen, es sich durch die Finger gleiten zu lassen, ein Verlangen, das um so heftige wurde, je länger sie es nicht stillen konnte. Wieso etwas derart Nichtiges alles in ihr so durcheinander brachte, konnte sie sich freilich nicht erklären. Sehnsüchtig wartete sie darauf, dass er sie zu umwerben beginnen würde, wie das die Bauernburschen taten, sobald ein Mädchen sie dazu ermunterte. Im Grafenschloss von Wildeshausen wäre das natürlich nicht so leicht möglich gewesen, und vielleicht galten bei den vornehmen Kaufherrenfamilien ähnlich strenge Ansichten. Doch von dem, was sich im Dickicht des Gartens an der Weidengasse abspielte, erfuhr niemand. Warum also ließ er sich nicht einmal dort von ihr umarmen? Davor, dass er sich gar zu sehr herausgefordert fühlen und zu weit gehen könnte, fürchtete sie sich nicht, denn sie wusste von den Raufereien her, dass sie nicht schwächer, vielleicht sogar stärker war als er. Zu ihrem Leidwesen aber wich er stets scheu wie ein Vogel vor ihr zurück, sobald sie ihm zu nahe kam, obgleich er sie andererseits oft mit kleinen Geschenken überraschte und sich nett mit ihr unterhielt. Bei der Suche nach einer Ursache dafür fielen ihr die Bemerkungen ihre älteren Schwester Agnes bei den Bällen des Grafen von Wildeshausen auf der Wardenburg ein. Damals hatte sie die meisten davon noch nicht recht verstanden. Jetzt ahnte sie, dass sie wohl bezogen waren auf solche jungen Männer, die sich an Mädchen nicht recht herantrauten und sich deshalb langweilen mussten, während andere sich vergnügten. Allerdings fand es Franziska sehr hässlich, jemanden daraufhin noch mutwillig zu ärgern. Da Raimund offenbar an dieser merkwürdigen Krankheit litt, wollte sie ihm helfen. Ihr Entschluss versetzte sie in eine solche Hochstimmung, dass sie sonst so gut wie nichts um sich herum wahrnahm. Es störte sie nicht, dass Ursula eher immer unfreundlicher als netter zu ihr wurde. Dass der geheimnisvolle 123 Verfolger plötzlich wieder aufgetaucht war, veranlasste sie lediglich dazu, ihr Schwert aus dem Versteck am Duffesbach zu holen und unter einem weiten Mantel verborgen bei sich zu tragen, wenn sie sich allein in etwas zweifelhafte Gegenden begab. Während sie allein in ihrer Kammer saß und Lederstücke zusammennähte, entwarf sie die abenteuerlichsten Pläne, um Raimund aus seiner Zurückhaltung herauszulocken. Bei solchen Gedanken wurde sie immer sehr aufgeregt, und nicht selten folgten ihr die Wünsche bis in die Träume nach. Sie hatte merkwürdige Träume, darunter solche, die sie ganz verwirrt und mit schwerem Kopf aufwachen ließen. Oft sah sie Raimund in der Gestalt des geheimnisvollen Verfolgers. Manchmal war er groß wie ein Riese, manchmal hatte er sich zu einer Bande finsterer Gesellen vervielfacht. Immer überfiel er sie am Ende. Sie wehrte sich wie besessen, doch er war so stark, dass sie nichts gegen ihn ausrichten konnte. Was er dann mit ihr anstellte, gehörte zu den Dingen, die zu träumen sie sich schämte. Nichtsdestoweniger musste sie am Tage immer wieder daran zurückdenken, so dass sie Ursula immer häufiger Pfusch ablieferte. Eines Tages - Franziska und Raimund waren wieder einmal durch das Loch im Zaun des Gartens an der Weidengasse gekrochen - ergab es sich, dass sie unter einem mächtigen Pflaumenbaum rasteten. Ein Ring verfilzter Sträucher verwandelte den Ort in ein wahres Liebesnest. Raimund freilich schien nichts zu merken davon, denn er wollte unbedingt ein Gespräch über das Buch irgendeines berühmten alten Griechen anfangen. Franziska interessierte sich im Grunde sehr wohl für Bücher, nicht aber in diesem Moment, denn die günstige Gelegenheit beschwor in ihr die wildesten ihrer Träume herauf, bis es ihr völlig gleichgültig wurde, ob sie im nächsten Moment Schande über sich brächte oder nicht. Zuerst täuschte sie ein wenig Zerstreutheit vor und ließ ihr Kleid wie zufällig bis über die Knie heraufrutschen. Sie beobachtete, dass er tatsächlich verstohlen nach ihren Beinen schielte und den Faden beim Erzählen verlor. Dennoch unternahm er nichts. Da vergaß sie sich völlig und nahm ihn einfach in den Arm wie ein Mädchen aus der Schwalbengasse, die noch einen zweiten, höchst unanständigen Namen trug. Raimund wusste vor Überraschung nicht recht, was er tun sollte, und erwiderte die Umarmung andeutungsweise. Sie wertete das als Einverständnis und begann, seinen Rock aufzuknöpfen. Dabei aber wehrte er sie ab. "Franziska, ich hab dich wirklich sehr gern, nur ..." "Ach, was! Du traust dich nur nicht, aber du wirst sehen, dass es Spaß macht." "Was trau ich mich nicht? Kannst du Gedanken lesen?" Erschrocken merkte sie, dass er ernsthaft wütend wurde. Er stand auf und sah sie so böse an, wie sie es ihm nie und nimmer zugetraut hätte. "Daran also hast du die ganze Zeit über gedacht!" schrie er sie an. "Ich bin aber nicht dein Spielzeug. Merk dir das!" Ihre Erregung war schlagartig wie weggeblasen, und sie suchte verzweifelt nach einem Weg, die nun auch für sie äußerst peinliche Situation zu retten. Ehe sie jedoch überhaupt etwas sagen konnte, ging er davon. Sie blieb zurück und rührte sich wie fest gezaubert lange nicht von der Stelle. Dass sie furchtbar ungeschickt gewesen war, das sah sie ein, sie begriff aber nicht, warum er sie daraufhin gleich so wütend, ja hasserfüllt angesehen hatte. Vielleicht gehörte er zu jenen Männern, die sündiger Weise nur Ihresgleichen lieben können? 124 Dann aber hätte er sich auch sonst anders zu ihr verhalten müssen. In ihrer Ratlosigkeit beschloss sie, sich Ramira anzuvertrauen. Im Grunde erwartete sie ein wenig Zuspruch in ihrem Kummer, obgleich sie sich nicht gerade im Recht fühlte. Die Gauklerin jedoch antwortete nicht, sah sie nicht einmal an, während sie ihr seltsam unruhig zuhörte. Plötzlich warf sie den Kopf herum, und in ihren Augen war für einen Augenblick ein böses Funkeln. "Du bist also auch nicht besser!" schrie sie, ohne sich näher zu erklären. Franziska prallte zurück, nicht allein, weil sie ihre Freundin nie zuvor so maßlos wütend erlebt hatte sondern mehr noch, weil sie deren Reaktion noch viel weniger verstand als zuvor die von Raimund. "Was habt ihr heute nur alle gegen mich? Ich will seine Frau werden. Die Bauernpaare feiern fast alle ihre Hochzeit im Stroh einer Scheune, bevor sie zur Kirche gehen." Dann hielt sie inne und fügte fast bettelnd hinzu: "Was ist los? Dir habe ich doch nun wirklich nichts getan." Ramira blickte ihr noch immer aus ihren eigentümlichen blaugrauen Augen gerade ins Gesicht. Das Funkeln war aber daraus verschwunden und einem Ausdruck tiefer Traurigkeit gewichen. "Warum will jeder immer einen anderen besitzen? Weißt du eigentlich, was das heißt, besessen zu werden? Ich weiß es. Du schreist, wehrst dich mit aller Kraft, aber es nutzt dir nichts. Du bist gefangen. Der andere kann mit dir machen, was er will. Du glaubst, dass er sogar Macht über deine Seele hat. Am Ende ekelst du dich vor dir selbst." Franziska spürte ein Würgen im Hals. "Du denkst an deinen Vater, ja? Gott wird ihn bestrafen." "Gott kann ihn strafen oder ihm vergeben. Es ist mir gleich. Übrigens hat er mir fast alles beigebracht, was jetzt die Leute so sehr bewundern. Ich war eine eifrige Schülerin, denn beim Üben hat er mich zwar angebrüllt und geschlagen, ansonsten aber in Ruh gelassen. Er konnte immer nur eins von beiden sein, Artist oder Mann." Beide schwiegen lange. Dann sagte Franziska zaghaft: "Aber warum ... warum wirfst du mir das vor? Ich habe doch nicht ..." "Wirklich nicht? Warum bist du nicht froh, dass dieser Raimund feinfühliger und rücksichtsvoller ist als die meisten anderen? Willst du ihn dir nur zu Füßen legen wie der Jäger einen toten Hasen?" Franziska zwang sich zu einem Lächeln, das ihr allerdings etwas verzerrt geriet. "Du bist wenigstens ehrlich!" III A m Sonntag nach dem Streit lief Franziska schon am frühen Morgen die Weidengasse auf und ab und hielt nach Raimund Ausschau. Sie wollte sich bei ihm entschuldigen, mit ihm aussprechen und dann wieder mit ihm versöhnen. Wenn er sie auch nicht liebte, so konnte er doch wenigstens mit ihr befreundet bleiben! Was sollte sie ohne ihn anfangen? Sicher würde sie mit ihm auch die Arbeit und die Kammer wieder verlieren, denn bei Ursula durfte sie kaum auf Verständnis und Hilfe hoffen. Ihr graute davor, wieder durch die Straßen getrieben zu werden auf der Suche nach etwas Essbarem und nach einem Schlafplatz für die Nacht. Spätestens jetzt bereute sie bitter, dass sie wie ein besessener Spieler alles gewagt und vielleicht alles verloren hatte. 125 Zu allem Überfluss war auch das schöne Wetter vorbei. Seit zwei Tagen regnete es ununterbrochen. Die (bis auf eine für die schweren Wagen aus Bohlen gelegte Spur) ungepflasterte Straße hatte sich in einen knöcheltiefen Morast verwandelt. Franziska wurde schmutzig und triefend nass, zumal sie wie eine Büßerin ihren Mantel absichtlich in der Kammer gelassen hatte. "Du wartest hier mitten im Regen auf mich?" So sehr sie nach ihm Ausschau gehalten hatte, stand er nun doch völlig überraschend vor ihr, und sie brachte kein Wort über die Lippen. Wie weggeblasen war alles, was sie sich zuvor im Kopf zurechtgelegt hatte, um es ihm zu sagen. "Entschuldige, dass ich so wütend geworden bin", sagte er. "Ich war schlecht gelaunt, wegen etwas anderem. Bist du einverstanden, dass alles wieder wird wie früher?" Sie nickte verwirrt. "Jetzt musst du dich aber erst einmal umziehen. Sonst erkältest du dich." Sie nickte abermals, ging ins Haus und kam wenig später im trockenen Kleid und mit ihrem regenfesten Mantel zurück. Es wurde zwischen ihnen tatsächlich wieder wie vor dem Streit. Franziska hütete sich, ihn noch einmal zu provozieren, und Raimund vergaß, dass sie es je getan hatte, dem Anschein nach zumindest. Am darauf folgenden Feiertag unternahmen sie wieder einen gemeinsamen Spaziergang. Zwar war der Sommer offenbar schon zu Ende, doch regnete es zumindest nicht mehr, und gegen Wind und Kühle konnten sie sich warm anziehen. Um nicht gleich wieder an jenem unglückseligen Garten vorbeizukommen, schlug Franziska vor, gleich hinter dem Haus in die Clingelmannpützstraße einzubiegen. Damit beschwor sie zwar gleichfalls schlechte Erinnerungen her- auf, nämlich jene an die hartherzige Familie Clingelmann, doch waren das weit zurückliegende Ereignisse. Franziska legte es sogar darauf an, sich die überwundene Zeit des schlimmsten Elends noch einmal mit einem gewissen Schaudern zu vergegenwärtigen. Nicht zuletzt deshalb trieb sie das Spiel so weit, nicht parallel zur Stadtmauer bis zum Platz vor Sankt Gereon zu schlendern, sondern sich am Clingelmannhaus nach links zum Entenpfuhl hin zu wenden. Gegenüber der wie immer verschlossenen Pforte des Ursulastifts jenseits des zum stinkenden Sumpf gewordenen alten Grabens blieb sie stehen. Ihr war, als sei der Sumpf in der Zwischenzeit schon wieder ein wenig breiter geworden und somit noch ein Stück näher an die Häuser heran gekrochen. Ansonsten hatte sich nichts verändert. Wie erstarrt wirkten die Hütten und Verschläge, auch die darin hausenden Bettler, selbst die Bäume und Büsche, so als würden sie alle nur darauf warten, vom Pfuhl verschlungen, in die Tiefe gerissen zu werden. "Gute Jungfer, habt Erbarmen mit einem armen Krüppel!" Ein alter Mann, von Krankheit und Elend so krumm gedrückt, dass er kaum halb so groß war wie das Mädchen, hielt die Hand auf. Genauso hatte sie selbst manches Mal um Almosen gebettelt. In Gedanken versunken, gab sie ihm einen Vierteldenarius, wohl wissend, dass dieser Mann sein Gebrechen vermutlich nur vortäuschte, dass er ganz sicher nicht zu den Allerärmsten hier gehörte, weil jene vom Hunger geschwächt und vom Fieber geschüttelt in irgend einer Ecke lagen. Auch dass nun viele andere kamen, weil nun jeder etwas haben wollte, wusste sie vorher. Bald konnte sie sich des Andrangs nicht mehr erwehren, und der Aufbruch geriet zur Flucht. 126 "Merkwürdig! Plötzlich gehöre ich zu den Wohlhabenden, die man anbettelt. Vor ein paar Monaten war ich ihre Schwester, und nun hassen sie mich wahrscheinlich ... Weißt du, was mich damals immer wieder aufgerichtet hat? ... Die Ursulakirche hinter der Mauer!" "Die Kirche der heiligen Jungfrauen?" fragte Raimund ungläubig und dozierte: "Anfangs eine kleine Kapelle über den Gräbern der Märtyrerinnen, dann ein Kanonikerstift des Erzbischofs. Durch die Nordmänner zerstört, aber bald wieder aufgebaut. Seit dem Jahr 922, als die Ungarn Gerresheim eroberten und zerstörten, ein Stift für vornehme Damen. Wie kann das jemanden im Elend aufrichten?" "Oh, du kennst dich ja besser aus als ich! Das wusste ich alles noch gar nicht. Das habe ich aber auch nicht gemeint." "Was dann?" "Die Geschichte um die Kirche, das Leben der heiligen Ursula, ihren festen Glauben, ihre Schicksalsergebenheit." Er zuckte mit den Schultern, sehr respektlos, wie sie fand. "Berührt dich so etwas denn gar nicht?" "Mich berührt etwas ganz anderes, wenn ich an Sankt Ursula denke. Beim Ausheben des Grabens, von dem heute nur noch der Entenpfuhl übrig ist, sind die Bauleute vor ungefähr hundert Jahren auf alte Gräber gestoßen und haben hunderte Knochen zu Tage gefördert. Woher sie stammen, wusste keiner so recht. Der Erzbischof aber behauptete, sie seien allesamt Reliquien heiliger Märtyrerinnen. Nicht elf Jungfrauen seien damals unterwegs gewesen sondern ihrer elftausend. Stell dir das einmal vor! Eine ganze Armee von Jung- frauen! Ich bin Kaufmannssohn und weiß ziemlich gut, wie viel es kostet, wenn elftausend Leute durch die Gegend ziehen. Aber es ging wohl gar nicht darum, dass diesen Unfug irgendjemand in Köln wirklich glaubt, denn mit der Geschichte ließ sich Geld verdienen. Man stellte eine riesige Menge hölzerner Mädchenköpfe her, schüttete in jeden davon ein paar Knochen rein und verscherbelte sie dann in alle Welt im Namen der Dreifaltigkeit, versteht sich. Nun sage mir bitte, was das ist Geschäftssinn, Dummheit oder Gotteslästerung?" Raimund ereiferte sich mehr, als es die Sache wert zu sein schien. Franziska erschrak zunächst über seine Heftigkeit, gab ihm dann aber in gewisser Hinsicht recht und musste schließlich laut lachen über seine bissige Ausdrucksweise. "Die Kölner sind schon ein sonderbares Völkchen!" sagte er und lachte nun auch. Nachdem sie sich mit Raimund ausgesöhnt hatte, gewann Franziska schnell ihre Unbekümmertheit zurück. Wie sie es auch drehte und wendete - immer erschien er am Ende als der beste irgend denkbare Mann für sie. Er war klug und mutig, aber auch rücksichtsvoll und aufmerksam. Bei ihm brauchte sie sich nicht vor Schlägen zu fürchten. An seiner Seite konnte sie sich geborgen fühlen und zugleich selber stark sein. Sollte ihm diese Seelenverwandtschaft auf Dauer verborgen bleiben? Früher oder später wird er sie lieben und sie ganz selbstverständlich auch das tun lassen, was sie vorerst nicht einmal versuchen durfte. Aber das lag schon außerhalb ihres Alltags und erregte sie deshalb nicht mehr so sehr wie zuvor. 127 IV W enn Franziska frei hatte, Raimund sie aber nicht besuchen konnte, ließ sie sich von Lust und Laune allein durch die Gassen treiben und genoss ihr ungebundenes Leben. Inzwischen kannte sie sich ziemlich gut aus in der Stadt. Sie wusste nun auch, wie sie selbst in den verrufensten Vierteln den Gefahren ausweichen konnte, und ließ ihr Schwert, das sie unterwegs mehr behinderte als schützte, in einem Versteck im verwilderten Garten an der Weidengasse. Manchmal schlenderte sie über den Platz vor Sankt Gereon, von dem sie nun keiner mehr vertrieb. Ein andermal umging sie die alte Stadtmauer und beobachtete die Damen von Sankt Ursula, wie sie über den Stiftshof flanierten und ihre Kleider zur Schau stellten. Manchmal unternahm sie noch größere Ausflüge - die Mauer entlang, vorbei an der Baustelle für das Eigelsteintor und an den Kontoreien der reichen Niedericher Korporationen bis zum Rhein, wo die Mauer nach rechts zur Kunibertstorburg mit ihrem finsteren Gefängnis hin abknickte. Am meisten aber mochte sie den Eigelstein. Inzwischen hatte sie keine Furcht mehr vor ihm und fand ihn noch viel interessanter als die Domgegend. Am Dom trafen sich nur die ganz reichen und die ganz armen Leute, auf dem Eigelstein hingegen drängten sich Menschen aller Art. Die breite, die gesamte Stadt durchschneidende Straße war vortrefflich geeignet, um zu hören, was in Köln und in der Welt gerade geschah. Der neugierigen Franziska entging nichts. Als ein gewisser Konrad von Marburg in der Stadt weilte, wusste sie das noch bevor der Erzbischof ihn empfangen konnte. Der Name sagte ihr nichts, doch musste er ein bedeutender Mann sein, denn die Leute waren nicht viel weniger aufgeregt als vor der Predigt des Maginulfus. Am Dom hoffte sie, noch mehr zu erfahren. Auf dem Wege dorthin sah sie am Straßenrand einen Mann liegen, um den sich niemand kümmerte, obwohl er offensichtlich kein Bettler war. Als Franziska zu ihm hin ging und sich über ihn beugte, bemerkte sie, dass er aus Mund und Nase blutete. "Was ist mit Euch geschehen?" fragte sie ihn und half ihm, sich ein wenig aufzurichten. "Bringe dich in Sicherheit!" stieß er mühsam hervor. "Warum soll ich das tun?" "Frag nicht lange! Lass mich hier liegen!" "Ich denke gar nicht daran." Plötzlich hörte sie hinter sich eine harte Männerstimme, die ihr bekannt vorkam. "Das ist ein Ketzer, der Reden gegen den Papst gehalten hat. Wer ihm hilft, macht sich mitschuldig." Sie blickte auf und fand sich von etwa zehn Canes umringt. Der gesprochen hatte, war Hans. Auch Eike erkannte sie. Er trug jetzt einen ebensolchen kurzen grauen Kittel wie die anderen und auch ein großes eisernes Kruzifix um den Hals. Franziska brachte kein Wort heraus. Sie hatte Angst. "Sei froh, dass ich dich kenne und verschwinde von hier!" befahl Hans. Dabei gab er ihr einen Weg aus dem Ring frei, den sie schleunigst nutzte. Doch sie war damit keineswegs in Sicherheit, denn im selben Moment beschwerte sich Eike: "Ihr wollt sie gehen lassen? Ich kenne sie auch und weiß, dass sie ihren ehemaligen Dienstherrn bestohlen hat." Die anderen ließen sich beeinflussen und begannen eine wilde Hetzjagd auf 128 das Mädchen. Die vielen Menschen, die den Eigelstein bevölkerten, hüteten sich, in das Geschehen einzugreifen, erschwerten allerdings durch ihr bloßes Vorhandensein die Verfolgung ungewollt. Indem sie verwirrende Haken schlug, gewann Franziska einen gewissen Vorsprung und konnte schließlich in den vertrauten Garten in der Weidengasse flüchten. Dort setzte sie sich ins Gras, um sich erst einmal zu erholen. Sie fühlte sich gerettet, aber das war ein verhängnisvoller Irrtum, denn plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, stand Eike vor ihr und grinste sie an. "Da staunst du wohl! Jetzt sitzt du aus eigener Schuld in der Falle." Die Sträucher hinter ihr waren so verfilzt, dass sie nicht entkommen konnte, und er kam Schritt für Schritt näher. "Bitte bleibe stehen", flehte sie ihn an. "Da müsste ich aber sehr dumm sein." "Ich werde mich wehren." "Wehr dich nur! Das mag ich." Dann packte er sie. Ihr Schreien beeindruckte ihn wenig. Er streifte ihr brutal das Kleid hoch. Eine Welle von Hass durchfuhr ihren Körper. Sie biss ihm mit aller Kraft in die Schulter und riss sich los. "Oh, du Miststück!" schrie er. "Das wirst du bereuen!" Franziska konnte nicht weiter zurückweichen, denn die dornigen Zweige eines Strauches stachen ihr bereits in den Rücken. "Bitte lass mich in Frieden!" bettelte sie noch einmal. "Es ist nicht meiner Jungfernschaft wegen, sondern ..." "Du hast Angst, mein Täubchen, ja?" Er stand einige Meter von ihr entfernt, wartete und weidete sich an ihrer Hilflosigkeit. "Du brauchst nicht auf ein schnelles Ende zu hoffen. Ich weiß, wie das quält, wenn man nicht weiß, was kommt. Da- rum lasse ich dich jetzt schön lange zappeln." Plötzlich geriet sie völlig außer Rand und Band. Sie brüllte wie am Spieß, und ihr Blick bekam den irren Glanz einer Besessenen. Dann warf sie sich auf die Erde und kroch unter den Strauch. Offenbar sah sie schließlich aber endgültig ein, dass sie auf diesem Wege nicht entkommen konnte. Schicksalsergeben sprang sie wieder auf die Füße und riss sich mit der linken Hand das Kleid auf, während sie die rechte verkrampft auf dem Rücken hielt, als sei sie gefesselt. "So nimm mich doch, du Teufel!" schrie sie und senkte den Kopf. Alles was danach geschah, erlebte das Mädchen unwirklich langsam, so als bremse Gott für einen Moment die Zeit. Langsam kam ein Schatten auf sie zugeflogen, langsam führte sie die rechte Hand mit dem Schwert vom Rücken nach vorn vor den Körper. Sie setzte den Knauf genau auf die eiserne Schnalle ihres Gürtels, umklammerte den Griff ganz fest mit beiden Händen und spannte die Bauchmuskeln an. Langsam bohrte sich die Klinge bis ans Heft von unten her in Eikes Brust. Im Stürzen wurde er regelrecht aufgeschlitzt. Gleichzeitig flog Franziska in den Strauch hinein. Röchelnd richtete er sich noch einmal auf und wandte sich dem Mädchen zu. "Ich wusste doch schon in Osnabrück, dass das Ganze nach Ärger stinkt. Warum habe ich mich nicht auf meinen Riechhaken verlassen?" Dann brach er sterbend über Franziska zusammen. Sie musste ihre ganze Kraft aufbieten, um ihn von sich zu wälzen. Dabei spritzte ihr eine Woge Blut direkt ins Gesicht. Sie hatte ihn doch gewarnt! Warum war er nicht stehen geblieben? Sie hatte es doch nicht gewollt! ... Aber sie hatte es getan! Sie zitterte, und weder die Arme noch die Beine gehorchten 129 ihren Befehlen. Die Dornen und spitzen Zweige des Strauches bohrten sich ihr ins Fleisch, doch sie spürte es nicht. Wie tot lag sie da, und ihre Gedanken stumpften ab, bis sie nicht einmal mehr wusste, ob das Blut in ihrem Kleid und auf ihrem Gesicht vielleicht ihr eigenes war, ob sie vielleicht verblutete. So lag sie auch noch da, als sie plötzlich die große Gestalt eines der Canes auftauchen sah, die Gestalt jenes Graukittels, den sie seinem Auftreten nach für den Anführer der Gruppe gehalten hatte. 130 13.Kapitel I W arst du auch am Dom? Wie viele von diesen Graukitteln hast du gesehen?" "Was machen die Waffenknechte des Erzbischofs?" "Was reden die Leute über diesen Konrad von Marburg?" Von allen Seiten mit Fragen bestürmt, wusste Mario nicht, wem er zuerst antworten sollte. "Da gibt's nicht viel zu erzählen? Ihr kennt doch die Leute. Da stellt sich so ein Prediger auf den Marktplatz und erzählt ihnen, dass eine neue Zeit anbricht und alles anders werden muss, und schon benehmen sie sich wie toll, schreien herum und prügeln sich." Er zuckte mit den Schultern und zog in tiefer Verachtung für die Bürger seine Mundwinkel herab. "Du erzählst das alles gerade so, als ob's uns gar nichts angeht", hielt ihm Ramira erregt entgegen. "Wenn sie uns erschlagen, ist's doch egal, ob sie toll sind oder nicht." "Sie werden uns schon nicht erschlagen." "So? Woher weißt du das denn so genau? Hat's dir Gott im Traum gesagt?" Das Feuer knisterte und verbreitete in der Stille des zur Neige gehenden Abends ein trügerisches Geborgenheitsgefühl. Sein Licht reichte nur einige Meter weit und schuf eine Insel inmitten des großen Platzes. Selbst Sankt Kunibert schien schon weit weg in einer anderen Welt zu stehen. Pentia liebte solche Lagerfeuer leidenschaftlich. An diesem Abend jedoch vermochte nicht zu träumen wie sonst. Jetzt, da alle schwiegen, blickte sie von einem zum anderen und fragte sich, woran jeder wohl gerade dachte. Mario versuchte, die Holzscheite neu zu ordnen, verbrannte sich dabei und schleuderte wütend einen Stecken hinter sich. Warum war er so fahrig, wenn er so fest an ein gutes Ende glaubte? Ramira verfolgte mit dem Blick die zum Himmel stiebenden Funken. Auch sie versuchte sich wohl irgendwie abzulenken. Ihre Freunde, die Schauspieler, beschäftigten sich mit den drei Kindern. Die Frau erzählte ihnen leise eine Geschichte. Melanie, die mittlerweile im neunten Monat schwanger war, sah fast flehend zu Mario herüber. Der aber konnte ihr auch nichts wirklich Beruhigendes sagen. Allein Alexanders Gesicht blieb undurchdringlich. Zu viele Spuren der Vergangenheit waren darin eingegraben, als dass neue Erlebnisse es hätten so rasch verändern können. Der Sippenälteste brach schließlich auch das Schweigen. "Wir sollten weiterziehen." "Aber warum denn?" ereiferte sich Mario sofort. "Wir haben die feste Zusicherung, dass wir hier auf diesem Platz bleiben dürfen, solange wir wollen. Wir haben Geld, wofür wir uns nirgends so viele gute Ware kaufen können wie in Köln. Wir haben noch immer Erfolg bei unseren Auftritten." "Weiß du eigentlich, wie sehr wir uns alle um dich gesorgt haben?" redete Ramira abermals auf ihn ein. "Hier ist's ruhig geblieben, aber die Leute erzählen von schlimmen Dingen." "Die Leute übertreiben." "Und selbst wenn sie übertreiben, sollten wir weiterziehen", beharrte Alexander. "Den Beldinis ist's nie gut bekommen, wenn sie aufs Glück allein vertraut haben." "Aber was wird aus mir?" rief Melanie. "Soll ich mein Kind irgendwo auf einer Straße bekommen?" "Vielleicht wäre es besser." "Niemals!" lehnte sich Mario nun sehr energisch auf. "Mögen wir meinethalben weiterziehen - aber erst, wenn das Kind auf der Welt ist." Alexander war keineswegs überzeugt, gab diesmal aber nach, und so blieb es bei der guten Absicht, ohne dass sich im Leben der Gaukler etwas Entscheidendes änderte. Allerdings fiel es allen immer schwerer, die Warnzeichen einfach zu ignorieren. Konrad von Marburg gehörte nicht nur demselben Mönchsorden an wie Maginulfus, sondern war auch ein ebenso erbitterter Ketzerfeind. Vielleicht übertraf er ihn sogar noch an Entschlossenheit. Zudem hatte ihn der Papst zwei Jahre zuvor zum Generalinquisitor ernannt und ihm damit eine gewaltige Macht übertragen. Selbst der Erzbischof versuchte, sich mit ihm gut zu stellen, wobei es diesem zweifellos nicht ganz ungelegen kam, dass ein Fremder die Blutarbeit zu übernehmen gedachte. Vorgeblich bestand Konrads Aufgabe darin, eine in der Stadt vermutete Ge- meinde der Katharer aufzuspüren und deren Mitglieder entweder zu Umkehr und öffentlicher Buße zu bewegen oder aber auf den Scheiterhaufen zu bringen. Vorgeblich wollte er sich persönlich zurückhalten und nur als Berater wirken. In Wahrheit aber unterließ er nichts, um die Bürger einzuschüchtern, und mancher befürchtete nicht ganz grundlos Verhältnisse wie in Südfrankreich, wo die Menschen einander aus Missgunst, Rache oder einfach nackter Angst gegenseitig bei den Predigermönchen denunzierten. Gewalttaten wie in den ersten Tagen nach Konrads Ankunft wurden freilich seltener. Allem Anschein nach hatte Theobaldus seine Canes zur Zurückhaltung ermahnt. Vielleicht waren die Unruhen zu diesem Zeitpunkt dem Großinquisitor nicht genehm. Die am helllichten Tage auf den Straßen und Märkten gebrüllten Sprüchen aber ließen erahnen, dass ein einziger Funken ausreichen konnte, um den Brand wieder auflodern zu lassen, und dass nicht nur die überzeugten Feinde des Papstes und der katholischen Kirche in Gefahr schwebten sondern ebenso die Juden, die Gaukler und die Bettler. II D ie Stimmung bei den Beldinis und ihren Freunden war gedrückt. Einer ging dem anderen aus dem Wege, weil jeder auf das kleinste Missgeschick, den kleinsten Widerspruch gereizt und ungeduldig reagierte. Ramira lenkte sich ab, indem sie Kunststücke bis zur Erschöpfung übte oder ihre Leier nahm und sich in die Welt ihrer Lieder flüchtete. Eines Tages aber wurde sie daraus durch einen spitzen Schrei jäh in die Wirklichkeit zurückgerissen. Der Schrei kam aus dem Wohnwagen, und sie rannte sofort dorthin. Als sie die Tür aufriss, fand sie Melanie, die kreidebleich auf dem Bett saß und sich den Bauch hielt. "Was ist? Fühlst du dich nicht wohl?" "Ich glaube, es geht los." Nun wurde auch Ramira blass. Sie war eine große Künstlerin, dafür aber fehlte ihr eine Menge Erfahrung, was die eigentlichen Pflichten der Frauen anging. Die Sippe hatte sie stets davon verschont, um ihre ungewöhnlichen Talente besser ausnutzen zu können. Wenn sie auch die alltäglichen Verrichtungen (sofern sie ihr ausnahmswei- 132 se einmal zufielen) trotz allem irgendwie meisterte - als Hebamme eignete sie sich ganz und gar nicht. Ziemlich kopflos eilte sie hinaus, um irgendeine erfahrene Frau als Hilfe herbeizuholen. Der Platz aber war wie leergefegt, und Melanie rief verzweifelt immer wieder nach ihr. Lediglich Pentia fand sie. "Was sollen wir nur tun?" "Wir werden ihr helfen und darauf vertrauen, dass Gott uns sagt, was wir tun müssen", sagte die Zwölfjährige sanft, und das wirkte sonderbarer Weise beruhigend. Melanie hatte sich auf das Bett gelegt, das Kleid hochgeschlagen und die Schenkel gespreizt. Die Wehen wurden von mal zu mal stärker. Die Stirn war nass vom Schweiß. Währenddessen versuchte Pentia, sauberes Wasser heranzuschaffen. Ramira fiel vorerst nichts Besseres ein, als immer wieder auf die Gebärende einzureden. "Hab keine Angst! Es wird alles gut. Ganz bestimmt." Innerlich bangte sie, dass Pentia nicht rechtzeitig zurückkäme. Die aber wusste gut genug, dass es auf sie ankam, und war die ganze weite Strecke bis zum nächsten öffentlichen Brunnen und zurück gerannt. Völlig erschöpft konnte sie sich danach kaum noch auf den Beinen halten, ließ es sich aber nicht nehmen, ohne eine Atempause die Wickeltücher für das Kind zurechtzulegen. Wenig später begann die Geburt. Melanie war zum Glück eine gesunde und kräftige Frau. Sie fiel nicht in Ohnmacht und wusste, obgleich sie ihr erstes Kind zur Welt brachte, ziemlich gut, was sie tun musste. Teilweise wusste sie es von Natur her, teilweise erinnerte sie sich an eine Geburt, bei der sie als Mädchen einmal hatte helfen müssen. So konnte sie Ramira Anweisungen geben. Die wiederum war im entscheidenden Augenblick so besonnen und selbstsi- cher, dass sie Melanie (die eigentlich die Wahrheit kannte) die Vorstellung vermittelte, eine verlässliche Stütze zu sein. Trotzdem lag die junge Frau am Ende mit geschlossenen Augen auf dem Bett und rührte sich nicht mehr. Ramira erschrak. Genauso hatte gewiss auch ihre Mutter dagelegen, als sie selbst auf die Welt gekommen war. Sie fragte sich, ob Mario wohl auch sein Kind für den Tod seiner Frau würde büßen lassen. "Melanie! Sag doch was! Du darfst jetzt nicht sterben!" Sie hätte alles Menschenmögliche getan, um sie zu retten, in der Hoffnung, dadurch einen Teil der Schuld, die sie auf sich lasten fühlte, abzutragen. "Drücke mir die Hand, wenn du mich hören kannst!" Erst als Melanie es tat, war sie beruhigt, zumindest für kurze Zeit. In ihrer Angst dachte sie an das Kind fast gar nicht mehr, obwohl es sich mit einer recht kräftigen Stimme durchaus in Erinnerung rief, und so blieb Pentia allein mit der Aufgabe, es zu waschen und zu wickeln. Das Wickeln war eine schwierige Prozedur, die sie mehr schlecht als recht vom Zusehen her konnte. Eigentlich sollte das Kleine vom Hals bis zu den Zehen von den Tüchern wie mit einem Panzer umschlossen sein, mitsamt den Ärmchen, und zwar so fest, dass sein Herz langsamer schlug und es deshalb sehr brav blieb und viel schlief. Pentia hatte aber Angst um das winzige Wesen und zog die Tücher so gut wie gar nicht fest, darauf vertrauend, dass bald eine erfahrene Frau kommt, die sich auf dergleichen besser versteht. Dennoch war sie stolz auf sich, fast so, als sei auch sie selbst ein wenig Mutter geworden. Mario und Alexander erfuhren erst am Abend von Melanies Entbindung und wussten sich vor Freude kaum zu fassen, zumal das Kleine ein Junge war. 133 Er erhielt den Namen David. Die junge Mutter, die nach einigen Stunden Schlaf bereits wieder erstaunlich munter wirkte, wollte es so haben und setzte sich durch. Das neue Mitglied der Sippe brachte viel Arbeit mit sich, die Melanie allein nicht bewältigen konnte. Als Helfer suchte sie sich ausgerechnet Pentia aus. Niemandem sonst wollte sie ihr über alles geliebtes Kind anvertrauen. Selbst wenn Mario es auf dem Arm hielt, blieb sie in unmittelbarer Nähe stehen, weil sie fürchtete, er würde es fallen lassen. Es war und blieb ein Geheimnis, warum sie die kleine Ritterstochter, der sie anfangs nicht für den hundertsten Teil eines Denarius über den Weg getraut hatte, plötzlich für verlässlicher als alle anderen hielt. Melanie, Pentia und Klein-David standen zueinander in einer ganz besonderen Beziehung und fühlten sich allem Anschein nach am wohlsten, wenn sie unter sich waren. III G egen Ende Oktober spürten die Beldinis die Folgen der Ketzerhysterie erstmals unmittelbar. Es kam zu keinen echten Pogromen, doch die Canes überfielen gezielt (und zweifellos auf Grund eines Befehls) einige kleine Händler, raubten sie aus und misshandelten sie. Das waren Händler, die im Ruf standen, mit Juden und Fremden Geschäfte abzuschließen, manchmal unter Umgehung der Gesetze. Dadurch blieben Mario plötzlich viele Türen verschlossen. Wollte er weiterhin gute Ware für sein Geld, musste er sich an Kaufleute wenden, die als seinesgleichen galten, an Juden also. Die Juden galten im Deutschen Reich als Unfreie, genossen in der Stadt Köln jedoch einige Privilegien, seit Friedrich Barbarossa ihnen einen Schutzbrief ausgestellt hatte. Als Kaiserliche Kammerknechte standen sie gegen eine jährliche Kopfsteuer unter dem Kaiserlichen Frieden. Das bewahrte sie freilich im Alltag noch lange nicht vor Anfeindungen und Übergriffen. Dass ihnen die Kölner ein wenig mehr Respekt entgegenbrachten als die Bürger anderenorts, war vor allem das Verdienst des großen, vor vier Jahren hinterrücks erstochenen Erzbischofs Engelbert, der mutig einen Adligen für den Mord an einem Juden zum Tode verurteilt hatte. "Hochwürden, Ihr könnt mich doch nicht dafür sterben lassen, dass ich unseren Herrn Jesus Christus gerächt habe!" versuchte der Angeklagte sich zu verteidigen. Engelbert indes entgegnete ungerührt: "Wohlan, so magst du auch noch büßen für deinen Großvater und für dessen Schandtaten während des ersten Kreuzzuges im Heere des unseligen Emich von Leiningen!" und befahl, ihm unverzüglich den Kopf abzuschlagen. Das Viertel bestand aus einer geraden, verhältnismäßig breiten, gepflegten Straße an seinem östlichen Rand und einer Vielzahl verwinkelter Gassen, die auf einen Fremden wie ein Labyrinth wirkten. Auf der gepflegten Straße stand rechts das Haus der Rates, ein lang gestrecktes, zweigeschossiges Gebäude, das sich an die Reste der Römermauer anlehnte. Dass die Bürger ihren wichtigsten Versammlungsort ausgerechnet hier in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Andersgläubigen errichtet hatten, beruhte auf einem ziemlich unreligiösen Grund. Köln war Straße für Straße aufgeteilt und den verschiedenen Zünften und Korporationen zugeordnet. Wohin sollte man also ein 134 allen gehörendes Haus bauen? Jeder Standort hätte irgendjemanden bevorzugt. Da bot sich am Ende der neutrale jüdische Grund und Boden als Ausweg an. Links überragte die Synagoge die davor stehenden niedrigeren Gebäude. Der Tatsache, dass man darin noch am alten Ritus festhielt, was einzigartig war weit und breit, verdankte das gesamte Viertel den Ehrennamen Rheinisches Jerusalem. Dicht daneben gab es noch eine vergleichsweise winzige Frauensynagoge. Mario wusste das alles aus den Erzählungen der Händler, hatte aber wenig Sinn dafür. Er war viel zu sehr dem Alltagsleben verbunden, um die komplizierten politischen und religiösen Streitigkeiten zu verstehen. So schenkte er weder dem stolzen Rathaus noch der nicht minder stolzen Synagoge einen Blick, als er in das Labyrinth hineintauchte. Er kannte sich inzwischen halbwegs aus. Geradezu endete die Gasse an der Mikwe, einem Badehaus, wo sich die Juden vor jedem Gottesdienst im fließenden Grundwasser waschen mussten. Dahinter lag das Hochzeitsund Spielhaus mit seinem großen Saal. Mario bog aber schon vorher nach links ab, stieg nach wenigen Metern ein paar Stufen nach oben und wandte sich dahinter sofort wieder nach rechts, in jene Richtung, woher ihm ein intensiver Geruch nach frischem Brot vom nahe gelegenen Backhaus her entgegenwehte. Dort befand sich der Krämerladen eines gewissen Herrn Goldstein im Keller eines von außen ziemlich ärmlich erscheinenden Gebäudes. Mario klopfte an die Tür. Ein weißhaariger, freundlicher Mann mit munteren, flinken Augen öffnete ihm, begrüßte ihn mit einem freundlichen "Schalom!" und führte ihn in eine Stube hinter dem Laden. "Adasse!" rief Goldstein. "Unser Gast wird durstig sein!" Eine etwas füllige Frau mit einem breiten Gesicht, das viel Güte ausstrahlte, servierte ein leicht süßlich schmeckendes Getränk, das Mario nicht kannte. Auch die Einrichtung des Zimmers wirkte auf ihn fremdländisch. Doch das freute ihn mehr als es ihn störte, denn er vermutete in jedem, der (wie er selbst) anders lebte als die christlichen Bürger der gewöhnlichen Viertel, einen Freund. "Was ist aus der Anzeige beim Rat geworden?" fragte der Gaukler, als Goldsteins Frau wieder gegangen war. "Gar nichts! Zwei der Ratsmitglieder schicken doch selbst ihre Ehefrauen und Töchter zu uns. Jedermann weiß, dass es in Köln kaum jemanden gibt, der sich in der Heilung von Frauenleiden besser auskennt als meine Adasse. Vor dem Schmerz und dem Tod bleibt der Glaube gering. Die Christen kommen heimlich und in den sonderbarsten Verkleidungen, aber sie kommen. Übrigens (weil wir gerade vom Rat reden) dieser Konrad von Marburg ist gestern überraschend abgereist. Es sieht so aus, als ob sich die Bürgerlichen und die Kirchlichen verständigen wollen." Mario zuckte mit den Schultern. "Etwas anderes war doch auch gar nicht zu erwarten. Irgendwann geht jeder Spuk vorbei." Der Alte wiegte den Kopf. "Was heißt das: Der Spuk geht vorbei? Für wen geht er vorbei? Für den Erzbischof? Für den Rat? Für die Bürger der Stadt? Für uns Juden? Das ist nicht dasselbe." Mario zupfte ungeduldig an seinem Ärmel. Goldstein verfiel oft auf solche Erörterungen. Wahrscheinlich fehlte ihm ein geeigneter Gesprächspartner. Mario, der fast nichts verstand, war denkbar ungeeignet, gab sich aber wenigstens so, als hörte er zu. "Der Rat und der Erzbischof sind und bleiben erbitterte Feinde. Wenn sie sich jetzt verständigen, so nur, weil sich kei- 135 ner von beiden seiner Sache sicher sein kann. Wie aber sollen sie das jetzt dem aufgehetzten Volk erklären? Die jungen Männer auf beiden Seiten brennen darauf, einem Feind den Schädel einschlagen zu dürfen. Was sagt man denen, wenn plötzlich kein Feind mehr da ist?" Er blickte Mario aufmerksam ins Gesicht, und dieser fühlte sich zu einer Antwort genötigt. "Sollen sie doch Waffenknechte werden bei irgendeinem Grafen oder Herzog." "Oh, ich glaube nicht, dass ihnen der Sinn danach steht, so rasch aus ihrem geliebten Köln fort zu gehen. Außerdem werden sie sich fragen, was sie die Wünsche eines fremden Fürsten angehen. Nein, sie wollen einen Feind in der Stadt haben und nirgends woanders." Während er noch redete, begann er schon, die Waren auszubreiten, die er anbieten wollte. "Es gefällt mir nicht, dass einige Patrizier neuerdings ähnlich wie die Dominikaner von einer sauberen Stadt reden." Dann kam er unvermittelt auf das Geschäftliche zu sprechen, und dabei wurde Mario wieder hellwach. Die Verhandlungen zogen sich (immer wieder unterbrochen durch Abschweifungen) bis in den späten Nachmittag hin. Am Ende waren beide zufrieden und verabschiedeten sich beinahe herzlich voneinander. Schwer bepackt verließ der Gaukler das Judenviertel wieder und wollte auf dem kürzesten Wege zum Lager vor Sankt Kunibert zurückkehren. Da versperrten ihm plötzlich nahe dem Platz vor dem Palast des Erzbischofs fünf Canes den Weg. Zuerst beachtete er sie gar nicht, denn er konnte sich nicht vorstellen, dass sie es tatsächlich auf ihn abgesehen hätten. Als er sich aber an ihnen vorbeidrängen wollte, hielt einer ihn am Arm fest. "Du Schwein bist also ein Judenfreund! Wir haben dich beobachtet. Erzähl uns, wofür man so viele Geschenke bekommt!" "Das sind keine Geschenke." Die jungen Männer lachten provokatorisch. "Für wie dumm hältst du uns? Du machst bei der jüdischen Verschwörung gegen die Christen mit, du dreckiger Gaukler!" Schon versuchten sie, ihm das Bündel von den Schultern zu reißen. Mario war aber kein Schwächling, und erst recht war er nicht feige. Er ließ das Bündel fahren, versetzte dem, der es nahm, im nächsten Augenblick einen kräftigen Fausthieb und eroberte es sich so zurück. Einen zweiten der Canes hielt er sich mit einem Tritt in den Magen vom Leibe. Angesichts dieser entschlossenen Gegenwehr ließen die übrigen von ihm ab und begnügten sich damit, ihm aus sicherer Entfernung Rache zu schwören. IV R amira lief, wenn sie keine Kunststücke vorführte, stets ein wenig liederlich umher. Manchmal aber legte sie es (aus welchem Grund auch immer) geradezu darauf an, einer Bettlerin zu gleichen. In einem völlig zerlumpten Kleid, das sie sich nicht wegnehmen ließ, sah sie dann so heruntergekommen aus, dass ihr selbst Mario mit einem gewissen Widerwillen aus dem Wege ging, obwohl er in dieser Hinsicht mit Melanie Kummer gewöhnt war. An einem solchen Tage kam Raimund ins Lager, um nach Franziska zu fragen. Ramira hatte gerade, um die mit ihrem Säugling beschäf- 136 tigte Melanie zu unterstützen, den Wohnwagen notdürftig gesäubert und balancierte mit einem Holzzuber voll schmutzigem Wasser die schmale Treppe herunter. Als er das sah, stürzte er aus gewohnheitsmäßiger Hilfsbereitschaft auf sie zu. Dabei jedoch (sei es, weil sie zu überrascht war, sei es seiner Ungeschicklichkeit wegen) rutschte der Zuber beiden durch die Hände, und ein beträchtlicher Teil des Wassers ergoss sich über die Kleider des Kaufherrensohnes. Ramira bemühte sich ängstlich um ihn, wusste sie doch, dass angesichts der gereizten Stimmung in der Stadt selbst ein so nichtiger Zwischenfall schlimme Folgen haben konnte. Viel bewirken konnte sie freilich nicht. Schließlich hinderte er sie sanft an ihrem hoffnungslosen Tun und sagte lächelnd: "Was macht das schon? Ich setze mich ein Weilchen an euer Feuer, bis der Rock trocken ist. Gewaschen werden muss er ohnehin." "Aber ..." "Wenn ich dir doch sage, dass es gut so ist!" Beide waren allein, denn Melanie saß mit ihrem David am Rhein, Alexander übte irgendwo mit Pentia Kunststücke, und Mario hielt sich noch im Judenviertel auf. Während Ramira - immer noch misstrauisch - dem Kaufherrensohn ans Feuer folgte und sich ihm nach kurzem Zögern schräg gegenüber auf eine Bank setzte, überlegte sie verwundert, weshalb er ihr überhaupt hatte helfen wollen, und begann zu ahnen, wer er war. "Du hast einmal Böses erlebt, nicht wahr?" fragte er unvermittelt. Sie verstand nicht, was er meinte, und sah ihn mit dem ihr eigenen Blick ihrer graublauen Augen durchdringend an. "Ja! Genau das ist es! Genauso hast du mich schon einmal angesehen. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Wir sind uns ganz zufällig begegnet, auf dem Altmarkt. Du bist nach einer Vorstellung herumgegangen, um Geld einzusammeln. ... Ich kann das schlecht beschreiben. Es ist, als ob du fragst: 'Bist du einer, der mir weh tun will?'" Er wurde plötzlich feuerrot und versuchte, seine Verlegenheit mit einem Lachen zu überspielen. "Ach, vergiss das wieder! Ich rede Unsinn." Er stocherte mit einem Stöckchen in der Glut herum. Immer wieder aber hob er den Kopf, um das Mädchen anzuschauen, und ihm wurde ganz heiß dabei. Bisher hatte er sie nur im Kostüm gesehen, bei den Auftritten, und nie etwas anderes an ihr im Gedächtnis behalten als ihre Augen. Jetzt aber, da sie diese Lumpen trug, war er bis ins Innerste ergriffen, und es gab nichts mehr an ihr, das ihm nicht gefiel. Vielleicht erinnerte sie ihn an eine Heilige. Da fühlte er, dass er diesen Augenblick nicht ungenutzt vorüber gleiten lassen durfte. Er kam zu Ramira auf die Bank, rückte dicht an sie heran und strich ihr behutsam ein paar Strähnen ihrer strubbeligen, rotblonden Mähne aus dem Gesicht. Sie wehrte ihn mit einer heftigen Armbewegung ab und fauchte: "Lass mich in Ruh! Ich bin nicht zu kaufen." Sie wollte noch mehr sagen, wollte ihm androhen, ihm die Augen auszukratzen (was sie im Notfall auch getan hätte) merkte jedoch, dass dieser Aufwand unnötig war. Raimund wurde so verlegen, dass er ihr fast Leid tat. "Du traust mir doch nicht zu, dass ich dich für eine ..." Er hatte, obwohl fast siebzehn Jahre alt, im Grunde panische Angst vor Mädchen und wäre nicht einmal im Weinrausch darauf verfallen, sich in der Schwalbengasse eine Dirne zu mieten. "Wenn ich dich beleidigt habe, bitte ich dich hiermit um Verzeihung." 137 Indem er sich vor sie auf den Erdboden setzte, erreichte er, dass sie ihn überragte. Er wollte sie um jeden Preis überzeugen, dass sie sich vor ihm nicht zu fürchten brauche. Zugleich fragte er sich, woher diese Hartnäckigkeit bei ihm mit einem Male kam. Normalerweise hätte er sich von solch unmissverständlicher Ablehnung und solcher Unnahbarkeit gründlich abschrecken lassen. Diesmal jedoch übten ungemein starke Gefühle eine unüberwindliche Macht auf ihn aus, Gefühle die er bei sich nicht kannte. "Du bist eine verzauberte Königstochter!" versicherte er. "Ich bin eine Gauklerin, die Tochter eines Gauklers", widersprach sie kühl. Als er dann aber ihrer Hände zu sich heranzog, ließ sie es geschehen. "Was soll das? Was sagst du, wenn einer deiner Verwandten jetzt hier vorbeikommt und dich so sieht?" Er würde gar nichts sagen, weil es in diesem Falle keinen Zweck hätte, eine Erklärung abzugeben. So sehr ihm das aber bewusst war, so gleichgültig war es ihm auch. Er konnte sich auf nichts mehr besinnen, das wichtig sein konnte außer ihr. "Ich werde nichts tun, was dir nicht gefällt", sagte er. Dann setzte er sich abermals neben sie. Sie machte sich steif wie ein Ast, war noch immer ganz und gar auf Abwehr eingestellt. Sie hatte jedoch keine Angst mehr vor ihm und hielt es für klug, ihn bis zu einem gewissen Maß gewähren zu lassen. Immerhin waren durch ihre Schuld seine Kleider besudelt. Er streichelte ihr zärtlich mit zwei Fingern über die Wangen und liebkoste sie mit winzigen Bewegungen seiner Hände. Sein Arm lag so sacht auf ihrer Taille, dass sie ihn kaum wahrnahm. Keine seiner Gesten erbat mehr von ihr, als nicht fort zu gehen. So saßen sie lange beieinander und schwiegen. "Du wirst noch schmutziger werden, als du schon bist", warnte sie ihn schließlich. "Schmutz kann man abwaschen - außer dem Schmutz der Seele." Er sagte, was er wirklich dachte. Das zerlumpte Kleid, die hoffnungslos zerzausten Haare, die ungewaschenen Hände und Füße, all das, was sonst selbst die Landsknechte vertrieb wie das Kruzifix den Teufel, es löste in ihm nicht einmal für den einen Augenblick ein Gefühl des Ekels aus. Seine Sinne nahmen anders wahr. Er fühlte ihre Wärme und das heftige Pochen ihres Herzens, und dahinter wurde jeder andere Eindruck belanglos. Seine sonderbaren Worte brachten sie dazu, den Kopf zu wenden, so dass beider Blicke einander begegneten. Die Fröhlichkeit, die sie in seinen Augen fand und die zuvor schon Franziska so beeindruckt hatte, verwirrte sie. Sollte es für sie wirklich noch einmal solche Sachen geben können wie Wärme und Geborgenheit? Sie versuchte, den Gedanken zu verscheuchen. Unerfüllbare, gar zu schöne Träume sind schädlich für Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen müssen. Man fällt zu tief von solchen Wolken. Doch Raimund war kein Traum. Er saß leibhaftig neben ihr. Sie musste an Arnold denken, ihren Ersatzvater, ihren Lehrer, ihren Liebhaber schließlich, dessen Tod sie nie endgültig überwinden würde. Ihr Widerstand wurde schwächer und plötzlich - sei es, dass er sie zu sich heranzog, sei es, dass sie von sich aus kam - setzte sie sich auf seinen Schoß. Er hielt sie in seinen Armen und drückte sie an sich, so wie wenn man jemanden tröstet. "Glaubst du mir, dass ich dir niemals wehtun werde?" fragte er, und sie nickte so leicht, dass er es nur merken konnte, weil seine Hand an ihrer Wange lag. 138 Ramira konnte sich an niemanden erinnern, der sich ihr jemals so behutsam und rücksichtsvoll genähert hatte, von Arnold abgesehen. Männer kannte sie nur als rohe Tiere oder als Kameraden. Raimund unterschied sich von ihnen allen derart gründlich, dass er nicht von dieser Welt zu sein schien. War vielleicht Arnold in fremder Gestalt zu ihr zurückgekehrt, ihr Arnold? Mit einem tiefen Seufzer kuschelte sie sich vollends an Raimund, den Kaufherrensohn, der sie Königstochter genannte hatte, legte den Kopf auf seine Schultern und vertraute sich ihm mit geschlossenen Augen an. Geschützt in seinen Armen fühlte sie sich unermesslich wohl. 139 14.Kapitel I F ranziska schlug die Augen auf und blickte auf eine von zwei sich kreuzenden Balken getragene Decke. Irgendwann hatte sie diese Decke schon einmal gesehen, wusste jedoch nicht mehr, wann und in welchem Zusammenhang. Der Raum, den die Decke überspannte, war ziemlich dunkel. Ein schmales Fenster, die einzige Lichtquelle, beleuchtete nur einen Teil davon, während sich der andere, größere nur erahnen ließ. Von der gegenüberliegenden Wand blätterte die Farbe ab. Wer immer hier wohnen mochte, er legte offenbar auf Behaglichkeit wenig Wert. Franziska beschäftigte sich einige Zeit damit, sich in die Umrisse der Stellen nackten Mauerwerks Figuren hineinzudenken. Das tat ihr gut, weil es sie ablenkte von Erinnerungen, die immer wieder wie Blitze durch ihren Kopf zuckten - grelle Bilder, die Schmerzen hervorriefen. Ein Mann trat ein. Wer war er? Es musste eine besondere Bewandtnis mit ihm haben. Woher kannte sie sein Gesicht? So sehr sie sich auch anstrengte, ihre Gedanken zu ordnen, sie enteilten ihr immer wieder wie Vögel. "Wie fühlst du dich?" fragte der Mann. "Ich bin müde", antwortete sie. "Du kannst gleich wieder schlafen. Vorher aber musst du etwas essen." Sie sah ein, dass sie etwas essen musste, aber sie vermochte sich nicht zu bewegen. Sie wollte aufstehen, spannte all ihre Muskeln an, glaubte zumindest, sie anzuspannen, doch nichts geschah. Ihr war, als habe ihre Seele nichts mehr mit ihrem Leib zu schaffen, und sie bekam panische Angst. Hätte sie es gekonnt, wäre sie aufgesprungen und da- vongerannt. Tatsächlich hingegen blieb sie wie fest gekettet liegen und glaubte, der Kopf würde ihr im nächsten Augenblick zerspringen. "Es geht nicht!" flüsterte sie. Der Mann strich ihr mit der Hand über die Wange, bis sie sich beruhigt hatte, und fütterte sie dann wie ein Kind. Wenig später schlief sie wieder ein. Im Traum sah sie sich durch einen Wald laufen, den Wald nahe dem Westerholthof, dem alten, nun von einer Bauernfamilie verwalteten Hof ihrer Eltern. Dort hatte sie mit den Dorfkindern gespielt, bis sie zur Erziehung nach Wildeshausen geschickt worden war. Von ihren Freunden aber fand sie niemanden mehr. Stattdessen umringten sie plötzlich sieben Riesen in grauen Kitteln. Sie glaubte sich schon verloren, als plötzlich der Teufel neben ihr stand und ihr ein gewaltiges Schwert gab. Vielleicht war das allerdings auch gar nicht der Teufel, denn er hatte zwar Hörner jedoch keinen Quastenschwanz und auch keinen Geißfuß. Zuerst fürchtete sie, das Schwert gar nicht anheben zu können, dann aber erwies es sich als federleicht. Außerdem focht es ganz von selber. Im Nu hatte es den Riesen die Köpfe abgeschlagen und aus den toten Leibern schoss ein Blutstrom hervor, der wie die Wellen einer Sturmflut an der norddeutschen Küste alles mit sich hinweg riss. Auch das Mädchen wurde von ihm erfasst und direkt vor die Füße eines von dem Zauberschwert offenbar verschonten Riesen geschleudert. Der grinste sie an und holte mit einem Baumstamm aus, um sie zu erschlagen. Da wachte sie auf. "Warum schreist du?" fragte der Mann besorgt. "Der Riese will mich erschlagen." "Der Riese? ... Hat er breite Schultern und kurze, dunkelblonde Haare? Trägt er ein Kreuz um den Hals?" "Ja, das ist er!" "Den habe ich besiegt. Du brauchst dich also nicht mehr vor ihm zu fürchten. Schlaf jetzt weiter!" Drei Tage lang hielt die Lähmung an, dann verschwand sie plötzlich. Franziska stand auf, wie betrunken hin- und herschwankend zunächst, dann aber zunehmend sicherer. Gleich zu Anfang trat sie ans Fenster. Vor ihr breitete sich ein Hof aus, der ebenso vernachlässigt aussah wie das Zimmer. Noch immer vermochte sie sich nicht zu erinnern, doch spürte sie, dass sie der Lösung des Rätsels ganz nahe war. Als dann der Mann herein trat, blickte sie ihn lange an und fragte ihn schließlich: "Heißt du Stefanus?" "Weißt du das denn nicht?" "Ich bin mir nicht sicher." "Du weiß nicht mehr, dass du hier ein paar Monate lang gewohnt hast?" "Mein Kopf ist leer." Verzweifelt kämpfte sie um ihr Gedächtnis. Wenn sie sich anstrengte, tauchten immerhin einige verschwommene Bilder aus Köln vor ihr auf - das Hahnentor zum Beispiel, der zur Weihnachtsmesse im Licht hunderter Kerzen erstrahlende Dom und die große Marienkirche. Leider konnte sie keinen Zusammenhang zwischen ihnen herstellen und wusste nicht, was sie selbst mit ihnen zu schaffen hatte. Manchmal setzte sich Stefanus zu ihr und half ihr. Dabei kam es vor, dass er etwas sagte, das sie wie ein Peitschenhieb traf. Dann weigerte sich ihr Kopf, noch weiter die Vergangenheit heraufzubeschwören. Nach und nach allerdings ertrug sie die Wahrheit. Wie wenn der Meister ein Gemälde aus immer neuen Figuren ent- stehen lässt, erst nur in grauen Umrissen angedeutet, dann immer farbiger und feiner, so vervollständigte sich auch Franziskas Erinnerung. Nach zwei Wochen wusste sie schon wieder über ihre Ankunft in Köln und über die Zeit bei den Jevers Bescheid. Sie besann sich auf den Platz vor Sankt Gereon, das Gelände um den Palast des Erzbischofs und den Entenpfuhl. Ihre Erlebnisse an der Seite des Räubers erschienen ihr ein wenig unwirklich, was aber weniger an ihrer Krankheit lag, als vielmehr daran, dass er sich ihr gegenüber ganz und gar anders verhielt als damals. Lediglich der Tag, an dem sie auf dem Eigelstein von den Canes angegriffen worden war, fehlte in ihrer Erinnerung nach wie vor. Sie ging davon aus, dass sie etwas Schreckliches erlebt hatte und dass sie Stefanus ihr Leben verdankte. Eine Woche später nahm Franziska endlich all ihren Mut zusammen und fragte rundheraus: "Was ist mit mir passiert?" "Du hast einen Rat von mir befolgt und etwas sehr Vernünftiges getan, obwohl du es nicht wolltest und bis heute nicht wahrhaben willst." Krampfhaft suchte sie in ihrem Gedächtnis nach einer Entsprechung zu diesem sonderbaren Hinweis, fand aber nichts. "Einer dieser Canes wollte dich vergewaltigen, vielleicht anschließend auch umbringen, in einem Garten an der Weidengasse. Siehst du den Garten vor dir?" Sie sah ihn vor sich, und sie wusste schlagartig auch, was sich darin zugetragen hatte. "Dafür werde ich in die Hölle kommen." Sie starrte einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand an und blieb minutenlang steif an einem Fleck stehen wie eine Statue. Stefanus redete auf sie ein, 141 doch sie reagierte nicht, hörte ihn gar nicht. II D ie Erinnerung daran, wie sie Eike getötet hatte, löste bei Franziska eine neue Nervenkrise aus. Sie aß fast nichts, lief häufig quer durch einen Raum, unterwegs vergessend, was sie eigentlich holen wollte, und wurde nachts von Alpträumen geschüttelt. Zugleich aber setzte sie sich mit ihrer Tat auseinander, versuchte, sie irgendwie in ihr Leben einzuordnen. Häufig ging sie dazu in eine ganz in der Nähe von einer Patrizierfamilie für die Schiffer des Viertels erbaute, kleine, behagliche Kirche. Dort saß sie manchmal noch nach dem Gottesdienst stundenlang im Gespräch mit Gott. Niemand störte sie dabei. Der Priester dachte vielleicht, sie würde um einen nahen Verwandten trauern. Dass sie Stefanus einmal gehasst und verachtet hatte, war ihr jetzt völlig unverständlich. Einen sanfteren und verständnisvolleren Menschen als ihn konnte sie sich gar nicht denken, und seine urwüchsige Körperkraft gab ihr jenes Gefühl absoluter Geborgenheit, das sie brauchte, um wieder gesund zu werden. Ein wenig erschien er ihr wie ein Wesen mit übermenschlichen Kräften. Wie zum Beispiel hatte er wissen können, dass sie in Gefahr war? Auf welch geheimnisvolle Weise hatte Gott ihn zu ihr geführt? Als sie sich bei ihm danach erkundigte, kostete ihn die Antwort sichtlich Überwindung. "Gott hat mir gar nichts gesagt. ... Ich ... ich war sehr oft in deiner Nähe." Überrascht blickte sie zu ihm hoch. "Dann warst du also dieser geheimnisvolle Verfolger! Aber warum?" "Ich wollte dich überreden, zu mir zurückzukommen. Seitdem du fort bist, fühle ich mich allein nicht mehr wohl." Ein Gefühl der Rührung stieg in ihr auf. Ob sie ihn mochte, wusste sie nicht, aber dass sie gebraucht wurde, dass sie jemandem wichtig war, stimmte sie so froh, dass dadurch sogar die schlimmen Erinnerungen an den verhängnisvollen Zusammenstoß mit den Canes in den Hintergrund traten. Hinterher empfand Stefanus sein Geständnis als Albernheit und versuchte seine vermeintliche Schwäche mit Unnahbarkeit und dem rüden Umgangston vergangener Zeit auszugleichen. Franziska ließ sich darauf aber nicht mehr ein, sondern blieb freundlich und redselig, und so verging auch diese Misshelligkeit innerhalb weniger Tage. Eines Abends forderte er sie nach ein paar Bechern Wein plötzlich auf, ihm zu folgen. Über die Stiege, den ungenutzten Vorratskeller und den schmalen Gang gelangten beide in den römischen Abwasserkanal. Bis hierher war der Weg nichts Besonderes für Franziska. Links lagen die drei eingerichteten Räume, in denen sie manchen Tag und manche Nacht als Gefangene hatte zubringen müssen. Wer in dieser Richtung weiterging, gelangte an den Rhein zu einem der geheimen Ausgänge. Der Kanal mündete in eine Einsturzgrube, deren Grund immer unter Wasser lag und die gegenüber durch die Kaimauer begrenzt wurde. In diese Mauer hatte der Fluss ein Loch gefressen. Stefanus war dank diesem Umstand durch beherztes Tauchen einige Male mit knapper Not Verfolgern entkommen. 142 Im linken Teil des Kanals kannte Franziska fast jeden Stein, dagegen wusste sie vom rechten fast nichts. Nun führte Stefanus sie dorthin. Wie lang der Gang in Wahrheit war, überraschte das Mädchen. Minutenlang konnte man ihn schnellen Schritts entlanggehen, ohne dass er sich in irgendeiner Weise veränderte. Was mochte wohl jetzt über ihnen liegen? Vielleicht die Plektrudisgasse? Oder bereits die Straße nach Bonn? Schließlich ging ein zweiter Kanal nach links ab - von gleicher Bauart, aber etwas niedriger. Stefanus musste sich bücken, Franziska nicht. In diesen Querkanal wiederum mündete ein Gang, der in seiner Enge an jenen hinter dem schwenkbaren Schrank im Vorratskeller erinnerte. Dann standen die beiden in einem Kellergewölbe, das bis unter die Decke mit Schätzen gefüllt war, Schätzen, die einem Adelshof zur Ehre gereicht hätten. Es gab Kisten mit goldenen und silbernen Schmuckstücken, reliefgeschmückte Tafeln unterschiedlicher Größe, Rüstungen fremdländischer Art, vieles mehr. Franziska konnte unmöglich alles überblicken. "Hast du das gestohlen?" fragte sie fassungslos und bewundernd zugleich. Stefanus lachte. "Oh nein! Nicht ein Dutzend Räuber von meiner Sorte könnten das je im Leben zusammentragen. Das ist eine Schatzkammer der Römer. Nicht weit von hier entfernt befand sich ihr Tempelberg, dessentwegen noch heute die Marienkirche im Kapitol genannt wird." Das Mädchen wich entsetzt einen Schritt zurück. "Dann sind das Opfergaben für Heidengötter?" "Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch keine Furcht davor. Jetzt gehört die Schatzkammer mir. Warum soll ich sie verschmähen, wo sich doch sogar die ehrbaren Stiftsdamen nichts daraus machen, dass ihre Kirche auf den Grundmauern des Tempels steht?" "Stefanus, ich möchte dich gern etwas fragen." "So frag doch!" "Du darfst es mir aber nicht verübeln ... Wie stehst du zu Gott? Ich sehe dich niemals in eine Kirche gehen, es sei denn, dass du daraus etwas stehlen willst. Ob du wenigstens manchmal im Stillen betest, weiß ich nicht. Ich dachte einmal allen Ernstes, dass du dem Teufel verfallen bist." Er wurde nicht wütend, wie sie befürchtet hatte, sondern setzte sich auf den Rand einer Truhe, und es war, als sei sein Blick in weite Ferne gerichtet. "Wie ich zu Gott stehe ... Es ist dein gutes Recht, mich danach zu fragen. Manchmal wünsche ich mir, selbst eine Antwort darauf zu wissen ... Ich bin mit sieben Jahren in ein Kloster gegeben worden. An meine Verwandten kann ich mich kaum noch erinnern. Mein Vater war ein ziemlich unbedeutender Graf in Lothringen. Vielleicht ist er es immer noch. Ich habe mich nie danach erkundigt." Franziska setzte sich auf eine andere Truhe ihm direkt gegenüber. "Du wirst mir vielleicht gar nicht glauben, dass ich ein wirklich vorbildlicher Mönch war. Ich wollte so sanft wie Christus sein. Wenn Arbeit verteilt wurde, meldete ich mich freiwillig für die schwerste. Wenn mich jemand beschimpft hat, bin ich zu ihm besonders freundlich gewesen. So ging das etliche Jahre lang. Ich war der Stärkste und ließ mich trotzdem von anderen Novizen verprügeln, weil ich dachte, dass ich mich nicht wehren darf. Glaube nur nicht, dass es in einem Kloster immer fromm und friedlich zugeht!" Er schnaubte heftig, und ihn packte noch immer die Wut, wenn er sich erinnerte, wie man ihn ausgenutzt hatte. 143 "Ich weiß nicht mehr genau, seit wann ich an Gottes Gerechtigkeit zweifle. Vielleicht hat mich ein bestimmtes Erlebnis, an das ich mich nicht mehr erinnere, ganz plötzlich aufgeweckt, vielleicht bin ich nach und nach schlauer geworden. Ich sagte mir jedenfalls, dass der Herr doch die Raffgierigen und Rücksichtslosen nicht so sehr bevorzugen würde, wenn er nichts für sie übrig hätte. Wenn er tatsächlich die Bescheidenen und Sanftmütigen liebt, warum lässt er sie nicht wenigstens in seiner eignen Kirche zu Ruhm und Ehre kommen? Sieh dich doch um in der Welt! Gibt es jemanden, der sich weniger an das Evangelium hält als die Bischöfe und Päpste?" Franziska wollte eigentlich nur still zuhören, doch diese Behauptung mochte sie denn doch nicht unwidersprochen hinnehmen. "Der heilige Martin hat als junger Offizier seinen Mantel entzwei geschnitten, um die Hälfte davon einem Bettler zu geben, und ist später Bischof geworden. Die meisten Priester sind von Gott erfüllt. Es mag sein, dass der Teufel sich manchmal auch als Kirchenmann ausgibt. Das lässt der Herr aber nur zu, damit wir unsere Festigkeit im Glauben beweisen können." "Woher weiß du das alles so genau?" "Daran muss man glauben!" Stefanus lachte bitter. "Man muss daran glauben, weil es die allmächtige katholische Kirche so verlangt. Ich glaube aber nicht daran. Gott hat die Menschen wie Wölfe geschaffen. Wenn du kein Wolf sein willst, wirst du gefressen." "Als Wolf lebst du vielleicht hier auf Erden ein wenig besser als andere, dafür aber kommst du nach dem Jüngsten Gericht in die Hölle." "Die ehrenwerten Mönche meines Klosters waren da ganz anderer Meinung. Sie dachten, dass sie mit Christus genauso reden können wie mit dem Abt. Wenn Christus Mensch war, ist er vielleicht auch für Schmeicheleien empfänglich. Jede Schandtat lässt sich beschönigen, wenn man die richtigen Worte findet." "Was bleibt noch an Hoffnung, wenn man nicht einmal mehr an die Gerechtigkeit beim Jüngsten Gericht glaubt?" rief Franziska verwirrt. "Hoffnung? Alle geben sich mit der Hoffnung zufrieden, zumindest alle die keinen schönen Titel führen und nicht reich sind. Dabei weiß jedes Kind, wie trügerisch solche Hoffnungen sein können. Ich habe mir abgewöhnt, mich auf etwas zu verlassen, von dem ich nicht genau weiß, dass ich es wirklich bekomme." Nach diesem Gespräch ließ Franziska die ersten Monate an der Seite des Räubers noch einmal an sich vorüberziehen und verstand vieles, was er gesagt und getan hatte, plötzlich viel besser. Dennoch blieb ihr seine Einstellung zum Leben und vor allem zu Gott unheimlich. Er war wohl nicht ganz im Unrecht mit seiner Meinung über den Zustand der Welt und gewiss nicht vom Teufel besessen, sicherlich aber auch nicht glücklich. Ihre Dankbarkeit dafür, dass er ihr das Leben gerettet hatte, war freilich unabhängig von diesen Gedanken. Sie fühlte sich ihm in besonderer Weise verpflichtet. Das bedeutete nicht zuletzt, dass sie ihm seine Launen nicht mehr verübelte. Leicht fiel ihr das in den nächsten Wochen nicht immer, denn je mehr sie sich erholte, desto wortkarger wurde er, und es hatte zuweilen den Anschein, als bereute er sein freimütiges Bekenntnis. Sobald sie auf jenes Gespräch zurückkam, gleich in welchem Zusammenhang, reagierte er gereizt. Eines Tages geschah es, dass sie mit ihm, trotz ihrer Vorsätze, hart aneinan- 144 der geriet. Sie sorgte sich um das Schicksal ihrer Schwester Pentia und ihrer Freundin Ramira, denn wenn die Canes in der Stadt wieder ihr Unwesen trieben, war es leicht möglich, dass sie auch die Gaukler behelligten. Immerhin hatte sie der Lagerplatz vor Sankt Kunibert vom ersten Tage an gestört. Von Stefanus erfuhr sie zwar, dass ihnen während des Besuchs Konrads von Marburg nichts geschehen war, doch beruhigte sie das nur zum Teil. "Können wir den Gauklern nicht helfen?" fragte sie schließlich zaghaft. "Ich meine: Im Labyrinth wären sie in Sicherheit, bis die Leute sich beruhigt haben." Er sah sie erstaunt, beinahe fassungslos an. "Bist du närrisch? Dies hier ist allein deshalb ein Versteck, weil außer mir und dir niemand davon weißt. Ich warne dich: Wenn du unser Geheimnis verrätst, erwürge ich dich." "Willst du zulassen, dass meine Schwester und meine beste Freundin umgebracht werden?" "Was gehen sie mich an? Die sind beide alt genug, sich allein durchzuschlagen. Ihnen zu helfen, wäre nicht nur gefährlich sondern auch sinnlos. Wer für diese Welt taugt, braucht keine Hilfe, wer nicht dafür taugt, geht früher oder später so oder so zu Grunde. Mit dir bin ich ein Bündnis eingegangen, weil es nützlich ist - für dich und auch für mich. Ich helfe nur Leuten, die mir später nützlich sein können." Das war wieder jener Stefanus, den sie in Erinnerung hatte. Tief enttäuscht, spürte sie den Hass und die Verachtung von damals wieder in sich aufsteigen, so sehr sie sich auch innerlich ermahnte, ihn als Lebensretter zu sehen. "Du sagst das nur so und meinst es anders!" sagte sie mit Nachdruck, fast beschwörend. "Ich meine es, wie ich es sage", gab er kalt zurück und ließ sich auf kein weiteres Gespräch mehr ein. In der darauf folgenden Nacht wälzte sich Franziska von einer Seite auf die andere und quälte sich mit dem Gedanken, ihn noch einmal der Gaukler wegen anzusprechen, doch fiel ihr, so sehr sie auch grübelte, nichts ein, mit dem sie hoffen konnte, ihn umzustimmen. Sie kannte ihn. Hatte er sich einmal festgelegt, wich er nicht mehr zurück. Aus Furcht, dass der Alltag mit ihm wieder hässlich werden würde, schlich sie sich am nächsten Morgen heimlich davon. III A ls Franziska nach ihrer abermaligen Flucht am Leystapel stand und auf den Rhein hinab blickte, überkam sie ein jähes Glücksgefühl, dessen Ursache sie sich zunächst nicht erklären konnte, wusste sie doch nicht einmal, wie sie sich das Essen für diesen Tag besorgen sollte. Vielleicht war da in ihr schon der Keim des Entschlusses, den sie wenig später fassen würde. Den Vormittag über irrte sie noch ziellos durch die Stadt, dann folgte sie ziel- strebig dem Uferweg an den Häfen, bis sie den Platz vor Sankt Kunibert erreichte, wo sie erleichtert ihre Schwester, ihre Freundin und die anderen Gaukler unbeschadet antraf. "Wo bist du gewesen?" fragte Ramira, nachdem sie sich ans Feuer gesetzt hatte. "Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Anfangs dachten wir, dass du außerhalb Kölns auf Arbeitssuche bist. Aber du hättest dich dann gewiss spä- 145 testens nach einer Woche bei uns gemeldet." "Ich kann wirklich von Glück reden, dass ich noch lebe", antwortete sie und musste nun natürlich die ganze Geschichte erzählen. "Und wie geht es euch?" fragte sie am Ende. "Wir haben uns zwei Monate lang nicht mehr gesehen, und inzwischen ist viel passiert, leider fast nur Schlechtes", antwortete Ramira. "Wir gehen so bald wie möglich fort von hier. Selbst Mario sagt jetzt nichts mehr dagegen. Die Canes werden immer dreister. Sie haben schon versucht, nachts unsere Wohnwagen in Brand zu stecken. Ich glaube nicht, dass alle Menschen hier so bösartig sind. Die meisten aber sehen weg, wenn wir angegriffen werden." "Ja, auf die braven Bürger würde ich mich an eurer Stelle auch nicht verlassen. Warum aber zögert ihr noch, wenn ihr euch schon entschlossen habt?" "Wegen dem kleinen David. Er hustet, und Melanie hat Angst, dass er auf einer langen Wanderung stirbt." "Lasst euch nur nicht zu viel Zeit!" Dann wechselte Franziska unvermittelt das Thema. "Du kennst dich doch gewiss schon gut aus in Niederich. Weißt du zufällig, wo die Familie Cranboim wohnt? Das muss eine sehr reiche Familie sein." Ramira zuckte zusammen, aber nur ein wenig, so dass ihre Freundin es nicht bemerkte. Zuerst wollte sie die Adresse für sich behalten, dann aber überlegte sie es sich anders. Raimund war nun einmal Franziskas Freund, vielleicht sogar ihr künftiger Mann. Ein Gauklermädchen hatte nicht das Recht, sich da einzumischen - abgesehen davon, dass die Ritterstochter pfiffig genug war, alles auch allein herauszufinden. "Die Cranboims sind ein weit verzweigtes Geschlecht und besitzen meh- rere Häuser. Du aber willst bestimmt nur wissen, wo dein Raimund zu Hause ist. Gehe immer geradeaus am Ufer entlang! Du kommst dann zur Straße des heiligen Klemens. Dort suchst du ganz einfach das Haus mit einer großen, schwarzen Krähe am Giebel." Es war nicht weit bis dorthin. Franziska stellte verblüfft fest, dass sie dem Anwesen schon oft ziemlich nahe gewesen war. Die Straße Unter den Krähenbäumen mündete am Kunibertstift in die Straße Unter den kalten Häusern. Bis dorthin hatte Raimund sie bei den Spaziergängen geführt, niemals weiter. Die nächstfolgende Straße aber war eben jene des heiligen Klemens. Die dem Rhein zugewandte Frontseite des Hauses bot einen prächtigen Anblick. Über dem Erdgeschoß erhoben sich zwei Stockwerke, und jede der drei Fensterreihen hatte eine andere Form. Beeindruckend waren vor allem die mit Ornamenten verzierten Doppelbögen im ersten Obergeschoß, wo das Mädchen einen Festsaal vermutete. Da das Haus annähernd dieselbe Breite und Länge hatte, erinnerte es an die Wohntürme mancher Herrensitze auf hohen Bergen. Nur ein wie eine Nase nach hinten herausragendes Nebengebäude beeinträchtigte die geometrische Regelmäßigkeit. Franziska dachte bei sich, dass man in einem solchen Haus nicht schlechter Hof zu halten verstand als im Schloss mancher Grafen. Das gab ihr einerseits ein Gefühl des Vertrautseins, stimmte sie aber auch beklommen, denn sie fürchtete, man werde sie für eine Vagabundin halten und einfach davonjagen. Die Magd, die ihr auf ihr Klopfen hin öffnete, beäugte sie dann auch tatsächlich misstrauisch von oben bis unten. "Was willst du? Almosen für die Armen gibt es in zwei Stunden hinten im Hof." 146 "Ich bin keine Bettlerin sondern eine gute Bekannte von Raimund." Nun wurde die Magd erst recht misstrauisch und war wohl schon drauf und dran, die Tür zuzuschlagen, als der Hausherr hinzukam. Franziska schätzte den äußerlich eher unbedeutend wirkenden, kleinen Mann Mitte vierzig richtig ein, ohne ihn zu kennen. Sein Auftreten verriet ihn als einen Menschen, der Erfolg hatte und zu bestimmen gewohnt war. "Wer ist dieses junge Mädchen?" fragte er beiläufig, während er nach seinem Kutscher Ausschau hielt. "Sie behauptet, Euren Sohn Raimund zu kennen." "Dann ruf ihn, damit er klärt, was es damit auf sich hat! Ich werde frühestens in drei Tagen zurück sein." Franziska wurde ins Haus gebeten in einen schmalen Durchgang, der geradeaus zur Haupttreppe führte. Rechts befand sich ein geräumiges Kontor mit zwei Fenstern zum Fluss hin. Dort sollte das Mädchen warten. Während sie sich umschaute und erstmals überlegte, ob sie sich hier wohl fühlen könnte, fiel ihr vor allem die vornehme Ruhe auf. An das Kontor grenzte die Schlaflaube der Hausdiener. Dahinter lagen Wirtschaftsräume. Dem Geruch nach konnte auch die Küche nicht fern sein. Dort wurde gearbeitet, aber ohne Geschrei und Geklapper. Raimund war, als er Franziska sah, derart erschrocken, dass er vergaß, sie zu begrüßen. Noch verlegener wurde er, als dicht hinter ihm seine Mutter eintrat. Anders als bei ihrem Mann ging von ihrem Wesen nichts Herrisches aus. Sie war eine hübsche, mädchenhaft zierliche Frau mit blonden, schulterlangen, lockigen Haaren, der man ihre fast erwachsenen Söhne kaum zutraute. So jugendlich erschien sie aber nicht nur ihrer Figur wegen sondern mehr noch auf Grund ihrer offenen, freundlichen Art. Obgleich sie noch nicht wusste, welcher Natur Raimunds Verhältnis zu ihr war, gab sie Franziska lächelnd die Hand und setzte sich zu ihr. "Ich glaube, ich kenne dich noch nicht." Das Mädchen stellte sich vor, wobei sie betonte, dass sie durch unglückliche Umstände in die Rolle einer Herumtreiberin geraten war. Von ihrem Vater, dem Ritter mit Ansprüchen auf den Grafentitel, erzählte sie freilich nichts, denn sie fürchtete, danach nicht mehr ernst genommen zu werden. Umso eifriger berichtete sie von Raimunds Rettungstat und von einigen Erlebnissen an seiner Seite. Damit jedoch auch dabei kein falscher Eindruck entstehen konnte, versicherte sie am Ende: "Es ist nichts Unkeusches zwischen uns vorgefallen." Kaum hatte sie das freilich ausgesprochen, zitterte sie, dass womöglich ihr ungeschickter Annäherungsversuch im Garten an der Weidengasse hier schon bekannt sein könnte. Da Frau Cranboim indes noch immer freundlich lächelte, war das eher unwahrscheinlich. "Wenn du möchtest, kannst du mit uns essen. Außer meinem Mann sind heute auch Jan und die beiden Mädchen zu Mittag nicht im Hause, und da können wir einen Gast gut gebrauchen." Franziska nahm die Einladung gerne an. Gegessen wurde im ersten Obergeschoß. Der eigentliche Festsaal wurde in der kalten Jahreszeit fast nie benutzt, denn so hoch und ausgedehnt wie er war, ließ er sich nur mit Unmengen von Holz beheizen. Das Familienleben spielte sich im danebenliegenden kleinen Saal ab. In die Diele davor mündete die Treppe. Von dort aus gelangte man auch zum Nebengebäude, wo sich (von der darunter befindlichen Küche mäßig gewärmt) die Schlafräume der Herrschaftsfamilie befanden - vorn das der 147 Eltern und Töchter, dahinter ein deutlich kleineres für die Söhne. Beim Essen ging es hier sehr viel feierlicher zu als bei den Jevers. Die Tafel war mit einem fleckenlos weißen Tuch bedeckt, und an jedem Platz lagen ein Messer und ein Löffel mit aus Geweih geschnitztem Griff. Zum Trinken dienten Gläser mit einem Muster aus gekreuzten Rippen, Maigeleine genannt. Gegessen wurde von runden Holzplatten, die zum Auffangen der Soßen mit Brot belegt waren, wobei das Brot nicht ganz bis zum Rand reichte, so dass das eingebrannte Muster sichtbar blieb. Vor Beginn der Mahlzeit standen alle auf und die Hausfrau sprach (in Vertretung ihres Mannes) ein Dankgebet. Dann reichte ein Diener eine Schüssel und ein Gießgefäß mit Wasser herum, damit sich jeder die Hände waschen konnte. Das war durchaus angebracht, denn vieles aß jeder unbefangen mit den Fingern. Der Braten allerdings war vom Koch geschnitten worden, so dass die mundgerechten Stücke nur noch aufgespießt werden mussten. Mehrere Gänge folgten aufeinander, doch hätte es recht unschicklich gewirkt, sich übermäßig den Magen voll zu schlagen. Die meisten Schüsseln blieben halb voll und wurden von einem Diener hinunter in den Hof getragen, wo bereits ein Dutzend Bettler auf die Almosen wartete. Diese Spenden waren Pflichten der christlichen Nächstenliebe, und keine auf ihr Ansehen bedachte Familie durfte wagen, sich ihr zu entziehen. Franziska fühlte sich an den Grafenhof von Wildeshausen zurückversetzt und beachtete ganz unbewusst die einst einstudierten, hier wieder gültigen Verhaltensregeln. Siglinde Cranboim fiel das auf. Allerdings sagte sie nichts. Ihre Ähnlichkeit mit Gundula Jever war nur oberflächlich. Die Liebe zur Harmonie vernebelte ihr nicht den Blick für die Wirklichkeit. Sie hatte einen wachen Verstand und kannte sich aus in der Welt. Außer Siglinde, Franziska, Raimund und zwei Geschäftspartnern der Cranboims, die sich für ein paar Tage in der Stadt aufhielten und im Hause wohnten, saß noch ein alter, schon recht gebrechlicher Mann mit am Tisch - Johannes, Raimunds Großvater väterlicherseits. Seit er sich vor einigen Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, betrachtete er sein Lebenswerk als abgeschlossen. In die Angelegenheiten seiner beiden Söhne mischte er sich so gut wie nie mehr ein und beriet sie allenfalls dann, wenn sie das ausdrücklich wollten. Aber er war noch bei klarem Verstand und beobachtete als Zuschauer aufmerksam alles, was um ihn herum geschah. Anfangs hatte der erstgeborene Sohn, der im Stammhaus der Familie an den Krähenbäumen wohnte, die besseren Möglichkeiten besessen, seine Vorrangstellung aber schon bald eingebüßt. Während dem älteren Zweig das Pech anzuhaften schien, blühte der jüngere sichtlich auf. Der alte Johannes freilich glaubte nicht an Glück und Unglück im Geschäft. Seiner Meinung nach bestand Wolfhards Vorteil ganz einfach in seiner Frau. Wolfhard hatte Siglinde als blutjunges, unerfahrenes Mädchen geheiratet und in den folgenden Jahren oft allein gelassen. Sie war nahe daran gewesen, auf die Stufe einer verträumten, ungeschickten Hausangestellten herabzusinken. Da hatte der Schwiegervater begonnen, sie regelmäßig zu Vertragsabschlüssen mitzunehmen. Er zeigte und erklärte ihr die Urkunden, ermunterte sie gelegentlich, sich im Voraus eine eigene Meinung zu bilden. Später ließ er sie mit kleinen Warenmengen und einem begrenzten Geldbudget selbständig Handel treiben. 148 Noch später übertrug er ihr einfache Buchführungsaufgaben. Schließlich gab er ihr das Wechselbuch, das wichtigste von allen Büchern, in volle Verantwortung und kontrollierte immer seltener. Im Unterschied zu seinem Bruder konnte Wolfhard die Stadt getrost für mehrere Wochen verlassen, ohne befürchten zu müssen, dass ihm ein gewinnbringendes Geschäft entging. Siglinde besaß inzwischen sämtliche Vollmachten, um Waren selbst in großen Mengen zu kaufen oder zu verkaufen, um Kredite aufzunehmen, Schulden einzutreiben und sogar Prozesse anzustrengen. Sie hatte Johannes niemals vergessen, was sie ihm verdankte, und kümmerte sich, seit ihn die körperlichen Kräfte allmählich verließen, in rührender Weise um ihn. Allerdings schlief er nach wie vor im Stammhaus der Familie. Er war an seine Stube dort zu sehr gewöhnt, um sich von ihr trennen zu wollen. Wenn sie nicht den Schwiegervater bediente, unterhielt sich die junge Frau mit Franziska. Beide fühlten vom ersten Augenblick an eine gewisse Seelenverwandtschaft. Raimund jedoch verhielt sich weiterhin sonderbar. An der Befürchtung, seine Familie würde eine Verbindung zu diesem (für eine Ritterstochter recht abgerissen aussehenden) Mädchen empörend findet, konnte das nun eigentlich nicht mehr liegen. Franziska nahm sich vor, ihn später zu fragen. Vorerst fand sie keine Gelegenheit dazu, denn sie wollte Siglinde das Angebot, ihr das Haus zu zeigen, auf keinen Fall abschlagen. Das zweite Obergeschoß war schmaler als das erste, weil hier bereits das Dach ansetzte. Neben mehreren Lagerräumen befand sich hier eine besondere Stube für Jan, ein kleines Kontor im Grunde, das den künftigen Hausherrn bezeichnete. "Das Haus ist fast hundert Jahre alt." "Tatsächlich? Ich hätte es viel jünger geschätzt." "Wolfhards Großeltern haben nur das Beste zum Bauen genommen: Stein statt Fachwerk für die Wände, Schieferplatten statt Ziegel oder Stroh für das Dach." Den ganzen Nachmittag liefen sie plaudernd so von einem Raum zum anderen und sahen sich auch die beiden Höfe und den Garten an. Als sie schließlich wieder im kleinen Saal anlangten, fragte Franziska: "Warum habt Ihr so viel Vertrauen zu mir?" und Siglinde entgegnete, ohne zu zögern: "Ich weiß zwar nicht, ob du zu unserem Raimund passt, aber dass du aus guter Familie stammst und keine Diebin bist, das sehe ich." Dabei war sie sich ihrer Sache so sicher, dass sie ihr im Vorraum an der vorläufig nicht benutzten Tür zum großen Saal einen Schlafplatz anbot. "Ich kann dich doch jetzt nicht auf die dunkle Straße hinausjagen!" meinte sie. 149 15.Kapitel I A u! Du ziepst mich!" protestierte die dreizehnjährige Katharina und verzog das Gesicht. "Ich sehe mich ja schon vor", beschwichtigte die Zofe, eine etwas beleibte Frau unbestimmbaren Alters. Sie hatte die Langmut eines Engels, was für ihre Arbeit bei den Cranboims auch erforderlich war, denn die beiden Töchter des Hauses konnten sich an Eigensinn mit Fürstenkindern messen. "Du willst doch die Hübscheste in der Kirche sein, also musst du dich auch kämmen lassen." "Der neue Kamm taugt nichts. Wo ist denn der andere geblieben, der mit den Elfenbeinzinken?" Ohne eine Antwort abzuwarten, sprang sie plötzlich auf und kramte hektisch in einem Schrankfach. "Ob die silberne Spange zu meinem neuen Kleid passt? Ach nein! Die gefällt mir nicht mehr, seit Radegundis eine ähnliche hat." "Ich denke, das ist deine Freundin." "Oh! Das war einmal. Sie ist eingebildet, weil ihre Eltern Patrizier sind. Dabei haben sie Schulden. Vater sagte, dass wir auch bald zu den Patriziern gehören ... Ich muss heute unbedingt noch lernen. Morgen kommt wieder dieser neue Lehrer. Ich mag ihn nicht. Er ist immer so streng." "Sei nicht störrisch und denk daran, was deine Mutter dir gesagt hat! Wenn du schon jetzt schreiben, rechnen und mit Büchern umgehen lernst, wird es dir später in der Ehe leichter fallen, deinem Mann eine Stütze zu sein." "Ich weiß gar nicht so recht, ob ich mich freuen soll, dass Vater nach einem Mann für mich sucht. Natürlich will ich keine alte Jungfer werden. Die Hoch- zeitsfeier wird bestimmt großartig sein. Es müssen mindestens siebzig Gäste kommen. Bei den Overstolzens waren es damals über hundert. Aber so einen hässlichen Kerl wie den Leopold von nebenan will ich auf gar keinen Fall. Lieber gehe ich ins Wasser." "Katharina! So etwas darfst du nicht einmal denken." "Na ja, vielleicht gehe ich nicht ins Wasser. Aber ich wäre dann sehr unglücklich, und das wird Vater ja wohl nicht wollen." Während sie so plapperte, blieb sie wenigstens eine kurze Zeit lang ruhig sitzen, was der Zofe Gelegenheit gab, das prächtige, rotblonde, bis zur Hüfte hinabreichende Haar in eine ansprechende Frisur zu legen. Kaum war das geschafft, kam die elfjährige Dorothea herein, woraufhin Katharina augenblicklich wieder aufsprang. "Willst du etwa so in die Kirche gehen?" entrüstete sie sich. "Das Tuch passt überhaupt nicht zu dem Umhang." "Ich ziehe an, was mir gefällt!" schrie die Kleine und ballte die Fäuste, wild entschlossen, ihr grün-gelb gemustertes Lieblingstuch unter allen Umständen zu verteidigen. Wer die beiden nur oberflächlich kannte, kam leicht zu der Ansicht, sie wären wie Hund und Katze. Die selbst für ihr Alter auffällig kleine, zerbrechlich schlanke und zierliche Dorothea fühlte sich von so ziemlich jedem unterdrückt und benachteiligt, besonders aber von ihrer Schwester. Entsprechend gereizt reagierte sie beim geringsten Anlass. Versuchte gar jemand, ihr mit Gewalt etwas wegzunehmen, kam es vor, dass sie wie ein wildes Tier kratzte und biss. Katharina ließ es aus Angst um ihr Gesicht darauf zu- meist nicht ankommen. Im übrigen war sie selbst eher klein und zierlich und wirkte erst durch ihre Erwachsenenkleider, nach denen sie leidenschaftlich verlangte, wie eine kleine Dame. "Sag du ihr, dass das hässlich aussieht!" versuchte sie, die Zofe als Verbündete zu gewinnen. "Lass ihr doch ihren Willen! Wir haben nicht mehr viel Zeit." Maulend kehrte das Mädchen auf den Stuhl zurück und ließ sich die Kette um den Hals legen. Über die Schulter hinweg unterhielt sie sich unterdessen mit ihrer Schwester, die sich, seit sie keine Gefahr für ihr Tuch mehr witterte, schnell beruhigt hatte. "Was hältst du denn von dieser Franziska?" "Ich find sie nett." "Na ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich die Tochter eines Ritters ist. Vater glaubt das auch nicht." "Es ist mir egal, was ihr glaubt. Sie kann so schön Geschichten erzählen." "Reg dich doch nicht gleich wieder auf! Du kannst dir ja weiter was von ihr erzählen lassen. Außerdem wäre Raimund schön dumm, wenn er sie nicht will. Für den findet Vater ja gar keine andere, so wie er sich anstellt!" Wolfhard Cranboim und sein Sohn Jan waren schon fertig angezogen und schlenderten hinter dem Haus über die beiden Höfe, vorbei an den Hütten der Dienstleute, den Werkstätten, den Ställen und der großen Scheune. Die Anlage des Anwesens war unverkennbar den Schlössern des Landadels nachempfunden. Das dafür notwendige große Grundstück hatte Wolfhards Großvater lange vor der Stadterweiterung von 1180 im damals noch außerhalb der Befestigungsanlagen liegenden Land für wenig Geld erworben. Wie durch ein Wunder war es in mehreren Kriegen und Revolten unbeschädigt geblieben und allmählich immer mehr gewachsen. Ein Gebäude, worin man Wasser zum Baden anwärmen konnte, gehörte zu den jüngsten Erweiterungen. Den familieneigenen Brunnen gab es seit dreißig Jahren. "Ich habe gestern mit einem Berater des Erzbischofs gesprochen. Seiner Meinung nach wird bald wieder Ruhe in Köln einziehen. So sehr ich Veränderungen fordere - dieses tobsüchtige Gesindel richtet nur Schaden an. Einige Kaufleute trauen sich nicht mehr in die Stadt." Der siebzehnjährige Jan nickte, nicht nur aus Ehrfurcht sondern aus (auf Kenntnis der Lage beruhender) Überzeugung. Er war nicht groß (ein Merkmal, das allen Familienmitgliedern mehr oder minder ausgeprägt anhaftete), hatte zarte, helle Haut (durch die stellenweise die Adern schimmerten) und blondes, gepflegtes Haar, das ihm bis auf die Schultern reichte. Man mochte kaum glauben, dass ihm das energische Wesen und der Ehrgeiz des Vaters im Blute lag und dass er sogar hart zupacken konnte, wenn es nötig war. Wolfhard Cranboim schätzte ihn beinahe schon wie einen Teilhaber, übertrug ihm wichtige Aufträge, bei denen er eigene Entscheidungen treffen musste, und hörte sich interessiert seine Meinung an. So war es auch diesmal, als Jan zu bedenken gab: "... vorausgesetzt, der Erzbischof hat über die Dominikaner hier noch genügend Macht. Diesen Maginulfus halte ich für einen Eiferer, der sich nicht leicht beiseite schieben lässt." "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Schwachsinniger, der eigentlich ins Hospital gehört, plötzlich zu Einfluss kommt. Aber selbst seine Macht ist begrenzt. Wenn er sich nicht in die Erfordernisse schickt, wird er es eines Tages dahin bringen, dass selbst sein eigener Orden ihn loswerden will. Der Besuch seines genauso schwach- 151 sinnigen Bruders Konrad hat sein Possenspiel nur ein wenig verlängert. Ein halbes Jahr gebe ich ihm noch." "Was ist aus dem Bauholzgeschäft geworden?" wechselte Jan das Thema. "Die Verträge sind unterschrieben. Der Rat muss aber noch eine Beschwerde verhandeln." "Was für eine Beschwerde?" "Wenn sich das Geschäft entwickelt, wie wir hoffen, können wir die Preise höher treiben. Das empfinden drei Familien (die Namen kann ich mir wohl sparen) als Verletzung der Gleichheit." "Ich verstehe. Haben wir Aussicht auf Erfolg?" "Beim Rat natürlich nicht. Ich werde aber meine Verbindungen zum Domkapitel ausnutzen. Noch ist der Erzbischof Stadtherr." Sieglinde Cranboim und Franziska flüchteten vor dem durch die Mädchen verursachten Aufbruchsdurcheinander in Jans Zimmer im zweiten Obergeschoß. Sie halfen sich gegenseitig beim Ankleiden und kamen rasch voran. Im Stockwerk unter ihnen wurde geschrieen und gezetert. Türen schlugen, und Truhendeckel fielen polternd ins Schloss. Doch das ging sie alles nichts an. "Das erinnert mich an die Steilküste bei Sturm. Unten schäumt das Wasser, und man steht oben und ist in Sicherheit." "Du sehnst dich noch sehr nach deiner Heimat?" "Nur manchmal. Ich möchte wieder zu einer Familie gehören, egal ob hier in Köln oder im Norden." "Würde dich dein Vater wieder bei sich aufnehmen?" "Er würde sich freuen, mich wieder zu sehen. Aber ich habe noch immer Angst. Ich bin ja nicht vor meinem Vater geflohen sondern vor Burchard von Wildeshausen." "Wer ist das?" Sie erzählte es ihr. "Und dein Vater ist Ritter bei diesem Burchard?" "Ja, leider. Dabei leben die Westerholts schon viel länger in dieser Gegend als alle Oldenburger Grafen. Die kamen erst vor knapp einhundertfünfzig Jahren aus dem Lüneburger Land dorthin und waren danach erst einmal nur Vizegrafen bei den sächsischen Billungern. Wir besitzen Urkunden, die beweisen, dass wir freie Herren auf unserem Grund und Boden sind und niemandem zu dienen brauchen." Sieglinde Cranboim musste lächeln, wie sich Franziska über das ihrer Familie zugefügte Unrecht ereiferte. "Es wird sich eines Tages schon ein Weg finden, eure Ansprüche durchzusetzen." "Ja, vielleicht ... Wo steckt eigentlich Raimund?" "Er ist schon auf dem Weg. Ich würde gern wissen, was in ihm vorgeht. Seit ein paar Wochen verhält er sich eigenartig - kommt spät nach Hause, ohne zu sagen, wo er war, hat Geheimnisse vor uns, ist ohne ersichtlichen Grund mal fröhlich und ausgelassen, mal völlig niedergeschlagen. Warum vertraut er sich nicht jemandem an?" "Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht mag er mich nicht und denkt, dass ich mich ihm aufdrängen will." "Nein, das glaube ich nicht. Etwas anderes bedrückt ihn." 152 II D as Kunibertstift stand auf traditionsreichem Grund, denn schon zur Zeit der ersten Frankenkönige gab es an dieser Stelle eine dem heiligen Klemens geweihte Kapelle. Bischof Kunibert ersetzte sie durch eine größere Kirche, die bald durch die von Pippin dem Älteren gestifteten Reliquien der heiligen Ewaldi eine besondere Bedeutung erhielt. Die Chorherren zogen gegen Ende des achten Jahrhunderts ein. Sie gaben der Kirche nicht nur ihren Namen, sondern mehrten auch ihren Besitz in einer (selbst für Kölner Verhältnisse) erstaunlichen Weise. Der Reichtum veranlasste sie schließlich, den ihrer Meinung nach zu unscheinbaren Bau bis auf die Grundmauern abzureißen und zu ersetzen. Seit vierzehn Jahren war das Gelände nun schon geprägt von Steinmetzen und Maurern. Auf der Rheinseite fiel das nicht auf, denn der Chor mit seinen mächtigen Flankierungstürmen stand bereits. Langhaus und Westbau jedoch waren erst bis zur Hälfte gediehen. Mit dem Westbau hatte es insofern eine besondere Bewandtnis, als er den vornehmen Bürgern des Stadtteils Niederich als Pfarrkirche dienen sollte. Um den Gottesdienst schon vor der Fertigstellung zu ermöglichen, hatte man ein provisorisches Dach gespannt. So gewann man im Innern (zumal angesichts der reichen Innenausstattung) durchaus den Eindruck, es sei nur noch wenig zu tun. Übrigens hatten die Chorherren die Baupläne nicht nach dem neuen französischen Stil, sondern nach den alten Formen entwerfen lassen - was ihrer Einstellung zur Welt entsprach. Als die Cranboims in die Kirche einzogen, wurden bereits die ersten Gesänge angestimmt. Dennoch blieben sie nicht unbeachtet. Die Leute drehten sich um und tuschelten miteinander. Katha- rina und Dorothea sonnten sich in den bewundernden Blicken, die sie auf sich zogen. Franziska suchte unterdessen nach Raimund und fand ihn schließlich mitten im Gedränge vorn kurz vor den Altarstufen. "Bist du schon lange hier?" fragte sie, weil ihr nichts Besseres einfiel. "Nein." "Deine Schwestern haben getrödelt, bis es zu spät war." "Sie haben es ja auch wirklich schwer, die Ärmsten! So viele Kleider, Umhänge, Tücher, Spangen, Diademe und was weiß ich noch alles zur Auswahl!" Während er das sagte, verzog er keine Miene. Er neigte von jeher zur Ironie. Seit einigen Tagen allerdings arteten seine Bemerkungen zumeist in bissigen Zynismus aus, so dass niemand recht wusste, ob er darüber noch lachen sollte. Franziska zog es vor, ihm seine Ruhe zu lassen, wie er es offenbar wollte, blieb aber in seiner Nähe stehen und lenkte sich ab, indem sie sich in der Kirche umsah. Ganz vorn wie ein Türhüter stand überlebensgroß der heilige Martin von Tours, in der Hand ein eisernes Schwert, im Begriff, damit seinen Mantel zu zerteilen. Rechts schauten die vier Evangelisten väterlich-gütig von ihren Sockeln aus auf die Gemeinde herab. Nicht weit von ihnen gab es noch ein paar Nischen, die das Mädchen aber nicht gut einsehen konnte, so dass sie die Heiligen darin nicht erkannte. Umso prächtiger hoben sich die Stadtheiligen Ursula, Gereon und Gregor Maurus ab. Deren üppigen Goldschmuck hatten sich die Niedericher einiges kosten lassen. Nahe am Altar war eine ganze Galerie kleiner Bischofsskulpturen aufgereiht. Franziska vermutete, dass sie die 153 verdienstvollsten Stadtherren Kölns darstellten. Auch Katharina interessierte sich nicht sonderlich für die Gebete, die der Priester mit melodischer Stimme der Gemeinde vorsang. Unterdrückt kichernd stieß sie ihrer Schwester in die Seite und wies sie auf einen jungen Mann hin, der sich nun schon zum dritten Mal nach ihr umgedreht hatte. "Kennst du den?" "Nein, den sehe ich heute auch zum ersten Mal." "Entweder er ist Gast in Köln oder er kommt aus einem anderen Viertel. Weißt du übrigens schon, dass wir zu einem Ball der Hirzelins eingeladen sind? Ich finde das furchtbar aufregend. Vater hat bestimmte Pläne mit mir, will aber noch nicht darüber reden." Dorothea hörte halb bewundernd, halb neidisch zu und verkündete, nur um etwas dagegenzuhalten: "Vaters Geschäftsfreund aus Hamburg hat mir eine Bernsteinkette geschenkt. Die ist viel schöner als alle deine Ketten." "Bernstein leuchtet gar nicht richtig und außerdem ..." Während die beiden Mädchen wieder einmal in Streit gerieten, wurden sie immer lauter, bis ihre Mutter sie zur Ordnung rief. Katharina schwieg nun zwar, doch man sah ihr dennoch an, dass sie voller Unruhe steckte und un- geduldig auf den Segen wartete. Sie war immer geschäftig, ganz gleich ob sie wirklich etwas Sinnvolles zu erledigen hatte oder nicht. "Einerseits wirft sie den jungen Männern Blicke zu und andererseits ist sie noch ein rechtes Kind", flüsterte Sieglinde Cranboim ihrem Mann ins Ohr. "Ich will sie ja auch so bald noch nicht verheiraten, sondern vorläufig nur ein wenig vorfühlen. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir uns über sie mit einer alten Geschlechterfamilie wie den Hirzelins verbinden könnten. Das kann den Weg in den Rat ebnen." "Wenn unser Raimund mit der Tochter eines Ritters ..." "Du bist wirklich hartnäckig!" "Du glaubst nicht, was Franziska erzählt." "Wenn ich jedem glauben würde, was er erzählt, wäre ich ein sehr schlechter Kaufmann." "Hast du sie denn noch nie beobachtet?" "Ich werde das alles nachprüfen lassen. Einverstanden?" "Aber lass dir nicht gar zu viel Zeit damit! Raimund bereitet mir Sorgen. Ich weiß nicht so recht warum, aber ... Er träumt zuviel und sondert sich ab. Mit einer tüchtigen Frau an der Seite ..." "Wenn du dich immer um ihn sorgst, wird er noch weichlicher, als er ohnehin schon ist." III F ranziska hatte sich, Kopfweh vorschützend, in ihr neues Zimmer zurückgezogen. Eigentlich war sie entschlossen gewesen, das offenbar Unvermeidliche gefasst und würdevoll über sich ergehen zu lassen. Sie hatte sogar ein gewisses Maß an Verständnis dafür aufgebracht. Jetzt aber konnte sie sich dennoch nicht dazu überwinden, sich dort unten im kleinen Saal mit an den Tisch zu setzen. Zu sehr hätte sie sich der Demütigung wegen geschämt. Bisher war ihr nie bewusst geworden, dass sie wie eine Almosenempfängerin ohne nennenswerte Gegenleistung Essen, Trinken und nicht zuletzt ein Nachtlager bekam. Die vornehme Höf- 154 lichkeit, mit der ihr jeder im Hause gegenübertrat, die Dienstleute eingeschlossen, hatte diesen Eindruck bisher verhindert. Wie selbstverständlich war für sie ein Lagerraum im zweiten Obergeschoß geräumt und zu einem Gästezimmer umgebaut wurden - wenn auch ein wenig hastig und behelfsmäßig. Sieglinde Cranboim kümmerte sich höchstselbst darum, dass es ihr an nichts mangelte. Doch spätestens seit diesem Tag musste sie (die durch ihre Erfahrungen mit vornehmen Familien zwischen formaler Höflichkeit und ehrlichem Wohlwollen durchaus unterscheiden konnte) endlich der Tatsache ins Auge blicken, dass ein Wolfhard Cranboim sie nur als ebenbürtig anerkennen würde, wenn er einen Beweis für ihre Herkunft fände. Von seinem letzten Urteil hing nicht nur ihr Gastrecht auf lange Sicht, sondern auch ihr Verhältnis zu Raimund ab. Als Tochter eines Ritters mit Ansprüchen auf den Grafentitel (und seien diese auf noch so viel juristischer Spitzfindigkeit aufgebaut) war sie eine würdige Schwiegertochter, als einfaches Mädchen mit Klugheit und guten Manieren nur ein bedauernswertes Geschöpf. Alles würde sich entscheiden durch die Aussage eines ziemlich unbedeutenden Mannes, eines Kaufmanns von der Art, wie es hunderte gab, der sich durch nichts abhob außer durch seine Herkunft aus Bremen. Obwohl sie ahnte, dass Wolfhard Cranboim zu viel Fingerspitzengefühl besaß, um plump seine Absichten offen zu legen, dass er seinen Gast vielmehr in Gespräche über unverfängliche Themen verwickelte, um nebenher zu erfahren, was er wissen wollte, erschien es ihr, als ob man dort unten ausnahmslos über sie spräche, sie mit Worten entkleidete, sie wie eine zum Kauf stehende Leibeigene abschätzte. Sie blieb bis zum Abend mit sich allein und hätte sich vielleicht noch länger vergraben, wenn nicht plötzlich zaghaft an ihr Tür geklopft worden wäre. "Ja! Wer ist dort?" "Katharina. Ich will nur fragen, ob es Euch immer noch schlecht geht." Franziska bat das Mädchen herein. War ihr schon die Höflichkeitsanrede merkwürdig erschienen, so wunderte sie sich nun erst recht. Die ältere der Cranboimtöchter bemühte sich ganz offensichtlich um ihre Freundschaft, und zwar mit einem Respekt, den sie ihr gar nicht zugetraut hätte. Sie dachte bei sich: 'Schau an, jetzt kannst du plötzlich nett sein! Glaube aber nicht, dass ich darauf hereinfalle!' während sie das Lächeln erwiderte und sich auf eine Plauderei über die Gepflogenheiten an den norddeutschen Grafenhöfen einließ. An diesem Abend und auch noch an den folgenden Tagen träumte sie von einer völlig neuen Stellung in der Familie. Bei den Cranboims spielte die Standesherkunft eine große Rolle. Auch Feinheiten wurden genau beachtet, zum Beispiel, ob jemand, der in militärischen Diensten eines Fürsten stand, einer Handwerkerfamilie entstammte und sich hochzuarbeiten versuchte oder aber der Sohn eines Adligen oder eines Patriziers war. Im ersten Fall galt er nur als Ministeriale, was sehr an Diener erinnerte, im zweiten als Vasall. Bei Franziskas Vater gab es am Vasallenstand keinen Zweifel, und so fühlte sie sich Wolfhard Cranboim gegenüber ziemlich stark. Schon bald aber wurde sie in die Wirklichkeit zurückgeholt. Der Verhandlungspartner für einen möglichen Ehevertrag war nicht das Mädchen sondern der Vater Wilhelm von Westerholt. Er musste zur Einwilligung in ein von ihm zweifellos nicht gewolltes Geschäft gebracht werden. Dafür hatte der Kaufmann mehrere, auf lange Sicht berechnete, der Situation entsprechend austauschbare Pläne entworfen. In ihrem 155 Kern beruhten sie alle auf dem Vorteil, dass die Ritterstochter praktisch in der Gewalt der Cranboims war, ohne dass die Eltern davon wussten. Allerdings erlebte Franziska eine Gefangenschaft angenehmer Art. Wolfhard sperrte sie nicht ein, denn er kannte bessere Mittel, sie an sich zu binden. Vor allem ihren Wissensdurst und ihre Sehnsucht nach sinnvoller Beschäftigung nutzte er aus. Nachdem er sich von ihrer Vorbildung überzeugt hatte, gab er ihr Aufgaben, von denen sie sich herausgefordert fühlte, und auf die sie sich dann mit unbändigem Ehrgeiz stürzte. Sie arbeitete nun häufig mit Jan zusammen. Mit seinem blonden, seidigen Haar sah er Raimund auf den ersten Blick sehr ähnlich, doch besaß er eine ganz andere Ausstrahlung. Vielleicht lag das an den Augen, die bei ihm niemals lächelten, sondern fast immer forschend und durchdringend blickten. Zudem fehlten ihm die unterdrückten Leidenschaften seines Bruders. Sein Charakter war berechnend und kühl. Anfangs fiel es Franziska schwer, sich mit seiner Wesensart abzufinden. Sie schätzte ihn hochmütig, voreingenommen und mitleidlos ein. Während er sie dann aber in ihre Arbeit einwies, verdrängte sie ihre Verdächtigungen. Bei manchen Aufgaben gab ihr sein überlegenes Auftreten Sicherheit. Durch die ständige Beschäftigung merkte Franziska kaum, wie die Monate vergingen und ein neues Frühjahr ins Land kam. Wenn Jan unterwegs war (was häufig geschah), saß sie in seinem kleinen Kontor im zweiten Obergeschoß und kam sich großartig vor angesichts des mit Rechnungen und Verträgen bedeckten Tisches. Tauchte er auf, musste sie den Platz selbstverständlich sofort wieder räumen. Sie hatte nach wie vor großen Respekt vor ihm. Wenn er sie dabei beobachtete, wie sie hastig jedes Ding an seinen Platz rückte, huschte manchmal ein kurzes Lächeln über sein Gesicht, was bei ihm schon als echte Gefühlsregung gelten konnte. Das war ein Zeichen guter Laune. "Wir hatten diesmal viel Glück", verkündete er einmal aufgeräumt. "Ist das nicht immer so, wenn du mit deinem Vater unterwegs bist?" "Da täuschst du dich. Einen guten Kaufmann reizt es vor allem, aus ungünstigen Bedingungen noch etwas Gutes herauszuholen. Darin sind wir Cranboims seit drei Generationen den meisten anderen überlegen. Wenn alles gelingt wie gestern und heute, dann ist das erfreulich, angenehm und - langweilig." Franziska hätte gern noch mehr über die Reise erfahren, doch eine Frage von ihm brachte sie auf völlig andere Gedanken. "Hast du meinen Bruder gesehen?" "Ist er nicht im Haus?" "Nein. Es geht mich zwar nichts an, doch würde ich trotzdem gern wissen, was er heimlich treibt. Ich dachte, dass er dir vielleicht mehr verrät als mir." "Nein, er weicht auch mir aus." "Was ist er bloß für ein merkwürdiger Mensch! Jedenfalls kein echter Cranboim." Er legte seinen Mantel mit geübter Sorgfalt auf eine Truhe und entledigte sich seiner Stiefel. Dann trat er ans Fenster und blickte hinaus, während seine Gedanken abschweiften zu den Geschäften, die er am nächsten Tag zu erledigen hatte. Franziska wollte ihn nicht stören und widmete sich wieder ihrer unterbrochenen Arbeit. Wenig später aber rief er: "Dort kommt er ja!" "Wer? Raimund?" Aufgeregt eilte sie die Treppe hinunter und schaffte es, ihn schon auf dem Gang vor dem Hauptkontor abzufangen. An den vergangenen drei Tagen hatten beide miteinander geschmollt. Franziska 156 war verärgert gewesen, weil er sie niemals im zweiten Obergeschoß besuchte. Ein Wort hatte das andere ergeben, und am Ende war sie zu dem Entschluss gelangt, mindestens eine Woche nicht mit ihm zu reden, damit er nicht denken könnte, sie liefe ihm nach. Doch schon jetzt vermochte sie ihren Vorsatz nicht mehr durchzuhalten. Obwohl ihr der Verstand sagte, dass sie sich etwas vergibt, wenn sie nicht zu warten verstünde, tat ihr Körper etwas ganz anderes. "Schön dass du wieder da bist. Wo warst du? Hattest du etwas für deinen Vater zu erledigen?" Er wurde verlegen, allerdings nur für einen Moment. Dann umarmte er sie unvermittelt und sagte an Stelle einer Antwort: "Wollen wir am Sonntag wieder spazieren gehen? Wir könnten uns ansehen, wie weit die Arbeiter mit der Stadtmauer an der Weidengasse vorangekommen sind." "Oh, ja!" "Du bist nicht mehr böse mit mir?" Sie schüttelte den Kopf und vergaß völlig, dass sie an die Aussöhnung hatte Bedingungen knüpfen wollen. 157 16.Kapitel I R aimund kam am frühen Nachmittag eines sonnigen Maitages ins Gauklerlager, das noch immer vor der Kunibertskirche stand, weil die Canes ruhiger geworden waren und somit (dem Anschein nach) keine unmittelbare Gefahr mehr drohte, und weil der kleine David kränkelte und sich schlechter als andere Kinder entwickelte. Als Ramira ihn sah, ließ sie alles stehen und liegen, rannte ihm entgegen und fiel ihm um den Hals. Sie klammerte sich regelrecht an ihm fest, während ihre Lippen seinen Mund suchten. Seit sie sich in ihn verliebt hatte, lebte sie in der ständigen Angst, dass es ein nächstes Treffen nicht geben würde. Die Romanze zwischen einem Kaufherrensohn und einem Gauklermädchen musste eines Tages zu Ende gehen. Noch besuchte er sie allerdings regelmäßig. Sie kämmte sich ihm zuliebe ihre Haare nicht mehr nur für die Auftritte und wusch ihr Alltagskleid regelmäßig. Mario und Melanie witzelten schon darüber. "Du bist wunderschön und wirst immer hübscher", sagte er, während er ihre Umarmung erwiderte und seine Hände in ihren Locken vergrub. "Wenn ich ins Geschäft meines Vaters einsteige und eigenes Geld habe, lasse ich dich malen, vielleicht als heilige Agnes." Endlich hatte es sich wieder einmal so ergeben, dass Ramira allein im Lager war. "Kommst du mit in meine Wohnung?" lockte sie ihn. Er nickte, und sie zog ihn an der Hand hinter sich her. Im Wagen setzten sich beide auf das Bett. Er nahm ihren Kopf in beide Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Seine Finger tasteten sich durch ihre rotblonde Haarflut, kraulten ihren Hals, spielten mit ihren Ohren. Dann umschlang er sie, um sie an sich zu drücken, zuerst unter den Armen, wenig später um die Taille. Ihr biegsamer Körper folgte ohne Widerstand jeder seiner Bewegungen. Er streichelte ihr behutsam über Wangen und Kinn, und sie tat nichts weiter, als mit geschlossenen Augen zu genießen. Irgendwie fanden sich ihre Lippen. Ramira öffnete ein wenig den Mund. Raimund kitzelte mit seiner Zungenspitze spielerisch ihren Gaumen. Das hatte sie ihm erst vor kurzem beigebracht, und er fühlte sich, wenn er es tat, noch immer etwas sonderbar. Er spürte nämlich, dass seine Freundin bei dieser Liebkosung unruhig wurde, sich ungestüm an ihn heran drängte, mit heftig schlagendem Herzen. Meistens beruhigte sie sich bald wieder. Diesmal allerdings löste sie sich mitten in der größten Erregung plötzlich von ihm. "Was ist?" fragte er, besorgt, einen Fehler begangen zu habe. Statt einer Antwort, zog sie die Bronzefibel am Halsansatz ihres Kleides heraus und entknotete den Strick, der ihr den Gürtel ersetzte. Obwohl sie dergleichen schon oft getan hatte (unfreiwillig zumeist, aber auch einige Male aus Liebe), war sie unsicher dabei. Einmal hielt sie inne und sah ihn fragend an. Tatsächlich brachten ihn innere Kämpfe beinahe ganz aus der Fassung. "Du weiß doch, dass ... dass ich das nicht tun darf!" "Weshalb?" flüsterte sie. "Weil deine Eltern dich mit Franziska verheiraten wollen?" Eine Stimme in ihr rief ihr zu, wie hinterhältig es ist, der Freundin den Verlobten wegzunehmen. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie auf diese Stimme wohl gehört. Diesmal jedoch hallte sie nur undeutlich wie aus großer Ferne herüber. "Ich meine etwas anderes ..." Ramira schreckte auf aus ihren Gedanken und begriff. Erleichtert versicherte sie ihm: "Heute kann nichts passieren. Nicht wahr: Wenn nichts passieren kann, ist's keine Sünde." Einen letzten zaghaften Protest von ihm erstickte sie mit einem neuen Kuss. Während ihr das durch nichts mehr zusammengehaltene Kleid von den Schultern glitt, war es sein Herz, das so heftig schlug, als wolle es zerspringen. Seine Hände glitten über ihren entblößten Oberkörper und suchten unwillkürlich nach den Brüsten. Dabei war er überzeugt, noch nie im Leben Kostbareres berührt zu haben. Für einen flüchtigen Moment erinnerte er sich, wie ihm (in seiner frühen Kindheit) sein Vater einmal zum Spaß einen ziemlich großen Diamanten in die kleine Hand gelegt hatte. Weil der Diamant kalt war wie ein Stück Eis ließ er ihn fallen und lief davon. Ramira drückte sanft seinen Kopf gegen ihren Busen und vergrub ihr Gesicht in seinen seidigen, blonden Haaren. In dieser Stellung verharrten beide eine Zeitlang. Sie war noch immer voller Angst vor einem alles verderbenden Fehler. Sich Männer zum Halse zu halten, das hatte sie gelernt, sie für sich zu gewinnen, hingegen nicht. Arnold war durch Zufall in ihr Leben getreten, ohne ihr Hinzutun. Endlich überwand sie sich, stellte sich vor ihn hin und streifte sich das Kleid ganz ab. Sie war nun vollkommen nackt. Eine Lichtbahn zielte vom Seitenfenster her genau auf sie. Nur mit Mühe widerstand sie dem Drang, sich mit Händen und Armen vor Raimunds Blicken zu schützen. Der indes begriff, in welcher Lage sie sich befand, und befreite sie rasch daraus, indem er sie auf den Schoß nahm und wieder an sich drückte. Dann zog auch er sich aus, und sie legten sich (nun endgültig beruhigt) nebeneinander auf das Bett unter dem Vogelbauer. "Weißt du, dass ich noch nie im Leben ein Mädchen nackt gesehen habe, jedenfalls noch nie bewusst?" gestand er ihr. "Du bist mir doch nicht böse, dass ich so neugierig bin auf alles an dir?" "Hoffentlich bist du am Ende nicht enttäuscht." "Dass du das hübscheste Mädchen der Welt bist, weiß ich schon am Anfang." Er beugte sich über sie und begab sich auf Entdeckungsreise. Noch die geringste Kleinigkeit erschien ihm ungemein wichtig. Mit zwei Fingern streichelte er über ihre Schultern und über die Fältchen am Ansatz der Arme. Ein paar Locken kräuselten sich neben dem Grübchen an ihrem Hals. Ihre Brüste waren rund und schön, so dass seine Hand und sein Mund immer wieder zu ihnen zurückkehrten. Als er ihre Hüften und ihre Beine liebkoste, fiel ihm auf, wie zart ihre Haut war und wie zerbrechlich ihr Körper. "Du bist wunderschön", wiederholte er flüsternd immer wieder. Tatsächlich wusste er nichts, was er sich noch hätte wünschen können. Nicht nur das Mädchen erschien ihm wie ein Spiegel der Vollkommenheit, der ganze Wohnwagen wurde zum Garten Eden für ihn. Die Strohmatte roch muffig. In einer Schale drohte ein Rest Gemüse zu verfaulen. Auf dem Fußboden hatte ein ausgelaufenes Gefäß eine klebrige Spur hinterlassen. Das alles störte ihn ebenso wenig wie ihn das (nun wie ein Bündel Lumpen auf einem Schemel liegende) schäbige Kleid gestört hatte. Das eine wie das andere gehörte zu seiner Rami- 159 ra, und er liebte sie nicht nur trotzdem sondern (auch) gerade deshalb. Nur einmal stieß er auf seiner Reise auf etwas, das ihn erschreckte. Wenn er sie über ihren Rücken streichelte, ertastete er eine lang gestreckte Unebenheiten in der Haut, die er sich nicht erklären konnte, bis er begriff, dass es Spuren von Peitschenhieben waren. Er erinnerte sich an ihre Andeutungen über ihren Vater. Nicht zum ersten Mal begegneten ihm die Grausamkeiten der Menschen. Öffentliche Bestrafungen auf einem der Märkte oder vor der berüchtigten Kunibertstorburg gehörten zum Alltag. Auch Hinrichtungen kamen immer wieder vor. Diesmal jedoch betraf das Leid jemanden, den er liebte, und war somit auch sein eigenes Leid. Wut und Hilflosigkeit stiegen gleichzeitig in ihm auf und zwar so heftig, dass sie es merkte. "Was hast du?" "Du bist um so viel Liebe betrogen worden! Ich komme mir vor wie dein Schuldner." "Was redest du da?! Du schuldest mir nichts, und ich mag nicht glücklich sein, wenn du's nicht auch bist." "Gibt es das überhaupt, dass zwei Menschen einander gegenseitig glücklich machen? Ist es nicht so, dass letztlich immer der eine das Vergnügen hat und der andere nur ausgenutzt wird?" "Du wirst mir nichts Böses antun und ich dir auch nicht." Sie sagte das mit solcher Überzeugung, dass es sinnlos war, ihr zu widersprechen. Dabei hatte er ihr noch gar nicht erklärt, worauf er eigentlich hinauswollte. Er stellte mit zunehmendem Erschrecken fest, dass sich seine Empfindungen und Wünsche veränderten, je länger er sich mit ihrem nackten Körper beschäftigte. Gegen seinen Willen wurden seine Hände grober. Wo sie nur hauchzart berühren sollten, packten sie fest zu. Ein unbezwingbares Verlangen drängte ihn dazu, ihr mit seinen Knien die Schenkel auseinander zu drücken. Weil er diesen Zustand äußerster Erregung noch nicht kannte, verstand er ihn nicht, und fürchtete, dass gerade ein Dämon Macht über ihn zu gewinnen begann. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn das Mädchen ihn in diesem Moment nicht so nachdrücklich ermuntert hätte, dass seine Zweifel zerstoben. Er ahnte nicht, dass nicht nur in ihm sondern auch in ihr Veränderungen vorgingen. Ihr war, als sei seine Hand die Quelle einer magischen Kraft, die bei jeder Berührung bis tief in ihren Körper hinein strahlte. Dass ihm bei seinen Liebkosungen das Geschick eines erfahrenen Mannes fehlte, störte sie nicht. Im Gegensatz zu seinen Vermutungen gefiel es ihr sogar, wenn er sie in der Erregung härter als gewollt anpackte. Sie wollte ihn spüren, auch seine Kraft. Ihr Schmerzempfinden trat dagegen mehr und mehr in den Hintergrund. Raimund hatte es endlich geschafft, sich von allem zu befreien, was ihn von seiner Freundin und von dem Augenblick mit ihr ablenkte. Die Erwartungen seiner Eltern, die Ansichten der Nachbarn, die Forderungen der Priester, seine eigenen Träume und Ängste - das alles war in weite, weite Ferne gerückt. Er folgte nur noch seinem Gefühl, darauf vertrauend, dass Ramira genau das wolle und dass es seine Richtigkeit damit habe. Nachdem er sie noch einmal von Kopf bis Fuß liebkost hatte, liebten sie einander mit solcher Heftigkeit, dass ihnen beinahe die Sinne schwanden. Am Ende waren sie beide völlig erschöpft aber dennoch unermesslich glücklich. Wie nach tiefer Bewusstlosigkeit brauchten sie einige Zeit, um sich zurechtzufinden. Besonders Ramira war noch lange wie im Rausch. Sie lächelte versonnen, während Raimund sie 160 behutsam streichelte. Dann krochen sie gemeinsam unter eine große Felldecke, kuschelten sich aneinander, so dicht, dass jeder den Atem des anderen spürte, und schliefen ein. Auch als bei Einbruch der Dunkelheit die anderen ins Lager zurückkehrten, schliefen sie noch fest. Melanie wunderte sich sehr, als sie die beiden eng umschlungen fand. Zunächst wollte sie herumzetern, weil sie nun Ramiras Arbeit erledigen musste und weil sie dem Jungen aus dem vornehmen Viertel misstraute. Doch bald erinnerte sie sich ihrer eigenen Leidenschaften. Aus wahrer Liebe begeht man nun einmal die schlimmsten Sünden. Und gerade weil sie glaubte, dass Ramira mit ihrem Freund nicht lange glücklich sein wür- de, zog sie sich mit Verschwörermiene leise wieder zurück. Am nächsten Morgen erschrak Raimund heftig über sich selbst und Ramira konnte sich vor Lachen kaum beruhigen. Dann aber berieten beide darüber, welche Geschichte er seinen Eltern erzählen könnte. Dabei half ihnen der in solchen Dingen erfahrene Alexander. Da Raimunds Gesicht aber das schlechte Gewissen deutlich genug widerspiegelte, während er zu lügen versuchte, blieb Sieglinde misstrauisch. Gewiss wäre ihr noch manche unangenehme Frage eingefallen, hätte nicht die im Hause Cranboim inzwischen über jeden Zweifel erhabene Franziska, ohne zu ahnen, wo er die Nacht wirklich verbracht hatte, ein sicheres Alibi erfunden. II F ranziska stand in ihrem Zimmer im zweiten Obergeschoß am Fenster und warf vor dem Zubettgehen noch einen Blick auf den Rhein, auf dem jetzt kein einziges Boot mehr zu sehen war, als sie von nebenan aus Jans kleinem Kontor Stimmen hörte. Neugierig, aber auch ein wenig beunruhigt legte sie ihr Ohr an die Wand und lauschte. Jan und sein Vater sprachen erregt miteinander. Das Mädchen verstand jedes Wort. "Hatte er denn keine Leibwächter in seiner Nähe?" "Seit einer Woche ging er keinen Schritt mehr allein. Dies war aber ein gut vorbereiteter Mord. Fünf Männer tauchten plötzlich bei ihm auf, stachen zu und verschwanden wieder unerkannt wie Geister." "So wollte Gott ihn also doch nicht beschützen!" "Hast du das je erwartet?" Franziska war überzeugt, dass um Wolfhard Cranboims Lippen ein spöttisches Lächeln spielte, während er das sagte. Sie schmiegte sich noch enger an die Wand, denn sie wollte nun unbedingt erfahren, wen man ermordet hatte. "Es ist gekommen, wie von Euch erwartet, Vater", sagte Jan und fügte hinzu: "Ich frage mich nur, ob die Dominikaner das einfach so hinnehmen können, ohne ihr Gesicht zu verlieren." "In Köln müssen zurzeit viele Leute Angst um ihr Gesicht haben - aus unterschiedlichen Gründen." "Ich fürchte, dass uns ein paar heiße Tage bevorstehen." "Sicherheitshalber habe ich vor unseren Lagern doppelte Wache aufgestellt. Eigentlich glaube ich nicht an Plünderungen, aber wenn der Abschaum einmal in Bewegung gerät, weiß man nie, was passiert." 161 "Wenn Erzbischof und Rat sich einig sind, könnten sie vielleicht den Aufruhr im Keim ersticken." "Sie könnten es, wollen es aber wahrscheinlich nicht. Ich sage dir voraus, dass die Waffenknechte erst eingreifen, wenn die Mehrheit der Bürger nach ihnen schreit, weil die Gewalt überhand nimmt. Setzt eine der Parteien ihre Leute zu zeitig in Marsch, kostet das dringend benötigte Sympathien." "Ob man die Mörder findet?" "Mag sein, dass man eines Tages jemanden dieses Mordes wegen verurteilt. Die wahren Täter sind sicher längst über alle Berge. Ich vermute, dass der Erzbischof selbst hinter dem Anschlag steckt. Er kann sich nicht leisten, dass ein Irrsinniger seine Geheimdiplomatie durchkreuzt." Franziska dachte sofort an ihre Freunde und lief am nächsten Morgen zeitig ins Gauklerlager, um sie zu warnen. Melanie bemühte sich gerade, mit Stein und Zunder ein Feuer für die morgendliche Suppe zu entzünden und nickte ihr kurz zu. Neben der jungen Frau schlummerte, in Decken gehüllt, der kleine David. Alexander und Mario schliefen wohl noch. Ramira übte Kunststücke, und zwar so angespannt, dass sie die Besucherin überhaupt nicht bemerkte. Nur Pentia, die sich, gerade aufgestanden, auf der Treppe des Wohnwagens reckte und streckte und dabei in die aufgehende Sonne blinzelte, kam Franziska entgegen. "Du bist bestimmt zu irgendwelchen Geschäften unterwegs." "Nein, ich bin nur euretwegen hergekommen." "Jetzt? Es ist doch noch fast Nacht!" "Gestern spätabends muss etwas passiert sein, was diese Graukittel wieder munter machen kann. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr so schnell wie möglich verschwindet." Inzwischen war auch Ramira aufmerksam geworden und hinzugetreten. "Der Prediger Maginulfus ist erstochen worden, auf offener Straße, nahe am Eigelstein." "Woher weiß du das?" "Ich hab' den Menschenauflauf gesehen und mich dazugestellt. Komm, setz dich! Ich erzähl 's dir!" Melanie hatte endlich Erfolg bei ihrem mühseligen Hantieren mit Stein und Zunder. Aus dem Holzhaufen unter dem großen Kessel züngelten erste Flammen heraus. "Das war saub're Arbeit gewesen von den Mördern. Ein paar von ihnen sind über seine Leibwächter hergefallen, die anderen haben sich ihn selbst vorgenommen und ihm mit mindestens einem Dutzend Stichen den Garaus gemacht. Er sah aus wie ein geschlachtetes Schwein." Ihre Augen funkelten hasserfüllt. Sie gönnte dem fanatischen Dominikaner den Tod von Herzen. "Die Leute die 's aus nächster Nähe miterlebt haben, konnten nicht einmal die Gesichter dieser Männer erkennen, so schnell ging das. Vielleicht sind Gottes Racheengel gekommen, um ihn zur Hölle fahren zu lassen. Es gibt nämlich viele, die sich als Anhänger von unserm Herrn Jesus ausgeben und in Wirklichkeit dem Teufel dienen. Nicht die armen Leute, die man auf dem Scheiterhaufen verbrennt, sind die wirklichen Sünder sondern ihre Henker." "Wo hast du solche Reden gehört?" fragte Franziska erschrocken. Von Raimund kannte sie gefährliche Meinungen dieser Art, und ihm traute sie mehr und mehr auch zu, dass er sich heimlich mit unruhigen Gesellen traf. Wie aber sollte ein Gauklermädchen mit Verschwörern und Ketzern in Berührung gekommen sein? Ramira indes holte statt einer Antwort ein eisernes Kruzifix unter ihrem Kleid hervor. 162 "Sieh mal, was ich gefunden habe! Der Herr Jesus ist von diesen schlechten Predigern gefangen gehalten worden und nun zu mir gekommen." Franziskas Beunruhigung verwandelte sich in blankes Entsetzen. Sie packte die Freundin bei den Schultern und rüttelte sie kräftig durch. "Was ist in dich gefahren? Haben dich alle guten Geister verlassen? Du benimmst dich wie eine Selbstmörderin und redest irrsinniges Zeug. Weiß du überhaupt, was die Waffenknechte mit dir machen, wenn sie dieses Kreuz bei dir finden? Du brauchst doch nun wirklich nichts mehr selbst zu unternehmen, um gefährlicher zu leben als jeder andere hier in Köln!" Ramira befreite sich unwillig. "Ich rede kein irrsinniges Zeug. Es waren so viele Leute dort auf der Straße, aber keiner von ihnen hat das Kreuz gefunden. Die Leiche ist fortgeschafft worden, die Zuschauer sind wieder ihrer Wege gegangen, und ich bin ganz allein zurückgeblieben - mit Jesus. Hältst du das für Zufall?" "Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber ich weiß, dass ihr fliehen müsst", sagte Franziska verzweifelt. Ramira ließ sich nicht beirren. So als begreife sie die drohende Gefahr gar nicht, betrachtete sie liebevoll das Kruzifix und war mit ihren Gedanken allem Anschein nach weit fort. Ab und zu huschte über ihr Gesicht ein verklärtes Lächeln. Sie träumte mit offenen Augen. Franziska gab es auf, weiter in sie zu dringen, und wandte sich an Alexander, der in diesem Moment die Tür des Wohnwagens öffnete. "Ihr müsst fliehen!" rief sie ihm schon von weitem zu. "Es wird wieder Gewalt geben in der Stadt." "Ja, so wird es wohl kommen", entgegnete der Alte fast ebenso gleichmütig wie Ramira. "Wollt ihr alle so schnell wie möglich im Himmel sein? Ich warne euch, und ihr hört mir gar nicht zu!" "Ich höre dir ja zu, aber was du erzählst, hat uns schon gestern Abend dieser Stefanus gesagt, der, bei dem du mal im Dienst warst. Ich kenne ihn ja kaum, aber ich vertraue ihm. Durch ihn wissen wir jetzt sogar, wie wir unbemerkt über den Rhein kommen." "Stefanus? War es wirklich Stefanus?" fragte Franziska und spürte, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann. "Ja, ganz bestimmt." "Oh, wenn er euch gewarnt hat, muss es wirklich schlimm für euch aussehen. Flieht noch heute und lasst alles zurück! Ich werde versuchen, den Wagen für euch zu retten." "Es ist ein paar Monate lang nichts passiert. Alle haben geglaubt, die Leute sind wieder zur Vernunft gekommen. Sonst, weiß Gott, wären wir längst über alle Berge." In diesem Moment kam Mario nach draußen. Er hatte die letzten Sätze verstanden und sagte beinahe gereizt: "Ich kann dieses Gerede nicht mehr hören. Wir haben ja nun beschlossen, dass wir weiterziehen. Warum sollen wir aber unseren Wagen zurücklassen? Wenn gestern kurz nach dem Mord in der Stadt alles ruhig geblieben ist, wird es heute nicht viel anders sein. Es reicht also völlig, wenn wir heute das Lager abbauen und morgen früh aufbrechen." Melanie pflichtete ihm vom Feuer her bei. Franziska suchte abermals bei Alexander Unterstützung. Der aber zuckte nur mit den Schultern und sagte dunkel: "Unser Schicksal liegt in Gottes Hand. Vielleicht könnten wir noch einen ganzen Monat bleiben, vielleicht ist es längst zu spät zum Fliehen." Immerhin begannen die Gaukler, nachdem sie gemeinsam ihre Suppe gegessen hatten, das Lager abzubrechen und ihre Habe auf den Wagen zu verla- 163 den. Franziska blieb bei ihnen, um zu helfen. "Wo sind eigentlich eure Freunde, die Schauspieler?" fragte sie Ramira, als sie mit ihr gemeinsam den großen Kessel ausscheuerte. "Weiter gezogen. Vor einer Woche schon." "Die sind wenigstens vernünftig - im Gegensatz zu dir, wenn du nicht endlich dieses Kreuz in den Rhein wirfst." "Kannst du mich beschützen, wenn jetzt die Canes über uns herfallen? Du kannst es nicht! Aber Jesus kann es, wenn nicht in dieser Welt, dann eben in der anderen." "Das hört sich an, als ob du dich schon auf den Tod vorbereitest!" "Fahrendes Volk lebt nun einmal mit dem Tod auf vertrautem Fuß." Ramira war allerdings nicht allein in so düsterer Stimmung. Besonders am Nachmittag, als der Wagen einsam im nun fast vollständig abgebrochenen Lager stand und ziemlich verloren wirkte auf dem weiten Platz vor der großen Kunibertskirche, lastete die Wehmut auf allen. Es ist ein Unterschied, ob man loszieht, weil man ein Ziel hat, oder ob man einfach nur flieht. Selbst Mario war ungewöhnlich still. Er wetterte nicht mehr gegen den überstürzten Aufbruch und suchte die Nähe Alexanders. Mehrmals nahm er Anlauf, um mit ihm zu sprechen, brach aber jedes Mal ab, weil ihn irgendjemand oder irgendetwas störte, oder weil er ganz einfach nicht den Mut fand. Erst als es schon fast dunkel war, raffte er sich auf, führte ihn hinter den Wagen und sagte: "Ich danke dir." Der Alte hatte sich über Marios sonderbares Gebaren zunächst gewundert und sich nur widerstrebend in den verschwiegenen Winkel führen lassen. Diese drei Worte aber verstand er sofort. "Was hätte ich sonst tun sollen? Ich war ein verträumter Trottel, bis du mir die Augen geöffnet hast." "Du hättest verbittert sein können. Auf jeden Fall hättest du mich nicht wie ... wie einen Sohn zu behandeln brauchen." "Wir sind eine Familie. Vielleicht sterben die Beldinis bald aus. Dann könnt ihr beide, du und Melanie, unsere Geschichte fortsetzen, auch wenn ihr beide kein Blut von uns in euch habt." III B ei Einbruch der Dunkelheit verabschiedete sich Franziska von den Gauklern und versprach, am nächsten Morgen wiederzukommen, um ihnen eine gute Reise zu wünschen und auch um Pentia mitzunehmen, denn seit sie Sieglinde Cranboim gegenüber die Schwester erwähnt hatte, drängte diese hartnäckig, die arme Kleine aus jener unwürdigen Umgebung wieder zu befreien. Pentia selbst freilich fühlte sich mit ihren neuen Freunden inzwischen so sehr verbunden, dass sie am liebsten mit ihnen mitgezogen wäre. Die letzte Nacht mit ihnen gemeinsam im Wohnwagen zu verbringen, wollte sie sich unter keinen Umständen verwehren lassen. In ihrem Zimmer angekommen, legte Franziska sich angekleidet auf ihr Bett und fragte sich, warum ihr so beklommen zumute war. Empfand sie nur Mitleid mit ihrer Freundin und deren Gefährten oder trauerte sie vor allem um das, was sie selbst verlor? Sie entwarf abenteuerliche Pläne, um Ramira in ihrer Nähe zu behalten. Doch keiner davon taugte. Dass sie die Vier bei den 164 Cranboims nicht unterbringen konnte, auch nicht als Mägde und Knechte, hatte sie herausgefunden. Zu groß waren die Vorurteile gegen fahrendes Volk. Es herrschte schon pechschwarze Nacht, als Franziska plötzlich von Ferne ein sonderbares Lärmen hörte. Beunruhigt schlich sie nach unten, hinaus auf die Straße. Die Tür fiel zu hinter ihr, und sie erkannte kaum noch die Hand vor den Augen. Rechts glühten zitternd mehrere Lichtpunkte. Wie weit fort sie waren, vermochte das Mädchen nicht zu schätzen, da sich jedoch in eben dieser Richtung das Gauklerlager befand, und von dort auch der Lärm stoßweise herüberwehte, sah sie ihre Befürchtungen bestätigt. Es kostete sie viel Überwindung, nicht einfach blindlings loszulaufen, sondern sich erst eine Öllampe aus dem Kontor zu holen. Während sie die Uferstraße entlang eilte (und dabei viel langsamer vorankam, als sie es gern wollte, weil sie ihre Lampe nicht verlöschen lassen durfte und weil sie im schwach rötlichen Lichtkegel die Löcher und Hindernisse immer erst im letzten Augenblick erkannte), wurde der Lärm lauter und bösartiger. Plötzlich flammte einer der Lichtpunkte zu einer Lohe auf. Über den nun hell erleuchteten Platz vor dem Kunibertsstift hetzten Menschen hin und her. Um den brennenden Wohnwagen herum herrschte ein solches Rennen und Jagen, dass sich nicht erkennen ließ, was eigentlich vorging. Noch ehe Franziska das Gesicht eines der Gaukler erkannt hatte, fand sie sich von vier Canes umringt. Weindunst schlug ihr entgegen. Einer lallte: "Verschwinde! Das hier ist nichts für kleine Mädchen." Doch sie ließen bald von ihr ab, weil jemand nach ihnen rief. Franziska fühlte sich wie in einem Alptraum - auf dem tiefsten Grund der Hölle, von Dämonen umtanzt, für ihre Sünden büßend. Dann entdeckte sie Alexander. Drei Männer schlugen mit Knüppeln auf ihn ein. Sie holten dabei aus, als würden sie Schmiedehämmer schwingen. "Warum macht ihr das?" schrie das Mädchen dem Nächstbesten zu. "Die Gaukler wollten morgen früh weiterziehen." "Eben weil sie uns entwischen wollten, machen wir das", erhielt sie zur Antwort. "Nicht nur Köln sondern die ganze Welt muss von solchem Gesindel gereinigt werden." Die Canes steigerten sich in einen Blutrausch hinein. Vielleicht war es der Wein, der sie anstachelte, vielleicht waren es die schaulustigen Niedericher Bürger, die sich in immer größerer Zahl einfanden und kaum weniger Beifall spendeten wie einst bei Ramiras Auftritt. Ein gellender Schrei ließ Franziska herumfahren. Sie sah, wie Melanie wie von Sinnen auf einen dicken Kerl einschlug, um zu ihrem wenige Meter entfernt hilflos im Staub liegenden Kind zu gelangen. Immerhin kamen nun vom Dom her zwanzig Waffenknechte mit umgebundenen Schwertern und Spießen in der Hand heran. Franziska hoffte, dass sie dem Treiben der betrunkenen Canes Einhalt gebieten würden. Als sie jedoch zu ihnen hinlaufen wollte, um sie zu der bedrängten Melanie zu führen, merkte sie, dass die Männer des Erzbischofs einen ganz anderen Auftrag hatten, als die Gaukler zu schützen. Sie bildeten einen Ring um das zerstörte Lager und hinderten die Überfallenen an der Flucht. Offenbar gab es eine Absprache. Mario hätte vielleicht entkommen können. Mit dem Mut der Verzweiflung wurde er ein geradezu furchtbarer Gegner für jeden, der sich in seine Nähe wagte. Drei mit Knüppeln bewaffnete Männer streckte er in kurzer Folge mit der bloßen Faust nieder. Wie aber konnte er davonlaufen, während seine Frau 165 gefesselt wurde, sein Kind mit schwächer werdendem Stimmchen schrie und Alexander, den er wie einen Vater zu lieben gelernt hatte, vor ihm verblutete?! Noch teilte er Hiebe im Dutzend aus, jedoch schon ohne Hoffnung auf Rettung, nur noch um sich an möglichst vielen Canes zu rächen. Franziska wurde hin- und her gestoßen. Die Waffenknechte zählten sie zu den Zuschauern, von denen inzwischen wenigstens hundert den Platz bevölkerten. Einer packte sie am Arm und zerrte sie aus dem Ring heraus. Sie sah noch, wie man Mario und Melanie abführte. Über das Schicksal Ramiras und Pentias erfuhr sie nichts. Ganz benommen von dem, was sie mit angesehen hatte, spürte sie kaum, wie die Zeit verging. Der Wohnwagen brannte nieder. Die Canes verschwanden, weil sie keine Opfer mehr fanden. Kurz nach ihnen zogen sich auch die Waffenknechte zurück. Am längsten harrten die Niedericher Bürger aus - besorgt, dass ihnen etwas Erzählenswertes entginge. Franziska war nun wieder allein. Bis auf das Glühen einiger Balken des Wohnwagens durchbrach nichts mehr die tiefe Dunkelheit. Die Stille ringsum war gespenstisch nach allem, was sich zugetragen hatte. Zum Glück befand sich in der (vom Wind ausgeblasenen) Lampe noch etwas Öl, so dass das Mädchen den Docht an einem der glimmenden Balken wieder entzünden konnte. Von den Brandspuren abgesehen, erinnerte nur noch wenig an den Überfall. Ein paar Kleidungsstücke lagen herum, auch ein paar Knüppel. Ein Spieß der Waffenknechte war zerbrochen, wohl beim Versuch, die Gaffer abzudrängen. Gerade dadurch aber erschreckten die reglosen Körper des weißhaarigen Mannes und des Säuglings umso mehr. Wie achtlos weggeworfener Abfall wirkten sie. Das waren sie wohl auch für diese reiche, vornehme Stadt, die fahrendes Volk nicht nur im Kreis ihrer Mauern vertilgen wollte sondern in der ganzen Welt. Einen kurzen Moment lang hoffte sie noch, den beiden helfen zu können. Als sie sich jedoch über sie beugte, begriff sie, wie töricht ihre Hoffnung gewesen war. Weil sie Ramira und Pentia während des ganzen Überfalls kein einziges Mal gesehen hatte, fürchtete sie, dass sie im Wohnwagen verbrannt seien. Vorsichtig schob sie die Trümmer auseinander und leuchtete in jeden Winkel hinein. Dass sie sich dabei verletzte, beachtete sie in ihrem Kummer nicht. Sie fand jedoch keine Spur der beiden. Vermutlich lagen sie also doch ebenso wie Mario und Melanie in einem Verließ der Kunibertstorburg, denn andernfalls wären sie zweifellos in der Nähe und würden sich ihr zeigen. Franziska sank auf die Knie, schlug die Hände vors Gesicht und weinte laut und hemmungslos in die Nacht hinein. Unter keinen Umständen wollte sie noch länger in Köln bleiben. Fort, einfach fort, irgendwohin. Wenig später aber fiel ihr ein, dass sie nicht fliehen durfte, solange noch vier Gaukler in Köln gefangen saßen und ihre Hilfe brauchten. Die Cranboims hatten Einfluss in der Stadt. In ihrer Verzweiflung verfiel sie sogar auf Befreiungspläne. Wozu hatte sie ihr Schwert? Wozu hatte Stefanus sie den Umgang damit gelehrt? In dieser Nacht freilich konnte sie nur noch verhindern, dass man die beiden Toten am nächsten Morgen bei den hingerichteten Ketzern, Zauberern und Schwerverbrechern vor dem Südtor verscharrte. Sie lief zum Haus zurück, holte sich eine Schaufel und füllte ihre Lampe mit frischem Öl auf. Dann schleppte sie Alexander und David zu einer stillen Stelle nahe am Ufer des Rheins und begrub sie dort. Das war eine schwere Arbeit, die sie ablenkte 166 und ihr gut tat. Segnen durfte sie die beiden nicht, doch sprach sie inbrünstig ein Gebet und hoffte, dass Gott sie hörte. Am Schluss verwischte sie alle Spuren. Sie war überzeugt, dass sich der Alte diesen Ort für sein Grab auch selbst ausgesucht hätte. Er hatte oft an eben dieser Stelle am Fluss gesessen, auf die Wellen geblickt und in dem träge und doch rastlos dahin fließenden Wasser ein Gleichnis auf die Geschichte der Beldinis gefunden. 167 17.Kapitel I D u siehst aus wie der Tod, und die Knechte behaupten, dich heute morgen vor Sonnenaufgang mit einer Lampe auf der Straße gesehen zu haben." Franziska schreckte hoch. Sie war völlig erschöpft, seelisch und auch körperlich, und es fiel ihr schwer, den Gesprächen am Frühstückstisch zu folgen. "Heute morgen? ... Ja, ich ..." "Wo warst du gewesen? Es ist gefährlich, nachts aus dem Haus zu gehen." Sieglinde Cranboim musterte das Mädchen mit jenem Blick, mit dem sie auch Raimunds Geheimnisse zu ergründen suchte. "Ich war am Kunibertsstift." "Aber warum mitten in der Nacht? So rede doch! Oder vertraust du mir nicht?" "Doch! Nur ... mir ist jetzt nicht nach Reden zumute. Später vielleicht." Sieglinde sah ein, dass es vorläufig wenig Sinn hatte, sie zu einer Antwort zu drängen, und lenkte auf ein anderes Thema. Franziska war ihr dankbar dafür. Nach dem Essen zog sie sich auf ihr Zimmer zurück und bat, nicht gestört zu werden. Dennoch klopfte wenig später jemand zaghaft an ihre Tür. Sie öffnete widerstrebend und stand Raimund gegenüber. Er wirkte verstört. "Entschuldige, dass ich ... Ich möchte nur wissen, ob du bei den Gauklern warst, dort wo deine Schwester ist." Franziska nickte stumm. Sie wunderte sich über seine Anteilnahme, denn während Pentias Schicksal für die übrigen Familienmitglieder seit Tagen ein beliebtes Thema war, hatte er darüber nie ein Wort verloren. Dennoch ließ sie ihn herein. "Die Gaukler sind meine Freunde", stellte sie klar. "Pentia lebt nicht als Gefangene bei ihnen, wie deine Mutter behauptet. Ramira, das Mädchen mit den roten Haaren, kenne ich schon von meiner Heimat her. Wenn ihr etwas zustößt, stirbt auch von mir ein Stück. ... Du erinnerst dich an sie vielleicht von den Auftritten her." "Du hast mir von ihr erzählt ..." "Ja, aber das, was sie wirklich für mich bedeutet, kann man nicht erzählen. Sie hat mir das Leben gerettet." Die letzten Worte würgte sie nur noch mühsam hervor, dann überwältigte sie ein Weinkrampf wie in der Nacht, als sie Alexander und David hatte begraben müssen. Raimund indes packte sie plötzlich bei den Schultern, rüttelte sie und schrie: "Was ist geschehen? Was weißt du?" In ihrem Kummer dachte sie sich nichts bei seinem Ausbruch. Als sie wieder sprechen konnte, antwortete sie: "Zwei sind tot, die anderen in der Kunibertstorburg gefangen, auch meine Schwester." "Was ist mit Ramira?" "Ich nehme an, dass sie noch lebt ..." "Sie müssen sie freilassen. Sie hat nichts verbrochen!" Raimund war aufgesprungen, lief im Zimmer auf und ab, raufte sich hilflos seine seidigen, blonden Haare, bis sie wirr wie bei einem Geisteskranken aussahen. "Was hast du?" fragte Franziska, als ihr endlich auffiel, wie sehr ihn das Schicksal der Gaukler traf. Er stutzte, besann sich und kehrte, sich zur Ruhe zwingend, an die Seite des Mädchens zurück. "Ich muss dir etwas gestehen. Du darfst es aber niemandem weitererzäh- len, auch nicht meinen Eltern. Versprichst es mir!" "Ja, natürlich!" "Ich gehöre zur Kölner Katharergemeinde. Unseretwegen sind die Dominikaner vor acht Jahren aus Frankreich hierher gekommen. Wir sind die Ketzer, von denen dieser Maginulfus vor Sankt Maria ad Gradus gesprochen hat. Nur weil sie uns nicht auf die Spur kommen, müssen die armen Gaukler und Bettler jetzt büßen." Obwohl Franziska mit einem dunklen Punkt in Raimunds Leben gerechnet hatte, war sie nun, da sie sich nicht mehr an der Wahrheit vorbeimogeln konnte, dennoch erschrocken. "Warum tust du das? Sie werden euch finden und verbrennen. Ich aber liebe dich und möchte nicht, dass du so endest." "Vielleicht ist das ein besseres Ende als jenes, was mein Vater für mich bestimmt hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als Tag für Tag heucheln zu müssen. Jahrelang immer neue Lügen. Wie ich sie hasse, diese scheinheilige Stadt, diese protzigen Kirchen, vor denen bettelnde Kinder geschlagen werden, diese goldenen Kruzifixe und Marienfiguren, diese fett gefressenen Pfaffen, die sich heimlich mit Dirnen vergnügen, diese raffgierigen Kaufleute, von denen mein Vater einer ist und mein Bruder bald einer sein wird! Und dabei lächeln, immerzu lächeln. Ist dir aufgefallen, dass bei den Cranboims immer gelächelt wird? Hier ist nie einer traurig oder enttäuscht oder zornig." Sie verstand nicht recht, warum diese Dinge, die zwar nicht schön waren, aber nun einmal zum Alltag gehörten, ihn vor Zorn beben ließen, unterbrach ihn jedoch nicht. Er redete sich frei von all dem, was er so lange in sich hatte verschließen müssen. Dann aber entspannte sich sein Gesicht plötzlich, und es trat sogar eine gewisse Verklärung hinein. "Die Katharerkommune ist schon lange meine eigentliche Familie. In mir lebt nicht das Erbe der Cranboims sondern das meiner Mutter. Ihr Urgroßvater kam einst als Katharer aus Frankreich hierher. Er versuchte, auch seine zwei Söhne und seine Tochter für seinen Glauben zu begeistern. Der eine Sohn wollte nichts davon wissen und wurde später Ministeriale des Erzbischofs, der andere aber leitete einige Jahre lang die Kölner Gemeinde. Die Tochter heiratete einen Glaubensbruder und zog mit ihm nach Frankfurt." "Aber deine Mutter ist doch keine ..." "Nein, nein! Sie nicht. Doch im Blut ist der Glaube erhalten geblieben. Es wird immer wieder Katharer geben bei uns." "Was ist das für eine Lehre, dieser Katharerglaube?" "Wir glauben, dass es zwei verschiedene Welten gibt - die vom Teufel geschaffene irdische, und die zu Gott gehörende himmlische. Die irdische Welt, das ist der Fluss, der uns bei Hochwasser ertränkt, das sind die wilden Tiere im Wald, die uns zerreißen, wenn wir ihnen zu nah kommen, das ist unser schwacher Körper, der krank wird und stirbt, das ist die Kirche mit ihrer Prunksucht und ihrer Heuchelei. Diese Welt ist bösartig und vergänglich. Bei der himmlischen Welt musst du an Gott und seine Engel denken, an deine Seele, die dich immer wieder auf den richtigen Weg zurückführt, an die Liebe ... Hattest du noch nie das Gefühl, dass zwei Menschen zugleich in dir sind? Der eine will gut sein, der andere böse. Der eine zerrt dich in diese Richtung, der andere in jene. So kämpfen Gott und Teufel in dir selbst gegeneinander." "Und für diesen Glauben würdest du auch sterben?" "Ja, denn das ist die Wahrheit, und nur wer die Wahrheit auf Erden bezeugt, kann in den Himmel kommen. Im 169 Jahre dreiundsechzig sind hier in Köln vier Katharer aus Flandern hingerichtet worden. Zu ihnen gehörte auch eine Frau, die man aus Mitleid am Leben ließ. Man bot ihr an, entweder katholisch zu heiraten oder ins Kloster zu gehen, sie jedoch riss sich los und sprang freiwillig in die Flammen." Franziska seufzte. "Ich will immer zu dir halten, aber ... ich möchte lieber mit dir leben als mit dir sterben." Sie sah so unglücklich aus, als sie das sagte, dass er sie, von Rührung überwältigt, in den Arm nahm und ihr behutsam übers Haar strich, wie er es auch mit Ramira getan hatte. "Ich habe es ja gar nicht so eilig mit dem Sterben", tröstete er sie. "Sie suchen uns schon so lange ohne Erfolg. Und wenn sie eines Tages doch etwas über uns erfahren, warnt uns der Sohn eines Ratsmitglieds, so dass wir rechtzeitig fliehen können. Lass uns jetzt lieber an die armen Gaukler denken!" "Du hast Recht. Wollen wir zur Kunibertstorburg gehen? Vielleicht erfahren wir dort etwas über ihr Schicksal." Raimund nickte, und sie gingen sofort los. II D ie Kunibertstorburg unterbrach die Uferstraße dort, wo die neue Stadtmauer auf den Rhein traf, und zwar kaum zehn Wegminuten vom Anwesen Wolfhard Cranboims entfernt. Was sich über den gesamten nördlichen Bogen der Mauer sagen ließ, galt auch für sie - sie harrte noch ihrer Vollendung. Zwei Blöcke mit quadratischem Grundriss, hatte man etwa bis zur Hälfte der geplanten Höhe fertig gestellt. Eines der beiden Gebäude war (zur Erhöhung der Wehrhaftigkeit) um einen halben rechten Winkel gedreht und bohrte eine seiner Ecken in eine Seite des anderen hinein. In fünf oder zehn Jahren würden sie zusammen ein fast uneinnehmbares Bollwerk bilden. Zwei Vorposten vervollständigten die Wehranlage. Der eine war ein kleines, rundes Türmchen an der Straße wenige Meter außerhalb der Stadt und markierte die Stelle, bis zu der ein Kaufmann mit seinem Schiff fahren durfte, ohne Zoll entrichten zu müssen. Der andere hatte die Form eines lang gestreckten Hufs, bildete den Gegenpfosten des großen Torbogens und ragte gut zwei Schritt weit ins Was- ser hinein. Dieser Vorposten diente der Stadt als Gefängnis. Im Volk erzählte man sich grauenhafte Geschichten darüber. So war die Rede von einem Verließ mit einem von der Decke hängenden Stück Brot und einem Abgrund darunter. Wollte der Gefangene nicht verhungern, musste er an das Brot gelangen, wobei er unweigerlich in den Abgrund stürzte, wo ihn scharfe Messer zerschnitten, bis die einzelnen Körperteile in den Rhein hineinfielen und vom Wasser fortgespült wurden. Aber selbst wenn diese Legenden vielleicht nicht der Wahrheit entsprachen, so war doch jeder, der hier gefangen saß, schon so gut wie tot. Er starb an den grausamen Haftbedingungen im feuchten Kerker, oder er wurde öffentlich hingerichtet, oder er ging nach der Freilassung an den Folgen der Verhöre zu Grunde. Franziska und Raimund hatten hier nichts zu befürchten. Die Waffenknechte, die gelangweilt am Tor standen, grüßten sie ehrerbietig. Dennoch lief ihnen ein Schauder über den Rücken, als sie an der dunkelgrauen Fassade mit 170 den winzigen, schmalen Fenstern hinaufblickten. Franziska, die törichterweise ihr Schwert (unter den Kleidern verborgen) mitgebracht hatte, sah ein, dass sie die Gaukler aus diesem Turm ganz bestimmt nicht befreien konnte. "Ob sich dein Vater für sie einsetzt, wenn wir ihn bitten?" flüsterte sie. "Für deine Schwester bestimmt. Er braucht sie wahrscheinlich in etwa vier Wochen." "Was sagst du da?" "Du hast noch immer falsche Vorstellungen vom Mitgefühl meines Vaters. Er will nach Bremen fahren und dabei (ganz zufällig natürlich) der Burg deines Vaters einen Besuch abstatten. Ganz plötzlich wird er sich erinnern, die Töchter des Herrn Vasallen in den Händen schlimmer Gesellen gesehen zu haben. Nicht minder ritterlich als der Ritter bietet er an, sie zu befreien, für eine kleine Gegenleistung, versteht sich. Dann geht das übliche Schachern los. Eine Tochter bekommt der Vater zurück (immerhin besser als nichts!), die andere bleibt hier und hilft den Cranboims beim gesellschaftlichen Aufstieg. Ein paar Beutel Schmiergeld, und der Ehevertrag ist perfekt, ehe irgendjemand vom Betrug etwas merkt. Hochzeit ist ein Geschäft. Wusstest du das noch nicht? ... Übrigens habe ich gestern ..." "Da sind wieder ein paar Satansjünger eingelocht worden", erklärte plötzlich jemand unmittelbar hinter ihnen, und sie fuhren erschrocken herum. Ein heruntergekommen aussehender Kerl mit schwammigem Gesicht und schiefem Grinsen hatte sich ihnen von hinten unbemerkt genähert. "Was weiß du darüber?" "Oh, so manches." Natürlich hatte er seinen Preis. Raimund kramte hastig aus seiner Tasche einen Vierteldenarius hervor und steckte ihn ihm zu. "War ein Mädchen mit rotblonden Locken bei den Gefangenen?" "Eine Rothaarige? Nun, es war dunkel, aber ich glaub' bestimmt, dass so eine dabei war. Es soll nämlich einen Hexenprozess geben. Eine rothaarige Hexe! Jawohl, genauso ist's! Wollt Ihr wissen, was mit der jetzt passiert? Ich kenn' mich da ein bisschen aus, weil ich mal Wächter da drin war." Ohne zu ahnen warum, spürte er, dass er die beiden mit seinem Gerede beeindrucken konnte, und das nutzte er nun hemmungslos aus. "Hexen haben bekanntlich hundert Zaubermittel, um andere Leute hinters Licht zu führen. Drum werden sie im Keller nackt ausgezogen." Sein schiefes Grinsen wurde noch widerlicher. "Wenn eine hübsch ist, gehört sie natürlich erst einmal dem Henker und seinen Knechten. Die Folter beginnt gewöhnlich mit den Daumenschrauben. Anschließend zerquetscht man die Beine. Schließlich werden die Brüste langsam mit glühenden Zangen zerrissen ..." Franziska war wie von Sinnen vor Wut und ging wider jede Vernunft mit ihrem Schwert auf ihn los. Er sprang zurück und rief aus sicherer Entfernung: "Eine Jungfrau mit Waffe! Das ist merkwürdig! Habt Ihr dafür die Erlaubnis unseres gütigen Stadtherrn?" Raimund warf ihm eine weitere Münze vor die Füße. "Nimm das und verschwinde!" Franziska raunte er zu: "Steck das Ding schnellstens wieder weg! Die Wächter haben zum Glück nichts gesehen, weil sie würfeln. Was ist in dich gefahren? Wegen diesem schleimigen Halunken! Und ausgerechnet vor der Kunibertstorburg!" "Du kennst sie ja kaum! Wenn sie dir so viel bedeuten würde wie mir, könntest du auch nicht so ruhig bleiben." 171 Einen Augenblick lang überlegte er, ob er die Wahrheit gestehen sollte, doch dann war ihm das peinlich, und so sagte er nur mit einem bitteren Lächeln: "Vielleicht stehe ich ihr näher als du." "Weil du ein Katharer bist, und weil sie dich darum vielleicht als nächstes holen! Entschuldige bitte! Ich rede dummes Zeug, weil ich mich so hilflos fühle." "Ich fühle mich auch elend. Dieser Halunke hat nämlich Recht, auch wenn wir das nicht glauben wollen. Für den Erzbischof und die anderen Mächtigen in der Stadt ist es nun einmal die beste Lösung, den Maginulfusmord dem Teufel und einer seiner Hexen anzuhängen. Unter der Folter gesteht man alles, was der Henker hören will. Unglücklicher- weise war Ramira in der Nähe, als es geschah." "Woher weißt du das?" "Ich ... ich habe sie zufällig dort gesehen an diesem Abend." "Ja, alles spricht gegen sie. Sogar sein eisernes Kruzifix hat sie mitgenommen! Wie kann man so dumm sein!" "Und du dachtest vorhin, mein Vater würde sie noch retten! Er könnte es nicht einmal, wenn er es wollte. Sie ist hin. Verstehst du? In einer Woche haben ihr die gottesfürchtigen Diener der Heiligen Inquisition die Knochen zerquetscht und die Haut vom Leib gesengt, und sie wird entehrt und zerbrochen danach winseln, dass man sie endlich auf dem Scheiterhaufen erlöst." "Sei still! Bitte!" flüsterte Franziska. III G egen Abend richtet es Raimund so ein, dass er mit Franziska allein sprechen konnte, und fragte sie: "Kommst du heute mit zu meiner Gemeinde?" Sie nickte ohne Zögern. Im Grunde hatte sie damit gerechnet, dass er sie mitnehmen würde, sogar ein wenig darauf gehofft. Er führte sie zur Weidengasse und zwar zu jenem Haus und in jenen Keller, wo sie nach den Tumulten vor Sankt Maria ad Gradus einige Tage zu Hause gewesen war. "Jetzt verstehe ich manches", sagte sie lächelnd und fühlte trotz ihrer Angst um die Gaukler einen Anflug von Freude in sich aufkommen. Endlich gab es keine trennenden Geheimnisse mehr zwischen ihnen, so glaubte sie. Im Zimmer saßen wenigstens zwanzig Leute im Kreis beieinander. Die Frauen hatte Franziska schon im Kommunehaus gesehen, wenn auch (von Ursula abgesehen) noch mit keiner von ihnen gesprochen. Die Männer kannte sie noch nicht. Einen von ihnen stellte Raimund als einen Onkel zweiten Grades mit Namen Viktor vor. Er war Mitte zwanzig, also nur wenige Jahre älter als sein Neffe, dabei aber bereits beleibt und behäbig wie ein alter, selbstzufriedener Mönch. Zudem strahlte er ein solches Maß an Friedfertigkeit und Harmlosigkeit von der ersten Begegnung an aus, dass mancher ihn nicht recht ernst nahm. Neben ihm stand ein nicht mehr jugendliches, zweifellos jedoch noch unverheiratetes Mädchen. Ihr blondes, nackenlanges Haar fiel etwas zu glatt herab, so dass ihr Gesicht lang und hager erschien. "Das ist Cordula", sagte Raimund. Die junge Frau gab Franziska unbeholfen und scheu die Hand und suchte nach ein paar freundlichen Begrüßungsworten, die sie dann aber doch nicht fand. Es blieb ihnen indes auch kaum Zeit zu einem Gespräch, denn Ursula kam, kaum dass sie die vormali- 172 ge Bewohnerin der Dachstube erblickt hatte, mit energischen Schritten heran und stellte klar: "Wir sind Freunde alter, frommer Gesänge. Nach unseren Bestimmungen muss ein Neuling Bürger der Stadt Köln sein." Sie sagte das so bestimmt und feindselig, dass Franziska nicht zu protestieren wagte, so sehr das Misstrauen sie auch kränkte. Das Mädchen warf noch einen fragenden Blick zu Raimund herüber, erkannte aber an dessen verdrossener Miene, dass sie sich nichts auszurechnen brauchte, und ließ sich deshalb ohne Widerstreben hinausführen. Wenigstens durfte sie in einem kleinen Nebenraum jenseits des Eingangskorridors warten, um nicht als Mädchen allein im Dunkeln durch die halbe Stadt zurück zum Anwesen der Cranboims gehen zu müssen. Zu ihrer Überraschung war sie nicht als einziger dorthin verbannt worden. Auf der groben Holzbank saß, als sie eintrat, schon ein junger Mann. Er trug ein Lederwams mit einem Wappen, das sie nicht kannte, dazu einen breiten Gürtel um die Taille und feste Schuhe an den Füßen. Die Kerze vor ihm auf dem Tisch beleuchtete sein von Sonne und Wetter frühzeitig gegerbtes Gesicht. Seine wirren Haare und das stoppelbärtige Kinn vervollständigten das Bild eines verwegenen Kriegers. Dennoch beunruhigte Franziska seine Nähe nicht. Das lag zum einen an seinen dunklen, freundlichen Augen und zum anderen an seinen (dem sonstigen Eindruck krass widersprechenden) vorbildlichen Umgangsformen. Selbst in den Schlössern der Oldenburger Grafen hatte man ihr selten mit solcher Eleganz einen Platz angeboten wie in dieser engen, düsteren Kellerkammer am Stadtrand von Köln. "Bonjour, mademoiselle. Asseyezvous, s'il vous plaît!" Sie bedankte sich, bemüht, ihm an Manieren nicht nachzustehen. "Je ne parle pas allemand. Je regrette." Er hob bedauernd die Schultern. Obwohl sie sich fast nur durch Blicke und Gesten verständigen konnten, langweilten sie sich beide nicht. Sie verstand nach einiger Zeit, dass er Pierre hieß, ein Chevalier war (was wohl dem Stand ihres Vaters entsprach), aus einem Occitanien genannten Gebiet im Süden Frankreichs stammte und jemanden begleitete und beschützte. Jenen (offenbar sehr bedeutenden) Mann zeigte er ihr, als er am Fenster vorbei schritt. Sie sah ihn nur kurz, war aber dennoch beeindruckt. Alles an ihm schien nicht aus dieser irdischen Welt zu stammen - nicht das weiße, sehr lange Haar, das wie Schnee auf seinen Schultern lag, nicht die fast bis zum Skelett abgemagerte Gestalt, nicht das tiefernste Gesicht, in welchem zwei große, dunkle Augen im scharfen Kontrast zur blassen Haut wie Kohlestücke erschienen, nicht der Gang, der einem Schweben glich. Er strahlte eine Würde aus wie ein Kirchenfürst, und war zugleich unheimlich wie ein Geist. "C'est un perfectus", erklärte Pierre mit Hochachtung, und Franziska ahnte, dass sie wohl hauptsächlich seinetwegen nicht an der Zusammenkunft teilnehmen durfte. Wieso der Ritter dieses Greises unter dieselben Bestimmungen fiel, verstand sie freilich nicht. Dem Perfectus folgte noch ein zweiter Mann, der ebenso wie dieser barfuss ging und das gleiche schwarze, mönchsähnliche Gewand trug, allerdings weniger Respekt einflößend wirkte. Er erinnerte an einen gelehrigen Schüler, der schattengleich und voller Eifer seinen Meister auf Schritt und Tritt begleitet. Um besser sehen zu können, war Franziska auf einen Schemel gestiegen, 173 der sich nun als sehr wackelig erwies. Als er umkippte, musste sie zufrieden sein, auf allen Vieren zu landen, wobei ihr allerdings das Schwert unter dem Mantel herausrutschte und klirrend zu Boden fiel. Das war ihr äußerst peinlich, doch Pierre beruhigte sie, indem er den rechten Finger an die Lippen führte. "C'est votre épée? Pouvez-vous faire des armes?" fragte er, und weil sie ihn nicht verstand, zog er sein eigenes Schwert hervor, deutete Fechtbewegungen an und nickte ihr aufmunternd, wenn auch ein wenig spöttisch zu. "Ah, du denkst, ich kann damit nicht umgehen?" rief sie, sprang blitzschnell auf ihn zu und setzte ihm die Waffe auf das lederne Wams. "Ha! Da staunst du, was!" Er hatte sein Schwert viel zu tief und viel zu lässig gehalten, um eine Abwehrmöglichkeit zu besitzen. Nun war er aber gewarnt, und weil er sich einem Mädchen gegenüber keine Blöße geben wollte, griff er seinerseits an. Damit wiederum hatte sie gerechnet und längst Schwung geholt, so dass sie mit einem prächtigen Parierschlag ihren Gegner ein zweites Mal in Erstaunen versetzen konnte. Erst jetzt wurde ein echter Kampf aus dem Geplänkel. Pierre hatte endlich begriffen, dass er sich ein wenig mehr anstrengen musste, wenn er sich nicht wirklich noch blamieren wollte, und bewies nun mit ein paar raffinierten Finten, dass er sehr wohl sein Handwerk verstand. Franziska hielt sich tapfer und erinnerte sich nach und nach an alles, was Stefanus ihr beigebracht hatte. Einarmiger Angriff von rechts oben, Ausweichbewegung mit gleichzeitigem Verwringen des Körpers, beidhändiger Verteidigungsschlag von links unten, erneu- ter Angriff über Kopf mit einer leichten Drehung. Sie führte das alles so korrekt und sicher vor, dass jeder Schwertmeister seine Freude an ihr gehabt hätte. Nur die Enge des Raumes störte sie. Mehr als einmal blieb sie mitten im schönsten Schwung in einem Balken hängen und kam sich dann sehr lächerlich vor. Ihr Ärger darüber, dass der französische Ritter sie am Ende doch in die Ecke drängte, verflog jedoch schnell, als sie merkte, dass er sie plötzlich mit anderen Augen sah. Sofort nachdem er ihr das Schwert aus der Hand geschlagen und somit endgültig besiegt hatte, packte er sie mit beiden Händen bei den Schultern, schüttelte sie kräftig und rief begeistert aus: "Très bien! Vous êtes un vrai garçon!" Dabei strahlte er über das ganze Gesicht und war nicht mehr der Charmeur von zuvor, sondern ein wirklicher Kamerad. Welchen Dienst er ihr damit erwies, konnte er nicht ahnen. Sie gewann ihre Zuversicht zurück, erinnerte sich des alten Spruchs, dass nur verloren ist, wer sich selbst aufgibt. Das Wort Occitanien ließ sie träumen von einem paradiesischem Land, wo immer die Sonne scheint. Dorthin wollte sie mit Raimund und den befreiten Gauklern fliehen. Sie wusste nicht, wie sie das anstellen sollte, aber sie vertraute fest auf Gottes Hilfe. Die Zeit verging Franziska und Pierre so schnell, dass sie sich wunderten, als der Perfectus und sein Begleiter verabschiedet wurden. Der Ritter musste die beiden nun zu ihrem Nachtquartier bringen, während sich das junge Mädchen endlich zu den anderen Katharern gesellen durfte. 174 IV F ranziska hatte erwartet, Spuren des gerade zu Ende gegangenen Rituals zu finden, stellte aber enttäuscht fest, dass alle noch genauso im Kreis saßen wie zuvor, und dass auch kein Gegenstand hinzugekommen war. Als einzige Veränderung entdeckte sie ein paar inzwischen angezündete Kerzen und fragte sich, wie man den Raum so schnell wieder in den ursprünglichen Zustand hatte versetzen können. Dass Ketzer sich gut zu tarnen verstehen, erschien ihr einleuchtend, und so traute sie ihnen von Geheimtüren angefangen bis hin zu einer beweglichen Decke fast alles zu. Durch dieses Rätsel erschien ihr die Gemeinde ein wenig unheimlich, was sie aber nicht hinderte, sich zu ihnen in den Kreis zu setzen. Da woanders kein Platz frei war, musste sie mit Viktor als Gesprächspartner vorlieb nehmen, gegen den sie anfangs, ohne es begründen zu können, eine heimliche Abneigung empfand. Er spürte ihr Widerstreben, vermutete, sie habe schlechte Erfahrungen mit aufdringlichen Männern gesammelt und stellte (nach einer peinlichen Zeit des Schweigens) ein für allemal klar: "Vor mir brauchst du dich nicht in Acht zu nehmen. Ich werde dich gewiss nicht in Versuchung bringen." Dabei wurde er verlegen, als sei ihm beinahe ein Geständnis entglitten, das er um jeden Preis hüten wollte. Das tat Franziska leid, und so zwang sie sich, ihre Vorurteile zu überwinden. "Erzähl mir ein bisschen von dir!" forderte sie ihn auf. "Erwarte nur nichts Heldenhaftes!" "Ich denke, dass jeder Mensch auf irgendeine Weise ein Held sein kann." "Das hast du schön gesagt! Mein Vater ist ein Ministeriale des Erzbischofs und glaubt, dass es nichts Ehrenvolleres auf der Welt gibt als eben das. Einmal begleitete er unseren Stadtherrn nach Italien. Vor dem Aufbruch erhielt er zehn Mark Silber für Ausrüstung und Bekleidung. Zudem gehörte er zu den Glücklichen, denen das Los ein Streitross samt Sattel und allem Zubehör verschaffte. Für jeden Tag jenseits der Alpen, vierundfünfzig an der Zahl, bekam er noch einmal eine Mark Silber. Vom Wert des Pferdes abgesehen, kam er auf einen Sold von vierundsechzig Mark Silber. Das sind 9.216 Denare. Diese Zahl musste ich einmal einen ganzen Nachmittag lang immer wieder in den Sand zeichnen, damit ich begreife, wie einträglich der Beruf eines Waffenknechtes ist." Er hielt kurz inne und seufzte. "Zum Kummer meines Vaters hat das wenig geholfen bei mir. Ein Jahr lang bin ich zwar als Knappe mit einem Ritter durchs Land gezogen, doch kann man aus einem Holzlöffel keinen Hammer machen." "Warum hat dein Vater dich nicht ein Handwerk erlernen lassen, wenn du die Waffen nun einmal nicht magst?" "Zwischen meinem Großvater und seinem Bruder (dem Urgroßvater von Raimund) gab es einmal einen bösartigen Streit. Seither sind die beiden Familien verfeindet und es ist eine Frage der Ehre, dass die Söhne des einen Zweiges Kaufleute und die des anderen Ministerialen des Erzbischofs werden. Ich bin der einzige Sohn meiner Eltern. Welch eine Schande! Allerdings habe ich, wenn man's genau nimmt, beiden Familien geschadet. Durch mich nämlich ist Raimund Katharer geworden." Er lächelte schelmisch. Franziska sah ihn an und fand ihn plötzlich durchaus sympathisch. Bald störte sie sich auch nicht mehr an seiner weichlichen Art und seiner helle, fast weibliche Stimme. 175 "Und hier fühlst du dich wohl?" fragte sie ihn, und fügte zweifelnd hinzu: "Geht es nicht sehr streng zu bei euch?" "Niemand wird gezwungen, bei der Gemeinde zu bleiben. Auch die Regeln befolgt jeder nur so weit, wie er es für richtig hält. Manche wohnen im Kommunehaus, andere so wie Raimund bei ihren Familien." "Und du?" "Ich bin vor zwei Jahren ins Kommunehaus gezogen, weil ich es bei meinem Vater nicht mehr ausgehalten habe." "Das finde ich merkwürdig: Ihr lebt zusammen wie in einem Orden, aber es gibt Männer und Frauen bei euch." "Das ist gar nicht so merkwürdig. Hast du noch nicht vom Doppelkloster Fontevrault gehört? Ein heiliger Mann namens Robert von Arbrissel hat es mitten im Wald gegründet. Dort gehört es sogar zur Regel, dass nur eine verheiratete Frau Äbtissin sein darf - Äbtissin über beide Klöster, auch über das der Männer." "Ich kann das kaum glauben!" "Und doch ist es die Wahrheit! Bei uns gibt es zwei Kommunehäuser. Das für unsere Schwestern kennst du, das für die Brüder befindet sich ein kleines Stück weiter zur neuen Stadtmauer hin. Die beiden Konvente bestehen nun schon seit fast zwanzig Jahren." "Und die ganzen Jahre über seid ihr nicht entdeckt worden?" "Wir konnten uns gut tarnen, weil unsere Lebensweise jener der Beginen und Begarden ähnelt. Die aber haben ihren Frieden mit der Kirche geschlossen und dürfen in der Stadt ihre Höfe gründen." "Ich habe mich am Anfang auch täuschen lassen." "Trotz allem hatte es unsere Gemeinde nicht immer leicht. Die Handwerkerinnungen mögen die Kommunen nicht, weil sie um ihr Geschäft fürchten. Allein die Lederbeutelmacher ließen sich überreden, weil die Arbeit schwer ist und schlecht bezahlt wird, so dass die Lehrlinge und Lehrmädchen davonlaufen. Immerhin darf jetzt von jedem unserer Häuser ein Vertreter an den Morgensprachen teilnehmen. Die Frauen vertritt übrigens Ursula. Du kennst sie doch?" "Ich kenne sie, aber ich mag sie nicht. Sie ist so ...engherzig. Was denkst du denn von ihr?" Da sich jetzt alle unterhielten, und deshalb ziemlich viel Lärm im Raum herrschte, war es ausgeschlossen, dass die junge Frau sie verstehen konnte. Dennoch zuckte Viktor unwillkürlich zusammen. Er wog den Kopf, und ihm war anzumerken, wie sorgsam er jedes Wort prüfte, um auf keinen Fall jemandem etwas Schlechtes nachzusagen. "Ursula ist sehr bescheiden. Sie nimmt sich immer die schwersten und niedrigsten Arbeiten, geht sogar betteln für die Gemeinschaft." "Ich glaube, dass sie mich nicht mag." "Sie möchte nicht, dass Mann und Frau beieinander liegen, weil dabei ein Kind gezeugt werden kann." "Und was ist so schlimm daran?" "Der Teufel unternimmt mit seinen Dämonen Raubzüge an die Grenze des Himmelreiches. Von dort entführt er die Engel des Herrn und sperrt sie in menschliche Körper. Verstehst du? Jedes Kind, das geboren wird, dient als Gefängnis für die Seele eines Engels." "Selbst wenn es so wäre, wie du sagst - ich und Raimund, wir haben noch nie beieinander gelegen. Das ist ein ungerechter Vorwurf." Sie verteidigte sich ein wenig zu heftig, musste einen Anflug von Verlegenheit überspielen. "Auf jeden Fall könnte sie mir sagen, was ihr an mir nicht gefällt." "Vielleicht liegt es an ihrem früheren Zuhause, dass sie manchmal hart urteilt. Ihre Eltern sind Handwerker und arbeiten fast nur für das Domkapitel und für 176 die Kölner Kirchen, vor allem für die reichen Stifte, die Mutter als Stickerin und der Vater als Goldschläger. Das hat wohl im Laufe der Zeit auf ihr ganzes Leben abgefärbt. Alles bei ihnen geschieht nach den Regeln der Poenitentiales. Dort steht zum Beispiel drin, an welchen Tagen ein Mann seine eigene Ehefrau zu sich ins Bett nehmen darf und an welchen nicht. Das Essen und Trinken ist geregelt, das Reden, einfach alles." "Aber die Poenitentiales sind doch die Bußbücher der Katholiken, und Ursula ist eine Ketzerin geworden!" "Sie nimmt die Regeln der Katharer ebenso genau wie ihre Geschwister die Regeln der Papstkirche." "Ihre Geschwister haben sich den Eltern also nicht widersetzt?" "Der jüngere ihrer beiden Brüder ist Priester geworden, die Schwester früh ins Kloster gegangen. Jetzt lebt nur noch der älteste Sohn im Hause. Der ist Goldschläger wie sein Vater und erbt eines Tages die Werkstatt." "Die beiden sehen einander zum Verwechseln ähnlich!" Das war ein Einwurf von Cordula gewesen, und Franziska drehte sich nun verblüfft nach ihr um. Sie hatte die junge Frau ganz vergessen, obwohl sie wie Viktor neben ihr saß. Cordula wurde durch die plötzliche Aufmerksamkeit furchtbar verlegen und entschuldigte sich sofort: "Verzeiht mir! Ich wollte euch nicht stören", was freilich nicht ganz aufrichtig war, denn in Wahrheit hatte sie genau dafür lange nach einem passenden Vorwand gesucht. So schwieg sie nun auch nicht, sondern beanspruchte Franziska fortan für sich: "Ich stamme aus einer Korbmacherfamilie. Leider ist Mutter schon vor über zehn Jahren gestorben und hat (Gott sei's geklagt) sieben Kinder zurückgelassen. Wir sind in Not gekommen, und Vater kriegt keine neue Frau. Seit einem Unfall hinkt er nämlich." Sie seufzte tief. "Ich war das älteste Kind und musste plötzlich Hausfrau sein. Zum Markt gehen, Essen kochen, waschen, auf die Kleinen aufpassen." Sie seufzte abermals. "Leider hab ich zwei linke Hände, und keiner hört auf mich, wenn ich was sage." Ihr Gesicht wirkte plötzlich vor Gram und Verbitterung wie versteinert. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, sagte Franziska: "Jetzt wohnst du im Kommunehaus, nicht wahr? Ich habe dich einmal dort gesehen." "Ja. Eines Tags bin ich davongelaufen. Die Katharer bestrafen niemanden wegen seiner Ungeschicklichkeit. Und weil sie glauben, dass die körperliche Hülle vom Teufel stammt, sind ihnen Frauen nicht weniger wert als wie Männer. Wir leben im Kommunehaus so schön und friedlich miteinander ... Ich fürchte mich aber vor diesen Canes. Ich träume oft davon, dass sie unser Haus stürmen. Darum male ich jeden Tag magische Zeichen in den Sand vor der Tür. Das muss ich aber heimlich machen, weil's Aberglauben ist." Viktor beklagte sich übrigens nicht, dass er seine Gesprächspartnerin hatte abtreten müssen. Er lehnte sich zurück und beobachtete mit einem gutmütigen Lächeln die anderen, die hin und wieder freundlich zurückblinzelten. Obwohl er nicht im Mittelpunkt stand, war er unübersehbar beliebt. 177 V E ine Gelegenheit, mit Raimund zu sprechen, fand Franziska erst wieder auf dem Heimweg tief in der Nacht. "Wie hast du dich mit Cordula und Viktor verstanden?" wollte er wissen. "Recht gut, zumindest am Schluss." "Cordula grämt sich, weil sie ihn liebt und nicht begreifen will, dass er Frauen nicht mag." "Wie meinst du das?" "Hast du noch nie davon gehört, dass manche Männer ..." "Ich verstehe. Doch ... das ist eine schwere Sünde." "Bist du enttäuscht?" "Nein ..." "Wer den Dominikanern glaubt, muss uns für blutrünstige Verbrecher halten. In Wahrheit sind wir fast alle unglückliche Geschöpfe, ausgestoßen und verachtet, zu schwach, um uns in dieser Stadt allein behaupten zu können. Nur zusammen sind wir stark genug. Ist dir aufgefallen, wie freimütig bei uns jeder seine Mängel zugibt? Bei uns darf man schwach sein. Niemand findet etwas Besonderes dabei." "Wie konnten solche Menschen jahrelang Krieg führen?" "Frankreich ist nicht Deutschland. Dort gehören nicht nur Sonderlinge zu den Katharern sondern auch Burgherren und Adlige. Dort ist unser Glaube stolz und gefürchtet." "Und wie ist das mit den strengen Regeln, von denen man sich erzählt? Stimmt es, dass sich manche von euch zu Tode hungern, nur um den vom Teufel erschaffenen Leib abzuschütteln?" "Glaube nicht solchen Unsinn! Wir halten bestimmte Fastenzeiten ein - das ist das ganze Geheimnis des Endura. Außerdem musst du wissen, dass sich nur die Perfecti der Lehre völlig unter- werfen. Für uns einfachen Anhänger sind die Bedingungen viel leichter." "Denkst du, dass die Katharer in Deutschland eines Tages genauso viel Macht bekommen wie in Frankreich?" "Ich denke, dass wir zum versprengten Rest eines geschlagenen Heeres gehören. Die katholische Kirche wird uns früher oder später vernichten, ohne sich anzustrengen." Franziskas wusste nun, dass er sie belogen hatte bei seinen tröstenden Beteuerungen am Vormittag - und in ihr Herz kehrte die Beklommenheit zurück, die sie (vor allem durch die Späße des Ritters Pierre) für einige Stunden abgeschüttelt hatte. Wieder sah sie Pentia, Ramira, Melanie und Mario in ihrem Unglück vor sich. Wieder sah sie sich Alexander und den kleinen David begraben. In ihrem Zimmer vergrub sie den Kopf im Kissen und weinte, bis sie vor Erschöpfung einschlief - und ihre Sorgen in den Träumen wiederauferstanden. Am nächsten Morgen war das Frühstück am großen Familientisch eine Qual für sie. Hier hatten die Gewalttätigkeiten, die nun schon den dritten Tag die Stadt in Schrecken versetzten, fast nichts verändert. Wolfhard und Jan unterhielten sich angeregt über ihren jüngsten Geschäftserfolg. Katharina, die sich langweilte, bedrängte die Mutter mit ihrem Wunsch nach einem neuen Kleid. Nur bei der zerbrechlich zarten Dorothea hatten die grausamen Berichte eine Spur hinterlassen. "Was haben die Juden diesen Canes eigentlich getan?" fragte sie unvermittelt. Der Vater wandte sich ihr zu und belehrte sie: "Sie rauben kleine Kinder, schlachten sie und opfern sie bei ihren teuflischen Ritualen." 178 Das Mädchen riss entsetzt die Augen auf, war aber dennoch nicht gänzlich überzeugt. "Hat man sie schon mal dabei gesehen?" "Das weiß man eben", versetzte der Vater und wollte sich wieder Jan zuwenden. In diesem Moment aber fasste sich Franziska ein Herz und bat ihn: "Meine Schwester sitzt unschuldig in der Kunibertstorburg gefangen. Könnt Ihr sie befreien?" "Ich kümmere mich heute darum. So ganz schuldlos an ihrem Unglück ist sie aber nicht, deine Schwester. Sie hätte bei uns wohnen können, anstatt sich mit diesem Pack herumzutreiben." "Mein Herr Vater kümmert sich darum! Wie mitfühlend!" Raimund schob den Teller mit einer heftigen Bewegung von sich. Seine Augen glühten. "Vier Menschen sind unschuldig eingesperrt. Vier! Euch beschäftigt aber nur das Schicksal der Ritterstochter, für die Ihr noch Verwendung habt." "Raimund!" rief Sieglinde Cranboim. Auch der Kaufherr war überrascht von der plötzlichen Aufsässigkeit seines sonst so in sich gekehrten Sohnes. "Ich bin heute aus gutem Grund ausgezeichnet gelaunt und will mir meine Stimmung nicht mit derlei Unsinn verderben lassen." Katharina unterstützte ihn: "Was geht uns der Spuk auf der Straße an? Können wir nicht über etwas Lustiges reden?" Der Vater tat ihr den Gefallen. Seine Töchter bogen sich vor Lachen. Jan und die Mutter schlossen sich ihnen an. Franziska und Raimund indes wurden vergessen. Nach dem Frühstück ging jeder seinen Pflichten nach. Franziska saß mit Jan in seinem kleinen Kontor und half ihm beim Sortieren von Rechnungen. "Ob dein Vater etwas erreicht?" "Bestimmt. Er hat seine Beziehungen." "Vielleicht könnte er auch für die anderen drei ..." "Für diese Gaukler? Warum? So etwas ist doch Abschaum." Sie wollte nicht glauben, dass er wirklich so dachte, wie er redete, und sah ihn lange an. Auf seinem Gesicht spiegelte sich jedoch keine Spur von Erregung wider. Offenbar mit seinen Gedanken längst woanders, nahm er ein Pergament in die Hand und vertiefte sich darin. Sie hatte sich immer gefragt, ob sein kühles Gehabe mit dem Geschäft zusammenhing oder seinem Wesen entsprach. Jetzt wusste sie die Antwort, und ihr fröstelte. 179 18.Kapitel I F ranziska und Raimund gingen jeden Morgen zur Kunibertstorburg. Wenn sie den Gefangenen schon nicht helfen konnten, wollten sie wenigstens etwas über ihr Schicksal erfahren. Nicht einmal das aber war ihnen vergönnt. Die Wächter wussten nichts oder durften ihnen nichts sagen, und den Schwätzern, die sich ihnen manchmal aufdrängten, schenkten sie keinen Glauben. Nach einer Woche wurde das Ergebnis der Verhöre verkündet, wie zum Hohn ausgerechnet dort, wo die Gaukler wochenlang gewohnt und große Erfolge bei den Niedericher Bürgern gefeiert hatten, auf dem Platz vor Sankt Kunibert. Selbstverständlich waren die Angeklagten geständig gewesen. "... und so flogen sie durch die Lüfte zu den Orgien des Satans, und gaben sich dort den abscheulichsten Ausschweifungen hin, die auszusprechen sich die Zunge eines rechtgläubigen Christenmenschen scheut, und schworen der Katholischen Kirche und dem Heiligen Vater ab und bekannten sich zu den Mächten der Hölle, und bereiteten Salben zum Schaden der Bürger unserer Heimatstadt Köln derart, dass sie nach Belieben Hagel und Sturm schicken konnten ..." Franziska zog Raimund fort. "Ich kann das nicht mehr mit anhören!" flüsterte sie ihm zu. "Das ist doch alles nicht wahr. Das haben sie nur gestanden, weil sie gefoltert worden sind." Er ging darauf nicht ein, sondern sagte stattdessen: "Mein Vater war bei den Inquisitoren." Sie blickte ihn aus großen Augen an. "Was hat er erfahren?" "Dass deine Schwester gar nicht in der Kunibertstorburg ist." "Wieso nicht? Sie muss dort sein." "Eine Ritterstochter gemeinsam mit fahrendem Volk wegen Schadenzauber anzuklagen, ist eine bedenkliche Sache. Ich kann mir vorstellen, dass man sie vorübergehend im Keller des Hospitals Sankt Maria Magdalena hat verschwinden lassen. Sobald sich die Aufregung über den Prozess legt, kann sie sich mein Vater dort abholen." "Ja, das wäre möglich. Trotzdem finde ich das alles so schrecklich! Diese Nacht habe ich von Ramira geträumt. Sie stand mit zerfetzten Kleidern vor mir und sah mich mit großen Augen an. Das werde ich nie vergessen. Lass uns fortgehen aus Köln! Wenn ich immer wieder an diesem Turm vorbeigehen muss, gräme ich mich zu Tode. Der Ritter, der euren Perfectus begleitet, hat mir von seiner Heimat erzählt." "Erzählt?" fragte er ungläubig zurück. "Nun ja, wir haben uns irgendwie verständigt." "Pierre gehört zur Besatzung der Burg Montségur. Sie steht auf einem hohen Felsen und ist so gut wie uneinnehmbar. Zwanzig Jahre Krieg überstand sie unbeschadet, und noch immer leiten die Führer der Katharer von dort aus den Widerstand. Die Burg ist ein Symbol für alle, die sich nicht einschüchtern lassen wollen und deshalb aus Höhlen und Wäldern heraus den Kampf gegen die Katholiken fortsetzen. Solange Montségur nicht fällt, werden die Inquisitoren ihr Ziel nicht erreichen. Im Herbst hat sich der Papst bei einem Konzil in Toulouse mit etlichen Bischöfen getroffen, um mit ihnen zu beraten, wie sie unseren Glauben endlich auslöschen können." "Woher weißt du das alles?" Er lächelte. "Von ihm. Ich kann Französisch." "Was hat er dir noch gesagt?" "Dass er sein Occitanien liebt und es niemals von Paris aus verwaltet sehen will. Eigentlich werden in Frankreich zwei Kriege zugleich geführt - zwischen Katharern und Papstanhängern sowie zwischen occitanischem Adel und König. Wenn Pierre nicht in seiner Heimatliebe ein wenig übertreibt, war die Grafschaft von Toulouse unter meinem Namensvetter Raimund VI ein Paradies auf Erden. Niemand brauchte sich zu fürchten, weil er an etwas anderes glaubte oder aus einem fernen Land kam. Den Menschen ging es gut. Die großen Städte waren blühende Handelsplätze." "Und was ist daraus geworden?" "Raimund wurde sein Verständnis für die Katharer zum Verhängnis. Erst hat ihn der Papst exkommunizieren lassen, dann verlor er seine Grafschaft. Später eroberte er sie sich zurück und verlor sie erneut. Ich glaube, er liebte das Kriegshandwerk nicht besonders. Bei seinem Neffen Raimund-Roger Trancavel, dem Vicomte von Bézier, war das anders. Als das riesige Heer des ersten Albigenserkreuzzugs heranrückte, verschanzte er sich in der großen Burg von Carcassonne." Franziska mochte es, wenn Raimund ihr etwas erklärte. Er wusste viel und sprach mit ihr auch von Dingen, die sie als Mädchen eigentlich nichts angingen. An diesem Tage war sie ihm dafür besonders dankbar, weil er sie damit ablenkte. "Aus Rache ließ der König die Stadt Bézier plündern und niederbrennen, die Bewohner abschlachten. Anschließend begann die Belagerung von Carcassonne. Unglücklicherweise war der Som- mer heiß, und schon nach zwei Wochen ging das Wasser zur Neige. Der Vicomte musste verhandeln. Als er die Burg verließ, wurde er heimtückisch gefangen genommen und bald darauf hingerichtet. Sein Sohn Raimund Trancavel entkam." "Eure vielen Raimunds kann man kaum voneinander unterscheiden!" "Eure vielen Heinrichs doch auch nicht ... Aber du hast recht - ich rede dich betrunken." "Nein, so war das nicht gemeint. Bitte erzähl weiter! Hat der Sohn seinen Vater gerächt?" "Er hat es versucht. Vor ein paar Jahren sind viele vertriebene occitanische Adlige zurückgekehrt. Das königliche Heer mit ihrem Feldherrn Amaury musste sich immer weiter nach Norden zurückziehen. Du kannst dir vorstellen, welch gute Nachricht das für uns war. Raimund Trancavel eroberte Carcassonne zurück, wurde Vicomte von Béziers. Doch der König nutzte seine guten Beziehungen zum Papst, um einen zweiten Kreuzzug predigen zu lassen. Die Menschen in Occitanien hatten die Gräuel des ersten noch in denkbar schlechter Erinnerung und darum wenig Mut zum Widerstand." Bekümmert merkte Franziska, dass Raimunds Geschichte ihre Gedanken zwar an einen anderen Ort führte, dass dort aber ebenso Unrecht, Grausamkeit und Habsucht regierten. "Hat man ihn hingerichtet wie seinen Vater?" fragte sie verzagt. "Pierre sagt, er sei enteignet worden und wieder ins Ausland geflohen." "Aber die Burg auf dem Felsen ..." Sie brach ab, weil sie fürchtete, er würde selbst diesen Hoffnungsschimmer wieder zurücknehmen. Das tat er aber nicht, im Gegenteil. "Im Gebirge gibt es noch viele Burgen, an denen sich die Katholiken und die Königlichen gemeinsam die Zähne 181 ausbeißen. Foix, Surespine, Quertinheux, Peyrepertuse. Ich habe schon so oft französische Glaubensbrüder davon reden hören, dass ich mir manchmal einbilde, schon dort gewesen zu sein. Quéribus ist vor vier Jahren vom Heer eines königlichen Seneschalls wochenlang vergeblich belagert worden. In Cabaret lebt seit fünf Jahren unbehelligt der Katharerbischof von Carcassonne. Und in Montségur liegt der Schatz der Katharer, ein fürstlicher Schatz, den Erzählungen nach." Franziska schöpfte wieder ein wenig Mut. "Bitte lass uns dorthin fliehen! Du selbst hast gesagt, dass euer Glaube in Frankreich stolz und gefürchtet ist, während ihm in Deutschland nur Sonderlinge anhängen. Deine wahre Heimat liegt also dort und nicht hier. Pierre wird uns mitnehmen und uns den Weg zeigen." Raimund sah sie sonderbar von der Seite an. "Was hast du nur für merkwürdige Einfälle! Was sollen die Leute von Montségur denn mit uns anfangen? Wir sind keine Perfecti und erst recht keine Ritter. Wir können weder die Lehre bewahren noch diejenigen, die das tun, beschützen." "Ich weiß noch, wie du mich vor den Graukitteln gerettet hast, damals bei unserer ersten Begegnung. Du kannst also kämpfen, wenn du willst. Und ich kann es auch, obwohl ich ein Mädchen bin. Pierre staunte nicht wenig über mich." "Pierre?" "Ja, Pierre. Ich habe mit ihm gefochten." Er seufzte und senkte tief in Gedanken den Blick. Was in ihm vorging, wusste das Mädchen nicht. Nach einiger Zeit sagte er dunkel: "Der Mensch ist von seinem Wesen her träge und feige. Trägheit und Feigheit aber gehören vielleicht zu seinen schwersten Sünden." "Du kommst also mit, ja?" "Wohin?" "Nach Frankreich. Hast du mir denn gar nicht zugehört?" "Entschuldige bitte!" "Ja oder nein?" Nach langem Zögern antwortete er: "Ja." Dann mussten sie sich trennen. Raimund hatte etwas für seinen Vater zu erledigen, Franziska wurde von Jan im kleinen Kontor erwartet. Am Nachmittag suchte sie nach dem Chevalier Pierre, um ihm von ihrem und Raimunds Entschluss zu berichten und ihn um seine Hilfe zu bitten. Sie traf ihn aber weder im Versammlungskeller noch im Kommunehaus an, und die wie immer unfreundliche Ursula wollte ihr auch nicht sagen, wo sie mehr Glück hätte. Ihre Enttäuschung jedoch wurde bald von einer viel schwerwiegenderen Nachricht überdeckt. Aus dem Gespräch zweier alter Damen erfuhr sie, dass die Hinrichtung der Gefangenen aus der Kunibertstorburg schon am nächsten Morgen stattfinden sollte. Eine einzige Nacht also blieb ihnen noch! Fast blind vor Tränen und ganz benommen vor Kummer, schaffte sie kaum den Heimweg. Dort schloss sie sich in ihr Zimmer ein, ohne sich um die noch nicht erledigte Arbeit zu kümmern. 182 II R aimund saß im großen Saal. Niemand vermutete ihn hier. Er war allein. Um die Junihitze zurückzuhalten, hatte man die Fensterläden geschlossen. Eine Lichtbahn (beginnend an einem vom Sturm ins Holz geschlagenen Loch) zerteilte den sonst dunklen Raum und brachte eine steinerne Madonna zum Leuchten. Dorthin starrte Raimund, während seine Gedanken zu seiner Freundin ins Verließ wanderten. Er sieht die eiserne Tür des Kerkers vor sich, steckt den Schlüssel, den er in der Hand hält, hastig ins Schloss und dreht ihn herum. Seine Augen gewöhnen sich nur langsam an die Finsternis in der Zelle. Endlich entdeckt er das wimmernde Bündel, das in der Ecke auf einer Strohschütte liegt. "Ich bin gekommen, dich zu befreien." Hier kann er ihr nicht helfen, und so nimmt er sie auf die Arme und trägt sie hinaus ins Freie. Draußen weht ein kalter, scharfer Wind. Ramira klammert sich an seinem Hals fest und schmiegt sich zitternd an ihn. Seine Eltern erwarten ihn schon. Sie wollen ihm den Weg zur Tür abschneiden und ihn zur Rede stellen. Er aber umgeht sie und hört ihnen nicht zu. Im Gästezimmer neben der Küche richtet er der Freundin aus weichen Fellen ein Lager her. Dann schleppt er einen Zuber mit warmem Wasser heran, streift ihr behutsam die zerfetzten Kleider vom Körper und wäscht ihr das Blut und den Schmutz ab. Mit großen, festen Tüchern umwickelt er die gebrochenen Beine, mit schmalen Binden die zerschundenen Finger. "Du wirst wieder gesund", versichert er ihr. "Nein. Ich werde hinken und meine Hände nicht richtig gebrauchen können. Was willst du mit mir anfangen?" Als Antwort streichelt er ihr zärtlich über Wangen und Haar, hüllt sie in eine große Decke und legt sich zu ihr. "Hast du vergessen, woran ich glaube? Sie haben nur deinen Leib verkrüppelt. Deine Seele ist unverletzt geblieben." "Und deine Eltern? Für die zählt meine Seele wenig. Die sehen nur die Hexe und Gauklerin in mir und werden mich aus dem Hause jagen." "Ich gehen mit dir, gleichgültig wohin." Unter seinen streichelnden Händen hört sie allmählich auf zu zittern. Noch laufen ihr Tränen über die Wangen, doch auch die versiegen schließlich. In seinen Armen sinkt sie in einen Erschöpfungsschlaf. Sobald sie aufwacht, wird er ihr eine Hühnerbrühe mit viel Fleisch geben. Plötzlich aber verschwand die Vision, und Raimund glaubte eine harte Stimme rufen zu hören: "Du Träumer! Sie ist verloren. Du weißt es, nur kannst du die Wahrheit nicht ertragen." Ihn fröstelte, obwohl es (trotz der geschlossenen Fensterläden) stickig warm war im großen Saal. "Sie ist verloren! Verloren!" hallte es in ihm wider. Da wurde er sich der leuchtenden Madonna bewusst, die ihn von ihrem Thron her zu verhöhnen schien - und fasste einen Entschluss. Sein Körper spannte sich. Angst und Trauer fielen ab von ihm. Er stand auf, sah noch einmal hasserfüllt hinüber zu Maria, die für ihn jetzt nur noch Symbol der päpstlichen Kirche war, und trat hinaus auf die Straße. Dort wandte er sich allerdings nicht nach links dem Gefängnis zu sondern nach rechts. Vieles ging ihm durch den Kopf. In kurzen Episoden zog sein ganzes Leben 183 noch einmal an ihm vorüber. Die glückliche Zeit der frühen Kindheit, als er seiner Mutter noch blind vertraut hatte, die Jahre in der Klosterschule mit den Rutenschlägen des Lehrmeisters, die ersten Botengänge für den Vater, die erste Begegnung mit den Katharern. Manche Bilder sah er deutlich, manche nur verschwommen. Der Abend, an dem er das Consolamentum empfangen hatte, stand ihm so klar vor Augen wie die Straße, auf der er gerade lief. Der mit einer blendendweißen Decke verhüllte Tisch, auf dem ein Neues Testament liegt. Der davor stehende Perfectus, flankiert von seinem französischen Gehilfen und Viktor. Damit nichts Unreines die Zeremonie überschattet, waschen sich die drei gründlich die Hände und trocknen sich an weißen Handtüchern ab. Dann folgt ein Teil des Rituals dem anderen. Vieles ähnelt der Priesterweihe in der katholischen Kirche. Ganz anders geartet allerdings ist der Schwur: "Niemals werde ich ohne Hemd und Hose schlafen, auf dass ich nicht in Versuchung komme, dem Teufel ein neues Gefäß zu schaffen. Niemals werde ich aus Angst vor Wasser oder vor Feuer oder vor irgendeiner anderen Todesart ablassen von der reinen Lehre. Niemals werde ich meine Katharerbrüder verraten." Anschließend legt ihm der Perfectus das Neue Testament aufs Haupt, und die Gemeinde sagt: "Heiliger Vater, nimm deinen Diener auf in deine Gerechtigkeit und erfülle ihn mit deiner Gnade und mit deinem Geist!" Franziska, deren Geburtstag ausgerechnet auf diesen Tag gefallen war, wusste nichts von alledem. Franziska! Wie oft hatte er sie hintergangen und belogen in den vergangenen Wochen! Jetzt, da er sein Leben überdachte, schämte er sich dafür. Hielt sein Körper wirklich die Seele eines Engels gefangen oder war er nichts als eine leere Hülse, ein vom Teufel auf Vorrat geschaffenes und dann doch nicht benötigtes Behältnis? Er hatte sich die Geistestaufe nicht spenden lassen, um die Lehre der Katharer zu verbreiten, sondern um zu sterben. Dann war er zu Franziska gegangen und hatte ihr versprochen, mit ihr nach Frankreich zu fliehen. Lügen, Lügen, immer wieder Lügen! Er stellte sich Franziska vor bei der Nachricht von seinem Tod. Warum nur liebte sie ihn so sehr? Welchen Grund hatte er ihr dafür gegeben? Vielleicht bricht sie zusammen, vielleicht aber übersteht sie es auch, denn sie ist stark. Und vor allem: Sie wird frei sein für einen Mann, wie sie ihn braucht. Dieser Gedanke tröstete ihn. Sie war nicht angewiesen auf ihn. Von ein paar Andeutungen her wusste er, dass sich Pierre in sie verliebt hatte. Ein charmanter, französischer Ritter und eine hübsche, gesunde, deutsche Burgherrentochter! Warum sollen sie sich nicht zusammentun? Sie kann mit ihm nach Occitanien gehen und dort das Leben führen, von dem sie träumt. Nun endgültig beruhigt, zogen seine Gedanken weiter, bis sie im Gauklerwagen ankamen, wo sie verweilten. Während er noch einmal jede Einzelheit seiner ersten und zugleich einzigen Liebesnacht genoss, fühlte er sich so glücklich, dass er hätte springen und tanzen mögen. Plötzlich verlor sogar der Tod seinen Schrecken für ihn. Wir werden uns wieder sehen. Morgen werden wir auf demselben Scheiterhaufen als Märtyrer sterben, und unsere Seelen werden frei sein und in der Welt des Lichtes, wo es keine Standesunterschiede mehr gibt, vor Gottes Thron Hochzeit halten. Raimund hatte Sankt Kunibert erreicht und zwar von der dem Rhein abgewandten Seite her, wo sich das provisorisch gedeckte, den Niedericher Bür- 184 gern als Pfarrkirche dienende Westwerk befand. Wie immer zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang war das Tor in der Umfassungsmauer des Chorherrenstifts nicht abgeschlossen, und auch in die Kirche selbst konnte man hineingehen. So hatte jedermann die Möglichkeit zu einem Gebet an geweihter Stätte, wenn ihm danach zumute war. Um diese Tageszeit aber arbeiteten die Leute, so dass dieses Recht niemand ausnutzte, und Raimund allein war in dem weiten Raum. Ohne sich zu beeilen, jedoch auch ohne zu zögern, trat er an die überlebensgroße Figur des heiligen Martin von Tours heran und zog ihm das eiserne Schwert, mit dem er seit Jahrzehnten seinen Mantel zu zerteilen versuchte, mit einer kräftigen Drehung aus der Hand. "Deine Kirche schert sich einen Dreck um deine großherzige Tat. Einem einzigen Bettler hast du geholfen und Tausende andere mussten weiter frieren. Du brauchst deine Waffe nicht mehr. Es ist sinnlos, was du damit anstellst." Das Schwert war schwer. Dennoch hob Raimund es über den Kopf, feierlich wie bei einem Ritterschlag. Seine Augen leuchteten. "Ihr glaubt, dass ich mich an euch nicht rächen kann, aber ihr irrt euch. Ich räche mich an euch, indem ich euch eure Götzen zerschlage." Dann begann er fast wollüstig sein Zerstörungswerk. Zuerst kamen die vier Evangelisten zu seiner Rechten an die Reihe. Markus, den die Heiden mit einem Strick um den Hals zu Tode schleiften, schlug er den Kopf ab und erlöste ihn so von seiner Marter. Lukas wurde schlecht beschützt von seinem Stier, ebenso Johannes von seinem Adler. Matthäus, dem ein kurzes, dolchähnliches Schwert im Rücken steckte und offensichtlich nichts anhaben konnte, bekam zu spüren, was geschieht, wenn eine solche Waffe mit wirklichem Grimm geführt wird. Kolumba, die sich in eine Nische verkrochen hatte (aus Angst vor dem Mann, der ihr im Kerker hatte Gewalt antun wollen), ließ er in Frieden. Sie erinnerte ihn zu sehr an seine Ramira. Umso ärger richtete er Ursula zu. Die stolze Königstochter mit ihrer goldenen Krone auf dem Kopf und dem kostbaren Mantel um die Schultern blickte ungeachtet des Hunnenpfeils in ihrer Brust hochmütig auf ihn herab. Er zertrümmerte sie bis zur Unkenntlichkeit. Als die ersten Leute, vom Gepolter angelockt, hereinkamen, war er noch immer mit ihr beschäftigt und merkte nichts. Er glich einem Bauern, der Brennholz für den Winter hackt. Nach Ursula widmete er sich Gereon, dem Stadtheiligen, und Gregor Maurus, dem thebäischen Hauptmann. "Wehrt euch, ihr ruhmreichen Krieger!" rief er ihnen zu und ließ das Schwert des Martin in ihre wurmstichigen Glieder fahren. Schlimm erging es auch den kleinen Skulpturen der heilig gesprochenen Kölner Bischöfe. Maternus flog im hohen Bogen gegen einen Pfeiler und zerbarst daran. Severinus folgte ihm. "Wie kommt es nur, dass sich bei euch die Heiligen nur so tummeln? Ihr habt doch nicht etwa den Papst bestochen?" Es war unbeschreiblich befreiend, mit offenem Mund hinauszuschreien, was er bisher nur flüsternd im Versammlungskeller hatte sagen dürfen. Inzwischen waren allerdings drei Waffenknechte hereingekommen und näherten sich ihm. Er bemerkte sie im letzten Moment und schleuderte ihnen in dichter Folge die Köpfe des Evergislus, des Bruno und des Heribert entgegen. Nachdem er sie so in die Flucht gejagt hatte, wandte er sich dem großen Christusbild hinter dem Altar zu. 185 "Schön siehst du aus!" höhnte er. "Einen vornehmen Bürger mit Sandalen an den Füßen haben sie aus dir gemacht, die Gotteslästerer." Seine wuchtigen Hiebe rissen die Leinwand wie altes Tuch in Fetzen. "Fangt ihn doch endlich!" forderten die Zuschauer von den Waffenknechten. "Jawohl! Fangt mich!" rief Raimund zurück. "Fangt mich, wenn ihr könnt!" Dann wuchtete er das über einen Meter große, hölzerne Kruzifix vom Altar und hielt es hoch, so dass jeder es sehen konnte. "Passt gut auf, was ich damit gleich mache!" Die Frauen kreischten, die Männer bekreuzigten sich hastig. Eine vornehm gekleidete Bürgerdame fiel in Ohnmacht. Raimund indes genoss die Angst, die man plötzlich vor ihm hatte. "Zittert nur, ihr Jammerlappen!" brüllte er und zerschmetterte das Kruzifix an den Altarstufen. Die Kraft, die er dabei aufbrachte, war in der Tat so gewaltig, als stünden ihm die Dämonen zur Seite. Allerdings versiegte sie ihm nun sehr schnell, und die Waffenknechte, die das merkten, wagten sich ein zweites Mal in seine Nähe. "Ihr könnt mich gar nicht fangen, ihr elenden Büttel", keuchte er. "Ihr habt nur Macht über meine Hülle. Zerstört sie, die Hülle, damit ich frei bin! Nur zu! Schlagt sie in Stücke! Verbrennt sie! Nur der Teufel wird darum trauern. Sein Werk ist es, was ihr zerstört." Mit diesen voller Verachtung hervorgestoßenen Worten warf er ihnen das Schwert vor die Füße und gab sich lächelnd gefangen. 186 19.Kapitel I F ranziska zuckte zusammen, als jemand an die Tür klopfte. Sie kniete gerade vor einem kleinen Kruzifix, das sie auf ihre Truhe gestellt hatte, und betete für die Seelen Ramiras und deren mit ihr zum Scheiterhaufen verurteilten Gefährten. Sie sprach die Gebete vielleicht schon zum hundertsten Mal, war davon bereits ganz wirr im Kopf, wusste nicht einmal, wie spät es war. Weil sie sich dunkel an ihre Aufträge für diesen Nachmittag erinnerte, befürchtete sie, dass Jan sie ermahnen wollte. Wie sollte sie ihm erklären, dass sie an diesem Tage beim besten Willen nicht arbeiten konnte? Zu ihrer Verwunderung aber kam Sieglinde Cranboim herein. "Weiß du, wohin Raimund gegangen ist?" "Nein. Ich habe ihn seit dem Vormittag nicht mehr gesehen. Aber warum sorgt Ihr Euch? Es ist doch noch heller Tag." "Den hellen Tag nennst du das? Die Sonne wird bald untergehen." "Na wennschon! Er ist öfter erst im Dunkeln mit der Laterne heimgekehrt. Ihr wisst doch, dass er manchmal eigene Wege geht." Sieglinde gab sich seufzend zufrieden. Im Weggehen aber sagte sie noch: "Ich habe so eine Vorahnung ..." Franziska zwang sich zu einem aufmunternden Lächeln. In Wahrheit jedoch begann auch sie sich zu sorgen. Wäre Raimund geschäftlich für seinen Vater unterwegs gewesen, hätte seine Mutter es wissen müssen. Wäre er zu den Katharern gegangen, hätte er es ihr gesagt, denn sie gehörte ja nun zur Gemeinde. Fast ängstlich eilte sie hinunter ins Erdgeschoß, wo in einem Wand- schrank auf dem Korridor die Öllampen, Fackeln und Kerzen aufbewahrt wurden. Ihre Befürchtungen bestätigten sich - alles stand und lag an seinem Platz, nichts fehlte. Die Dunkelheit senkte sich herab, und Raimund lief irgendwo durch die Stadt, ohne Laterne. Am späten Abend trafen sich Jan, Franziska und die Cranboimeltern im großen Erdgeschoßkontor beim Schein eines Öllichts. Die Stimmung war gedrückt, selbst bei Wolfhard, dem erfolgreichen Großkaufmann. Lediglich Jan wirkte so ruhig wie immer, und niemand vermochte zu sagen, woran er gerade dachte. Sieglinde sprang bei jedem kleinen Geräusch auf und lief zur Tür. Jedes Mal freilich kam sie umso niedergeschlagener zurück. "Er ist wahrscheinlich überfallen worden." "Möglich wäre es", stimmte Wolfhard ihr zu. "An Gesindel, dem man dergleichen zutrauen muss, mangelt es nicht in der Stadt. Raimund allerdings brauchte sich solcher Gefahr nicht auszusetzen. Warum treibt er sich in üblen Vierteln herum? Warum lässt er sich in unruhiger Zeit nicht von einem Waffenknecht begleiten?" "Hör auf!" flehte Sieglinde. "Das hilft uns doch jetzt nicht weiter. Kann man ihn nicht suchen lassen? Vielleicht ist er verletzt." "Mitten in der Nacht?" "Vielleicht ist er entführt worden", mutmaßte Jan, der bisher geschwiegen hatte. Alle wandten sich ihm zu. "Das wäre immer noch besser, als erschlagen oder erstochen", fügte er hinzu. Wolfhard stand auf und lief wie ein gefangenes Tier von Wand zu Wand auf und ab. Die anderen schwiegen, um ihn nicht zu stören. Offensichtlich berechnete er, wie sich eine Lösegeldforderung auf das Unternehmen auswirken würde. "Dieser Raimund ist ein Unglückssohn", sagte er schließlich ernsthaft verärgert. "Mehr als achtzig Pfund Silber können wir nicht geben, und selbst diese Summe reicht aus, um uns im ungünstigsten Fall zu ruinieren. Das Geld der Cranboims liegt doch nicht wie ein Sandhaufen herum, darauf wartend, dass ihn einmal jemand braucht. Jeder erworbene Denar fließt sofort wieder in ein neues Geschäft ein. Wir haben Verbindlichkeiten." Einen Augenblick lang fürchtete Sieglinde, ihr Mann wolle den Sohn für die Interessen des Unternehmens einfach opfern, dann aber sagte er: "Selbstverständlich würde ich ihn freikaufen. Was zählt Geld gegenüber einem Menschen von unserem Fleisch und Blut?" Das beruhigte sie wenigstens in dieser Hinsicht. Es wurden noch manche Vermutungen ausgesprochen und als unwahrscheinlich wieder verworfen. Noch manches Mal lief Sieglinde hoffnungsvoll zur Tür und kehrte mit gesenktem Kopf zurück. Die berittenen Nachtwächter trabten gemächlich vorüber und unterhielten sich dabei. Ihre tiefen Stimmen erschienen den Wartenden wie Gebrüll. Die Kunibertskirche schlug Mitternacht. Das Ausharren hatte ganz offensichtlich nicht mehr viel Sinn, und Jan war es, der das schließlich aussprach: "Vor Sonnenaufgang können wir nichts über Raimunds Schicksal in Erfahrung bringen und auch nichts für ihn unternehmen. Folglich wäre das Beste, wenn wir uns ins Bett legten und schliefen, damit wir morgen erholt sind." Der Vater stimmte sofort zu. Die Mutter zögerte, ließ sich dann aber überreden. Lediglich Franziska weigerte sich beharrlich, dem Rat zu folgen. Sie blieb allein zurück, während die anderen die knarrende Wendeltreppe hinaufstiegen. Es war ihr durchaus recht, allein zu sein mit ihrem Kummer. Die ganze Nacht lang bis zum Anbruch des neuen Tages kniete sie auf dem harten Steinfußboden und betete. Der stärker werdende Schmerz in ihren Knien verhinderte, dass sie einnickte. Endlos allerdings war diese freiwillige Marter denn doch nicht zu ertragen. Traum und Wirklichkeit gingen immer mehr ineinander über und schließlich erzwang der Leib sein Recht. Sieglinde Cranboim fand sie später, wie sie auf dem Fußboden schlief und dabei Gebetsfetzen murmelte, und bat ihren Mann, sie vorsichtig hinauf auf ihr Zimmer zu bringen. II A ls Franziska wieder aufwachte, war ihr der Kopf schwer und sie brauchte lange, um sich an die Ereignisse des Vortags zu erinnern. Dann aber sprang sie mit einem Satz aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Auf der Uferstraße liefen Leute geschäftig auf und ab. Die Sonne stand hoch am Himmel. "Ramira!" schrie es in ihr. Ihr war, als könnte sie die Freundin noch retten, käme sie nur rechtzeitig zum Hinrichtungsplatz. Sie zog sich so schnell wie nie die Kleider über, rannte grußlos an der fassungslosen Sieglinde Cranboim vorbei und hetzte am Rhein entlang in Richtung Dom. Das Fluchen 188 der Leute, die sie dabei anstieß, hörte sie nicht. Sie hatte einen weiten Weg vor sich. Der Elendsfriedhof für Fremde, Juden und Schwerverbrecher, an dessen Rand man auch die Scheiterhaufen zu errichten pflegte, war am anderen Ende der Stadt jenseits der Mauer an der Straße nach Bonn gelegen. Franziska überquerte den Platz vor Sankt Kunibert, bog in die Trankgasse ein, lief an Sankt Maria ad Gradus vorbei, erreichte hinter dem Dom die Verlängerung des Eigelstein. Im Gewühl der Innenstadt wurde sie zum Verzweifeln oft aufgehalten. Endlich tauchten die Türme der großen Marienkirche auf. Doch an der Brücke über den Duffesbach scheute gerade ein Pferd. Abermals warten! Sankt Georg erinnerte das Mädchen an die Raubzüge mit Stefanus. Hinter jenem Viertel besser gestellter Bürger eine von armen Handwerkern bewohnte Gegend. Auf der Straße spielten Kinder zwischen frei herumlaufenden Schweinen. Ein streunender Hund suchte sich ausgerechnet Franziska als Jagdwild aus, so dass sie stehen bleiben und auf ihn einreden musste. Zum Stadtrand hin führte eine Straße aus der Zeit der Römer, eine schnurgerade Straße, die bis zum Horizont zu reichen schien. Die Häuser wurden seltener und glichen bald den Hütten der Bauern. Kleine Felder wechselten mit umfriedeten Weingärten, die den reichen Stiften und Klöstern des südlichen Kölns gehörten. Die Kirchturmspitze von Sankt Severin aber kündete Franziska schließlich, dass es nicht mehr weit war. Nachdem sie die Severinstorburg ohne Kontrolle passiert hatte, sah sie bereits die Menschenansammlung am Rande des Friedhofs. Gerade kam Bewegung in die Menge. Etliche Leute glaubten wohl, genug gesehen zu haben, und wollten zurück in die Stadt gehen. Andere riefen ihnen etwas zu, um sie zurückzuhalten. Im Gedränge und Geschiebe wurde das Mädchen vor- und zurückgerissen, ohne vom eigentlichen Ort des Geschehens mehr zu erkennen als das Dach der Tribüne, auf der die Inquisitoren und ein paar Vertreter des Erzbischofs und des Rates saßen. "Hat die Hinrichtung schon begonnen?" fragte sie die neben ihr Stehenden. Sie musste mehrmals fragen, bis ihr jemand antwortete. "Wenn du diese Gaukler meinst - die sind längst zu Asche verbrannt. Der Haufen qualmt bloß noch ein bisschen. Du hättest früher aufstehen müssen." Jemand fiel ihm ins Wort: "So etwas ist sowieso nichts für kleine Mädchen." Der erste verteidigte sich: "Ach was! Das kann den Kindern eine Warnung sein." Dann wandte er sich wieder Franziska zu: "Du hast nur die Hälfte verpasst. Die Inquisitoren sind einem Ketzer aus vornehmer Familie auf die Spur gekommen." Das Mädchen taumelte, als wäre sie von einem Faustschlag getroffen worden. Traumwandlerisch kämpfte sie sich nun mit aller Gewalt durch die dichten Reihen der Schaulustigen, bis sie ganz vorn an den rot-weiß gestrichenen Absperrungsbalken stand. Da sah sie ihn. Kaum zehn Meter von ihr entfernt wartete er ruhig, gelangweilt fast, mit schweren Ketten an Armen und Beinen zwischen zwei Waffenknechten, die ihn um Haupteslänge überragten. Wie von Sinnen versuchte sie, unter den Balken hindurch zu kriechen. Sie wusste, dass sie ihm nicht mehr wirklich helfen konnte, aber sie wollte bei ihm sein, ihn noch ein letztes Mal umarmen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch kläglich. Ein Mann, auf dessen Lederwams das Wappen des Erzbischofs glänzte, packte sie 189 wie eine Katze im Genick und stieß sie grob zurück. Durch den Zwischenfall wurde aber Raimund auf sie aufmerksam. Ihre Blicke fanden einander, und sie sahen sich lange in die Augen. Dabei entdeckte Franziska etwas ihr ganz und gar Unbegreifliches. Seine blauen Augen strahlten genau jene Fröhlichkeit aus wie am Tage, als er mit ihr zum ersten Mal zur Weidengasse gegangen war. Auch aus der Entfernung erkannte sie es ganz deutlich. Er stand unmittelbar vor dem für ihn allein bestimmten Scheiterhaufen nur wenige Schritte entfernt von einem anderen, inzwischen zu Asche zerfallenen, einem auf dem gerade andere Verurteilte ihr Leben ausgehaucht hatten, und - lächelte. Sie deutete ihm durch Zeichen an, dass sie für ihn beten und ihm, wenn Gott es ihr gewährte, einen Teil seiner Sünden abnehmen wolle. Er aber schien dessen gar nicht zu bedürfen. Sie hatte jämmerliche Angst, nicht er. Sie war am Verzweifeln, während er längst mutig einer neuen Welt entgegen schritt, einer Welt, deren verschwommene Umrisse er vielleicht schon erkannte. Die Anklageschrift gegen Raimund war lang. Ein Dominikaner trug sie mit ermüdend gleichförmiger Stimme vor, und Franziska hörte kaum zu. Immerhin fand sie erstaunlich, was man alles in einer einzigen Nacht herausgefunden hatte. Dabei war Raimund allem Anschein nach nicht einmal grob verhört worden. Wahrscheinlich hatten es die ehrbaren Geistlichen sehr eilig mit der Hinrichtung, um Wolfhard Cranboim, dessen Einfluss bis in die Umgebung des Erzbischofs hineinreichte, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ein Zeichen sollte gesetzt werden, und diesem Zeichen diente auch die Anklageschrift. Franziska dachte in Raimunds Worten. Sie glaubte geradezu seine Stimme zu hören - scharf, höhnisch und dennoch leichthin. "Dein sündiger Körper wird dem Scheiterhaufen nicht entgehen", wandte sich der Dominikaner, als er das Untersuchungsprotokoll zu Ende verlesen hatte, an den Angeklagten. "Du kannst aber deine unsterbliche Seele retten, indem du dich zu deinen Irrtümern bekennst und Reue zeigst. In diesem Falle würden wir dich zudem gnädig erdrosseln, bevor wir den Stoß entzünden." "Retten werde ich meine Seele, indem ich auf eure Gnade verzichte, denn ihr seid die Gehilfen des Teufels und seid Gott, unserem Herrn, ein Gräuel", antwortete Raimund laut und voller Stolz. "Du würdest anders reden, hättest du vorhin das Winseln der anderen Ketzer gehört." "Oh nein! Nichts hätte ich mir mehr gewünscht, als mit ihnen gemeinsam auf demselben Scheiterhaufen die elende Hülle meiner Seele abzuwerfen. Fragt die Knechte aus dem Gefängnis, wie oft ich sie gebeten, ja angefleht habe, mich endlich hierher zu bringen! Dank des Verbrechens, das ihr an mir begehen wollt und durch das ihr durch Gottes Macht am Ende doch nur Gutes bewirkt, bin ich schon bald mit ihnen vereint." Er warf mit einer fast eleganten Bewegung des Kopfes sein ihm ins Gesicht gefallenes, langes, seidiges Haar in den Nacken und wandte sich an die Schaulustigen hinter den Absperrbalken: "Auf wessen Seite steht ihr? Glaubt ihr wirklich, dass Gottes Gnade auf jenem grausamen und am Ende dennoch jämmerlichen Haufen von Kapuzenträgern ruht? Seht mich an! Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, denn ich weiß, dass er für mich nichts anderes ist, als das Tor zum Himmel. Diese da aber umgeben sich mit Scharen von Waffen- 190 knechten, seit der Teufel ihren Spießgesellen Maginulfus geholt hat." Raimund predigte wie jemand, der ganz und gar von einer heiligen Mission erfüllt ist, und dem die Worte in der Erleuchtung ohne eigene Willensanstrengung über die Lippen kommen. Seine Bewacher ließen ihn gewähren, weil sie viel zu überrascht waren, um ihn zu hindern. "Da sie nun zogen gegen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: 'Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen!' und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk und sprachen: 'Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis in den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.' Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: 'Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasset uns hernieder fahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe!' Also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. ... So steht es in der heiligen Schrift, doch ihr wisst nicht, dass ihr gemeint seid, ihr und eure Stadt. Ihr lebt im Wohlstand, doch ihr lebt nur noch für euch allein. Die Angst, dass jemand euch euren Besitz entreißt, entzweit euch mit euren Brüdern, mit Gott und mit euch selbst. Ihr irrt umher auf der Suche nach Wärme und Geborgenheit, doch in diesen Mauern werdet ihr nichts davon finden. Ihr habt Christus zum Tor hinausgejagt, weil er euch mit seinen Fragen und Ermahnungen lästig geworden ist. Ohne ihn aber bricht die Kälte herein, wie wenn die Sonne nicht mehr scheint. Köln ist dem Untergang geweiht, doch in anderer Weise als die Schwärmer es euch prophezeiten. Es wird kein Feuer vom Himmel fallen, und euren Leibern wird nichts geschehen. Die Kirchtürme werden stolz zum Himmel ragen wie eh und je, und ihr werdet zwischen ihnen umherlaufen. Erfroren ist nur eure Seele. Ihr werdet sprechen, aber nichts sagen. Ihr werdet euch umarmen, aber nichts als die Lust eines Tieres dabei spüren. Ihr werdet immer mehr Reichtum zusammenraffen und dennoch niemals Befriedigung und Ruhe finden. Ihr werdet Geister in einer Geisterwelt sein und es nicht einmal mehr bemerken. Euer Bemühen ist sinnlos, weil es einem falschen, verworfenen Ziele dient." "Bringt ihn doch endlich zum Schweigen!" forderte einer der Dominikaner von der Tribüne und erinnerte die Waffenknechte damit an ihre Pflichten. Raimund wurde gepackt und hastig zum Scheiterhaufen geschleppt. Widerstand leistete er nicht. Offenbar war seine Predigt das letzte, was er im Leben noch hatte bewerkstelligen wollen. Nun sehnte er sich nur noch nach dem Tode. Als der Henker ihn, der Vorschrift entsprechend, ein letztes Mal fragte, ob er bereuen und in den Schoß der päpstlichen Kirche zurückkehren wolle, antwortete er nicht. Obwohl an vier Stellen gleichzeitig entzündet, brannte des aufgeschüttete Holz zunächst sehr schlecht. Statt lodernder Flammen entwickelten sich nur tiefschwarze Russschwaden. Der an einen dicken Pfahl gebundene Raimund wurde von ihnen völlig eingehüllt. Nur ab und zu, wenn eine Bö über den Platz blies, konnte Franziska noch seinen Kopf erkennen. Dennoch gab es keinen Zweifel, dass er den Tod noch immer nicht fürchtete. Gierig atmete er den giftigen Rauch ein und wurde in kurzer 191 Zeit sichtlich benommen davon. Nach einem letzten Kampf entspannte sich sein Gesicht plötzlich, und spiegelte nun eine an die steinernen Heiligenfiguren in den Kirchen erinnernde Verklärung wieder. Dann sank ihm das Kinn auf die Brust. Als das Feuer endlich zu prasseln anfing, war er längst tot. III D as Schauspiel ging zu Ende, die Menge zerstreute sich. Einige der Leute blickten betroffen zu Boden - sei es, weil der hübsche, blonde Jüngling ihnen im Nachhinein leid tat, sei es, weil sie an die eigene Vergänglichkeit dachten - die meisten jedoch lachten und unterhielten sich angeregt. Franziska wurde vom Strom mitgerissen und ließ sich willenlos treiben. Die Erlebnisse auf dem Hinrichtungsplatz, vor allem Raimunds letzten Worte nahmen sie so in Anspruch, dass sie ihre Umgebung völlig vergaß, nicht einmal auf drohende Gefahren achtete. "Euer Bemühen ist sinnlos, weil es einem falschen, verworfenen Ziel dient." Wie oft hatte sie sich gegen solche und ähnliche Reden von ihm aufgebäumt und eine glückliche Zukunft an seiner Seite heraufbeschworen - in Köln, in Wardenburg oder in Montségur! Jetzt waren ihre Hoffnungen dahin, verbrannt mit ihm auf dem Scheiterhaufen. Sie fühlte sich heimatlos wie nach der Flucht aus der Burg des Grafen von Wildeshausen. Zu den Cranboims wollte sie auf keinen Fall zurückkehren. Die Geschäftigkeit des stets erfolgreichen Wolfhard und seines ihm kaum noch nachstehenden Sohnes Jan hätte sie nicht ertragen, erst recht nicht das oberflächliche Gerede der Mädchen Katharina und Dorothea. "Ob sie es schon wissen?" fragte sie sich und versuchte, sich jeden einzelnen bei der Mitteilung vorzustellen. Wolfhard heuchelt Trauer und ist in Wahr- heit nur in Sorge um das Ansehen der Familie und des Unternehmens. Jans Gesicht bleibt undurchdringlich, und es kann sein, dass er tatsächlich nichts fühlt. Die empfindsame Dorothea weint zunächst jämmerlich, lässt sich dann aber von den albernen Bemerkungen ihrer Schwester, der die schlechte Stimmung im Hause zuwider ist, schnell beeinflussen. Nur Sieglinde trauert wirklich, doch sie ist allein, so allein wie Raimund am Pfahl es war. Auch Stefanus wollte Franziska nicht sehen. "Er hat es so gewollt und ist auf seine Art glücklich geworden", hörte sie ihn sagen und wusste ihn im Recht. Im Grunde hatte der Räuber mit jeder seiner zynischen Reden Recht behalten, und seine Weltverachtung unterschied sich vielleicht gar nicht so sehr von der ihres Raimunds. Gerade darum aber konnte sie nicht zur Rheingasse gehen. Während sie Bilanz zog und dabei immer mehr von der Sinnlosigkeit des Lebens überzeugt war, lief sie, ohne es zu merken, die Römerstraße entlang zurück zum Dom und von dort aus weiter bis zur Weidengasse, bis sie sich vor dem Kommunehaus der Katharer wieder fand und von Ursula aus ihrer Lethargie herausgerissen wurde. "Was willst du?" "Wisst ihr, dass Raimund heute Morgen verbrannt worden ist?" "Ja." "Wo soll ich jetzt hingehen? Was soll ich jetzt anfangen ohne ihn? Ich ... ich möchte bei euch bleiben." 192 "Wir müssen dich erst prüfen, bevor wir dich aufnehmen können." Obwohl Franziska schon ihre Erfahrungen mit Ursula gesammelt hatte, war sie fassungslos angesichts der Kälte, die ihr entgegenschlug. Sie brachte kein Wort über die Lippen - während sie einerseits vor Verzweiflung fast wie ein Kind in Tränen ausgebrochen oder wie eine Bettlerin auf die Knie gefallen wäre und andererseits (an Raimunds Stolz selbst angesichts des nahen Todes denkend) davongehen und ihren Kummer tapfer allein tragen wollte. Noch ehe sie jedoch Ordnung in ihre Gefühle bringen konnte, tauchte Viktor auf und trat entschlossen auf Ursula zu. "Du wirst sie nicht abweisen!" "Doch, das werde ich, und du kennst den Grund. Wir achten bei uns nicht auf die Herkunft, nicht auf besondere Fertigkeiten, schon gar nicht auf das Aussehen, wohl aber auf den Lebenswandel. Hier ist kein Platz für eine Dirne!" "So hast du also vergessen, was unser Herr Jesus Christus sagte, als die Leute eine Ehebrecherin nach Recht und Gesetz steinigen wollten! Bist du so vermessen, dass du dich für fehlerfrei hältst?" Ursula wurde unsicher, und Viktor brachte sie schließlich ganz aus der Fassung, als er hinzufügte: "Du weißt, was du versprochen hast. Vielleicht ist Franziska die Probe, auf die der Herr dich stellt." "Ja, ich darf nicht streng richten über andere, auf dass nicht der Herr streng richtet über mich", murmelte sie. Dann gab sie Franziska ein Zeichen, ihr zu folgen. In der Werkstatt arbeitete jetzt am Sonntag niemand. Das Karree der Bänke, die kleinen Ablagetische, die Stapel der Lederhäute und der fertigen Beutel und Taschen entlang der Wände, das alles schien in tiefem Schlaf zu lie- gen und sich von den Mühen der zurückliegenden Woche auszuruhen. "Die anderen sind in die Kirche gegangen. Wir dürfen hier in Köln nicht auffallen. Nutzen wir die Zeit, um einen Schlafplatz für dich herzurichten!" "Ich darf also ab jetzt bei den anderen schlafen?" fragte Franziska (noch etwas ungläubig) zurück. "Gewiss! Möchtest du das nicht?" "Nichts wünsche ich mir mehr als das. Ich bin dir so dankbar!" "Dazu hast du keinen Grund." "Du bist die Meisterin. Nur mit deiner Erlaubnis kann ich hier bleiben." "Nein, ich bin keine Meisterin. Ich verteile und leite die Arbeit, habe deshalb aber nicht mehr Rechte als die anderen. Bei uns sind alle dem Rang nach gleich, auch die Perfecti, die sich von uns Credentes nur dadurch unterscheiden, dass sie die reine Lehre bewahren und weitergeben, und dass sie sich darum zu einem besonders vorbildlichen Lebenswandel verpflichtet haben." Nachdem der Platz für die Nacht im Schlafsaal des Kommunehauses hergerichtet war, kehrte Franziska zu Viktor zurück. Der hatte die ganze Zeit über geduldig vor der Tür gewartet. "Ursula ist wirklich nicht so bösartig, wie du glaubst", versicherte er ihr. "Für viele ihrer Eigenschaften bewundere ich sie sogar, für ihren Mut zum Beispiel." "Ach, wenn ich euch jetzt nicht hätte!" "Hoffentlich bereust du deinen Entschluss nicht schon bald! Die Inquisitoren sind so rührig wie lange nicht mehr, und es kann sein, dass wir bald fliehen müssen." "Du glaubst doch nicht, dass Raimund euch verraten hat?" "Nein, bestimmt nicht. Diese Stadt aber ist voller Augen und Ohren. Heute Abend wissen wir mehr." "Heute Abend?" 193 "Du weißt noch nichts von unserer Versammlung? Der Perfectus aus Frankreich wird ein letztes Mal für uns predigen. Bei dieser Gelegenheit können wir dich in unsere Gemeinde aufnehmen. Übrigens wird auch Pierre da sein. Du erinnerst dich an den Ritter aus Montségur?" Franziska nickte. "Du musst ihn sehr beeindruckt haben." "Ich weiß." IV B is zum Abend half Franziska bei der Arbeit, dann folgte sie den anderen in den Versammlungskeller. Wenig später traf auch der Perfectus in Begleitung Pierres dort ein. Der Ritter ließ sich nicht nehmen, dem Mädchen zuzuzwinkern. Um sie anzureden, blieb ihm aber keine Zeit, denn der Gottesdienst begann sofort. Franziska erwartete eine heidnische Feier mit geheimnisvollen Riten sowie allerlei Zauberei und war erstaunt, dass die Katharer den Christus so einfach und unmittelbar anbeteten wie Jesu erste Anhänger zur Zeit der Apostel. Die Gemeinde kniete nieder, verneigte sich dreimal bis zur Erde und sagte gemeinsam, zum Perfectus und seinem Begleiter gewandt: "Gute Christen, gebt uns den Segen Gottes und Euren Segen und betet für uns!" Der weißhaarige Mann antwortete mit tiefer Stimme: "Nehmet ihn von Gott und von uns! Gott möge euch zu einem guten Ende führen und Gute Christen aus euch machen!" Indem sie sich selbst die Guten Christen nannten, grenzten sich die Katharer ab gegen die Kirche des Papstes, in der das Evangelium im Sumpf aus Heuchelei, Besitzstreben und Grausamkeit versank. Nachdem alle zusammen das Vaterunser gebetet hatten, segneten der Perfectus und sein Begleiter ein in ein weißes Tuch gehülltes Brot. Der Segen durch nur einen einzelnen Perfectus wäre ungültig gewesen, weshalb die Priester der Katharer niemals allein reisten. Von dem Brot bekam schließlich jeder, der zur Gemeinde gehörte, ein kleines Stück, das er aß, um dadurch Anteil an der Gnade Gottes zu haben auch Franziska, die von nun an als Anhängerin galt. Eine besondere Zeremonie für die Aufnahme der Credentes gab es nicht. Nach der Mahlzeit stand der Perfectus auf und ergriff noch einmal das Wort. Das gehörte nicht mehr zum Abendmahl, doch war dem Alten nicht entgangen, dass sich die Blicke fast aller Versammelten immer wieder erwartungsvoll auf ihn richteten. "Ihr fürchtet euch und erwartet, dass ich euch Trost spende", sagte er und blickte mit seinen großen, dunklen Augen einen nach dem anderen in der Runde an. "Ihr sollt den ersehnten Trost erhalten. Zuvor aber muss ich euch sagen, dass euch die Dominikaner auf die Spur gekommen sind." Niemanden konnte das überraschen, und dennoch breitete sich Bestürzung aus. Es wurde so still im Keller, dass man das Atmen des Nachbarn hörte. Selbst Franziska, die wenige Stunden zuvor keinerlei Sinn mehr in ihrem Leben gesehen hatte, packte jäh die Angst. Sie versuchte, sich abzulenken, indem sie den Perfectus beobachtete. Diesmal wirkte er auf sie nicht mehr unheimlich. Das lange, schneeweiße Haar erschreckte sie ebenso wenig wie die ungewöhnlich magere Gestalt. Warum sah 194 sie ihn an diesem Abend mit anderen Augen? Warum vertraute sie ihm plötzlich? Verdiente er dieses Vertrauen? Übrigens sprach er fast wie ein echter Kölner. Gewiss hatte er einige Jahre seines langen Lebens in der Stadt verbracht, vielleicht sogar seine Kindheit. Nach einer Pause, die allen geradezu unendlich erschien, fuhr er fort: "Der Herr sprach zu seinen Jüngern: 'Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Tempeln. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.' Ich verstehe eure Angst sehr gut aus eigenem Erleben. Wir wissen, dass unser Leib nur ein Gefängnis unserer Seele ist, und hängen dennoch so sehr an ihm. Glaubt mir aber: So steinig der Weg, der vor euch liegt, auch immer sein mag, ihr werdet ihn nicht vergebens gehen, denn es steht geschrieben: 'Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können, fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle!'" Dann bedankte er sich für die Gastfreundschaft und schickte sich zum Gehen an. Plötzlich aber blieb er noch einmal stehen und zwar vor Franziska. "Du hast beim vorigen Abendmahl gefehlt. Warum?" "Ich bin heute erst der Kommune beigetreten." Der Perfectus sah die Ritterstochter aufmerksam an und sagte dann bedächtig: "Dir ist ein Unglück zugestoßen? Hast du einen geliebten Mensch verloren?" "Ja ... woher wisst Ihr ... ?" "Es steht dir im Gesicht geschrieben. Du solltest nichts nur aus Verzweiflung tun, mein Kind." "Sie ist nicht nur aus Verzweiflung bei uns. Sie hat schon früher einmal im Kommunehaus gewohnt", versuchte Viktor, sie zu verteidigen. Der Perfectus indes, keineswegs überzeugt, antwortete ausweichend: "Gottes Ratschlüsse sind unerforschlich, selbst für mich." Dann brach er endgültig auf. "Er muss sich beeilen, denn er darf auf keinen Fall der Inquisition in die Hände fallen", flüsterte Viktor. "Wenn die Mönche ihn fangen, werden sie nichts unversucht lassen, um ihn zum Abschwören zu bringen. Dann nämlich würden alle jemals durch ihn erteilten Segnungen nichtig sein, auch Raimunds Consolamentum." Draußen wartete Pierre. Als die Tür geöffnet wurde, stürzte er auf Franziska zu und zog sie am Arm in einen Winkel, wo er aufgeregt auf sie einredete. Dass sie ihn nicht verstand, brachte ihn fast zur Verzweiflung. Am Ende wiederholte er mehrmals in beschwörendem Tonfall die Worte danger und Montségur. Ihr wurde klar, dass er mehr wusste, als der Perfectus der Gemeinde gesagt hatte. Er wollte ihr das Leben retten, und sie brauchte dabei nicht mehr zu tun, als sich mit einem Nicken einverstanden zu erklären und ihm zu folgen. Das aber empfand sie als Verrat an Viktor, der sie (wenn auch auf seine Weise) so sehr mochte, an Raimund, an Ramira ... Sie wollte nicht sterben, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Dennoch brachte sie es nicht über sich, mit dem Ritter zu fliehen. Jemand rief immer ungeduldiger nach ihm. 195 "Suivez-moi! Suivez-moi!" beschwor er sie. Sie schlug die Hände vors Gesicht. "Pierre!" Sie presste die Hände noch fester gegen die Augen, wollte nichts sehen, wollte nicht in Versuchung gebracht werden. Nun rief niemand mehr. Sie ließ die Hände sinken. Er war fort. 196 20.Kapitel I H ilfst du mir, hier noch ein wenig aufzuräumen?" fragte Viktor, und Franziska ließ sich nicht lange bitten, während die anderen bereits hinüber zu den Kommunehäusern oder nach Hause gingen. Als beide allein waren, sagte das Mädchen: "Viktor, heute Nachmittag hast du mir erzählt, dass ihr ... dass wir vielleicht bald fliehen müssen. Gibt es einen Plan dafür?" "Einen Plan?" Er sah sie erstaunt an. "Wenn es für uns in Köln zu gefährlich wird, gehen wir zum Tor hinaus und suchen uns anderswo eine neue Heimat." "Aber Viktor! Wenn die Inquisition erfährt, dass wir Ketzer sind, lassen uns die Torwächter nicht mehr aus der Stadt heraus. Wir werden auch so leicht keine neue Heimat finden, weil der Erzbischof über ein großes Gebiet herrscht und viele mächtige Freunde hat." Viktor, der gerade zwei Krüge in den Schrank zurückstellen wollte, hielt inne, setzte sich an den Tisch und legte, in Gedanken versunken, das Kinn auf seine Fäuste. "Wir haben nie darüber gesprochen, weil wir nicht an eine wirkliche Gefahr glauben wollten." "Bei euren Zusammenkünften war doch immer der Tod mitten unter euch!" Er warf ihr einen fast flehentlichen Blick zu. Sie setzte sich ihm gegenüber und seufzte. "Jetzt jedenfalls sind wir ganz gewiss in Gefahr." "Ist das nicht eigenartig: Leute, die uns überhaupt nicht kennen, wollen uns umbringen, nur weil wir Gott auf eine etwas andere Art verehren als sie. Was treibt diese Canes zu so viel Grausam- keit? Warum freuen sich die Leute, wenn ein Mensch verbrannt wird?" "Raimund meinte, dass den Menschen die Seele erfriert, und dass sie deshalb nur noch auf ihren vom Teufel erschaffenen Leib hören." "Ich war immer ein Schwächling. Als Kind bekam ich von jüngeren Spielkameraden Prügel. Mein Vater wollte mir beibringen, mich zu wehren, aber leider ..." Das Geräusch schneller Schritte kam von der Straße her. Wenig später erschien Cordula, kreideweiß im Gesicht. "Was ist geschehen?" fragten Franziska und Viktor zugleich. "Sie sind in unserem Haus!" würgte die junge Frau hervor. "Wer ist in unserem Haus?" "Vor der Tür stehen zwei Bewaffnete mit Laternen. Und in der Werkstatt ist Licht." Franziska erfasste die Bedeutung der Nachricht zunächst nicht, denn sie achtete nur auf Cordula, die vor Angst nicht aus noch ein wusste, und die sie zu trösten versuchte. Währenddessen kehrten nach und nach auch die anderen zurück. Es gab keinen Zweifel, dass die Inquisition spätestens am nächsten Morgen zuschlagen würde. "Lasst uns Laternen, Fackeln und Kerzen suchen und von hier verschwinden, ehe sie uns entdecken!" rief jemand. "Wir klettern über die Mauer", ergänzte ein anderer. "Ich kenne rechts neben dem Eigelsteintor eine Stelle ..." "Man würde uns sehen und den Weg abschneiden." Ursula hatte das gesagt, und alle Blicke richteten sich auf sie. Am Anfang waren es wütende Blicke, denn der Satz tötete die letzte Hoffnung, noch zu entkommen. Später änderte sich das, denn obwohl die junge Frau dem Unvermeidlichen wie niemand sonst aus der Gemeinde ins Auge sah, fürchtete sie offensichtlich nichts. Ihr Gesicht verlor sogar die Strenge, die es oft zu einer Maske hatte erstarren lassen. Ruhig und beherzt war sie entschlossen, die Führung zu übernehmen, und gab den anderen damit wieder Halt. Selbst Franziska verzieh ihr jetzt in Gedanken. Vielleicht hatte Gott sie für eben diese Rolle von Anfang an vorgesehen. "Was sollen wir sonst tun?" fragte Viktor nach einiger Zeit zaghaft. "Habt ihr die Worte des Perfectus nur mit den Ohren gehört und nicht mit dem Herzen? Er wusste, was uns bevorsteht, und wollte unseren Mut stärken. Erinnert ihr euch nicht mehr an das, was unser Herr Jesus Christus zu dem Übeltäter am Kreuz sprach? 'Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.' Auch wir sind Übeltäter, aber wir werden Gottes Gnade erlangen, weil wir ohne Hunger nach Macht und Ansehen und ohne Gier nach Reichtum an ihn glauben. Ihr werdet den Tod nur als einen kurzen, schmerzlichen Moment erleben und dann glücklich sein für alle Ewigkeit. Ihr werdet durch einen langen, schwarzen Gang fliegen und dann eintauchen in ein Licht, wie ihr es nie zuvor gesehen habt, mild und dennoch alles überstrahlend." Sie sprach so überzeugend, dass nach und nach jeder in der Runde seine Angst verlor. Franziska, die sich an Raimunds glücklichen Tod erinnerte, war einer der ersten, der ihr glaubte. Sie saß ein wenig abseits. Cordula hatte sich zu Viktor geflüchtet und der nahm sie (ungeachtet seiner anders gearteten Neigungen) in dieser Nacht zärtlich in den Arm. Franziska fragte sich, ob es vielleicht immer die Schwächlinge sind, die in wirklicher Gefahr den meisten Mut beweisen. Dann glitten ihre Gedanken ab. Sie besann sich ihrer Kindheit in Wardenburg und ihrer Erziehung am Hof zu Wildeshausen. Wie bei einem Schauspiel sah sie ihr Leben noch einmal vor sich, und begriff nicht, warum sie so oft selbstsüchtig gewesen war, so oft gelogen, geheuchelt, gestohlen hatte! Da stimmte Ursula ein Lied an. Das Singen befreite nicht nur Franziska sondern auch die anderen. Während sie sangen, fühlten sie Gottes Nähe, und so sangen sie die ganze Nacht hindurch auch noch, als Waffenknechte das Haus umstellten. Wäre es nicht um Leben und Tod gegangen, hätte man dem nun Folgenden eine gewisse Lächerlichkeit nicht absprechen können. Da des Erzbischofs Leute auf einen gefährlichen Feind eingestimmt waren, stürmten sie den Keller wie eine Burg. Die nur angelehnte Tür zersplitterte unter mächtigen Axthieben. Sinnlos zischten Pfeile durch den Raum. Ein Speer bohrte sich, lange nachzitternd, in die große Truhe. Die Luft vibrierte vom Gebrüll der Kommandos. Die Katharer unterbrachen jäh ihren Gesang. Vor Angst gelähmt, blieben sie, während um sie herum Getümmel wie bei einem Scharmützel herrschte, wie Unbeteiligte auf ihren Stühlen sitzen. Allmählich aber erinnerten sie sich, dass sie angesichts der nahen Märtyrerkrone eigentlich Grund zur Freude hatten. Zugleich wurde ihnen bewusst, wie sehr man sie letztlich ehrte mit diesem Aufgebot an Häschern. Ursula brachte den Mut auf, dem Hauptmann mit einem Lächeln entgegenzutreten und zu sagen: "Ich ergebe mich Euren Waffen, tapferer Rittersmann." Diese Ironie überraschte den Offizier des Kirchenfürsten so sehr, dass er keine passende Antwort fand und den Spott der eigenen Leute einstecken musste. 198 "Packt sie und bringt sie raus auf die Straße!" brüllte er, außer sich vor Zorn. Um jeden der Gefangenen kümmerten sich zwei oder drei Bewaffnete, und es war für alle nicht leicht, wenigstens den Anschein persönlicher Unentbehrlichkeit zu wahren. Franziska hatte einen Moment lang daran gedacht, sich mit ihrem Schwert zu verteidigen, um wie ein Mann im Kampf zu sterben. Sie tastete schon mit der Hand nach dem Griff unter ihrem Mantel, da fielen ihr Viktors Worte über die Gleichheit aller in der Gemeinde ein. Sie wollte sich nicht von den anderen abheben, und so ließ sie sich widerstandslos wie sie gefangen nehmen. Die Männer, denen sie sich ergab, bemerkten die Waffe nicht einmal. Draußen warteten einige Dominikaner, unter ihnen Theobaldus, auf den Ausgang des Unternehmens. In ihren strahlend weißen Kutten fielen sie am meisten auf in der Menge, die sich inzwischen eingefunden hatte. Etwas abseits standen zwei Leiterwagen, auf denen man die Ketzer zur Kunibertstorburg fahren wollte. Franziska kletterte freiwillig auf den ersten der beiden zu Viktor und Cordula hinauf. Einer der Waffenknechte jedoch zerrte sie am Arm wieder herunter. "Ist es nicht gleich, ob ich auf diesem Wagen fahre oder auf dem anderen?" wehrte sie sich. "Ihr könnt noch genug Willkür mit uns treiben." "Komm mit!" befahl der Mann ungerührt. "Ist sie das?" fragte er dann einen Benediktiner, zu dem er sie brachte. Der Mönch nickte und führte sie nun seinerseits ab. Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen, weil er die Kapuze seiner Kutte tief nach unten gezogen hatte. "Warum lasst Ihr mich nicht bei meinen Freunden? Was habt Ihr mit mir vor?" Sie fand keine andere Erklärung für die Sonderbehandlung als die, dass die Inquisition (woher auch immer) bereits wusste, wer sie war. Musste sie nun als Ritterstochter mit einer härteren oder milderen Strafe rechnen? Hatte sich Wolfhard Cranboim für sie eingesetzt? Während der Benediktiner sie durch die verwunderte Menge hindurch zum Eigelstein und von dort weiter in Richtung Dom führte, hielt sie so gut wie alles für möglich. Vor allem sein beharrliches Schweigen verunsicherte sie. Seine große, kräftige Hand umspannte ihren rechten Arm wie ein Eisenring und verbot ihr von vornherein jeden Gedanken an eine Flucht. Von einem Gefängnis in der Nähe des Doms hatte sie noch nie etwas gehört. Sie wusste zwar, dass man adlige Gefangene oft statt im Kerker in einem beliebigen, gut verschließbaren Raum verwahrte, trotzdem beschlich sie zunehmend das Gefühl, dass etwas nicht Vorgesehenes geschah. Wenig später ging ihr die Wahrheit wie ein Licht auf. "Nein! Ich will Eure Hilfe nicht!" schrie sie, und wollte auf der von Menschen überfüllten Straße für jedermann hörbar hinzufügen, dass sie eine überführte Ketzerin sei. Dazu fand sie aber keine Gelegenheit mehr, denn ein Fausthieb traf sie so hart am Kinn, dass sie sofort in Ohnmacht fiel. Stefanus hatte derart schnell und unauffällig zugeschlagen, dass die Leute ringsum sie für krank hielten. Einige boten ihm sogar ihre Hilfe an. Er lehnte höflich ab und trug das Mädchen auf seinen Armen fort. 199 II F ranziska erwachte im vorderen der drei eingerichteten unterirdischen Räume. Auf welchem Wege Stefanus sie hierher gebracht hatte, wusste sie nicht. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass er in Verkleidung mit ihr auf den Armen einfach über die Rheingasse in sein Haus hineingegangen war. Letztlich war ihr das in diesem Moment aber auch gleichgültig, denn sie dachte an ihre neuen Freunde aus der Katharergemeinde. "Warum habt Ihr das getan?" schrie sie. "Warum bestimmt Ihr über mein Leben? Ihr seid nicht mein Vater und schon gar nicht der Herrgott." Ohne auf ihr Aufbegehren einzugehen, nahm der Räuber einen Schluck Wasser aus einem irdenen Krug und trocknete sich bedächtig seinen Bart ab. Dann erst antwortete er: "Wenn jemand einen anderen vor dem Ertrinkenden rettet, bestimmt er damit urechter Weise über sein Leben?" "Ihr habt nur mich gerettet. Warum nicht auch die anderen?" "Weil nur du wirklich gerettet werden wolltest." "Das ist nicht wahr!" Ganz blass vor Wut stürzte sie auf ihn zu und hätte ihn wohl geschlagen, wäre sie sich dabei nicht plötzlich lächerlich vorgekommen. "Ich bin keine Verräterin. Ihr habt mich gezwungen, Euch hierher zu folgen." "Und dein Schwert? Warum wolltest du dich davon nicht trennen? Du hättest damit auch gekämpft wie damals an der Weidengasse, wusstest aber, dass das dein sicherer Tod gewesen wäre. Natürlich hast du dir hehre Absichten eingeredet. Aber tief in dir ..." Ruhiger, aber dafür umso verbitterter entgegnete sie: "Für Euch gibt es nichts Heiliges. In Eurer Gegenwart wird alles schmutzig und widerwärtig. Und doch habt Ihr Unrecht. Ich wollte wirklich als Märtyrerin sterben, und dass ich mich vor dem Tode fürchte, bedeutet nicht, dass ich gern weiterleben mag." "Du denkst an Raimund. Richtig?" lenkte er ein und beobachtete sie aufmerksam. Sie nickte. "Mit ihm wäre alles gut geworden. Ich bin so wild und vorlaut, dass ich mich nicht leicht einem Manne unterordnen kann, wie Apostel Paulus das von den Frauen in Jesu Namen fordert. Bei Raimund hätte ich es gekonnt, denn er wollte mich nicht einsperren." "Du träumst! Glaubst du, dass dein Raimund nach der Hochzeit plötzlich im Hause Cranboim zu bestimmen gehabt hätte? Wolfhard gilt als gütiger Ehemann und Vater, bleibt immer freundlich, wird niemals grob. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. In Wahrheit duldet er bei wichtigen Entscheidungen keinen Widerspruch und verlangt Wahrung des Familienansehens. Der Drang nach Freiheit wäre dir bald ausgetrieben worden. Da sogar ich das weiß, musst du es erst recht wissen, denn du hast lange genug dort gewohnt." Franziska spielte verstört mit einem Zipfel ihres Kleides. "Dann war vielleicht der elegante, französische Ritter für mich bestimmt. Der hätte mich mit Rosen überschüttet." "Woher soll ich wissen, was über dich im Buch der Schicksale geschrieben steht? Vielleicht wirst du allein bleiben so wie ich. Nur eines kann ich dir mit Gewissheit sagen: Ob Raimund am Leben geblieben wäre oder nicht du hättest ihn nie und nimmer bekommen." 200 Nach einer längeren Pause fügte er nachdenklich hinzu: "Du darfst dein Leben nicht vergeuden. Lass dir von den Menschen nicht wegnehmen, was Gott dir geschenkt hat! Aus mir ist nur ein gewöhnlicher Räuber geworden ..." Dann lenkte er unvermittelt auf ein anderes Thema: "Es sieht danach aus, als ob das Leben in Köln wieder in die gewohnten Bahnen zurückkehrt wie die Fluten des Rheins nach einem Hochwasser. Der Erzbischof, der Rat und die Dominikaner sind sich so einig wie nie zuvor, die Organisation der Canes wurde still und heimlich aufgelöst, und als die Alleinschuldigen an den Unruhen hat man, wie jetzt jeder auf den Straßen und Plätzen hören kann, die Ketzer ermittelt. Es ist beschlossene Sache, die leidigen Geschichten zu vergessen, und so wird wohl auch in den Chroniken nicht viel davon die Rede sein." "Ja, die braven Bürger werden alles vergessen. Trotzdem sind unschuldige Menschen vor ihren Augen erschlagen worden. Manche Menschen werden von niemandem beschützt, nicht einmal von Gott." "Du versündigst dich!" "Ich meine das ernst." "Ich auch. Gott, dem du gerade Vorhaltungen machst, hat ein Wunder geschehen lassen. Geh nach nebenan!" Klopfenden Herzens folgte Franziska der Aufforderung - zaghaft, weil sie nicht glauben konnte, was sie sich wünschte, und sich vor der Enttäuschung fürchtete, zugleich aber magisch angezogen von dem Lichtschein hinter der Tür, der ihr jetzt erst auffiel. Als sie Ramiras roten Haarschopf entdeckte und zudem feststellte, dass es der Freundin gut ging, kannte ihr Freude keine Grenzen mehr. Sie umarmte sie ungestüm und küsste sie immer wieder, bis ihre Schwester sie am Arm zupfte und vorwurfsvoll sagte: "Darüber, dass ich noch lebe, freust du dich wohl nicht?" Franziska schämte sich, wandte sich ihr sofort zu und umarmte auch sie. "Verzeih mir! Um dich hatte ich nicht so sehr viel Angst. Für dich wollte sich Wolfhard Cranboim einsetzen, und der kennt viele einflussreiche Leute in der Stadt." "Er konnte doch nicht einmal seinen eigenen Sohn beschützen!" rief Ramira dazwischen und brach sofort in Tränen aus. Die Verstörtheit der Freundin verwirrte Franziska. Sie beugte sich zu ihr herab, legte den Arm um ihre Schultern und fragte, noch völlig ahnungslos: "Was hast du?" Ramira fiel auf die Knie und weinte noch heftiger als zuvor. "Ich verdiene nicht, dass du mich tröstest. Wenn du alles weißt, wirst du mich hassen. Ich bin schuld an seinem Tod. Ich hab ihn umgebracht." Sie war hilflos wie ein kleines Kind. Franziska empfand Mitleid mit ihr, wusste aber nichts anzufangen mit dem, was sie sagte, und fürchtete für einen Moment, sie hätte den Verstand verloren. "Was ist geschehen?" Ramira ließ sich durch nichts dazu bewegen, wieder aufzustehen, griff aber nach den Händen der Freundin und drückte sie an ihre tränennassen Wangen. "Ich wollt einfach nur ein wenig glücklich sein, für einen kleinen Moment nur. Verstehst du? Es war wie damals mit deinem Bruder. Warum werden immer die anderen für meine Sünden bestraft?" Allmählich kam Franziska eine Ahnung. "Hast du Raimund ... geliebt?" Ramira nickte. 201 "Und er? Hat er dich auch geliebt? ... Ich meine: Wollte er dich als ... Frau?" Ramira nickte abermals. Wenige Tage zuvor wäre Franziska von einer solchen Eröffnung tief gekränkt gewesen, nun aber empfand sie sonderbarer Weise wie ein Außenstehender, der aus reiner Wissbegier einen Zusammenhang ergründen will. "Also hat er bei mir seinen Katharerglauben nur als Ausrede gebraucht. Jetzt verstehe ich, was Stefanus mir vorhin sagen wollte. Raimund war wirklich nicht für mich bestimmt." "Du verzeihst mir, dass ich deinen Verlobten verführt hab?" "Er war nicht mein Verlobter und er hat sich aus freiem Willen für dich entschieden." Ramira weigerte sich trotzdem aufzustehen. "Du weißt noch immer nicht alles. Raimund hat sich der Inquisition selbst ausgeliefert." "Er wäre ihr doch in jedem Fall ins Netz gegangen. Sie wusste längst alles über die Gemeinde." "Er wäre ihr nicht ins Netz gegangen, sondern gemeinsam mit mir geflohen. Wir hatten uns verabredet." "Er wollte Gaukler werde? Raimund Cranboim?" "Ja. Ich konnte es ihm nicht ausreden. Keiner konnte das." Franziska starrte betroffen die gegenüberliegende Wand an. "Er war so glücklich auf dem Hinrichtungsplatz, und dabei hatte er sich geirrt! Aber vielleicht findet er es jetzt sogar besser so. Er kann im Himmel ein gutes Wort für dich einlegen, und du bist noch am Leben." "Glaubst du denn, dass er im Himmel ist?" "Ganz bestimmt ist er dort." Ramira wurde etwas ruhiger. Franziska zog sie zu sich herauf und drückte sie an sich. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, lenkte sie auf ein anderes Thema: "Warum meint Stefanus, dass Gott an dir und Pentia ein Wunder bewirkt habe?" Das Gauklermädchen setzte sich auf eine Bank und wischte sich mit dem Ärmel ihres Kleides das Gesicht trocken. "Wir waren nicht im Wohnwagen, als die Graukittel gekommen sind. Ich konnte nicht schlafen und Pentia auch nicht. Drum haben wir uns an den Rhein gesetzt. Als ich den Lärm hörte, wusste ich sofort, was passiert ist, und wollte zu den andern. In der Gefahr gehört die Sippe zusammen." "Doch das habe ich ihr ausgeredet", fügte Pentia hinzu. "Es wäre doch ein sinnloses Opfer gewesen." "Also sind wir im Versteck geblieben, bis alles vorbei war, und dann die Uferstraße entlang bis zum Leystapel gelaufen." "Wir konnten so gut wie nichts sehen", ergänzte wiederum Pentia. "Ich begreife bis heute nicht, warum wir nicht in ein Loch oder gar in den Fluss gefallen sind. Wir hatten keine Fackel bei uns, keine Kerze, nichts." "Jesus war bei uns." Ramira holte das Kruzifix des Maginulfus unter ihrem Kleid hervor und betrachtete es versonnen. "Du wolltest, dass ich es wegwerfe, aber Jesus liebt die Armen und die Sünder und beschützt sie. Das hat mir dein Bruder Arnold aus der Bibel vorgelesen." "Darauf würde ich mich an eurer Stelle nicht verlassen." Die drei Mädchen wandten sich erschrocken um und gewahrten Stefanus, der hinter ihnen stand und ihnen wohl schon seit einiger Zeit zugehört hatte. "Die Inquisition gibt ihre Beute nicht gern preis. Ihr müsst verschwinden von hier und zwar möglichst bald." 202 III N och in derselben Nacht brachte Stefanus die drei über den Rhein. Wegen der milden Witterung, konnten sie jenen Ausgang benutzen, bei dem sie unter der Kaimauer hindurchtauchen mussten. Auf diese Weise gelangten sie gefahrlos zum Versteck eines Floßes. Franziska wunderte sich inzwischen nicht mehr über die Sicherheit, mit welcher sich Stefanus trotz tiefer Dunkelheit im Gewirr der Schieferstapel, Kisten und Lagerhütten zurechtfand. Er lief voraus und die Mädchen folgten ihm, wobei sich jeder am Gürtel des Vorausgehenden festhielt. Auf dem Wasser konnte man sich überhaupt nicht mehr orientieren, denn die wenigen, winzigen Lichtpunkte von Köln und (am anderen Ufer) von Deutz verwirrten mehr, als sie halfen. Wenigstens gab die Stärke der Strömung einen Hinweis darauf, wie weit die Flussmitte entfernt war. Stefanus hatte allerdings auch mit diesen Umständen seine Erfahrungen und lenkte das Floß sicher zu einer zum Anlegen geeigneten Stelle außerhalb der Stadt. Eine Verabschiedung duldete er nicht. Von Franziska nahm er weder einen Dank noch eine Entschuldigung entgegen. Nur ein paar Ratschläge gab er noch. "Versucht, schon in der Nacht so weit wie möglich zu kommen! Morgen dürft ihr euch keine Pause gönnen, auch wenn ihr müde werdet. Umgeht die Dörfer. Zumeist könnt ihr in der Nähe des Rheins bleiben. Und jetzt verschwindet!" Schon von der Nacht verschlungen, rief er den Mädchen noch nach: "Und lasst euch von den Kaufleuten auf dem Fluss nicht sehen! Es kann sein, dass man sie nach euch fragt." Dann gab es ihn für sie nicht mehr. Die Dunkelheit schuf nach wenigen Schritten eine dem Anschein nach unüberwindliche Wand zwischen ihm und ihnen. Von der Angst getrieben, liefen sie, wie ihnen geraten, immer geradeaus, ohne zu wissen wohin. Einen vagen Anhalt gab ihnen das Plätschern des Rheins zu ihrer Linken. Allerdings durften sie dem Fluss nicht zu nahe kommen, um nicht in den ihn als breites Band begleitenden, sumpfigen Schilfstreifen zu geraten. Mehrmals bemerkten sie tückische Morastlöcher erst im letzten Moment. Als ihnen ein Wasserlauf unbekannter Breite und Beschaffenheit den Weg versperrte, beschlossen sie, den Anbruch des neuen Tages abzuwarten. Im Licht der ersten Sonnenstrahlen bemerkten sie, dass sie sich von einem kaum einen Meter breiten Bächlein hatten narren lassen, sprangen darüber hinweg und setzten ihre Flucht fort. Um sie herum erstand die Welt in all ihrer Vielfalt neu auf. Zuerst traten (als Umrisse nur) die Bäume hervor und die Sträucher in nächster Nähe. Dann waren einzelne Äste und Zweige zu erkennen. Schließlich löste sich das Schilf in ein Meer unendlich vieler Halme auf. Die Wiesen bildeten einen tiefen, flauschigen Teppich von gelblich-grüner Farbe. Eine Kolonie Krähen hob sich schwarz ab. Ein Hase flüchtete erschrocken ins Dickicht, als er die Menschen bemerkte. Die Mädchen verloren derweil mehr und mehr ihre Angst und begannen (jedes für sich), über die Zukunft nachzudenken. Franziska wollte nach Wardenburg gehen. Graf Burchard hatte inzwischen für sie seinen Schrecken verloren. Warum sollte ihr Vater nicht in der La- ge sein, sie vor ihm zu beschützen? Vielleicht war der Mörder ihres Bruders sogar inzwischen vor ein Gericht gestellt und verurteilt worden. Pentia dachte ähnlich. Allein Ramira fand zu keinen glaubwürdigen Hoffnungen. Sie fühlte sich wie ein im Herbst vom Ast gerissenes und nun umher treibendes Blatt. Zwar konnte sie auf Franziskas Freundschaft vertrauen, doch graute ihr vor den Spuren der Zeit mit Arnold, auf die sie im Oldenburger Land zwangsläufig stoßen würde. Am Abend konnten die drei vor Erschöpfung kaum noch laufen, waren aber ein beruhigendes Stück vorangekommen. Verfolger hatten sie nirgendwo bemerkt. An einer Stelle, wo sie durch dichten Wald und eine scharfe Biegung des Rheins vor Beobachtung geschützt waren, richteten sie sich für die Nacht ein. Sie entzündeten ein Lagerfeuer und leisteten sich ein ausgiebiges Abendbrot. Wenigstens den Hunger brauchten sie vorläufig nicht zu fürchten, denn sie trugen ausreichend Proviant bei sich. Die Sonne war längst hinter die Bäume am jenseitigen Ufer gesunken, tauchte aber noch den Horizont in ein so intensives Rot, dass es einem verheerenden Brand in der Ferne glich. Ringsum herrschte gespenstische Stille, die nur das Knistern der Holzscheite im Lagerfeuer unterbrach. Der Widerschein der Flammen überhauchte den Fluss mit einem Schleier irrlichternder Funken. Die Mädchen rückten unwillkürlich dichter aneinander heran, ohne recht zu wissen, warum ihnen der Friede trügerisch erschien. "Wie vor einem Gewitter", sagte Franziska. "Daran hab ich auch gedacht", bestätigte Ramira und stellte dann eine Frage, die ihr schon lange auf der Seele lag: "Du bist viel klüger als ich, kannst sogar lesen. Was glaubst du: Ist die Welt vom Teufel oder von Gott geschaffen worden?" "Du kommst nicht los von Raimund." "Das hat nicht nur mit Raimund zu tun. Ich selber will es wissen. Sag mir ehrlich, was du denkst!" "Du versprichst dir zuviel von den dicken Büchern. Da steht so vieles drin und gleichzeitig gar nichts. Wie oft habe ich als Kind meinen Bruder Arnold mit solchen Fragen bedrängt! Wir Menschen sind viel zu winzig für die Wahrheit." "Wir alle tragen ein Stück vom Heiligen Geist in uns, und deshalb können wir mit unserem Herzen urteilen", sagte Pentia voller Überzeugung. "Gott hat die Welt geschaffen, und sie ist dafür bestimmt, dass wir glücklich darin leben. Jeder Nacht folgt ein neuer Morgen. Wenn ich nach Wardenburg zurückkehre, verheiratet Vater mich sicherlich bald. Ich werde eine gehorsame Ehefrau sein, aber (wenn es sein muss) mit meinen Mitteln auch meinen eigenen Willen durchsetzen. Warum wollen die Leute alles mit Gewalt erreichen, obwohl doch Nachgiebigkeit und Freundlichkeit oft viel schneller zum Ziel führen?" Franziska blickte ihre Schwester verblüfft an. So vernünftig hatte sie die Jüngere noch nie reden hören. "Was soll ich darauf sagen? Ich glaube fast, dass du mich nicht mehr brauchst." "Natürlich brauche ich dich, nur nicht mehr als ... als Mutter." "Du träumst von einem schönen Grafensohn. Habe ich recht?" sagte Ramira leise. "Ich habe gelernt, mich vor schönen Träumen zu fürchten. Meistens bringen sie Unglück." Pentia rückte an die Freundin heran und umarmte sie. "Nicht alle Träume enden mit einem Unglück. Auch du wirst einen Mann bekommen. Vielleicht wartet der, den 204 Gott für dich bestimmt hat, schon ganz in der Nähe auf dich." "Gott hat schon zwei solche Männer zu mir geschickt und beide sind durch mich zu Tode gekommen. Glaubst du nicht, dass das für die Hölle ausreicht?" "Dem nächsten wirst du Glück bringen." Franziska legte ein paar neue Scheite ins Feuer. "Wir sind abgekommen von der Frage, von wem die Welt erschaffen ist. Ich glaube wie Pentia, dass es Gott war. Ich glaube aber auch, dass sich der Teufel damit nicht abfindet. Ob er sie nun erschaffen hat oder nicht - wenn wir uns nicht wehren, wird sie ihm bald gehören. Ich will nicht einfach zusehen, wenn um mich herum so viel Böses geschieht. Vielleicht hat Stefanus das gemeint, als er sagte, dass ich mir von den Menschen nicht wegnehmen lassen darf, was Gott mir geschenkt hat. Doch der Preis dafür wird wohl die Einsamkeit sein. Wer will sich abgeben mit jemandem, der gegen das Althergebrachte aufbegehrt?" IV D er alte Perfectus kehrte wohlbehalten nach Montségur zurück, wo er drei Jahre später eines natürlichen Todes starb. Pierre, der occitanische Ritter, fiel im Sommer 1238 bei einem Ausfall in die von den Truppen des französischen Königs kontrollierte Ebene unterhalb der Burg. Erst am 16. März 1244 jedoch gelang es einem 6000 Mann starken Heer unter Führung Hugues de Arcis, des Seneschalls von Carcassonne, diese letzte Bastion der Katharer zu erobern. Der Schatz der einst mächtigen Gegenkirche wurde rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Seine Spur verliert sich im wild zerklüfteten Ariège-Tal zwischen den Städten Ax und Tarascon, wo sich Anhänger der Reinen Lehre noch jahrzehntelang verborgen hielten. Die Stadt Köln war in den folgenden fünfzig Jahren Schauplatz vieler blutiger Kämpfe - sowohl zwischen den Patriziern und dem Stadtherrn, als auch zwischen den Patriziern und den Handwerkerinnungen und sogar zwischen den verschiedenen Parteien innerhalb der Patrizierkaste. Am Ende setze sich eine von der Familie Overstolz dominierte Gruppe reicher Kaufleute durch. In der Schlacht bei Worringen am 5. Juni 1288 kämpfte ein Aufgebot der Bürgerschaft in einer Koalition unter Führung des Herzogs Johann von Brabant gegen Erzbischof Siegfried von Westerburg. Der mächtige Kirchenfürst erlitt dabei überraschend eine vernichtende Niederlage, die ihn an den Rand des politischen Unterganges trieb. Er war gezwungen, sich nach Bonn zurückzuziehen und den Kölnern für alle Zeit die volle Unabhängigkeit zu gewähren. Den Einfluss der Dominikaner in der Stadt beeinträchtigte das nicht. Wie fast nirgendwo sonst trat hier die ganze Widersprüchlichkeit des Predigerordens ans Tageslicht. So bedeutende Gelehrte wie Albertus Magnus und sein Schüler Thomas von Aquino, der Begründer der Scholastik, wirkten in Köln, aber auch grausame Fanatiker wie Jacob Sprenger, der Hexenjäger. Sprenger war gegen Ende des 15.Jahrhunderts Prior des Klosters über dem ehemaligen Hospital Sankt Maria Magdalena und verfasste gemeinsam mit Heinrich Institoris im Auftrage des Papstes den Malleus Maleficarum, die im ganzen Spätmittelalter verbindliche Anleitung zur Verfolgung, 205 Folterung und Verurteilung der "mit dem Teufel im Bunde stehenden Frau- en". 206