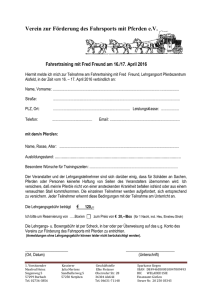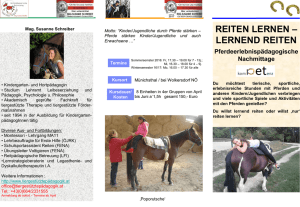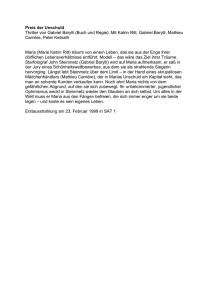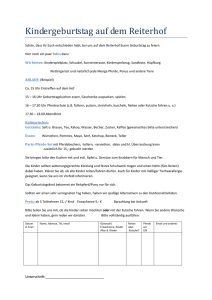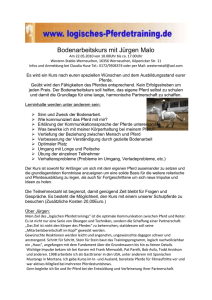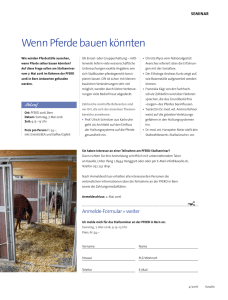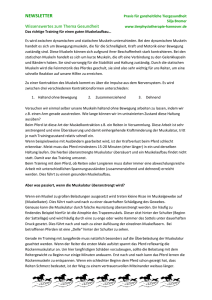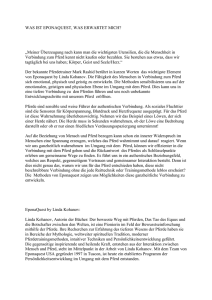Far Far Away - Regina Käsmayr
Werbung

FAR FAR AWAY Sie reiten durchs wilde Kasachstan, durch tropische Wälder, Schneestürme und Wüsten. Viele tausend Kilometer weit. Jahrzehnte lang. Weitreiter nehmen ungeheure Strapazen auf sich, um ihr Ziel zu erreichen. Was treibt sie an und wie geht es ihnen nach der Heimkehr ins enge Deutschland? TEXT: REGINA KÄSMAYR Am 17. Oktober 2003 schreibt die Afrika-Reiterin Esther Stein per E-Mail an die westliche Welt: „Wir sind in Mkushi, was wohl eine Stadt sein soll. Es gibt eine Post und ein paar kleine Läden, das war’s. Horst hat einen ekelhaften Mitreisenden, einen Wurm! Ein halber Meter seines neuen Freunds kam heute Morgen aus seinem Hintern heraus. Jetzt hat er eine Entschuldigung dafür, dass er ständig hungrig ist. Wir beide sind wundgeritten und würden am liebsten aufgeben. Aber Mkushi ist nicht der Ort zum Aufgeben. Also machen wir weiter.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Horst Hausleitner ritt die Schauspielerin Esther Stein ein Jahr lang mit Zelt und Schlafsack quer durch den afrikanischen Busch. Nur mit dem Allernötigsten ausgerüstet, durchstreifte das Paar mit seinen Pferden die Kalahari Wüste in Botswana, den Urwald Sambias, die Steppen Tansanias und schließlich die Weidegründe der Maasai im Kenianischen Hochland. „Ihr habt erfolgreich eine der schwierigsten und gefährlichsten Reittouren unserer Zeit durchgeführt“, lobte anschließend die US-amerikanische Weitreitergilde „The Long Riders’ Guild“. Wundgeritten. Von Parasiten geplagt. Warum, fragt man sich da, reiten die beiden nicht einfach durch die Lüneburger Heide? Oder Günter Wamser und Barbara Kohmanns. Unterwegs von Patagonien nach Alaska. Er seit 11 Jahren, sie fünf Jahre lang. Durch tropisches Klima und Monsunregen. Schwärme von Insekten, gequält vom Dengue-Fieber, einer Tropenkrankheit ähnlich Malaria. Die ehemalige Biologin Barbara Kohmanns lebt heute wieder in Deutschland und hat sich als Yoga-Lehrerin selbstständig gemacht. „Ich hatte es mir romantischer vorgestellt“, sagt sie über ihre Reise. „Der Alltag war mit sehr viel Arbeit verbunden. Man kommt müde am Lagerplatz an und muss sich dann noch ein bis zwei Stunden um die Pferde und das Lager kümmern, bevor man sich mit sich selbst beschäftigen kann. Außerdem wird selbst diese Art von Alltag irgendwann zur Routine. Auf unseren Bildern sieht alles immer so wahnsinnig schön aus. Nicht mit drauf sind all die Zecken, Ameisen und fliegenden Insekten aus Panama.“ Trotzdem dachte die 45jährige nie ans Aufgeben. „Ich wollte immer weiter“, sagt sie. Kohmanns Motivation für den Wahnsinnsritt mit Günter Wamser: Lust an der Natur. Schon immer war sie am Leben in freier Natur interessiert, arbeitete längere Zeit auf einer Alb, wo sie Butter und Käse selbst herstellte. „Für mich hat ein Tetrapak Milch aus dem Supermarkt etwas völlig Entfremdetes. Ich dachte mir oft: Das ist es nicht! Ich will mittendrin leben, ein Teil der Natur sein.“ Bei ihrem Ritt durch Mittelamerika standen Essen und Trinken im Mittelpunkt. Gab es beim Einkaufen nur Eier und Mehl, so wurden eben tagelang Fladen gebacken. „Oder wir haben irgendwelche Knollen gekauft und wussten nicht, wie man sie zubereitet“, erinnert sich die Weitreiterin. „Die Marktfrauen haben uns dann lachend erzählt, wie man es macht. Ich habe gelernt, die einfachsten, alltäglichen Dinge zu schätzen.“ Ähnlich war das bei Manfred Schulze. Von 1996 bis 2000 ritt er auf zwei Huzulenpferden um die Welt – von Geisenheim in Deutschland durch Europa, Russland, die Mongolei, Korea und die USA. 4,5 Jahre unterwegs, 17.459 km weit. Das gewaltige Projekt hatte seine Wurzeln in Schulzes Jugendzeit in der DDR. „Ich hatte mein Leben lang den Wunsch, mit Pferden auf Wanderschaft zu gehen, hatte ständig Fernweh, aber die Grenzen in der DDR waren einfach zu eng für mich. Ich war ein Einzelgänger, der schon als 16jähriger oft allein unter freiem Himmel schlief. Das hat mich geprägt“ sagt der heute 66-Jährige. Vor seiner Weltumrundung war Schulze Inhaber einer kleinen Büromaschinen-Firma. Doch mit dem Einzug des Computers steuerte die Firma langsam aber sicher in den Ruin. Ein Grund mehr für den Zigeuner im Geiste, sich von allem loszumachen. „Ich wollte frei sein von den Zwängen der Gesellschaft, etwas versuchen, das noch keiner versucht hat. Wieder ins kalte Wasser springen, etwas nicht Planbares unternehmen.“ Eine ganz andere Motivation hatte Albert Knaus, der mit seiner Partnerin Kerstin Hüllmandel, auf dem Jakobs-Pilgerweg von Bayern aus nach Santiago de Compostela ritt – 5,5 Monate lang und 3300 Kilometer weit. „Als Rittführer habe ich viele große Ritte mit Trekkinggruppen gemacht, etwa eine im Jahr. Meine Motivation war immer, das Niveau des Trekkingreitens zu verbessern, Erfahrungen und Verhaltensregeln für Konfliktsituationen an Reiter und Ausbilder weiterzugeben.“ Seinen ersten Ritt in die Camargue 1982 bezeichnet Knaus heute als „Katastrophe“. Zu viele Unbekannte standen ihm damals noch im Weg. Was ist polizeirechtlich und zollrechtlich zu beachten, wenn ich mein Pferd nach Frankreich bringen will? Wo darf ich überhaupt reiten? Was mache ich, wenn mir ständig kilometerlange Weidezäune im Weg stehen? „Heute wissen wir das alles und geben unsere Erfahrungen an andere Trekkingreiter weiter“, sagt Knaus. Die Tour nach Santiago de Compostela schenkte der Gründer von Knaus Wohnwagen sich selbst zum 60. Geburtstag. Mit Pilgern und dem heiligen Jakobus hatte er eigentlich nichts am Hut. „Mich reizte einfach der Gedanke, mit meinem 16-jährigen Pferd an den Alantik zu reiten, als krönenden Abschluss unserer Karriere. Vor Santiago waren die Stute und ich verlobt. Nach Santiago verheiratet.“ Mittlerweile hat Knaus seine Einstellung zum katholischen Heiligen so weit geändert, dass er sogar als Pilgerberater fungiert. Die innere Wandlung passierte unterwegs von ganz allein. „Man ist so lange unterwegs und wäscht so viele Gedanken aus 60 Jahren in seinem Kopf rein. Die Nackenschläge, die ich unterwegs erlebte, empfand ich als Quittung für Negatives aus diesen 60 Jahren. Und plötzlich hört man sich selbst Dinge sagen wie ‚Wir werden nicht verdursten. Jakobus wird schon eine Quelle springen lassen.’“ Was der Reitstallbesitzer und ehemalige Unternehmer unterwegs am meisten genoss, war, die Tagesschau zu verpassen und die Aktienkurse in der FAZ nicht mitzukriegen. „Wir lebten mit den Vögeln und dem Geplätscher von Wasser. 5 Monate ohne Bildzeitung und Fernseher – in dieser Zeit tankt man Dankbarkeit und Demut auf.“ Trotzdem fiel es ihm schwer, aus der Abgeschiedenheit und Meditation wieder in sein altes Leben zurückzukehren. Nach Monaten auf dem Pferderücken sah er sich plötzlich wieder mit dem normalen beruflichen Alltag und Egoismus konfrontiert und stellte fest, „dass man in der Tretmühle des Alltags selber egoistisch ist. Auf so einem Ritt lernt man sich selbst kennen.“ Manfred Schulzes eindringlichste Erfahrung auf seiner Weltumrundung hatte mit den Pferden selbst zu tun. In den weiten Steppen Kasachstans und der Mongolei entwickelte er ein starkes Verantwortungsbewusstsein für Puschkin und Panka. „Dieses Zusammenwachsen mit den Pferden wurde so schlimm, dass ich ständig um sie zitterte. Es passierte oft, dass ich mich nachts zu ihnen auf die Koppel legte und morgens aufwachte – da lagen sie rechts und links neben mir. In den Mittagspausen ließ ich sie einfach laufen, setzte mich in die Nähe auf einen Stein und wartete, dass sie zurückkamen.“ Das Trio überstand die Reise trotz zahlreicher Komplikationen unbeschadet. Puschkin entging in Südkorea wegen einer angeblichen Infektion mit Equiner Arteriitis nur knapp einer Tötung und Panka brachte in den USA das Hengstfohlen Temujin zur Welt. Und dann, wieder daheim auf scheinbar sicherem Boden in Deutschland, klappte gar nichts mehr. Schulze hatte Schwierigkeiten, sich nach seiner Rückkehr in der hektischen, engen Welt zurecht zu finden. „Man hat sich vom Verständnis des Lebens in westlichen Ländern verabschiedet. Anfangs bin ich ständig überall erschrocken stehen geblieben. Was hier an Kaltherzigkeit zwischen Menschen möglich ist! Ich hatte Sehnsucht nach dem anderen, tiefer fühlenden Leben ohne Besitztümer und Autos. Ich begriff: Diese Art des Reisens verändert einen Menschen von Grund auf. Man kann nie mehr völlig in sein altes Leben zurückkehren.“ Innerhalb von zwei Jahren trafen den Weltumreiter zwei schwere Schicksalsschläge. Erst starb nach 37 Jahren Ehe seine Frau, dann, fünf Monate später, seine treue Stute Panka. Sie lag eines Tages einfach tot auf der Koppel. Die Tierärztin vermutete einen Aorta-Abriss oder ein Herz-KreislaufProblem. Für Schulze war das alles das Ende der Welt. Zudem hatte er für die Reise seine Altersversorgung angezapft und Schulden auf sich genommen. „Ich war auf dem absteigenden Ast“, sagt er. Das war vor sechs Jahren. „Jetzt bin ich wieder optimistisch und habe große Lebensphantasien. Als Reiseschriftsteller werde ich über Gebiete schreiben, wo auch Pferde leben. Jedes Jahr soll ein Buch erscheinen. Im Frühjahr breche ich zu den Reisen auf, im Winter schreibe ich.“ Leider musste er sich für diese Tätigkeit und aus finanziellen Gründen von seinen beiden verbliebenen Pferden Puschkin und Temujin trennen. Zur Zeit stehen sie in Pflege bei der Bogenschützen-Lehrerin Pettra Engländer im hessischthüringischen Grenzland. „Wenn sich kein Käufer finden sollte, können sie dort bleiben“, sagt Schulze mit Bedauern. Bisher halten sich die Interessenten noch stark zurück, denn der neue Besitzer soll die Pferde nicht nur angemessen bezahlen, sondern auch „betüddeln“, eine starke Zweisamkeit zu ihnen aufzubauen und sie artgerecht halten. Wohl zu viel verlangt ... Aus finanzieller Sicht hat das Aussteigertum mit Pferd schon so manchen Weitreiter ruiniert. Zwar kostet das tägliche Leben in Mittelamerika, Afrika und der Mongolei nur wenig, doch Visas, Veterinärkosten und Flüge schlagen sich heftig zu Buche. „An den Grenzen warteten wir auch oft bis zu drei Wochen lang, weil wir kein Schmiergeld für die Einreise zahlen wollten“, erzählt Barbara Kohmanns, die die Reise über ihr Erspartes finanzierte. „Mehr als 500 Dollar braucht man in Mittelamerika nicht im Monat. Das einzig Teure waren die Tierarztkosten an den Grenzen.“ Albert Knaus und Kerstin Hüllmandel gaben für den Ritt nach Santiago 20.000 Euro aus. „Das klingt viel, sind aber nur 62,30 Euro für zwei Menschen und zwei Pferde am Tag“, gibt Knaus zu bedenken. Nur „wenn’s Kreuz sehr weh tat“, nahmen sich die beiden auch mal ein Hotelzimmer, sonst schliefen sie im Zelt oder Heulager. Günter Wamser, der „Abenteuerreiter“, der seit insgesamt 21 Jahren durch die Welt tourt, ist einer der wenigen Extremreiter, die ihre Passion nahezu komplett über Diavorträge und Buchverkäufe finanzieren. „Alle zwei bis drei Jahre komme ich in der Wintersaison nach Deutschland und halte dann 80 bis 120 Vorträge. Davon lebe ich. Es gibt einen großen Markt dafür. Ich lebe die Träume vieler Menschen und deshalb kommen sie in meine Vorträge“, sagt Wamser. Hier lernte er auch seine frühere Mitreiterin Barbara Kohmanns und seine jetztige Partnerin Sonja Endlweber kennen. Beide beschlossen während eines Vortrags: „Da will ich mit!“ und ließen nicht locker, bis sie neben dem großen Abenteurer im Sattel saßen. Ursprünglich hatte Wamser geplant, in vier bis fünf Jahren von Patagonien nach Alaska zu reiten. Aber dann lernte man unterwegs nette Leute kennen und blieb länger als geplant. „Bleibt doch bis nächste Woche zur Taufe oder zum Dorffest!“ So entstanden die Verzögerungen. Mittlerweile sind elf Jahre vergangen, doch das Ziel rückt in greifbare Entfernung. Was macht ein Abenteurer, wenn das Abenteuer vorbei ist? „Weiß ich noch nicht“, gibt Wamser zu. „Ich werde wohl eine ganze Weile dort bleiben. Ich möchte die Erfahrung machen, wie es ist, wenn’s wirklich eiskalt ist. Vielleicht mache ich was mit Schlittenhunden. Mir ist immer noch wichtig, unterwegs zu sein. Wenn ich das eines Tages in Frage stelle, werde ich aufhören und sesshaft werden.“ „Die Integrationsquote liegt nahezu bei Null“ Interview mit Dr. Dietmar Köstler, VFD-Vorsitzender in Bayern und Herausgeber der deutschen Seite „Weitreitergilde.de“. Das amerikanische Vorbild, die Long Riders’ Guild, wurde 1994 gegründet, um Menschen aller Nationen zu verbinden, die bei einem einzigen Ritt mehr als 1000 Meilen (1600 Kilometer) zurückgelegt haben. Zur Zeit leben mehr als 100 Mitglieder der Weitreitergilde in 19 Ländern der Erde. Woher kommt ihr Einsatz für die Weitreiter? Köster: Ich war immer unglaublich fasziniert von der Tatsache, dass es Menschen gibt, die solche Riesen-Entfernungen auf dem Pferd zurücklegen. Ich finde es nicht einmal selbstverständlich, dass mein Pferd 250 km von Freising nach München läuft. Wollen sie selbst auch eines Tages die 1000-Meilen-Marke knacken? Köster: Das erfordert einen Zeitraum von ca. 2 Monaten oder mehr. Ein dreiwöchiger Ritt geht für einen Selbstständigen wie mich mit Mühe. Aber dann ist’s vorbei. Klar habe ich Ideen, etwa nach Rumänien zu reiten. Aber das müsste schon mit meinem Leben vereinbar sein. Längere Ritte sind aus meiner Sicht nicht unproblematisch, weil man dann nahezu dauerhaft in eine andere Lebensweise schlüpft, aus der herauszufinden nicht einfach ist. Warum nicht? Köster: Eine Freundin von mir ist als Sozialarbeiterin für die Reintegration von Aussteigern zuständig. Sie sagt, die Integrationsquote liegt nahezu bei Null. Viele wollen definitiv wieder sesshaft werden, aber sie schaffen es nicht, ihren regelmäßigen Verpflichtungen nachzukommen. Es gibt aber auch einige Beispiele von Weiterreiterin überall auf der Welt, die es geschafft haben, eine Balance zwischen dem Aussteigertum und dem Leben in der westlichen Welt hinzubekommen. Was ist der Unterschied zwischen Weitreitern und Distanzreitern? Köster: Einfach: Distanzreitern geht es um den Wettbewerb, dort wird auf Zeit geritten, und in aller Regel (bei uns) nur einen Tag. Bei langen Wanderritten dagegen steht das Erleben im Vordergrund, mit dem Ziel, den Partner Pferd und sich selbst gesund ans Ziel zu bringen. Die Zeit spielt nur eine untergeordnete Rolle. Welcher Weitreiter hat sie persönlich am meisten beeindruckt? Köster: Das sind drei Frauen. Vielleicht, weil das, was sie gemacht haben, nicht dem typischen Frauenbild entspricht: Die Afrikareiterin Esther Stein und Evelyn Landerer, eine zierliche Frau, die seit Jahren immer wieder allein durch die Mongolei reitet und inzwischen fließend mongolisch spricht. Außerdem noch Basha O’Reilly, die alleine von Moskau nach London ritt. Kasten: WEITREITER-FAKTEN Die erste Weitreiterin war Celia Fiennes. Im Jahre 1697 ritt die Reiseschriftstellerin von Land’s End in England nach Aitchison Bank in Schottland: 2600 km im Damensattel – ohne männliche Begleitung. Der bekannteste Weitreiter war Aimé Felix Tschiffely. Er legte die 16.093 Kilometer lange Strecke von Buenos Aires nach Washington mit seinen 15 und 16 Jahre alten Criollos „Mancho“ und „Gato“ zurück. Der Reitanfänger Tschiffely ritt beide immer abwechselnd und brauchte für den Weg 504 Tage. Eine Zeitung titelte damals über ihn: „Unmöglich! Absurd! Der Mann muss verrückt sein!“ Als er zurückkam, schrieb er über seinen Ritt ein Buch, das über Nacht zum Bestseller wurde. Mancha und Gato lebten nach dem kontinentalen Gewaltritt noch fast zwanzig Jahre lang – Gato wurde 36, Mancha 40 Jahre alt. Sie sind im Transport-Museum von Luján nahe Buenos Aires ausgestopft zu sehen. Auf der Estancia El Cardal in Argentinien ist dem „Gefleckten“ und dem „Getigerten“ ein Ehrenmal gewidmet. Den längsten Ritt unternahmen von 1912 bis 1915 „The Overland Westerners“ George und Charlie Beck, Jay Ransom und Raymond Rayne. Sie ritten durch alle unteren 48 Staaten der USA. Ein Pferd, ein Morab Wallach namens Pinto schafft den ganzen Ritt von 32.560 km Strecke. Bei ihrer Ankunft erwarteten die vier Männer, als heimkehrende Legenden gefeiert zu werden. Doch niemand interessierte sich für sie. Der Erste Weltkrieg nahm alle Schlagzeilen für sich ein. Alle außer George Beck verkauften Pferde und Equipement, um sich „mit gebrochenem Herzen“ eine Heimfahrt mit dem Zug leisten zu können. Beck und sein treuer Pinto folgten später nach. Ein Buch konnten sie nie veröffentlichen. Heute werden sie als „vergessene Helden“ gefeiert. Der Mustang-Hengst Hidalgo ist keine Erfindung der Filmindustrie. Ihn gab es wirklich. Ende des 19. Jahrhunderts gewann er unter seinem Reiter Frank Hopkins 400 Distanzrennen in den USA und siegte 1889 im 3000-Meilen-Rennen durch die Arabische Wüste. Tatsächlich kam er aber nicht eine Nasenlänge, sondern 33 Stunden vor dem Zweiten ins Ziel. In dem USKinohit hatte das Hautdarsteller-Pferd „T.J“ fünf Doubles, die so geschminkt wurden, dass sie wie das Original aussahen. Kasten: Buchtipps: Günter Wamser: Der Abenteuerreiter – in elf Jahren mit Hund und Pferden von Feuerland nach Mexiko. 384 Seiten, Hardcover, 19,90 Euro: 1994 reist Günter Wamser nach Patagonien, kauft zwei Wildpferde, zähmt sie und reitet los. Über 20.000 Kilometer durch 12 Länder. Von der Südspitze Argentiniens will er bis nach Alaska reiten. Schritt für Schritt, im Takt der Hufe, Land und Leute erfahren und die Natur spüren. Unterwegs mit seinen Pferden gelangt er in Gebiete, die kein Tourist jemals erreicht hat, in Regionen, in denen die Menschen noch freundlich, offen und hilfsbereit sind. Selbstironisch und erfrischend direkt erzählt Günter Wamser von den berührenden Erlebnissen mit seinen Tieren, von der südamerikanischen Bürokratie und Korruption, von herzlicher Gastfreundschaft und von Liebe und Enttäuschung. Manfred Schulze: „Mit zwei Pferden um die Welt“, 336 Seiten, Hardcover, 25,00 Euro: „Soll das alles gewesen sein? Ein Leben voller Arbeit und Streben nach Wohlstand oder gar Reichtum? Was würde ich davon haben, wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liege? Einmal wenigstens ein richtiges Abenteuer erleben, bevor es zu spät ist. Reich zu sterben, kann wohl nicht Ziel des Lebens sein. Dann schon arm, aber mit der Gewissheit, wirklich Großes erreicht zu haben. Deshalb machte ich mich auf, etwas zu wagen, was noch niemand tat: die Erde mit zwei Pferden zu umrunden, auf der nördlichen Halbkugel – dort, wo es hoffentlich genug Wasser und Futter für die Tiere gibt.“ Die Reiseerzählung nach Tagebuchaufzeichnungen des ersten Weltumreiters. Sie berichtet in ergreifender Weise von einem der größten Abenteuer der Neuzeit. Horst Hausleitner: Farasi, Seifert Verlag, 352 Seiten, gebunden, 22,90 Euro: Mit dem Pferd quer durch Afrika. 5.000 Kilometer Savanne, Busch, Urwald, wilde Tiere, fremde Kulturen - Esther und Horst wagten gemeinsam das Abenteuer ihres Lebens. Ein Pferdediebstahl, ohne Wasser mitten in der Steppe, von 500 Wilden gesteinigt und nur knapp dem Tod entronnen, dies sind nur einige Episoden, die sie auf ihrer zwölfmonatigen Tour von Südafrika nach Kenia erlebten. Amerikanische Medien sollten später von dem „Ritt des Jahrhunderts“ sprechen. Zugleich ist für die beiden diese Expedition aber auch eine Reise zurück zu den Wurzeln der Menschheit, eine Flucht aus der von Überfluss und Entfremdung geprägten Zivilisation hin zu einem wesentlichen und intensiven Leben.