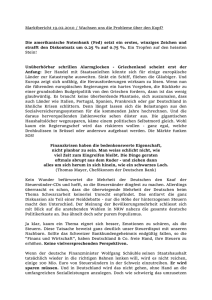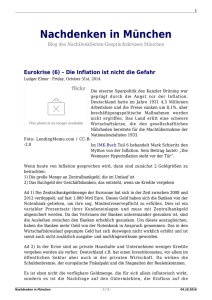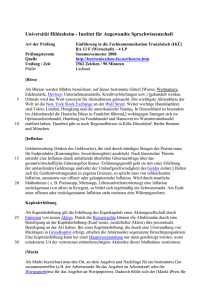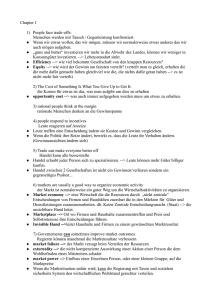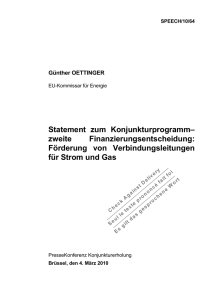Marktbericht 08
Werbung
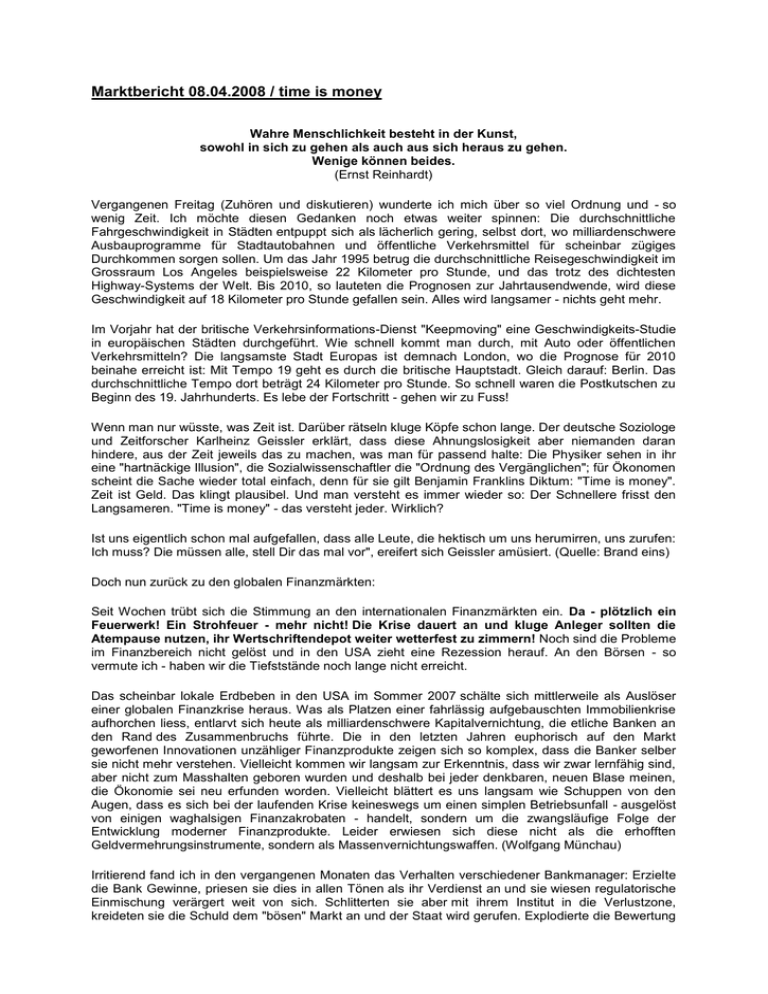
Marktbericht 08.04.2008 / time is money Wahre Menschlichkeit besteht in der Kunst, sowohl in sich zu gehen als auch aus sich heraus zu gehen. Wenige können beides. (Ernst Reinhardt) Vergangenen Freitag (Zuhören und diskutieren) wunderte ich mich über so viel Ordnung und - so wenig Zeit. Ich möchte diesen Gedanken noch etwas weiter spinnen: Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit in Städten entpuppt sich als lächerlich gering, selbst dort, wo milliardenschwere Ausbauprogramme für Stadtautobahnen und öffentliche Verkehrsmittel für scheinbar zügiges Durchkommen sorgen sollen. Um das Jahr 1995 betrug die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit im Grossraum Los Angeles beispielsweise 22 Kilometer pro Stunde, und das trotz des dichtesten Highway-Systems der Welt. Bis 2010, so lauteten die Prognosen zur Jahrtausendwende, wird diese Geschwindigkeit auf 18 Kilometer pro Stunde gefallen sein. Alles wird langsamer - nichts geht mehr. Im Vorjahr hat der britische Verkehrsinformations-Dienst "Keepmoving" eine Geschwindigkeits-Studie in europäischen Städten durchgeführt. Wie schnell kommt man durch, mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln? Die langsamste Stadt Europas ist demnach London, wo die Prognose für 2010 beinahe erreicht ist: Mit Tempo 19 geht es durch die britische Hauptstadt. Gleich darauf: Berlin. Das durchschnittliche Tempo dort beträgt 24 Kilometer pro Stunde. So schnell waren die Postkutschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es lebe der Fortschritt - gehen wir zu Fuss! Wenn man nur wüsste, was Zeit ist. Darüber rätseln kluge Köpfe schon lange. Der deutsche Soziologe und Zeitforscher Karlheinz Geissler erklärt, dass diese Ahnungslosigkeit aber niemanden daran hindere, aus der Zeit jeweils das zu machen, was man für passend halte: Die Physiker sehen in ihr eine "hartnäckige Illusion", die Sozialwissenschaftler die "Ordnung des Vergänglichen"; für Ökonomen scheint die Sache wieder total einfach, denn für sie gilt Benjamin Franklins Diktum: "Time is money". Zeit ist Geld. Das klingt plausibel. Und man versteht es immer wieder so: Der Schnellere frisst den Langsameren. "Time is money" - das versteht jeder. Wirklich? Ist uns eigentlich schon mal aufgefallen, dass alle Leute, die hektisch um uns herumirren, uns zurufen: Ich muss? Die müssen alle, stell Dir das mal vor", ereifert sich Geissler amüsiert. (Quelle: Brand eins) Doch nun zurück zu den globalen Finanzmärkten: Seit Wochen trübt sich die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten ein. Da - plötzlich ein Feuerwerk! Ein Strohfeuer - mehr nicht! Die Krise dauert an und kluge Anleger sollten die Atempause nutzen, ihr Wertschriftendepot weiter wetterfest zu zimmern! Noch sind die Probleme im Finanzbereich nicht gelöst und in den USA zieht eine Rezession herauf. An den Börsen - so vermute ich - haben wir die Tiefststände noch lange nicht erreicht. Das scheinbar lokale Erdbeben in den USA im Sommer 2007 schälte sich mittlerweile als Auslöser einer globalen Finanzkrise heraus. Was als Platzen einer fahrlässig aufgebauschten Immobilienkrise aufhorchen liess, entlarvt sich heute als milliardenschwere Kapitalvernichtung, die etliche Banken an den Rand des Zusammenbruchs führte. Die in den letzten Jahren euphorisch auf den Markt geworfenen Innovationen unzähliger Finanzprodukte zeigen sich so komplex, dass die Banker selber sie nicht mehr verstehen. Vielleicht kommen wir langsam zur Erkenntnis, dass wir zwar lernfähig sind, aber nicht zum Masshalten geboren wurden und deshalb bei jeder denkbaren, neuen Blase meinen, die Ökonomie sei neu erfunden worden. Vielleicht blättert es uns langsam wie Schuppen von den Augen, dass es sich bei der laufenden Krise keineswegs um einen simplen Betriebsunfall - ausgelöst von einigen waghalsigen Finanzakrobaten - handelt, sondern um die zwangsläufige Folge der Entwicklung moderner Finanzprodukte. Leider erwiesen sich diese nicht als die erhofften Geldvermehrungsinstrumente, sondern als Massenvernichtungswaffen. (Wolfgang Münchau) Irritierend fand ich in den vergangenen Monaten das Verhalten verschiedener Bankmanager: Erzielte die Bank Gewinne, priesen sie dies in allen Tönen als ihr Verdienst an und sie wiesen regulatorische Einmischung verärgert weit von sich. Schlitterten sie aber mit ihrem Institut in die Verlustzone, kreideten sie die Schuld dem "bösen" Markt an und der Staat wird gerufen. Explodierte die Bewertung von Vermögenswerten, war das normal. Tauchten aber harsche Marktkorrekturen auf, stufte man die Märkte als irrational, instabil und intransparent ein. Glauben die Bankchefs das eigentlich selbst? Oder sind sie sich bewusst, wie viel Geld sie mit dem Vertrieb eben solch undurchsichtiger Finanzvehikel verdient haben? Solange die Bankvorstände nicht von ihrem hohen Ross klettern, ihr eigenes Mitverschulden nicht eingestehen und selbst in der Krise noch ein fröhliches "Weiter so" prusten, sollte der Staat sie noch zappeln lassen. Stopft der Staat oder die Notenbank nämlich jetzt die Löcher, werden die notwendigen Strukturanpassungen bei den Banken auf die lange Bank geschoben und der Lernprozess bleibt aus. "Weiter so" aber geht nicht mehr. Wer glaubt, Regulierer und Regierungen müssten nur beherzt genug die Krise anpacken, übersieht, dass sie aus langjährigen Exzessen entstanden ist. Staatshilfen nützen in dieser Situation wahrscheinlich wenig: dem Überkonsum muss der Kater folgen. Bei einer ehrlichen Analyse müssen wir doch erkennen, dass es wirkungsvolle Soforthilfe kaum geben kann, wo es doch um die Beseitigung jahrelanger Ungleichgewichte und Systemfehler geht. Die Bankenwelt hat sich von der Realwelt abgekoppelt. "Einige Beobachter befürchten, dass die US-Notenbank (Fed) den Banken das finanzielle Risiko abnimmt. Aber mich beunruhigt mehr, dass ihr Einfluss angesichts des Problems begrenzt ist", warnt US-Ökonom Paul Krugman. "200 Milliarden US-Dollar klingt nach viel Geld. Aber wenn man diese Summe mit der Grösse der Märkte vergleicht - 11 Billionen US-Dollar US-Hypotheken sind ausstehend! -, ist klar, dass dies bloss ein Tropfen auf den heissen Stein ist." So könne man nur hoffen, dass die Inflation helfe, einige Schulden abzubauen. Die sich im Markt einpendelnden Zinserwartungen spiegeln längst mehr als den Kampf der Währungshüter gegen eine Rezession: die Überzeugung der Anleger, dass das Fed gegen sämtliche Schattierungen der Kreditkrise vorgehen wird, von den noch bevorstehenden Wertberichtigungen der Banken über die Straffung der Kreditkonditionen, die Risikoaversion am Kapitalmarkt bis hin zum Preiszerfall in Immobilien. Kann eine Zentralbank eine so vielschichtige Aufgabe überhaupt in den Griff kriegen? Es tauchen Zweifel auf. Thomas Hoenig, Präsident der Distriktnotenbank von Kansas City, ermahnte vor drei Wochen die zum Treffen des Institute of International Finance (IIF) angereisten Banker: Der Geldpolitik würden zu viele Lasten aufgebürdet. Welches Land kann von sich behaupten, optimal gegen einen grösseren Unfall im globalen Finanzsystem gerüstet zu sein? Die Geschichte lehrt, dass Notenbanken zwar vorübergehend Starthilfe betreiben können, um den zum Stillstand gekommenen Konjunkturmotor in Gang zu bringen. Danach sollten sie sich aber rasch auf ihre eigentliche Aufgabe zurückbesinnen und für stabile, inflationsfreie Rahmenbedingungen sorgen. Mehr zu versuchen, wäre gefährlich. Was aber beobachten wir heute? Durch die expansive Politik der Fed baut sich weltweit ein erhebliches Teuerungspotential auf. Geldpolitiker und Anleger sollten sich dringend an die Schäden erinnern, die so etwas verursacht. Blicken wir nach Russland, Vietnam, Argentinien und Venezuela, dann wuchert dort die Inflation im soliden zweistelligen Bereich. "China im Preisrausch!", lese ich in der jüngsten Ausgabe der "Bilanz". Schon vor den Olympischen Spielen explodieren in China die Preise, speziell für Nahrungsmittel. Die offizielle Teuerung lag bei knapp 9 %, die Nahrungsmittelpreise stiegen gar um 23 %. Nach 6 erfolglosen Versuchen mit Zinserhöhungen erwarten Experten weitere Massnahmen, um die gefährliche Inflation bei wichtigen Nahrungsmitteln zu unterbinden. Schliesslich leben im Riesenland immer noch gut 300 Millionen Menschen in Armut. Aber - ein weiterer Zinsschritt bringt nicht mehr Schweinefleisch auf den Markt. Der Kampf gegen die Teuerung erhält für die chinesische Regierung aber höchste Priorität. Tatsächlich können wir uns - ausser im deflationsgeschüttelten Japan - fast überall von hoher und weiter steigender Teuerung überzeugen. Das Epizentrum der globalen Inflation liegt derzeit in den USA. Angesichts der bösartigen Mischung aus kollabierenden Hauspreisen und zusammenbrechenden Kreditmärkten kappt die amerikanische Notenbank fast panisch die Zinsen, um eine Rezession abzuwenden. Doch selbst wenn sie dies in ihren Prognosen nicht eingesteht: Der Preis dieser "Versicherungspolice" schlägt sich früher oder später in einer teuflischen Inflation nieder, die dann möglicherweise mehrere Jahre anhält. ACHTUNG: In allen weltwirtschaftlich besonders wichtigen Regionen verzeichnet des Stimmungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts Rückgänge. Die Wirtschaftsakteure, dies macht die Konjunkturanalyse der "NZZ" deutlich, stellen sich auf rauere Zeiten ein. Die Finanzkrise setzt der Triade zu: Konjunkturelles Wetterleuchten über der Euro-Zone - Sorgen um die Kaufkraft! Die USWirtschaft nahe oder vielleicht schon in einer Rezession! Japans Wirtschaft stagniert! Wasser ist Leben: Im Gegensatz zu Öl gibt es keinen Ersatz dafür. Die Süsswasserressourcen in vielen Weltregionen trocknen aus. Bevölkerungswachstum und Klimawandel verschärfen die Lage. Und so, wie die Weltwirtschaft wächst, so wird auch ihr Durst anschwellen. Alle 20 Sekunden stirbt ein Kind an Krankheiten, die durch den Mangel an sauberem Wasser hervorgerufen werden. Insgesamt kommen aus diesem Grunde jedes Jahr 1.5 Millionen Kinder und Jugendliche ums Leben. Mehr als 2.5 Milliarden Menschen müssen in unerträglichen hygienischen Verhältnissen ihr Leben fristen. Die Nichtregierungsorganisation "International Alert" hat 46 Staaten mit total 2.7 Milliarden Einwohnern identifiziert, in denen Klimawandel und wasserbezogene Krisen zu einem hohen Risiko eines gewalttätigen Konflikts führen. In weiteren 56 Staaten mit total 1.2 Milliarden Menschen gibt es demnach instabile politische Verhältnisse. Zusammengerechnet ist das mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Das Problem ist keine Frage von Arm oder Reich, von Nord oder Süd. China zum Beispiel leitet vor den Olympischen Spielen im Sommer zwar Hunderte Millionen Kubikmeter Wasser in die dürregefährdete Region um Peking, aber es wird erwartet, dass es dort auf Jahre zu Wasserknappheit kommen wird. Und in Nordamerika mündet einer der mächtigsten Flüsse, der Colorado, nur noch selten ins Meer. Das Wasser des Tschadsees in Zentralafrika versorgt etwa 30 Millionen Menschen. In den vergangenen 30 Jahren ist der See infolge von Dürre, Klimawandel, Missmanagement und zu starker Nutzung auf ein Zehntel der ursprünglichen Grösse geschrumpft. (Quelle: Ban Ki-Moon, UNGeneralsekretär) Laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen wird der Wasserbedarf in der Zeit bis 2020 um 40 % zulegen. Der globale Umsatz liegt derzeit bei $ 400 Milliarden - Tendenz steigend.