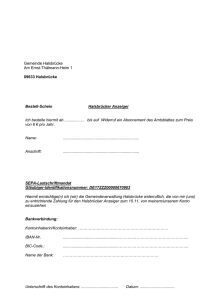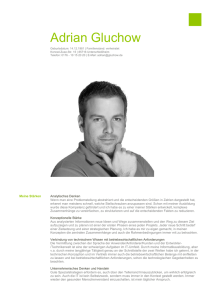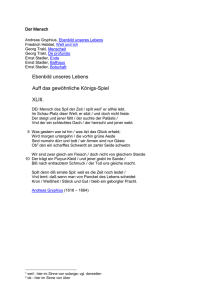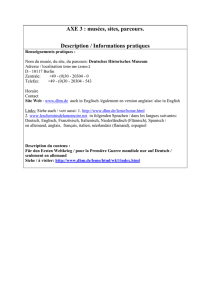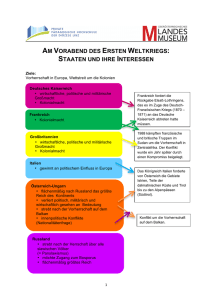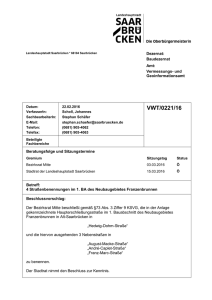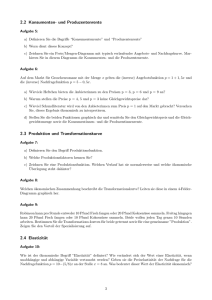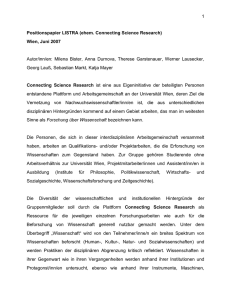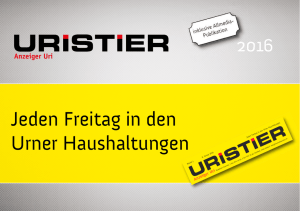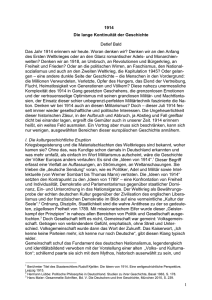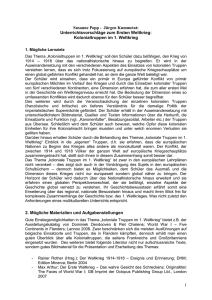1 Vorwort - Wasserburg am Inn!
Werbung

Städtischer Geschichtswettbewerb 2003/2004 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern - Fachbereich Sozialverwaltung Wasserburg am Inn Der städtische Fürsorgeausschuss und die Zentralisierung einer Massenspeisung der Wasserburger Bevölkerung Carmen Rau Maximilianstraße 70 95444 Bayreuth Tutoren: Herr Haupt / Herr Gihl Inhaltsverzeichnis Seite 1 Vorwort 4 2 Einleitung 5 2.1 Allgemeine Bemerkungen 5 2.2 Die allgemeine Versorgungslage der deutschen 6 Zivilbevölkerung im 1. Weltkrieg 2.3 Die Versorgungslage der Wasserburger Bevölkerung 7 3 Der städtische Fürsorgeausschuss von 1914 9 und die Zentralisierung einer Massenspeisung 3.1 Der Fürsorgeausschuss im verwaltungsrechtlichen Sinne 9 3.2 Die Zuspitzung der wirtschaftlichen Lage 12 3.3 Die Gründung des Fürsorgeausschusses 13 3.4 Die Suppenanstalt für Kinder von 1914 bis 1916 15 3.5 Die Einrichtung einer Volksküche ab 1916 20 4 Zusammenfassung 27 5 Anhang 30 5.1 Statistik: Häufigkeit über Inanspruchnahme der 30 Speisenverteilung in der Suppenanstalt von November 1914 bis August 1916 5.2 Speisezettel einer Münchener Volksküche vom 31 16. Oktober bis 22. Oktober 1916 6 Abkürzungsverzeichnis 34 2 7 Quellen- und Literaturverzeichnis 35 7.1 Quellen 35 7.1.1 Gedruckte Quellen 35 7.1.2 Ungedruckte Quellen 38 7.2 Literatur 40 8 Erklärung 40 3 1 Vorwort Die Zeit rund um den 1. Weltkrieg stellt aus historischer Sicht ein sehr komplexes Thema dar. Um alle Begebenheiten, die unmittelbar mit diesem Krieg zu tun hatten, sinnvoll aufzubereiten, verlangt es nach einer detaillierten Spezialisierung in verschiedene Teilbereiche. In sehr vielen Publikationen, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, werden zumeist allgemeine politische Darstellungen, militärische Handlungen oder das Leben der Zivilbevölkerung in Großstädten in den Vordergrund gestellt. Im Gegensatz dazu finden die Lebensverhältnisse von Bewohnern, die in Kommunen lebten nach meiner Einschätzung kaum Beachtung. Da ich die Gelegenheit bekam die Stadt Wasserburg am Inn durch mein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Sozialverwaltung, näher kennen zulernen, möchte ich mich speziell mit der Verpflegungssituation in Wasserburg in der Zeit von 1914 bis 1918 beschäftigen. Hierbei war es besonders interessant zu erfahren wie die Organisation einer Zentralisierung der Speisenverteilung durch die Verwaltungsorgane der Stadtgemeinde ihren Weg nahm und mit welchem Erfolg sie in die Praxis umgesetzt wurde. Besonders möchte ich mich bei Herrn Haupt, Leiter des Stadtarchivs Wasserburg bedanken, der mir bei meinen Recherchen über die damalige Zeit zur Verfügung stand. Ebenfalls Herrn Gihl, Fachbereichslehrer der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Sozialverwaltung gilt mein Dank, der mir bei der weiteren Betreuung meiner Arbeit zur Seite stand. 4 2 Einleitung 2.1 Allgemeine Bemerkungen Um eine möglichst effiziente Aufzeichnung der Koordination einer Zentralisierung der Massenspeisung unter Führung des Fürsorgeausschusses in der Wasserburger Bevölkerung darzustellen, verwendete ich ausschließlich zeitgenössische Literatur. Dieses im Stadtarchiv Wasserburg aufbewahrte Schriftgut zu diesem Thema gliedert sich u. a. in 2 Akten, die sowohl gedruckte als auch ungedruckte Quellen zur allgemeinen Fürsorgesituation Wasserburgs und Umgebung in dieser Zeit enthalten. In diesen Akten befinden sich z. B. Sitzungsprotokolle und Beschlüsse des Stadtmagistrats und des Fürsorgeausschusses, interne handschriftliche Bemerkungen, Bekanntmachungen sowie ein umfangreicher Schriftverkehr zwischen den Verwaltungsbehörden Bayerns. Der größte Anteil der gedruckten Quellen außerhalb der Akten stellt eine Ansammlung von Ausgaben des „Wasserburger Anzeigers“ von 1914 bis 1916 dar. Als erklärende Unter-stützung verwendete ich Konversationslexika sowie die Bayerische Gemeindeordnung dieser Zeit. Trotz dieser umfassenden Literatur waren im chronologischen Zeitablauf der Akten teilweise große Sprünge vorhanden, so dass nicht immer durchgängig die damaligen Zustände von mir beschrieben werden konnten. Dennoch glaube ich, dass es mir gelang, die Zentralisierung der Speisenverteilung in Wasserburg in der Zeit des 1. Weltkrieges weitestgehend vollständig zu analysieren. 5 2.2 Die allgemeine Versorgungslage der deutschen Zivilbevölkerung im 1. Weltkrieg Als schließlich das Deutsche Kaiserreich am 01. August 1914 nach einer Kettenreaktion von Kriegserklärungen und Mobilmachungen anderer Staaten Russland den Krieg erklärte, galt der 1. Weltkrieg als begonnen. Mit der Ausarbeitung des sogenannten Schliefenplanes, der einen Überraschungsangriff auf Frankreich und einen weiteren Angriff auf Russland vorsah, glaubten sowohl die Regierung als auch Vertreter der herrschenden Klassen diesen Krieg in kürzester Zeit gewinnen und damit beenden zu können.1 Aufgrund dieser Auffassung hatten die militärischen und zivilen Behörden des Kaiserreiches und Preußens Planungen und Vorbereitungen von wirtschaftlichen Maßnahmen für einen eventuellen Ernstfall vernachlässigt. Die erst ab Ende Mai 1914 vom wirtschaftlichen Ausschuss des Reichsamtes des Inneren erarbeiteten Vorschläge für eine Versorgung mit Getreide blieben auch wegen des eng begrenzten Reichshaushaltes ein unverbindliches Planspiel. Trotz des stagnierenden Weltmarktes im Herbst 1913 aufgrund von Ernteausfällen und kriegerischen Handlungen sowohl auf dem Balkan als auch in Peru, Brasilien und Mexiko sah man seitens der Regierung keinen Bedarf zum verstärkten Getreideeinkauf. Beobachter der Konjunkturentwicklung erwarteten bis Mitte 1914 eine allmähliche Belebung des Marktes. So kam es, dass die deutsche Landwirtschaft von den Ereignissen vom Sommer 1914 überrascht wurde und bei Kriegsbeginn nur geringe Getreidevorräte im Handel lagerten. Trotz der Mobilmachung hielt sich der Arbeitskräftemangel zunächst in Grenzen, da ein Teil der Ernte bereits abgearbeitet war. Kinder und Frauen nahmen die Stelle der Bauern ein, die für die kriegswichtige Industrie eingezogen wurden. Durch die Einbeziehung der besten Pferde für Kriegszwecke 1 wurde die Produktionskraft der Landwirtschaft Drost, K / Wünsche, W: Der erste Weltkrieg – Erscheinung und Wesen, 1989, S. 50 - 51 6 geschwächt. Weiterhin verschärften der Mangel an Kraftfutter und Düngemitteln die Wirkungen der Kriegserscheinungen.2 2.3 Zur Die Versorgungslage der Wasserburger Bevölkerung Ermittlung der allgemeinen Lebensmittelversorgung der Wasserburger Bevölkerung vor Kriegsbeginn wurden zahlreiche Ausgaben der regionalen Zeitung „Wasserburger Anzeiger“ vom Juni und Juli des Jahres 1914 herangezogen. Berichte über Lebensmittelknappheit oder von einer Bevorratung von Lebensmitteln für einen eventuellen Kriegszustand waren trotz der beschriebenen aktuellen politischen Meldungen nicht zu finden. Im lokalen Teil beschäftigte sich der Anzeiger stattdessen mit allgemeinen sozialen und kulturell-gesellschaftlichen Inhalten. So thematisierten die unbekannten Autoren beispielsweise das Handwerk, Kino und Theater, Telefongebühren, Ziehung der Klassenlotterien und vieles mehr für den Bereich Wasserburg aber auch für umliegende Gebiete. Weiterhin gab es bis Ende Juli 1914 Meldungen von verschiedenen Volksfesten, die in Wasserburg und Umkreis stattfanden.3 Lediglich eine sich Anfang Juni 1914 ausbreitende Maul- und Klauenseuche in der Gemeinde Erharting, in Mühldorf und Griesstätt und weiterhin Mitte dieses Monats in Ebersberg, Traunstein und in der Gemeinde Kienberg sorgte für Beachtung in der Wasserburger Zeitung. Aus diesem Grund kam es zu Aussetzungen von Viehmärken in Wasserburg und Um- Schumacher, M: Land und Politik – Eine Untersuchung über politische Parteien und agrarische Interessen 1914 – 1923, Düsseldorf 1978, S. 33 - 35 3 Die Kunstgewerbeabteilung. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (04. Juni 1914), S. 1 - 2 Der geänderte Telephongebührentarif. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914), S. 1 Preußisch=Süddeutsche Klassenlotterie, Ueber das Kinotheater In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914), S. 6 Zur Plätzeversteigerung In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (27. Juni 1914), S. 3 2 7 gebung in diesem Zeitraum.4 Am 25. Juni 1914 bemerkte der Anzeiger, dass sich die Fleisch- und Milchpreise durch die anhaltende Seuche gegenüber den Vorjahren verändert hatten. Zudem war das Jahr 1914 aufgrund von fluktuierenden klimatischen Verhältnissen von einer schlechten Ernte gekennzeichnet.5 Trotz dieser unvorhergesehenen Störungen in der Land- und Forstwirtschaft waren in nahezu allen Ausgaben der letzten beiden Monate vor Kriegsausbruch immer wieder Werbungen für verschiedene Lebensmittel enthalten. So wurden neben Fleisch, Kaffee und Gemüse (insbesondere Kartoffeln) auch verschiedene Getränke zum Kauf angepriesen.6 Die in der Auswertung herausgestellten Fakten in der Berichterstattung des „Wasserburger Anzeigers“ lassen den Schluss zu, dass vor Kriegsanbruch noch keine Lebensmittelknappheit vorherrschte. Auch eine massive Bevorratung von Lebensmittel schien es noch nicht gegeben zu haben. Vermutlich hatten die Meldungen des Wasserburger Lokalblattes, welche nicht konkret von möglichen kriegerischen Handlungen in Deutschland sprachen, auch dazu beigetragen, dass sich die Bevölkerung nicht über den drohenden Weltkonflikt im klaren war. Selbst im Artikel „Vom grossen europäischen Konflikt zwischen Oesterreich & Serbien.“ in der Ausgabe 4 Infolge des Ausbruchs der Maul= und Klauenseuche. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914), S. 1 Maul= und Klauenseuche in Griesstätt. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (09. Juni 1914), S. 2 Von der Klauenseuche umringt In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (18. Juni 1914), S. 2 Viehmärkte in Mühldorf. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (25. Juni 1914), S. 1 Verbotener Viehmarkt. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (04. Juli 1914), S. 6 5 Schlechtes Jahr. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (25. Juni 1914), S. 4 6 Anzeige: Rauchfleisch In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg.(02. Juli 1914), S. 4 Anzeige: Inntal-Quelle In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (04. Juli 1914), S. 8 Anzeige: Billige Lebensmittelpreise. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (09. Juli 1914), S. 7 Anzeige: Kaffee In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (11. Juli 1914), S. 8 Anzeige: Frische, gute Rosenkartoffel! In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (14. Juli 1914), S. 4 8 vom 01. August 1914 wurde die Bevölkerung nicht über die Beteiligung Deutschlands am 1. Weltkrieges am gleichen Tag informiert. 7 Die sprunghaft verbundenen Veränderungen durch diesen Kriegseintritt und die Umstellung der wirtschaftlichen Lage zugunsten des Militärs zwangen die Staatsregierung und die Regierungen der Länder wie auch das Königreich Bayern zu einer tiefgreifenden Organisation der Nahrungsmittelverteilung für die Zivilbevölkerung der Städte und Gemeinden. Um diesen Problem entgegenzuwirken, gründete die Stadtgemeinde Wasserburg einen Fürsorgeausschuss, der sich fortan für eine Bekämpfung der auftretenden Not der Bewohner einsetzte. In wie fern war nun der Ausschuss in der Lage aufgrund der Stellung in der Verwaltungshierarchie seiner Aufgabe gerecht zu werden und wie gelang es ihm, die Nahrungsmittelverteilung für alle bedürftigen Bürger der Stadtgemeinde während des 1. Weltkrieges zu gewährleisten? 3 Der städtische Fürsorgeausschuss von 1914 und die Zentralisierung einer Massenspeisung 3.1 Der Fürsorgeausschuss im verwaltungsrechtlichen Sinne Unter dem Begriff „Verwaltung“ (Administration) wird die Bearbeitung von eigenen oder fremden Angelegenheiten einer Gemeinschaft verstanden. Beispielsweise sind dies die Verwaltung einer Stiftung, eines Mündelvermögens, eines Landgutes oder einer Gemeinde. Im allgemeinen wird die Verwaltung mit der Staatsverwaltung (Regierung) assoziiert. Die Verwaltung des Deutschen Kaiserreiches bestand aus der auswärtigen Verwaltung, Finanzverwaltung, Verwaltung des Heerwesens, Justizverwaltung und Inneren Verwaltung (Landesverwaltung).8 7 Vom grossen europäischen Konflikt zwischen Oesterreich & Serbien. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (01. August 1914), S. 1 8 Verwaltung. In: Meyers Konversations-Lexikon. Band 17, 5. Aufl., Leipzig und Wien 1897, S. 288 9 Deutschland setzte sich aus mehreren Ländern mit Landesregierungen zusammen, in denen einzelne voneinander unabhängige Verwaltungen installiert waren. So gliederte sich Bayern mit dem König als oberstes Organ und seinen Staatsministerien in 8 Regierungsbezirke. In den Regierungsbezirken gab es je eine Kreisregierung mit zwei Kammern (Kammer des Innern und der Finanzen), an deren Spitze ein Regierungspräsident stand. Diesen Kreisregierungen waren u. a. die Bezirksämter unterstellt. Unter diesen Bezirksämtern standen wiederum die Gemeinden, wie auch die Stadtgemeinde Wasserburg. Deren Angelegenheiten wurden durch den Magistrat, welcher als Organ der Gemeinde die Durchführung der Verwaltungsaufgaben übernahm und durch Gemeindebevollmächtigte als Gemeindevertretung geregelt.9 Handelte es sich jedoch um einen Zusammenschluss von Gemeinden, sprach man von Distrikten, deren oberstes Organ der Distriktsrat war und sich aus Vertretern dieser Gemeinden und des reichsten Grundbesitzers zusammensetzte.10 Gemäß Art. 106 Abs. 1 der „Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins“ vom 29. April 1869 (GO 1869) konnten „zur Verwaltung örtlicher Stiftungen und Anstalten, sowie zur Besorgung bestimmter Geschäfte ...“ „... auf Beschluss des Magistrats besondere Ausschüsse aus Mitgliedern des Magistrats oder aus zu Gemeindeämtern wählbaren Gemeindebürgern gebildet werden, deren Auswahl dem Magistrate zusteht.“11 Zu solchen besonderen Ausschüssen zählte vermutlich auch der städtische (Kriegs-)Fürsorgeausschuss in Wasserburg, da dieser nur zu dem 9 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 70; in Erläuterung zu Nr. 4 Art. 70, Ansbach 1912, S. 240 Verwaltung. In: Meyers Konversations-Lexikon. Band 2, 5. Aufl., Leipzig und Wien 1897, S. 619 - 620 10 Geiger, M: Heimat am Inn 1, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Kultur des Wasserburger Landes, Wasserburg am Inn 1980, S. 44 10 Zweck der annähernden Sicherstellung der Lebensqualität der Bevölkerung, also „zur Besorgung bestimmter Geschäfte“ gegründet wurde. Solche Ausschüsse waren laut Abs. 3 des oben genannten Artikels „... dem Magistrate untergeordnet, an dessen Instruktionen gebunden und können von dem Magistrate aufgelöst werden. Der Bürgermeister oder ein von ihm bezeichnetes Magistratsmitglied führt den Vorsitz.“12 In Wasserburg wurde der Ausschuss gemäß Art. 101 Abs. 2 GO 1869 durch den dienstältesten Magistratsrat Herrn Irlbeck in Vertretung des im August 1914 für den Kriegsdienst eingezogenen Bürgermeisters Ertl geleitet.13 Wählbar war gemäß Art. 172 GO 1869 jeder wahlberechtigte Bürger der Gemeinde, welcher das 25. Lebensjahr vollendet und seinen Wohnsitz in der Gemeinde hatte.14 Der Magistrat hatte laut Art. 107 Abs. 1 GO 1869 die Möglichkeit, eine Geschäftsordnung für die ihm untergeordneten Einrichtungen anzuweisen. Als ein solches untergeordnetes Organ wurde der Fürsorgeausschuss aufgefordert, Geschäftsordnung zu erlassen. für seine Arbeit eine Diese wurde vom Magistrat nachgeprüft.15 Unterstellt war der Fürsorgeausschuss also dem Magistrat der Stadtgemeinde Wasserburg und hatte stets seinen Anordnungen zu folgen und im allgemeinen keine eigenen entscheidenden Beschlüsse 11 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 106, Ansbach 1912, S. 304 - 306 12 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 106 Abs. 3, Ansbach 1912, S. 304 - 306 13 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 101, Abs. 2, Ansbach 1912, S. 294 Eine Abschiedssitzung In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg.(15. August 1914), S. 2 14 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 172, Ansbach 1912, S. 411 - 412 15 Magistratssitzung vom 21. August 1914. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (01. September 1914), S. 3 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 107, Abs. 1, Ansbach 1912, S. 306 11 zu fassen. Diese Beschlüsse waren nur dem Magistrat der Stadt vorbehalten, der für die Tätigkeit des Ausschusses verantwortlich war. Trotz seiner untergeordneten Rolle konnte dem Ausschuss eine größere Selbständigkeit erteilt werden.16 So beschloss beispielsweise der Ausschuss am 18. Februar 1915 die Fortführung der Lebensmittelkarten17 oder am 29. Oktober 1914 die Teilübernahme von Entbindungskosten.18 Jedoch wurde ein wichtiger Beschluss des Ausschusses vom 23. September 1915 zur Bewilligung von Ergänzungsunterstützungen für bedürftige Familien vorläufig vom Organ des Distriktes außer Kraft gesetzt.19 3.2 Die Zuspitzung der wirtschaftlichen Lage Durch die politischen Ereignisse, die sich Ende Juli 1914 zuspitzten und schließlich zum Ausbruch des Krieges führten, spürten auch die Einwohner Wasserburgs eine plötzliche Erhöhung der Lebensmittelpreise. Der Stadtmagistrat von Wasserburg erklärte jedoch, dass es für diese Erhöhungen keine Begründung gab, da keine Engpässe vorherrschten „... läßt sich diese Preissteigerung auch nicht voll begründen; insbesondere hätte der an sich unnötige Vorlauf an Lebensmitteln keinen Grund bilden dürfen...“.20 Ebenso berichtete der „Wasserburger Anzeiger“ über eine gute Getreide- und Kartoffelernte für das Jahr 1914. Auch Zucker und Salz waren in ausreichenden Mengen vorhanden.21 Auf der anderen Seite wurde der Kriegsausbruch für Spekulationen mit Nahrungsmitteln missbraucht. So 16 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Erläuterung zu Nr. 1 und 5 Art. 106, Ansbach 1912, S. 305 17 Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des Städtischen Kriegs-Fürsorge-Ausschusses Wasserburg vom 18. Februar 1915., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 18 Beschluss des Fürsorgeausschusses vom 29. Oktober 1914, II-67 Teil 1, StdAWbg./Inn 19 Beschluss des städtischen Kriegsfürsorge-Ausschusses vom 19. Oktober 1915., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 20 Mahnung! In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. August 1914), S. 4 21 Keine Sorge. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (08. August 1914), S. 5 12 versuchten Viehhändler unter dem Vorwand des baldigen Heranrückens des Feindes die Bauern zu überzeugen, ihre Tiere zu niedrigen Preisen an sie zu verkaufen.22 Trotz solcher Verharmlosungen und unseriösen Geschäften warnte beispielsweise die Wasserburger Zeitung die Schweinezucht zur Gewinnung von Schweinefleisch nicht zu vernachlässigen.23 Weiterhin sollte ein Bericht über ausführliche Hinweise für eine sparsame aber gesunde Ernährung sowie die Herstellung von einfachen Gerichten die Bürger auf die aktuelle Krisensituation vorbereiten.24 3.3 Die Gründung des Fürsorgeausschusses Da sich auch die regionalen Politiker darüber im klaren waren, dass die vorhandene Eskalation des angespannten Zustandes in der Welt nun nicht mehr von Deutschland abgewendet werden konnte, war es notwendig geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Versorgung u. a. von Nahrungsmitteln der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Zur Sicherung der Angehörigenfürsorge wurde am 21. August 1914 auf Beschluss der städtischen Kollegien Wasserburgs vom 12. August 1914 ein städtischer Fürsorgeausschuss auf Widerruf eingesetzt, der dem Magistrat der Stadt unterstand. Diese städtischen Kollegien bestanden gemäß Art. 70 GO 1869 aus dem Magistrat und aus Gemeindebevollmächtigten. Der Ausschuss, welcher Ende 1914 in städtischer Kriegsfürsorgeausschuss umbenannt wurde, setzte sich aus Mitgliedern des Magistrates der Stadt Wasserburg, der Gemeindebevollmächtigten, des Armenpflegschaftsrates, des Frauenzweigvereins vom Roten Kreuz und des Privatunterstützungsvereins 22 Preisdrückereien durch Viehhändler. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (15. August 1914), S. 2 - 3 23 Fördert die Schweinezucht. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (15. August 1914), S. 3 13 zusammen. Finanzielle Mittel erhielt er aus dem Gemeindebudget und von der Geldsammelstelle des Roten Kreuzes soweit diese für die Angehörigenfürsorge gedacht waren. Außerdem standen ihm laut Ziffer 4 der Vollzugsanweisung zum Gesetz über die Familienunterstützung Bezüge wie Mietzinszahlungen als Ersatz von Geldunterstützungen zur Verfügung.25 Weiterhin erhielt er Spenden von Privatpersonen, örtlichen Einrichtungen und Opfertagen sowie Zuschüsse von Wasserburger Wohltätigkeitsstiftungen und der Königlichen Regierung Oberbayerns.26 Die Aufgabe dieser Institution war es, die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel gerecht unter der hilfebedürftigen Bevölkerung aufzuteilen. Um einer Zerstückelung dieser Gelder entgegenzutreten, sollte eine solche Fürsorge weitestgehend zentralisiert werden.27 Bald darauf spendeten der Rennverein und die Brauereibesitzer dem Ausschuss 2150 Lebensmittelkarten für Hilfebedürftige. Auf Beschluss vom 29. Oktober 1914 in seiner 2. Sitzung stellte der Ausschuss diese Karten zunächst für 6 Monate überwiegend denjenigen Familien zur Verfügung, deren Kinder nicht die Mahlzeiten einnehmen konnten, die 24 Wie soll man sich im Kriege nähren? In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (20. August 1914), S. 1 25 Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, in Art. 70, Ansbach 1912, S. 240 Magistratssitzung vom 21. August 1914. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (01. September 1914), S. 3 Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des Stadtmagistrats Wasserburg vom 21. August 1914., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 26 Geldspenden In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (27. August 1914), S. 4 Magistratssitzung vom 04. Dezember. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (10. Dezember 1914), S. 3 Geldspenden In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (01. Juli 1916), S. 4 Schreiben der K. Regierung von Oberbayern, Kammern des Innern an Stadtmagistrat Wasserburg vom 18. Dezember 1915 mit Beschluss, II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des städt. Kriegsfürsorgeausschusses Wasserburg vom 3. August 1916., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 27 Magistratssitzung vom 21. August 1914. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (01. September 1914), S. 3 Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des Stadtmagistrats Wasserburg vom 21. August 1914., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 14 in der Suppenanstalt ausgegeben wurden.28 In der darauffolgenden 3. Sitzung vom 03. Dezember 1914 befasste sich der Ausschuss mit der gesetzlich festgelegten Familienunterstützung. Hierzu gehörten beispielsweise Suppenanstalten, Lebensmittelkarten sowie finanzielle Zuschüsse (gesetzliche Ergänzungsunterstützungen). Zusätzlich beschäftigte er sich u. a. mit seinen Aufgaben, d. h. mit der Beschaffung von Lehrmitteln und Schuhen für Kinder, Arzt- und Medikamentenkosten sowie Beerdigungskosten. Der Fürsorge- ausschuss wies in dem Zusammenhang auch auf die erhöhten finanziellen Ausgaben hin und rief im Wasserburger Lokalblatt zu Spenden auf.29 3.4 Die Suppenanstalt für Kinder von 1914 bis 1916 Im Herbst des Jahres Fürsorgeausschuss über 1914 beriet den Aufbau einer der Wasserburger Suppenanstalt für Kinder. Er vereinbarte mit der Frau Oberin des Englischen Instituts, dass diese Verpflegungsstelle in den Räumen des neuen Wasserburger Mädchenschulhauses seinen Betrieb aufnehmen konnte. Die zuvor geplante Nutzung der Turnhalle für die Suppenanstalt erwies sich aufgrund der zu geringen Raumtemperatur und eines zu teuren Unterhaltes als ungeeignet. Diese Anstalt war in erster Linie für diejenigen Kinder gedacht, deren Väter zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Aber auch andere Kinder konnten mit einer Beköstigung rechnen. Die Rationen sollten sich pro Tag und Kind auf 0,45 Liter Suppe und ein kleines Stück Brot im Gesamtwert von 10 Reichspfennig belaufen und wurden gegen Einbehalt von Lebensmittelkarten ausgegeben30 „Vergütet wird vom 28 2. Sitzung des städt. Fürsorgeausschusses. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (07. November 1914), S. 4 Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des städt. Kriegsfürsorgeausschusses Wasserburg vom 29. Oktober 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn 29 Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (10. Dezember 1914), S. 3 30 Schreiben vom 16. September 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Schreiben des Stadtbauamt a. Inn Nr. 225 , II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn 15 Kriegsfürsorgeausschuß pro Kind und Tag 10 Pf. Die Kinder erhalten etwas 0,45 Liter dicke Suppe und eine kleines Stück Brot. Für das Brot erforderliche Mehl müssen die Kinder Marken einliefern.“31 Am 29. September 1914 wandte sich nun der Fürsorgeausschuss in einem Brief an die Königliche Lokalschulinspektion. Hierin bat er um die Aufstellung einer Liste von Kindern von sozial schwachen Familien, die in der Kinderbewahranstalt (Einrichtung für den Tagesaufenthalt für Kinder) und den Wasserburger Schulen gemeldet waren. Hintergrund dieses Anliegens war die prinzipielle Befürwortung der Einrichtung einer Suppenanstalt, bei der die Leitung die Frau Oberin des Englischen Institutes übernehmen sollte „Der städt. Fürsorgeausschuß hat im Prinzipe die Errichtung einer Suppenanstalt für Bewahranstalt und die beiden Volksschulen beschlossen; der Betrieb dieser Einrichtung würde von der Frau Oberin des Engl. Institutes durchgeführt werden.“32 Da die Kosten hilfebedürftiger Kinder der Ausschuss übernahm, entschied er welche Kinder tatsächlich hilfebedürftig waren und welche Gesamtkosten sich für eine solche Verpflegung ergaben.33 Die Inbetriebnahme dieser Suppenanstalt sollte auf Beschluss der Sitzung des städtischen Fürsorgeausschusses vom 29. Oktober 1914 am 16. November 1914 erfolgen. Zu diesem Zweck setzte er sich am 10. November 1914 ein weiteres Mal schriftlich mit der Lokalschulinspektion in Verbindung. Sie wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass anhand ihrer zugearbeiteten Aufstellung 109 Kinder an der Verpflegung teilnehmen durften. Weiterhin bat der Ausschuss um weitere Koordination in Verbindung mit der Leiterin der zu-künftigen Suppenanstalt bezüglich der Umsetzung dieser ersten Einnahme der Verpflegung34 „Diese Kinder bitten wir davon verständigen und ihnen sagen zu lassen, dass sie den Esslöffel jeden 31 Schreiben vom 16. September 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Schreiben des städtischen Fürsorgeausschusses an die Kgl. Lokalschulinspektion vom 29. September 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn 33 Schreiben des städtischen Fürsorgeausschusses an die Kgl. Lokalschulinspektion vom 29. September 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn 34 Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des städt. Fürsorgeausschusses Wasserburg vom 29. Oktober 1914., II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn Schreiben des städt. Fürsorgeausschusses an die Kgl. Lokalschulinspektion vom 10. November 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn 32 16 Tag von zu Hause mitzubringen haben. Die Esszeit bitten wir mit der Frau Oberin des Engl. Institutes zu vereinbaren.“35 Eine Statistik (siehe Anhang Punkt 5.1), die nach Einführung der Suppenanstalt vom Wasserburger Stadtmagistrat geführt und am 16. September 1916 dem Königlichen Bezirksamt vorgelegt wurde, gibt Aufschluss über die Häufigkeit der Inanspruchnahme der Speisenverteilung. In dieser Statistik sind nun einige Schwankungen sichtbar. Wenn man sich die monatliche Summe der ausgegebenen Suppenrationen näher betrachtet, ist im Gründungsjahr 1914 zunächst ein sprunghafter Anstieg der Verpflegungen von 1664 Rationen von einem Monat zum nächsten erkennbar. Dies ist höchstwahrscheinlich auf die erst Mitte des Monats November eröffnete Anstalt zurückzuführen. Auch im Januar 1915 erhöhte sich die Zahl der verteilten Suppen noch einmal leicht um 307 Portionen. Dieser Anstieg kennzeichnet die offensichtliche Annahme dieser Speisenverteilung bei den Kindern. Aber schon im Februar des selben Jahres wurden wieder 342 weniger Suppen verteilt. Der Grund hierfür könnte zum einen der rapide Preisanstieg Stadtmagistrat im der Speisekartoffeln „Wasserburger sein, Anzeiger“ der am durch 11. den Februar veröffentlicht wurde.36 Es ist anzunehmen, dass weniger Kartoffeln eingekauft wurden und somit weniger Zutaten zum Herstellen von Mahlzeiten zur Verfügung standen, durch die die Kinder verköstigt wurden. Zum anderen hatte der Bundesrat am 16. Februar beschlossen, dass die Haferbestände in ganz Deutschland bis auf eine begrenzte Menge für die Zivilbevölkerung zu Gunsten des Krieges beschlagnahmt werden sollten.37 Im März wurden jedoch wieder etwas mehr Rationen in Anspruch genommen. Weiterhin wurde am 15. März eine Brotkartenkontrolle seitens 35 Schreiben des städt. Fürsorgeausschusses an die Kgl. Lokalschulinspektion vom 10. November 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn 36 Bekanntmachung. Höchstpreise für Speisekartoffeln betr. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg.(11. Februar 1915), S. 3 37 Beschlagnahme der Hafervorräte. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. 17 der Regierung beschlossen, die für das damalige gesamte Deutsche Kaiserreich gelten sollte. In der Stadt Wasserburg wurde mit der Ausgabe dieser Karten am 25. März begonnen.38 Im Folgemonat April sank nun die Zahl der ausgegebenen Suppen sprunghaft um 811 Portionen und blieb zum Juni relativ stabil. Diesen Besucherrückgang begründete der Wasserburger Magistrat mit nur mäßig vorhandenen Brot- und Mehlkarten innerhalb der Bevölkerung, so dass viele Kinder die vorgesehenen Mahlzeiten nicht einnehmen konnten.39 Ein weiterer Rückgang der ausgegebenen Rationen trat im Juli ein. Es wurden nur noch 1995 Suppen an die Kinder vergeben. Die Gründe hierfür sind vermutlich bei einer erneuten Kostenerhöhung für Lebensmittel zu suchen. Laut einer Statistik stiegen deren Kosten bis zum Mai durchschnittlich um 45,3 %. Diese Preissteigerung verschärfte sich im Juli deutlich, so dass sich die Verhältnisse der Bevölkerung weiter verschlechterten und die Beschaffung von notwendigen Lebensmitteln für die Suppenanstalt wahrscheinlich negativ beeinflusst wurde.40 Bereits im März wurden von der Königlichen Regierung in Oberbayern erneute Höchstpreise für Speisekartoffeln festgeschrieben, dies berichtete der „Wasserburger Anzeiger“ am 10. Juli.41 Auch setzte am 16. Juli das Wasserburger Bezirksamt neue Höchstpreise für Brot und Mehl mit Wirkung für den 20. Juli fest.42 Auch durch die Tatsache, dass sich die Bevölkerung hauptsächlich in den Sommermonaten durch Ernten des eigenen Anbaus von Obst und Gemüse selbst versorgen konnte, ist der Besucherrückgang der Suppenanstalt vermutlich zu begründen. (16. Februar 1915), S. 3 38 Der Brotkartenzwang. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (13. März 1915), S.3 39 Schreiben vom 16. September 1916, II-59, StdA Wbg./Inn 40 Die Verteuerung der Lebenshaltung. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (24. Juli 1915), S. 3 41 Höchstpreise für Speisekartoffeln. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (10. Juli 1915), S.5 42 Geänderte Mehl= und Brotpreise. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (17. Juli 1915), S. 3 18 In den Monaten November 1915 bis Januar 1916 konnten jedoch wieder beträchtliche Steigerungen an der angebotenen Verpflegung von maximal 3006 ausgegebenen Suppen verzeichnet werden. Im Februar des Jahres 1916 wurden wieder etwas weniger Rationen verteilt. Ein weiterer Rückgang wurde dann noch einmal im April mit 2228 Portionen erkennbar. Die wieder ansteigende Tendenz der Monate Mai und Juni wurde durch die im Juli sinkende Ausgabe an Suppen erneut abgeschwächt. Diese jedoch recht durchschnittlich stabile Abgabe von Suppen ist wahrscheinlich auf die verhältnismäßig gute Aussicht über die Bereitstellung von Lebensmitteln zurückzuführen. Laut eines Berichtes des „Wasserburger Anzeigers“ vom 14. März über eine staatliche Bestandsaufnahme vom Januar des Jahres 1916 beliefen sich die aktuellen Getreidevorräte für das gesamte Kaiserreich auf 400 000 Tonnen. Bei dem Vergleich mit den Reserven des Vorjahres sprach man von der doppelten Menge gegenüber 1915. 43 Am 04. April gab der Stadtmagistrat bekannt, dass zusätzlich Bezugskarten an hilfebedürftige Familien für den kostenlosen Erhalt von Kartoffeln und Grieß abgegeben wurden.44 Eine weitere Verteilung von Bezugskarten für Kartoffeln, die minderbemittelte Familien kostenlos beziehen konnten, wurde vom Stadtmagistrat am 25. Mai veröffentlicht. 45 Weiterhin beschloss der Magistrat auf seiner Sitzung vom 19. Mai, die Mehl- und Brotmarken zukünftig in einem regelmäßigen Zeitraum von 4 Wochen ausgeben zu lassen.46 Auch äußerte sich der Präsident des Kriegsernährungsamtes über die Richtlinien der neuen Wirtschaftsplanung gegenüber der Presse. Er teilte mit, dass sich die Preise für Brotgetreide nicht ändern und sich sogar die Kosten für Gerste und Hafer verringern werden. Schließlich dementierte er vorerst 43 Unsere Brotversorgung ist gesichert. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (14. März 1916), S. 2 44 Kartoffel= und Grießabgabe. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (04. April 1916), S.4 45 Kartoffel=Abgabe. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (25. Mai 1916), S. 4 46 Magistratssitzung vom 19. Mai. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (30. Mai 1916), 19 unter anderem ein plötzliches Verbot über den Fleischverzehr.47 Wenig später kam die Einführung einer Reichsfleischkarte, die der Bevölkerung einen begrenzten Fleischgenuss garantierte.48 Der eigentliche Rückgang der Suppenrationen machte sich ab August bemerkbar. Während im Juli noch 2393 Speisen verteilt wurden, waren es im August nur noch 1181 Portionen. Dies hing offenbar damit zusammen, dass trotz regelmäßiger Ausgabe von Mehl- und Brotmarken diese nicht ausreichend bei den Kindern vorhanden waren. Weiterhin mangelte es trotz der Bemühungen des Magistrats an ausreichenden Lebensmitteln und demzufolge der Zubereitung gehaltvoller Speisen „Der wohltätige Betrieb der Anstalt leidet sehr unter der Anforderung von Mehl und Brotmarken von den Kindern [...] und unter dem Mangel nahrhafter Suppeneinlagen (dicke Suppe nötig).“.49 Im Dezember des Jahres 1916 kam es infolge der Errichtung einer Volksküche, die für die Verpflegung der gesamten Bevölkerung Wasserburgs zuständig war, zur Auflösung der Suppenanstalt. In dieser neuen Institution sollten fortan nicht nur bedürftige Kinder verpflegt werden, sie diente auch für die Speisenversorgung von allen minderbemittelten oder bedürftigen Personen.50 3.5 Die Einrichtung einer Volksküche ab 1916 Wohlfahrtsanstalten wie Volksküchen, bei denen Alleinstehende und unbemittelte Personen preiswert verköstigt wurden, waren keine Erfindung des 1. Weltkrieges, sondern gewannen bereits besonders S. 2 47 Der Krieg. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (29. Juni 1916), S. 1 48 Die Einführung der Reichsfleischkarte In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (04. Juli 1916), S. 2 49 Schreiben vom 16. September 1916, II-59, StdA Wbg./Inn 50 Schreiben der Oberin des Engl. Instituts an den Stadtmagistrat Wasserburg vom 10. November 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Bekanntmachung. Die städt. Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916), S. 3 20 1813 und im Hungerjahr 1816/1817 an Bedeutung. Durch die Tätigkeit der Frauenvereine Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Art der Massenspeisung bekannt. Die erste größere Wohlfahrtsanstalt, die auf dem Prinzip der Selbstfinanzierung beruhte, wurde 1849 in Leipzig gegründet. Später folgten Anstalten in Dresden 1851, in Berlin 1866 sowie viele andere, die die Einrichtung in Leipzig als Vorbild nahmen.51 Am 11. Oktober 1916 wandte sich das Bayerisch Königliche Staatsministerium des Innern in einem Brief an die Kammern des Inneren der Königlich Bayerischen Regierungen. Anlass war ein Schreiben des bayerischen Königs vom 03. Oktober gerichtet an den Staatsminister des Innern zur Erleichterung der Ernährungslage in der Bevölkerung. In diesem Schriftstück befürwortete er die Einrichtung einer zentralen Massenspeisung, die zum Beispiel in Form von Volksküchen mit einer finanziellen Unterstützung von 200 000 Reichsmark gefördert werden sollte. Diese Mittel waren zunächst für die Einrichtungskosten wie Miete, Mobiliar, Geräte u. a. vorgesehen, um einen einwandfreien Betrieb zu garantieren. Für die Abgabe von kostenlosen Speisenrationen waren diese Gelder nicht gedacht. Vorhandene Wohltätigkeitseinrichtungen, die bereits in verschiedenen Gemeinden bestanden und erfolgreich zur Entspannung der Ernährungssituation beigetragen hatten, sollten weiter ihren Dienst verrichten oder erweitert werden. Zusätzlich war nach Meinung des Königs die Gründung von Institutionen für die Verteilung von Speisen an die allgemeine Bevölkerung außerhalb der Armen- oder Wohltätigkeitspflege notwendig. Das Ziel hierbei war eine gerechte Verteilung der vorhandenen Lebensmittel unter Bezugnahme von Rationierungskarten für begrenzt vorhandene Nahrung. Vorschriften 51 Volksküchen. In: Meyers Konversations-Lexikon. Band 17, 5. Aufl., Leipzig und Wien 1897, S. 391 - 392 21 und Richtlinien wurden zunächst nicht erlassen, damit eine freie Entfaltung und ein ungehinderter Betrieb der Küchen gewährleistet werden konnte. Um eine Ausdehnung solcher zentralen Volksküchen im gesamten Bayerischen Königreich zu forcieren, forderte das Staatsministerium des Innern die Regierungen auf, die zur Verfügung gestellten Finanzen in ihren Gemeinden schnellstmöglich bereitzustellen.52 Auch die Kammer des Innern der Königlichen Regierung Oberbayerns rief die Königlichen Bezirksämter des Regierungsbezirks in einem Brief vom 18. Oktober 1916 auf, die Gründungen von Volksküchen voranzutreiben.53 Am 07. November 1916 berichtete nun das Wasserburger Lokalblatt über den gemeinsamen (kreisunmittelbare Städte, Beschluss des Kommunalverbands Distriktgemeinden) und städtischen Kriegsfürsorgeausschusses vom 14. Oktober 1916 für die Errichtung einer Volksküche in Wasserburg zur Sicherung der Verpflegung für die allgemeine Zivilbevölkerung der Stadt. Verband und Ausschuss drangen auf ein zügiges Umsetzen des Beschlusses in die Praxis. In einem weiteren Abschnitt der selben Ausgabe veröffentlichte der „Wasserburger Anzeiger“ die Ausschreibung des städtischen Kriegsfürsorgeausschusses für eine fest angestellte weibliche Arbeitskraft als Köchin in der zukünftigen Volksküche in Wasserburg. Ebenfalls meldete der Anzeiger die Bekanntmachung des Ausschusses über die Inbetriebnahme der städtischen Volksküche Anfang Dezember 1916 im Kosakhaus, eines früheren gut bürgerlichen Lokals in Wasser52 Schreiben des Kgl. Staatsministeriums des Innern an die Kgl. Regierungen, Kammern des Innern vom 11. Oktober 1916, II-59, StdA Wbg./Inn 53 Kgl. Schreiben der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern an die Kgl. Bezirksämter des Regierungsbezirks vom 18. Oktober 1916, II-59, StdA Wbg./Inn 22 burg. Die Räume wurden vom Stadtmagistrat kostenlos zur Verfügung gestellt.54 Die Leitung der neu gegründeten Volksküche übergab der Fürsorgeausschuss an einen Betriebsausschuss, der neben der ehrenamtlichen Oberleiterin Frau Major Eckert u. a. aus Magistratsräten bestand. Zur Buchhaltung wurde eine Kasse eingerichtet, die der Stadtkämmerer Vogler übernahm.55 Die Speisenzusammenstellung sollte nach den Erfahrungen der Münchener Volksküchen erfolgen.56 In München existierten 20 Volksküchen, die täglich bis 22000 Gäste mit gehaltvollen Speisen verpflegten. Ihren Dienst nahmen die Volksküchen bereits im Herbst 1914 auf.57 Um die gewonnenen Erkenntnisse zu multiplizieren, veranstaltete der Bayerische Landesausschuss zur Fürsorgetätigkeit für die Angehörigen der Kriegsteilnehmer vom 20. bis 25. November 1916 einem Lehrgang über Massenspeisungen, bei dem neben Vertretern des Betriebsausschusses Wasserburg weitere 500 Interessierte aus ganz Bayern vor Ort waren. Neben vielen anderen Ideen brachten die Wasserburger Delegierten vermutlich auch Wochenverpflegungspläne mit nach Hause, nach denen die Betreiber der einheimischen Küche sich richten konnten.58 54 Die Errichtung einer Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916), S. 2 Bekanntmachung. besold. Wirtschafterin. u. Köchin; Bekanntmachung. Die städt. Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916), S. 3 Einstimmiger Beschluß des Stadtmagistrats Wasserburg vom 10. November 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Ein Besuch in der Kriegsküche. ; In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (28. Dezember 1916), S. 2 Volkert, W: Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799 – 1980, München 1983, S. 279 55 Sitzung des Kriegsfürsorgeausschusses vom 14. November. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (18. November 1916), S. 2 56 Bekanntmachung. Die städt. Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916), S. 3 57 Die städtische Volksküche dahier. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (11. November 1916), S.3 58 Massenspeisung. In: Bayerische Staatszeitung, II-59, StdA Wbg./Inn, (22. November 1916), S. 7 Sitzung des Betriebsausschusses der städt. Kriegsküche vom 15. Nov. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (18. November 1916), S. 2 23 Ein im Anhang Punkt 5.2 abgedruckter „Speisezettel“ einer Münchener Volksküche gibt einen Überblick über die ausgewählten Gerichte dieser Zeit. Dargestellt wird ein Wochenplan vom 16. Oktober bis 22. Oktober 1916. Der Preis für ein Mittagessen wurde auf 30 Reichspfennig festgesetzt. Eine Wochenkarte kostete 1,80 Reichsmark, für deren Erwerb zusätzlich diverse Lebensmittelkarten abzugeben waren. Besonders arme Personen konnten auf Antrag vom Lieferungsverband (Distrikt) Wasserburg, vom Ortsarmenverband oder vom städtischen Kriegsfürsorgeausschuss sogenannte „Drittel Freikarten“ beziehen, bei denen ca. 66 % des Wertes die Bedürftigen selbst tragen mussten. Diese Karten wurden von wohlhabenderen Bürgern gestiftet. Außerdem konnten die Spender Freikarten selbst erwerben und diese an bedürftige Personen weitergeben. Die offizielle Eröffnung der Volksküche am 18. Dezember 1916 wurde durch den Betriebsausschuss im „Wasserburger Anzeiger“ bekannt gegeben.59 Die Küche wurde versuchsweise zunächst nur von Montag bis Samstag geöffnet. Die Ausgabe von Speisen belief sich in der ersten Woche auf täglich 100 Portionen. Die Gäste waren laut Bericht der Wasserburger Lokalzeitung mit der Qualität des Essens sehr zufrieden.60 Auf Verlangen der Kammer des Innern der Königlichen Regierung von Oberbayern vom 19. Dezember 1916 erstellte das Königliche Bezirksamt Wasserburg am 31. Dezember 1916 einen detaillierten 59 Aufruf! In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916), S. 3 Bekanntmachung. Die städt. Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (21. November 1916), S. 3 Bekanntmachung des Kriegsfürsorgeausschusses; Bekanntmachung des Betriebsausschusses In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (16. Dezember 1916), S. 6 60 Sitzung des Betriebsausschusses der städt. Kriegsküche am 27. Nov. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (30. November 1916), S. 2 Ein Besuch in der Kriegsküche. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (28. Dezember 1916), S. 2 24 Bericht über die Aufwendungen und den Nahrungsmittelbezug der Volksküche. Hieraus ging hervor, dass die Küche mit einer fest angestellten Köchin, Hilfsköchin und einer Gehilfin betrieben wurde. Die Grundnahrungsmittel, die das Personal für die Zubereitung der Gerichte benötigte, welche sich zu gleichen Teilen aus fleischhaltiger und fleischloser Kost zusammensetzten, wurden durch die Freibank bei Fleischwaren und überwiegend vom Kommunalverband geliefert. Auch Einzelhändler und einheimische Gärtner insbesondere ein Kriegsgarten, welcher von Schülern bewirtschaftet wurde, trugen zur Lebensmittelversorgung der Volksküche bei.61 Die Finanzierung der bayerischen Volksküchen erfolgte u. a. aus bereitgestellten Mitteln des Königs von Bayern. So unterrichtete das Königliche Staatsministerium des Innern am 04. Januar 1917 die Kammer des Innern der Königlichen Regierung von Oberbayern schriftlich über die Verteilung der Zuschüsse an die Gemeinden. Danach erhielt die Stadtgemeinde Wasserburg für die Errichtung ihrer Volksküche 900 Reichsmark, die am 10. Januar 1917 an den Stadtmagistrat ausgezahlt wurden. Zusätzlich bekam der Magistrat auf Antrag vom 17. November 1916 für die Deckung von vorfinanzierter Einrichtung einen Zuschuss von Kreismitteln in Höhe von 400 Reichsmark vom Königlichen Bezirksamt Wasserburg.62 Das Königliche Staatministerium des Innern wies in einem Scheiben vom 07. Februar 1917 die Kammern des Innern der Königlichen Regierungen und Kommunalverbände Bayerns daraufhin, dass ein 61 Schreiben der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern an K. Bezirksamt, Wasserburg vom 19.Dezember 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Bericht des K. Bezirksamtes an die Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern vom 31. Dezember 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Schreiben des K. Staatsministerium d. Innern an K. Regierungen; Kammern des Innern und die Kommunalverbände vom 22. Oktober 1918, II-59, StdA Wbg./Inn Schreiben an den Ausschuß für örtliche Angehörigenfürsorge in Wasserburg vom 05. Dezember 1917, II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 62 Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an die K. Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern vom 04. Januar 1917, II-59, StdA Wbg./Inn Schreiben des K. Bezirksamtes Wasserburg an den Stadtmagistrat Wasserburg vom 25 Zwang zur Teilnahme an der Massenspeisung nicht durchsetzbar ist. Trotz allem wurden die Gemeinden ermutigt, bei denen die Notwendigkeit einer Massenspeisung für das kommende Frühjahr vorlag, diese vorzubereiten. Die daraufhin entstandenen und bereits existierenden Volksküchen erwiesen sich als erfolgreich und wurden von der Bevölkerung dankend angenommen. Auch für das Folgejahr trugen die zentral eingerichteten Massenspeisungen, wie auch die Wasserburger Volksküche entscheidend dazu bei, dass Ernährungsschwierigkeiten innerhalb der Bevölkerung überwunden werden konnten. Nicht unbeachtet sollten hierbei die im Jahr 1917 guten bis sehr guten Kartoffelerträge aus den Ernten der Landwirtschaft bleiben, die den Küchen die Zubereitung der Speisen erleichterte.63 In einem Schreiben vom 22. Oktober 1918 an die Kammern des Innern der Königlich Bayerischen Regierungen und Kommunalverbände lobte das Königlich Bayerische Staatsministerium des Innern die Leistungsfähigkeit der Massenspeisungen. Es wies aber auch auf die in Zukunft verstärkte zusätzliche Belastung der Zentralküchen in den Städten und Gemeinden mit hoher Bevölkerungspopulation hin. Denn aufgrund des zu erwartenden Kriegsendes und der daraus folgenden Rückkehr vieler Soldaten aus dem Kriegsdienst war es zu erwarten, dass es zum sprunghaften Anstieg Bevölkerung kommen der mit Lebensmitteln konnte. Aus einem zu versorgenden solchen daraus resultierenden verstärkten Besuch der Volksküchen auch von Bürgern, die kein Geld hatten sich eine Mahlzeit zu leisten, mussten die Küchen jederzeit vorbereitet sein. Weiterhin erinnerte das Ministerium auch an die rechtzeitige Versorgung mit Hausbrandkohle und Kochgas für die Volksküchen, um eine fortlaufende Verpflegung zu garantieren. Abschließend wiederholte das Ministerium nochmals „... das Gesuche um Zuschüsse für die Einrichtung und Erweiterung von Volksküchen 09. März 1917, II-59, StdA Wbg./Inn 63 Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an K. Regierungen, Kammer des Innern und die Kommunalverbände vom 07. Februar 1917, II-59, StdA Wbg./Inn Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an K. Regierungen, Kammer des Innern und die Kommunalverbände vom 22. Oktober 1918, II-59, StdA Wbg./Inn 26 von Gemeinden, Kommunalverbänden und gemeinnützigen Gesellschaften jederzeit eingereicht werden können.“.64 4 Zusammenfassung Die Notwendigkeit einer Organisation zur Nahrungsmittelverteilung für die Bevölkerung der Städte und Gemeinden Deutschlands wurde durch die Eskalation der weltpolitischen Situation im August 1914 notwendig. Die Veränderung der wirtschaftlichen Lage zugunsten des Krieges und der Versorgung des Militärs als oberste Priorität trug im wesentlichen dazu bei, dass nun eine Lösung gefunden werden musste, um die Zivilbevölkerung vor einer Lebensmittelknappheit zu bewahren. Die Überlegungen der Staatsregierung aber auch der Regierungen der Länder mit Hilfe einer Zentralisierung der Massenspeisung möglichen aufkommenden Nahrungsmittelengpässen entgegenzuwirken und somit auch mittellosen Bürgern verpflegen zu können, wurden Realität. Ein Beispiel für die Organisation der Nahrungsmittelvergabe und deren Umsetzung in die Praxis wurde in dieser Arbeit am Beispiel der Stadtgemeinde Wasserburg am Inn im Königreich Bayern näher gebracht. Um nun die Voraussetzung für eine Aufrechterhaltung des Lebensstandards innerhalb der Bevölkerung der Stadt zu schaffen, wurde zunächst am 21. August 1914 ein sogenannter städtischer Fürsorge-ausschuss auf Widerruf unterstand dem Magistrat der gegründet. Stadt Dieser Ausschuss Wasserburg, einer Verwaltungsbehörde auf Gemeindeebene, dessen Mitglieder im wesentlichen ebenfalls Angehörige des Magistrates waren. Die Frage, wie nun der Ausschuss aufgrund seiner Stellung in der Verwaltungshierarchie seiner Aufgabe gerecht werden konnte und wie es ihm später gelang, die Nahrungsmittelversorgung für die bedürftigen 64 Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an K. Regierungen, Kammer des Innern und die Kommunalverbände vom 22. Oktober 1918, II-59, StdA Wbg./Inn 27 Bürger der Stadtgemeinde Wasserburg während des 1. Weltkrieges gewährleisten zu können, kann wie folgt beantwortet werden: Durch seiner zugeteilten Rolle in der Verwaltung war es dem Ausschuss nicht möglich, ohne die Zustimmung des Magistrates entscheidende Beschlüsse zu fassen. Auf der anderen Seite hatte der Magistrat das Privileg, dem Ausschuss eine gewisse eigene Entscheidungsgewalt zu übertragen. Dies wird durch die im Punkt 3.1 angegebenen 3 Beispiele für Beschlüsse des Ausschusses im Jahr 1915 deutlich. Die Aufgabe der neu gegründeten Institution neben diversen anderen Fürsorgepflichten eine gerechte und ausreichende Nahrungsmittelversorgung zu realisieren, bewältigte er in mehreren Teilschritten. Noch im Gründungsjahr 1914 beschloss der Fürsorgeausschuss mit dem Einverständnis des Magistrates die Einrichtung einer Suppenanstalt bei der vorrangig Kinder mittelloser Familien an einer regelmäßigen Verpflegung teilnehmen konnten. Da diese nur eine Wohlfahrtsanstalt mit begrenzten Kapazitäten und vor allem von Spenden abhängig war, wurde sie im Oktober 1916 durch eine komplexere zentrale Massenspeisung ersetzt. Die tung solcher Verpflegungspunkte, nämlich den Errichsogenannten Volksküchen, wurde vom bayerischen König angeregt. Die im ganzen Land wie auch die in Wasserburg eingerichteten Küchen waren Institutionen, bei denen nun alle Bürger der jeweiligen Städte und Gemeinden mit nahrhaften Speisen versorgt werden konnten. Aufgelöst wurde die Wasserburger Volksküche erst - das genaue Datum ist nicht bekannt - nach dem 1. Weltkrieg. Dies lässt den Schluss zu, dass die Zusammenarbeit zwischen Magistrat und Fürsorgeausschuss und die Organisation und Überwachung desselben anscheinend erfolgreich war, da bereits nach kurzer Zeit die Einrichtung einer Suppenanstalt erfolgte. Dieser Verpflegungsstelle war es trotz 28 der zeitweise auftretenden Nahrungsmittelengpässe möglich, die hilfebedürftigen Kinder der Stadtgemeinde Wasserburg ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Dies belegen grundsätzlich die Zahlen aus der im Punkt 5.1 dargelegten Statistik. Mit dem Ersetzen der Anstalt durch die Volksküche, die u. a. regelmäßige finanzielle Unterstützung seitens der Bayerischen Regierung erhielt, wurde die Verpflegung für alle Bürger der Stadt möglich. Da offensichtlich diese zentrale Einrichtung ihren Betrieb im gesamten Kriegsverlauf nicht einstellte und von der Bevölkerung angenommen wurde, kann die These von einer erfolgreichen Organisation und Koordination der zentralen Massenspeisung des Fürsorgeausschusses unter der Aufsicht des Magistrates der Stadt Wasserburg und damit die konstante Versorgung mit Lebensmitteln der Bevölkerung aufrecht gehalten werden. 29 5 Anhang 5.1 Statistik: Häufigkeit über Inanspruchnahme der Speisenverteilung in der Suppenanstalt von November 1914 bis August 191665 Anzahl der verteilten Speisen monatsweise aufgeschlüsselt von November 1914 bis August 1916: Jahr Monat 1914 November abgegebene Speisen 1730 Dezember 3394 Januar 3701 Februar 3359 März 3525 April 2714 Mai 2763 Juni 2734 Juli 1995 August 1750 September 2048 Oktober 2520 November 3006 Dezember 2870 Januar 2751 Februar 2473 März 2428 April 2228 Mai 2589 Juni 2673 Juli 2393 August 1181 1915 1916 30 5.2 Speisezettel einer Münchener Volksküche vom 16. Oktober bis 22. Oktober 191666 „Speisezettel“ „vom Montag, den 16. Oktober mit Sonntag, den 22. Oktober 1916.“ „Montag, den 16. Oktober 1916.“ „Gerstengrützsuppe.“ „4 Pfund Gerstengrütze, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfund Nährhefe, für 50 Grün-zeug, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Kartoffeln mit Schwammerl.“ „50 Pfund Kartoffeln, 3/4 Pfund getrocknete Schwämme (auch frische), 5 Pfund Brennmehl, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Dienstag, den 17. Oktober 1916.“ „Grüne Suppe.“ „Für 1 Mark Kräutl oder dergleichen, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfund Nährhefe, 5 Pfund Mehl oder 10 Pfund Kartoffeln, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Grießpolenta mit Obst.“ „20 Pfund zur Hälfte Grieß und Polenta, 35 L Milch oder 3 Pfund Trockenmilch, 4 Pfund Zucker, 1/2 Pfund Butter, 5 Pfund Marmelade oder 20 Pfund frisches Obst.“ 65 Schreiben vom 16. September 1916, II-59, StdA Wbg./Inn Speisezettel vom Montag, den 16. Oktober mit Sonntag, den 22. Oktober 1916., II-59, StdA Wbg./Inn 66 31 „Mittwoch, den 18. Oktober 1916.“ „Brennsuppe.“ „4 Pfund Brennmehl, Gewürz“ „Gemüse mit Wurst.“ „40 Pfund Gemüse, 20 Pfund Kartoffeln, 10 Pfund Wurst, 1/2 Pfund Fett, 5 Pfund Mehl, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Donnerstag, den 19. Oktober 1916.“ „Grießsuppe.“ „3 Pfund Grieß, 5 Pfund Kartoffeln, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfd Nährhefe, für 50 Pfennig Grünzeug, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Lunge, Gekröse oder Euter mit Kartoffeln.“ „20 Pfund Lunge oder dergleichen,1/2 Pfund Fett, 5 Pfund Brennmehl, 50 Pfund Kartoffeln, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Freitag, den 20. Oktober 1916.“ „Kohlsuppe.“ „10 Pfund Weißkraut, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfund Nährhefe, 5 Pfund Mehl, Kümmel, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Nudeln oder Makkaroni mit Brösel.“ „25 Pfund Nudeln, 1 1/2 Pfund Fett, Brösel.“ 32 „Samstag, den 21. Oktober 1916.“ „Polentasuppe.“ „4 Pfund Polenta, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfund Nährhefe, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Sauerkraut oder grünes Gemüse mit Fleischknödeln.“ „50 Pfund Sauerkraut oder 40 Pfund Gemüse, 20 Pfund Kartoffeln, 1/2 Pfund Fett, 4 Pfund Mehl, 10 Pfund Brat, 7 Pfund Knödelbrot, 2 Pfund Grieß, 4 Eier, 2 Pfund Zwiebeln, viel Grünzeug.“ „Sonntag, den 22. Oktober 1916.“ „Erbsenmehlsuppe.“ „4 Pfund Erbsenmehl, 1/2 Pfund Fett, 1 Pfund Nährhefe, für 50 Grün- zeug, 1 Pfund Zwiebeln.“ „Sauerbraten mit Kartoffeln.“ „15 Pfund Rindfleisch, 5 Pfund Brennmehl, 1/2 Pfund Fett, 50 Pfund Kartoffeln, 1 Pfund Zwiebeln.“ 33 6 Abkürzungsverzeichnis Abs. Absatz Art. Artikel d. h. das heißt Engl. Englisch GO 1869 Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 Jhrg. Jahrgang K. Königlich Kgl. Königlich Pf. Pfennig S. Seite städt. städtisch StdA Wbg./Inn Stadtarchiv Wasserburg/Inn u. a unter anderem z. B. zum Beispiel 34 7 Quellen- und Literaturverzeichnis 7.1 Quellen 7.1.1 Gedruckte Quellen a. Die Kunstgewerbeabteilung. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (04. Juni 1914) b. Der geänderte Telephongebührentarif. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914) c. Preußisch=Süddeutsche Klassenlotterie In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914) d. Ueber das Kinotheater In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914) e. Infolge des Ausbruchs der Maul= und Klauenseuche. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. Juni 1914) f. Maul= und Klauenseuche in Griesstätt. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (09. Juni 1914) g. Von der Klauenseuche umringt In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (18. Juni 1914) h. Viehmärkte in Mühldorf. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (25. Juni 1914) i. Schlechtes Jahr. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (25. Juni 1914) j. Zur Plätzeversteigerung In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (27. Juni 1914) k. Anzeige: Rauchfleisch In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (02. Juli 1914) l. Verbotener Viehmarkt. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (04. Juli 1914) m. Anzeige: Inntal-Quelle In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (04. Juli 1914) n. Anzeige: Billige Lebensmittelpreise. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg.(09. Juli 1914) 35 o. Anzeige: Kaffee In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (11. Juli 1914) p. Anzeige: Frische, gute Rosenkartoffel! In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (14. Juli 1914) q. Vom grossen europäischen Konflikt zwischen Oesterreich & Serbien. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (01. August 1914) r. Mahnung! In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (06. August 1914) s. Keine Sorge. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (08. August 1914) t. Eine Abschiedssitzung In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (15. August 1914) u. Preisdrückereien durch Viehhändler. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (15. August 1914) v. Fördert die Schweinezucht. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (15. August 1914) w. Wie soll man sich im Kriege nähren? In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (20. August 1914) x. Geldspenden In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (27. August 1914) y. Magistratssitzung vom 21. August 1914. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (01. September 1914) z. 2. Sitzung des städt. Fürsorgeausschusses. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (07. November 1914) aa. Magistratssitzung vom 04. Dezember. In: Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (10. Dezember 1914) bb. Wasserburger Anzeiger, 76. Jhrg. (10. Dezember 1914) cc. Beschlagnahme der Hafervorräte. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (16. Februar 1915) dd. Der Brotkartenzwang. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (13. März 1915) ee. Höchstpreise für Speisekartoffeln. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (10. Juli 1915) ff. Geänderte Mehl= und Brotpreise. In: Wasserburger Anzeiger, 36 77. Jhrg. (17. Juli 1915) gg. Die Verteuerung der Lebenshaltung. In: Wasserburger Anzeiger, 77. Jhrg. (24. Juli 1915) hh. Unsere Brotversorgung ist gesichert. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (14. März 1916) ii. Kartoffel= und Grießabgabe. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (04. April 1916) jj. Kartoffel=Abgabe. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (25. Mai 1916) kk. Magistratssitzung vom 19. Mai. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (30. Mai 1916) ll. Der Krieg. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (29. Juni 1916) mm. Geldspenden In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (01. Juli 1916) nn. Die Einführung der Reichsfleischkarte In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (04. Juli 1916) oo. Bekanntmachung. Die städt. Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916) pp. Die Errichtung einer Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916) qq. Bekanntmachung. besold. Wirtschafterin. u. Köchin In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916) rr. Aufruf! In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (07. November 1916) ss. Die städtische Volksküche dahier. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (11. November 1916) tt. Sitzung des Kriegsfürsorgeausschusses vom 14. November. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (18. November 1916) uu. Sitzung des Betriebsausschusses der städt. Kriegsküche vom 15. Nov. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (18. November 1916) vv. Bekanntmachung. Die städt. Volksküche In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (21. November 1916) 37 ww. Massenspeisung. In: Bayerische Staatszeitung, II-59, StdAWbg./Inn, (22. November 1916) xx. Sitzung des Betriebsausschusses der städt. Kriegsküche am 27. Nov. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (30. November 1916) yy. Bekanntmachung des Kriegsfürsorgeausschusses; Bekanntmachung des Betriebsausschusses In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (16. Dezember 1916) zz. Ein Besuch in der Kriegsküche. In: Wasserburger Anzeiger, 78. Jhrg. (28. Dezember 1916) 7.1.2 Ungedruckte Quellen a. Schreiben des Stadtbauamt a. Inn Nr. 225 , II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn b. Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des Stadtmagistrats Wasserburg vom 21. August 1914., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn c. Schreiben des städtischen Fürsorgeausschusses an die Kgl. Lokalschulinspektion vom 29. September 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn d. Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des städt. Kriegsfürsorgeausschusses Wasserburg vom 29. Oktober 1914, II-67 Teil 2, StdA Wbg./Inn e. Beschluss des Fürsorgeausschusses vom 29. Oktober 1914, II67 Teil 1, StdA Wbg./Inn f. Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des Städtischen KriegsFürsorge - Ausschusses Wasserburg vom 18. Februar 1915., II67 Teil 1, StdA Wbg./Inn g. Beschluss des städtischen Kriegsfürsorge - Ausschusses vom 19. Oktober 1915., II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn h. Schreiben der K. Regierung von Oberbayern, Kammern des Innern an Stadtmagistrat Wasserburg vom 18. Dezember 1915 mit Beschluss, II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 38 i. Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des städt. Kriegsfürsorgeausschusses Wasserburg vom 3. August 1916. , II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn j. Schreiben vom 16. September 1916, II-59, StdA Wbg./Inn k. Schreiben des Kgl. Staatsministeriums des Innern an die Kgl. Regierungen, Kammern des Innern vom 11. Oktober 1916, II-59, StdA Wbg./Inn l. Kgl. Schreiben der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern an die Kgl. Bezirksämter des Regierungsbezirks vom 18. Oktober 1916, II-59, StdA Wbg./Inn m. Speisezettel vom Montag, den 16. Oktober mit Sonntag, den 22. Oktober 1916., II-59, StdA Wbg./Inn n. Schreiben der Oberin des Engl. Instituts an den Stadtmagistrat Wasserburg vom 10. November 1916, II-59, StdA Wbg./Inn o. Einstimmiger Beschluß des Stadtmagistrats Wasserburg vom 10. November 1916, II-59, StdA Wbg./Inn p. Schreiben der Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern an K. Bezirksamt, Wasserburg vom 19. Dezember 1916, II-59, StdA Wbg./Inn q. Bericht des K. Bezirksamtes an die Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern vom 31. Dezember 1916, II-59, StdA Wbg./Inn r. Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an die K. Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern vom 04. Januar 1917, II-59, StdA Wbg./Inn s. Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an K. Regierungen, Kammer des Innern und die Kommunalverbände vom 07. Februar 1917, II-59, StdA Wbg./Inn t. Schreiben des K. Bezirksamtes Wasserburg an den Stadtmagistrat Wasserburg vom 09. März 1917, II-59, StdA Wbg./Inn u. Schreiben an den Ausschuß für örtliche Angehörigenfürsorge in Wasserburg vom 05. Dezember 1917, II-67 Teil 1, StdA Wbg./Inn 39 v. Schreiben des K. Staatsministerium des Innern an K. Regierungen, Kammer des Innern und die Kommunalverbände vom 22. Oktober 1918, II-59, StdA Wbg./Inn 7.2 Literatur a. Drost, K / Wünsche, W: Der erste Weltkrieg – Erscheinung und Wesen, 1989 b. Geiger, M: Heimat am Inn 1, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Kultur des Wasserburger Landes, Wasserburg am Inn 1980 c. Helmreich, K / Rock, K: Handausgabe der Bayerischen Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 mit Erläuterungen, Ansbach 1912 d. Meyers Konversations-Lexikon. Band 2, 5. Aufl., Leipzig und Wien 1897 e. Meyers Konversations-Lexikon. Band 17, 5. Aufl., Leipzig und Wien 1897 f. Schumacher, M: Land und Politik – Eine Untersuchung über politische Parteien und agrarische Interessen 1914 – 1923, Düsseldorf 1978 g. Volkert, W: Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799 – 1980, München 1983 8 Erklärung Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig verfasst und das keine anderen als die angegebenen Quellen von mir benutzt wurden. Datum: 09.01.2004 Unterschrift: 40