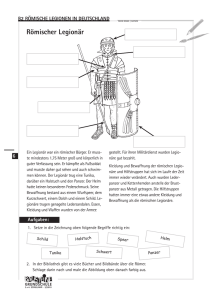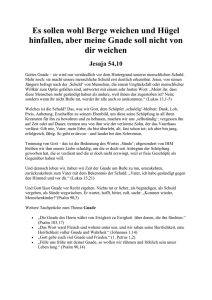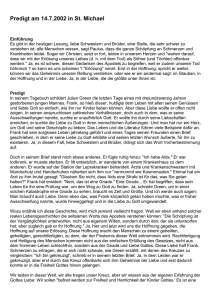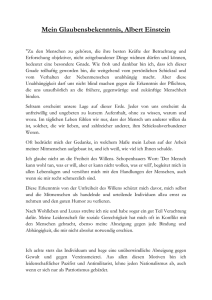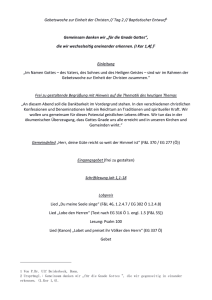Abenteuer Legionsapostolat (P. Alkuin - Legion
Werbung
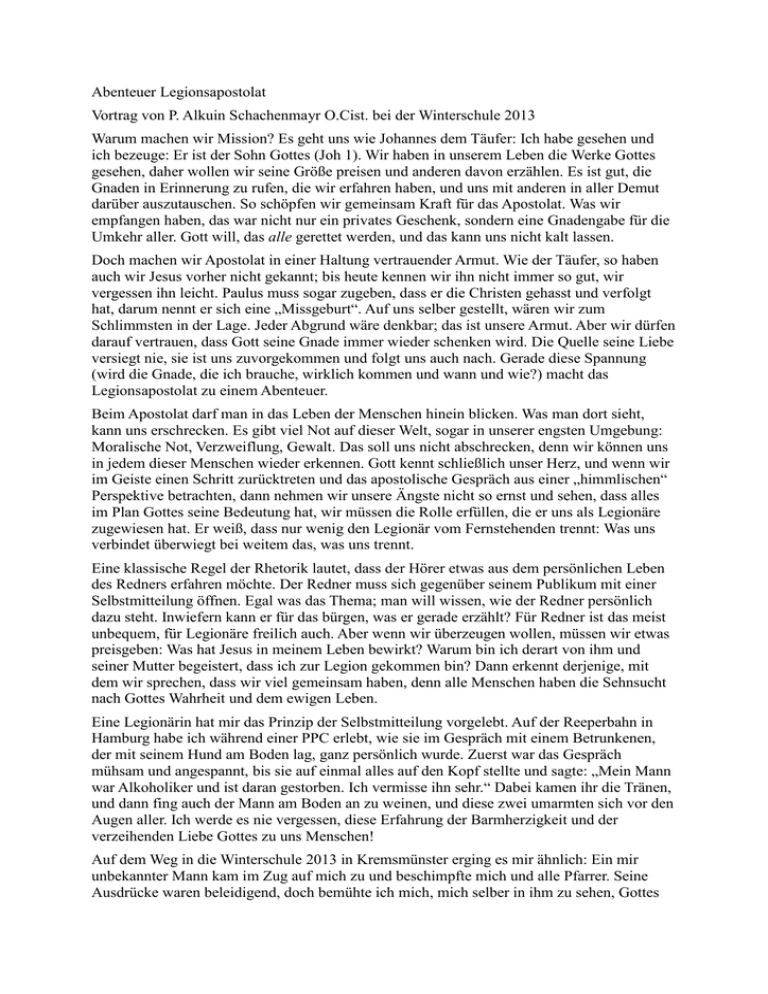
Abenteuer Legionsapostolat Vortrag von P. Alkuin Schachenmayr O.Cist. bei der Winterschule 2013 Warum machen wir Mission? Es geht uns wie Johannes dem Täufer: Ich habe gesehen und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes (Joh 1). Wir haben in unserem Leben die Werke Gottes gesehen, daher wollen wir seine Größe preisen und anderen davon erzählen. Es ist gut, die Gnaden in Erinnerung zu rufen, die wir erfahren haben, und uns mit anderen in aller Demut darüber auszutauschen. So schöpfen wir gemeinsam Kraft für das Apostolat. Was wir empfangen haben, das war nicht nur ein privates Geschenk, sondern eine Gnadengabe für die Umkehr aller. Gott will, das alle gerettet werden, und das kann uns nicht kalt lassen. Doch machen wir Apostolat in einer Haltung vertrauender Armut. Wie der Täufer, so haben auch wir Jesus vorher nicht gekannt; bis heute kennen wir ihn nicht immer so gut, wir vergessen ihn leicht. Paulus muss sogar zugeben, dass er die Christen gehasst und verfolgt hat, darum nennt er sich eine „Missgeburt“. Auf uns selber gestellt, wären wir zum Schlimmsten in der Lage. Jeder Abgrund wäre denkbar; das ist unsere Armut. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott seine Gnade immer wieder schenken wird. Die Quelle seine Liebe versiegt nie, sie ist uns zuvorgekommen und folgt uns auch nach. Gerade diese Spannung (wird die Gnade, die ich brauche, wirklich kommen und wann und wie?) macht das Legionsapostolat zu einem Abenteuer. Beim Apostolat darf man in das Leben der Menschen hinein blicken. Was man dort sieht, kann uns erschrecken. Es gibt viel Not auf dieser Welt, sogar in unserer engsten Umgebung: Moralische Not, Verzweiflung, Gewalt. Das soll uns nicht abschrecken, denn wir können uns in jedem dieser Menschen wieder erkennen. Gott kennt schließlich unser Herz, und wenn wir im Geiste einen Schritt zurücktreten und das apostolische Gespräch aus einer „himmlischen“ Perspektive betrachten, dann nehmen wir unsere Ängste nicht so ernst und sehen, dass alles im Plan Gottes seine Bedeutung hat, wir müssen die Rolle erfüllen, die er uns als Legionäre zugewiesen hat. Er weiß, dass nur wenig den Legionär vom Fernstehenden trennt: Was uns verbindet überwiegt bei weitem das, was uns trennt. Eine klassische Regel der Rhetorik lautet, dass der Hörer etwas aus dem persönlichen Leben des Redners erfahren möchte. Der Redner muss sich gegenüber seinem Publikum mit einer Selbstmitteilung öffnen. Egal was das Thema; man will wissen, wie der Redner persönlich dazu steht. Inwiefern kann er für das bürgen, was er gerade erzählt? Für Redner ist das meist unbequem, für Legionäre freilich auch. Aber wenn wir überzeugen wollen, müssen wir etwas preisgeben: Was hat Jesus in meinem Leben bewirkt? Warum bin ich derart von ihm und seiner Mutter begeistert, dass ich zur Legion gekommen bin? Dann erkennt derjenige, mit dem wir sprechen, dass wir viel gemeinsam haben, denn alle Menschen haben die Sehnsucht nach Gottes Wahrheit und dem ewigen Leben. Eine Legionärin hat mir das Prinzip der Selbstmitteilung vorgelebt. Auf der Reeperbahn in Hamburg habe ich während einer PPC erlebt, wie sie im Gespräch mit einem Betrunkenen, der mit seinem Hund am Boden lag, ganz persönlich wurde. Zuerst war das Gespräch mühsam und angespannt, bis sie auf einmal alles auf den Kopf stellte und sagte: „Mein Mann war Alkoholiker und ist daran gestorben. Ich vermisse ihn sehr.“ Dabei kamen ihr die Tränen, und dann fing auch der Mann am Boden an zu weinen, und diese zwei umarmten sich vor den Augen aller. Ich werde es nie vergessen, diese Erfahrung der Barmherzigkeit und der verzeihenden Liebe Gottes zu uns Menschen! Auf dem Weg in die Winterschule 2013 in Kremsmünster erging es mir ähnlich: Ein mir unbekannter Mann kam im Zug auf mich zu und beschimpfte mich und alle Pfarrer. Seine Ausdrücke waren beleidigend, doch bemühte ich mich, mich selber in ihm zu sehen, Gottes Liebe zu ihm selber nachzuempfinden, und begann zu erzählen, warum ich katholisch bin und Priester wurde. Daraufhin beruhigte er sich und teilte mir bald mit, dass er 12 Jahre im Gefängnis war. Als ich ihn fragte, wo er aussteigen wollte, sagte er: Kremsmünster. Wir hatten also doch viel gemeinsam, sogar dasselbe (Reise-) Ziel! Diese Extrembeispiele zeigen, dass ein apostolisches Gespräch nie umsonst sein kann. Jeder Mensch hat eine unstillbare Sehnsucht nach Gott. Freilich sind viele verwirrt und wollen diesen Durst an den falschen Quellen stillen, doch die Sehnsucht ist da und wir selbst sind genauso sehnsüchtig danach. Wenn wir in einem Gespräch mit einem Fernstehenden nur etwas von Gottes Liebe in aller Ehrlichkeit und Bescheidenheit vermitteln können, ist unser Gesprächspartner seinem Lebensziel ein Schritt näher gekommen. Es kann also nichts schief gehen, auch im Fall einer Ablehnung ist etwas Gutes geschehen. Das Handbuch sagt uns, dass eine Ablehnung niemals als Misserfolg, sondern verzögerter Erfolg zu sehen ist, weil der Legionär etwas von seiner Sehnsucht mit anderen Sehnsüchtigen geteilt hat, weil hier eine übernatürliche Tür geöffnet wurde. Noch mehr: Es ist uns möglich, die Ablehnung aus der übernatürlichen Perspektive dankbar anzunehmen, weil sie für uns sogar wertvoller sein kann als eine harmonisches Begegnung. Wie geht das? Wenn wir das angespannte, unfreundliche Gespräch als Buße hinnehmen (HB 261 und 382). Die meisten von uns hätten viel vor dem Herrn wieder gut zu machen. Ein Betrachtungsvorschlag: Hat uns Gott in diesem unangenehmen Gespräch vielleicht mit uns selber konfrontiert? Wie würden wir auf einen Legionär reagieren, wenn wir nicht Gottes Gnade erfahren hätten? Von dieser Gnade wollen wir erzählen.