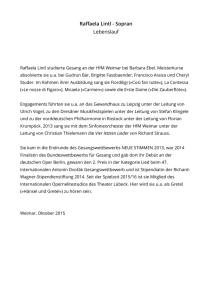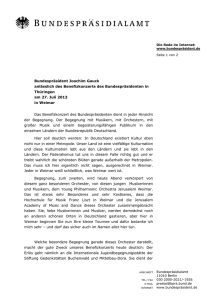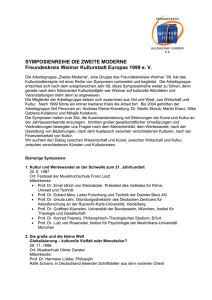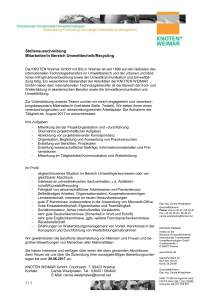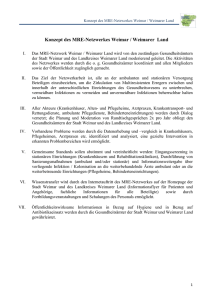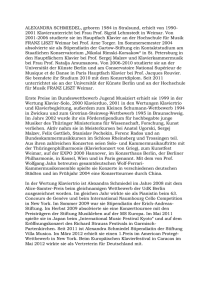Nicht Weimar?
Werbung
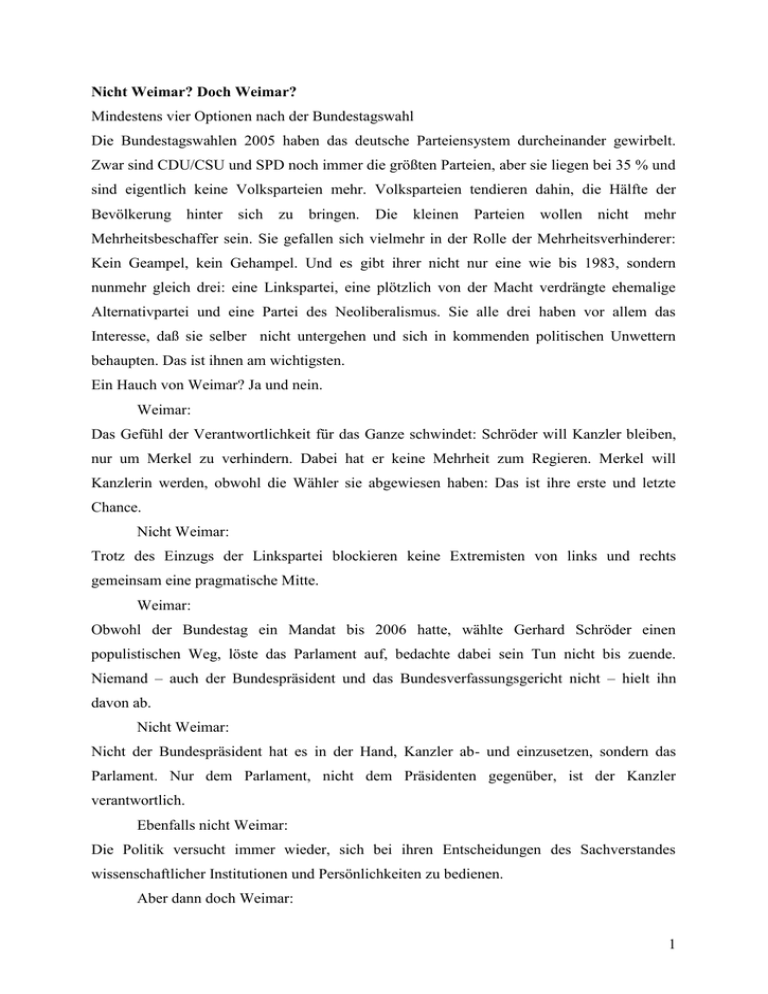
Nicht Weimar? Doch Weimar? Mindestens vier Optionen nach der Bundestagswahl Die Bundestagswahlen 2005 haben das deutsche Parteiensystem durcheinander gewirbelt. Zwar sind CDU/CSU und SPD noch immer die größten Parteien, aber sie liegen bei 35 % und sind eigentlich keine Volksparteien mehr. Volksparteien tendieren dahin, die Hälfte der Bevölkerung hinter sich zu bringen. Die kleinen Parteien wollen nicht mehr Mehrheitsbeschaffer sein. Sie gefallen sich vielmehr in der Rolle der Mehrheitsverhinderer: Kein Geampel, kein Gehampel. Und es gibt ihrer nicht nur eine wie bis 1983, sondern nunmehr gleich drei: eine Linkspartei, eine plötzlich von der Macht verdrängte ehemalige Alternativpartei und eine Partei des Neoliberalismus. Sie alle drei haben vor allem das Interesse, daß sie selber nicht untergehen und sich in kommenden politischen Unwettern behaupten. Das ist ihnen am wichtigsten. Ein Hauch von Weimar? Ja und nein. Weimar: Das Gefühl der Verantwortlichkeit für das Ganze schwindet: Schröder will Kanzler bleiben, nur um Merkel zu verhindern. Dabei hat er keine Mehrheit zum Regieren. Merkel will Kanzlerin werden, obwohl die Wähler sie abgewiesen haben: Das ist ihre erste und letzte Chance. Nicht Weimar: Trotz des Einzugs der Linkspartei blockieren keine Extremisten von links und rechts gemeinsam eine pragmatische Mitte. Weimar: Obwohl der Bundestag ein Mandat bis 2006 hatte, wählte Gerhard Schröder einen populistischen Weg, löste das Parlament auf, bedachte dabei sein Tun nicht bis zuende. Niemand – auch der Bundespräsident und das Bundesverfassungsgericht nicht – hielt ihn davon ab. Nicht Weimar: Nicht der Bundespräsident hat es in der Hand, Kanzler ab- und einzusetzen, sondern das Parlament. Nur dem Parlament, nicht dem Präsidenten gegenüber, ist der Kanzler verantwortlich. Ebenfalls nicht Weimar: Die Politik versucht immer wieder, sich bei ihren Entscheidungen des Sachverstandes wissenschaftlicher Institutionen und Persönlichkeiten zu bedienen. Aber dann doch Weimar: 1 Ein anerkannter Rechtsgelehrter und ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichtes wird aus politischer Opportunität heraus zum „verrückten Professor“ herabgewürdigt, der den Menschen mit Monster-Ideen den Alltag verderben wolle. Im Prinzip nicht Weimar: Die Presse hat viele Freiheiten im Lande und nutzt diese, seit der „Spiegel“-Affäre ziemlich unbehelligt von der Politik, weitgehend aus. Doch auch da Weimar: Pressefreiheit ist vor allem etwas für den privilegierten Berufsstand der Journalisten. Die Privilegiertesten von ihnen sind beim Fernsehen und haben mittlerweile einen elitären Status okkupiert, aus dem Selbstüberschätzung wird: Ein durch nichts legitimierter Journalist nimmt sich in aller Öffentlichkeit heraus, den Inhaber des politisch wichtigsten Amtes mit Benimmregeln zu schmähen. Das tut er jetzt, da der Kanzler angeschlagen ist. Und ein Karrierepolitiker der nächsten Generation setzt nach: Ich bin zwar jünger als Sie, aber nicht blöder. Wehe jedem gefallenen Politiker: Die gestern noch so devote Meute zerfetzt ihn. Derweil gibt es mindestens 5 Millionen Arbeitslose im Lande, und weitere Millionen fürchten, gefeuert zu werden, weil Manager Rezepte gefunden zu haben glauben, aus Unternehmen binnen kurzer Zeit günstigere Aktienkurse herauszupressen zu können. Zugleich bringt das Land keine Entscheidungen zustande, weil noch bei jedem Gesetz regionale Ministerpräsidenten von überall her mitreden dürfen. Obendrein ist das Verhältnis zur wichtigsten Macht der Welt, den einst im Lande so angehimmelten USA, die Deutschland vom Terror befreit haben, zerrüttet. Aber Schröder klebt am Amt, weil er sich besser findet als Frau Merkel. Frau Merkel will jetzt Kanzlerin werden, weil sie es sonst nie würde. Lafontaine triumphiert, weil er Schröder düpiert hat. Westerwelle verweigert sich, weil er seine Partei festgelegt und damit seine Fehler von 2002 korrigiert hat. Stoiber lauert, weil es ihn nach Revanche für die Niederlage von 2002 dürstet. Sie alle sind Egomanen und Abhängige von den Drogen Publizität und Macht. Da verwundert es, daß ausgerechnet Joschka Fischer Verantwortung für das Ganze zu zeigen scheint und sich nicht hineinziehen läßt in den Clinch der auf der Bühne Angekommenen. Parteien haben unter anderem die Aufgabe, das Führungspersonal der Republik zu rekrutieren. Es scheint, sie bringen oft die Falschen nach oben und vor die Fernsehkameras. Wer dahin kommen will, der muß kungeln, durchstechen, diffamieren und intrigieren können. Nicht der originellste Kopf, nicht der Lebenserfahrenste setzt sich durch, sondern der 2 Eindimensionale, der mit großer Brutalität nur seine Meinung gelten läßt und jeden um sich herum „abschießt“, der anders argumentiert. Sicher muß ein Bundeskanzler sich durchsetzen, Intriganten zuvorkommen und sich selber ins rechte Licht rücken können. Aber um die Probleme eines Landes anpacken zu können, bedarf es mehr: eines politischen Zieles, das bekannt ist. Zu dessen Erreichbarkeit gehört die Fähigkeit, Weggefährten um sich zu versammeln, die - wenn sie es für richtig halten - widersprechen. Vielleicht brauchen wir statt des Bundesrates doch einen Senat, bestehend aus „Elder Statesmen“, unabhängigen Wissenschaftlern, Künstlern oder Wirtschaftlern, der Vorschläge macht für die politischen Spitzenpositionen. Vielleicht brauchen wir bei den Abgeordneten doch die Rotation – nach zwei Wahlperioden – damit sich keine abgehobene Politikerkaste herausbildet. Zunächst aber müssen die anderen „Spitzen“-politiker außer Fischer zur Räson kommen, bedenken, daß sie dem Gemeinwesen dienen müssen und entsprechend handeln. Konkret heißt das: Schröder und Merkel – alle beide – müssen das Feld räumen. Sie haben ihre Wahlziele nicht erreicht. Andere – vielleicht Koch und Steinbrück – müssen übernehmen und eine große Koalition führen, die dann aber nicht nur die Wirtschaft reformiert, sondern auch das politische System: Die Politikverflechtung muß aufhören, und die Vorschläge der Föderalismuskommission gehören wieder auf den Tisch. Das Wahlrecht muß reformiert werden, damit es klare Mehrheiten gibt, Rotation stattfindet und die Wähler über Vorwahlen an der Kandidatenaufstellung beteiligt werden. Das Verhältnis zu den USA muß wieder normalisiert werden. Das alles sind große Aufgaben, die eine große Koalition rechtfertigen würde. So käme das Land voran. Die zweitbeste Lösung könnte „Jamaika“ heißen. Union, FDP und Grüne würden die großen politischen Reformen zwar nicht schaffen, aber sich doch um wichtige wirtschaftliche Veränderungen kümmern. Dazu müßten sich vor allem die Grünen bewegen. Aber sie haben ja schon unter Schröder gezeigt, daß sie zu vielem fähig sind. Aus der linken Partei würde endgültig eine bürgerliche Gruppierung. An die Stelle Herrn Trittins würde Frau Scheel treten. Herr Bütikofer hat gezeigt, daß er anpassungsfähig und geschickt genug ist, dergleichen hinzukriegen. Und Fischer war der einzigste Staatsmann in der Berliner Runde am 18. September. Es könnte also gehen. Optimal wäre es, wenn die Union für diese Lösung eine Persönlichkeit wie Töpfer als Kanzler stellte. Die Zukunft der Grünen danach freilich wäre ungewiß: „Ungewiß“ aber heißt nicht „vorbei“. Mit welcher Legitimation aber schließen Politiker andere Konstellationen aus? Die „Ampel“ ist eben nicht nur eine rechnerische, sondern auch eine politische Option. Zwar hat es Westerwelle geschafft, dass diese Option nicht ohne einen abermaligen Umfall der FDP 3 verwirklicht werden könnte. Aber die FDP ist auch 1961 umgefallen und hat überlebt. Eine Ampel würde – immerhin – den Schröderschen Reformkurs fortsetzen können. Schließlich ist auch eine Mehrheit der Linken möglich: Das Volk hat halt so gewählt. SPD, Grüne und Linkspartei könnten sich verabreden, es zu wagen, den Sozialstaat zu retten, ohne die Wirtschaft zu gefährden. Durch die Wahl ist auch die Linkspartei in der Pflicht zur Verantwortung, und persönliche Animositäten bei grünen und SPD-Politikern können kein Grund sein, eine politische Option zu verteufeln. Dennoch sind die große Koalition an erster oder Jamaika an zweiter Stelle die naheliegendsten Lösungen: Das Land braucht jetzt politische Mehrheiten für große oder kleine Reformen. Große Reformen wären besser. Versäumten die Politiker es, das eine oder das andere oder das ganz andere zu schaffen, ginge es weiter Richtung Weimar. Die Schuld läge bei den Gewählten, nicht bei den Wählern: Die haben mindestens vier Optionen geschaffen, wie regiert werden könnte. Jürgen Dittberner 4