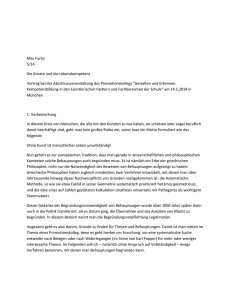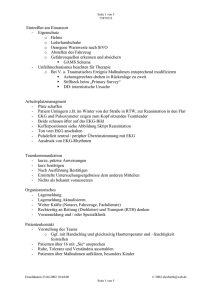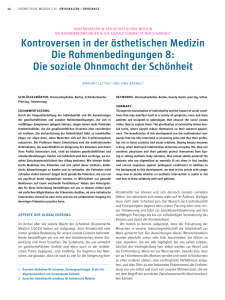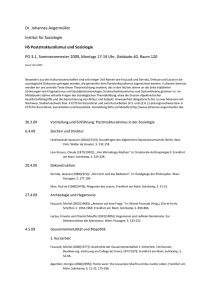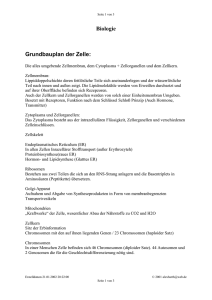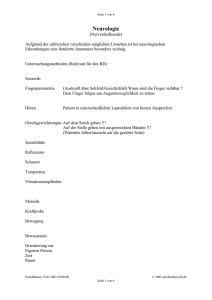- Max Fuchs
Werbung
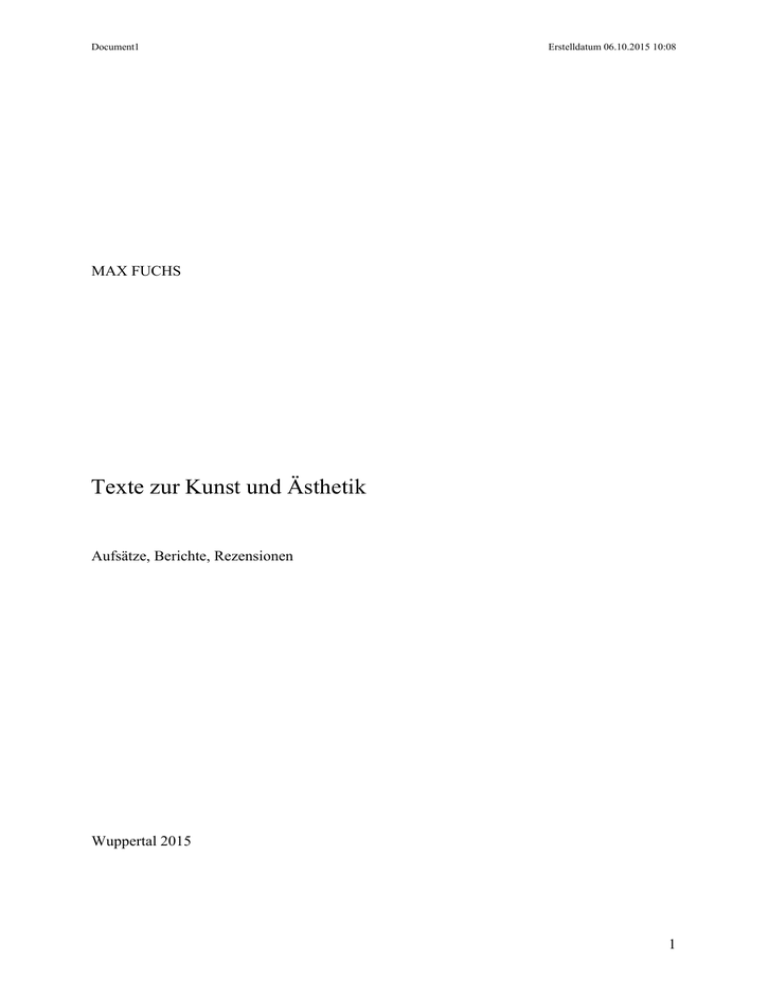
Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 MAX FUCHS Texte zur Kunst und Ästhetik Aufsätze, Berichte, Rezensionen Wuppertal 2015 1 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung 3 Teil 1: Kunsttheorie und Ästhetik Wozu Kunst? 5 Autonomie der Kunst 60 Die Formung des Menschen 79 Darwin und die Kunst 118 Einige Dinge, die man über Kunst und Ästhetik wissen könnte 122 Ethik und Ästhetik – Thesen 124 Kunst und Ästhetik 127 Künste wirken, aber wie? 173 Teil 2: Berichte, Rezensionen, Kontexte Die documenta XI 178 Die documenta XII 184 Die documenta XIII 189 Die Wohlgesinnten (Jonathan Littell) 192 2 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Sind wir jemals modern gewesen (Thomas Mann) 197 Künste wirken, aber bei wem? 207 Kulturpädagogik und die Freiheit (Michel Foucault) 218 Der Schriftsteller und die Gesellschaft 233 Von der Notwendigkeit der Kulturpädagogik (Theaterpädagogik) 238 3 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Vorwort Die in dieser Textsammlung zusammengestellten Texte aus den letzten Jahren befassen sich mit unterschiedlichen Künsten und mit verschiedenen Aspekten von Kunst und Ästhetik. Es handelt sich um Artikel, Vorträge, Rezensionen und Berichte, die in unterschiedlichen Zeitschriften veröffentlicht bzw. die zu unterschiedlichen Gelegenheiten gehalten wurden. Sie ergänzen meine systematischen Überlegungen zur Kunst und Ästhetik (bzw. haben diese vorbereitet), die etwa in den Büchern „Die Macht der Symbole“ (2008) oder „Kunst als kulturelle Praxis“ (2012) dargestellt worden sind. 4 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 TEIL 1: Kunst und Ästhetik Wozu Kunst? Zur sozialen und individuellen Funktion und Wirkung von Kunst Arbeitsmaterialien zum Modellprojekt „Schlüsselkompetenzen erkennen und bewerten“ der BKJ (Stand 6/01, einige Abbildungen fehlen)) 0. Abstract 1. Problemstellung 2. Kunst: Ein symbol- und zeichentheoretischer Zugang 3. Anthropologie der Sinne und der Künste – ein Ausblick 4. Der soziale Gebrauch der Künste – Kulturfunktionen 5. Der Mensch im Mittelpunkt: Kompetenzen als Teil der Persönlichkeit 6. Anhang: Einzelne Künste und spezielle Kulturpädagogiken – Hinweise 6.1 Allgemeines 6.2 Die Macht der Bilder 6.3 Theater als symbolische Form 6.4 Musik, Bildung und der Mensch 7. Literatur Abstract Der vorliegende Text hat zum Ziel, pädagogische Wirkungen einer künstlerischen Praxis zu verstehen und beschreiben zu helfen. Es werden dazu Erkenntnisse aus unterschiedlichen Wissens- und Reflexionsfeldern zusammengetragen. Insbesondere werden anthropologische, philosophische und kunsttheoretische Aussagen zu dem Konzept der „Kulturfunktionen“ verdichtet, die wiederum – in Bezug auf den Einzelnen – als „Bildungsfunktionen“ gedeutet 5 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 werden. Diese werden zu dem Konzept der Kompetenz in Beziehung gesetzt, das eine Schlüsselstellung bei der Frage der pädagogischen Wirksamkeit einnimmt. Denn der Kompetenzbegriff erfasst Bildung und Persönlichkeitsentwicklung aus der Sicht der Stärken, Fähigkeiten und kreativen Möglichkeiten des einzelnen Menschen in seinem sozial-kulturellen Kontext. 1. Problemstellung Die Ästhetikerin Annemarie Gethmann-Siefert (1995) beendet ihre „Einführung in die Ästhetik“ mit der Bekräftigung der „kulturellen Relevanz der Künste“. Damit meint sie deren unverzichtbare Rolle in einer spezifisch menschlichen Kultur“ (ebd., S. 268). Später präzisiert sie diese Rolle als Aufgabe bei der „Gestaltung der Natur zum Zweck der Einrichtung des Menschen in einer menschlichen, ihm gemäßen Welt.“ (ebd.)1. Kunst hat also eine Kulturfunktion, die mit einer oft oberflächlich verstandenen Rede von ihrer Autonomie eher überdeckt wird2. Diese hier genannte Kulturfunktion, die Kunst als „Kulturmacht“ übernehmen muss, wird später ausdifferenziert und um weitere Kulturfunktionen ergänzt. Der Grundgedanke dieses Textes lässt sich jedoch hieran festmachen: Es geht mir darum, in einer tour d’Horizon – also eher skizzenhaft und essayistisch – das Feld der Kunsttheorien zu durchmessen, um weitere Anhaltspunkte zu finden, die als Nachweis für die Erfüllung der Kulturfunktionen von Kunst gelten können3. Diese Unternehmung ist in zweierlei Richtung relevant: Im Hinblick auf den Einzelnen ergibt sich die Frage nach den Bildungswirkungen eines Umgangs mit Kunst und einer ästhetischen Praxis. Dahinter steckt die Idee, dass gesellschaftliche Kulturfunktionen je individuell gelebt und realisiert werden müssen. Da Bildung als subjektive Seite der Kultur betrachtet werden kann, werden (soziale) Kulturfunktionen zu (individuellen) Bildungsfunktionen. Eine pädagogische Wirkungsforschung hat daher die Aufgabe, diese möglichen Kunst-Wirkungen zu erforschen. Im Hinblick auf die Gemeinschaft hängt die Legitimierung einer gesellschaftlichen Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Kunstsystems u. a. davon ab, dass der Nachweis der kulturellen Relevanz der Künste gelingt. Dies muss insbesondere die Kunst- und Kulturpolitik interessieren, die ständig auf der Suche nach überzeugenden Gründen für ein finanzielles Engagement von Öffentlicher Hand und Privaten sind (Fuchs 2001). Der Schwerpunkt des vor- Damit sagt Gethmann-Siefert mit anderen Worten, dass Kunst eine Rolle bei der „kulturellen Verfasstheit des Menschen“ spielt; vgl. Fuchs 1999. 2 Zu diesem schwierigen Topos und seiner politischen Wirkungsgeschichte siehe Nipperdey 1994 und Bollenbeck 1994. Die philosophische Grundlegung erfasst in der „Kritik der Urteilskraft“ I. Kant (1890) unter dem Stichwort: Zweckmäßigkeit ohne Zweck. 1 6 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 liegenden Textes betrifft die erstgenannte (individuumsbezogene) Fragestellung. Daraus erklären sich auch einzelne Abschnitte. Ich diskutiere Kunst als spezifische „symbolische Form“ im Sinne von Ernst Cassirer (1953/54; 1990). Dies heißt insbesondere, dass die Anthropologie der Künste berührt wird. Diese anthropologische Orientierung bringt es mit sich, dass Fragen der Menschenbilder relevant werden. Man kann heute geradezu eine anthropologische Wende in unterschiedlichen Disziplinen und Diskursen feststellen (die freilich nicht immer unter diesem Label zu finden sind). So stellten UNO/UNESCO in den letzten Jahren ihre Programmatik unter das Motto „Das Subjekt im Mittelpunkt“, weil erkannt worden ist, dass es letztlich die einzelnen Menschen sind, die die abstrakten Politikvorschläge in ihrer täglichen Lebenspraxis umsetzen müssen, sollen diese Programme nicht scheitern (DUK 1999; Our Creative Diversity 1995). Im UNO-Kontext entstanden daher auch hochreflektierte Anthropologieentwürfe – etwa von A. Sen und M. Nussbaum (1993) und ihrer Arbeitsgruppe zur Lebensqualität -, da nur durch eine präzisierte Vorstellung dessen, was Menschsein ausmacht, vertretbare Kriterien etwa bei Verteilungsfragen in der Entwicklungshilfepolitik zu gewinnen sind. Dass Humanwissenschaften ein reflektiertes Menschenbild benötigen, liegt auf der Hand. Aber auch in Feldern, in denen bislang ganz andere Ansatzweisen dominierten, rücken Fragen des Menschenbildes in den Mittelpunkt des Interesses. Neben der Managementlehre (Woll 1994, Matthiesen 1995) ist es etwa die Soziologie, bei der nicht nur der Mensch, sondern insbesondere das spezifische Bild des Menschen interessant wird. So wird zunehmend das verbreitete Konzept des Menschen als „rationales Entscheidungswesen“ als unzulänglich gesehen, da die Relevanz der Emotionen, des Willens und der Einstellungen als mindestens ebenso bedeutungsvoll für das alltägliche Handeln betrachtet werden wie die Rationalität des Menschen (Wahl 2000). Hier ist eindeutig eine Entwicklung hin zu einem komplexeren Menschenbild festzustellen, das sehr viel realitätsnäher ist als die bisherigen Konstrukte. Insbesondere in Hinblick auf meine kunstbezogene Fragestellung sind solche komplexen Menschenbilder die Voraussetzung dafür, die Relevanz der Kunst in Bezug auf den Menschen überhaupt in den Blick nehmen zu können. Allerdings stellt sich dann sofort – gerade in Deutschland – ein neues Problem. Im Zuge der Postmoderne ergab sich nicht nur eine Rehabilitation des Ästhetischen gegenüber der Vernunft: Dem Ästhetischen wurde sogar – als „dem Anderen der Vernunft“ – der Vorrang gegeben4. Diese Tendenz hat gerade in Deutschland eine lange Tradition. Denn im Zuge eines kultur- und zivilisationskritischen Diskurses seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde politisch, 3 Weitere Ausführungen zur Kunst, auf die ich mich hier stütze, finden sich in meinen Büchern Fuchs 1994, 1999 (Symbole) und in Fuchs/Liebald 1995. 4 Zur Bilanzierung siehe das Themenheft „Postmoderne“ des Merkur, Heft 9/10 1998. 7 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 epistemologisch und anthropologisch die Aufklärung als Ursache für menschenunwürdige Zustände bewertet – mit dem Höhepunkt in der „Dialektik der Aufklärung“ von Horkheimer/Adorno (1971). Als Gegenbewegung quer durch das gesamte Geistesleben entstand die Romantik, wobei vernunftorientierte Autoren der „Dialektik der Aufklärung“ die „Dialektik der Romantik“ entgegenstellten. Ein wichtiges Beispiel ist etwa die polemische Kampfschrift „Die Zerstörung der Vernunft“ von Georg Lukacs (1983/84). Da die Künste und das Ästhetische in diesem Romantik-Diskurs im Mittelpunkt stehen, sind sie auch in das Zentrum eines hochgradig ideologischen Streites geraten (Klinger 1995). Dies hat zur Folge, dass alle unsere Begriffe und Kategorien, die eine philosophische oder kunsttheoretische Relevanz haben, nahezu hoffnungslos in ihrer Semantik von diesem ideologischen Streit überlagert werden. Wer heute daher versucht, reale Wirkungen und Funktionen von Kunst in Bezug auf Gesellschaft und Einzelnen zu untersuchen, steht vor der fast aussichtslosen Lage, diese Bedeutungsschichten entwirren zu müssen. Im folgenden versuche ich, zumindest einige Zugangsmöglichkeiten aufzuzeigen und Werkzeuge bereitzustellen, die in diesem Prozess hilfreich sein könnten5. 2. Kunst: Ein symbol- und zeichentheoretischer Zugang Eine erste Annäherung an Kunst gewinne ich im Kontext der Philosophie der symbolischen Formen von Ernst Cassirer (1990; vgl. auch Langer 1979). Cassirer arbeitet die Relevanz des Symbols für den Menschen – und nur für ihn – heraus, wobei das „Symbol“ eine Verbindung zwischen einem (sinnlich wahrnehmbaren) Gegenstand, Ding oder Prozess und einer vom Menschen geschaffenen „Bedeutung“ erfasst. Symbole sind von unterschiedlichster Art: Werkzeuge und Waffen, Worte und Bilder, Sprache und Geld begleiten die Menschwerdung, so dass Cassirer verschiedene „symbolische Formen“ als Weltzugangsweisen unterscheiden kann6: Mythos, Sprache, Religion, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Technik. Jede dieser symbolischen Formen ist notwendig, weil zwar jede das Ganze in den Blick nimmt, dies aber jeweils auf spezifische Weise tat (Cassirer spricht von verschiedenen „Brechungswinkeln“ – vgl. Fuchs, 1999). Symbolische Formen sind unterschiedlich nah am Menschen bzw. am Gegenstand, auf den sie sich beziehen. Bei Künsten insgesamt gibt es eine vergleichsweise große Nähe zum Subjekt und dessen innerer Befindlichkeit. Allerdings nicht in 5 Ich knüpfe hierbei an (auch) mentalitätsgeschichtlich orientierte Studien wie der zur Geschichte der IchKonzepte (Fuchs 2001) an. 6 Ähnlich auch Goodman 1990. 8 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 der oft vorgestellten simplen Verständnisweise von Kunst als bloßem individuellen Gefühlsausdruck, sondern als Ausdruck „verallgemeinerter Gefühle“: In der künstlerischen Expressivität finde ich mich mit meiner eigenen Emotionalität als Teil des Gattungswesens Mensch wieder. Die Partikularität des Individuums wird im Erleben der Allgemeinheit der Gattung aufgehoben7. Ich komme darauf zurück. Das Symbol ist als zweistellige Relation (zwischen Artefakt und Bedeutung) eingeführt worden. Ich greife zur Ausdifferenzierung dieser Relation auf ein semiotisches Zeichenmodell zurück, das sich als nützliches Werkzeug gerade im Hinblick auf Wirkungen und Funktionen von Kunstwerken und -prozessen erweist8. Man stelle sich ein Kunstwerk (Bild, Roman, Musikstück, Tanz, Theateraufführung etc. vor). All dies sind zunächst sinnlich fassbare Dinge und Prozesse: Man kann sie sehen, hören, riechen, vielleicht sogar fühlen und schmecken. Die „syntaktische Dimension“ erfasst die Art und Weise der ästhetischen Gestaltung, die Formsprache, die Gestaltungsmittel. Der oben vorgestellte Bedeutungsaspekt, das also, was als Interpretation auf dieses Artefakt bezogen wird, geht in der „semantischen Funktion“ auf. Diese unterteilt man gelegentlich in Semantik i.e.S. und Sigmatik, wenn man eine Abbildrelation, also ein dargestelltes Objekt, auf das sich das Kunstwerk bezieht, identifizieren kann. Nun fallen Kunstwerke nicht vom Himmel – sie werden hergestellt. Einige Definitionen von Kunst verlangen zudem, dass nur eine rezipierte Kunst als solche bezeichnet wird: Die „pragmatische Dimension“ bringt explizit die Menschen – Produzenten und Rezipienten – ins Spiel. Es ist offensichtlich, dass diese Unterscheidung verschiedener semiotischer Funktionen bloß analytisch ist: Denn der Mensch nimmt Kunst durch die Brille angeeigneter Bedeutungsstrukturen wahr, die wiederum abhängig sind von den verwendeten Stil- und Gestaltungsmitteln. Schematisch stellt sich die Situation dar wie in Abb. 1. So einfach dieses Schema auch ist: es lassen sich bestimmte kunsttheoretische Sachverhalte und Ansätze daran erläutern. So kann man in der kunsttheoretischen Debatte eine Verschiebung feststellen – von einer eher objektivistischen Sichtweise, die ausschließlich das Kunstwerk und seine immanente Gestaltung betrachtet, über eine größere Betonung der Rolle des Künstlers – auch als Autorität für die Deutung seines eigenen Werks – bis zur Dominanz des In diesen Kontext gehört auch der Gedanke, dass jeder einzelne Mensch – auf besondere Art – die gesamte Gattung repräsentiert. Bei Lukacs heißt es: „In der ästhetischen Kartharsis gelangt das partikuläre Alltagsindividuum zum Selbstbewusstsein der Menschgattung. Die Kunst wird zur Erinnerung der Menschheit, zum sich objektivierenden, weltschaffenden, geschichtlichen Gedächtnis.“ (Lukacs 1972; vgl. auch Holz 1996 ff.). So ähnlich auch der Musiker und Psychologe Holzkamp bei seiner Beschreibung von Musikwirkungen; s. u. 8 Semiotik ist inzwischen ein verbreitetes Instrumentarium in der Kunstanalyse; vgl. etwa Fischer-Lichte 1988, Schmieder 1980 sowie die Schriften von Umberto Eco zur Literatur und insgesamt zur Kulturanalyse; siehe auch Fuchs 1999. 7 9 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Publikums, der Rezeption: Das Kunstwerk entsteht diesen Ansätzen zufolge geradezu erst in den Köpfen der Rezipienten. Damit wäre eine Subjektorientierung gegeben, die sich etwa an der Konjunktur von Kategorien ablesen lässt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen: etwa seine ästhetische Erfahrung oder das „Erlebnis“ im Umgang mit Kunst. Anders gehen solche Ansätze vor, die den ästhetischen Gegenstand in den Mittelpunkt stellen. Diese versuchen, mit unterschiedlichsten Methoden (informationstheoretischen, phänomenologischen etc.) diesen Gegenstand präzise so zu beschreiben, dass eine „Ontologie des Ästhetischen“ entsteht. 9 Abb. 1: Semiotik des Kunstwerks Semantik: Bedeutung, Interpretationen Syntax: Gestaltungsmittel Formensprache Kunstwerk oder -prozess (physikalischer Träger) Sigmatik: Bezugsmotiv, Gegenstand (falls vorhanden) Pragmatik Produzent Rezipient Die jüngste Entwicklung – sehr deutlich etwa in den Cultural Studies – erweitert den Rezipienten-Ansatz um die Einbeziehung des sozialen und kulturellen Kontextes: Hier untersucht man sehr stark die soziale und kulturelle Prägung der Rezipienten als Basis ihres Kunstzugangs und ihrer ästhetischen Praxis (Hepp/Winter 1997; Hörning/Winter 1999) (Abb. 2). Abb. 2: Subjekt, Objekt und die Kunst gesellschaftlicher Kontext ästhetische Syntax 9 Es gibt unzählige kunsttheoretische Ansätze; vgl. etwa die Textsammlung Henrich/Iser 1997 sowie Pochat 1986 und 1983. Zwischen Subjekt und Werk vermittelnde Positionen gehen etwa davon aus, dass es auf evolutionärem Weg zu einer Art Homologie zwischen der Naturgeschichte menschlicher Rezpetionsvermögen und sachbezogener („ontologischer“) Strukturbildung gekommen ist; so etwa H.H. Holz in seiner Philosophie der Bildenden Kunst. 10 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Subjekt (schafft „Bedeutung“) ästhetischer Schein ästhetischer Gegenstand/Prozess der Rezeption subjektbezogene Kategorien: Sinnlichkeit ästhetische Erfahrung Geschmack Leib Anschauung Erlebnis Ontologie des Ästhetischen Im Hinblick auf die unterschiedlichen Disziplinen, die sich mit den Künsten befassen, lassen sich grob folgende Zuordnungen treffen: Die speziellen Kunstwissenschaften (also Musik-, Tanz-, Theater- etc.-wissenschaft) haben einen Schwerpunkt in der immanenten Betrachtung der Kunstwerke und der Entwicklung der Sparten. Die Psychologien der Künste untersuchen – gelegentlich auch in historischer Perspektive – die subjektiven Aneignungs- und Rezeptionsweisen. Ästhetik wird – oft – als philosophische Reflexionstheorie der Kunst betrachtet. Kultur- und Kunstsoziologie untersuchen den sozialen Gebrauch der Künste; sie sind die genuinen Wissenschaften von den „Kulturfunktionen“ der Künste. Aufgabe der Kultursoziologie ist u. a. die Untersuchung des spezifischen Feldes, in dem sich der jeweilige Kunstbetrieb entfaltet. Die Pädagogiken (der Kunst-Sparten) befassen sich mit (Bildungs-)Funktionen und Wirkungen der Künste. Noch relativ neu ist eine Zivilisationsgeschichte der Künste, die in historischer Perspektive sowohl die immanente Entwicklung der Künste, als auch ihren Bezug zu sozialkulturellen Entwicklungen der Gesellschaft darstellt (Abb. 3). 10 10 Vgl. etwa Fischer-Lichte 2000, Klein 1992 oder Kaden 1993. 11 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 3: Kunst, Kultur, Bildung Theorien der Künste Kulturfunktionen (in der Geschichte) Theorien der Kunstpädagogiken (Musik, Tanz, ...) Bildungsfunktionen Teil des FELDES (i.S. von P. Bourdieu): System von Akteuren und ihren Beziehungen (Künstler, Vermittler, Nutzer, Staat, Verbände, Einrichtungen, Zeitschriften ...) 3. Anthropologie der Sinne und der Künste – ein Ausblick Die anthropologische Dimension lässt sich – so wie die Überschrift dieses Abschnittes es tut – in zwei Bereiche aufteilen: die Sinne und die künstlerische Dimension des Menschen.11 Die Sinne – Sehen, Hören etc. – sind mit spezifischen Organen des Menschen verbunden.12 Sie erfassen je spezifische Gegebenheiten und Facetten eines Gegenstandes (gerne auch: sie (re-)konstruieren diese) in einem aktiven Prozess. Ohne dies hier weiter ausführen zu wollen, gilt auch für die Sinne die von Plessner (1976 im Kontext seiner These von der exzentrischen Positionalität des Menschen) ausgearbeitete Überlegung, dass der Grundmodus des menschlichen Lebens seine Reflexivität ist: Der 11 Dies entspricht der Doppelbedeutung von aeisthesis: Wahrnehmung schlechthin und Kunstwahrnehmung. Baumgarten als Begründer der Ästhetik als philosophischer Disziplin hat sich um beides bemüht: die Rehabilitation der Sinne und der Wahrnehmung, aber auch um eine Grundlegung eines einheitlichen Begriffes von Kunst, der die bis dahin – z.T. bloß „mechanischen“ – Künste („artes“ i. S. des Mittelalters) unter einen einheitlichen Begriff packt. Trotzdem ist das Selbstverständnis, zu einem allgemeinen Kunstbegriff zu gehören, bis heute nicht gleichmäßig ausgeprägt: Unter „Kunst“ wird oft genug nur die Bildende Kunst gezählt, und auch die Musik und die Literatur wollen stets gesondert genannt werden. Der Begriff der „performing arts“, der neben Theater auch Tanz und die Musik erfasst, hat sich in Deutschland bislang nicht durchgesetzt. 12 Vgl. das Handbuch „Vom Menschen“ (Wulf 1997), das entsprechende Abschnitte zu der Natur- und Kulturgeschichte der Organe und ihrer Leistungsfähigkeit im historischen Wandel enthält. 12 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Mensch sieht, hört, spürt, riecht etc. einen Gegenstand oder Prozess; gleichzeitig erlebt er sich selbst als Sehenden, Hörenden, Spürenden etc.13 Abb. 4: Reflexivität und Gegenstandsbezug der Sinne KONTEXT: Kultur und Soziales Subjekt mit Organen/Sinnen: Auge/Sehen Nase/Riechen Haut/Fühlen Zunge/Schmecken Ohr/Hören Objekt mit Gegenstandsqualitäten: Visuelles Akustisches … … … Reflexivität der Sinne Künstlerische Aktivitäten Diese sinnlichen Prozesse werden in ästhetisch-künstlerischen Kontexten auf besondere Weise „kultiviert“. Es ist Aufgabe einer Kunsttheorie und Kunstwirkungsforschung, die „Besonderheit“, die Alltagswahrnehmung/Praxis von künstlerischer/ästhetischer Wahrnehmung/Praxis unterscheidet, präziser zu fassen. Spätestens an dieser Stelle ist zudem darauf hinzuweisen, dass das verwendete Persönlichkeitsmodell die eingangs angesprochene Komplexität erfüllen muss, es also Sinnlichkeit und Verstand, Gefühl und Fantasie, Werte und Wille berücksichtigt. Im Vorgriff auf den später zu erläuternden Kompetenzbegriff lässt sich dies modellieren wie in Abb. 5 (in Anlehnung an Graphiken in Erpenbeck/Heyse 1999). Abb. 5: Persönlichkeit, Bewusstheit und Reflexivität „Reflexivität“ dürfte der zentrale Lebensmodus des Menschen sein. Selbst die später aufgeführten Prozessmerkmale menschlicher Lebendigkeit wie Selbstorganisation, Selbststeuerung etc. (Gerhardt 1999) setzen Reflexivität voraus. 13 13 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 bewusstes Verhältnis zu Geschichte und Zukunft (Zeitkompetenz) Wissen Fähigkeiten Fantasie Willen Fertigkeiten bewusstes Verhältnis zu Gesellschaft und Natur (u. a. Sozialkompetenz) Erfahrungen bewusstes Verhältnis zu sich (Selbstkompetenz) Im Hinblick auf die Anthropologie der Künste will ich nur zwei Hinweise geben: Eine erste Hypothese erklärt die Entstehung und Funktion des Ästhetischen mit dem Bewusstwerden der Risiken des Überlebens: Der Mensch braucht ein Medium, das ihm die Bewältigung seiner Emotionen ermöglicht (Neumann 1996). Eine zweite Hypothese stammt von Gehlen (1950). Dieser deutet die Freude des Menschen an „schönen“ Signalen so, dass es solche Signale waren, die er als instinktgebundenes Wesen zwanghaft mit bestimmten festgelegten Handlungen befolgen musste. Befreit von Instinktzwängen erkennt er zwar noch die Signale, muss sie jedoch nicht mehr zwanghaft befolgen: Er erlebt sich in seiner Freiheit – und freut sich. Ästhetischer Genuss ist also letztlich nicht gegenstandsbezogen, sondern der Mensch feiert in seiner Freude am „Schönen“ den Gewinn von Freiheit und damit letztlich sich selber.14 Man muss an dieser Stelle daran erinnern, dass die heutige Trennung von Ästhetik, theoretischer Philosophie/Erkenntnislehre und Moralphilosophie ein junges Ergebnis des sich ausdifferenzierenden philosophischen Systems ist und schon gar nicht eineindeutig mit – ebenfalls als deutlich unterscheidbar angenommenen – Bereichen im menschlichen Hirn korrespondiert. Vielmehr ist von einer Einheitlichkeit sowohl des psychischen Apparates als auch der Philosophie auszugehen, bei der kognitive, emotionale, volitive und motivationale Aspekte 14 So auch die Psychologie des Ästhetischen, die folgende Funktionen des Schönen aufführt: das Schöne erfreut und beglückt, erleichtert Orientierung, bereichert Verhalten und Handeln, erinnert und schafft Rückbindungen (Schurian 1986). 14 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 sich ständig durchmischen. Dies gilt insbesondere für die Frühzeit des Menschen. Hier darf man von Anbeginn an von einer Gleichursprünglichkeit eines theoretischen, moralischen und ästhetischen Verhaltens zur Welt ausgehen. So schreibt der Anthropologe Leroi-Gourhan: „Die ästhetische Sensibilität des Menschen hat ihre Ursprünge in den tieferen Bereichen der viszeralen und muskulären Sensibilität, in der Hautsensibilität, in den Sinnen des Riechens/Schmeckens, Sehens und Hörens, und schließlich auch im intellektuellen Bild, dem symbolischen Reflex des gesamten Empfindungsgeflechtes.“ Und: „Noch die reinste Kunst ist stets in tiefsten Schichten verankert, sie taucht nur mit der Spitze aus jenem Sockel aus Fleisch und Blut hervor, ohne den sie nicht wäre.“ (Zitiert nach Schurian 1986, S. 188). Den erstgenannten Gedanken – ästhetische Expressivität als Mittel zur Stressbewältigung – kann ich nutzen, um einige weitere Elemente der Philosophie der symbolischen Formen in Hinblick auf Kunst zu präzisieren. Die Bewältigung von Emotionen lässt sich als Schaffen von Ordnung – dieses Mal im Inneren des Menschen – begreifen. Dies ist kompatibel mit der Ordnungsfunktion symbolischer Formen in der Außenwelt: Götternamen z. B., so eine frühe Studie von Cassirer (1956), schaffen eine künstlich hergestellte Ordnung in der chaotischen Welt der Naturereignisse. Sie sind Mittel der Benennung, der Repräsentanz, der Beschwörung, der Beeinflussung. Sie strukturieren das Verhältnis des Menschen zur Natur und in der Gemeinschaft. Der Mensch braucht Ordnung und Struktur, und er braucht sie im Hinblick auf den zweiten oben genannten Gedanken, um nämlich Freiheit zu realisieren (Cassirer 1961). Künstlerische Tätigkeit schafft eine solche Ordnung. Ein Kunstwerk oder -prozess ist Kosmos, ist gesetzmäßig gestaltete Ganzheit. Auch andere anthropologische Grundgesetze gelten – z.T. geradezu vorbildlich – für Kunst; ich liste einige auf: der Prozess von Aneignung und Vergegenständlichung der menschlichen Wesenskräfte; der Prozess kumulativer Entwicklung, der dadurch zustande kommt, dass nachfolgende Generationen auf den (vergegenständlichten) Kenntnisstand der vergangenen Generationen aufbauen können („soziales und kulturelles Gedächtnis“); der Prozess der Reflexivität, der in jeder Entäußerung und Objektivierung des Inneren des Menschen dieses für sich und andere kommunikabel macht. Auch der Symbolcharakter, so wie er oben dargestellt wurde, ist in Kunstwerken offensichtlich: die Verbindung von sinnlich wahrnehmbaren Dingen/Prozessen und einer Bedeutung, die dazu führt, das dargestellte, aber nicht vorhandene Objekt präsent zu machen und/oder 15 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 abstrakten Ideen eine gegenständliche Repräsentanz zu geben. Niklas Luhmann, auf den noch zurückzukommen ist, charakterisiert das Kunstsystem dadurch, dass dort mit Kunstwerken kommuniziert wird.15 Die oben vorgestellten Grundideen bestätigen diesen Ansatz: Kunstwerke sind Medien der Kommunikation des Menschen mit sich und mit anderen. Sie sind Gestaltung von Raum und Zeit – freilich je nach Kunstsparte auf unterschiedliche Weise. Kunstwerke sind verdichtete Stellungnahmen zur Welt. Denn in keinem künstlerischen Prozess wird bloß etwas abgebildet16, sondern jede Form von „Abbildung“ enthält eine Bewertung und oft auch eine Aufforderung zum Handeln. Es sind also – bezogen auf die Persönlichkeit – alle Dimensionen angesprochen: Erkennen und Bewerten, Kognition und Emotion, Fantasie und Wollen. Auch die kommunikativen Dimensionen, die in der Theorie von Watzlawik entwickelt werden, sind unschwer – zumindest als heuristisches Frageraster – an Kunstwerken zu studieren, nämlich die Frage danach, wie Darstellen, Appellieren, Beziehungen herstellen im Einzelnen funktioniert. 15 Auch das ist ein relevanter Ansatz: von den Arten der Kommunikation in der Gesellschaft auszugehen, also ästhetische, moralische, politische etc. Kommunikation zu unterscheiden; vgl. Plumpe 1993. In diesen Kontext gehört die allgemeine Theorie der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung sozialer Systeme; vgl. umfassend Luhmann 1997, Kap. 5 sowie speziell bezogen auf Kunst Luhmann 1995. 16 Selbst diejenige ästhetische Kategorie, die die Widerspiegelung am ehesten zu suggerieren scheint, der Begriff der „Mimesis“, geht ursprünglich auf das handelnde, also bereits gestaltete, darstellerische Nachahmen von Mimen in der griechischen Polis zurück. 16 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Man sieht: Die unterschiedlichen Theorien der Künste, die im Laufe der Zeit entwickelt worden sind, lassen sich in ihren Grundideen auf sehr basale und elementare anthropologische und symboltheoretische Prinzipien zurückführen. Machen wir einen Sprung in die aktuelle Ästhetik-Diskussion, so zeigt sich, dass sich aktuelle künstlerische Probleme genau an der Ausformung jener „klassischen“ Prinzipien festmachen. Ich gebe einige Beispiele: Gerade die Kunst ist – zumindest in den letzten 200 Jahren – in ihrem Selbstverständnis der Ort der Entwicklung von Neuem, der Auseinandersetzung mit Tradition geworden, so dass ein Widerspruch – durchaus im Sinne der Dialektik als Bewegungsgesetz und Motor verstanden – derjenige von Bekanntheit und Innovation ist. Der Kosmoscharakter von Kunstwerken bedeutet, dass eine Strukturierung insbesondere von Raum und Zeit geschieht, so dass der Widerspruch zwischen Offenheit und Geschlossenheit zentral wirksam wird. Die Materialität des Kunstwerkes wird in den „flüchtigen“ Kunstformen, die nur im Augenblick entstehen – also etwa Tanz, Theater, Musik –, besonders zu diskutieren sein, aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die aktuelle Medienentwicklung, die Entstehung von Kunstwerken in Rechnern und Netzen, hat Virtualität zum Prinzip, so dass sich hier das Problem „Fiktionalität und Virtualität versus Materialität“ verschärft stellt. Im Zuge der Postmoderne stellen sich als ästhetische Grundfragen etwa die folgenden: - die Auflösung von Stilen zu Gunsten von Bricolage, was insbesondere die Frage des historischen Bewusstseins und seiner Vergegenständlichung in der Kunst stellt; - die Frage nach der Referenz, also die Thematisierung der sigmatischen und semantischen Funktion bzw. die These von der Verselbständigung der Zeichen ohne Referenz; - Fragen der Konstruktion – als Schaffung von Neuem, als kreativem Akt – und ihr Verhältnis zur Dekonstruktion. Zugleich kehren archaische Denkmotive zurück: etwa der Mythos (gegen Vernunft); - und immer wieder die Frage danach, ob eine Kunstproduktion in der Warengesellschaft nicht doch von der Logik der Warenförmigkeit so überlagert wird, dass genuine Kunst- (als Kultur-)funktionen nicht mehr erfüllt werden.17 17 In diesen Kontext gehört auch die harsche Kritik des Kulturgeschichtlers Jost Hermand, der in der Entwicklung elitärer Ismen in den Künsten (serielle Musik, Absurdes Theater, PopArt) wenig demokratische Kunstformen sieht, die sich vor allem dem Wunsch verdanken, Aufmerksamkeit auf dem Markt zu erzielen; vgl. Hermand 1990, S. 278ff. 17 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Im Hinblick auf die Frage nach den Wirkungen lässt sich diese anthropologische und symboltheoretische Skizze insofern auswerten, als Kunst als symbolische Form identifiziert wird und somit all jene Funktionen erfüllt, die jede symbolische Form erfüllt. Die Beweisbarkeit dieser These steht und fällt daher mit der Überzeugungskraft der Philosophie der symbolischen Formen. Anthropologie ist jedoch nicht bloß spekulative philosophische Anthropologie, sondern auch ganz handfest empirische Sozial- und Kulturanthropologie und Ethnologie. Hier lassen sich abstrakte anthropologische Funktionen, so wie sie oben beschrieben wurden, am konkreten Fall studieren. Cassirer (1990) bezeichnet als „Kultur“ die Sinne aller symbolischen Formen. Funktionen dieser symbolischen Formen sind daher Kulturfunktionen. Ein Teil der Kulturfunktionen kann also anthropologisch und symboltheoretisch begründet werden. Die Konkretisierung im Hinblick auf historisch-konkrete Gegebenheiten, ihre Ausdifferenzierung und gegebenenfalls neue Kulturfunktionen liefert allerdings erst eine soziologische Betrachtungsweise. 4. Der soziale Gebrauch der Künste: die Kulturfunktionen Die anthropologische Sichtweise liefert – wie gesehen – eine Reihe fundamentaler Kulturfunktionen. Ich gebe hier einen erweiterten Katalog solcher Kulturfunktionen an und werde im Anschluss daran zeigen, wie sie auf der Grundlage ausgewählter soziologischer Theorien begründet werden können. Kulturfunktionen sind etwa die folgenden: Entwicklung von Zeitbewusstsein im Hinblick auf Vergangenheit und Zukunft, Entwicklung von Raumbewusstsein, Identitätsbildung von Personen und Gruppen, Herstellung und Aushalten von Pluralität, Angebot von Deutungen und Deutungsmustern, Weltbildern, Symbolisierung von Gemeinschaftserfahrungen, Angebote für Lebensführungen und Lebensbeschreibungen (Biographie), Angebot von Lebensstilen (i. S. der aktuellen Lebensstilsoziologie und im weiten Sinne von Rothacker), De-Legitimation von Prozessen in den gesellschaftlichen Bereichen der Politik, des Marktes, der Gemeinschaft, des Rechts etc., 18 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Reflexivität je aktueller Formen von Sittlichkeit und Moral, Selbstbeschreibung von Einzelnen, Gruppen, Gesellschaften, Zeitabschnitten, Selbstbeobachtung, Angstbewältigung angesichts gesellschaftlicher oder individueller Risiken, Integration. Neben anthropologischen Argumentationen zu Gunsten dieser Funktionen führen soziologische Begründungen weiter. Insbesondere liefern soziologische Systemtheorien Aufschlüsse. Richard Münch (1991) und Niklas Luhmann beziehen sich beide auf die Systemtheorie von Talcot Parsons, entwickeln sie aber sehr unterschiedlich weiter. Aufschlussreich ist die folgende Grafik (Abb. 6) von Münch (in Anschluss an das AGIL-System von Parsons): Die Grafik ist auf den ersten Blick sicherlich unübersichtlich. Das Grundprinzip ist ein Vierfelder-Schema, das eine Aufteilung des sozialen Systems („die Gesellschaft“) in vier relevante Subsysteme (Wirtschaft, Politik, Soziales, Kultur) vornimmt. Jedes dieser Subsysteme hat eine spezifische Funktion sowohl in Beziehung auf das Ganze der Gesellschaft als auch zu den anderen Subsystemen. Außerdem hat jedes Subsystem – verbunden mit der jeweiligen Spezialaufgabe – ein eigenes zentrales Medium, das eine subsystemspezifische „Sprache“ schafft: Wirtschaft: Geld; Politik: Macht; Soziales: Solidarität; Kultur: Sinn. Die Spezialfunktionen sind Wirtschaft: Adaptation Politik: Goal attainment Soziales: Integration Kultur: Latent pattern maintenance Es ergibt sich daher Abb. 7 Abb. 7: G A I L 19 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 6: Die Interpenetration der gesellschaftlichen Subsysteme (entfällt) Quelle: Münch 1991, S 371 20 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Für das Subsystem Kultur, das das Kunstsystem, aber auch Religion, Bildung und Wissenschaft enthält, ist SINN-Kommunikation der zentrale Prozess mit dem Ziel, (verborgene) Wertstrukturen und Orientierungsmuster in der Gesellschaft zu erhalten. Im Hinblick auf andere Subsysteme sind es vor allem Prozesse der Legitimation und Delegitimation, die das Kultursystem kommuniziert. Nun hat man reichlich Kritik geübt an dem Kulturbegriff von Parsons: zu starr, zu konservierend, zu schablonenhaft, zu einheitlich. Die Dynamik moderner Gesellschaft mit ihrer Pluralität könne wenig auf diese Weise modelliert werden. Richard Münch versucht daher seit Jahren, die Ansätze von Parsons auf die Situation entwickelter Gesellschaften anzupassen. Für unsere Zwecke will ich festhalten: Aufgabe des Kultursystems ist die Kommunikation von Sinn. „Sinnhaftigkeit“ ist daher auch ein Kriterium für die Beschreibung und Bewertung der Prozesse in Politik, Wirtschaft und Sozialem. Das spezifische Kommunkationsmittel im Kunstsystem sind Kunstwerke und -prozesse (die zu dem Sinn-Diskurs beitragen). Sie nehmen als L (im Sinne des AGIL-Schemas) die Welt, also „AGI“, in den Blick in der bewertenden Perspektive der Legitimation der Subsysteme Wirtschaft, Politik und Soziales. Das Kultursystem selber ist vielfältig abhängig von den anderen Subsystemen (der Begriff dieser Wechselwirkung ist der der Interpenetration). Luhmann bringt zusätzlich weitere Erkenntnisse in unsere Überlegungen ein. Ich will hier nur drei anführen: der Gedanke der Autopoiesis und der Selbstorganisation, der Gedanke der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung, der Gedanke der Kontingenz. Die Funktionen der Subsysteme i. S. von Luhmann gibt folgende komprimierte Übersicht an (Abb. 8). 21 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 8: Beobachtung sozialer Systeme und kommunikativer Wirklichkeiten Quelle: Krause 1999, S. 36 22 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Ein weiterer Soziologe, Pierre Bourdieu (1994, 1987, 1996, 1999) lehrt uns nicht nur, neben den humanisierenden Wirkungen der Künste ihre segmentierenden Wirkungen zu studieren. Daneben ist das Konzept des Feldes hoch relevant, weil es die Genese und Funktionsweise der Interaktions- und Kommunikationssysteme – wie etwa, Literatur, Musik, etc. – zu verstehen lehrt (Jurt 1995). Neben diesen eher sach- und fachbezogenen Ansätzen sind es in großer Zahl Soziologen, die sich mit den globalen Entwicklungstendenzen der Gesellschaft (Stichwort: Zeitdiagnose) auseinander setzen. Dies hat eine Tradition, die bereits rund um 1900 mit den großen Würfen zur Bewertung der Moderne einen Höhepunkt hat: u. a. von Max Weber, Georg Simmel, Emile Durkheim. Für die heutige Situation liste ich verbreitete „Soziologische Gegenwartsdiagnosen“ (Schimank/Volkmann 2000) auf: Zweite Moderne und Risikogesellschaft (Ulrich Beck) Kommunikationsgesellschaft (Richard Münch) Lebenswelt- und Zivilgesellschaft (Jürgen Habermas) Erlebnisgesellschaft (Gerhard Schulze) Multioptionsgesellschaft (Peter Gross) Systemtheorie der Gesellschaft (Niklas Luhman). Aus Frankreich kommen die Analysen /Diagnosen von Bruno Latour, Jean Baudrillard, Alain Tourraine und Pierre Bourdieu. Aus Großbritannien kommen Anthony Giddens, Zygmunt Baumann und Ralf Dahrendorf; und aus den USA James Coleman, Amitai Etzioni, George Ritzer, Samuel Huntington und Richard Sennett. Ein anderes Überblicks-Buch (Kneer/Nassehi/Schroer 1997) unterscheidet (mit großen Überschneidungen) die postmoderne, multikulturelle, schamlose, funktional differenzierte, individualisierte, postindustrielle, Disziplinar-, Welt-, Zivil-, Risiko-, Markt-, Erlebnis- und Informations- und Mediengesellschaft. Kein Mangel also an umfassenden Gesellschaftsdiagosen. Bereits ein oberflächlicher Blick zeigt: Es geht um die zunehmende Erkenntnis von der Ambivalenz der Moderne und der Zumutungen der Moderne an das Individuum. Diese Traditionslinie ist überraschend alt. Bereits Rousseau hat Mitte des 18. Jahrhunderts für einen europaweit wahrgenommenen Paukenschlag mit seiner Preisschrift von Dijon (1750) gesorgt: Dass die Wissenschaften und Künste eben doch nicht „zur Läuterung der Sitten“ beigetragen haben. „Zerrissenheit“ wird zur Signatur der Moderne – und entsprechend die Wiederherstellung von Ganzheit das Gegenprogramm. Gegen die Topoi der Moderne (Vernunft und Öffentlichkeit) werden Sinnlichkeit, Privatheit und Subjekt gesetzt. Cornelia Klinger (1995) be23 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 schreibt in ihrer Studie, wie der Entwurf ästhetischer Gegenwelten gegen die „kalten Skeletthände“ rationaler Ordnung (Max Weber) in der Romantik vorgedacht und im Diskurs der Postmoderne zu einem neuen Höhepunkt gelangten. Und natürlich gehört zur Dialektik der Geschichte, dass der humanistische Aufschrei gegen Deformationen der Aufklärung – die ihrerseits von humanistischen Idealen einer Befreiung von der Repressivität der damaligen politischen und ideologischen Verhältnisse des aufgeklärten Absolutismus getragen war – immer wieder auch in repressiven Tendenzen bis hin zum Faschismus endeten. Die Künste spielen in diesem Diskurs geradezu die zentrale Rolle. Denn sie waren die Hoffnungsträger, die das „Andere der Vernunft“ als das wahrhaft Humane verkörpern. Und trotzdem waren es gerade die Künste, war es die Ästhetisierung des Politischen, die mit zu den oben angesprochenen Niederungen der romantischen Gegenbewegung zur Aufklärung geführt haben. An dieser Stelle helfen daher globale Zeitdiagnosen nicht mehr weiter. Hier müssen wir in die einzelwissenschaftliche Detail-Analyse der einzelnen Kunstsparten eintreten. 5. Der Mensch im Mittelpunkt: Kompetenzen als Teil der Persönlichkeit Der Mensch im Mittelpunkt – auch in diesem Text. Die kulturelle Relevanz der Kunst bezieht sich auf ihre Bedeutsamkeit für den Menschen. Dies meint insbesondere, dass es keine „Autonomie der Kunst“ geben kann, die sich gegen die „Autonomie des Menschen“ stellt: Kunst hat ihre Bedeutsamkeit nur, insofern sie eine Bedeutung für den Menschen hat. Doch woran macht man dieses Bedeutsamkeit fest? In soziologischer Hinsicht ist zu diesem Zweck das Konzept der Kulturfunktionen entwickelt worden, bei denen man zum einen zeigen kann, dass ihre Erfüllung notwendig für das Gemeinwesen ist; und bei denen man zeigen kann, dass und wie die Künste sie erfüllen. Doch „der Mensch“ ist nicht nur die soziale Gesellungsform, sondern auch der Einzelne.18 Hierzu wurde eingangs bemerkt, dass auch Kulturfunktionen je individuell gelebt werden müssen. Im Hinblick auf individuelle Subjektivität – hier verstanden als individuell mögliche Gestaltungsfähigkeit – kann man davon ausgehen, dass sie durch Partizipation an der gesellschaftlichen Subjektivität – als gesellschaftlich vorhandener und praktizierter Steuerungsfähigkeit des Ganzen – entsteht; zumindest setzt letztere einen Maßstab für die erstgenannte. Dieses Denkmodell gilt auch für Kulturfunktionen: bezogen auf das Individuum lassen sie sich als Bildungsfunktionen verstehen. Damit wäre zugleich ein Kon18 Die Formulierung soll nicht die übliche Entgegensetzung von Einzelnen und Gemeinschaft suggerieren: Gesellschaftlichkeit ist ebenso Grundbedingung des Individuums, wie Individualität der Modus ist, in der Gesellschaft gelebt wird. Zum ersten siehe Holzkamp 1979, zum zweiten siehe Gerhardt 2000. 24 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 zept gegeben, mit dessen Hilfe sich Kunstwirkungen auf den Einzelnen beziehen lassen können. Bevor wir diesen Gedanken weiter vertiefen, sollte diese spezifische „Individualisierungsthese“ getestet werden. „Bildung“ erfasst die wechselseitige Erschließung von Mensch und Welt (Fuchs 2000). Zu ihr gehört die Entwicklung eines bewussten Verhältnisses des Menschen zu sich, zu seiner natürlichen und sozialen Umwelt, zu seiner Geschichte. Vergleicht man diese Begriffsbestimmung mit den Kulturfunktionen, so fällt sofort die Übertragungsmöglichkeit auf. Entwicklung von Raum- und Zeitbewusstsein, die Bildung von Identität, die Reflexivität seines moralischen, theoretischen und ästhetischen Verhaltens, das Entwerfen von Bildern von sich: all dies sind lediglich Paraphrasierungen des Topos von der „Herstellung eines bewussten Verhältnisses zu sich und zu seiner sozialen und natürlichen Umwelt“. Die „Angebote an Deutungsmustern und an Lebensführungen“ bringen den anthropologischen Tatbestand zum Ausdruck, den Plessner als erstes beschrieben hat: Eben auf Grund des Verlustes einer selbstverständlichen Mitte des Lebens muss der Mensch dieses bewusst führen. Der Mensch ist sein eigener Regisseur, Drehbuchautor oder Steuermann – auch wenn lange Zeit machtvolle gesellschaftliche Instanzen (Kirche, Parteien etc.) ihm diese „Last“ eigenverantwortlicher Entscheidungen abgenommen haben.19 Kunst hat also in Bezug auf den Einzelnen Bildungsfunktionen. Dabei ist es gleichgültig, von welchem Punkt des semiotischen Vierecks man diesen Subjektbezug zu denken beginnt: Die „Bedeutung“ (Semantik), die Formensprache (Syntax), die Herstellung einer Abbildungsrelation (Sigmatik): all dies ist letztlich Menschenwerk, ist Konstruktion – so hat es Kant als erster umfassend durchdekliniert, und so sagen es alle aktuellen Varianten des Konstruktivismus. Selbst Konzeptionen, die – anders als der Radikale Konstruktivismus (Glasersfeld 1996) – noch eine Realität zulassen (z. B. evolutionäre Ansätze), gehen von der Aktivität der Subjekte aus bei der Erschaffung entsprechender psychischer Regulationstrukturen. Doch was ist dieses „Subjekt“? Wie muss man sich die „Apparatur“ oder die „Architektonik“ der Persönlichkeit vorstellen? Lassen wir kurz einige Modellvorstellungen Revue passieren. Die inzwischen klassische Dreiteilung der Philosophie in theoretischen Philosophie, praktische Philosophie und Ästhetik legt nicht nur eine Dreiteilung der Tätigkeitsformen (theoretische, moralische und ästhetische Tätigkeit) – neben dem praktischen Handeln – nahe, sondern ebenso eine 19 Eigentlich ist das eine Grundbestimmung menschlicher Existenz. Gleichzeitig schafft sich der Mensch jedoch Institutionen und Rituale, die die Last zu vieler Einzelentscheidungen zugunsten standardisierter Formen mildern, also – im Sinne von A. Gehlen – die Funktion der „Entlastung“ übernehmen. Offensichtlich wird hierbei eine Balance angestrebt: Ein zu große Standardisierung führt zur Entmündigung, zu wenig führt zu Überlastung und Verzweiflung. Dass das individuelle Leben eine eigenständige Gestaltungsaufgabe ist, setzt ein entwickeltes 25 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Dreiteilung der Rationalitätsformen: theoretische, moralische und ästhetische Rationalität (Welsch 1998). Damit ist ein breites Spektrum menschlicher Lebendigkeit erfasst. Philosophische und einzelwissenschaftliche Konzepte, die von Rationalität ausgehen, sind gut entwickelt – bis hin zur öffentlichen Ehrung durch die Vergabe des Nobelpreises (an G. Becker und seinen rational-choice-Ansatz, der weit über die Ökonomie Geltung beansprucht; Nida-Rümelin 1994). Diese „logozentrische“ Verständnisweise des Menschen hat im „Abendland“ eine reiche Tradition, da das griechische Denken zurecht als Entwicklung „vom Mythos zum Logos“ (Nestle) verstanden wird: Der Mensch ist das denkende, begründende und rational entscheidende Wesen. Diese Notwendigkeit zur Begründungspflicht von Entscheidungen ist in der Tat eine unverzichtbare zivilisatorische Errungenschaft, auf die nicht verzichtet werden kann. Doch zurecht wird darauf hingewiesen, dass trotz aller Weite des Rationalitätsbegriffs weite Bereiche – möglicherweise die entscheidenden – ausgeklammert werden. Ich erläutere dies anhand einiger ausgewählter Texte. Der Mensch ist nicht nur denkender, rational entscheidender Verstand20, sondern er ist zugleich Leib, hat – trotz aller Kulturbestimmtheit – seine Verwurzelung in der Natur, ist also auch Naturwesen. Dies wurde immer wieder vergessen – etwa erkennbar daran, dass die Sinnlichkeit – verstanden als naturnähere Disposition – immer wieder gegenüber der „edleren“ Vernunft rehabilitiert werden musste. Der Mensch ist auch Körper und Leib, dies hat man im Anschluss an Plessner in der phänomenologischen Philosophie (v. a. Merleau-Ponty) ausgearbeitet.21 Der Mensch spürt, und vermutlich spürt er, bevor er rational agiert. Ulrich Potthast (1998) hat diese Grundidee zu dem Konzept einer „lebendigen Vernünftigkeit“ ausgearbeitet: Der Mensch ist nicht vollständig als rationales Wesen zu begreifen. Diese irrige Sicht hat vielmehr dazu geführt, dass mit der Naturseite, also der spürenden Seite des Menschen auch seine ökologischen Bezüge zur Natur vernachlässigt wurden – mit all den Folgen, die nunmehr zu bewältigen sind. Offenbar ist die Frage des Menschenbildes überhaupt nicht zweitrangig, wenn dieses die Art des Eingreifens des Menschen in die Natur – auch in die eigene am Beispiel der Gentechnologie – orientiert. Dieser Aspekt ist eng verbunden mit der (ebenfalls vernachlässigten) Dimension der Emotionalität, des „in etwas involviert seins“ (so Agnes Heller). Emotionalität beinhaltet den Prozess des Bewertens kognizierter Sachverhalte, ist Konzept von Individualität voraus. Man setzt die Zeit der Entstehung eines solchen Konzeptes mit der Renaissance an; vgl. Fuchs 2001. 20 Gerade in deutscher Tradition wäre Verstand und Vernunft zu unterscheiden. Ich verzichte an dieser Stelle darauf. 21 Inzwischen ist die Literatur zu dieser Dimension reichhaltiger. Ich nenne nur zwei Autoren: Foucault untersucht die Geschichte des Körpers als Disziplinierungsgeschichte; Bourdieu liefert mit seinem Habitus-Konzept eine Grundlage, um verstehen zu können, wie Handlungsanforderungen und Normen buchstäblich verinnerlicht und inkorporiert werden. 26 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 also eine wertende Beziehung zur Welt (Goleman 1997, de Sousa 1997, aber auch Holzkamp 1983). Ein dritter, inzwischen vernachlässigter Bereich (neben dem Spüren und der Emotionalität), der zumindest bis in die Anfangsjahrzehnte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte, ist der Aspekt des Willens. Die Skepsis gegenüber dieser Persönlichkeitsdimension ist sicherlich erklärbar durch den geschichtlichen Missbrauch („Triumph des Willens“), allerdings nicht gerechtfertigt. In psychologischer Hinsicht ist der Wille im Kontext von Motivationskonzeptionen als Motor des Handelns unverzichtbar. In philosophischer Perspektive ist der Kontext der (Willens-)Freiheit von zentraler Bedeutung: „Freiheit ist das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen“, so Kant, wobei Willensfreiheit das innere Vermögen und Handlungsfreiheit das äußere Vermögen beschreibt. Und auch im künstlerischen Kontext ist der Wille – als Gestaltungswille Teil der Kreativität – systematisch unverzichtbar (Erpenbeck 1993). Der Mensch steht also in einer komplexen Vielfalt von Beziehungen der Welt und sich selbst gegenüber: Erlernen, Bewerten, Erleben, Streben, Entscheiden, Kontrollieren, Behalten. Es entstehen durch (tätige) Habitualisierung Kenntnisse, Einstellungen, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Temperaments- und Gefühlseigenschaften. Im folgenden will ich – im Anschluss an Erpenbeck/Heyse 1999 – zur Konzeptionalisierung des Subjektbezugs künstlerischer Prozesse den Begriff der Kompetenz in den Mittelpunkt stellen. Die folgende Abbildung (Abb. 9) zeigt, dass die oben vorgestellten Dimensionen des Bildungsbegriffs (bewusstes Verhältnis zu sich etc.) sehr gut mit dem Kompetenzbegriff erfasst werden können. 27 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 9 Quelle: Erpenbeck/Heyse 1999, S. 158 28 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abbildung 10 präzisiert diesen Gedanken im Hinblick auf das Konzept der Schlüsselkompetenzen. Es hat im Umgang mit diesem Konzept inzwischen eine gewisse Verbreitung gefunden, Schlüsselkompetenzen – als außerfachliche Kompetenzen – in Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen zu unterteilen. Die Abbildung zeigt, wie zwanglos diese Unterteilung auf das hier zu Grunde liegende Bildungskonzept bezogen werden kann. Abb. 10: Schlüsselqualifikation und Bildung: Ein Vergleich Schlüsselqualifikationen: Bildung: Kompetenzbereiche wechselseitige Verschränkung von Mensch und Welt; das meint u. a. Selbstkompetenz: bewusstes Verhältnis zu sich kompetenter Umgang mit sich selbst, d.h. Umgang mit dem Selbstwert Selbstmanagement reflexiver Umgang mit sich selbst bewußte Entwicklung eigener Werte und eines Menschenbildes die Fähigkeit zu beurteilen und sich selbst weiterzuentwickeln Sozialkompetenz: Teamfähigkeit Kooperationsfähigkeit Konfliktfähigkeit Kommunikationsfähigkeit bewusstes Verhältnis zu anderen zu Geschichte und Zukunft zur Natur Methodenkompetenz: „Metawissen“ das geplante zielgerichtete Umsetzen von Fachwissen, d. h. analysieren (systematisches Vorgehen) Erarbeiten von kreativen, unorthodoxen Lösungen (neben den Gleisen gehen) Strukturieren und Klassifizieren von neuen Informationen in den Kontext setzen, Zusammenhänge erkennen kritisch hinterfragen, um Innovationen zu erreichen abwägen von Chancen und Risiken. Erpenbeck/Heyse (S. 159) nehmen die folgende Unterteilung vor, die sie auch ihren empirischen Untersuchungen zu Grunde legen (Abb. 11). 29 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 11 Quelle: Erpenbeck/Heyse 1999, S. 159 30 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Damit ist zugleich ein wichtiger Schritt im Hinblick auf eine definitorische Bestimmung des Kompetenzbegriffs getan. „Kompetenzen“ werden an der Stelle in die pädagogischpsychologische Diskussion eingebracht, an der man von den äußeren Qualifikationserwartungen (v. a. der Wirtschaft, aber auch der Politik) übergeht zu einer subjektorientierten Sichtweise, wenn also der Aspekt der „Autonomie“ im wörtlichen Sinne der Selbstgesetzgebung in den Vordergrund tritt. Der Begriff der „Selbstgesetzgebung“ wird allerdings in den letzten Jahren weniger verwendet. Stattdessen hat der Begriff der Selbstorganisation Karriere gemacht. Diese Karriere ist durch neuere Erkenntnisse in unterschiedlichen Einzeldisziplinen befördert worden, so dass das „Prinzip Selbstorganisation“ inzwischen einen grundlegenden Status in Human-, Sozial- und Naturwissenschaften erhalten hat. In der Literatur wird immer wieder auf drei Quellen des Gedankens der Selbstorganisation hingewiesen: die Neurobiologie (am Anschluss an Maturana/Varela) in der Physik (Prigogine, Haken) in der allgemeinen Systemtheorie (Kybernetik 2. Ordnung; von Foerster). Die Systemtheorie Luhmanns und der Radikale Konstruktivismus (v. Glasersfeld) – beide inzwischen in vielen Disziplinen angewandt – haben diese Grundgedanken extensiv weiter entwickelt. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass keineswegs die Akzeptanz des Prinzips der Selbstorganisation zwangsläufig zur Akzeptanz bestimmter erkenntnistheoretischer oder antiontologischer/antirealistischer Überzeugungen führt. Es hat sich vielmehr selbst im Kreis der Konstruktivisten ein harter Meinungsstreit zwischen unterschiedlichen Schulen ergeben, obwohl die Bezugsautoren dieselben sind. Die Hervorhebung des Selbst im Topos der Selbstorganisation liegt auf der Linie der oben angesprochenden Kritik an der zu starken Hervorhebung der Rationalität bei der Bestimmung des menschlichen Lebens. Bei den unterschiedlichen Begriffen, die das Ich kennzeichnen (u.a. Ich, Selbst, Subjektivität, Individualität, Identität) ist das „Selbst“ derjenige Begriff, der durch Selbstbezüglichkeit entsteht: Das Leben wird – in all seinen Dimensionen – zunächst einmal durch das eigene Erleben des Lebens charakterisiert. Dies ist auf unhintergehbare Weise mit jedem Lebensprozess verbunden: Der Mensch denkt nach – und erlebt sich selbst als Denkenden; er nimmt sinnlich wahr – und nimmt sich selbst als denjenigen wahr, der dies tut. „Leben ist der umfänglichste und gleichwohl in sich reichhaltigste Begriff für den Zusammenhang, in dem wir sind. Verglichen mit ihm sind die Begriffe des Seins, der Wirklichkeit oder der 31 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Welt abstrakt; was sie bedeuten, können wir bezeichnenderweise nur vom Leben her bestimmen. Entsprechendes gilt für die schon konkreter, d. h. sinnlich gefassten Termini des Kosmos, des Universums oder der Physis, also der Natur. Ihnen gegenüber hat das Leben den Vorteil innerer Anschaulichkeit.“ (Gerhardt 1999, 148). Konsequent bestimmt daher Volker Gerhardt (2000) nicht nur „Individualität“ als das bestimmende Moment der Welt- und Selbstverhältnisse des Menschen, sondern er dekliniert systematisch dessen Dimensionen in ihrer Selbstbezüglichkeit durch (1999): Selbsterkenntnis, Selbstständigkeit, Selbstherrschaft, Selbstbestimmung und Selbstzweck, Selbstbewusstsein, Selbststeigerung, Selbstverantwortung, Selbstbegriff, Selbstgesetzgebung, Selbstverwirklichung. Und natürlich gehört auch Selbstorganisation in diesen Kreis der Selbstbezüglichkeiten. Ich weise hier auf diesen umfassenderen philosophischen Kontext hin, weil dadurch deutlich wird, dass Selbstorganisation tatsächlich zu einem grundlegenden Bestimmungsmoment menschlicher Lebendigkeit wird, mehr noch: es scheint sich sogar um ein grundlegendes Strukturprinzip der Natur zu handeln, dessen systematische Nutzung in bewussten Gestaltungsprozessen rund um das menschliche Leben geradezu das Comenius-Prinzip der Didaktik wieder aufleben lässt: Die Natur zur Lehrmeisterin des Lebens zu machen. An anderer Stellte habe ich gezeigt, dass mit Herder nicht nur bewusst wird, dass „Kultur“ als menschliche Weise der Existenzsicherung auf sehr unterschiedliche Weise realisiert werden kann – weshalb „Kultur“ nur als Pluralitätsbegriff (Kulturen) – sinnvoll wird. „Kultur“ erfasst auch die Tatsache des Gemachtseins, so dass bei ihrer Begriffsbestimmung die Kontingenz menschlichen Machens in Rechnung gestellt werden muss: Das Tätigkeits-Ergebnis ist nie vollständig voraussehbar, es kann immer auch völlig anders ausfallen als geplant. Erpenbeck/Heyse (1999, S. 157) bestimmen als „Ort“ der Selbstorganisation „Handlungen, deren Ergebnisse auf Grund der Komplexität des Individuums, der Situation und des Verlaufs (System, Systemumgebung, Systemdynamik) nicht oder nicht vollständig voraussagbar sind.“ In meinen Worten: Es ist die Kontingenz der Handlungen, die sie dem Prinzip der Selbstorganisation zugänglich macht. Und: Kultur als tätiger (kontingenter) Prozess wird wesentlich durch dieses Prinzip bestimmt. Das überrascht nun nicht, insofern „Kultur“ die Spezifik menschlicher Lebendigkeit erfasst und Selbstorganisation ein zentrales Prinzip dieser Lebendigkeit ist. Man betrachte vor diesem Hintergrund erneut Abb. 9, die die Bestimmung des Begriffs der „Handlungskompetenzen“ in Abb. 11 konkretisiert: 32 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 1. Kompetenzen erfassen Werte, Erkenntnisse/Wissen, Verhaltensweisen (oder Kompetenzen werden von Willen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und auf Grund von Willen realisiert.“ (S. 486).) 2. die im handelnden Umgang des Menschen mit sich und der Welt benötigt, aber auch manifestiert werden. Inhalte von Kompetenzen sind also Wissen, Werte und Willen, so dass die Frage nach Aneignungsformen solcher Inhalte entsteht, wobei Tätigkeit und Handeln sowohl bei der Aneignung, aber auch als Orte der Wirksamkeit relevant werden. Dabei liegt sowohl bei der Vermittlung von Kompetenzen als auch bei ihrer diagnostischen Erfassung das Prinzip der Handlungsorientierung nahe; Kompetenzen sind als Qualitäten der Handlungsorientierung in den Handlungen erkennbar. Sie gehören zum dispositionellen System der Persönlichkeit: Theorien der Kompetenzen sind Teil einer Theorie der Persönlichkeit, Kompetenzmessung ist daher Teil einer Persönlichkeitsdiagnostik und Kompetenzentwicklung ist Entwicklung der Persönlichkeit.“ (ebd.) Vor dem Hintergrund der oben vorgestellten Überlegungen zur Binnenstruktur der Persönlichkeit lässt sich das folgende Schema (Abb. 12; so etwa bei Faulstich 1997, S. 166, ergänzt um die Dimension des Willens) aufstellen. Abb. 12 Aspekt Bereiche I fachlich I L sensomotorisch emotional affektiv kognitiv volitiv methodisch A L sozial A reflexiv sensomotorisch: affektiv: kognitiv: volitiv: beachten, handhaben, ausführen, beherrschen aufnehmen, reagieren, werten, verantworten kennen, verstehen, bewerten, anwenden wollen, anstreben, entscheiden. 33 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Wir brauchen also Bilder und Modellvorstellungen der Persönlichkeitsstruktur, wenn wir Kompetenzentwicklungen erfassen wollen. Ich erinnere daran, dass die Freudsche Systematik von Ich/Es/Überich ein solches Modell ist. In früheren Zeiten waren Schichtenmodelle der Persönlichkeit verbreitet, bei denen es einen hierarchischen Aufbau von eher naturnahen Bestandteilen bis zu elaboriert-kultivierten Bestandteilen der Persönlichkeit gab. In der berühmten Bedürfnispyramide von Maslow finden sich immer noch solche Modellvorstellungen. Wie komplex aktuelle kunstpsychologische Modelle vorgehen, zeige ich am Beispiel von Walter Schurian. Dieser zeigt an dem gerade für künstlerische Prozesse zentralen Feld der Wahrnehmung, wie differenziert vorzugehen ist. Ästhetische Erfahrung knüpft natürlich an Sinneswahrnehmungen an. Doch bereits Klaus Holzkamp (1973) hat in seinen Studien zur „Sinnlichen Erkenntnis“ gezeigt, wie wenig empiristische tabula-rasa-Konzeptionen erklären können, sondern dass vielmehr Wahrnehmung bereits durch Begriffe und Vorbegriffe gesteuert wird, begleitet durch sofort vorhandene Prozesse der Bewertung und des Auswählens. Wie stark die konstruktiven Akte bei diesen Prozessen sind, kann man schon daran erkennen, dass alleine auf Grund der Konstruktion des Gehirns dieses sich zu einem erheblichen Teil ausschließlich mit sich selbst und seinen Aktivitäten (ca. 90%) im Vergleich zu Außenwahrnehmungen befasst. Und auch diese Außenwahrnehmungen präsentieren eine derart chaotische Fülle von Signalen, dass es geradezu ein Wunder ist, dass und wie in jedem Augenblick durch strengste Selektion ein kohärentes Bild – und dies auch noch in einem dynamischen Ablauf – entsteht. (Roth 1997, v. a. Kap. 11). Kunstbezogene Wahrnehmung ist also ein äußerst komplexer Akt, der zudem hochgradig kognitiv auch deshalb ist, weil der Wahrnehmungsgegenstand eine sinnliche Präsentation reflexiver Prozesse ist: Der Modus ästhetischer Anschauung und Wahrnehmung ist die Wahrnehmung/Rezeption anschaulicher Unanschaulichkeit auf Grund des inkorporierten Reflexionsgehaltes von Kunstwerken (Holz 1997, Bd. 3; vgl. auch 6.2 in diesem Text). Angesichts dieser Komplexität des Wahrnehmungsvorgangs wundert darum auch die Vielschichtigkeit des Wahrnehmungskonzeptes nicht, von dem Schurian ausgeht (Abb. 13). 34 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 13: Vielschichtigkeit, Interaktionsweisen und psychische Tätigkeit Ebenen der Vielschichtig- Interaktionsweise psychische Tätigkeit keit Evolutiv-symbolische Ebene Überbewusstsein Selbstreflexive Ebene, Bewusstsein Reflexive Ebene, Organismische Ebene Verlangen Verhalten Handeln Zelluläre Ebene Organelle Ebene Reaktion Empfindung Dissipative Ebene Quelle: Schurian 1986, S. 93 Damit ist die Frage nach dem systematischen Ort einer Zertifizierung von Kompetenzen benannt: es geht dabei um die Bestätigung von Befunden, die auf der Basis der Persönlichkeitsanalyse gewonnen wurden. Als Methode einer solchen Analyse entwickeln Heyse/Erpenbeck überprüfte Selbsterzählungen der Befragten nach lebens- und berufsbiographisch angelegten Leitfadengesprächen. Kurz: Sie entwickeln das Konzept der Kompetenzbiographie im Dreieck von Biografie, Lerngeschichte und Kompetenzerwerb (S. 200 ff.). 6. Kunst, Persönlichkeit und Kompetenzen: Zu ihrem systematischen Zusammenhang Kunst wurde als „Kulturmacht“ bestimmt, so dass es sinnvoll ist zu fragen, ob und wie sie die allgemeinen Kulturfunktionen erfüllt. Kulturfunktionen wurden aus der Sicht des Einzelnen als Bildungsfunktionen identifiziert, Bildung wiederum als Entwicklung der Persönlichkeit beschrieben. Kompetenzen wiederum wurden als Teil der Persönlichkeit erkannt. Es ergibt sich daher der folgende systematische Zusammenhang (Abb.14) 35 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 14: Kulturfunktionen, Bildungsfunktionen und Kompetenzen Symbolische Formen: KUNST, Religion, Wissenschaft erfüllen Gesellschaft: Einzelner: Persönlichkeit (Wissen, Wille, Werte, Sinnlichkeit) KULTURFUNKTIONEN BILDUNGSFUNKTIONEN KOMPETENZEN (Sozial-, Selbst-, Methodenkompetenzen vermittelt im tätigen Umgang mit Künsten, durch künstlerische Praxis gemessen mit Methoden der Persönlichkeitsdiagnostik Die Fähigkeit zur Zertifizierung von Bildungswirkungen setzt daher Kenntnisse in folgenden Bereichen voraus, die zugleich Curriculum-Bausteine der Multiplikatorenfortbildung sein können: pädagogische Kunstwirkungen, Persönlichkeitstheorie, Erwartungen der Wirtschaft, Verfahren der dialogischen Persönlichkeitsdiagnostik (d. h. gemeinschaftliche Ermittlung von Entwicklungsfortschritten). Anknüpfungspunkte für die einzelnen Curriculum-Bausteine sind dabei: Die Erwartungen der Wirtschaft im Hinblick auf Schlüsselqualifikationen sind in Abb.10 zusammengefasst. Sie lassen sich zwanglos unter den Rubriken Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz zusammenfassen. Diese Untergliederung ergibt sich auch auf völlig anderem systematischen Weg. 36 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Persönlichkeitsdiagnostische Verfahren (auf der Grundlage spezifischer Persönlichkeitstheorien) gibt es einige. Das Verfahren der Kompetenzbiographie ist ein Vorschlag, der psycholgische und (qualitative) soziologische Verfahren integriert. Bei den zu erwartenden pädagogischen Kunstwirkungen kann man auf die Fülle von Wirkungsbehauptungen („Lernziele“) in der Kulturpädagogik und die vereinzelten Wirkungsstudien zurückgreifen. 6. Anhang Einzelne Künste, spezielle Kulturpädagogiken: Hinweise 6.1 Allgemeines Ich knüpfe an die anthropologischen Überlegungen zur Sinnlichkeit des Menschen und die Theorien zur Kunst – etwa im Kontext der Philosophie der Symbolischen Formen – an. Der Fokus der Überlegungen bleibt der Mensch und seine Entwicklung. Zu dieser Perspektive stelle ich im folgenden einige Materialien zusammen, die zwar höchst unvollständig sind, die aber vielleicht zum Weiterdenken anregen. Als Leitlinie meiner Überlegungen soll gelten, die Unterschiedlichkeit der künstlerischen Praxen auf der Basis gemeinsamer Grundideen zu formulieren. Zu diesen Gemeinsamkeiten zählen insbesondere anthropologische Ansätze (Plessner, Cassirer) sowie ein ausformuliertes Konzept von Bildung. Als Hintergrundfolie für die Diskussion der Wirksamkeit der verschiedenen Künste gebe ich einen Katalog von Wirkungsbehauptungen (Lernzielen) wieder (Fuchs/Liebald 1995, S. 94ff.): 1. Religiöse, ästhetische, politische, abbildende Funktion von Kunst. 2. Darstellung und Produktion kultureller (und/oder sozialer) Ungleichheit. 3. Kommunikative, edukative, kulinarische, epistemologische und tautologische Funktion des ästhetischen Gegenstandes. 4. Ermöglichung von Kontingenzerfahrungen. 5. Appellativer Charakter. 6. Ethische Funktionen (immer wieder von Anbeginn an bis heute). 7. Informationsfunktion. 8. Mimetische Funktion. 37 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 9. Selbstreflexivität der menschlichen Gattung (z.B. Theater als Spiegel der Gesellschaft, Shakespeare). 10. Anlass zur Kontemplation und/oder Überhöhung; auratische Funktion. 11. Anlass für Gefühl der Erhabenheit. 12. Emanzipation (von F. Schiller bis H. Glaser). 13. Weltweisen – Wahrnehmung. 14. Die Herstellung von Distanz zur Gegenwart, u. U. in gesellschaftskritischer Absicht (Verschiedene: von Adorno bis zur Postmoderne). 15. Gewinnung von Erkenntnis (sehr viele, z. T. sehr unterschiedliche Autoren, z. B. Gadamer, Welsch). 16. Alternative zu diskursiver und begrifflicher Erkenntnis (z. T. sehr verschieden Autoren, z. B. Nietzsche und Adorno). 17. Kunst als Teil eines sinnvollen Lebens (Verschiedene). 18. Kunst als Antizipation, als Möglichkeitsraum (Block; Musil). 19. Sinnhaftigkeit unserer Erfahrung erfahren (M. Seel). 20. Explorative und erkundende Haltung entwickeln als sehr spezifische Erkenntnisleistung . 21. Ökonomische Funktionen wie Kapitalverwertung, Verbesserung der Verwertungsbedingungen, Leistungssteigerung, Desintegration in Betrieben, Marketinginstrument. 22. Verändertes Sehen (bzw. Hören usw.) lehren. 23. Wahrnehmungsschulung (v. Hentig), Sinnlichkeit entwickeln (Zacharias). 24. Repräsentationsfunktion von Herrschern, Klassen, Staaten; Geschichtsaufarbeitung beziehungsweise -klitterung. 25. Kunstförderung als Modernitätsbeweis. 26. Funktionales Äquivalent für Religion, innerweltliche Erlösung (m. Weber, P. Bürger). 27. Geringe Wirkung moderner Kunst auf Einstellungen der Rezipienten (Adorno). 28. Läuterung, um schlechte Welt besser ertragen zu können; Kompensation; Absorption revolutionärer Energien (u.a. O. Marquardt). 29. Entfaltungsort von Subjektivität und Gestaltungswollen. 30. Negative moralische Wirkungen (am Beispiel von Flaubert und Baudelaire). 31. Möglichkeit des interesselosen Wohlgefallens, von Zweckmäßigkeit ohne Zweck, von allgemeinem Wohlgefallen ohne Begriff (Kant). 32. Auslösen von Empfindungen /z. B. Lyotard). 33. Widerspiegelung a) von innerem Gefühlsleben (Ausdruck-Ästhetiken) b) von gegenständlicher Welt, wie sie ist oder sein soll (sozialistischer Realismus, Welsch). 38 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 34. Unterhaltung, hedonistische Funktion. 35. Welt als Welt des Menschen wieder erkennen (Hegel). 36. Steigerung des nationalen Selbstbewusstseins. 37. Selbstbewusstsein der Menschengattung (Lukacs). 38. Kompensation der Modernisierungsprozesse. 39. Stärkung der Sittlichkeit durch Gestaltung der Sinnlichkeit; Förderung der ästhetischen Individualität (Mayrhofer/Zacharias). 40. Kompensatorische, kognitive, bewusstmachende, befreiende, utopische realutopische Funktion (J. Zimmer). 41. Exploration des Möglichen (v. Hentig). 42. Etwas sichtbar machen, was von sich aus nicht zu sehen ist (Theater: etymologisch von sehen, schauen). 43. Erzeugung von Wohlgefallen durch Wiedererkennen. 44. Eröffnung des außergewöhnlichen Bereichs völliger Funktionslosigkeit (R. Bubner). 45. Heilende Wirkung; Katharsis-Funktion. 46. Stimulanz des Lebens, Alarmsystem der Gesellschaft, Sonde der Wirklichkeitsforschung. 47. Deckung des Bedarfs nach Bildern. 48. Erfüllung eines anthropologischen Grundbedürfnisses (nach Ästhetik/Kunst). 49. Vermittlung von Erkenntnissen und Impulsen in Form von Genüssen im Theater (B. Brecht). 50. Genuss der Aktivitäten des Rezipienten, die das Kunstwerk ihm abfordert; Selbstbestätigung, Selbstverwirklichung, Orientierung. 51. Wiederherstellung der durch kapitalistische Produktionsweise erzeugten Entfremdung und Zerstückelung rationaler Erfahrung im ästhetischen Bild (Lukacs). 52. Nicht Vehikel, sondern Artikulationsort menschlicher Emanzipation inmitten feindlicher Realität (Adorno). 53. Prodesse et delectare (Horaz). 54. Ausbreitung von Vernunft und Tugend. 55. Kunst als Sprache von Gefühlen (Ausdruckstheorien der Ästhetik (. a. v. Kutschera) 56. Kunst als seelische Vorbereitung für neue Formen des Lebens; Speicher für menschliche Werte der Vergangenheit. 57. Kulturelles und soziales Gedächtnis. 58. Kunst als optimale Beanspruchung unseres informationsverarbeitenden Systems. 59. Erwirtschaftung von Einnahmen oder sogar von Gewinnen. 39 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 60. Herstellung von Identität (einer Person, Gruppe, Stadt, Region, Staat, Kontinent). 61. Herstellung von Urbanität. 62. Möglichkeit zur Selbstinszenierung bestimmter Milieus – auch als Herstellung von gruppenbezogener Integration. 63. Herstellung ästhetischen Vergnügens durch Erkenntnis der schönen Form (Ransom) und/oder Erkenntnis der schönen Gestaltung (Vivas) und/oder Empfinden der Neuheit und des Wiedererkennens (Wellek/Warren) und/oder Nachdenken und Empfinden eines losgelösten Systems und/oder Entziffern eines zweiten Codes. 64. Für Literatur-Produzenten: Hervorbringen einer Welt als eigenem Wert; für Rezipienten: Ergreifen der Möglichkeit, die Welt anders wahrzunehmen (Jauß). 65. Stillung von Innovationsbedarf in der Gesellschaft (neben Wissenschaft). 66. Modellbildung durch Wissenschaft, Spiel und Kunst (Lotman). 67. Realisierung der epochenspezifischen sozialen Wirklichkeitsmodelle in eigenem „Sinnsystem“ (Iser). 68. Negation und Utopie: Kritik der Gesellschaft durch bloße Existenz von Kunst (Adorno). 69. Ermöglichung besonderer Unmittelbarkeit des Ausdrucks beim Künstler, des Miterlebens bei Rezipienten; Umgang mit Themen, die sonst nicht ohne Angst und Schuld erlebt werden könnten; Befriedigung und Lösung von Wünschen (Psychoanalyse – F. Wyatt). 70. Selbstverwirklichung des Menschen. 71. Integrales (hedonistisch-individualistisches, kognitiv-reflexives und moralisch-soziales) Erleben; Integration von Werterfahrung, Sinnerfahrung und Selbsterfahrung (S. J. Schmidt). 72. Umgang mit Kunst als symbolische Kulthandlung: Zeremoniell, ein Tanz zum Lobpreis von etwas anderem; selbstverschuldete Unmündigkeit, Selbstentmachtung der Vernunft. 73. Imaginäres Probehandeln, entlastet von Risiken den Alltag und macht daher freier. Erneuerung der Wahrnehmung des Lebens gegen Gewohnheit, Erstarrung, Verflachung. Ziel. Ergriffenheit. 74. Schaffung von Möglichkeitsräumen. 75. Zu Naturästhetik: Konfrontation mit etwas, das keiner Intention entsprungen ist. Es ist sinnvoll, etwas ohne Sinn (wie die Natur) zu betrachten (M. Seel). 76. Aneignung von Kunst als Teil unserer Lebenspraxis, nicht-auratischer Umgang mit Kunstwerken (P. Weiß). 77. Ermöglichung von „zerstreuter Rezeption“ statt kontemplativer Versenkung (W. Benjamin). 40 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 78. Kunst in bürgerlicher Gesellschaft: Gegenwelt gegen zweckrational organisierte Gesellschaft aufbauen ( P. Bürger). 79. Bereitstellung eines Mittels zur Selbstaneignung (G. Selle). 80. Ungleiche Wirkungen und Erfahrungen auf Grund einer ästhetischen Erfahrung, die a) subjektive Verarbeitung ästhetischer Wahrnehmungsergebnisse und b) Verarbeitung objektiver Wahrnehmungstrends aus der Soziallage des einzelnen ist (G. Selle). 81. Funktionen im Bereich der Sozialstruktur (soziale Ungleichheit), des humanen Lebens, der kulturellen Ungleichheit und der politischen Gestaltung und Partizipation. 82. Kunst als Sinn- und Orientierungslieferantin, als Verbindungsmöglichkeit von Menschen, als Erhöhung des lokalen Kreativitätspotentials, als Förderin von Urbanität, als Aufwertung von Stadtteilen, als Bewahrerin des Kulturerbes, als Verbesserung des Stadtimages, als Touristenattraktion; als Teil der kommunalen Wirtschaftsförderung, als Wirtschaftspotential, als Arbeitsplatzbeschaffung. 83. Kunst als Kitt der Zwei-Drittel-Gesellschaft. 84. Stillung der romantischen Sehnsucht nach unhintergehbarem „Erlebnis“ (T. Eagleton). 85. Kunst als Kulturindustrie betrügt Massen um das, was sie ständig verspricht; erfüllt Herrschaftsfunktionen; ist Individualitätsillusion (R. Erd). 86. Roman ist Widerspiegelung insofern, als „Homologie“ zwischen Struktur des Romans und Bewusstseinsstruktur in Gesellschaft besteht (L. Goldmann). 87. Erkenntnis der Struktur der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit durch Ästhetik (Busch). 88. Immanente Kritik der Entfremdungen der Lebenswelt (Paetzold). 89. Kunst als ästhetischer Filter für Wahrnehmung, um Realität zuerkennen und zu erfragen (R. Barthes). 90. Produktivkraft; Orientierung inmitten von Not, Krieg, Entbehrung, Zerstörung; Ausgleich (wie Religion) und Entwurf eines Gegenmodells (Schurian). 41 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 6.2 Die Macht der Bilder Susanne Langer (1979) unterscheidet repräsentative, v. a. ikonische von diskursiven smbolischen Formen. Bilder und ihre Rolle im menschlichen Leben müssen daher auf ihre Wirkungsweise untersucht werden. Ich gehe dabei in die Frühzeit des Menschen zurück, da hier eine basale Funktionsbestimmung von Bildern möglich ist. Bilder und das frühe Menschsein Fels- oder Höhlenbilder lassen sich bis 8000 v. d. Z. nachweisen22. Sie finden sich in allen Teilen der Erde – und wurden an einigen Stellen der Erde bis ins 20. Jh. angefertigt. Schon früh lässt sich die Verwendung von Farbe nachweisen. Natürlich gibt es Kulturfunde wie Waffen, Werkzeuge oder Beerdigungsstätten, die weitaus länger in die Vergangenheit zurück reichen. Die Entwicklung des Menschen mit all seinen Vorstufen und Nebenzweigen dauerte einige Millionen Jahre. Das „Tier-Mensch-Übergangsfeld“ (Heberer) zwischen Pliozän und Pleistozän wird mit 10 Millionen Jahren angegeben – und spätestens der Fund von Ötzi zeigt, dass Datierungsversuche über bestimmt Aspekte der Menschheits- und Kulturentwicklung sehr rasch bei neuen Funden revidiert werden müssen. Die folgende Eingangspassage der Propyläen-Weltgeschichte dürfte jedoch unbestritten sein: „Der Mensch aber wurde geboren, als er zum ersten Mal etwas „Unnatürliches“, etwas Künstliches schuf, als er einen natürlich vorkommenden Gegenstand zu einem Artefakt umformte, zu einen erdachten, planvoll gestalteten menschlichen Produkt“ (Rust in Mann/Heuß 1991, S. 157). Ab diesem Moment „scherte er aus den biologisch-natürlichen, „gesetzmäßigen“ Entwicklungsabläufen aus und lebte unter künstlich geschaffenen Bedingungen“ (ebd. S. 159). Dieser Kulturprozess der Selbstschöpfung des Menschen beschleunigt sich in dem Maße, in dem der Mensch neue Mittel der Naturgestaltung entwickelt: Die Eroberung der Natur ist zugleich die Selbstschöpfung des Menschen als kulturell verfasstem Wesen. In diesem Kontext spielt die bildhafte Darstellung eine entscheidende Rolle. Im folgenden werde ich einige Bestimmungsmomente dieser frühen Bildpraxis entwickeln. 1. Ein erster Aspekt ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass wir heute, vielleicht 10.000 Jahre nach ihrer Herstellung, mit Hilfe der Bilder überhaupt Überlegungen zu ihrer Funktion und ihrer Wirkungsweise anstellen und so ein Stück (Kultur-)Geschichte rekonstruieren können. Bilder sind nämlich Teil eines sozialen bzw. kulturellen Gedächtnisses (Maurice Halbwachs). Sie konservieren einen kulturellen Entwicklungsstand und gestatten so 22 Mann/Heuß 1991, Bd. 1, v. a. die Abschnitte Plessner: Conditio Humana; Heberer: Die Herkunft der Menschheit; Rust: Der primitive Mensch. Es handelt sich um die Entwicklung des modernen Menschen seit der letzten Eiszeit. 42 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 die Herstellung eines bewussten Verhältnisses zur Geschichte des Menschen, sogar noch grundsätzlicher: Sie sind vitale Zeichen dafür, dass der Mensch Geschichte hat und dies bewusst erlebt. Zur Erinnerung: Eine aktuelle Bestimmung des Begriffs von Bildung versteht unter dieser die Herstellung eines bewussten Verhältnisses zu sich, zu seiner natürlichen und sozialen Umgebung, zu seiner Vergangenheit und Zukunft. Mit dieser Geschichtsfunktion, die das Bild erfüllt, realisiert sich also ein entscheidender Aspekt von Bildung. Der etymologische Zusammenhang von Bild und Bildung ist also kein zufälliger, sondern ein inhaltlicher. Als paradox mag man bewerten, dass ausgerechnet ein Medium, das in seiner Darstellung die Zeit festhält, eine entscheidende Rolle bei der Gewinnung eines Zeitbewusstseins spielt. Diese Rolle zähle ich zu den Kulturfunktionen, also zu solchen Bedingungen, die in einer Gemeinschaft erfüllt sein müssen, wenn sie Bestand haben soll. 2. Die Höhlenbilder sind Darstellungen überlebensrelevanter Situationen (vgl. Holzkamp 1978, v. a. den Beitrag „Kunst und Arbeit“). Die ikonisch-symbolische Präsentation ist Teil des Alltages, und es ist ein existentiell bedeutsamer Teil. Kunst hat also auf dieser Stufe der menschlichen Entwicklung eine unmittelbar einsichtige Überlebensfunktion. Es gibt gerade keine Kluft zwischen Alltag und Kunst. Bevor man darüber all zu sehr erstaunt ist – denn immerhin ist die erneute Herstellung dieser Einheit ein wichtiges programmatisches Ziel aller Avantgarden seit über 100 Jahren -, sollte man daran denken, dass die Trennung von Kunst und Alltag, die uns heute oft genug als selbstverständlich erscheint, in dieser heutigen Form gerade mal 200 Jahre alt ist und mit dem sozialen und politischen Gebrauch der von Schiller und Kant ausgearbeiteten „Autonomie“ zu tun hat (Bollenbeck 1994). 3. Die Darstellungsweise der Höhlenbilder ist z. T. äußerst stilisiert. Es ist offensichtlich kein Naturalismus, es ist etwa nicht der konkrete Büffel der letzten Jagd, sondern ein höchst stilisierter, geradezu abstrakter Büffel. Auch dies lässt sich aus der Funktion des Bildes erklären: Nämlich eine allgemeine – und allgemeingültige – Jagdszene darstellen zu wollen, weil nur eine solche für zukünftige Jagden auch Relevanz beanspruchen kann. Der dargestellte Büffel ist daher der Büffel schlechthin, ist die visuelle Darstellung einer Abstraktion, einer theoretischen Kategorie. Die Jagdszene wiederum enthält dadurch verallgemeinertes Wissen über das Jagen. Und dieses Wissen ist wesentliches Wissen, das auch nur stilisiert angemessen dargestellt werden kann. Dies kann man sich etwa dadurch verdeutlichen, dass eine Fotografie mit ihren vielen konkreten Einzelheiten völlig ungeeignet für diesen Zweck der Erfahrungsvermittlung wäre, eben weil sie zu sehr von den 43 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 entscheidenden Bildelementen ablenkt. Nur die verdichtete und sparsame künstlerische Form leistet dies. 4. Überleben als Mensch ist nur über die Gestaltung der Umweltbedingungen möglich. „Gestaltung“ ist eine Form von Herrschaft und Macht. Der Mensch muss Ordnungsprinzipien des zu gestaltenden Bereichs kennen bzw. entwickelt haben. Zu diesem Zweck entwickelt er „symbolische Formen“ (Ernst Cassirer)23. Das Bild als symbolische Form ist in dieser Perspektive Mittel der Ordnung, der Macht, denn es enthält Macht-Wissen. Den in der Überschrift hergestellten Zusammenhang von Bild, Mensch und Macht gibt es also schon bei dem ersten Auftreten des Bildes. Er ist vermutlich auch eine ursprüngliche Motivation zur Bildherstellung. 5. Die Macht über die äußere Natur lässt sich nur herstellen als Gemeinschaftsaktion des Stammes, der Herde oder der Gens. Viele der Jagdszenen zeigen Menschen in unterschiedlichen Funktionen, etwa als Jäger und Treiber. Diese Bilder geben also eine frühe Form von Arbeitsteilung wieder, sie sind Abbilder der sozialen Organisation der Gemeinschaft. Auch dies ist eine wichtige Kulturfunktion, die jede stabile Gemeinschaft braucht: Eine Form der Symbolisierung von Gemeinschaftserfahrung als Grundlage für die Entwicklung einer sozialen Identität. Doch geht es nicht nur um „objektive“ und notwendige Funktionsaufteilungen einer gelingenden Jagd, sondern es geht auch um die soziale Hierarchie in der Gruppe: Wer ist der Anführer, wer trägt Waffen, wer ist bloß Treiber – und wer nimmt überhaupt nicht teil? Neben dem offiziellen Lehrplan des Bildes als Bildungsmittel in der Jagdunterweisung gibt es also einen heimlichen Lehrplan, der eine gewisse soziale Hierarchie als sachlich begründet und „selbstverständlich“ darstellt. Bilder wirken als Machtmittel also auch in die Gruppe hinein, sie sind frühe Mittel des „ideologischen Klassenkampfes“. Als Zwischenbilanz kann man festhalten, dass nicht nur viele wichtige Kulturfunktionen mit Bildern realisiert werden: Bilder sind zugleich eine Einheit von Erkenntnis/Wissen, Handlungsanleitung (Ethik/Moral) und Ästhetik. Daran zu erinnern ist gerade heute relevant. Denn es gehört zur Geschichte der Moderne, dass eine als analytische Trennung menschlicher Funktionsbereiche (in Erkennen, moralisches Bewerten und ästhetisches Gestalten) im Laufe dieser Geschichte zu einer „ontologischen“ Trennung so geführt hat, dass man heute wieder 23 Ernst Cassirer (hier 1990) entwickelt seine Anthropologie/Kulturphilosophie geradezu entlang dieser Dialektik zwischen Ordnung und Freiheit mit der Quintessenz: Der Mensch kann nur auf der Basis von Ordnung seine Freiheit entwickeln und leben. 44 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 erhebliche Anstrengungen unternehmen muss, Erkenntnistheorie, Moralphilosophie und Ästhetik zusammen zu denken.24 In (reform-)pädagogischer Formulierung heißt dies: die Einheit von Kopf, Herz und Hand ist wieder herzustellen. Zur Reflexivität des Sehens und der Bilder Offensichtlich braucht der Mensch Bilder zum Überleben. Es sind Bilder von sich und seiner Lebenswelt. Bilder sind also Mittel der Selbstbezüglichkeit und Selbstreflexivität. Genau dies scheint notwendig zum Menschsein zu gehören: Der Mensch ist dasjenige Wesen, das sich immerzu – und offenbar ausschließlich – über sich selber verständigen muss. „Dass Selbsterkenntnis das höchste Ziel philosophischen Fragens und Forschens ist, scheint allgemein anerkannt,“ so beginnt Ernst Cassirer (1990) seinen „Versuch über den Menschen“. Bilder sind also auch eine praktische Form von Philosophie „avant le lettre“. Ihre ikonische Präsentationsform erzwingt eine anschauende Zugangsform. Es ist also ein Augenblick – ein Blick der Augen -, mit dem die Totalität des Bildes erfasst wird, und dieses wiederum erfasst auf spezifische Weise eine Totalität des Gegenstandes.25 Zu dieser Totalität des Gegenstandes – und dies führt zu einer entscheidenden, vielleicht der wichtigsten anthropologischen Erkenntnis – gehört der Betrachter selbst. Das Bild als eine distanzierte Betrachtung einer Situation, in der sich die urzeitlichen Betrachter selber befunden haben und wieder befinden werden, ist also die gleichzeitige Verkörperung von Involviertheit und Distanz. Es hat bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts gedauert, bis die Philosophie diesen Mechanismus angemessen erklären konnte. Helmut Plessner (1970, 1983, 1965), Biologe und Philosoph, hat dies mit seinem Konzept der „exzentrischen Positionalität“ geleistet: Der Mensch unterscheidet sich vor allem dadurch wesentlich von den anderen Arten und Gattungen, dass er – virtuell oder fiktiv – aus seiner Mitte heraustreten und sich selber zum Gegenstand von Betrachtungen machen kann. Jedes andere Lebewesen lebt selbstverständlich – aber unbewusst – in seiner Mitte. Nur der Mensch sieht sich bewusst in seinen Lebensvollzügen, hat Geschichte und Zukunft und verfügt nicht mehr über eine instinktgesteuerte Selbstverständlichkeit des Überlebens: Er muss sein Leben führen. Diese Distanz zu sich selber ermöglicht also Reflexivität, ermöglicht, dass er sich auf vielfältige Weise zum Gegenstand unterschiedlichster Betrachtungen machen kann. 24 Zum Verhältnis von Ethik und Ästhetik siehe etwa Wulf/Kamper/Gumbrecht 1994. Man informiere sich einmal in einem etymologischen Wörterbuch über das komplexe semantische Feld der Worte „sehen“ und „schauen“. 25 45 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 „Reflexivität“ meint dabei nicht nur kognitives Überlegen oder diskursive Erörterung, sondern sie ist zugleich Grundmechanismus seiner Sinnlichkeit: Auch das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen sind reflexiv. Auf besonders komplexe Weise ist das Sehen, speziell das Sehen von Bildern, reflexiv: a. Beim Sehen nimmt der Mensch nicht bloß visuell einen Gegenstand wahr. Er nimmt sich selbst auch als Sehenden wahr. b. Insbesondere betrachtet sich der Mensch selbst beim Handeln: Er ist also zugleich Subjekt und Objekt des Sehens, eine Rückkopplung, die wiederum u. a. zur erheblichen Verbesserung seiner Steuerungsfähigkeit führt. c. Beim Sehen von Bildern gilt nicht nur diese doppelte Reflexivität: Er hat es zugleich mit einem Gegenstand zu tun, der selber eine reflektierte Stellungnahme zur Welt enthält. Sehen von ästhetisch gestalteten Bildern ist also mitnichten simple Wahrnehmung, sondern Auseinandersetzung mit einer spezifischen Reflexionsleistung. Und immer wieder begegnet er in diesen Prozessen der Wahrnehmung/Reflexion sich selbst: Er sieht – durchaus in Hegelschem Sinne – seine individuelle Existenz „aufgehoben“ in der Kulturleistung der Gattung Mensch. Auch die individuellste Versenkung in ein Bild führt daher zur sozialen Integration, insofern das Bild als Menschenwerk gesehen wird und daher nach menschlicher Erfahrung in diesem Bild gefahndet werden kann. Zudem ist das Bild – ob nun gegenständlich oder nicht – eine abgeschlossene Ganzheit, ein gestalteter kleiner Kosmos, der im Hinblick auf Ordnungsprinzipien befragt werden kann. Bilder sind also wichtige Mittel einer reflexiven Stellungnahme zu sich und seiner Beziehung zur Welt26. Sie sind symbolische Ordnungs- und Machtmittel nach draußen in Richtung äußere Natur und nach innen in Richtung soziale Gemeinschaft. Eine anthropologische Erklärung der Entstehung des „Ästhetischen“ (s. o.) zeigt zudem, dass Bilder entschieden Macht- und Ordnungsmittel auch gegenüber der inneren Natur des Menschen sind. E. Neumann erläutert – wie gesehen – mit hoher Plausibilität, wie der Mensch mit der durch seine exzentrische Positionalität erzeugten Bewusstheit feststellen muss, dass er von Fress-Feinden oder anderen natürlichen Gefahren umgeben ist: Er lebt (schon lange vor Ulrich Becks Analyse der Moderne) in einer „Risikogesellschaft“ – und In der Entwicklung der Malerei sind es G. Braque („Die Sinne lügen“) und vor allem Paul Cézanne, bei denen eine Einbeziehung der theoretischen Reflexion des Sehens in den Prozess der Bildentwicklung selbst stattgefunden hat, was sie zu Gründervätern des späteren Kubismus hat werden lassen. In jedem Fall macht sie ihre „reflektierte“ Malerei zu denjenigen Vertretern der bildenden Kunst, die aus philosophischer bzw. soziologischer Sicht besonders gerne analysiert werden, etwa von Merleau-Ponty (vgl. Boehm 1994) bzw. Gehlen 1986. Insbe26 46 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 er bemerkt dies. Die Folge wäre Angst und Panik, wäre letztlich Verrücktheit, würde er nicht sofort eine Möglichkeit entwickeln, seine Panik zu bearbeiten und schließlich zu beherrschen: Und dieses Mittel ist ästhetische Expressivität, ist gestaltete Bewegung, sind gestaltete Töne, ist die plastische oder zeichnerische Gestaltung. Ästhetische Praxis ist also auch dort, wo sie nicht unmittelbar überlebensrelevant scheint, also dort, wo sie keine Gebrauchsgegenstände herstellt, Waffen schmiedet oder Feste gestaltet, ein symbolisches Mittel der Ordnung. 6.3 Theater als symbolische Form Insofern Theater die oben genannten Kulturfunktionen erfüllt, ist eine individuelle Involviertheit in das Theater zugleich die Realisierung theatraler Bildung. Doch nun zur symbolischen Form Theater. Als eine Grundlagentheorie für kulturelle Bildung wurden oben die Anthropologien/Kulturphilosophien von Plessner und Cassirer eingeführt. Offensichtlich realisiert das mimetische, also nachahmende Spiel als bereits früh in der Menschheitsgeschichte auftauchende Handlungsform nahezu maßgeschneidert die „exzentrische Positionalität“: Menschen schlüpfen in Rollen und zeigen sich und anderen bestimmte Handlungsabläufe, oft in vielfältigen Wiederholungen (Rituale). Sie machen damit für sich Situationen und Emotionen erlebbar und kommunizierbar. Sie treten aus der unmittelbaren Lebenssituation heraus und „schauen“ auf sich selbst (so wie es die griechische Wortbedeutung von „Theater“ nahelegt). 27 Diese Form von Mimesis unterscheidet sich von der „anschauenden Reflexion“ im Umgang mit einem Bild, bei dem bewusst in stilisierter Form die Zeit stillgestellt ist. Hier handelt es sich um körperhafte Präsenz im zeitlichen Ablauf. Es ist also kein Wunder, dass Helmut Plessner (1982, S. 146ff) nicht bloß eine „Anthropologie“ des Schauspielers geschrieben hat, sondern auch derjenige war, der nach dem zweiten Weltkrieg die soziologische Rollentheorie in Deutschland eingeführt hat. Denn es ist kein bloß metaphorischer Sprachgebrauch, den Prozess der Sozialisation mit dem Theaterbegriff der „Rolle“ zu konzeptionalisieren, sondern genau dies ist wörtlich zu nehmen (Goffman: „Wir alle spielen Theater“).28 Es ist eben notwendig, die Unmittelbarkeit des eigenen Ich zu verlassen und sich im Sinne einer Perspektivverschränkung mit den Augen anderer zu sehen, wenn man eine persönliche Identität entwickeln will. sondere scheint der Begriff der Bildrationalität von Gehlen ertragreich bei dem Verständnis von Bildern zu sein; vgl. auch die Auseinandersetzung in Holz 1990ff. 27 Vgl. hierzu Wulf 1997, insbes. die Artikel „Theater“ (E. Fischer-Lichte), „Ritual“ (Wulf) und „Mimesis“ (Wulf). 28 Hierzu gibt es aus marxistischer Sicht jedoch auch Kritik: Kirchhoff-Hund 1978. 47 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Das Theater liefert in jüngster Zeit weitere Erklärungsmöglichkeiten für gesellschaftliche Prozesse. So spricht man – eben aufgrund der gewachsenen Relevanz der Postmoderne und der Betonung der Oberfläche und des Scheins – zunehmend von einer „Inszenierung der eigenen Person oder des öffentlichen Lebens“. Die Stadt wird als „Bühne der Sichtbarkeit“ verstanden, bei der bewusst gestaltet wird29, was man zeigen will und was nicht. Generell spielt in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft „Theatralität“ eine zunehmend wachsende Rolle. Hier ist die Postmoderne nur ein letzter kräftiger Akzent: „Dass theatralisches Gebaren durchaus zum Instrumentarium gesellschaftlicher Kommunikation gehört, ist eine über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg zu betrachtende Erscheinung. Beschneidungsriten, zirzensische Spiele, Gottesdienste, Prozessionen, Festumzüge, Aufmärsche, militärische Manöver und Paraden, „Haupt- und Staatsaktionen“, Demonstrationen, Parteitage: Die Inszenierung von Festen, die Architektur, die Stadtgestaltung, ja: das Verständnis allen sozialen Handelns nach Maßgaben des Theaters – oft allerdings in der negativen Bewertung von Verstellung und Manipulation – prägt das Selbstbild der Gesellschaft seit langem“.30 In dieser Situation war es dann nur noch ein kleiner Schritt zu der umfassenden Inszenierung aller lebensweltlichen Bereiche, so wie sie in jüngster Zeit registriert wird. Bill Clinton gilt in diesem Zusammenhang als erster US-Präsident, dessen Politik – in ihrer Präsentation und in ihren Inhalten – nur noch über ihre Inszenierungsqualität und ihre Akzeptanz beim Publikum gesteuert wird. Theatrale Bildung erhält hier geradezu gesellschaftskritische Bedeutung, denn es ist die spezifische Symbolkompetenz des Theaters, die helfen kann, öffentliche Inszenierungen zu durchschauen. 6.4 Musik, Bildung und der Mensch Auch bei der Musik sind unterschiedliche Zugänge möglich, so wie sie das „semiotische Viereck“ nahelegt: Die pragmatische Dimension als Umgang des Menschen mit Musik wird in Musikpsychologie und -soziologie untersucht, wobei gerade die Musiktherapie vielleicht die wichtigsten Einblicke in die Wirkung von Musik auf den Menschen gestattet. 29 Als kritische Anwendung auf die (Kriminalisierung von) Jugend siehe Breyvogel 1998. Vgl. auch Meyer 1992. 30 Kröplin: Theatralität als gesellschaftliches Phänomen im 19. Jahrhundert. In: Andraschke/Spaude 1992, S. 85ff. Zur „performative turn“ in den Kulturwissenschaften siehe Fischer-Lichte 2001. 48 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Die Syntax als Studium der Formensprache ist – etwa als „systematische Musikwissenschaft“ – weit entwickelt, da gerade in der Musik und Musikwissenschaft eine immanente Sichtweise dominiert. Ein offenes Problem ist daher die Frage nach der Semantik in ihren beiden Dimensionen: zum einen im Hinblick auf eine gegenständliche Referenz, was – mit berühmten Ausnahmen etwa von Lautmalereien (z. B. in „Peter und der Wolf“) – eine kleine Rolle spielt; zum anderen im Hinblick auf die „Bedeutung“, so wie sie in der „Musikalischen Hermeneutik“ untersucht wird. Hauptstreitpunkt ist hier die Frage danach, ob Musik überwiegend oder sogar ausschließlich Ausdruck menschlicher Emotionen ist („Gefühls- oder Ausdrucksästhetik“). Hier spielt Eduard Hanslick mit seiner Forderung nach einer Formalästhetik im neuen musiktheoretischen Diskurs eine entscheidende Rolle („Der Inhalt der Musik sind tönend bewegte Formen“). Eine Betrachtung von Musik, die das Werk in den Mittelpunkt stellt, kann – vor dem Hintergrund der hier vorgestellten (Cassirerschen) Kulturphilosophie – alle anthropologischen Grundgesetze an der Musik zu verifizieren versuchen: das musikalische Werk als Vergegenständlichung menschlicher Wesenskräfte, die auf diese Weise kommunikabel und kumulativ weiter entwickelt werden können Musik als Stellungnahme zu sich und seinem Verhältnis zur Welt und vor allem: Musik als strukturierter Kosmos, als Ordnung in Raum und Zeit. Da also selbst die (objektive) Form als Moment von Ordnung in ihrer anthropologischen Bedeutung von Cassirer herausgehoben wurde – und die Ausdrucksästhetik ohnehin auf die Emotionalität des Menschen verweist, will ich bei meinen Anmerkungen zur Musik auch hier wieder einen subjektorientierten Standpunkt einnehmen, Musik also aus der Perspektive des Menschen und seiner musikalischen Praxis betrachten. An dieser Stelle erweist sich die „Anthropologie der Musik“ von Wolfgang Suppan (1984) als ausgesprochen hilfreich. Bereits seine Kapitelüberschriften lassen die Passfähigkeit seiner Aussagen zu den hier formulierten Grundvorstellungen erkennen: „Musik ist Teil der Symbolwelt des Menschen: Mitteilung, Kommunikation, Interaktion“, darunter „Musik als Sprache der Sinne“, sowie „Musik als Gebrauchsgegenstand und als Teil seiner biologischen und kulturellen Evolution“. "Die Aufbereitung der Fakten/Materialien in Kapitel C dieses Buches (in dem zahlreiche ethnologische, medizinische etc. Forschungs-Ergebnisse gesammelt sind; M. F.) wollte zeigen, daß Musik nicht zufälliges Dekor oder Ornament lebenswichtiger Vollzüge des Alltags sei, 49 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 sondern an sozial wichtige Verrichtungen geknüpft ist: An Riten und Zeremonien, an Kult und Gottesdienst, an Politik und Rechtswesen, an die Heilung von Kranken; um meditative Trauerzustände zu erreichen; bei körperlicher und geistiger Arbeit; im Zusammenhang mit Erotik, Sexualität, Gebot, Initiation, Totenbestattung, Klage, Kampf, Jagd, Krieg; um Tanz und Ballett, gesprochenes und gesungenes Theater, Poesie, Puppenspiel deren spezifischen Qualitäten zu garantieren." (Suppan 1984, S. 190 f.). Auch für Musik gilt das allgemeine anthropologische Gesetz, dass selbst im höchst Individuellen stets die Allgemeinheit des Gattungswesens zu erkennen ist. Hans Heinz Holz entwickelt diese Gedanken in Anschluss an Lukacs (und Hegel) am Beispiel der Bildenden Kunst. Der Musiker und Psychologe Klaus Holzkamp überträgt dies auf die Musik: „So gesehen sind in vorfindlicher Musik stets auf irgendeine Weise Möglichkeiten zur Bewältigung, Gestaltung, Steigerung subjektiver Befindlichkeit historisch kumuliert. Im Vollzug der musikalischen Bewegung hebt sich in meinem Befinden das Wesentliche, Überdauernde, Typische gegenüber deren bloßen Zufälligkeiten und Zerstreutheiten meines Befindens heraus.... Meine eigene Befindlichkeit tritt mir in der Musik in überhöhter, verallgemeinerter, verdichteter Form entgegen, ohne daß dabei die sinnlich-körperliche Unmittelbarkeit meiner Betroffenheit reduziert wäre... . Ich mag aber über die Musik... eine neue Distanz zu meinen aktuellen emotionalen Lebensäußerungen gewinnen, wobei diese Distanz nicht nur "kognitiver" Art ist, sondern ihre eigene unverwechselbare Erfahrungsqualität gewinnt: Als "innere Ruhe", Übersicht, Gelassenheit, bis hin zur kontemplativen Versunkenheit als Gegenpol zu musikalischer Extase. In jedem Fall gewinne ich aber über die Musik eine neue Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber den Anfechtungen und Wirrnissen des Naheliegenden - ändere ich durch meine Ergriffenheit von Musik, die mir keiner wegnehmen oder ausreden kann, mich selbst, meine Lebendigkeit, meine widerständige Präsenz in dieser Welt, quasi in reiner und gesteigerter Form erfahre, bin ich – mindestens vorübergehend – weniger bestechlich und nicht mehr so leicht einzuschüchtern." (Holzkamp 1993, S. 70) Ich will diese Grundgedanken, die im Kern das aussprechen, was (musikalische) Bildung ausmacht, durch einige längere Zitate aus der aktuellen Diskussion – speziell um die Neue Musik – ergänzen. Ich greife etwa auf Helmut Lachenmann zurück, der „bedeutendste Komponist seiner Generation“ (so der Klappentext in Lachenmann 1996) und ein profunder Theoretiker der Musik: „Musik, wie Kunst überhaupt, denkt – über jede unmittelbare kulturelle Dienstleistung hinaus – in jedem Werk fundamental über sich selbst neu nach. Diese Erfahrung kann man an historischer Musik weithin verdrängen und unterschlagen, weil man an deren Klangerscheinung schon gewohnt ist und weil sie so zum unreflektierten, unangefochtenen Kulturmobiliar gehört. Aber in Neuer Musik kann man solcher Verunsicherung nicht ohne weiteres ausweichen – und dies führt zum Dauerkonflikt mit der allgemein dominierenden Bequemlichkeit und ist letztlich der Grund für solche Entfremdung und schlimmer noch: für Interesselosigkeit, und ist doch zugleich das entscheidende Gütezeichen von Musik in einer Gesellschaft, die sich gedankenlos an ihre Gewohnheiten anklammert und sich die – falsch verstandene – Tradition als warme Bettdecke über den Kopf zieht, und die in einem 50 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 ganz bestimmten gegebenen kulturellen Klima unfähig ist zu erkennen, dass die Lebendigkeit von Kunst in nicht anderem beruht als in ihrer Möglichkeit der Provokation. Provokation, das heißt: Ausbruch aus eingeschliffenem Hörverhalten und zugleich Angebot an die Wahrnehmung; Angebot, anders zu hören, im Hören übers Hören nachzudenken, sich immer von neuem dem Ungewohnten zu öffnen, sich ihm auszusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Damit ist Kunst keineswegs „definiert“, wohl aber wird so an einen wesentlichen Aspekt von Kunst erinnert, mit dessen allgemeiner Verdrängung die Schwierigkeiten Neuer Musik in der Öffentlichkeit direkt zusammenhängen. Die allgemeine Interesselosigkeit, Kern des Problems „Neue Musik“, ist zu einem großen Teil nichts als mangelnde Aufklärung in diesem Sinn. Der Hunger, gerade auch der Jugend, nach einer Kunst, in der sie ihre Situation, wie auch immer vermittelt, wiedererkennt, ist da. Der Missbrauch dieser Aufnahmebereitschaft durch kommerziell orientierte Interessen ist heute größer und gefährlicher als irgendwann früher. Neue Musik, Kunst allgemein, kann durch ihr bloßes Irgendwo-Vorhandensein dem kaum entgegenwirken.“ (Lachenmann 1996, S. 335) Der Grundgedanke, auf den es mir an dieser Stelle ankommt, ist die Hervorhebung der Reflexivität des Hörens, wobei der Reflexionsprozess über das Hören selber erfolgt. Ebenso wie ich eine dreifache Reflexivität des Sehens unterschieden habe, lässt sich dies beim Hören tun: Ich höre, erlebe mich selbst als Hörenden und höre in einer komponierten Musik eine reflektierte Stellungnahme zum Hören und zur Welt. Hören von Musik ist also Sinnlichkeit, ist Auseinandersetzung mit Vorstellungen anderer vom Hören, ist Auseinandersetzung mit verallgemeinerter Emotionalität und führt geradezu zwanglos von Sinnlichkeit und Emotionalität zur Auseinandersetzung mit Ordnung: „Wir trauen offenbar also den Kindern, als den Entdeckenden und Lernenden schlechthin, und zwar durchaus als lustvolle Erfahrung der eigenen Möglichkeiten, tatsächlich das zu, was wir Erwachsenen, wo es uns selbst zugemutet wird, als unbequem verdrängen und dem wir uns in der Kunst so gern bequem verschließen: nämlich die Erfahrung der Horizont-Erweiterung und der eigenen Veränderbarkeit. Solche Erfahrung, vollends in der Kunst, ist unbequem für uns Erwachsene, weil sie uns an die eigene Verfestigtheit und zugleich an die eigene Verantwortung erinnert, solche Verfestigtheit zu überwinden, den Kopf aus dem Sand zu ziehen und den Blick auf den Spiegel unserer Wirklichkeit auszuhalten, einer Wirklichkeit, die – vom Menschen verursacht – nun diesem selbst offenbar zur Bedrohung geworden scheint, einer Wirklichkeit, vor der wir uns in der Kunst immer wieder in die Utopie eines scheinbar intakten Welt- und Menschenbildes flüchten und uns verzweifelt daran klammern. In der Musik, die, wenn sie die Bezeichnung Kunst verdient, auf ihre Weise an solche Kräfte und Möglichkeiten des Menschen über dessen ästhetische Erfahrung gemahnt, bedeutet dies wahrnehmungstechnisch etwas sehr Einfaches und zugleich doch Schwieriges: nämlich den scheinbaren Umweg des Erlebnisses zum Gemüt über das Denken und übers Bedenken. Noch pragmatischer eingeengt: den scheinbaren Umweg zur ästhetischen Empfindung über die Bewusstmachung der im Werk wirkenden Strukturen, das heißt: der im Werk wirkenden immanenten und übergreifenden Zusammenhänge; das Erlebnis von musikalischem Ausdruck also nicht bloß als irrational empfundenem Gemüts-Reiz unseres Sensoriums, sondern Ausdruck als Resultat einerseits von neu zu Grunde gelegten Regeln, andererseits aber auch als Resultat der Überwindung von bereits vorgegebenen Spielregeln.“ (Lachenmann 1996, S. 163) 51 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Lachenmann entwickelt geradezu parallel zu dem Begriff des sehenden (bewussten) Sehens von Imdahl ein Konzept des hörenden Hörens, wenn er Hören als „Abtastvorgang (bezeichnet), welcher Rückschlüsse auf die im Werk wirkenden Bauprinzipien und darüberhinaus auf die zu Grunde liegende expressive und ästhetische Haltung ermöglicht...“. (S. 166). Abb. 15 Sinnesart Sehen Hören Wahrnehmungsgegenstand Sichtbares/ Optisches Hörbares/ Akustisches Reflexivität 1 Reflexivität 2 Reflexivität 3 sich sehend erle- sich selber (ganz Sehen einer visuben oder teilweise) ellen Stellungsehen nahme (Kunstwerke) sich hörend erle- sich selber hören Hören einer muben sikalischen Stellungnahme (Komposition) Sehen und Hören gehören zu den (privilegierten) „höheren“ Sinnen, die man daher auch bis hin zur Kunstförmigkeit kultiviert hat. Riechen, Schmecken und Tasten – die ersten beiden als „chemische Sinne“ – sieht man eher am triebhaft-naturnahen Wesenskern des Menschen, zumal die Zivilisationsgeschichte hier zu einem Verlust ursprünglicher Funktionen geführt hat; Beispiel Nase/Riechen: Witterung einer drohenden Gefahr, Suche nach kopulationsbereiten Sexualpartnern, Aufspüren von Nahrung. Inzwischen können massive Lebensgefahren von diesen Sinnen nicht mehr aufgespürt werden (Ozonloch, Vergiftung von Lebensmitteln, Krankheiten); und es hat sich zudem eine Unlust in ihrem Gebrauch ergeben (Peinlichkeit und Scham gegenüber biologischen Gerüchen, als aufdringlich empfundene Körpernähe; vgl. Artikel „Nase“ und „Mund“ (beide von Mattenklott) und „Haut“ (O. König) in Wulf 1997; siehe auch Burdach 1988). Vielleicht mag es zur Beruhigung beitragen, dass nach wie vor durch Geruch, Geschmack und Tastempfindungen erhebliche körperliche Reaktionen ausgelöst werden, die die Kochkunst und die Parfümindustrie weidlich nutzen, so dass sich auch hier die Naturseite des Menschen heftig zu Worte meldet (siehe die Kulturgeschichte dieser Sinne, etwa Corbin 1984). Musik über einen anthropologischen Zugang zu verstehen, heißt dann auch, sich mit den subjektbezogenen Kategorien des Genusses, des Erlebens, der musikalisch(-ästhetischen) Erfahrung auseinander zu setzen. Darauf stützen sich – zurecht – vorliegende Kataloge zur Begrün52 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 dung musikalischer Bildung, die die Rolle von Musik bei der Bildung, Humanisierung, Kultivierung, Entwicklung und Sensitivität, in ihrer human-biologischen Notwendigkeit, als Mittel der Sinnsuche etc. durchdekliniert (vgl. etwa Kaiser 1995). Da in solchen Lernzielkatalogen und bei der theoretischen Erfassung von Musik insgesamt die Nähe zur Emotionalität in der Musik hervorgehoben wird, gebe ich eine Übersicht von H. Rösing (Bruhn/Oerter/Rösing 1993, S. 580/1) wieder (Abb.16). Bei Rolle (1998) finden sich solche Vorstellungen zwar auch, doch reicht die von ihm ausgewählte Kategorie der „ästhetisch-menschlichen Erfahrungen“ erheblich weiter: a. „Ästhetische Erfahrungen sind vollzugsorientiert. Sie unterscheiden sich von nichtästhetischen unter anderem dadurch, dass wir sie zwar machen, nicht aber haben können. Von musikalischen Erfahrungen in diesem ästhetischen Sinne zu reden, ist nur sinnvoll, wenn wir damit auf den Erfahrungsprozess abheben. So weit wir das sedimentierte Erfahrungswissen, Erfahrung als Resultat, meinen (in dem Sinne, dass jemand musikalische Erfahrung hat), ist es besser, von nicht-ästhetischer musikbezogener Erfahrung zu sprechen. b. Ästhetische Erfahrungen machen wir in der Auseinandersetzung mit einer sinnlich wahrnehmbaren materialen Grundlage, nämlich insofern diese ästhetisch wahrgenommen wird. Ästhetisch-musikalische Erfahrungen haben stets auditive Wahrnehmungsprozesse zur Grundlage. Nicht-ästhetische (sondern theoretische) Erfahrung im Umgang mit Musik zeigt sich dagegen beispielsweise in der analytischen oder klassifizierenden Tätigkeit eines Musikwissenschaftlers. c. Erfahrungen haben immer einen Subjekt-Bezug, weil sie immer die Erfahrungen von jemandem sind. Ästhetische Erfahrungen haben darüber hinaus reflexiven Charakter, insofern ich in ihnen immer auch eine Erfahrung mit mir mache. Erfahrungswissen ist Wissen, das für mich bedeutsam ist. In ästhetischen Erfahrungen wird diese persönliche Bedeutung thematisiert. Ästhetische Erfahrung ist durch eine Ichaffiziertheit gekennzeichnet, die als ästhetisch genussvoll erlebt wird. d. Nicht-ästhetische Erfahrung kann sich als nützlich erweisen, insofern das von ihr hervorgebrachte Wissen eine handlunsorientiertende Funktion gewinnt. Die vollzugsorientierte ästhetische Erfahrung ist nicht in dieser Weise instrumentalisierbar. Gleichwohl ist ästhetische Erfahrung wirksam, insofern sie bisherige Einstellungen bestätigt oder verunsichert und damit Neuorientierungen provoziert. Dass ästhetisch-musikalische Erfahrungen selbstzweckhaft vollzogen werden, bedeutet nicht, dass sie keinen Bezug zum Leben hätten.“ (Rolle 1998, S. 79 f.). Insbesondere spielen ästhetische Erfahrungen bei der Gewinnung eines Selbst- und Weltverhältnisses eine Rolle, sind also Moment der (anthropologisch als notwendig erwiesenen) Selbstbeschreibung des Menschen in seinem sozialen und natürlichen Kontext. Musik ist daher – wie jede andere künstlerische Praxis – Arbeit an sich selbst, Arbeit insbesondere am individuellen Sinn, was vor allem heißt: Bewertung individueller und gesellschaftlicher Lebensumstände und Rückbezug auf eine übergeordnete Ganzheit („Integration“) bzw. ein globaleres (Lebens-)Ziel. Dies tun auf ihre Weise alle symbolischen Formen. Daher ist es nützlich und sinnvoll, die Unterteilung von Susanne Langer (1979) zu übernehmen. 53 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Diese unterscheidet auf der Basis von Ernst Cassirer „diskursive“ und „präsentative Formen“, Abb. 16: Musik und Emotion 54 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 wobei sie die Musik „als echtes Symbolsystem“, allerdings ohne feststehende Konnotation, bezeichnet (S. 235): Musik ist unvollendetes Symbol, eine sinnhaltige Form ohne konventionellen Sinngehalt (S. 236). Musik – macht Züge von Welt und personalem Leben zugänglich, so wie jede symbolische Form, allerdings anders als diskursive Sprache, so auch der Symboltheoretiker Nelson Goodman (1990, 1997; vgl. Pothast in Musik & Ästhetik, Heft 10/April 1999, S. 101ff). Vor diesem Hintergrund erhalten Ergebnisse aus einer sorgfältigen qualitativen Studie von Mollenhauer u. a. (1996) eine weitere Begründung. Ich gebe aus der Zusammenfassung dieser Studie einige hier relevante Aussagen (verkürzt) wieder: 1. „Ästhetische Bildung“ ist Teil der Auseinandersetzung des Menschen mit „Welt“, ist Moment der Weltaneignung. 2. Diese Auseinandersetzung erfolgt – im Produktiven und Rezeptiven – stets tätig: „Ästhetische Erfahrung“ heißt also in dieser Hinsicht: seine eigene Symbolisierungsfähigkeit erfahren als produktiven Umgang mit den bisher erworbenen Anteilen des Selbst, in Relation zu dem bildnerischen und musikalischen Material, das kulturell überhaupt zur Verfügung steht.“ (S.254) 3. Auf der Basis der These von der „exzentrischen Positionalität“ (Plessner) dokumentiert das ästhetische Produkt Differenzerfahrung: Ästhetische Erfahrung ist also auch eine Erfahrung mit den anthropologischen Vorgaben, die das Subjekt in seinem Organismus vorfindet“. (S. 255) 4. Ästhetische Erfahrung ist sozial im Sinne eines individuellen Bezugs zum Allgemeinen (zur „Gattungsnormalität“, wie Lukacs und Holz, aber auch Holzkamp sagen; s.o.), wobei auch die Differenz zwischen Individuell-Besonderem und Seelisch-Allgemeinem präsent bleibt. 5. Diese Differenzerfahrung kann kritisch-emanzipatorisch gewendet werden (siehe auch das Holzkamp-Zitat). Literatur Andraschke, A./Spaude, E. (hg.): Welttheater. Die Künste im 19. Jahrhundert. Freiburg: Rombach 1992. Boehm, G. (Hg.): Was ist ein Bild? München: Beck 1994. Bollenbeck, G.: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. München: Insel 1994. Bourdieu, P./Wacquant, Loie J. D.: Reflexive Anthropologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1996 55 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987. Bourdieu, P.: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Bourdieu, P.: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M. Suhrkamp 1987/1994. Bourdieu, P.: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994 (1974). Breyvogel, W. (Hg.): Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität. Bonn: Dietz 1998. Bruhn, H./Oerter, R./Rösing, H. (Hg.): Musikpsychologie. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt 1993 Burdach, K. J.: Geschmack und Geruch. Gustatorische, olfaktorische und trigeminale Wahrnehmung. Bern/Stuttgart/Toronto: Huber 1988. Cassirer, E.: Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte. Darmstadt: WBG 1961. Cassirer, E.: Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Darmstadt: WBG 1953 (1923) / 1953 (1924) / 1954 (1929). (PSF) Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Frankfurt/M.: Fischer 1990 (Original: 1944). Cassirer, E.: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstadt: WBG 1956. Cassirer, E.: Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien. Darmstadt: WBG 1961. (LK) Corbin, A.: Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs. Berlin: Wagenbach 1982. DeSousa, R.: Die Rationalität des Gefühls. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997 Erpenbeck, J.: Wollen und Werden. Ein psychologisch-philosophischer Essay über Willensfreiheit, Freiheitswillen und Selbstorganisation. Konstanz: Universitätsverlag 1993. Fischer-Lichte, E.: Semiotik des Theaters. Drei Bände. Tübingen: Narr 1988. Fischer-Lichte, E.: Theater im Prozeß der Zivilisation. Tübingen/Basel: Francke 2000. Fischer-Lichte, E.: Vom "Text" zur "Performance". Der "Performative Turn" in den Kulturwissenschaften. In Kunstforum..., 2001, S. 61ff. Fuchs, M./Liebald, Chr. (Hg.): Wozu Kulturarbeit? Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik und ihre Evaluierung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Remscheid: BKJ 1995. Fuchs, M.: Bildung, Kunst, Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der kulturellen Bildung. Remscheid: BKJ 2000 Fuchs, M.: Kultur Macht Politik. Studien zur Bildung und Kultur der Moderne. Remscheid: BKJ 1998. Fuchs, M.: Kulturelle Kompetenzen für eine veränderte Arbeitswirklichkeit. Vortrag im Rahmen des Projektes "Arbeit und Kultur". Fuchs, M.: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998. 56 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Fuchs, M.: Mensch und Kultur. Anthropologische Grundlagen von Kulturarbeit und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Historische und systematische Studien zu ihrer Genese. Leverkusen: Leske + Budrich 2001 Fuchs, M.: Wozu Kulturpolitik? Deutscher Kulturrat. www.kulturrat.de/Diskussion (April 2001). Gehlen, A.: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn: Athenäum 1950. Gehlen, A.: Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei. Frankfurt/M.: Klostermann 1986. Gerhardt, V.: Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität. Stuttgart: Reclam 1999. Gerhardt, V.: Ästhetische Kommunikation der Moderne. Bd. 1 + 2. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1993. Gerhardt, V.: Individualität: das Element der Welt. München: Beck 2000. Gethmann-Siefert, A.: Einführung in die Ästhetik. München: Fink 1995. Glasersfeld, E. v.: Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt/M.:Suhrkamp 1996. Goodman, N.: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Goodman, N.: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1990. Hepp, A./Winter, R. (Hg.): Kultur - Medien - Macht. Cultural Studies und Medienanalyse. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997. Hermand, J./Trommler, F.: Die Kultur der Weimarer Republik. München: Nymphenburger 1978. Hermand, J.: Die Kultur der Bundesrepublik Deutschland 1965 - 1985. München: Nymphenburger 1988. Hermand, J.: Kultur im Wiederaufbau. Die Bundesrepublik Deutschland 1945 - 1965. München: Nymphenburger 1986. Holz, H. H.: Philosophie der bildenden Kunst. Drei Bände. Bielefeld: Aisthesis-Verlag 1996/1997/1998. Holzkamp, K.: Gesellschaftlichkeit des Individuums. Köln: PRV 1978. Holzkamp, K.: Grundlegung der Psychologie. Frankfurt: Campus 1983. Horkheimer, M./Adorno, Th.: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/M.: Fischer 1971 (zuerst 1944). Hörning, K.-H./Winter, R.: Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Jurt, J.: Das literarische Feld. Das Konzept Pierre Bourdieus in Theorie und Praxis. Darmstadt: WBG 1995. Kaden, C.: Des Lebens wilder Kreis. Musik im Zivilisationsprozeß. Kassel: Bärenreither 1993 Kaiser, H. J.: Die Bedeutung von Musik und Musikalischer Bildung. In: Musikforum 83, Dezember 1995, S. 17ff. 57 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Kirchhoff-Hund, B.: Rollenbegriff und Interaktionsanalyse. Soziale Grundlagen und ideologischer Gehalt. Köln: PRV 1978. Klein, G.: FrauenKörperTanz. Eine Zivilisationsgeschichte des Tanzes. Weiheim/Berlin: Quadriga 1992 Klinger, C.: Flucht, Trost, Revolte. Die Moderne und ihre ästhetischen Gegenwelten. München/Wien: Hauser 1995. Kneer, G./Nassehi, A./Schroer, M. (Hg.): Soziologische Gesellschaftsbegriffe. Konzepte moderner Zeitdiagnosen. München: Fink/UTB 1997. Krause, D.: Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhman. Stuttgart: Enke 1999. Lachenmann, H.: Musik als existenzielle Erfahrung. Schriften 1966 – 1995. Hg. Josef Häusler, Wiesbaden 1996. Langer, S. K.: Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Mittenwald: Mäander 1979. Luhmann, N.: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997. Luhmann, N.: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Lukacs, G.: Ästhetik I - IV. Neuwied usw.: Luchterhand 1972. Lukacs, G.: Die Zerstörung der Vernunft. Drei Bände. Neuwied: Luchterhand 1983/1984. Mann, G./Heuß, A. (Hg.): Propyläen Weltgeschichte. 10 Bände. Berlin/Frankfurt/M.: Propyläen 1991 (Nachdruck der Ausgabe von 1960-1964). Matthiesen, K. H.: Kritik des Menschenbildes in der Betriebswirtschaftslehre. Auf dem Weg zu einer sozialökonomischen Betriebswirtschaftlehre. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt 1995. Meyer, Th.: Die Inszenierung des Scheins. Essay-Montage. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1992. Münch, R.: Dialektik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1991. Neumann, E.: Funktionshistorische Anthropologie der ästhetischen Produktivität. Habil. FU Berlin 1996. Nida-Rümelin, J. (Hg.): Praktische Rationalität. Grundlagenprobleme und ethische Anwendungen des rational-choice-Paradigmas. Berlin/New York: de Gruyter 1994. Nipperdey, Th.: Deutsche Geschichte. 1800 - 1866. Bürgerrecht und starker Staat. München: Beck 1983. Nipperdey, Th.: Deutsche Geschichte. 1866 - 1918. Bd. I: Arbeitswelt und Bürgergeist. München: Beck 1990. Nussbaum, M./Sen, A. (eds.): The Quality of Life. World Institute for Development and Economies Research (WIDER) - The United Nations University Helsinki. New York: Oxford University Press 1993. Plessner, H.: Die Frage nach der Conditio humana. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976. Plessner, H.: Die verspätete Nation. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974. Pochat, G.: Der Symbolbegriff in der Ästhetik und Kunstwissenschaft. Köln: DuMont 1983. Pochat, G.: Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie: von der Antike bis zum 19. Jahrhundert. Köln: DuMont 1986. Postmoderne. Eine Bilanz. Merkur 594/595, Sept./Okt. 1998. 58 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Rolle, Chr.: Ästhetische Bildung durch musikalische Erfahrung? In: Musikpädagogik, Beiheft 8. Mainz etc.: Schott 1998, S. 66ff. Roth, G.: Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Schimank, U./Volkmann, U. (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnose I. Leverkusen: Leske + Budrich 2000. Schneider, R.: Semiotik der Musik. München: Fink 1980. Schurian, W.: Kunst im Alltag. Psychologische Untersuchungen zur Kunst zwischen Idividuum und Umwelt. Göttingen/Stuttgart: VAP 1991 JYA 122 Strauß, D.: Eduard Hanslick. Vom Musikalisch-Schönen. Historisch-Kritische Ausgabe. 2 Bde. Mainz etc.: Schott 1990. Suppan, W.: Der musizierende Mensch. Anthropologie der Musik. Mainz: Schott 1984 Wahl, K.: Kritik der soziologischen Vernunft. Sondierungen zur Tiefensoziologie. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2000. Welsch, W./Pries, Chr. (Hg.): Ästhetik im Widerstreit. Interventionen zum Werk von JeanFrancois Lyotard. Weinheim: VCH 1991. Welsch, W.: Aisthesis. Grundzüge und Perspektiven der Aristotelischen Sinnenlehre. Stuttgart: Klett-Cotta 1987. Welsch, W.: Ästhet/hik. Ethische Implikationen und Konsequenzen der Ästhetik. In: Wulf usw. 1995. Welsch, W.: Ästhetisches Denken. Stuttgart: Reclam 1990. Welsch, W.: Unsere postmoderne Moderne. Weinheim: VCH 1988. Welsch, W.: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Wenzel, H. (hg.): Typus und Individualität im Mittelalter. München: Fink 1983. Woll, H.: Menschenbilder in der Ökonomie. München/Wien: 1994. Wulf, Chr. (Hg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Weinheim/Basel: Beltz 1997. Wulf, Chr./Kamper, D./Gumbrecht, H. U. (Hg.): Ethik der Ästhetik. Berlin: Akademie-Verlag 1994. 7/04 59 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Autonomie der Kunst Systematische und historische Anmerkungen zu einem schwierigen Begriff 1. Zur Aktualität der Thematik Wenn ein großer Kulturverband aus dem Theaterbereich auf seiner Hauptversammlung ausdrücklich in einer Resolution formuliert, Theater sei Kunst und sonst nichts und dies mit der bedrohlichen Bemerkung verstärkt, dass jeder, der etwas anderes sage, nichts von Theater verstünde, dann muss man durchaus einmal darüber nachdenken, warum dies so formuliert wird, welches das Ziel dieser Formulierung ist und auf welche historischen und systematischen Zusammenhänge man mit einer solchen Formulierung anspielt. Das Ziel dieser Formulierung ist relativ leicht aus dem Kontext zu erschließen: Es geht um den Versuch, die reichhaltige Theaterlandschaft in Deutschland zu erhalten und weiteren Kürzungen der öffentlichen Hand entgegenzutreten. Dies ist selbstverständlich eine legitime Aufgabe eines kulturellen Fachverbandes. Aus dem Kontext erschließet sich auch schnell, dass man sich mit der Formulierung, Theater sei nichts anderes als Kunst, nicht bloß gegen die im Moment grassierende Ökonomisierung aller Lebensbereiche wendet, die auch vor dem Kulturbereich nicht Halt macht, sondern man wendet sich auch gegen Versuche, Kultur- und Kunsteinrichtungen im Rahmen einer Argumentation mit Begriffen wie „Daseinsvorsorge“ oder „Grundversorgung“ vor dem Zugriff einer ökonomischen Denkweise und sparwütiger Politiker zu schützen und eine öffentliche Förderung des Theaterbereichs auch zukünftig aufrechtzuerhalten. Möglicherweise ist es gerade angesichts der historischen Tradition in Deutschland nicht sonderlich bemerkenswert, dass man glaubt, dies mit einer Einordnung des Theaters in den Kunstkontext erreichen zu können. Denn Kunst, so die hier vermutlich gemeinte, allerdings nicht explizit ausgesprochene Bedeutung dieses Begriffes, ist „autonom“, was hier etwa meinen könnte: nicht weiter begründungsbedürftig und so eigenständig, dass weitere Legitimationen für eine Förderung nicht nur nicht nötig sind, sondern möglicherweise das „Wesen“ des angesprochenen Gegenstandsbereichs, der „Kunst“, sogar beschädigen könnten. So selbstverständlich diese Formulierung gerade in deutscher Tradition also erscheint, so lohnt es sich doch, über diese unterstellte Selbstverständlichkeit nachzudenken. Denn man muss nur die 60 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Grenzen Deutschlands überschreiten, um zu erleben, dass in anderen Ländern der Hinweis auf eine vorgebliche „Autonomie“ keineswegs ausreicht, um Finanzierungsfragen zu lösen. Wie ist es also zu der These von der „Autonomie der Kunst“ gekommen? Was ist damit gemeint? Was bedeutet in diesem Zusammenhang überhaupt „Kunst“ und wieso ist die Autonomiebehauptung finanziell so ertragreich? Dies sind sehr viele und zum teil schwierige Fragen, von denen ich im folgenden nur zwei aufgreife und auch dort nur andeutungsweise einige Antworten versuchen will. Eine erste Assoziation könnte die unterschiedlichen Erscheinungsformen dessen, was unter Kunst subsummiert wird, Revue passieren lassen. Wenn man sich etwa ganz traditionell und im Einklang mit dem Alltagsverständnis ein Gedicht vorstellt, ein Bild, eine Skulptur, ein Konzert, eine Choreographie oder eine Theateraufführung, dann gelangt man schnell zu der Überlegung, dass bei all diesen künstlerischen Manifestationen Menschen beteiligt sind, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten! Man denkt daran, dass man es unter Umständen mit Betrieben und Kultureinrichtungen unterschiedlicher Größe zu tun hat, die aus der Bereitstellung dieser künstlerischen Produkte nicht bloß Einnahmen, sondern manchmal sogar einen Gewinn erzielen wollen und können. Allerdings denkt man in diesem finanziellen Zusammenhang sicherlich auch daran, dass viele der Einrichtungen einen erheblichen Zuschuss zu ihren Betriebskosten brauchen. Spätestens hierbei fällt auf, dass es zwar bei der Rede von Kunst natürlich und in erster Linie um den künstlerischen Prozess oder ein Kunstwerk geht, dass aber dieses Kunstwerk auf vielfältige Weise in gesellschaftliche und auch in ökonomische Zusammenhänge eingebettet ist, bis es seinen Weg von seinem künstlerischen Produzenten bis zu dem Rezipienten gegangen ist. „Kunst“ hat es also natürlich mit künstlerischen Artefakten oder Prozessen zu tun, doch ist Kunst auch ein sozialer Prozess, ein ökonomischer Prozess, ein Prozess der Kommunikation. Es geht um Personen und Einrichtungen, um ökonomische Abläufe, um politische Rahmenbedingungen und um spezifische Professionalitäten, die der Erwerbstätigkeit dienen, so dass man es nicht vermeiden kann, dass sich alle relevanten Wissenschaften mit Kunst befassen ( Abb.). 61 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 zuständige Fachdisziplinen Politikwissenschaften Medienwissenschaft Kommunikationswissenschaft Ökonomie politische Medien Medien Kommunikation Wirtschaftsfaktor Die KÜNSTE als..... Kulturtheorien Sprachen Teil der Kultur Bildungsmittel Sprachwissenschaften SEMIOTIK Symboltheorien Tätigkeiten Mittel sozialer Stukturierung Seinsbereich (Ontologie) Bildungstheorien Soziologien: Kultur-, Bildungs-, Kunstsoziologien (Tätigkeits-) Philosophie/ Psychologie Philosophie/spezielle Ästhetiken Theater als Kunst hat natürlich auch mit diesem komplexen Kunst-Kontext zu tun: Es ist ein sozialer, ein politischer und ein ökonomischer Prozess und kann damit auch in einer sozialen, politischen und ökonomischen Perspektive betrachtet werden. Die These, Theater sei Kunst und sonst nichts, führt also gerade nicht zur Beendigung der Debatte, sondern man kann wegen der Vielperspektivität von Kunst dann auch bei dem Theater anfangen mit einer vielperspektivischen Diskussion. Der systematische Ertrag dieser ersten Assoziationskette besteht darin, dass sich aus der Einordnung einer künstlerischen Aktivität gleich welcher Art unter die Rubrik „Kunst“ nicht sofort eine plausible Erklärung der Sonderstellung des betreffenden Bereichs ergibt, sondern vielmehr dadurch vielfältigste Diskurse eröffnet werden, bei denen die Frage der „Autonomie“ sich gerade nicht von selbst beantwortet. Man könnte nun zwar sagen, dass all die ge62 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 nannten Bereiche relevant sind, aber die ästhetische Dimension diejenige sei, bei der primär an den Aspekt der Autonomie zu denken ist und sich so das gewünschte (politische) Ziel ergibt. Man wird sehen. Dass man sich gegen eine Ökonomisierung des Kunstbereichs wehrt, ist einsichtig. Denn eine Unterordnung unter das ökonomische Verwertungsprinzip, was auch heißt: unter den Zwang zur Gewinnmaximierung, würde sofort zum Ende eines jeden künstlerischen Experiments führen. Doch wieso wehrt man sich dagegen, ein Teil der „Daseinsvorsorge“ bzw. der „Grundversorgung“ zu sein? Beide Begriffe haben zwar durchaus eine problematische Geschichte bzw. führen zu Assoziationen, die dem Kulturbereich unangemessen sind, so dass man sehr genau über die Bedingungen ihrer Anwendbarkeit nachdenken muss.31 Doch wird man beiden Begriffen nicht bestreiten können, dass sie sich mit existenziellen Fragen des menschlichen Lebens („Dasein“) befassen. Gerade wenn man einer anthropologischen Begründung der Notwendigkeit von Kunst für das menschliche Leben nicht abgeneigt ist 32 – und eine solche liegt etwa der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Kinderrechtskonvention oder dem Pakt für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte, aber auch vielen Positionierungen aus dem Feld der Künste und natürlich auch aus dem Theaterbereich (vgl. etwa Deutscher Bühnenverein 2003) zugrunde –, dann fällt es schwer, die Beziehung von Kunst zu einer solchen anthropologischen Konnotierung der genannten Begriffe als kunstfeindlich oder der Kunst wesensfremd zu verstehen. Ich werde an späterer Stelle darauf zurückkommen und zu zeigen versuchen, dass Kunst ihre humane und gesellschaftliche Relevanz in der Tat nur dadurch erreicht, dass sie eine Kulturmacht ist. Aber wieso vermuten die Verfasser in der oben angeführten Resolution, dass ein Verweis auf die „Autonomie der Kunst“ ein stärkeres Argument für die Erhaltung einer öffentlichen Förderung darstellt als eine Argumentation, die Kunst einordnet in einen anthropologischen und kulturellen Kontext, was sogar soweit geht, dass man in einem weiten Kulturbegriff (also etwa der Kulturbegriff der Unesco) die Gefahr sieht, dass er „Kunst aushöhle“? Es lohnt sich daher, der Frage nachzugehen, was denn „Autonomie“ im Zusammenhang mit Kunst bedeuten könnte. Zu dem Begriff der Daseinsvorsorge siehe meinen entsprechenden Aufsatz in „Politik und Kultur“, Ausgabe 2/04, „Grundversorgung“ habe ich bei einer Veranstaltung zur Kulturentwicklungsplanung der LHS Dresden am 30.06.04 kritisch analysiert (Der Text „Grundversorgung kulturelle Bildung“ steht als download – wie alle anderen hier genannten Texte von mir – auf der Homepage der Akademie Remscheid (www.akademieremscheid.de) zur Verfügung. 31 63 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 2. Was ist „autonom“ an der Kunst? Eine Übersicht In einer ersten Annäherung gibt die Übersetzung der beiden aus dem Griechischen stammenden Wortbestandteile dieses Kunstwortes einen Aufschluss über seine mögliche Bedeutung. So steckt in dem ersten Wortbestandteile (auto) das Wort „selbst“ und in dem zweiten Wortbestandteil (nomos) das Wort „Gesetz“. In der Tat ist „Selbstgesetzgebung“ ein verbreitetes Übersetzungsangebot für Autonomie, wobei zu diesem Wortfeld auch Unabhängigkeit, Freiheit und vor allem Willensfreiheit gehören. All diese Begriffe, die in Verbindung mit dem Wort „selbst“ stehen (man kann noch Selbsterkenntnis, Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung oder Selbstverwirklichung nennen; vgl. Gerhardt 1999), gehören zu dem Bedeutungsskontotext von „Subjektivität“: dass man nämlich selbst die Regeln gibt, nach denen man handelt. Der Gegensatz von Autonomie ist daher Fremdgesetzgebung, ist „Heteronomie“. Man hat es also mit Regeln und Gesetzen zu tun, wobei die entscheidende Frage darin besteht, wer diese Regeln und Gesetze erlassen hat. Regeln und Gesetze kann man befolgen oder man kann gegen sie verstoßen. Stets geht es jedoch um das Handeln des Menschen. Die philosophische Disziplin, die sich mit richtigem oder falschem Handeln des Menschen befasst, ist die Praktische Philosophie, ist also Ethik oder Moralphilosophie bzw. politische Philosophie. Mit dieser Überlegung ist bereits eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Der Begriff der Autonomie stammt nicht primär aus der philosophischen Ästhetik oder der Kunsttheorie, sondern es ist ein Begriff der Praktischen Philosophie. Natürlich hat jeder philosophische Autor das Recht, Begriffe aus einem speziellen Bereich im übertragenen Sinne auch in anderen Feldern zu verwenden. Man möge sich allerdings daran erinnern, wie viel Aufwand etwa Kant investiert hatte, um zu einer Architektur der Philosophie zu gelangen, die einigermaßen trennscharf auf der Grundlage dreier „Vermögen“, nämlich der Fähigkeit zu erkennen, der Fähigkeit, Lust und Unlust zu empfinden und dem Begehrungsvermögen zu unterscheiden, die drei Disziplinen Erkenntnistheorie, Ästhetik und Moral-Philosophie als eigenständige Teildisziplinen der Philosophie entwickelt hat. Mit Kant beginnt bei vielen Philosophiehistorikern die ausgereifte Philosophie der Moderne (vgl. aus einer unüberschaubaren Literaturmenge Schönrich/Kato 1996). Er ist auch und gerade bei unserer Fragestellung der Autonomie der entscheidende Philosoph, weil er im ersten 32 An anthropologischen Zugängen zur Kunst ist kein Mangel. Für einen Überblick siehe Fuchs 1999, wo insbe- 64 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Teil seiner „Kritik der Urteilskraft“ (1790) die sogenannte „Autonomie-Ästhetik“ begründet hat. Alle drei genannten philosophischen Teil-Disziplinen sind bei ihm im Subjekt und seinen „Vermögen“ verankert, wobei Kant auch der entscheidende Denker ist, der zu einer Bedeutungsumkehrung des Subjektbegriffs beigetragen hat. Bis zu dieser Zeit war das Subjekt das Unterworfene in einer engen Bedeutungsverbindung zu Zwang und Demütigung. Kant bleibt zwar bei diesem Bild, bei dem sich das Subjekt unten befindet, nur wird es jetzt zum Tragenden der gesamten Konstruktion. Das Subjekt ist nunmehr in völliger Umkehrung der bisherigen Bedeutung das Aktivitätszentrum, das sich seine eigene Welt konstruiert, das sich seine Gesetze des Handelns vorgibt und das auch maßgeblich über die ästhetischen Werturteile und deren Maßstäbe entscheidet: Das Individuum, das spätestens seit der Renaissance zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, wird nun zum handlungsmächtigen Subjekt (Fuchs 2001). Die Freiheit des Subjekts ist in dieser philosophischen Konzeption nicht bloß eine Spezialfrage der Moral-Philosophie, sondern Grundprinzip der gesamten Philosophie. Ich weise an dieser Stelle nur darauf hin, dass der Gedanke der Freiheit bis heute eine entscheidende Rolle in Ästhetik-Konzeptionen spielt. So verankert etwa Gehlen das Konzept der Schönheit im Erleben von Freiheit (der Loslösung aus der Naturgesetzlichkeit der Evolution). Andere Autoren bewerten die Künste und die ästhetische Erfahrung deshalb so hoch, weil hier generell die Möglichkeiten menschlichen Weltzugangs ausgelotet und erweitert werden können: Kunst wird zum Musterbeispiel der Selbsterfahrung des Menschseins. Gerade für das Theater wird hier eine unersetzbare Möglichkeit gesehen: Modelle unterschiedlicher Handlungsmöglichkeiten zur Anschauung zu bringen (vgl. neben zahllosen Theatertheorien allgemein für alle Künste meinen Text „Ethik und Kulturarbeit“, 2003). Diese philosophiegeschichtliche Erinnerung erbringt einen weiteren systematischen Ertrag: „Autonomie“ ist zunächst einmal ein Begriff der Praktischen Philosophie und erfüllt in dem subjektorientierten Philosophiegebäude von Kant eine Querschnittsfunktion für alle philosophischen Teildisziplinen. Dieses ist möglich aufgrund der zentralen Rolle des Subjekts in der Philosophie Kants: Wer im Sinne von Kant von Autonomie spricht, geht von einem handelnden und wertenden Subjekt aus, das sich selber die Regeln seines Handelns oder Wertens gibt. Ich komme später darauf zurück. Doch welches sind die „handelnden Subjekte“ im Kontext der Kunst und welche Dimensionen von Kunst lassen sich außerdem noch identifizieren? sodnere auf Plessner und Cassirer Bezug genommen wird. Vgl. auch Frey 1994 sowie Wulf 1998. 65 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 „Kunst“ ist ein ausgesprochen komplexes Geschehen. Man mag daher von einem einfachen Strukturmodell des Kunstprozesses ausgehen: Es gibt KünstlerInnen, die in einem künstlerischen Prozess etwas gestalten. Der Kunstwerkbegriff ist zwar sowohl im Zuge der realen Entwicklung der Künste als auch in den kunsttheoretischen und philosophischen Reflexionen über diesen Prozess oft angegriffen worden, doch ist er im Zusammenhang dieses Textes immer noch brauchbar. Im Hinblick auf eine Annäherung an „Kunst“ können wir somit die drei Komponenten künstlerisches Subjekt, künstlerische Tätigkeit und künstlerisches Objekt (Kunstwerk) unterscheiden und jeweils die Frage nach der Autonomie stellen. In der Tat führt selbst diese einfache Ausdifferenzierung des Komplexes Kunst zu sinnvollen Untersuchungsrichtungen: Man kann sich mit der Genese des Künstlerberufes beschäftigen und danach fragen, unter welchen Umständen der Beruf des Musikers, des Komponisten, des Malers, des Schauspielers, des Schriftstellers, des Regisseurs oder Dichters etc. entstanden ist, aus welchen Berufen sich diese künstlerischen Berufe entwickelt haben und wie und warum sie ihre Eigenständigkeit gewonnen haben (vgl. Ruppert 1998). Autonomie der Kunst heißt unter dieser Perspektive: Autonomie des künstlerischen Berufs. Man kann danach fragen, unter welchen Bedingungen sich die verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten als besondere Tätigkeitsformen (die gegebenenfalls von Menschen mit speziellen Berufen ausgeübt werden) entwickelt haben. Autonomie der Kunst heißt unter dieser Perspektive: Autonomie der künstlerischen Tätigkeiten. Man kann danach fragen, unter welchen Bedingungen die Ergebnisse der künstlerischen Tätigkeit einen besonderen Status erhalten (z.B. „Aura“) und in einer besonderen Weise präsentiert werden. Autonomie der Kunst heißt unter dieser Perspektive: Autonomie des Kunstwerks. Der Kunstprozess besteht jedoch nicht nur in der Herstellung von Kunstwerken, sondern es müssen diese auch verteilt (Kunstvermittlung, Distribution) und schließlich auch rezipiert werden. In einer semiotischen Sichtweise ist dies die pragmatische Dimension eines Umgangs mit dem Zeichenkomplex Kunstwerk. Man kann danach fragen, ob die Kategorie der Autonomie in irgendeiner Weise sinnvoll auf den Prozess der Kunstvermittlung angewandt werden kann. 66 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Man kann danach fragen, ob der Prozess der Kunstrezeption in einer Weise stattfindet, dass man von seiner „Autonomie“ sprechen könnte. Wenn man berücksichtigt, dass all diese Prozesse der Kunstherstellung, der Kunstvermittlung und der Kunstrezeption nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern unter konkreten sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnissen, dann ist es unmittelbar einsichtig, dass diese Prozesse zum Gegenstand der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen werden können: Natürlich sind in erster Linie die spartenbezogene Kunstwissenschaften (mit historischer und systematischer Perspektive) und die philosophische Ästhetik gefragt. Es ergeben sich allerdings auch sinnvolle Fragestellungen für die Ökonomie, die Soziologie, die Politikwissenschaft oder die Psychologie. Da die Künste außerdem Gegenstand der Bildungsarbeit sind, interessieren sich auch die Erziehungswissenschaften für diese Prozesse. Auch hier ist es bekannt, dass „Autonomie“ (man spricht hier lieber vom Eigenwert oder Eigensinn der künstlerischen Tätigkeit) eine Voraussetzung für gelingende künstlerische Bildungsarbeit ist. Man könnte nun in der Tat in einer umfangreicheren Arbeit alle genannten Komponenten und Aspekte des komplexen Geschehens Kunst untersuchen.33 Ich will hier nur einige Hinweise zu zwei ausgewählten Aspekten geben: Zunächst will ich einige Hinweise zur sozialen Einbettung des Kunstprozesses im historischen Verlauf geben, sodann werde ich diese soziale Einbettung ausblenden und in einer ästhetischen Annäherung die Frage nach einer möglichen Bedeutung von „Autonomie“ stellen. 3. Kunst im sozialen Kontext Die These von der Autonomie der Kunst war nicht bloß immer wieder ein Gegenstand einer wertfreien Nachforschung ihrer historischen Genese und ihrer systematischen Bedeutung im Rahmen der Ästhetik oder den Theorien der Künste. Sie war auch immer wieder eine Herausforderung für Künstlerinnen und Künstler, die sich mit ihrer Kunst bewusst in soziale und 33 Zu allen Kunstsparten gibt es hochentwickelte wissenschaftliche Disziplinen, Lehrstühle, Zeitschriften und Fachliteratur, die über alle genannten Fragestellungen ausführlich informieren und die leicht zugänglich sind. Es gibt sogar inzwischen wuchtige Begründungen dafür, dass all diese Disziplinen – man zählt sie heute zu den „Kultur(!)wissenschaften“– für unsere Gesellschaft und ihre Selbstauslegung unverzichtbar sind (Steenblock 1999; zur „Kulturfunktion“ der Selbstdeutung – auch und gerade durch die Künste – siehe meine beiden Texte 67 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 politische Prozesse einmischen wollten und die die von der Autonomiethese unterstellte Trennung von Kunst und Leben bewusst nicht mit vollziehen wollten. Insbesondere war es immer wieder die Avantgarde, die Kunst und Leben zusammenbringen wollte und die von daher das Verständnis einer autonomen Kunst nicht teilte.34 In einer materialistischen Perspektive gehört Kunst zum ideologischen Überbau der Gesellschaft und ist daher abhängig von der materiellen Basis. Materialistische Untersuchungen zur Geschichte der Kunst versuchten daher immer wieder, diese Abhängigkeit der Kunst von den Produktionsverhältnissen nachzuweisen. Im Gegenzug hierzu bestanden anti-materialistische Denker auf der Priorität des geistigen Lebens.35 Es liegt auf der Hand, dass diese beiden konträren Positionen über den Status der Kunst zu unterschiedlichen Konzeptionen von Kulturpolitik führen müssen. Diese nicht vermittelbare Entgegensetzung eines lebensdistanzierten Idealismus und eines mechanistischen Materialismus hat lange Zeit den Blick darauf verstellt, in welcher Weise und in welchen Abhängigkeiten sich das System der Künste historisch-konkret entwickelt hat. Eine wichtige Rolle spielte nicht nur die materialreiche „Sozialgeschichte der Kunst und Literatur“ von Arnold Hauser, sondern auch das Alternativprogramm zum 13. Deutschen Kunsthistorikertag im Frühjahr 1972, das damals junge und kritische Kunsthistoriker - heute alles etablierte und angesehene Lehrstuhlinhaber - aus Protest gegen die erstarrten Rituale ihrer Zunft organisierten (Müller u. a. 1972). Ich zitiere aus dem Vorwort: „Die Vorstellung von der „Autonomie der Kunst“ hat sich nicht überlebt. Alle Versuche der Künstler selbst, aus dem Rahmen, den sie setzt, auszubrechen, sowie alle Theorien über „Kunst als Ware“ können nicht verstellen, dass Kunst in unserer Gesellschaft noch immer vorwiegend „autonom“ gesehen wird - auch dort, wo der Begriff nicht ausdrücklich fällt -, und dass der Warencharakter der Kunst ihr autonomes Wesen nicht auflöst, sondern gerade zur Voraussetzung hat; autonome Aura und Marktwert der Kunst bedingen einander noch heute.... Ist also von Autonomie in der spätmittelalterlich-frühbürgerlichen Geschichtsphase noch nicht explizit die Rede, so weist doch die Entwicklung der in der Renaissance zu ihrer „Kulturfunktionen der Künste“ (2003) und „Das Interesse der Moderne an sich selbst“ (2004), beide auf der ARS-Homepage. 34 Hierzu nach wie vor erkenntnisfördernd die Schriften von Peter Bürger, insbesondere seine „Theorie der Avantgarde“ (1974) und seine „Kritik der idealistischen Ästhetik“ (1983). Bemerkenswert ist das Kapitel über die „Geschichtlichkeit des Kunstbegriffs“ in Pracht u.a. 1987. 35 Ein gutes Beispiel für Dialektik ist Stephan George, der sehr strikt seine Position des aristokratischen l’art pour l’art entwickelt und quasi generalstabsmäßig dafür gesorgt hat, dass sie politisch und ökonomisch an Einfluss gewinnt: Mit Kunstautonomie ließ sich immer schon gut Politik betreiben. 68 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 autonomen Form „befreiten“ Kunst als die Phase des Werdens auf die Entwicklung in der Moderne hin.“(a.a.O., S.7). Im Sinne dieses Zitats untersuchen die Autoren, wie sich im Schoße der Feudal- Gesellschaft, also insbesondere in Abhängigkeit von Hof und Kirche, nach und nach die künstlerische Produktion sowohl in der Literatur, aber vor allem im Bereich der bildenden Kunst aus der Enge der Auftragsvergabe und Kontrolle der genannten Instanzen löst. Es entsteht allmählich ein Kunstmarkt, bei dem der Künstler als identifizierbarer Autor und Schöpfer seines Werkes namentlich in Erscheinung tritt und nicht mehr nur für konkrete Auftraggeber – etwa für das reich gewordene Bürgertum – sondern auch für einen entstehenden anonymen Markt herstellt. Mit erheblichen Unterschieden in den einzelnen Kunstsparten und durchaus in einer Konkurrenz zueinander entstehen die künstlerischen Berufe in einem ersten Schritt dadurch, dass sie sich aus den mittelalterlichen mechanischen artes herauslösen. Künstler sind damit nicht mehr dem Zwang unterworfen, ihre Produkte gemäß präzise vorgegebener Regeln, die die Zunft streng kontrolliert, herzustellen. Es entsteht der Künstler als Schöpfer, der sich die Regeln selbst gibt (in einer späteren Phase: das Genie) Wir haben es also mit parallel laufenden Prozessen zu tun, die in den einzelnen Sparten (Musik, Literatur, Malerei, Architektur) höchst ungleichzeitig verlaufen und bei denen eine Loslösung aus dem Einflussbereich von Hof und Kirche, die Entwicklung eines einflussreichen Bürgertum, die Entstehung eigenständiger künstlerischer Berufsbilder, die Entwicklung spezifischer Kultureinrichtungen und die Genese von Kulturmärkten ein interdependentes Beziehungsgeflecht bilden. Mitte des 18. Jahrhunderts datiert die Entstehung einer eigenständigen philosophischen Disziplin Ästhetik als Theorie der sinnlichen Wahrnehmung (Baumgarten) und gleichzeitig entsteht das Konzept eines einheitlichen Kunstbegriffes, der die bislang getrennt behandelten Bereich Literatur, Musik und Malerei zusammenfasst. Es gibt die These, dass die Entstehung sowohl eines einheitlichen Kunstbegriffes als auch einer philosophischen Disziplin Ästhetik, die sich generell mit der Gesamtheit der Künste und ihren Gemeinsamkeiten befasst, mit der Ausdifferenzierung des Systems der Künste zu tun hat: Man wollte zumindest auf geistiger Ebene eine Ordnung schaffen, die in der sozialen Ausdifferenzierung der Sparten nicht mehr so ohne weiteres sichtbar war. Dabei fiel es den Akteuren durchaus schwer, ihr eigenes spezielles Arbeitsfeld unter einen Allgemeinbegriff „Kunst“ einzuordnen. Und selbst wo dies akzeptiert wurde, investierte man erhebliche Energien, um zu einer Rangordnung über den Wert der unterschiedlichen Künste zu gelangen (vgl. 69 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 etwa den Laokoon von Lessing und die heftige, bis heute anhaltende Diskussion). Dabei geht es nicht nur um rein ästhetische Fragen, welche Kunstsparte etwa das Leiden besser darstellen könne, sondern es geht immer auch um die Platzierung im ökonomischen Feld. Etwa 30 Jahre nach Lessing entwickelte Herder seinen weiten Kulturbegriff, den er brauchte, um die Vielzahl der von ihm beschriebenen menschlichen Lebensformen zu erfassen. Der Kulturbegriff war hier ein Begriff der Unterscheidung, der zugleich die Einheit in der Vielfalt ausdrückte. Erst Jahre später wird Schiller dieses Konzept von Kultur und den Allgemeinbegriff von Kunst aufeinander beziehen. Es gibt also durchaus eine Berechtigung, nicht nur die Frage der Einbeziehung des Theaters unter „Kunst“ zu diskutieren, sondern es ist auch die Beziehung von „Kunst“ und „Kultur“ durchaus ein interessantes Untersuchungsfeld. Allerdings liegen die hierfür entscheidenden Diskussionen etwa 200 Jahre zurück. Gerade die Geschichte des Theaters ist im Hinblick auf ein Selbstverständnis als „Kunst“ äußerst vielschichtig. Während etwa Literatur als Gattung relativ früh sich unstrittig unter den einheitlichen Kunstbegriff einordnen konnte (hier ging es literaturintern eher darum, was innerhalb der Literatur den höchsten Rang hat: dramatische Literatur, Lyrik oder – wie allerdings erst im 19. Jahrhundert – der Roman), stand der Kunstcharakter des Theaters immer wieder zur Diskussion. Es ist in unserem Kontext durchaus interessant, dass die (ästhetische) Frage nach dem Kunstcharakter aufs engste mit dem Theater als sozialer und kultureller Erscheinung und mit seiner gesellschaftlichen Funktion zu tun hat. Dies kommt etwa in der „Kurzen Geschichte des deutschen Theaters“ von Erika FischerLichte (1993) darin zum Ausdruck, dass die Autorin – entsprechend der von ihr identifizierten Veränderung der gesellschaftlichen Funktionen – für die unterschiedlichen Etappen der Theatergeschichte unterschiedliche methodische historiographische Ansätze wählt: Mentalitätsgeschichte, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte etc. Wie wenig man die sozialen und ökonomischen Ausdifferenzierungsprozesse von der künstlerischen und ästhetischen Entwicklung trennen kann, hat Pierre Bourdieu (1999) am Beispiel der Genese des literarischen Feldes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund um die Person von Gustave Flaubert gezeigt. Diesem ist es nämlich gelungen, mit Hilfe neuer ästhetischer Prinzipien des Romans ein relativ autonomes soziales (und ökonomisches) LiteraturFeld zu konstituieren. Neben diesem feldtheoretischen Ansatz von Bourdieu hat Luhmann (1995) eine Soziologie der Kunst geschrieben, in der er ebenfalls darstellt, wie sich in der historischen Genese ein „autopoietisches System“ Kunst entwickelt hat, das gemäß seiner soziologischen Systemtheo70 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 rie selbstreferentiell (also durchaus „autonom“), d.h. nach eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten, funktioniert. Heute ist Kunst- und Kultursoziologie eine eigenständige soziologische Disziplin; zudem gibt es in allen Kunstsparten materialreiche sozialgeschichtliche Darstellungen ihrer Genese, so dass die Annahme eines von der Gesellschaft strikt abgekoppelten geistigen Seinsbereichs „Kunst“ kaum noch vertreten wird: Kunst wird von Menschen gemacht und sie wird unter konkreten Bedingungen, also unter sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen gemacht, auf die sie wiederum auf eine oft nicht unmittelbar erkennbare Weise Einfluss nimmt. „Autonomie in der Kunst“ bedeutet dann, dass sich im Zuge der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft ein relativ selbständiges Sub-System gebildet hat, ebenso wie sich andere relativ selbstständige Subsysteme (Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft, Politik etc.) gebildet haben. „Relative Autonomie „ bedeutet dabei nicht eine hermetische Abriegelung gegenüber anderen Subsystemen, sondern – im Sinne der Soziologie nach Parsons - vielfältige Interpenetrationen, also wechselseitige Beeinflussungen und Interdependenzen. Zu einer solchen soziologischen Betrachtungsweise von Kunst gehört auch die Berücksichtigung der Entstehung dessen, was der Literaturwissenschaftler Peter Bürger „das Betriebssystem der Kunst“ oder was der amerikanische Kunsttheoretiker Danto „art world“ nennt: die Künste benötigen für ihre gesellschaftliche Wirksamkeit bestimmte Institutionen. So braucht die Kunstform Theater ein Theatergebäude, für Bücher braucht man Bibliotheken, für die bildende Kunst (und auch für andere Artefakte der Kultur) hat man entsprechende Museen eingerichtet. Der Ausbau einer umfangreichen Kunstlandschaft in Deutschland hatte dabei sehr viel mit dem Bürgertum zu tun, das über kulturelle Mittel versucht hat, soziale und politische Hegemonie zu gewinnen bzw. seinen Ausschluss aus der politischen Steuerung zumindest kulturell zu kompensieren (vgl. Nipperdey 1988). Gerade die autonome Kunst konnte offenbar diese soziale und politische Funktion erfüllen. Man kann zwar in einer abstrakten Betrachtung die Kunstformen von ihren Realisierungsbedingungen trennen und die Künste rein immanent in einer ästhetischen Zugangsweise untersuchen, wenn man dabei nicht vergisst, dass die Künste ohne die zugehörigen Einrichtungen nicht existieren können. Dies gilt in besonderer Weise für die Kulturpolitik, für die die Kunsttheorien und die Ästhetik relevantes Basiswissen liefern, die aber nicht so tun darf, als ob es um Tanz, Theater, Literatur oder bildende Kunst oder Musik „an sich“ ginge. Kulturpolitik muss vielmehr die politischen, rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen sicher- 71 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 stellen, damit die Künste sich in ihrer grundgesetzlich gesicherten Autonomie entfalten können. 4. Autonomie der Kunst als ästhetischer Begriff Die zentralen Begriffe, mit denen Kant den Grundstein für seine (und viele folgenden) Autonomieästhetik(en) legte, sind „interesseloses Wohlgefallen“ und „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“. Ich will an dieser Stelle nicht die Notwendigkeit skizzieren, warum Kant diese Begriffe eingeführt hat; sie haben etwas mit der Architektur seines philosophischen Gesamtgebäudes zu tun. Bei beiden Begriffen hat er allerdings auf eine intensive kunsttheoretische Diskussion in Deutschland, aber vor allem in Frankreich und in England zurückgreifen können. Annemarie Gethmann-Siefert (1995) stellt in ihrer „Einführung in die Ästhetik“ zwei grundsätzliche Paradigmen einander gegenüber: Kunst als Erkenntnis, für die Kant der Hauptvertreter ist, und Kunst als Handeln, bei denen der Weg von Schiller (immerhin einer der einflussreichen Kant-Schüler) über Schelling zu Hegel führt. Die Autorin arbeitet heraus, dass und in welcher Weise die Kantsche Ästhetik letztlich theologische Ursprünge hat: Es geht um eine uneigennützige Liebe, um eine Interesselosigkeit des Wohlgefallens, wobei das Kunstschaffen des Genies (!) in Analogie zur Schöpfung Gottes gesehen werden muss: „Dem genialen Künstler wird die Möglichkeit zu erkannt, die Vollkommenheit der Welt in der Schönheit seines Produktes aufscheinen zulassen.... Der die Freiheit des Handelns charakterisierende Begriff der Autonomie wird daher aus der Bestimmung menschlichen Handelns auf ein Ding, auf die Kunst, übertragen. Das Kunstwerk erscheint als der aktive Part, denn es lässt uns die Welt neu und ursprünglich sehen, da es sich nicht den Gesetzen der Realität unterordnet, sondern die Gesetze des Neuvollzugs... gegen die Realität aus sich selbst schöpft.“ (146) Obwohl Kant sich mit seiner Philosophie durchaus in die Gestaltung der Welt einmischen will (nicht umsonst spielen seine politischen Schriften, etwa die Schrift „Vom ewigen Frieden“, heute in der völkerrechtlichen Diskussion eine wichtige Rolle), entwickelt er seine philosophischen Grundlagenwerke quasi vom Reißbrett. Man kann dies sofort etwa dann feststellen, wenn man die „Kritik der Urteilskraft“ neben die „Vorlesungen über die Ästhetik“ von Hegel legt, der natürlich als philosophischer Systematiker zwar auch mit einem Willen zur Vollständigkeit alle Fassetten von Kunst analysiert und systematisch aufeinander bezieht, aber diese 72 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 systematischen Erörterungen immer wieder auf die Geschichte der Künste bzw. auf die Kunstentwicklungen in anderen Teilen der Welt bezieht. Für Gethmann-Siefert ist Hegel der wichtigste Repräsentant der Position „Kunst als Handeln“, was bedeutet: „Die Kunst ist ein Produkt des Menschen für den Menschen. Ihr Ziel ist die Bildung des Menschen zur Vernunft und Freiheit, zu einem geglückten Leben. Die Autonomie der schönen Gestalt ist - mit Schillers Worten - He-Autonomie, eine den Dingen geliehene Autonomie, die Freiheit anschaulich werden lässt; eine dem fiktionalen Handeln eingebildete Freiheit, die zum Gebrauch moralischer Freiheit stimuliert.“ (247). Kunst ist in diesem Verständnis ein Weltdeutungsangebot (253). Ihr Fazit: „Es geht um die Frage nach der Relevanz der Kunst für den (die) Menschen, um die Bestimmung ihrer unverzichtbaren Rolle in einer spezifisch menschlichen Kultur. Diese These von der kulturellen Relevanz der Kunst ist die gemeinsame Basis jeglichen Umgangs mit der Kunst..... Die kulturelle Aufgabe der Kunst liegt im Bereich der Humanisierung der Natur, und zwar dient die Kunst dabei nicht allein der Bearbeitung der Natur zu Lebenszwecken, sondern der Gestaltung der Natur zum Zweck der Einrichtung des Menschen in einer menschlichen, ihm gemäßen Welt. Grundvoraussetzung dieser Bestimmung der geschichtlich-gesellschaftlichen Funktion der Kunst ist die Annahme, dass der Mensch, der sich durch Arbeit in der Natur gegen die Natur durchsetzt, nicht nur die Überlebenschance des Individuums und der Gattung sichert. Durch seine Fähigkeit zu freier Gestaltung und in der Ausbildung einer Tradition der Weltdeutung, in der die Kunst eine konstitutive Rolle (die Ausbildung einer Welt-Anschauung) übernimmt, wird menschliches Überleben gesichert.“ (268). Ich schließe mich dieser Sichtweise von Kunst an, weil sie die humane Dimension von Kunst, nämlich ihre Relevanz für das Leben des Menschen und damit ihre kulturelle Bedeutung, betont. Diese Sichtweise von Kunst ist unmittelbar anschlussfähig an die eingangs angedeutete anthropologische Begründung für eine Notwendigkeit von Kunst für das menschliche Leben und sie liefert zugleich eine geeignete theoretische Basis für die Kulturpolitik. (Fuchs 1998). Wenn in dieser vorgestellten Konzeption von Kunst Kant gegen Hegel ausgespielt erscheint, so bedeutet dies nicht, dass Kunst nur in einer vordergründigen Instrumentalisierung und Zweckbindung ihre Berechtigung hat. Man kann vielmehr zeigen, dass gerade in der Loslösung von gesellschaftlichen Zweckbindungen und vordergründig eingebrachten Funktionali73 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 sierungen sich auch die von der Autorin in den Mittelpunkt gestellte Bildungswirkung von Kunst entfaltet. Der Gedanke von Kant, den Schiller ins Politische gewendet hat, ist nach wie vor richtig und wird auch in aktuellen Ästhetikkonzeptionen berücksichtigt36: Nur in einer handlungsentlasteten Situation kann sich der Mensch in ästhetischer Weise auf die Natur und vor allem auf künstlerische Prozesse und Gegenstände so einlassen, dass die Wirkung einer Ausdehnung von Wahrnehmungs- und Bewertungsmöglichkeiten der Welt sich einstellt. In aktuellen Kunsttheorien hebt man insbesondere den Aspekt hervor, dass die Menschen Kontingenz erfahren können, was heißt, dass sie erkennen und erleben, dass alles auch ganz anders sein könnte, als es ist. Es geht um die Kompetenz des Denkens in Kategorien der Möglichkeit, das zu einer Befreiung von der normativen Kraft des Faktischen führen könnte. „Autonomie“ ist also in dieser Hinsicht immer noch ein wichtiges Charakteristikum im Umgang mit Kunst. Gerade in Hinblick auf die subjektive Seite der Produktion und Rezeption lässt sich eine solche Autonomie anthropologisch begründen, denn offenbar braucht der Mensch zur „Kultivierung“ seiner Menschlichkeit immer wieder Augenblicke einer Handlungsentlastung, auch um „Freiheit“ als Spezifikum seiner Existenz erleben zu können. Sehr schön bringt diese Dialektik von Funktionalität und Autonomie der Kunstkritiker der ZEIT, H. Rauterberg, zum Ausdruck, den ich daher mit einem längeren Zitat zu Wort kommen lassen will: "Kunst ist überflüssig", behauptete ein vorwitziges Transparent auf der documenta 5, und vielleicht muss man tatsächlich einräumen, dass wir sie nicht brauchen, zumindest nicht für irgendetwas Unverzichtbares. Letzte Wahrheiten sucht man in ihr vergeblich - anders als Schiller hoffte, wird in der Kunst nicht alle Entfremdung aufgehoben; anders als Adorno und Heidegger behaupteten, ist sie keine höhere Art der Welterkenntnis. Und wer nie ins Museum geht, ist kein schlechterer Mensch als der stete Kunstgänger. Dies Eingeständnis klingt ernüchternd und könnte doch entlastend wirken. Erlöst von allen Selbstzwängen der Artokratie, dürften sich die Künstler endlich darauf besinnen, wovon und, mehr noch, wofür sie eigentlich frei sind. Schnell stellte sich dann heraus, dass die Kunst sehr unterschiedlichen Funktionen zu folgen vermag: Sie kann ein schönes Sonntagsvergnügen sein oder - mit Kant - "die Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung befördern". Sie kann einen Freiraum für das Unangepasste bieten, kann schmücken, politisieren, amüsieren Ich habe in einigen Texten den aktuellen Diskussionsstand in der philosophischen Ästhetik – auch in Hinblick auf die praktischen Zwecke der Kulturpolitik und Kulturpädagogik – gesichtet: z. B. in Kunst und Ästhetik – Neuere Entwicklungen (2003) und in Wozu Kunst? (2001), alle mit zahlreichen Literaturhinweisen auf der ARSund z. T. auf der Kulturrats-Homepage. 36 74 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 oder nur sich selbst zum Thema machen. Gerade in dieser Unvorherbestimmtheit liegt ihre große Chance. Doch wird sie von vielen Künstlern leichtfertig vergeben. Sie folgen den Marktregeln und legen sich fest auf ein Thema, eine Machart, einen Stil. Wohl deshalb wirken viele Werke konstruiert, fahl und dünnblütig. Kunst aber ist nur, was uns als Kunst vorkommt. Sie kommt uns als Kunst vor, wenn sie uns etwas bedeutet. Und sie bedeutet uns etwas, wenn sie uns berührt, uns packt oder ansticht, wenn sie selbst in ihrem Schweigen etwas sagt. Bei aller Nähe aber muss sie unnahbar bleiben, sie muss unsere Neugier wecken, ohne sie zu stillen. Erst in diesem unlösbaren Wechselspiel wird sie unsere moralische, soziale und religiöse Fantasie beflügeln. Künstler vermögen es, uns "sehen zu lassen, dass es Unsichtbares im Sichtbaren gibt", wie Jean-François Lyotard schreibt. Sie können unsere Lust am Denken im Konjunktiv wecken, können in uns die Vorstellung reifen lassen, dass die Welt einst anders war und dass sie anders werden könnte. Welche Form, welches Material die Kunst dafür wählt, ob sie in Schönheit glänzt oder mit Hässlichkeit alle Harmoniebedürfnisse durchkreuzt, ob sie Genuss bietet oder Zumutung verordnet, ist gleichgültig.“ (H. Rauterberg: Was soll uns diese Kunst?, Die ZEIT Nr. 24, 6.6.2002). Allerdings ergibt sich aus der kulturellen Relevanz des Theaterspiels, aus seiner Bedeutung auch im Alltag des Menschen, durchaus eine Gefahr für das Theater als Kunstform. Möglicherweise geht diese Gefahr davon aus, dass in der Gesellschaft gezielt Theatralität eingesetzt wird – etwa in der Politik –, so dass „Inszenierung“ (Rollenspiel ohnehin) zu einem zu entschlüsselnden Alltagserlebnis wird. Fischer-Lichte spricht von einer „Theatralisierung des Lebens“ und einer „Entgrenzung des Theaters“. Möglich ist aber auch eine Entgrenzung der Theaterwissenschaft, die gerade (etwa rund um das von Fischer-Lichte geleitete DFGForschungsprojekt zur Perfomativität) theatrale und theaterwissenschaftliche Zugangsweisen als allgemeine kulturwissenschaftliche Methoden durchsetzen will. Wo das ganze Leben als „Theater“ angesehen wird, hat es eine ausgewiesene Kunstform Theater schwer, zumal – im Hinblick auf die Autonomie – die notwendige „Exterritorialität“ des Kunsterlebnisses als Voraussetzung für eine Handlungsentlastung dann nicht mehr vorhanden ist. So gesehen ist dann nicht der „weite Kulturbegriff“ eine Gefahr für das Theater, sondern vielmehr eine Überdehnung des „engen Kulturbegriffs“ auf die Kultur schlechthin.37 75 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 5. Schlussbemerkung Die Rede von der „Autonomie der Kunst“ kann nicht die Unterstellung einer rein geistigen, von materiellen Realisierungsbedingungen abgetrennten Entwicklung der Künste bedeuten. Vielmehr sind die Künste in enger Verbindung mit sozialen, ökonomischen und politischen Entwicklungen der Gesellschaft entstanden. Auch heute sind die Künste als relativ autonomes Subsystem vielfach mit den anderen Subsystemen der Gesellschaft verbunden. Sinn macht die Autonomiethese dort, wo es um die Handlungsentlastung des Menschen, um die Abwehr von eindimensionalen politischen und ökonomischen Vereinnahmungen geht. All dies kann jedoch in seiner Komplexität nur schwer auf die These, irgendetwas „sei Kunst und nichts anderes“ gebracht werden: Die ästhetische Verwendung des Autonomietopos ist nicht so ohne weiteres auf die Kulturpolitik zu übertragen. In einem politischen Verwendungszusammenhang, wo es um Geld, Strukturen, Richtlinien und Regeln geht, wo es um Bestandssicherung und berufliche Existenzen geht, kann man möglicherweise (in Deutschland) noch eine Weile einige politische Scharmützel mit einer solchen Argumentation gewinnen, was allerdings voraussetzt, dass man nicht allzu genau über reale Geschichtsverläufe und aktuelle Wirkungen und durchaus auch Funktionen von Kunst nachdenkt. Man macht daher mit einem solchen Gebrauch den nach wie vor wichtigen Begriff der Autonomie zu einem ideologischen Konzept und zerstört ihn dadurch letztlich. Man tut dies auch ohne Not, denn ein realistischer Blick sowohl auf die anthropologische Notwendigkeit von Kunst als auch auf ihre aktuellen Kulturfunktionen liefert genügend Argumentationspotential für eine Politik, die überhaupt noch an rationalen Begründungen interessiert ist. Der „weite Kulturbegriff“, der diese humane Relevanz von Kunst zur Grundlage hat und auf ihre Unverzichtbarkeit hinweist, höhlt daher gerade nicht den Kunstbegriff aus, sondern setzt ihn – philosophisch und wissenschaftlich redlich und nachvollziehbar – in sein Recht. Kunstpolitik kann daher heute – zumal in internationaler Perspektive – nur im Rahmen einer Kulturpolitik betrieben werden, die sich den weiten Kulturbegriff zu eigen gemacht hat. So verstehe ich auch den derzeitigen Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, Klaus Zehelein, wenn er sagt: „Wir müssen aus der Perspektive argumentieren, dass das Theater eben kein sozial isoliertes Kunstbiotop ist, sondern dass Theater eingebunden ist in ein soziales Netz und in diesem Netz entscheidend zur Entwicklung sozialer, kreativer, kultureller Kompetenzen beiträgt, die ent- 37 So etwa auch D. Brandenburg: Vom Nutzen und Nachteil des Theaters in der Mediengesellschaft. Die Deutsche Bühne 4/2003, S. 18ff., hier: S. 20. 76 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 wickelt werden müssen in einer Stadt, in einer Region, in einem Land“. (Deutsche Bühne 7/2003, S. 25). Literatur Bourdieu, P.: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Bürger, P.: Theorie der Avantgarde. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974. Bürger, P.: Zur Kritik der idealistischen Ästhetik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1983. Deutscher Bühnenverein (Hg.): Muss Theater sein? Fragen, Antworten, Anstöße. Köln 2003 Frey, G.: Anthropologie der Künste. Freiburg/München 1994. Fuchs, M.: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998. Fuchs, M.: Mensch und Kultur. Anthropologische Grundlagen von Kulturarbeit und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Historische und systematische Studien zu ihrer Genese. Leverkusen: Leske + Budrich 2001. Fuchs, M.: Wozu Kulturpolitik. Deutscher Kulturrat. www.kulturrat.de/Diskussion. 2001 Fuchs, M.: Wozu Kunst? 2001. www.akademieremscheid.de/Publikationen Fuchs, M.: Kunst und Ästhetik. www.akademieremscheid.de/Publikationen. 2003 Neuere Entwicklungen. Fuchs, M.: Kulturfunktionen der Künste. Konzepte, Ansätze, Erkenntnisse. Remscheid 2003. www.akademieremscheid.de Publikationen Fuchs, M.: Kultur als Daseinsvorsorge? In: Politik und Kultur Nr. 01/04, Januar/Februar 2004, S. 3f. Fuchs, M.: Grundversorgung kulturelle Bildung. Zur Rolle der Kommune. Juni 2004 Gerhardt, V.: Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität. Stuttgart: Reclam 1999. Gethmann-Siefert, A.: Einführung in die Ästhetik. München: Fink 1995. Hauser, A.: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München: Beck 1972. Iden, P. (Hg.): Warum wir das Theater brauchen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Luhmann, N.: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Müller, M. u.a.: Autonomie der Kunst. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1972. Nipperdey, Th.: Wie das Bürgertum die Moderne erfand. Berlin: Siedler 1988. Pracht, E. u.a.: Ästhetik der Kunst. Berlin: Dietz 1987. Ruppert, W.: Der moderne Künstler. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998. Schönrich, G./Kato, Y. (Hg.): Kant in der Diskussion der Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1996. 77 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Steenblock, V.: Theorie der kulturellen Bildung. Zur Philosophie und Didaktik der Geisteswissenschaften. München: Fink 1999. Wulf, Chr. (Hg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Weinheim/Basel: Beltz 1997. 78 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Februar 2004 Die Formung des Menschen Künste wirken – aber wie? – Eine Skizze von sozialen Wirkungen der Künste und ihrer Erfassung – Abstract Künste wirken – dies weiß eigentlich jeder, der aktiv oder rezipierend mit ihnen umgeht. Doch wird eine unbelastete Diskussion der Frage, wie man diese Wirkungen erfassen kann, in Deutschland durch eine hochideologische Verständnisweise von „Kunstautonomie“ oft genug verstellt. Hat man das damit verbundene Denkverbot überwunden, überhaupt nach Wirkungen der Künste zu fragen, dann erschließen sich überraschend viele Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Annäherung an die Wirkungsfrage. Der vorliegende Text stellt in einer tour d’horizon eine Fülle von Theorien und Konzepten vor, die bei einer systematischen Untersuchung sozialer Wirkungen von Kunst genutzt werden können. 1. Zur Einordnung des Textes Die Frage nach der Wirksamkeit ist heute in aller Munde. Nicht bloß bei Medikamenten, sondern auch bei politischen Reformen, bei Modellprojekten oder Gesetzen fragt man danach, was eigentlich bleibt. Hätte man gerne einen solchen Erfolg, dann spricht man von dem Ziel der „Nachhaltigkeit“, seit einigen Jahren einer der Top-Begriffe in der politischen Sprache. Diese Frage nach der Wirksamkeit gilt auch für die Künste. SchauspielerInnen wären gerne insofern „wirksam“, als es sich in ihrer Berühmtheit und „Prominenz“ niederschlägt. Schriftsteller sind nicht unempfindlich gegenüber Verkaufszahlen ihrer Werke. Und geradezu penetrant ist die „Wirksamkeit“ von Fernsehsendungen, die sich an dem scheinbar konkurrenzlosen Indikator „Einschaltquote“ ablesen lässt. Im Hinblick auf die Künste sind heute zwei Dimensionen von Wirksamkeit gefragt: Es geht um die Wirksamkeit bei dem Einzelnen, der sich – rezeptiv oder produktiv – künstlerisch betätigt. Hierbei geht es um die Entwicklung der Persönlichkeit in ihren verschiedenen Facetten: dem Kognitiven und dem Emotionalen, der Kreativität oder der Kompetenz zu sozialen Kon79 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 takten etwa. Es geht zum anderen um die Wirksamkeit in die Gesellschaft hinein. Also etwa um die Frage, ob die Künste hilfreich bei der Sicherung eines tugendhaften Lebens in der Stadt seien. Platon lässt bekanntlich Sokrates in seinem Dialog mit Adeimantos im „Staat“ die Ansicht entwickeln, dass die Gefahr, die von vortragenden Künstlern ausgeht, so groß ist, dass man diese tunlichst aus der Polis zu verweisen habe. Gnade fand – als Teil der „musischen Bildung“ – vor allem die Musik als tugendstärkende Kraft. Was für Platon und seine Zeitgenossen noch selbstverständlich war und was über die Jahrhunderte hinweg immer wieder in politischen Utopien (wie etwa Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung) aufgegriffen wurde, ist heute in Zweifel geraten: die Meinung, dass Künste so notwendig für die Entwicklung der Menschen und für eine (humane) Gestaltung der Gesellschaft seien, dass es deshalb eine öffentliche Verantwortung und Förderung für sie geben müsse. Zu dieser Problematik liefert der vorliegende Text einen weiteren Baustein. Er ordnet sich dabei ein in einen längerfristigen Arbeitschwerpunkt. In früheren Texten habe ich zum einen Theorien der Künste und Konzeptionen von Ästhetik ausgewertet in Hinblick darauf, inwieweit Theorien des ästhetischen Handelns und der Künste überhaupt die Frage zulassen und vielleicht sogar beantworten, dass und wie eine solche pädagogische oder politische Wirksamkeit möglich ist (u.a. Kunst und Ästhetik 2003; Wozu Kunst? 2002). Ich habe zudem versucht, Methoden vorzustellen und zu entwickeln, in denen im Rahmen einer pädagogischen Diagnostik individuelle Bildungswirkungen ermittelt werden können (Bildungswirkungen, 2002). Mir scheint, dass es zu dieser individuumsbezogenen Frage hinreichend überzeugende Literatur gibt, die sie positiv beantwortet. Schwieriger gestaltet sich die Frage nach der sozialen oder sogar politischen Wirksamkeit. Leicht ist es dort, wo sich Wirkungen in Mark und Pfennig ausdrücken lassen, also bei der ökonomischen Dimension von Kunst. Schwieriger wird es dort, wo man Veränderungen bei den Einstellungen, bei Wahrnehmungsformen und Werthaltungen sucht. Geht man historisch an diese Fragestellung heran (so wie in meinem Text „Kulturfunktionen der Künste“; 2003), dann lassen sich erhebliche Wirkungen (nachträglich!) belegen, etwa in Hinblick auf die Genese von nationalen Identitäten mittels der jeweiligen „Nationalliteratur“. Schwieriger wird die Frage nach der aktuellen Wirksamkeit. Der vorliegende Text stellt sich die Aufgabe, zwar diese Frage auch nicht eindeutig beantworten zu wollen, aber immerhin in einer tour d’horizon einige relevante Disziplinen danach zu befragen, ob und wie man entsprechende Antworten bekommen könnte. Ein methodischer Kniff, eine solche Frage überhaupt sinnvoll stellen zu können, besteht darin, „Kunst“ umzuetikettieren bzw. einzuordnen in entsprechende disziplinäre Begriffe. So lässt sich etwa 80 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 zwanglos und mit guten philosophischen Bezugsautoritäten Kunst als „Medium“ begreifen, so dass man das ganze Arsenal der Medienwirkungsforschung zumindest als „tool-box“ für eine soziale Kunst-Wirkungsforschung zur Verfügung hätte. Man wird sehen, wie weit ein solches Vorgehen trägt. Da aber auch eine Wirkung in das Soziale und Politische hinein nur über den Einzelnen funktioniert, stelle ich zunächst einige Überlegungen zur Funktionsweise der menschlichen Psyche zusammen (die sich z. T. schon in den oben genannten Texten finden). In Kategorien verbreiteter Erkenntnis-Konzeptionen handelt es sich dabei um einen „gemäßigten Konstruktivismus“, der die Existenz einer realen Außenwelt zugesteht, jedoch von der Notwendigkeit konstruktiver Eigentätigkeit des Menschen zum Aufbau „seiner“ Welt ausgeht. 2. Der Mensch im Mittelpunkt seiner Welt Der Mensch und seine Verbindung zur Außenwelt wird über ein einfaches, aber folgenreiches Schema konzeptionalisiert: Abb. 1 Subjekt Mittel Objekt Darin kommt die anthropologische Erkenntnis zum tragen, dass der Mensch wesentlich mittelverwendendes Wesen ist: Das „Mittel“ (= Medium!) trennt und verbindet zugleich Subjekt und Objekt. Ein weiterer Aspekt dieser Grundbefindlichkeit des Menschen ist seine aktive Auseinandersetzung mit der Welt, wobei man unterschiedliche Aktivitäts- und Tätigkeitsformen unterscheiden kann. Abb. 2 81 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Arbeiten Spielen Kommunizieren politisches Handeln Tätigkeiten Konsumieren soziales Handeln künstlerische Tätigkeiten Lernen Diese Ausdifferenzierung der Tätigkeitsarten legt es nahe, dass man sofort ein Bündel relevanter Bezugsdisziplinen ins Auge fassen kann, bei denen man nach der Wirksamkeit der jeweiligen Tätigkeit auf die Persönlichkeit fragen könnte: Abb. 3 82 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Tätigkeitsbereiche zuständige Wissenschaften praktisch gegenständliche Tätigkeit / Arbeit Arbeitspsychologie Spielen Spielpädagogik Lernen Lernpsychologie künstlerische Tätigkeiten Theorien künstlerischer Tätigkeit/kulturelle Bildungstheorie politische Aktivitäten politische Psychologie soziales Handeln Wissenssoziologie Massenpsychologie Medienkontakte Kommunikationsforschung Medienwirkungsforschung Konsumieren Werbepsychologie Wirtschaftspsychologie Sowohl die Logik der Tätigkeiten als auch die „Logik“ bzw. Struktur des Objekts haben Einfluss auf die Ausgestaltung der Persönlichkeit, der psychischen (und körperlichen) Ausstattung des Subjekts. Die folgenden drei Abbildungen modellieren dies. 83 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 4 WIRKLICHKEITSKONSTRUKTION durch den Menschen vorhandene Inhalte 1: cognitive maps Vorurteile Wissen Gefühlsstrukturen Wünsche Ziele Habitus Einstellungen Werte/Normen Ergebnis: aktueller Wahrnehmungsinhalt Die formale Dimension/tools: Prozesselemente Denken Beurteilen Strukturieren Deuten Empfinden Fantasie (Einbildungskraft) Denkformen (Wahrnehmen) Formen von Emotionalität Urteilsformen Deutungsmuster vorhandene Inhalte 2: ganzheitliche Wirklichkeitskonstruktionen Weltbilder/Selbstbilder/Weltanschauungen (aus Philosophie,Religion,Medien) Ideologien Wirklichkeitskonstruktionen Vorbilder LEIB/KÖRPER; Naturseite des Menschen; Einflüsse durch Hormone etc. Entwicklung/ Biografie/ Lebenslauf handelnde Gestaltung des individuellen Lebens Auseinandersetzung mit Naturgesetzen, Sozialem 84 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 5 3/03 visuelle Umwelt; Bildende Kunst, Städte und Landschaften, Texte/Lesen akustische Umwelt; Musik, Stadt- und Hausgeräusche, eigene Stimme Oralität Hören Sehen Geruchswelten Riechen Sprechen Das gesprochene Wort, Sprachformen, Oralität Tasten Schmecken Der Mensch im gestalteten Raum, der Raum als Gestalter des Menschen: Architektur, Stadtplanung, Natur etc. Der Körper in Bewegung; Tanz, Sport, Fortbewegung etc. der körperliche Habitus Theater 85 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 6 2/03 Der Mensch in der Welt Welt/Umwelt, u.a.: - gestaltete Umwelt Beziehungen zur Welt, u.a.: - sinnliches Wahrnehmen - Erkennen - Lernen - Bewerten - Gestalten - Arbeiten - Strukturieren - Ordnen - Verteilen - Sprechen - sich bewegen - Produktionsverhältnisse - politische Ordnung - Alltagsformen - Wertebasis - Medienwelten - Tauschpraxen - Ideologien - Vergegenständlichungen geistiger Traditionen (Kirchen etc.) - Praxisformen individuelle Geschichte des Menschen, u. a.: - Mentalitäten - Kunstbetrieb - Biographie - Traditionen - Bildungsweg - Familie - Heimat - Erfahrungen - Schicksalsschläge - Habitualisierungen - Kommunikationsformen - Sprachwelten 86 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Stellt man die Tätigkeit in den Mittelpunkt, so lässt sich speziell die künstlerische Tätigkeit/Praxis modellieren wie folgt: Abb. 7 Dimensionen der künstlerischen Tätigkeit externe soziale Dimension: Kunst als gesellschaftliche Erscheinung psychologische Dimension: kognitive, emotionale und kooperativ-soziale Entwicklung inklusive Aneignung des Selbst interne soziale Dimension: Kunst als sozialer Prozess/ künstl. Tätigkeit als sozialer (Gruppen-)Prozess künstlerisch-ästhetische Tätigkeit gegenständliche Dimension 1: Kunst als praktischgegenständliches Verhalten gegenständliche Dimension 2: Kunst als Aneignungsform von Wirklichkeit Im Hinblick auf die Einwirkungen der Gesellschaft auf das Subjekt ist es nützlich, „die Gesellschaft“ nach dem verbreiteten Parsonsschen Schema aufzuteilen in Subsysteme 87 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 8 Politik Wirtschaft - politisches Handeln - ökonomischer Tausch/Markthandeln, u.a.: - Konsum - Produktion - Arbeit politische Sozialisation ökonomische Sozialisation/ Integration SUBJEKT Sozialisation Soziales - soziales Handeln in unterschiedlichsten Gruppen Enkulturation Kultur - religiöse Tätigkeit - Handeln in Wissenschaft und Philosophie - künstlerische Praxen Denselben Sachverhalt stellt – unter Berücksichtigung der Konzeptionen der Mentalitätsforschung – Abb. 9 dar 88 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Kollektive Identitäten/Mentalitäten Ein Produkt der Gesellschaft, der Kultur, der Persönlichkeit Soziale Variablen Räumliche Strukturen Wirtschaft Soziale Differenzierungen und Stratifizierungen Politik Religion/Ideologie Massenmedien Familie Erziehung Bildung Kulturelle Variablen Kulturmuster, Kulturnormen, Kulturstandards, Kulturwerte, Kultursymbole Historische Ereignisse und Erfahrungen, Traditionen Aktuelle Ereignisse und Erfahrungen, Sozialkultureller Wandel, Modernisierung Persönlichkeitsvariablen Kollektive Identitäten/Mentalitäten Habitus Selbstbewusstsein/Selbstrealisierung Selbstdefinition/Selbstkonstruktion Psychische Manifestationen des Habitus/der Mentalität Handlungen Kommunikation Denk- und Gefühlsstile Prozesse Expressionen Produkte Symbolisierungen Selbst- und Zugehörigkeitsbewusstsein Quelle: Hahn 1999 89 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 3. Unterschiedliche Sichtweisen der Künste Wie oben angedeutet, lassen sich die Künste auf ganz unterschiedliche Weise betrachten. Man kann sie als spezifische menschliche Tätigkeiten (Musizieren, Malen etc.) oder in Hinblick auf Ergebnisse dieser Tätigkeiten („Kunstwerke“) auffassen. Man kann sie zudem aus der Sicht der Entfaltung der psychischen Kräfte des Einzelnen betrachten (Musik-, Kunst- etc. psychologie). Unter anderen geben sich so die folgenden Auffassungsweisen: I. Die Künste als symbolische Formen (i.S. von Ernst Cassirer) Ernst Cassirer (1990; vgl. Fuchs 1999) entwickelt seine Kulturphilosophie/Anthropologie als Philosophie der symbolischen Formen, die jeweils unterschiedliche Zugangsweisen des Menschen zur Welt sind. Künste als Symbolsysteme aufzufassen ermöglicht die unterschiedliche Symboltheorien auf Künste anzuwenden (vgl. Fuchs, Die Macht der Symbole, 1999). II. Kunst als Teil der Kultur Künste sind Teil der Kultur, wenn „Kultur“ die spezifisch menschliche Ausprägung des Lebens charakterisiert (Fuchs 1999). Ist dies aber so, dann erschließt man sich die Fülle von Kulturtheorien (Ashcroft 1998, Nünning 2001, Schnell 2000) für die eigene Fragestellung. Insbesondere kommen die cultural studies (Hörning/Winter 1999, Hartley 2002) ins Blickfeld, die integrative Konzeptionen von Kultur, Politik und Medien anbieten. III Kunst als Kommunikation Der Kommunikationsbegriff hatte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts seine Blütezeit. Insbesondere waren Lehrstuhlbezeichnungen wie „Visuelle“ oder „Auditive Kommunikation“ keine Seltenheit. IV Künste als (Massen-)Medien Bei einzelnen Kunstformen (Film, Musik, Literatur) ist die massenhafte Verbreitung wesensmäßig angelegt. Die „technische Reproduzierbarkeit“ (Benjamin) macht es zudem möglich, auch eher auf Unikate angelegt Künste massenhaft zu verbreiten, ebenso wie es die technische Kommunikation ermöglicht, Aufführungen der performativen Kunstformen (Tanz, Theater) einem großen Publikum zugänglich zu machen. 90 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 V. Künste als (soziologische) Medien Eine solche Verständnisweise findet sich etwa in soziologischen Systemtheoreien (Parsons, Münch, Luhmann). Es ergibt sich das folgende Strukturbild (Abb. 10) Abb. 10 zuständige Fachdisziplinen Politikwissenschaften Medienwissenschaft Kommunikationswissenschaft Ökonomie politische Medien Medien Wirtschaftsfaktor Kommunikation Die KÜNSTE als..... Kulturtheorien Sprachen Teil der Kultur Bildungsmittel Sprachwissenschaften SEMIOTIK Symboltheorien Tätigkeiten Mittel sozialer Stukturierung Seinsbereich (Ontologie) Bildungstheorien Soziologien: Kultur-, Bildungs-, Kunstsoziologien (Tätigkeits-) Philosophie/ Psychologie Philosophie/spezielle Ästhetiken In einzelnen systemtheoretischen Ansätzen (Luhmann, Parsons, Münch) wird das Kunstsystem (etwa das Literatursystem) ausführlich gemäß der Logik der jeweils übergreifenden soziologischen Systemtheorie behandelt. Ähnliches gilt für Bourdieu (1999) und seine Konzeption des Feldes. 91 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 VI. Künste in einer funktionalen Sicht Auch die Kunsttheorie hat in den letzten Jahren die Frage möglicher sozialer Funktionen von Kunst wieder aufgegriffen. Die ausführlichste Behandlung dieser Frage dürfte in Kleimann/Schmücker 2001 zu finden sein. Dort stammt auch Abb. 11 her. 92 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Abb. 11: Funktionen der Kunst generelle Funktionen potentielle Funktionen konstitutive Funktion nichtkonstitutive Funktion kunstinterne Funktionen kunstästhetische Funktion ästhetische Funktionen Traditionsbildungsfunktion(en) Innovationsfunktion(en) Reflexionsfunktion(en) Überlieferungsfunktion(en) kunstexterne Funktionen kommunikative Funktionen dispositive Funktionen expressive Funktion(en) appellative Funktion(en) emotive Funktion(en) Motivationsfunktion(en) konstative Funktion(en) Distanzierungsfunktion(en) therapeutische Funktion(en) Unterhaltungsfunktion(en) soziale Funktionen kognitive Funktionen mimetischmnestische Funktionen dekorative Funktionen Identitätsbildungsfunktion(en) Distinktionsfunktion(en) Schmuckfunktion(en) Illustrationsfunktion(en) Status Erkenntnisdokumentaindizierende funktion(en) rische FunktiFunktion(en) on(en) kultische Erinnerungsfunktion(en) Funktion(en) ethisch-explorative Funktion(en) politische Funktion(en) religiöse Funktion(en) (sonstige) weltanschauliche Funktion(en) geselligkeitskonstitutive Funktion(en) ökonomische Funktion(en) Schmücker in Kleimann/Schmücker 2001, S. 28 93 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 94 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Das Schema ist insofern aufschlussreich, als es aus einer kunsttheoretischen Sicht – also vom Kunstprozess her – die hier vorgenommene Zugangsweise zur Wirkungsfrage stützt. Denn die hier unterschiedenen Möglichkeiten, Kunst aufzufassen, finden sich alle als spezifische Funktionen von Kunst wieder, so dass der nächste Schritt nahe liegt, die jeweils zuständigen Disziplinen (wie etwa Kommunikations- oder Medienwissenschaft) auf ihren Sachstand in der Wirkungsforschung zu befragen. 4. Künste als Medien – Kunstwirkungen als Medienwirkungen Der Mensch ist ein mittelverwendendes Wesen. Diese anthropologische Bestimmung ist durchaus weitreichend. Zum einen erfasst sie die Tatsache, dass die Nutzung und vor allem vorsorgliche Herstellung von Werkzeugen aufs engste mit der Anthropogenese verbunden sind. Zum anderen taugt sie ebenfalls zur Bestimmung der Natur der wissenschaftlichen Tätigkeit als elaboriertester Form menschlicher Tätigkeit, insofern als die mögliche Reichweite wissenschaftlicher Erkenntnisse von den je vorhandnen Mitteln (Methoden, Forschungsweisen, Untersuchungsmitteln) abhängig gedacht werden kann. Die Medien in ihrer allgemeinsten Bestimmung als Mittler zwischen und Vermittlung von Subjekt und Objekt, aber auch als Mittel der Subjekt-Subjekt-Beziehung schaffen sowohl den notwendigen „sozialen Kitt“ wie die Verbindung des Menschen mit der Welt. In diesem allgemeinsten Sinne ordnen sich die Künste in das System der symbolischen Formen von Ernst Cassirer ein. Aber auch die Medien- und Kommunikationswissenschaft im engeren Sinne kann die Künste leicht in ihren Zuständigkeitsbereich integrieren. Dies liegt in der – in deutscher Tradition etwas überraschend klingenden – sozialen Natur der Künste. Es definieren sich nämlich nicht nur die performativen Künste wie etwa das Theater („Theater findet statt, wenn ein Schauspieler eine Rolle für ein Publikum spielt!“) über eine soziale Beziehung: auch bei den eher individualistisch scheinenden Künsten wie Literatur oder Bildender Kunst lautet eine allgemeinste Bestimmung, dass man von einem Kunstcharakter dieser Praxisformen eigentlich erst dann sprechen könne, wenn die Werke öffentlich werden. Dieses systematische Bestimmungsmoment von Kunst findet eine Begründung in ihrer Entstehung. Ebenso wie sich Tanz als Ästhetisierung von Bewegungen aus sozialen kultischen Ereignissen von sozialen Gruppen entwickelt, haben Bilder (etwa die Höhlenmalereinen) neben kultischen (also per se sozialen) auch erkenntnissichernde und handlungsleitende Funktionen. Selbst nachdem diese Funktionen zum Erliegen kamen, weil andere Medien sie offenbar besser erfüllen konnten, 95 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 wurden diese spezifischen sozialen Funktionen abgelöst durch andere soziale Funktionen: Der Zurschaustellung von Macht oder der Schaffung sozialer Symbole. Selbst die Unterhaltungsfunktion, die von Anbeginn die künstlerische Praxis begleitet, ist meist sozial gedacht: Denn Feiern, Genießen und Entspannen haben in so vielen Fällen einen sozialen Charakter, dass man es schon als Besonderheit herausstellen muss, wenn Menschen sich in die Einsamkeit der Kontemplation zurückziehen. So ist es also nur konsequent, wenn das Funkkolleg Kunst die Geschichte der Bildenden Kunst anhand ihrer religiösen, ästhetischen, politischen und abbildenden Funktion darstellt. Vor diesem historischen und systematischen Hintergrund wird deutlich, wie stark unser Blick auf die Kunst durch eine eigentümliche Ideologie ihrer Autonomie verstellt ist, die jegliches Fragen nach dem sozialen Wirken fast als Sakrileg betrachtet. Künste (und ihre Vorformen) haben etwas mit Erkenntnissicherung, mit Wissensspeicherung, mit Handlungsanleitung (und natürlich auch mit Kult, Religiösität und Unterhaltung) zu tun. Diese Erkenntnis passt zu der Grundidee der ambitionierten mehrbändigen Geschichte der Medien von Werner Faulstich, der die Entwicklung von Medien entlang der Leitlinien ihrer Steuerung- und Orientierungsfunktion untersucht. Nicht nur, dass er die Notwendigkeit solcher Funktionen als selbstverständlich für jede soziale Gruppe unterstellt: Er erklärt die Entwicklung der Medien, ihr Irrelevantwerden oder die Entstehung neuer Medien damit, wie das jeweilige Medium diese Funktionen zu erfüllen imstande war. Damit ergibt sich für ihn eine engste Verwobenheit von Medienentwicklung und Gesellschaftsgeschichte. Wer einen weiten Medienbegriff verwendet, braucht Unterteilungen. Auf Helge Pross geht die häufig benutzte Aufteilung zurück, die folgende Formen unterscheidet: primäre Medien: Leiblichkeit, menschliche Elementarkontakte, nonverbale Sprache wie Körperhaltung, Geste etc. sekundäre Medien: bei diesen verwendet der Sender bereits technische Geräte (Flaggensignale, Grenzsteine etc.). tertiäre Medien: Sender und Empfänger verwenden bei der Kommunikation technische Geräte. Faulstich verwendet eine Unterscheidung in Menschmedien: z. B. Tanz, Theater Gestaltungsmedien: z. B. Architektur und Bildende Kunst Schreibmedien: Von der Höhlenmalerei, der Verwendung von Wand oder Tafel bis zur modernen Schriftkommunikation. 96 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Die drei Medientypen sind dabei durchaus als chronologische Ordnung zu verstehen, wobei vorhandene Medien zwar nicht abgelöst, aber doch nach und nach verdrängt werden und dabei auch einen Wandel ihrer Funktionen erfahren haben. Dabei sieht Faulstich die Entwicklung so, dass ein sich herausbildender „Kunstcharakter“ dem Mediencharakter – etwa bei der Entwicklung von kultischen Bewegungen zur Kunstform Tanz – mit dem Verlust des Mediencharakters einherging. Diese These macht natürlich nur Sinn, wenn man ein entsprechendes Verständnis von Kunst zugrundelegt, das zumindest ein Herauslösen aus dem unmittelbaren Alltagsleben und eine Ästhetisierung der jeweiligen Praxisform bedeutet. Hierbei wird deutlich, dass sogar die Definition dessen, was „Kunst“ ist, nicht ohne die soziale Einordnung dieser Tätigkeitsform geschehen kann. Das Vorgehen von Faulstich macht Sinn, wie man es unschwer bei einer Lektüre entsprechender Geschichten der Künste bestätigt findet: Die gegenwärtige Verwendung von „Kunst“ steht am Ende eines Prozesses, in dem (soziologisch) „Künstler“ entstehen, in dem auf der philosophischen Ebene „Kunst“ als Sammelbezeichnung für bis dahin deutlich unterschiedene Praxisformen eingeführt wird (Baumgarten) und sich eine Spezialdisziplin Ästhetik herausbildet. Diese Genese des Kunstcharakters verläuft dabei sehr unterschiedlich in den einzelnen Kunstsparten (und dauert bis heute an, wenn man sich etwa an die Diskussion des Kunststatus der „angewandten Künste“, etwa der Architektur, erinnert). Die Funktionen, die Faulstich untersucht, decken sich dabei sowohl mit den Kunstfunktionen in Abb. 11 als auch mit den vier Grundfunktionen des Funkkollegs: Er untersucht die Speicherfunktion, die Repräsentationsfunktion, die kultisch-kommunikative Funktion, die publizistische Funktion, die Unterhaltungsfunktion, die Herrschafts- und Kontrollfunktion. Der Wandel der Gesellschaft entspricht dabei – wie erwähnt – einem Wandel in der Funktionalität bestimmter Medien und ist daher verbunden mit einem Wandel ihrer Bedeutung. Auch die Künste – als Medium aufgefasst – haben soziale Funktionen (auch als Ursache für ihre Entstehung, Verbreitung und Nutzung), die sich jedoch im Laufe der Zeit verändern können. So gibt es einen generellen Wandel vom Kultischen zum Profanen, vom Alltäglichen zum Besonderen. Die gilt speziell für die Künste. Sie starten mit einem kultischen Charakter, erhalten irgendwann einen Unterhaltungswert, erleben ihre Ästhetisierung und geraten (im Zuge der Erklärung ihrer „Autonomie“) in die Situation einer sich zunehmend im Hinblick auf Nutzergruppen beschränkenden Ausstrahlungskraft. Generelle Leitlinie der Medienentwicklung ist dabei der Grad ihrer Funktionalität als Steuerungs- und Orientierungsfunktion. Wenn der Wechsel in den Medien damit erklärt werden kann, dass herkömmliche Medien diese Funktionen immer schlechter erfüllen und daher von 97 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 neuen Medien verdrängt werden, dann wird man sich diesen Prozess auch in seiner Anwendung auf die Künste (als Medien) vorstellen müssen: Kann es sein, dass die Künste ihre Funktionalität (welche?) verlieren, etwa weil ein erneuter „Strukturwandel“ zu einem Relevanzverlust führt? Die funktionale Betrachtung der Künste als Medien führt also zu einer Fragestellung, die heute durchaus im Kunstbereich diskutiert wird: Bei der Frage nach der sozialen Funktion muss man in den Blick nehmen, für welche Gruppe diese Funktion Relevanz hat. Viele heutige Kultureinrichtungen (Theater, Kunstverein, Museum) sind in großer Zahl im 19.Jahrhundert entstanden und hatten sehr viel mit der Entwicklung der bürgerlichen Identität zu tun (Nipperdey). Das Bürgertum hat sich daher auch als Träger- und Nutzergruppe verantwortlich für seine Kultureinrichtungen gefühlt, da diese Orte der (politischen) Öffentlichkeit waren. Damit ist „Öffentlichkeit“ als eine weitere Kategorie ins Spiel gekommen, die spätestens seit Habermas’ Untersuchungen unter der Perspektive ihres Strukturwandels aufmerksam verfolgt wird (s.u.). Die Möglichkeit eines erneuten Strukturwandels der Öffentlichkeit – etwa unter dem Einfluss der modernen elektronischen Massenmedien – muss in Erwägung gezogen werden, wobei dann die Frage nach der zukünftigen Relevanz der Kunst- und Kulturorte in der veränderten Öffentlichkeit gestellt werden muss. Als Kriterien für (politische) Öffentlichkeiten (und damit auch als mögliche Messlatten der Relevanz der Künste) gibt Neidhardt (1994. die folgenden an: A) Die Öffentlichkeit soll offen für alle Gruppen, für alle Meinungen von kollektiver Bedeutung sein: Transparenzfunktion. B) Öffentlichkeitsakteure sollen mit Meinungen anderer diskursiv umgehen: Validierungsfunktion. C) Öffentliche Kommunikation erzeugt öffentliche Meinung: Orientierungsfunktion. Es liegt auf der Hand, dass hiermit einige relevante Aspekte auch für Kunstangebote angesprochen werden, wobei die Kunst- und Kultursoziologie eine Vielfalt an empirischen Befunden liefert, ob und wie etwa ein Publikum – und welches – erreicht wird (hier ist an Bourdieu zu erinnern), wie ein Kunstdiskurs in der Gesellschaft stattfindet oder ob und wie eine Meinungsbildung über Kunstrezeption erfolgt. „Publikum“ und „Meinungsbildung“ als zentrale Kategorien einer Soziologie der Öffentlichkeit sind also durchaus relevante Aspekte im Hinblick auf die Frage nach der Relevanz der Künste. Dies betrifft – insbesondere im Rahmen unseres Vorgehens, Künste als Medien zu 98 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 betrachten – die Frage ihrer Wirksamkeit, für die wir nunmehr einen Blick in die Medienwirkungsforschung werfen. Medienforschung Jedes Einführungsbuch in die Kommunikations- oder Medienwissenschaft enthält Kapitel über Medienwirkungen (Merten 1999, Merten u.a. 1994, Kübler 1994; siehe auch Jäckel 1999). In den letzten Jahren hat sich dabei – unter dem starken Einfluss von radikalkonstruktivistischen Ansätzen – die Frage nach dem „Wirklichkeitsbild“ und seiner Beeinflussung/Konstruktion durch die Medien in den Vordergrund geschoben. Ich kann und will hier keinen Überblick über die ausufernde Forschung und Debatte über Medienwirkungen, sondern nur einige Hinweise geben, die für meine Zwecke relevant sein könnten. (Beabsichtigte) „Wirkungen“ könnte man u.a. als Realisierung von „Funktionen“ verstehen. Kübler (1994, S. 72ff) unterscheidet die folgenden Funktionen der Massenkommunikation: Speicherfunktion und kulturelle Wertschätzung Kulturfunktionen der Medien; hiermit meint der Autor den Einfluss technischer „Transportmedien“ (Buchdruck, Filmtechnik, Radiotechnik etc.) auf die (ästhetische) Entwicklung der Kunstsparten Welt- und Wirklichkeitsvermittlung Unterhaltungsfunktion Informationsfunktion Selektions- und Strukturierungsfunktion (i. S. von Wirklichkeitsbildern) Orientierungsfunktion Integrationsfunktion Kritik- und Kontrollfunktion Sozialisationsfunktion Selbst eine flüchtige Durchsicht dieser Funktionen lässt ihre Relevanz für die Künste erkennen. 99 Document1 Erstelldatum 06.10.2015 10:08 Ziele von Kommunikation Beobachtbare Kommunikationsstimuli Prädispositionen Situation der Kommunikation Freie Kommunikation (allgem. Überredbarkeit) Eigenschaften des Inhalts: Gebundene Kommunikation Interne Mediatisierungsprozesse Einstellungsänderungen Meinungsänderungen Inhalt: Gegenstand - Inhalt der Argumentation Appelle Argumente Stil Gegenstand: ("topic-bound") Appelle ("appeal-bound") Argumente ("argument-bound") Stil ("style-bound") Eigenschaften des Kommunikators: Beobachtbare Effekte der Kommunikation Aufmerksamkeit Veränderungen im Wissen Kommunikator: "communicator-bound" Rolle Zugehörigkeit Ziele Verständnis Eigenschaften des Mediums: Veränderungen im emotionalen Bereich Medium: direkte vs. indirekte Kommunikation Art der Bedeutungsvermittlung (optisch - akustisch) "media-bound" Annahme Situative Bedingungen: Situation: Soziales Feld Sanktionen (pos./neg.) "situation-bound" Verhaltensänderung Das Grundmodell der Wirkungsforschung (Hovland/Janis 1979, S. 225; entnommen aus Burkart 2002, S. 469) 100 Document1 15.05.16 Eine Medienwirkungsforschung könnte sich nunmehr damit befassen, inwieweit diese Funktionen als intendierte Wirkungen erfüllt oder ob auch unbeabsichtigte Wirkungen erzielt worden sind. Der Trend in der Wirkungsforschung zeigt dabei in eine Richtung, die sich von monokausalen und linearen Wirkungsverläufen verabschiedet (wobei in der öffentlichen Wirkungsdiskussion – etwa bei dem Thema „Gewalt in und durch Medien“ – sich diese monokausale Sicht doch immer wieder durchsetzt). Man erkennt die Konstruktivität des Rezipienten an, was gelegentlich bis hin zu einer Bewertung der Realität bzw. der Medieninhalte als völlig bedeutungslos ausgedehnt wird. Im Hinblick auf die Dimensionen der Persönlichkeit sind folgende Spezialisierungen denkbar: Wirkungen auf Wissen und kognitive Strategien Wirkungen auf Wahrnehmungsformen und Deutungsmuster Wirkungen auf Emotionen und Motivationen Wirkungen auf Wertehaltung und Einstellungen Wirkungen auf den Körper Wirkungen auf das Verhalten. Man wird diese Frage in Verbindung bringen mit entsprechenden (sozial-)psychologischen Disziplinen wie etwa der Vorurteils- oder Einstellungsforschung. Allerdings hat die Sicherheit der Ergebnisse mit dem sprunghaft gewachsenen Forschungsaufwand nicht notwendig zugenommen. Relativ präzise lassen sich empirisch Nutzerquoten feststellen. Doch stößt die Forschung recht schnell auch hier an ihre Grenzen, da nicht klar ist, mit welcher Intensität der Nutzer das Medium genutzt hat. Auch deshalb gab es in der Medienwirkungsforschung eine Veränderung in der Fragestellung danach, wie die unterschiedlichen Nutzer mit ihren Medien umgehen. Auch ergab sich eine (medien)-biographische Wende, die die Evolution des individuellen Medienverhaltens in den Blick nahm. Einfache Ergebnisse sind also nicht zu erwarten, auch wenn eine starke Strömung in der Forschung davon ausgeht, dass zum einen eine Selektion danach stattfindet, wie schon vorhandene Überzeugungen gestützt werden, die rezipierten Inhalte also assimiliert werden in vorhandene Wirklichkeitsbilder. Andere Forscher stellen fest, dass Anregungen und Informationen aus Medien zwar genutzt, aber subjektiv zu einem Wirklichkeitsbild integriert werden (bei dem bestimmte Ursprünge seiner Elemente nicht mehr leicht identifiziert werden können). Für die Medienwirkungsforschung zieht man inzwischen das Resumé, dass immer noch die unterstellten Modelle vom Menschen unzureichend sind und zu simple Vorstellungen von 101 Document1 15.05.16 „Wirkung“ unterstellt werden. Eine eher negative Bewertung der Resultate führt jedoch nicht zu einer Absage an die Wirkungsforschung schlechthin, sondern zur Ermutigung zur Entwicklung komplexerer Modelle. Was bedeutet dies für die Frage nach den Kunstwirkungen? Nutzerstudien – etwa das Zählen des Publikums – gibt es natürlich auch im Kunstbereich. Mit Film, Musik und Literatur gibt es zudem einen großen Überschneidungsbereich mit modernen Massenmedien. Es gibt sogar in der Medienwirkungsforschung und im Kontext der cultural studies eine Vielzahl von Untersuchungen, die sich mit diesen Formen der „Massenkünste“ befassen (etwa als Teil der „populären Kultur“). Allerdings sind die Ergebnisse auch nicht konkreter als in der „normalen“ Medienwirkungsforschung. In anderen Kunstbereichen – Tanz, Theater, Bildende Kunst – hat man m. W. solche Studien noch nicht angestellt. Die seinerzeit umfassendste Zusammenstellung aus dem Bereich „Kulturevaluation“ findet sich in Fuchs/Liebald 1995. Fazit dieses Abschnittes ist also: 1. Es ist sinnvoll und legitim, Künste als Medien zu betrachten 2. Damit werden die an anderer Stelle historisch (Fuchs: Kulturfunktionen 2003) bzw. systematisch aus Kunsttheorien (Kleinmann; siehe Abb. 11) gewonnenen sozialen Funktionen, die Kunst haben kann, erhärtet und bestätigt. 3. Das Spektrum möglicher Ansätze einer Wirkungsforschung wird erweitert. Allerdings: 4. Es sind die Ergebnisse der Medienwirkungsforschung eher ernüchternd. 5. Auch für eine Kunstwirkungsforschung muss dasselbe gelten wie für die Medienwirkungsforschung: Nur mit hinreichend komplexen Modellierungen des rezipierenden Menschen wird man akzeptable Ergebnis erhalten. Bis dahin sprechen Plausibilitätsargumente und Einzelbelege dafür, dass im Grundsatz Wirkungen erzielt werden – sofern ein Publikum erreicht wird. Michael Jenne (1977) hat die Auffassung von „Musik als Kommunikation“ durchdekliniert und kommt zu folgendem Fazit: „Musik muss zunächst als ein autonomes System menschlicher Kommunikation erkannt werden. Sie kann im Dienst der Unterdrückung und der Befreiung stehen; durch sie vermag sich individuelle Entfaltung oder auch Abstumpfung zu vollziehen; Musik kann der Selbstverwirklichung des Menschen dienen, der Differenzierung seiner Empfindungen, der Kritikfähigkeit und der kreativen Souveränität im Umgang mit Denkmustern und Normen – oder auch der Entmündigung des Individuums, seiner manipulativen Steuerung, der ideologischen Verengung seines Bewusstseins. Musik ist damit im technischen Zeitalter, also in ihrer beliebigen instrumentalen – produktiven wie rezeptiven – Verfügbarkeit, mehr denn je zu einem Machtfaktor geworden. Die 102 Document1 15.05.16 Macht freilich ist ihrerseits mitbedingt durch die Qualität der kommunikatorischen Grundtendenzen, die Einstellungen und Verhalten des einzelnen prägen. Gewiß sind diese Zusammenhänge in der Musik aufgrund ihrer außerbegrifflichen, immanenten Sinnstruktur schwerer erkennbar als etwa im sprachlichen Kommunikationssystem. Vor dem Hintergrund einer Theorie kommunikatorischer Qualitäten, von denen die sozialen Steuerungsmöglichkeiten abhängen, wird jedoch die Unhaltbarkeit der Diskrepanz deutlich, die nicht nur den Stand der bildungspolitischen, sondern auch der sozialwissenschaftlichen Diskussion in diesem Bereich kennzeichnet: Die Diskrepanz zwischen der intensiven Zuwendung von Bildungsforschung, Bildungsplanung und Bildungspolitik zum Bereich sprachlich-begrifflicher Differenzierung und Sensibilisierung und der Vernachlässigung des musikalisch-außerbegrifflichen Bereichs der Sozialisation, der damit weitgehend den auf irrationale Affirmation und Trivialisierung gerichteten Einflüssen anheimfällt.“ (Jenne 1977, S. 177f.). Damit ergibt sich die Frage, welche Konzepte sich finden lassen, die diese Prozesse zu erfassen gestatten. 5. Deutungsmuster, Mentalität, Habitus, Geschmack Medien (und somit auch die Künste) wirken vielfältig auf den Menschen: zum einen als Informationsmedien, wobei dies im Gebrauch der Künste wohl der seltenere Fall ist. Vor allem wird man sie zur Unterhaltung und/oder als Mittel der Reflexion, des Kennenlernens neuer Sichtweisen, der Überprüfung der Bewertung von Lebensstilen etc. wählen. Bei all diesen Gebrauchsformen geht es weniger um Wissen und Information, sondern eher um die normative, motivationale und emotionale Seite des Menschen. Möglicherweise ist es noch nicht einmal die Absicht des Kunstnutzers, einen Lebensstil zu überprüfen und zu bewerten, sondern einfach ein Bedürfnis nach „kultivierter“ Unterhaltung, Entspannung oder ästhetischem Genuss. Insofern in diesem Prozess der Kunstbegegnung nun etwas Evaluatives oder Emotionales geschieht, dann eher beiläufig, en passant. Es ist also eher ein „informelles Lernen“, so wie es im Rahmen der Sozialisation und Enkulturation geschieht. Die Soziologie befasst sich durchaus auch mit dieser Frage, wieso die Menschen so fühlen, denken und handeln, wie sie es tun. So gibt es spezielle Forschungszweige – oft kaum abgrenzbar von den entsprechenden Schwerpunkten der Entwicklungspsychologie –, die sich mit kognitiver, sprachlicher, emotionaler, motivationaler, moralischer, politischer oder geschlechtspezifischer Sozialisation befassen und dabei die „gängigen“ Theorien verwenden (Lerntheorie, Behavionismus, Psychoanalyse etc.). Die klassische Grundsatzfrage zwischen „angeboren“ und „erworben“ scheint inzwischen – verstärkt durch neurowissenschaftliche Forschungen – in dem Kompromiss eine Lösung zu 103 Document1 15.05.16 finden, dass eine gegebene genetische Ausgangsposition nach dem Modell der Formatierung (als der gesellschaftlichen Prägung) einer Computerfestplatte (als dem „Angeborenem“) von Umwelteinflüssen geformt wird: Kultur, Soziale Kontexte und natürlich auch die Medien spielen hierbei eine wichtige Rolle. Ebenso verschiebt sich unter Nutzung der Neurowissenschaften der Akzent bei der Erklärung menschlichen Verhaltens eindeutig weg von Kognition hin zum Emotionalem als zentraler Steuerungsinstanz. Bestätigt sich dies, spricht dies für eine erhebliche Relevanz künstlerischer Aktivitäten, die nach einhelliger Lehrmeinung in diesem Bereich ihre zentrale Wirksamkeit entfalten. Nun kann in diesem Text nicht die unüberschaubare Fülle von Themen und Befunden wiedergegeben werden (ersatzweise sei für die Entwicklungspsychologie auf Fend 2000, für die Persönlichkeitstheorie auf Percin 2000 und für die Sozialisationsforschung auf Hurrelmann/Ulich 1996 verwiesen). Ich will an dieser Stelle zwei Konzepte herausgreifen, den „Habitus“ und das „Deutungsmuster“. Ein „Deutungsmuster“, so Bollenbeck (1994, S. 19) in seiner Studie, die sich mit der Genese und Wirksamkeit zweier spezifischer Deutungsmuster befasst, „leitet Wahrnehmungen, interpretiert Erfahrenes und motiviert Verhalten. Diese individuelle Sinngebung vollzieht sich persönlich, ist aber keineswegs unvergleichbar, denn Deutungsmuster meint von außen angeeignete, vorgefertigte Relevanzstrukturen, die man nicht auswählt, sondern eher übernimmt.“ Es geht also um einen Prozess „symbolischer Vergesellschaftung, bei dem das Individuum in seinem sozialen Kontext komplexe Bedeutungen von Begriffen durch einen handelnden Umgang damit erwirbt“. Das Konzept des „Deutungsmusters“ vermittelt also Individuum und Gesellschaft, und zwar an der Stelle, an der nach der Genese des Bildes/des „Wissens“ von der sozialen Wirklichkeit im Einzelnen gefragt wird. Man kann es also der Wissenssoziologie oder Ideologietheorie zuordnen. Ein weiterer relevanter Begriff stammt aus dem Theoriengebäude von Pierre Bourdieu: Der Habitus: „Als einverleibte, zur Natur gewordene und damit auch vergessene Geschichte ist der Habitus wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die ihn erzeugt hat.“ Er ist ein „System dauerhafter und übertragbarer Dispositionen“, eine „Erzeugungs- und Ordnungsgrundlage für Praktiken und Vorstellungen“ (alle Definitionen nach Krais/Gebauer 2002, S. 5f.). Die Tradition des Habitus-Begriffes reicht bis zu Aristoteles zurück. Bei Bourdieu spielt etwa der Kommentar einer Arbeit des Kunsthistorikers Panofsky über scholastische Architektur eine Rolle (später gesondert publiziert in seiner „Soziologie der symbolischen Formen“). Von dort aus führt der Weg über Thomas von Aquin zu Aristoteles: Der Habitus als Resultat 104 Document1 15.05.16 von Gewöhnungshandlungen, so wie sie etwa bei der Aneignung von Sitten und Gebräuchen ein wichtige Rolle spielen („hexis“). Es ist ein „nicht-intellektuelles Vermögen zur Hervorbringung von Handlungen“ (Krais/Gebauer 2002, S. 29), quasi die Einverleibung und dann auch Verkörperung eines Sozialen im Individuum. Es ist also kein Zufall, dass insbesondere die Studien der körperbezogenen Aktivitäten des Menschen (Tanz und Sport) größtes Interesse an diesem Konzept haben. Die Begriffe „Deutungsmuster“ und „Habitus“ stammen aus unterschiedlichen Theorietraditionen, so dass ein Vergleich heikel ist. Denn stets definieren die theoretischen Kontexte den Einzelbegriff mit. Trotz dieser Bedenken wird man jedoch das Deutungsmuster als Teil des Habitus sehen können, der sehr viel weit reichender und komplexer die Persönlichkeitsstruktur als Ganzes – einschließlich der körperlichen Bewegungsformen – erfasst. Beide Konzepte haben Relevanz in Hinblick auf die Beschreibung der Wirkung von Künsten: Künste liefern Deutungsmuster als Wahrnehmungs- und Bewertungsformen von Wirklichkeit. Ein Habitus kann entstehen durch eine regelmäßige Praxis in den Künsten (was für KünstlerInnen und ihre intensive Auseinandersetzung mit ihrer Sparte ohnehin gilt). Das Subjekt sieht sich also vielfältigen sozialen Einflüssen ausgesetzt, die jeweils dafür sorgen, dass es in diesem Sozialen auch agieren kann. Es muss sich an bestimmte Spielregeln halten, soll aber auch immer wieder versuchen, ein reflexives Verhältnis zu diesen Regeln und Einflüssen zu gewinnen und diese sogar zu gestalten. Die beiden folgenden Graphiken (Abb. 13 + 14) versuchen, die Fülle dieser sozialen Einflussfaktoren aufzuzeigen, entsprechende wissenschaftliche Konzepte zu benennen und disziplinäre Zuordnungen vorzunehmen. Man sieht, dass sich gleich eine ganze Reihe von Disziplinen mit dieser Beeinflussbarkeit des Einzelnen befasst, so dass die Frage der sozialen Wirksamkeit von Kunst in Hinblick auf diese vorgestellten Einflussfaktoren, Konzepte und Wissenschaften präzisiert werden kann. In jedem Fall ist man nicht so hilf- und mittellos, wie es in der kulturpolitischen Diskussion gelegentlich erscheint. 105 Document1 15.05.16 Abb.13 MF 03/04 Konzepte zur Erfassung der sozialen Einflüsse auf den Einzelnen SOZIALPSYCHOLOGIE Deutungsmuster P O L I T I S C H E Ö K O N O M I E Einstellungen Präferenzen soziales, kulturelles Gedächtnis (Assmann) Mentalitäten Klassenbewusstsein kollektives Gedächtnis (Halbwachs) Weltbild inkl. Religion, Philosophie, geistige Welt Der MENSCH in der sozialen Gruppe ges. Stimmung Krisenerfahrung Anomie Geschmack Zeitgeist Ethos (z. B. im Beruf) soziale, kulturelle, nationale Identität K U L T U R W I S S E N S C H A F T E N Sozialcharakter Charaktermaske Rolle SOZIOLOGIE Die Konzepte und die Realitäten, die sie erfassen, beziehen sich auf bestimmte Zeiten und Epochen auf bestimmte soziale Gruppen, z. B. das Klassenbewusstsein auf den politischen oder sozialen Standort auf den jeweiligen geographischen Ort 106 Document1 15.05.16 6. Zur Wirksamkeit der Künste im sozialen Zusammenhang – ein Modell Die in diesem Abschnitt im Mittelpunkt stehende Graphik (Abb. 14) versucht, Akteure und Einflüsse im sozialen Wirkungsgeschehen zu skizzieren. Es werden unterschieden: Die (traditionellen) Künste, wobei sowohl die Produzenten als auch die dazugehörigen, z. T. kulturwirtschaftlich organisierten Vermittlungsformen zusammengefasst werden (also etwa: Bildende Künstler und der Kunsthandel). Natürlich spielen bereits in diesem Verhältnis zwischen „Produzenten“ und „Verwertern“ vielfältige soziale Einflüsse eine Rolle, die die Produktionsmöglichkeit der KünstlerInnen entschieden beeinflussen (Moden, Kritikerurteile Geschmack, Geschäftsstrategien etc.). Bourdieu konzeptionalisiert diese komplizierte Beziehung im Rahmen seiner Theorie des „künstlerischen (z.B. literarischen, musikalischen etc.) Feldes“. Daneben – obwohl nicht trennscharf abgrenzbar – gibt es die eher auf einen breiten Publikumsgeschmack ausgerichtet populäre Kulturproduktion mit den Massenmedien Kino, Zeitschriften/Zeitungen, populäre Musik, Bestseller-Literatur etc. Bei diesem Bereich liegt es auf der Hand, wie stark die Kunstproduktion hier von sozialen (v.a. ökonomischen) Regeln beherrscht wird. Immerhin leisten Sendungen, die „Superstars“ suchen, einen gewissen Einblick in Entscheidungsprozesse in diesem Feld. All diese Produktionsformen wirken mittelbar und unmittelbar auf ein Publikum: Unmittelbar dort, wo sofort das Publikum erreicht wird, mittelbar dort, wo Meinungsmacher in den Medien (z. T. auch im eigenen kulturellen Bereich) ihre Geschmacksurteile mehr oder weniger erfolgreich öffentlich machen. Auch Entscheidungsträger in der Politik spielen angesichts des Strukturwandels der Politik (hin zu „Politainment“) eine wichtige Rolle. Die „Bevölkerung“ wiederum splittet sich – ganz so, wie es die Kultursoziologie von P. Bourdieu analysiert – in ein hochdifferenziert strukturiertes „Publikum“. Meinungs- und Trendforscher untersuchen regelmäßig dessen Geschmacksorientierungen, so dass in keinem Fall ein lineares Wirkungsverhältnis entsteht, sondern man von komplizierten dialektischen wechselseitigen Beeinflussungsprozessen ausgehen. muss. Natürlich ist dieser Teilbereich einer „kulturellen Öffentlichkeit“ nicht nur eingebettet in die allgemeine Öffentlichkeit, sondern auch vielfach in einer Wechselbeziehung zu Entwicklungen im Bereich der Ökonomie, des Sozialen, des Politischen und den anderen kulturellen Feldern (Religion, Wissenschaft), ganz so, wie es das AGIL-Schema der soziologischen Systemtheorie beschreibt. Abb. 14 107 Document1 15.05.16 MF 03/04 Mittelbare und unmittelbare Einflussmöglichkeiten der Künste und Medien ein Wirkungsmodell Kulturelle Öffentlichkeit KULTURVERBÄNDE t af) P K B il d e un n d st e Bo ul e va Mu rd T si c he a al te r TV /Ki no Th e O at K pe er on r / ze / rt Li te ra tu r e l är r pu po ratu te en n Li n g fte i tu h ri t Ze ts c af ei n ch ) Z ie rts i k (U e d wi r us e M s tri n m lt u se K u du as + in M on i kt du ro ( uz od r P w te u r ns u lt ü K K + n te en h sc ir t E -M us ik unmittelbare Wirkung auf Publikum Politische Redaktion/Feuilleton/ inklusive Kritik Meinungsbildende Medien mittelbare Wirkung auf Publikum Medienstars Meinungsführer Entscheider in Politik und Wirtschaft mittelbare Wirkung Demoskopie/ Werbung Rückw irkung des Publikums-Geschmacks Bevölkerung strukturiert nach Milieus, Lebensstilen, Einflussgruppen etc. Prägung von: - Geschmack - Einstellungen - Zeitgeist - Weltbild - kulturellem Gedächstnis POLITIK ÖKONOMIE - sozialen Gesellungsformen Identitäten Bew usstseinsformen Wahlentscheidungen (politisch + Konsum) SOZIALES andere KULTURBEREICHE (Wissenschaft, Religion etc.) 108 Document1 15.05.16 7. Evaluation in der Kulturpolitik Am Anfang der Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab es im Zuge der Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der öffentlichen Verwaltung und damit auch in Kultureinrichtungen, die in öffentlicher Trägerschaft betrieben wurden, erste Überlegungen zur Evaluation in der Kulturpolitik. Der überwiegende Teil der damaligen Überlegungen betraf die einzelne Einrichtung oder das einzelne Projekt. Allerdings bezog man durchaus auch komplexere Aktivitäten ein. In einer Pilotstudie für das damalige Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Fuchs/Liebald 1995), die sich mit „Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik“ auseinandersetzte, wurden Grundlinien eines „kulturverträglichen“ Evaluationsverfahrens entwickelt, das später – etwa bei der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung – auch in die Praxis umgesetzt wurde (BKJ 1998). Der Bogen wurde dabei von der Evaluation pädagogischer Wirkungen bei dem Einzelnen (ein Thema, das als „pädagogische Diagnostik“ im Rahmen des BKJ-Projektes „Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung“ wieder aufgegriffen wurde) über die Evaluation einzelner Einrichtungen bis – wie erwähnt – zur Evaluation ganzer Politikprogramme gespannt. Neben Ansätzen, die ausschließlich ökonomische oder andere quantitative Aspekte (Nutzerstudien) erfassten, gab es dabei durchaus weiter reichende Ansätze. Einige will ich hier erwähnen: Ein erster wichtiger Schritt in der Kulturpolitikevaluation ist die Beschreibung des zu erfassenden Systems. Hierzu gibt es inzwischen im Kontext des Europa-Rates eine ganze Reihe von Länderberichten, die die Struktur der jeweiligen nationalen Kulturpolitiken darstellen. Einen weiteren wichtigen Ansatz liefert die UNESCO, die seit 1998 zwei Weltkulturberichte vorgelegt hat. Hierbei geht es u. a. um eine zahlenmäßige Erfassung von Produktion, Distribution und Konsum im kulturellen Bereich. Eine wichtige Frage ist dabei die Festlegung von aussagekräftigen Indikatoren. Neben einer zahlenmäßigen Erfassung der Auflage von Zeitungen und Büchern wird etwa auch die Analphabetenrate in den einzelnen Ländern – zur Kennzeichnung der basalen Kulturtechnik Lesen – dargestellt. Ein ähnliches Beispiel findet sich in der Schweiz, wo das Statistische Bundesamt für jede Kunstsparte sowohl Produktions-, Distributions- und Konsumindikatoren entwickelt hat. Diese Bemühungen ordnen sich ein in die Entwicklung einer Kulturstatistik. Das seinerzeit bemerkenswerteste Beispiel einer Evaluation im Bereich der Kulturpolitik, das neben ökonomischen und Nutzerdaten auch pädagogische und soziale Wirkungen mit einbezog, war eine Pilotstudie aus Großbritannien (F. Bianchini: Social Impact of the Arts, 1993), in der ein weites Forschungsdesign beschrieben wurde. 109 Document1 15.05.16 Hier die Schlüsselkategorien: 1. Selbstbildung und Verbesserung von Fertigkeiten: Verbesserung der Kommunikation Ermutigung zur Selbst-Bildung Verbessern und Vergrößern der Wahlentscheidungen bei Lebensentscheidungen. Indikatoren: Bewertung der Veränderungen in der Karriere der Teilnehmer Bewertung der persönlichen Effektivität vor und nach dem Kunst-Projekt Bewertung der Entwicklung beruflicher sozialer Fertigkeiten Bewertung der erhöhten Nutzung kultureller Angebote. 2. Identität und Unterscheidbarkeit: Verbesserung der individuellen oder Gruppenidentität Bestätigung lokaler Besonderheiten Ermutigung zu kritischer Loyalität zum eigenen Beruf Indikatoren: Gewachsene Anzahl sozialer Transaktionen und Kommunikationen innerhalb der Projektgruppe Veränderungen im Sozialverhalten Veränderungen in der Nutzung sozialer Räume vor und nach einer KunstVeranstaltung. 3. Phantasie und Selbst-Ausdruck: Verbesserung des kreativen Potentials Diskussion von Träumen und Hoffnungen Indikatoren: Veränderungen im kreativen Ausdruck der Teilnehmer Verbesserung der Problemlösefertigkeiten Erfolge bei der Überwindung von Depressionen. 4. Physisches und soziales Wohlbefinden: Verbesserung der Lebensqualität Verschönerung öffentlicher Räume Entdeckung der Geschichte von Menschen und Plätzen. Indikatoren: Gesundungsraten von Patienten 110 Document1 Zufriedenheit von Patienten und Pflegepersonal Wahrnehmung der Umgebung. 15.05.16 5. Sozialer Zusammenhang und wechselseitiges Verständnis Unterstützung inter-ethnischer Kontakte Schaffung einer gemeinsamen Basis von Menschen verschiedenen Alters, verschiedener sozialer Klassen etc. Ausdehnung des individuellen sozialen Netzes. Indikatoren: Muster sozialer Netzwerke Werthaltungen gegenüber anderen Kulturen Bewusstheit gegenüber anderen Kulturen. 6. Organisationsgrad der kulturellen Infrastruktur: Verbesserung des Selbstvertrauens von Gruppen Schaffen von Bedingungen für Partnerschaften zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor Indikatoren: Gründung neuer Organisationen Veränderungen im Selbstvertrauen 7. Erziehung und Bildung Verbesserung von Bildungsprogrammen Ermutigung zu eher altruistischem, kooperativen, umweltsensiblen Lebenshaltungen Verbesserung der politischen Bürgertugenden Anregung einer öffentlichen Diskussion von Fragen von öffentlichem Interesse. Indikatoren: Beobachtungen von Lehrern Veränderungen der Resultate der Schüler und Studenten Veränderungen in der Mitgliedsstärke von Parteien, Interessensgruppen und Initiativen. 8. Visionen und Inspiration: Erweiterung des mentalen, kulturellen, politischen und sozialen, räumlichen und geographischen Horizonts Handeln als Katalysator für sozialen und politischen Wandel Entwerfen von Zukunftsbildern. Indikatoren: 111 Document1 15.05.16 Gründung neuer politischer oder Bürgerinitiativen Veränderung von Mustern des kulturellen Konsums und des Sozialverhaltens Überblicke über Veränderungen von Erwartungshaltungen von Bürgern gegenüber der Politik. Aus dieser Pilotstudie entstand ein reales Evaluations-Projekt, dessen Ergebnisse inzwischen publiziert wurden (F. Matarasso: Use or Ornament. The Social Impact of Participation. Comedia 1997/2000). Der Ansatz der Studie ging davon aus, dass selbst bei den inzwischen reichlich untersuchten ökonomischen Dimensionen kultureller Aktivitäten die Frage der Geldströme dominierte und tieferliegende – ebenfalls ökonomisch hochrelevante – Fragen nach der Entwicklung sozialer und persönlicher Ressourcen („Humankapital“) nicht berücksichtigt wurden. Daneben wurde der eigentliche Zweck der Künste („the real pupose of the arts“, S. V) überhaupt nicht berührt, nämlich zu einer stabilen, vertrauensvollen und kreativen Gesellschaft beizutragen (ebd.). Vor diesem Hintergrund werden sechs Themen identifiziert: 1. Persönliche Entwicklung: Selbstvertrauen, Selbst- und Fremdbilder, soziale Kompetenzen, etc. 2. Sozialer Zusammenhalt: Entwicklung von Partnerschaft und Kooperation, Zusammenbringen von Alt und Jung, neue Freundschaften, interkultureller Dialog. 3. „Community Empowerment“, Selbstbestimmung: Selbstorganisation und Interessensvertretung, politische Beteiligung 4. Lokales Image, lokale Identität: Stärkung des Engagements bei lokalen Projekten 5. Kreativität: Erproben neuer Dinge, Entwicklung neuer Ideen und Sichtweisen, Entwicklung des Wunsches nach Kreativität. 6. Gesundheit und Wohlergehen: Beiträge zur Gesundheitserziehung Daneben wurden weitere politische Ziele formuliert, untersucht und es wurde belegt, dass sie erreichbar waren. Die Ergebnisse: Partizipation an den Künsten hat sozialen Nutzen Die sozialen Wirkungen sind komplex, aber zu verstehen Sozialer Nutzen kann gemessen und geplant werden. 112 Document1 15.05.16 Daraus wurden kulturpolitische Schlussfolgerungen gezogen, die sich etwa auf die Planung von Kultur- und Kunstprojekten (Einbeziehung partizipativer Aspekte von Anfang an) beziehen. Insgesamt ergab sich eine Liste (Abb. 15) mit 50 belegten sozialen Wirkungen. Abb. 15 50 Social Impacts of Participation in the Arts The Study shows that Participation in the Arts can 1. Increase people’s confidence and sense of self-worth 2. Extend involvement in social activity 3. Give people influence over how they are seen by others 4. Stimulate interest and confidence in the arts 5. Provide a forum to explore personal rights and responsibilities 6. Contribute to the educational development of children 7. Encourage adults to take up education and training opportunities 8. Help build new skills and work experience 9. Contribute to people’s employability 10. Help people take up or develop careers in the arts 11. Reduce isolation by helping people to make friends 12. Develop community networks and sociability 13. Promote tolerance and contribute to conflict resolution 14. Provide a forum for intercultural understanding and friendship 15. Help validate the contribution of a whole community 16. Promote intercultural contact and co-operation 17. Develop contact between the generations 18. Help offenders and victims address issues of crime 19. Provide a route to rehabilitation and integration for offenders 20. Build community organisational capacity 21. Encourage local self-reliance and project management 22. Help people extend control over their own lives 23. Be a means of gaining insight into political and social ideas 24. Facilitate effective public consultation and participation 25. Help involve local people in the regeneration process 26. Facilitate the development of partnership 27. Build support for community projects 28. Strengthen community co-operation and networking 29. Develop price in local traditions and cultures 30. Help people feel a sense of belonging and involvement 31. Create community traditions in new towns or neighbourhoods 32. Involve residents in environmental improvements 33. Provide reasons for people to develop community activities 34. Improve perceptions of marginalised groups 35. Help transform the image of public bodies 36. Make people feel better about where they live 37. Help people develop their creativity 38. Erode the distinction between consumer and creator 39. Allow people to explore their values, meanings and dreams 40. Enrich the practice of professionals in the public and voluntary sectors 41. Transform the responsiveness of public service organisations 42. Encourage people to accept risk positively 43. Help community groups raise their vision beyond the immediate 44. Challenge conventional service delivery 45. Raise expectations about what is possible and desirable 46. Have a positive impact on how people feel 47. Be an effective means of health education 48. Contribute to a more relaxed atmosphere in health centres 49. Help improve the quality of life of people with poor health 50. Provide a unique and deep source of enjoyment Quelle: F. Matarasso: Use or Ornament. The Social Impact of Participation in the Arts. London: Comedia 1997/2000 113 Document1 15.05.16 Noch ein Wort zu den Methoden. Das Forschungsteam besuchte in 12 Städten (von kleineren englischen Ortschaften über Großstädte wie Nottingham bis hin zu Metropolen wie London und New York) zwischen 50 und 100 Kulturprojekte und fertigte Fallstudien auf der Basis unterschiedlicher Befragungstypen an, u.a. fragebogengestützte Interviews, offene Interviews, Gruppendiskussionen. Beobachter mussten Projekte anhand vorgegebener Indikatoren bewerten. Ein Methodenhandbuch zur Evaluation sozialer Wirkungen von Kunstprojekten ist in Vorbereitung. 8. Schlussbemerkungen Die Frage nach der Wirksamkeit der Künste lässt sich sinnvoll stellen. Zwar gibt es gerade in Deutschland mit seiner unseligen und hochideologischen Diskussion um „Kunstautonomie“ selbstverordnete Denkverbote. Doch brechen diese angesichts des anwachsenden Legitimationsbedarfs nach und nach zusammen. Die Autonomie der Künste ist dabei natürlich ein wichtiges Bestimmungsmerkmal einer künstlerischen Praxis, die diese von zweckrationalem Handeln im „normalen“ Alltag unterscheidet. Meine These ist, dass es gerade die Entlastung von Effizienz und pragmatischer Wirksamkeit ist, die die Handlungsform Kunst so wirkungsvoll macht. Man kann also sinnvoll danach fragen, was die Künste im Hinblick auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Einzelnen leisten. Dass sie hier wichtige Wirkungen erzielen, dürfte unstrittig sein. In diesem Text ging es daher primär um soziale Wirkungen. Hier gibt es – mit Ausnahme der inzwischen unstrittigen ökonomischen Wirksamkeitsstudien im Kulturbereich – einen erheblichen Forschungsbedarf. Dieser Text wollte hierbei einige Anregungen geben, in welcher Richtung gefragt bzw. nach geeigneten Methoden gesucht werden kann. Überraschenderweise konnte ein hochprofessionelles Feld, nämlich das der Medienwirkungsforschung, identifiziert werden, in das sich unsere Fragestellung zwanglos einordnen lässt. Kunst als Kommunikation, vielleicht sogar als Massenkommunikation eröffnet zudem einen soziologischen und politikwissenschaftlichen Diskurs, nämlich dem nach der (Rolle der Künste in einer) politischen Öffentlichkeit. Ein Blick in die Geschichte dieses Begriffs zeigt, dass die Künste bei der Entstehung dieser Öffentlichkeit sogar eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle gespielt haben. Damit sind wir bei hochrelevanten Fragestellungen gelandet. Denn wenn wir danach fragen, welcher Typus des sich zur Zeit gravierend verändernden Staates überhaupt Interesse an der öffentlichen Förderung einer Kunst und Kultur 114 Document1 15.05.16 haben soll, dann wird man sofort auf die Frage nach der gewünschten Funktion von Kunst in diesem Staat gestoßen. In einem demokratischen Staat stellt ein gut funktionierendes Kunstsystem eine wichtige Diskursarena dar, in der die Reflexion der Entwicklung des Gemeinwesens auf Dauer gestellt ist. Ich glaube nicht, dass man – im Interesse der Legitimität unserer politischen Ordnung – es sich leisten kann, solche Diskursarenen zu dezimieren. Denn die weiteren Alternativen zum Kunstsystem, in denen ebenfalls öffentliche Belange öffentlich diskutiert werden könnten, sind so reichlich nicht (mehr) gesät. Stimmt man dieser Überlegungen zu, dann ergibt sich hieraus eine Forderung an die Kulturbetriebe und die Kulturförderung. Ganz so, wie es die oben vorgestellte britische Studie belegt, ist dann die Partizipation, ist eine möglichst umfassende Teilhabe am kulturellen Leben unabdingbar. Hier schließt sich dann auch der Kreis. Denn mit der Forderung nach umfassender kultureller Teilhabe ist man bei demjenigen Schlüsselbegriff gelandet, der in allen internationalen Grunddokumenten verwendet wird: In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ebenso wie in der Kinderrechtskonvention oder dem Pakt für ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung. Literaturangaben Ashcroft, B./Griffiths, G./Tiffin, H. (eds.): Key Concepts in Post-Colonial Studies. London/New York: Routledge 1998. Bollenbeck, G.: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. München: Insel 1994. Bourdieu, P.: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994 (1974). Bourdieu, P./Wacquant, Loie J. D.: Reflexive Anthropologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1996 Bourdieu, P.: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Evaluation und Qualitätssicherung in der kulturellen Bildung. Remscheid 1998. Burkart, R.: Kommunikationswissenschaft. Wien usw.: Böhlau 2002. Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Frankfurt/M.: Fischer 1990 (Original: 1944). Dörner, A.: Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001. Edgar, A./Sedgwick, P. (eds.): Cultural Theory. The Key Thinkers. London/New York: Routledge 2001. 115 Document1 15.05.16 Faulstich, W.: Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter. 800 - 1400.Geschichte der Medien Bd. 2. Göttingen: V & R 1996. Faulstich, W.: Das Medium als Kult. Geschichte der Medien, Bd. 1; Von den Anfängen bis zur Spätantike (8. Jahrhundert). Göttingen: V & R 1997. Faulstich, W.: Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Die Medienkultur der frühen Neuzeit (1400 - 1700). Geschichte der Medien Bd. 3. Göttingen: V & R 1998. Faulstich, W.: Die bürgerliche Mediengesellschaft (1700 - 1830). Geschichte der Medien. Bd. 4. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 2002. Fend, H.: Entwicklungspsychologie des Entwicklungsalters. Opladen: Leske und Budrich 2000. Forgas, J.: Soziale Interaktion und Kommunikation. Eine Einführung in die Sozialpsychologie. München/Weinheim: Beltz 1995. Fuchs, M./Liebald, Chr. (Hg.): Wozu Kulturarbeit? Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik und ihre Evaluierung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Remscheid: BKJ 1995. Fuchs, M.: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998. Fuchs, M.: Mensch und Kultur. Anthropologische Grundlagen von Kulturarbeit und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Fuchs, M.: Die Macht der Symbole. Ein Versuch über Kultur, Medien und Subjektivität. Ms. Remscheid 2000. Fuchs, M.: Wozu Kulturpolitik. Deutscher Kulturrat. www.kulturrat.de/Diskussion. 2001 Fuchs, M.: Wozu Kunst? 2001. www.akademieremscheid.de/Publikationen Fuchs, M.: Bildungswirkungen in der Jugendkulturarbeit - Überlegungen zu ihrer Erfassung www.akademieremscheid.de/Publikationen 2002) Fuchs, M.: Kulturfunktionen der Künste. Konzepte, Ansätze, Erkenntnisse. Remscheid 2003. www.akademieremscheid.de Publikationen Fuchs, M.: Kunst und Ästhetik. Neuere Entwicklungen. www.akademieremscheid.de/Publikationen. 2003 Habermas, J.: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Neuwied: Luchterhand 1962. Hahn, H. (Hg.): Kulturunterschiede. Interdisziplinäre Konzepte zu kollektiven Identitäten und Mentalitäten. Frankfurt/M.: IKO 1999. Halbwachs, M.: Entwurf einer Psychologie sozialer Klassen. Konstanz: UVK 2001 (1938). Hartley, J. (ed.): Communication, Cultural and Media Studies. London/New York: Routledge 2002. Hörning, K.-H./Winter, R. (Hg.): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Hurrelmann, K./Ulich, D. (Hg.): Handbuch der Sozialisationsforschung. Fünfte neu ausgestattete Auflage. Weinheim/Basel: Beltz 1998 (zuerst 1984; Neuauflage 1991). Jäckel, M.: Medienwirkungen. Ein Studienbuch zur Einführung. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Jarren, O. u.a. (Hg.): Zerfall der Öffentlichkeit? Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2000. 116 Document1 15.05.16 Jarren, O./Sacrinelli, U./Saxer, U. (Hg.): Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein Handbuch. Opladen/Wiesbanden: Westdeutscher Verlag 1998. Jenne, M.: Musik, Kommunikation, Ideologie. Stuttgart: Klett 1987. Kleimann, B./Schmücker, R. (Hg.): Wozu Kunst? Die Frage nach ihrer Funktion. Damstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2001. Krais, B./Gebauer, G.: Habitus. Bielefeld: transcript 2002. Kübler, H.-D.: Kommunikation und Massenkommunikation. Ein Studienbuch. Münster: Lit 1994. Luhmann, N.: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Matarasso, F.: Use or Ornament. The Social Impact of Participation. Stroud: Comedia 1997. Merten, K./Schmidt, S.J./Weischenberg, S. (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag 1994. Merten, K.: Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Bd. 1: Grundlagen. Münster: LIT 1999. Neidhardt, F. (Hg.): Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale Bewegungen. Sonderheft 34/1994 der KZfSS. Nipperdey, Th.: Deutsche Geschichte. 1800 - 1866. Bürgerrecht und starker Staat. München: Beck 1983. Nipperdey, Th.: Deutsche Geschichte. 1866 - 1918. Bd. I: Arbeitswelt und Bürgergeist. München: Beck 1990. Nipperdey, Th.: Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays. Beck: München 1991. Nünning, V. : Grundkurs anglistisch-amerikanistische Literaturwissenschaft . Stuttgart usw. : Klett 2001. Pervin, L.: Persönlichkeitstheorien. München/Basel: Reinhardt/UTB 2000. Platon: Sämtliche Dialoge (O. Apelt): Hamburg: Meiner 1993. Rolke, L./Wolff, V. (Hg.): Wie die Medien die Wirklichkeit steuern und selber gesteuert werden. Opladen: Westdeutscher Verlag 1999. Sartori, G.: Demokratietheorie. Darmstadt: Primus 1997. Schmidt, V.: Ästhetisches Verhalten. Anthropologische Studien zu einem Grundbegriff der Ästhetik. Stuttgart: Metzler 1997. Schnell, R. (Hg.): Metzler Lexikon Kultur der Gegenwart. Stuttgart: Metzler 2000. Schücking, L.: Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. Bern: Francke 1961. Sennett, R.: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrranei der Intimität. Frankfurt/M.: Fischer 1983. Tocqueville, A. de: Die Demokratie in Amerika (Auswahl). Frankfurt/M.: Fischer 1956 UNESCO: Word Culture Report. Culture, Creativity and Markets. Paris: UNESCO 1998. UNESCO: World Culture Report 2000. Diversity, Conflict and Pluralism. Paris: UNESCO 2000. 117 Document1 15.05.16 Darwin und die Kunst – Hinweise und Einfälle Vier narzisstische Kränkungen hat der Mensch sich selbst zugefügt, Kränkungen also, die empfindlich sein bisheriges Bild von sich selbst und seiner Rolle in der Welt verändert haben. Kopernikus war der erste in dieser Reihe, als er zeigte, dass die Erde mitnichten im Zentrum des Alls steht, sondern vielmehr ein durchschnittlicher Trabant einer eher kleinen Sonne in einer Nebenlage des Weltalls ist. Freud zeigte, dass es keineswegs die Vernunft ist, die das Leben des Menschen steuert, sondern meist schamhaft verschwiegene Körperregionen die entscheidende Impulse für sein Verhalten geben. Bourdieu schließlich setzte sich zum Ziel, die Kunst zu entmythologisieren, insbesondere die idealistische Autonomietheorie von Kant: Nicht autonom, nicht abgehoben vom Alltag, nicht verbunden mit der Entwicklung zur Humanität ist sie seinen Studien zufolge, sondern effektivstes Mittel des Machterhalts und der Aufrechterhaltung ungerechter sozialer Verhältnisse. Und natürlich Darwin. Als er sein Hauptwerk „Die Entstehung der Arten“ vor 150 Jahren veröffentlichte, haben andere schon sehr viel grobschlächtiger als er seine Ergebnisse publikumswirksam veröffentlicht. Ein enormer Publikumserfolg war es dann doch. Man sprach nunmehr von Zuchtwahl und Auslese, vom Kampf ums Dasein und dass es besondere Merkmale, Eigenschaften und Fähigkeiten waren, die dem Tüchtigsten das Überleben sicherten. Dreizehn Jahre später legt er nach: Die Anwendung seiner Theorie auf die Entwicklung des Menschen. Seither ist es nicht mehr zu ignorieren: Nicht ein Schöpfungsakt nach dem Ebenbild Gottes (imago dei) stand am Beginn des Menschen, sondern eine lange Entwicklungsgeschichte, bei der sich irgendwann sogar gemeinsame Vorfahren des Menschen mit den haarigen Freunden auf den Bäumen fanden. Er selbst sah seine Theorie zunächst nicht in Widerspruch zur Religion, hat sich vom Christentum dann aber doch getrennt. Doch was hat all dies mit Kunst zu tun? Mehrere Fragen sind sinnvoll zu stellen: Gibt es eine Entwicklungsgeschichte der Disposition des Menschen zu ästhetischem Gestalten und zu ästhetischer Erfahrung? Lassen sich vielleicht sogar Vorläufer eines Sinnes für Schönheit bei den vormenschlichen Vorfahren finden? Hat die ästhetische Kompetenz dem Menschen Entwicklungsvorteile verschafft, spielten sie also eine Rolle bei dem berühmten „Survival of the Fittest“? Aber wozu muss uns das interessieren? Zunächst einmal: Mit diesen Fragen rücken gleich zwei der oben erwähnten narzisstischen Kränkungen in die Nähe der Künste und des Ästhetischen. Offenbar ist dieses Feld besonders wichtig – oder besonders anfällig für Kränkungen, weil wir uns hier zu viel in die Tasche lügen. Bei der tagespolitischen Erläuterung, warum Künste wichtig sind (auch: wes118 Document1 15.05.16 halb Kulturförderung daher sein muss) verwenden wir oft anthropologische Argumente: Kunst gehört zum Menschsein dazu, ohne Kunst ist menschliches Leben unvollständig, Kunst ist ein Lebensmittel, es gab keine menschliche Gemeinschaft ohne Kunst, es gab Kunst immer und überall, insbesondere ist sie schon bei den Anfängen der Menschheit zu finden. All dies sind Argumente, die die Kunst in Beziehung zur menschlichen Natur setzen. Es sind z. T. entwicklungsgeschichtliche Argumente, wie sie auch die philosophische Anthropologie verwendet. Also ist die Frage nach der Verbindung zur Evolutionstheorie zunächst einmal sinnvoll. Doch wie soll man dies erforschen? Zum einen hat man Artefakte aus der Frühzeit (Höhlenmalereien, Kultstätten, geschmückte Waffen und Werkzeuge, Skulpturen etc.). Zum anderen behilft man sich mit der (ethnologischen) Untersuchung von Menschengruppen, die sich heute noch auf einer früheren Entwicklungsstufe befinden. Doch eines ist in jedem Fall notwendig: Die Abkehr von unserem gerade mal 200 Jahre alten Kunstbegriff. Wenn wir in Hinblick auf eine Entwicklungsgeschichte von Kunst und Ästhetik nach „Kunst“ fragen, dürfen wir nicht an auratische Kunsterlebnisse, an endlose Debatten über Kunstautonomie und an Gefahren einer Instrumentalisierung denken oder an Kunsttempel, wie sie v.a. im 19. Jahrhundert entstanden sind. Wenn wir Antworten auf die genannten Fragen wollen, müssen wir Kunst als Teil des Lebens (ganz so, wie es die Avantgarde immer wollte) verstehen, müssen die Frage klären, welche Überlebensrelevanz ästhetischer Ausdruck hatte und hat? Sind wir bereit, diesen Preis der Entideologisierung unseres Kunstdiskurses zu zahlen, werden wir durchaus reihhaltig belohnt. Erinnern wir uns erst einmal an einige Vorschläge aus der Anthropologie (G. Frey: Anthropologie der Künste, 1994). Von Arnold Gehlen stammt die Überlegung, dass die Idee der „Schönheit“ in der Musik sich auf frühzeitliche Warnsignale vor Fressfeinden in einer Horde zurückführen lässt. So gab es auch dann noch diese akustischen Signale, als der Mensch schon längst in der Lage war, seine Umgebung bewusst zu kontrollieren, so dass er nicht mehr instinktmäßig die Flucht beim Ertönen dieses Signals ergreifen musste. Vielmehr erinnerte er sich an diese Zeiten zwanghaften Verhaltens und genoss nunmehr seine Freiheit, nicht mehr reagieren zu müssen. Es ist also durchaus die Kantsche Theorie einer Befreiung von einem Handlungszwang bei Kunst erleben und es ist eine Freude nicht primär an dem Signal selbst, sondern an sich selbst als freiheitlich handelndem Subjekt. Eine andere These wurde ebenfalls von einigen Wissenschaftlern begründet: Im Zuge seiner Entwicklung entwickelte der Mensch ein bewusstes Verhältnis zu sich und seiner Umgebung. Helmut Plessner schlug den Begriff der exzentrischen Positionalität vor: Dass der Mensch nämlich die Fähigkeit entwickelte, quasi virtuell neben sich zu treten und sich selbst zum Gegenstand von Betrachtungen zu machen. Im Zuge dieses Bewusstwerdens erkannte der 119 Document1 15.05.16 Mensch, dass er in einer feindlichen Umgebung mit zahlreichen Fressfeinden lebte. Angst ist die Folge einer solch bedrohlichen Situation und Angstbewältigung demzufolge die notwendige Aufgabe. In dieser Situation entwickelte sich – durchaus als Entwicklungsvorteil – die Fähigkeit zu expressivem Ausdruck von Gefühlen: Ästhetische Gestaltung von Emotionen konnte diese sichtbar machen – für den Menschen selber, aber auch für die Gruppe. Kunst war also ein Bindemittel für die Gemeinschaft und zugleich eine Möglichkeit, innerste Erfahrungen zu kommunizieren. Ähnliches lässt sich bei den Höhlenbildern vermuten: Sie fanden sich offensichtlich an kultischen Orten. Man konnte sie zudem für die Unterrichtung der Nachwachsenden nutzen: Der Symbolcharakter von Kunst beinhaltet, Nichtvorhandenes zu vergegenwärtigen, also Ort und Zeit zu beherrschen. Daher nimmt Ernst Cassirer die Künste in seinen Katalog symbolischer Formen auf und beschreibt sie aufgrund ihrer Überlebensrelevanz als unverzichtbar für das menschliche Leben. Es ist also heute zum einem die Anthropologie, es ist die Verhaltensforschung, es ist die Ethnologie, die Belege dafür beibringen, dass es eine enge Verbindung von Darwin und Kunst gibt. Auch die Philosophische Ästhetik geht an der Relevanz eines entwicklungsgeschichtlichen Zugangs zur Kunst nicht vorüber. So befasste sich der anerkannte Ästhetiker Wolfgang Welsch mit „Animal Aesthetics“ auf dem XVIth International Congress on Aesthetics 2004 in Rio de Janeiro (Text leicht zu googlen) und suchte nach Wurzeln menschlicher Kunst noch vor der Kulturgeschichte des Menschen. Natürlich stellte er klar, dass er keinen Picasso unter den Säbelzahntigern sucht. Ausführlich beschreibt er, dass Darwin sein zentraler Impulsgeber war. In der Tat befasst sich dieser immer wieder mit der Tatsache, dass Konzepte von „Schönheit“ gerade bei der Auswahl von Sexualpartnern im Tierreich eine Rolle spielen: Die „schönen“ Männchen signalisieren Kraft und Energie (K. Richter: Die Herkunft des Schönen. 1999). Welsch spricht in diesem Zusammenhang von „nichtästhetischer“ und „vorästhetischer“ Schönheit. Interessant auch der folgende Aspekt: Der Kampf zwischen den Männchen verläuft nunmehr unblutig als CastingShow, bei der der Schönere siegt. Doch bleibt auch bei dieser Erklärung eine Lücke, weil sich nicht alle ästhetischen Präferenzen eindeutig mit einem Fitness-Vorsprung der Träger der schönen Merkmale in Verbindung bringen lassen. Eine enge Evolutionstheorie, die sehr kurzschlüssig nur unmittelbar erkennbare Entwicklungsvorteile gelten lässt, erklärt zwar manches, doch bleiben unerklärte Reste: Es gibt offensichtlich einen Überhang an ästhetischer Gestaltung über die unmittelbare Nützlichkeit hinaus. An dieser Stelle führt Welsch die Neurowissenschaften ein – und stößt auf die wichtige Rolle des Vergnügens im menschlichen Leben. Liegt Horaz mit seiner Funktionsbeschreibung von Kunst des delectare und prodesse, des Nutzens und Vergnügens, also auch 120 Document1 15.05.16 nach 2000 Jahren Wissenschaftsgeschichte immer noch richtig? Welsch sagt ja. Doch hilft hier das Werk einer interessanten Seiteneinsteigerin, der amerikanischen Ethnologin und Ethologin Ellen Dissanayake weiter (hier: What is Art for? 2002). Ihre zentrale Idee enthält Kap. 4 des genannten Buches „Making Special“. Dahinter steckt der Ansatz, dass es zum einen in der Tat einen Überschuss an ästhetischer Gestaltung gibt, der über eine enge Funktionalisierung von Kunst hinausgeht. Sie kann jedoch zumindest einen Teil dieses Überschusses erklären: Mit ästhetischer Expressivität wird besonderen wichtigen Ereignissen oder Dingen eine Bedeutung verliehen. Ästhetik wird so zu einer Unterstützung des kollektiven Gedächtnisses, der Hervorhebung überlebensrelevanter Ereignisse, der Stiftung von Gemeinschaft rund um bestimmte kultische Handlungen. Jagdfeste, Beerdigungen, Ritualen oder besonders wichtige Personen: Bei allem hebt eine ästhetische Inszenierung deren Bedeutung aus dem Alltag heraus. Dieser kurze Streifzug durch ein Feld, das man heute etwa in dem Ansatz einer „evolutionären Ästhetik“ behandelt, bringt eine vielleicht überraschende Erkenntnis: Man muss die engen Grenzen eines eurozentrischen Kunstverständnisses zunächst einmal verlassen (gerade Ellen Dissanayake wird nie müde, auf die erkenntnisverhindernde Wirkung hinzuweisen, die die 200-jährige Ideologiegeschichte von „Kunst“ für sie hatte). Dann aber wird man reichhaltig fündig und kann entwicklungsgeschichtlich viele Funktionen von Kunst belegen, die wir im alltäglichen politischen Gebrauch oft und zurecht für ihre Legitimation verwenden: Künste sind identitätsstiftend, erkenntnisfördernd, sie leisten einen Beitrag zur Selbstreflexion von Einzelnen und Gruppen. Künste stärken die emotionale Seite und bieten „ganzheitlich“ Entwicklung- und Erkenntnisimpulse. Sie tun dies in einer einmaligen Verbindung von Nützlichkeit und Genuss. Sie haben eine Alltagsrelevanz, wie man sie kaum vermutet und wie man sie nicht erfahren kann, wenn man eine – oft auch noch nur halb verstandene – Autonomiebehauptung wie eine Monstranz vor sich herträgt. Ein solch weiter Begriff von Kunst, der dann auch nicht zulässt, Kunst aus Afrika weiterhin bloß als Folklore oder Volkskunst zu begreifen (wie noch lange Zeit bei Kunstmessen geschehen) ist auch notwendig in der internationalen Zusammenarbeit. So hagelte es zahlreiche Proteste bei der ersten Weltkonferenz zur künstlerischen Bildung 2006 in Lissabon, weil die UNESCO zur Kunst lediglich die traditionellen europäischen Kunstformen zählen wollte (Musik, Bildende Kunst, Theater): KollegInnen aus Afrika und Asien bestanden dagegen darauf, dass in einigen Ländern Stelzenlaufen oder Haare flechten für sie sehr viel relevantere Kunstformen seien. 150 Jahre nach Darwins „Entstehung der Arten“: Ein guter Anlass also, auf die Lebensrelevanz von Kunst hinzuweisen. 121 Document1 15.05.16 Einige Dinge, die man über die Künste und die Ästhetik/Kunsttheorie wissen sollte 1. Gerade im Kontext von „Kunst und Ästhetik“ stellt sich das Problem, dass es sich um moderne Begriffe handelt, die gerade erst 200 Jahre, z. T. erst 150 Jahre alt sind. Für den größten Teil der menschlichen Geschichte und den größten Teil der Erde macht ihr modernes Verständnis keinen Sinn: Sie sind beide aufs engste mit der westlichen Moderne verbunden. 2. Man muss zudem gerade die Geschichte der letzten 200 Jahre als permanenten Versuch verstehen, vorhandene Konzepte von Kunst bzw. Ästhetik als falsch oder unzureichend nachzuweisen. Man muss daher mit einer Vielzahl von (z.T. einander widersprechenden) Definitionen und Begriffsbestimmungen rechnen. Es gibt zudem keine Entwicklung in dem Sinne, dass ältere Verständnisweisen von „Ästhetik“ bzw. „Kunst“ verschwinden. 3. Die Diskurse über Ästhetik (als philosophischem Versuch, sich über Begriff, Gegenstandsbereich und dessen „Wesen“ zu einigen), über die Künste und die reale Entwicklung der Künste sind zwar nicht völlig unverbunden, sollten jedoch eher als unabhängig voneinander betrachtet werden. Es handelt sich zudem um unterschiedliche Professionen, die jeweils Ästhetik, Kunsttheorie oder Kunst betreiben: Wer das eine beherrscht, ist nicht automatisch Experte für das andere. 4. Auch in dem Feld der Künste und der ästhetischen Reflexion ist in mehrfacher Hinsicht mit Konkurrenz und einem Kampf um Deutungshoheit zu rechnen: Zum einen konkurrieren verschiedene Verständnisweisen sowie verschiedene berufliche Zugänge (philosophisch, soziologisch, ökonomisch, psychologisch, kunstwissenschaftlich etc.) miteinander. Gesamtgesellschaftlich konkurriert „Kunst“ zudem mit anderen Sinnstiftungsinstanzen wie Wissenschaft oder Religion. Beide Konkurrenzsituationen sind sogar eine wichtig Antriebsquelle für die jeweilige Entwicklung. 5. Gerade in praxisbezogenen Diskursfeldern wie (Kultur-)Politik und (-)Pädagogik sind oft historisch widerlegte Verständnisweisen von Ästhetik und Kunst zu finden. Viele Legitimationsfiguren für beides speisen sich von Ideen über „Kunst“, die mit der Kunstentwicklung der letzten 150 Jahre nichts zu tun haben (kunstreligiöse Vorstellungen, Argumente der idealistischen Autonomieästhetik etc.). 122 Document1 15.05.16 6. Ein enges westlich-modernes Verständnis von „Kunst“ grenzt den Großteil ästhetischer Produktivität der Menschen aus. So gilt für die ästhetische Praxis zum allergrößten Teil der klassische Satz von Horaz des prodesse et delectare (des Nützens und Erfreuens). Der Gedanke der Autonomie ist für den größten Teil der künstlerischen Praxis sehr fremd. Allerdings macht dieser Gedanke der Autonomie Sinn, wenn man das Feld der Künste als zunehmend „autonomer“ werdenden Teil der modernen Gesellschaft betrachtet (ebenso wie andere Felder im Zuge der Modernisierung ihre relative Autonomie gewinnen). 7. Ästhetik, Kunsttheorie und die reale Entwicklung der Künste stehen immer wieder in einem spannungsvollen Verhältnis zueinander. So konkurrieren die einzelnen Kunstwissenschaften mit der Philosophie um das Deutungsrecht. Zum anderen versuchen immer wieder Künstlerl/innen, sich von den normativen Vorgaben beider Disziplinen zu befreien (Danto spricht in diesem Zusammenhang von Entmündigung der Kunst durch die Philosophie). Im Gegenzug werden „Künstlerlästhetiken“, also Reflexionen von Künstler/innen über ihre eigene Praxis, von Ästhetikern und Kunstwissenschaftlern häufig gering geschätzt. 8. Die Ästhetik ist in der Moderne nicht nur entstanden: Sie ist – zumindest in bestimmten Zeitabschnitten – geradezu zu der philosophischen Leitdisziplin geworden. Dies hat z. T. seinen Grund darin, dass die Vernunft als Zentralkategorie fragwürdig wurde und man daher „das Andere der Vernunft“ thematisierte. Z. T. hat es aber auch damit zu tun, dass gerade die Ästhetik der Selbstvergewisserung des (bürgerlichen) Subjekts und seiner Fähigkeit zur Selbst- und Weltaneignung diente. Annäherungen an die Begrifflichkeit: Die Ästhetik reflektiert die ästhetischen Welt- und Selbstverhältnisse des Menschen. Sie ist Teilgebiet der Philosophie. In den ästhetischen Welt- und Selbstverhältnissen nimmt der Mensch das jeweilige Objekt in Hinblick auf Gestalt- und Formqualitäten wahr und bewertet diese. Insbesondere spielten in diesem Prozess Aspekte der Nützlichkeit und Funktionalität höchstens eine nachrangige Rolle. Als Objekte einer solchen Betrachtungsweise kommt alles in Betracht. Künste sind spezifische Gestaltungsprozesse und ihre Ergebnisse, wobei das, was als „Kunst“ zählt, Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse ist. 123 Document1 15.05.16 Thesen zum Zusammenhang von Ethik und Ästhetik Es liegt in der Natur philosophischer Reflexionen, zu keinem allseitig akzeptierten Ende zu kommen. Meinungsstreit ist das Wesen der Philosophie. Doch was machen Pädagogik und Politik, die handeln müssen? „Der Handelnde hat immer Unrecht!“ sagt Friedrich Dürrenmatt. Dies ist so, weil aus einer Fülle von Handlungsmöglichkeiten nur eine einzige ausgewählt wird, obwohl für die dann abgelehnten Handlungsmöglichkeiten ebenfalls gute Gründe sprechen. Dies ist auch der Fall angesichts einer Fülle von Ethikkonzeptionen. Der Angreifbarkeit des konkreten Vorschlages bewusst, will ich trotzdem einige allgemeine Thesen zu einem Verständnis von Ethik formulieren, so wie es für die Pädagogik anwendungsfähig ist: 1. Basis sowohl des Ästhetischen als auch des Ethisch-Moralischen ist die Anthropologie, ist eine Auffassung des Menschen als kulturell verfasstes Wesen in seiner Widersprüchlichkeit und Komplexität, insbesondere in seinen produktiven und destruktiven Möglichkeiten. 2. Dazu gehört, dass der Mensch Selbst- und Weltverhältnisse entwickelt, die theoretische, ethisch-moralische und ästhetische Anteile haben. Diese unterschiedlichen Anteile lassen sich zwar analytisch trennen, treten jedoch in der Praxis immer zusammen auf und finden letztlich im handelnden Subjekt eine Integration: Das Leben, insbesondere das menschliche Leben ist Ausgangs- und Endpunkt moralphilosophischer und ästhetischer Reflexion. Solche Selbst- und Weltverhältnisse sind etwa die symbolisch-kulturellen Formen in der „Philosophie der symbolischen Formen“ von Ernst Cassirer, nämlich Sprache, Kunst und Wissenschaft, Mythos und Religion, Wirtschaft, Politik und Technik. 3. Die Bedürftigkeit des einzelnen Menschen und die – entwickelbare – leibliche Ausstattung auf der einen Seite und die sozial-kulturellen (sittlichen) Kontexte, in die der Mensch eingebettet ist, auf der anderen Seite, sind gleichermaßen „Bedingungsfelder“ seiner Entwicklung, die sich zudem wechselseitig konstituieren: So leistet der Einzelne einen Beitrag zur Ausgestaltung des Sozial-Kulturellen, adaptiert, verändert, entwickelt es und trägt es weiter. Dieses Soziokulturelle wiederum ist eine entscheidende Enwicklungsbedingung für sein individuelles Werden. Das Ich und der/das Andere stehen also nicht (nur) einander gegenüber, so dass man nach der Vorrangigkeit des einen oder anderen fragen könnte: Beide konstituieren sich wechselseitig. 124 Document1 15.05.16 4. Insbesondere entstehen in diesem individuellen Entwicklungs- und aktiven Aneignungsprozess die Wert- und Norm-Orientierungen des Einzelnen durch eine Habitualisierung der je vorhandenen Sittlichkeit („Üblichkeit“), die in all seinen Welt- und Selbstbeziehungen (Nr. 3) eine Rolle spielen: Diese enthalten nämlich stets eine wertende Beziehung zur Welt. In seinem Bildungsprozess entwickelt der Einzelne dann ein bewusstes Verhältnis zu dieser vorliegenden Norm- und Wertewelt und wird diese akzeptieren oder verändern wollen. 5. Es lassen sich – analytisch – ästhetische und moralisch-ethische Werte unterscheiden. Diese sind wesentlich Bestandteil der Persönlichkeit und eng verbunden mit dem Volotiven und Motivationalen: Der Mensch erkennt, bewertet, fühlt sich motiviert (oder nicht) etwas zu tun oder zu lassen. 6. Die Berücksichtigung individueller („Glück“), sozial-kultureller („Sittlichkeit“) und globaler Aspekte ist gleichermaßen anzustreben. 7. Daraus ergibt sich, dass man dreierlei braucht: eine Vorstellung des individuell guten, sinnhaften, glücklichen Lebens (Lebenskunst; Ethik des guten Lebens, Individualethik) einen funktionierenden Nahraum, dessen Sitten und Gebräuche („Üblichkeiten“) sowohl „Heimat“ als auch normative Einengung sind (Sozialethik) ein faires Verfahren, weitgehend universell gültige und akzeptierte Regelungen herbeizuführen, eben weil vor dem Hintergrund der Globalisierung nur ein ethischmoralischer Minimalkonsens sowie ein zivilgesellschaftliches Verhandlunsprozedere bei Meinungsverschiedenheiten eine friedvolle Gestaltung des Zusammenlebens ermöglichen (moral-philosophischer Universalismus). Die an Aristoteles orientierte kommunitaristische Zugangsweise ermöglicht die Reflexion des sozial-kulturellen Kontextes („Sittlichkeit“). Die aktuelle Individualethik stellt den Einzelnen in den Mittelpunkt („Lebenskunst“). An Kant orientierte universalistische Ansätze versuchen, Werte und Normen in größter Allgemeinheit verhandelbar zu machen (z.B. die Diskursethik). Eine praxisbezogene Ethik kann daher nur als Integration dieser drei genannten Ansätze entwickelt werden. 8. Der gemeinsame anthropologische Bezug von Ethik und Ästhetik führt quasi zwangsläufig zu dem Begriff von Bildung. Bildung als eine bewusste Form der Lebensgestaltung, als Herstellung eines bewussten Verhältnisses zu sich, zur sozialen und natürlichen Umwelt, zur Zeit lässt sich ohne Mühe als Pointierung dessen darstellen, was eine Anthropologie im Sinne von Plessner und Cassirer als das spezifisch Menschliche ausweist. Die besondere Qualität der (menschlichen) Welt- und Selbstverhältnisse bringt eine ästhetische und eine moralische Dimension mit sich, so dass – in der Logik dieses Gedankens wenig verwunderlich – im gebildeten und sich bildenden Subjekt Ethik und Ästhetik zusammenlaufen (müssen): Das Subjekt steht im Mittelpunkt ästhetischer und moralischer Praxis, 125 Document1 15.05.16 steht im Mittelpunkt der Selbst- und Weltgestaltung. Das gebildete Subjekt muss äußere Ansprüche der Community bzw. der universellen Moral mit individuellen Ansprüchen an das eigene Leben vermitteln, muss Erkennen, Bewerten, Urteilen und Fühlen integrieren. Die Prozesshaftigkeit dieser sich immer wieder stellenden Anforderungen kommt in der Rede von „Bildung als nichtabschließbarem Prozess“ zum Ausdruck. 9. Ethik und Ästhetik als philosophische Spezial-Disziplinen sind in diesem Prozess relevant. Zwar handelt jeder immer schon ästhetisch oder ethisch-moralisch. Doch wenn Bildung das Bemühen um Bewusstheit der Lebensvollzüge wesentlich mit einschließt, dann gehört hierzu auch das Bewusstmachen der Voraussetzungen und Folgen moralischer und ästhetischer Urteile und ihres kohärenten Zusammenhangs im Leben des Einzelnen. Und hierbei haben die Reflexionen über die Logik dieser Beurteilungsprozesse, so wie sie die verschiedenen Ästhetik- und Ethik-Konzeptionen anbieten, ihren Nutzen und ihre Berechtigung in der Kulturpädagogik: als Reflexionstheorien des ethisch-ästhetischen Handelns. Dabei muss die Offenheit der individuellen Entscheidung für bestimmte Konzeptionen von Ethik bzw. Ästhetik gewahrt bleiben, da sich kaum ein archimedischer Punktfinden lässt, von dem aus sich eine letztgültige Entscheidung über „wahr“ und „falsch“ einzelner Theorien treffen ließe. Aus einer praktischen Sichtweise ist daher notwendig, was aus der Sicht der philosophischen Grundlagenforschung eher schwierig ist: Die gleichzeitige Relevanz der drei sich ansonsten bekämpfenden Ethik-Ansätze zu behaupten. Der gemeinsame Bezug auf den Menschen, seine Bestimmungsmerkmale, Bedürfnisse und Chancen macht zudem die Integration von Ethik und Ästhetik denkbar. Denn beiden geht es um individuelle Dispositionen, die in allen Weltzugangsweisen (kulturell-symbolische Formen) zu finden sind. Sie überschneiden sich zum einen dort, wo die moralische Urteilsbildung darauf angewiesen ist, Gegebenheiten und Verläufe genau wahrzunehmen (aisthesis), Handlungsmöglichkeiten zu (er)kennen („Möglichkeitsdenken“ in der Kulturarbeit), und vielleicht sogar probehandelnd ausführen zu können. Eine Überschneidung ist andererseits dort zu finden, wo wahrgenommene Dinge und Prozesse zwar auch ästhetisch, aber eben auch ethisch-moralisch bewertet werden, wo moralische Überzeugung in der ästhetisch-kulturellen Praxis entstehen, ebenso wie die Motivation zu moralischem Handeln. 126 Document1 15.05.16 Januar 2003 Kunst und Ästhetik Neuere Entwicklungen Abstract In diesem Text werden einige Grundzüge der Ästhetik und der Theorie der Künste vorgestellt. Grundlage ist die Unterscheidung von Subjekt, künstlerischer Tätigkeit und Objekt, mit der eine erste grobe Ordnung in die unterschiedlichen Ansätze zur Theorienbildung gebracht werden kann. In diesem Sinne stehen in Bezug auf das Subjekt der Begriff der ästhetischen Erfahrung und in Bezug auf das Objekt der Begriff des Kunstwerks im Mittelpunkt der Ausführungen. Es werden zudem einige neuere Arbeiten zu diesen Themenkomplexen vorgestellt. Inhalt: Anlass und Struktur der Arbeit Was ist Kunst? Wann ist Kunst? Das Subjekt Das Objekt Künstlerische Tätigkeiten Der Begriff des Symbols Anmerkungen und Literatur 127 Document1 15.05.16 1. Anlass und Struktur der Arbeit Wenn der künstlerische Leiter einer der bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst davon spricht, dass es der Kunst nach wie vor um die „...Erarbeitung und Entwicklung von Interpretationsmodellen für die verschiedenen Aspekte heutiger Vorstellungswelten...“ (Enwezor 2002, S. 40) geht, dann spricht er von „Kulturfunktionen“, die diese Kunst – immer noch – erfüllen soll. Ähnliche Aussagen gibt es von VertreterInnen der Literatur, des Theaters, der Musik oder des Tanzes. Man erwartet also nach wie vor in den Künsten, dass sie den Gesellschaften immer wieder Möglichkeiten verschaffen, sich selbst den Spiegel vorzuhalten, Lebensstile zu reflektieren, Identitätsangebote zu produzieren und Orientierungen bereitzustellen, die eine Verortung in Raum und Zeit ermöglicht. Dies gilt selbst dann, wenn in einer postmodernen oder dekonstruktivistischen Sicht all diese Konzepte und Vorstellungen radikal in Frage gestellt werden – eben auch als spezifisches Deutungsangebot, dass nämlich die heutige Gesellschaft mit solchen Konzepten nicht mehr zu begreifen ist (Zima 1994, 1997, 2000). In der Geschichte der Menschheit entstanden als „Medien“ einer solchen Selbstgestaltung, Selbstreflexion und Weltaneignung Religion und Mythos, aber auch Wissenschaft und Kunst. Ernst Cassirer (1990) nennt diese Hervorbringungen menschlichen Geistes symbolischkulturelle Formen und ihre Gesamtheit „Kultur“. In dieser Hinsicht steht also die Kunst durchaus in Konkurrenz zu anderen Sinngebungsinstanzen, so dass die Skepsis von Enwezor, ob und wie die zeitgenössische Kunst diese Aufgabe der Integration noch erfüllen kann, verständlich wird. Und tatsächlich zeigt die Geschichte, dass nicht alle symbolisch-kulturellen Formen zu jeder Zeit gleichmäßig in Anspruch genommen worden sind. Vielmehr geraten bestimmte Formen immer wieder in Verdacht, ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen zu können. So wurde der Mythos abgelöst durch Wissenschaft und Religion, die Religion wiederum erlebte in der Säkularisierung des 19. Jahrhunderts einen Prozess der Entwertung. Und seit einigen Jahren ist der Glaube an die Wissenschaft stark beschädigt. Verständlich ist daher die Skepsis gegenüber der zeitgenössischen Kunst bei Enwezor, weil die Art und Weise, wie sie diese die genannten Funktionen erfüllt, ebenfalls ins Gerede gekommen ist. Zum Teil lag das sicherlich an innerkünstlerischen Entwicklungen, zum Teil hatte es mit der generellen Infragestellung von Sinngebungsangeboten zu tun. Es ist also zu fragen, wie die Künste die genannten Kulturfunktionen überhaupt erfüllen können. Gleichgültig, wie Kunst letztlich definiert oder verstanden wird, geht es darum, etwas zur Anschauung oder zu Gehör zu bringen, etwas den Sinnen zu präsentieren, das wahrgenommen werden kann. Der etymologische Rückbezug der Ästhetik auf aisthesis – Wahrnehmung 128 Document1 15.05.16 – bleibt in jedem Fall relevant, selbst dort, wo Kunst die Wahrnehmung als Grundmodus ihrer Funktionsweise in Frage stellt.1 Doch wird man zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Sinne längst nicht mehr die untrügerische Quelle von Wissen durch Wahrnehmung sind, für die man sie einmal gehalten hat. Die Sinne trügen und lügen – und sind zudem leicht zu manipulieren. Auch dies ist daher ein Anlass, sich mit der Funktionsweise der Künste auseinander zu setzen. Selbstzweifel an der eigenen Darstellungskraft und Wirksamkeit waren zudem immer schon starke Motoren zur Weiterentwicklung der Künste. Dies ging – gerade in der jüngeren Zeit – soweit, den Kunstbegriff bzw. zentrale ästhetische Kategorien total in Frage zu stellen. Auch hat die Konjunktur der Ästhetik in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts („Postmoderne“) ihr selbst nicht unbedingt gut getan. Es könnte jedoch sein, dass nach dem Ende dieser Denkweise als Modeerscheinung2 nunmehr eine Bilanz gezogen werden kann, die die zutreffenden Erkenntnisse der radikalen Vernunftskritik der Postmoderne einbezieht. Mir scheint, dass die Entwicklung der Künste, so wie sie etwa auf der documenta XI präsentiert wurden, Anlass zur Annahme einer solchen Synthese gibt. Zudem sind in den letzten Jahren einige interessante Texte zur Ästhetik erschienen, die sich erneut um die Klärung von ästhetischen und kunsttheoretischen Grundbegriffen bemühen. Im folgenden will ich aus einem (kultur-)politischen und einem (kultur-)pädagogischen Interesse heraus einige systematische Überlegungen zur Kunsttheorie und Ästhetik vorstellen.3 Ich gehe dabei nicht von einem vermeintlichen Nullpunkt aus, sondern argumentiere auf einer anthropologischen Basis, die oben bereits mit dem Namen von Ernst Cassirer – ich könnte noch Helmut Plessner dazufügen – verbunden ist (Fuchs 1999, Frey 1994). Demnach muss der Mensch aktiv seine Beziehung von Welt gestalten (er muss sein Leben führen, so Plessner). Und hierbei gestaltet er sich selbst. Eine anthropologische Perspektive lässt sich an alle Momente des ästhetisch-künstlerischen Prozesses anlegen. Neben der grundsätzlichen Frage danach, welche Rolle Kunst bei der Anthropogenese gespielt hat, kann man etwa nach den Ursprüngen des Ästhetischen sowohl auf der Seite des Subjekts als auch auf der Seite des gestalteten bzw. wahrgenommenen Gegenstandes fragen (Abb.1). 129 Document1 15.05.16 Abb. 1: Anthropologie des Ästhetischen Anthropologie* des Subjekts (Marx: Geschichte der fünf Sinne) Anthropologie der Sinne** Auge Ohr Nase Tastsinn Geschmack Anthropologie der sinnlichen Wahrnehmung/Erfahrung/Erkenntnis Anthropologie des Körpers/Leibes Anthropologie des Schönen Anthropologie ästhetischer Produktivität: Herstellungslust, Formungslust Anthropologie der Urteilskraft Anthropologie des Symbolgebrauchs Anthropologie der gestalteten Umwelt Häuser Städte Gegenstände, Dinge, Prozesse Anthropologie des Designs und des Schmucks von Alltagsgegenständen Anthropologie der Kunstobjekte *Anthropologie, d.i.u.a.: Psychologie, Biologie, Natur- u. Kulturgeschichte, Philosophie ** inkl. (Kultur-)Geschichte der Sinne Diese Gegenüberstellung von Subjekt und einem Gegenüber („Objekt“) wird vermittelt durch seine Aktivität, durch Tätigkeit. Auf sehr allgemeine Weise lässt sich – quasi als Grundmodus des Seins in der Welt – dies durch das folgende Schema darstellen4 Abb. 2 Subjekt Tätigkeit Objekt Für die Zwecke dieses Textes taugt dieses allgemeine Schema, um nicht nur den Text zu strukturieren, sondern um eine erste Ordnung in Ästhetik-Konzeptionen zu finden: So gibt es Ansätze, Kunst aus der Sicht des Subjekts, des Objekts („Kunstwerk“) oder der künstlerischen Tätigkeit zu begreifen. Zahlreiche ästhetische oder kunsttheoretische Kategorien lassen sich diesen drei Grundkategorien zuordnen (Abb. 3) und spielen daher in denjenigen ästhetischen Ansätzen, die Subjekt, künstlerische Tätigkeit bzw. Objekt in den Mittelpunkt stellen, jeweils eine unterschiedlich bedeutsame Rolle. 130 Document1 15.05.16 MF 6/02 Abb. 3 Annäherungen an die Ästhetik aus der Perspektive von Subjekt, Tätigkeit und Objekt Zentrale Kategorien bzw. Ästhetikansätze SUBJEKT (eher Kant) TÄTIGKEIT OBJEKT (eher Hegel) aisthesis i. S. von sinnlicher Erkenntnis ästhetische Erfahrung ästhetische Wahrnehmung ästhetische Bewertung/ ästhetische Urteilskraft Katharsis Geschmack ästhetisches Verstehen Sinne (Auge, Ohr, Nase, Mund, Tastsinn) ästhetische Rationalität zwischen Subjekten: ästhetische Kommunikation Spüren, Leib, Erfahren von Gegenständlichkeit Menschen im Raum (Stadt, Haus), d. h. Relevanz von Architektur und Stadtplanung künstlerisch-ästhetische Praxis: Rezeption Produktion Formung, Gestaltung (Poiesis) Konstruktion Bewegung in gestalteten Räumen Dichten, Musizieren, etc. als symbolische Tätigkeiten „symbolische Arbeit“ (Willis) das KUNSTWERK Geschichte der Künste (Kunst-, Literaturetc. -geschichte) Verkörperung/ Vergegenständlichung ästhetische „Ontologie“ Baukultur; geformte Gegenstände Design, angewandte Kunst 131 Document1 Es ist nun möglich, jedes dieser Strukturelemente von Kunst (als Tätigkeit) in den Mittelpunkt von ästhetischen Überlegungen zu stellen: Ich will es hier überblicksweise tun und in den später folgenden Abschnitten vertiefen. Dabei verwende ich ein einfaches semiotisches Grundmodell (Fuchs 2000). Abb. 4 Sigmatik (gegenständlicher Bezug) Syntax (Formsprache, Gestaltungsqualitäten) Zeichen Semantik (begrifflicher Bezug, Bedeutung) Pragmatik (tätiger Umgang mit dem Zeichen) Bezogen auf ein Kunstwerk (Objekt) sieht die Anwendung dieses Grundmodells aus wie folgt (Abb.5). Diese Abbildung berücksichtigt über die einfachen Strukturmomente hinaus noch die Tatsache, dass Kunstproduktion und -rezeption in einem gesellschaftspolitischen Kontext stattfinden, der vielfältig diese Prozesse der Produktion bzw. Rezeption prägt. Nimmt man die künstlerische Tätigkeit als Ausgangspunkt – und sieht diese in einem historischen Prozess – dann lässt sich im zeitlichen Ablauf das folgende Schema konstruieren (Abb. 6), das zeigt, wie künstlerische Kompetenzen und Dispositionen immer wieder durch Tätigkeit in „Werken“ vergegenständlicht werden, die wiederum Grundlage für die Entwicklung von (neuen) Kompetenzen und Dispositionen bei anderen Menschen sind. 132 Document1 Abb. 5 Semiotik der Kunst Gesellschaftlich-kultureller Kontext: ästhetische Kommunikation, Gegenständliche Umgebung Relevanz von Sujets eher objektive Dimension von Kunst Sigmatik (gegenständliche Referenz) ges. Reservoir ges. Genese Kunstwerk oder -prozess Syntax und (Formensprache) Funktion von Form und Gestalt z. B. Ikonographie Semantik Hermeneutik („Bedeutung“) an Bedeutungen Kunstherstellung u. -gebrauch Pragmatik Produktion künstl. Prozess Psychologie u. Soziologie des Künstlers Distribution (Kunstvermittlung, -kritik, -markt) Kunstdiskurs ökon. Funktionen von Kunst Rezeption (Gebrauch); Wirkungen auf Subjekt eher subjektive Dimension von Kunst Psychologie und Soziologie des Kunstgebrauchs ökonomische, politische, kulturelle etc. Rahmenbedingungen 133 Document1 Abb. 6: Entstehung und Wirkung von Kunst im zeitlichen Ablauf zusammen mit jeweils „zuständiger“ Fachdisziplin Soziologie und Sozialgeschichte der Kunst und der Sinnlichkeit des Menschen (historische Anthropologie) gesellschaftliche Grundlage eines Umgangs mit Kunst und Ästhetik einzelne Kunstwissenschaften Kunst und Ästhetik in Persönlichkeitstheorien subjektive Disposition zur Kunst/Ästhetik genetische Erbschaft für ästhetisches Handeln (Fähigkeit zum Umgang mit Bildern und Tönen, mit Form und Gestalt, Symbolkompetenz) künstlerischästhetische Tätigkeit (produktiv und rezeptiv) Theorien künstlerischästhetischer Tätigkeit, ästhetische Handlungstheorien, Pädagogik der Künste Werk Prozess Rückwirkung auf Mensch und Gesellschaft Wirkungstheorien Anthropologie, Biologie und Psychologie der Kunst 134 Document1 Das künstlerisch aktive Subjekt ist dabei gleich dreifach mit „Objekten“ konfrontiert, nämlich durch Erkennen, Gestalten und Rezeption. Unter Nutzung klassischer ästhetischer Kategorien lässt sich dies modellieren wie folgt (Abb. 7): Abb. 7: Tätigkeitsformen im künstlerischen Prozess: Erkennen – Gestalten – Rezipieren Urbild ErkenntnisMittel Subjekt (Katharsis) GestaltungsMittel zu gestaltendes Material Poiesis Mimesis (ästhetische) Erkenntnismittel aisthesis: rezeptive ästhetische Erfahrung künstlerisches Objekt Das Subjekt im Mittelpunkt kann also erkennendes, produzierendes oder kunstreproduzierendes Subjekt sein. Geht man hingegen von der Tätigkeit aus, so lassen sich Dimensionen wie in Abb. 8 unterscheiden. Zusammenfassung: Kunst lässt sich sinnvoll aus der Sich der Strukturelemente von Tätigkeit, also im Hinblick auf das aktive Subjekt, die künstlerische Tätigkeit und das entstehende Werk (Produkt oder Prozess), betrachten. Es ist letztlich eine Frage der persönlichen Überzeugung, was im Mittelpunkt von Kunsttheorie steht. Letztlich wird jedoch jede umfassende Kunsttheorie alle Teile des Prozesses in den Blick nehmen müssen. 135 Document1 Abb. 8: Dimensionen der künstlerischen Tätigkeit externe soziale Dimension: Kunst als gesellschaftliche Erscheinung psychologische Dimension: kognitive, emotionale und kooperativ-soziale Entwicklung inklusive Aneignung des Selbst interne soziale Dimension: Kunst als sozialer Prozess/ künstl. Tätigkeit als sozialer (Gruppen-)Prozess künstlerisch-ästhetische Tätigkeit gegenständliche Dimension 1: Kunst als praktischgegenständliches Verhalten gegenständliche Dimension 2: Kunst als Aneignungsform von Wirklichkeit 2. Was ist Kunst? Wann ist Kunst? Die klassische Frage danach, was Kunst ist, hat sich inzwischen in die Frage danach verschoben, wann Kunst ist. Was bedeutet dies und warum ist dies geschehen? Lange Zeit diskutierte die westliche Philosophie die Frage, was eigentlich ein Kunstwerk zum Kunstwerk macht. Ich will nur am Rande darauf hinweisen, dass diese Diskussion in jeder der heutigen Kunstsparten für sich gesondert geführt wurde, bis Baumgarten im 18. Jahrhundert nicht nur Ästhetik – basierend auf dem Wahrnehmungsbegriff – als philosophische Teildisziplin konstituierte und zugleich einen einheitlichen Kunstbegriff geschaffen hat, der Bilder und Texte, Skulpturen und Musikstücke gleichermaßen als „Kunst“ erfasste. Dies war bis dahin nicht üblich gewesen. Das Ringen um den Kunststatus (Eagleton 1994) hatte etwa mit den Vorstellungen über Bildung zu tun: Musik gehörte als eher mathematische Disziplin – im Verständnis von Pythagoras – zu den klassischen Fächern der mittelalterlichen Universität; Malerei und Bildhauerei waren dagegen lange Zeit rein handwerkliche Künste (vgl. Hauser 1972). Die Frage nach „Kunst“ ist zudem verbunden mit der Stellung des Künstlers als Schöpfer eines Werkes in der Gesellschaft; ein Verständnis, das sich erst im Zuge der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft ausgeprägt hat (Ruppert 1998). Diese sozialgeschichtliche Perspektive, die einen Ästhetik- und Kunstdiskurs, wie wir ihn heute kennen, lediglich 250 Jahr zurückverfolgen kann, schließt natürlich nicht aus, dass über einzelne Fragen, die heute zum Ästhetikdiskurs gehören, seit Jahrhunderten diskutiert wurde, etwa über die Frage der Schönheit (Scheer 1997, Plumpe 1993). 136 Document1 Lange Zeit versuchte man, in den Gestaltqualitäten – also in objektiv erfassbaren und als zeitlos verstandenen Merkmalen – eines „Kunst-„Objekts das „Wesen der Kunst“ zu finden. Der entwickelste Ansatz einer solchen objektivistischen Ästhetik ist sicherlich die informationstheoretische Ästhetik, wie sie in Deutschland prominent von Max Bense vertreten wurde (vgl. die Theoriensammlung Henrich/Iser 1982). Nach wie vor ist die Suche nach und die Identifikation von objektiven Gestaltqualitäten eine wichtige Aufgabe der Kunstanalyse und Bestandteil jeglichen Kunstverstehens. Allerdings geschieht dies heute weniger in einer philosophischen Ästhetik, sondern vielmehr in den einzelnen Kunstwissenschaften.5 Doch hat die Entwicklung der Künste selbst dazu geführt, dass eine derart „objektive“ Bestimmung von Kunst immer schwieriger wurde: Man kann geradezu als Motor der Entwicklung der Künste den Versuch sehen, den jeweils vorfindlichen Kunstbegriff zu sprengen. Eine entscheidende Etappe in diesem Prozess war – etwa in der Bildenden Kunst – der schrittweise Verlust des Gegenständlichen im späten 19. Jahrhundert bis zu den ready-mades von Marcel Duchamp, bei denen lediglich eine kleine Manipulation an Industrieprodukten vorgenommen wurde und die dadurch zu „Kunstwerken“ erklärt wurden. Spätestens an dieser Stelle wurde deutlich, was eine Sozialgeschichte bzw. eine sozial sensible, eher immanente Kunstgeschichte ebenfalls herausgebracht hat: Das Verständnis dessen, was „Kunst“ eigentlich ist, hängt sehr stark davon ab, was ein sozialer Kontext für Kunst hält. Es ist also bei der Definition von Kunst eine Verschiebung festzustellen, die vom Kunstwerk über den produzierenden Künstler nunmehr bei den soziokulturellen Kontexten landet. Der us-amerikanische Kunsttheoretiker Danto (1984) hat diese Auffassung umfassend ausgearbeitet: Ohne eine sozial-historische Einordnung ist das jeweils vorfindliche Kunstverständnis nicht nachzuvollziehen. Die Studien von Pierre Bourdieu (hier v.a. 1999 und 1987) zeigen zudem, wie sehr die Definition dessen, was Kunst ist, mit Macht und Einfluss zu tun hat. Man wusste zwar immer schon – nicht zuletzt aus den Biographien von KünstlerInnen, die sich mit neuen Ansätzen bei Kritik, Publikum und Markt durchsetzen mussten –, dass „Kunst“ sehr stark von diesen drei Mächten, also von (Fach)-Publikum, Kritik und Kunst-Marktinstitutionen abhängt. Bourdieu hat jedoch das notwendige sozialwissenschaftliche Instrumentarium zur Analyse dieser sozialen Definitionskämpfe geliefert und am Beispiel von Flaubert (Bourdieu 1999; vgl. auch Jurt 1995) gezeigt, wie KünsterInnen in der Lage waren, das für sie relevante soziale „Feld“ über neue ästhetische Maßstäbe zu definieren. Ästhetische Maßstäbe heißt dabei natürlich auch und insbesondere: Formqualitäten.6 Dies gilt auch für die Gesellschaftstheorie von Luhmann (v.a. 1996), in der das Subsystem Kultur/Kunst über Kunstwerke kommuniziert. Gerade für soziologische Ansätze, Kunst zu verstehen, spielt das Rezeptionsverhalten, also der soziale Kontext des 137 Document1 Kunstgebrauchs – in semiotischer Sprache: die Pragmatik – eine wichtige Rolle. Doch wird diese nur dadurch ermöglicht, dass es objektiv unterscheidbare Formqualitäten (und spezifische Inhalte) gibt, auf die sich diese pragmatische Dimension bezieht und die daher (mit)entscheiden, was als Kunstwerk gehandelt wird. Zu diesen Formqualitäten gehören allerdings auch die Rahmenbedingungen und Gestaltqualitäten der Präsentation. Es macht eben einen Unterschied, ob „Kunst“ in der Wohnung, in der Galerie, im Museum, in einer Ausstellung oder auf der Straße präsentiert wird. Dies bringt zum Ausdruck, dass es in vielfacher Hinsicht um Beziehungen geht, die sowohl von den Gestaltqualitäten im Kunstobjekt selbst abhängen, die aber auch mit den Beziehungen zwischen Kunstobjekt und Umgebung zu tun haben. Dies ist ein erstes Ergebnis bei einer Bestimmung dessen, was „Kunst“ heute sein kann: Ein gestaltetes Objekt oder ein Prozess, das bzw. der durch die Art der Gestaltung und Präsentation in vielfache Beziehung zu seiner sozialen und gegenständlichen Umgebung tritt, das oder der ein immanenter Zusammenhang von GestaltBeziehunen ist und insbesondere mit dem Kunstbetrachter eine Beziehung eingeht. Man kann nun sagen, dass die gezielte Herstellung solcher Beziehungen zur Aufgabe von Kunst gehört (Kleimann 2002). Damit hätte man einen Schritt in ein funktionalistisches Verständnis von Kunst getan, also sich auf das Feld der Beantwortung der Frage „Wozu Kunst?“ begeben (Fuchs/Liebald 1995, Kleimann/Schmücker 2001). Dies ist eine traditionsreiche Frage, auf die man eine Unzahl von Antworten geben kann. In einer Studie (in Fuchs/Liebald 1995) habe ich 90 Antworten auf diese Frage gesammelt. Eine neue Initiative zur Beantwortung dieser Funktionsfrage findet sich in Kleimann/Schmücker (2001). Dieses Buch ist – als aktuelle Publikation – nicht nur interessant im Hinblick auf die unterschiedlichen Antworten, die gegeben werden. Es zeigt zugleich, dass trotz der gerade in Deutschland vorherrschenden Ideologie der Kunstautonomie nach wie vor sinnvoll über die Funktionen von Kunst diskutiert werden kann (Gethmann-Siefert 1995, Bollenbeck 1994). Das Spektrum der Antworten ist breit, von der Erkenntnisfunktion bis zur Entwicklung eines „Gefühls zur Welt“ – und beides wird durchaus auch verstanden als Subversion, die mit Kunst herkömmliche gesellschaftliche Werthaltungen und Sichtweisen in Frage stellen will und soll (zur ethischen Relevanz von Kunst vgl. Fuchs 2002). Systematisch bringt Schmücker die möglichen Funktionen von Kunst in einem Tableau unter (Abb. 9). 138 Document1 Abb. 9: Funktionen der Kunst generelle Funktionen potentielle Funktionen konstitutive Funktion nichtkonstitutive Funktion kunstinterne Funktionen kunstästhetische Funktion ästhetische Funktionen Traditionsbildungsfunktion(en) Innovationsfunktion(en) Reflexionsfunktion(en) Überlieferungsfunktion(en) kunstexterne Funktionen kommunikative Funktionen dispositive Funktionen expressive Funktion(en) appellative Funktion(en) emotive Funktion(en) Motivationsfunktion(en) konstative Funktion(en) Distanzierungsfunktion(en) therapeutische Funktion(en) Unterhaltungsfunktion(en) soziale Funktionen kognitive Funktionen mimetischmnestische Funktionen dekorative Funktionen Identitätsbildungsfunktion(en) Distinktionsfunktion(en) Schmuckfunktion(en) Illustrationsfunktion(en) Status Erkenntnisdokumentaindizierende funktion(en) rische FunktiFunktion(en) on(en) kultische Erinnerungsfunktion(en) Funktion(en) ethisch-explorative Funktion(en) politische Funktion(en) religiöse Funktion(en) (sonstige) weltanschauliche Funktion(en) geselligkeitskonstitutive Funktion(en) ökonomische Funktion(en) Quelle: Schmücker in Kleimann/Schmücker 2001, S. 28 139 Document1 Nun gibt es gegen solche funktionalen Bestimmungen von Kunst Einwände. Hierbei ist es nützlich, den Unterschied von „Funktionen“ und „Wirkungen“ im Kopf zu behalten:: „Funktionen“, so mag man definieren, ergeben sich aus der absichtsvollen Herstellung von „Wirkungen“. Wirkungen können daher beabsichtigt oder nicht beabsichtigt sein. Auch eine streng antifunktionalistische Sicht von Kunst kann daher danach fragen, ob – trotz aller Autonomie – der Umgang mit Kunst soziale oder individuelle Wirkungen zeigt. Es liegt auf der Hand – und die Geschichte zeigt es auch – dass eine enge Funktionalisierung von Kunst, z. B. in politischideologischer Hinsicht, nicht immer gelingt oder anders gelingt, als beabsichtigt. Warum jedoch Kunst stets Wirkungen hervorruft, beantwortet in Hinblick auf den Einzelnen die Kunstpsychologie, in Hinblick auf soziale Zusammenhänge die Kunstsoziologie. Die meist genannten Funktionen beziehen sich zum einen auf solche Wirkungen, die man im einzelnen Individuum vermutet (vgl. hierzu Abschnitt 3).7 Überwiegend sind es jedoch Funktionen, die etwas mit sozialen Kontexten zu tun haben. In einem erweiterten Sinne kann man diesen Sachverhalt unter der Rubrik „Kommunikation“ einsortieren, sofern man ein Verständnis von Kommunikation unterstellt, das weit genug ist, dass es neben Sprache (als diskursivem Medium) weitere Medien zulässt (in der Terminologie der Philosophin S. Langer (1979): präsentative Symbole).8 Jede kommunikationstheoretische Deutung von Kunst hat sich mit dem Diktum Adornos (1974) auseinanderzusetzen, dass „kein Kunstwerk ... in Kategorien der Kommunikation zu beschreiben und zu erklären (sei)“. Schmücker (1998), der (trotzdem) eine kommunikationstheoretische Deutung von Kunst vorschlägt, muss sich daher mit diesem Diktum auseinander setzen, und er baut seine Argumentation auf der Tatsache auf, dass es auch im Prozess des Kunstverstehens um Bedeutungen geht. Kunstwerke sind daher Medien im Kommunikationsprozess (282). Es sind allerdings „Medien sui generis“. Was heißt das? Kommunikation ist „jeder Verweisungszusammenhang eines Zu-Verstehen-gebens und eines Zu-Verstehen-suchens“. Bei der Kommunikation mit und über Kunst geht es dabei nicht um die „Erzielung eines intersubjektiven Einverständnisses“; dies nennt Schmücker „diskontinuierlich“. „Kunst“ liegt also dann vor, wenn wir in einem Artefakt/Prozess ein potenzielles Medium eines solchen diskontinuierlichen Prozesses sehen. Kunstwerke laden somit zur Kommunikation ein ohne die „Last“, ein einvernehmliches Verständnis zu erzielen. Man mag dies in traditioneller Terminologie eine „entlastete“ Kommunikation nennen und damit einen Anschluss zu klassischen Ästhetiken (z. B. Kant, Schiller) herstellen, bei denen die Handlungsentlastung als „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ formuliert wird. Die Möglichkeit, auf ein „einvernehmliches Verständnis“ zu verzichten, liegt darin be140 Document1 gründet, dass „Bedeutung“ – also das, worauf Kunstwerke eindeutig verweisen könnten – nicht existiert, zumindest nicht so, wie wir es in der Alltagskommunikation erwarten. Eco (1972, 1995) sprach in diesem Zusammenhang vom „offenen Kunstwerk“und zielte auf die Bedeutungsoffenheit künstlerischer Zeichen. Trotzdem vermutet der Teilnehmer an der Kommunikation eine Botschaft, die man ihm mitteilen will. Der Modus der Wahrnehmung, nämlich als ästhetische Wahrnehmung (vgl. Abschnitt 4), versetzt den Rezipienten in diesen Zustand des erwartungsvollen Entlastet-Seins. Es wird also entscheidend darum gehen, ästhetische Wahrnehmung als spezifische Wahrnehmung zu präzisieren. Die pädagogische Bedeutsamkeit dieser Aufgabe wird bei dem phänomenologischen Ansatz von Böhme (2001, S. 180) deutlich, der Ästhetik als Wahrnehmungslehre begreift, die sich um die affektive Betroffenheit des Menschen kümmert. „Wahrnehmung“ ist dabei eine „Weise, sein eigenes Da sein zu spüren“ (ebd., S. 81) und weiter: „Zur Erfüllung dessen, was Menschsein heißt, gehören auch sinnliche Erfahrungen. Doch die Kompetenz dazu kann heute nicht mehr als naturgegeben angesehen werden, vielmehr muss man sie erwerben, und zumindest zu sagen, was man da erwerben muss, dazu ist die neue Ästhetik der Ort“ (ebd. S.180). Kunst, so der bisherige Gedankengang, ist eine spezifische Kommunikation, die insofern entlastet ist, als eine Notwendigkeit zur Einigung auf ein bestimmtes Verständnis der Mitteilung nicht vorhanden ist. Die Umschaltung auf diesen Modus der Entlastung erfolgt über die Wahrnehmung des Ästhetischen: Dieses schafft Neugier und Interesse an dem Inhalt ohne den Zwang zur Eindeutigkeit. Dies wiederum ist nur möglich, wenn kein Handlungszwang besteht, wenn also die Situation handlungsentlastet ist (Böhme 2001, S. 183ff.). Bekanntlich knüpfen ältere Ästhetik-Entwürfe hieran eine Funktion von Kunst: Den Menschen erleben zu lassen, dass er überhaupt in der Lage ist, derart befreit („entlastet“) sich mit der Welt und sich selbst auseinanderzusetzen. Schillers Ästhetik (1959) etwa sieht hierin gerade das emanzipatorische politische Potenzial des Ästhetischen: Freiheit zu erleben.9 Kunstwerke hätten dann die Aufgabe, auf diese spezifische Weise wahrgenommen werden zu können, um dem Menschen diese Selbsterkenntnis, nämlich frei sein zu können, zu ermöglichen So lautet etwa auch die Erklärung des Phänomens der Schönheit in der Anthropologie von Gehlen (1950); siehe auch Schmidt 1997, dort insbesondere die Ausführungen über die Kategorie der Entlastung, die das Ästhetische von Arbeit und Ethik/Moral unterscheidet. Gehlen leitet dieses Spezifikum des Ästhetischen aus der gattungsgeschichtlichen Entwicklung der 141 Document1 Instinktreduktion ab. Dies ist auch die Basis für seine (kritische) Deutung der modernen bildenden Kunst (Gehlen 1986): Gerade die bürokratisierte Gesellschaft hat eine „Sehnsucht nach Außenseitern und Nonkonformisten, das Publikum liebt es, wenn ihm das als erreichbar vorgeführt wird.“ (ebd., S. 223). In diese Richtung gehen auch aktuelle Vorstellungen, die in Kunst die Möglichkeit sehen, Kontingenzerfahrungen zu machen, dass also alles auch völlig anders sein könnte, als es ist.10 Es scheint sich hierbei also um ein anthropologisches Faktum zu handeln, das aktuell auch die Neurowissenschaften bestätigen: nämlich die elementare Freude des Gehirns am Entwerfen (Pfütze 1999, S. 26). Diese entwerfende Praxis heißt in der aristotelischen Terminologie Poiesis. Sie bezieht sich zum einen auf die „creatio ex nihilo“, die Schöpfung aus dem Nichts, also den kreativen Akt des Künstlers als Akt der Formung auf der Basis einer Formungslust. Sie findet sich jedoch auch beim Publikum, nämlich bei der (rezeptiven) Freude, mit der Kunst Formerfahrungen zu machen (und machen zu wollen!) und Beziehungen einzugehen, die zweckfrei sind und nicht auf Arbeit zielen (ebd., S.27). Das Bemerkenswerte an der bisherigen Begriffsbestimmung von Kunst, die ich auf der Grundlage einiger neuerer Versuche und im Anschluss an traditionelle Theorien vorgenommen habe, besteht darin, dass zwar Subjekt und Objekt im Kunstprozess unterscheidbar bleiben, aber nur der wechselseitige Bezug den künstlerisch-ästhetischen Prozess definiert: Auch das spezifische Mensch-Welt-Verhältnis in der Kunst ist in erster Linie ein Verhältnis, eine Relation. Mit dieser Sichtweise findet die Ästhetik als philosophisch-wissenschaftliche Disziplin Anschluss an die Entwicklungen moderner Wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert, nicht Dinge, sondern Relationen in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. Cassirer 1923). Es liegt auf der Hand, dass die semiotische Sichtweise diesen relationalen Ansatz übernimmt, da es um immanente Beziehungen von Gestaltungsqualitäten (Syntax), die Beziehungen zwischen den gegenständlichen Artefakten und Deutungen (Semantik), die Beziehung zwischen Artefakt und einem real vorhandenen Gegenstand (Sigmatik) und die soziale Beziehung Artefakt/Produzent bzw. Rezipient geht. Im Mittelpunkt dieses Textes steht zwar das Subjekt. Doch deutlich wird, dass die spezifisch ästhetischen Wirkungen im Subjekt nur dann erzielt werden, wenn auf der Objektseite – unter Einbeziehung des räumlich-sozialen Kontextes des Kunstwerkes oder -prozesses – die ent142 Document1 sprechenden „ontologischen“ Voraussetzungen vorliegen. Man muss daher auch dann nach allen drei Strukturmerkmalen der Tätigkeit, also nach Subjekt, Tätigkeit und Objekt, im Künstlerisch-Ästhetischen fragen, wenn man sich verstärkt nur für eines der drei genannten Momente interessiert: also nach der Spezifik des Objektiv-Ästhetischen, nach der Konstitution des Subjekts, das in der Lage ist, mit diesen ästhetischen „Botschaften“ umzugehen oder diese zu schaffen, und nach den spezifisch ästhetischen Praxen und Tätigkeiten, die Subjekt und Objekt in Produktion oder Rezeption miteinander vermitteln. Hilfreich ist dabei der Definitionsversuch von Gelfert (1998), der fünf Bestimmungsmerkmale von Kunst erarbeitet: Kunst hat einen Werkcharakter, ist also Ergebnis menschlicher Arbeit Kunst hat einen Selbstzweck, dient nicht der unmittelbaren Lebenserhaltung Kunst hat eine finite Form, was heißt: sie ist vollständig durchformalisiert Kunst ist scheinhaftig, ist abgehoben von der Wirklichkeit Kunst ist zeitlos, gleichgültig ob es sich um ein Werk oder eine Aufführung (“Zeitlosigkeit des Augenblicks“) handelt. Die folgende Grafik (Abb. 10) bringt diese Bestimmungsmomente in einen systematischen Zusammenhang (Gelfert 1998, S. 57) 143 Document1 Abb. 10: Bestimmungsmerkmale der Kunst Die Welt (= Gesamtheit aller Gegenstände und Sachverhalte) geistig wahrnehmbar (Mathematik usw.) Natur sinnlich wahrnehmbar Menschenwerk zweckhaft: Arbeit Selbstzweck: Kultus offene Form finite Form wirklich: Ritus scheinhaft: Kunst Performanz: zeitloser Augenblick Werk: zeitlose Dauer 144 Document1 Exkurs: Die Künste und die Kultur Die documenta XI erinnert daran, dass und wie die Künste in einem kulturellen Kontext entstehen und kulturelle Funktionen, so wie sie eine anthropologische Zugangsweise verständlich macht, auf eine bestimmt Art und Weise erfüllen. Walter Benjamin, der bei den Kuratoren dieser documenta eine große Rolle spielt, sagte einmal, dass jede Hervorbringung einer Gesellschaft in Kultur und Wissenschaft zugleich auch ein Dokument der Barbarei sei. Dies ist im Auge zu behalten, wenn man sich wie in diesem Text mit einem Denken über Kunst befasst, das zunächst einmal nur in einer europäischen Tradition entstanden ist und nur dort Sinn macht. Insbesondere sind hierbei solche Bestimmungen von Kunst im Hinblick auf ihre Geschichte und Genese zu untersuchen, die heute oft als „ontologisch“-zeitlose Bestimmungen dargestellt werden. Theorien der Kunst, die oft auch die Praxis und das Selbstverständnis der Künstler beeinflusst haben, sind auch Ideologien der Kunst, also interessens-, zeit- und ortsgebundene Deutungsangebote, die gerade nicht frei von Macht- und Herrschaftsbestrebungen sind. So entsteht etwa der heute als Kern jeglicher Kunsttheorie geltende Autonomiegedanke erst am Ende des 18. und im 19. Jahrhundert, nämlich mit dem philosophischen und künstlerischen Werk von Kant, Schiller und Goethe, von Beethoven, Wordsworth, Hugo und Flaubert. Und diese Auffassung einer autonomen Kunst wird nur nachvollziehbar, wenn man sie einordnet in ihren kulturellen (und auch politisch-ökonomischen) Kontext. Dies gilt ebenso für die damit verwandte Idee eines autonomen Subjekts, eines Individuums, das sich erstmals als Person und nicht als Teil eines Kollektives versteht, so wie sie in der Renaissance entstanden ist (Fuchs 2001). Bei näherer Betrachtung erweisen sich dabei auch die scheinbar so feststehenden Epochenbezeichnungen und ihre kulturellen Bedeutungen als rückwirkende Konstruktionen und Erfindungen, die oft mehr mit der Zeit ihrer Erfindung als mit tatsächlichen Abläufen zu tun haben. Auch Geschichte ist nämlich Teil der Herstellung einer kulturellen Selbstdefinition der jeweiligen Gegenwart. Die Erfindung der Renaissance im 19. Jahrhundert, die Erfindung der Griechen am Anfang desselben Jahrhunderts, die Erfindung Ägyptens und des Orients (so Burke, Said und Asmann in Schröder/Breuninger 2001) – z. T. in imperialistischer Absicht bzw. im Zuge der Kolonialisierung dieser Gebiete durch europäische Staaten – spielen eine zentrale Rolle in den Eroberungsgeschichten der Neuzeit: „Alle kulturellen Identitäten sind nicht einfach gegeben. Sie sind ein kollektives Konstrukt auf der Basis von Erfahrung, Gedächtnis, Tradition (die ihrerseits ebenfalls konstruiert und erfunden sein kann) und einer ungeheuren Vielfalt von kulturellen, politischen und sozialen Praktiken und Formen. Zweitens: Vom ausgehenden 18. Jahrhundert an bis heute sind die zentralen 145 Document1 Begriffe des Westens, Europas und der europäisch-westlichen Identität fast immer eng verbunden mit Aufstieg und Fall der großen imperialistischen Mächte, vor allem Großbritanniens, Frankreichs, Rußlands und der USA. Keine Beschreibung der euopäischen kulturellen Identität und der Künste kann meiner Meinung nach die Beziehung zwischen Kultur und Herrschaft einfach übersehen.“ (Said in Schröder/Brenninger 2001, S. 41). Damit werden die hier vorgetragenen Untersuchungen, die sich auf die ästhetische Dimension konzentrieren und die die politisch-hegemoniale Wirkung zunächst einmal vernachlässigen, keineswegs obsolet. Allerdings wird deutlich, wie relevant die Kulturtheorie für eine Theorie der Künste wird und welchen Wert das Projekt der documenta XI – mit den zugehörigen politologischen, soziologischen und ökonomischen Reflexionen zur Globalisierung und zum Postkolonialismus – zum Verständnis der kulturellen Funktion von Kunst in der heutigen Zeit hat, da es die Entwicklung der Künste und Kulturen konsequent in diese Prozesse der Macht und Herrschaft einordnet (Enwezor 2002). Gerade in einer solchen Perspektive muss es daher interessieren, wie es den Künsten und dem Ästhetischen gelingen kann, die genannten Prozesse der Konstruktion von Identitäten, der Selbstbeobachtung und Verortung erfolgreich zu gestalten und wie die oft verkannte und subversive Macht des Kulturellen erkannt und dann auch emanzipatorisch nicht gegen die Menschen, sondern zu ihren Gunsten angewendet werden kann. Das Ziel kann also nur eine politisch, ökonomisch und soziologisch aufgeklärte ästhetische Theorie sein. Akzeptiert man dies, wird man bei Durchsicht der meisten relevanten Texte eine deutliche Verabsolutierung des europäischen Entwicklungsweges als allgemein-menschlichem feststellen müssen (vgl. Fuchs 2002 – culture unlimited; Fuchs 2002 – Kunst und Politik, Abb. 10). Ich gehe zwar davon aus, dass trotz dieses Reflexionsdefizits – das allerdings traditionsgemäß zur Spezifik einer rein philosophischen bzw. fachkulturwissenschaftlichen Zugangsweise zur Kunst gehört – im Grundsatz die Funktionsweise von Kunst/Ästhetik erfasst sind, sofern man sich das Anwendungsfeld auf den westlichen Bereich reduziert denkt. Notwendig ist zudem die Einbettung der Kunsttheorie in eine aufgeklärte Kultursoziologie. Bourdieu etwa verortet systematisch Kunst im System sozialer Praktiken. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass ausgerechnet ihm ein respektloser Blick auf Kunst gelingt, denn er hat viele Jahre in Nordafrika verbracht und dort die Auswirkungen des Kolonialismus auf lokale Kulturen studieren können. Ästhetik und Kunsttheorie erfassen also durchaus Zutreffendes, doch bleibt so lange ein Ideologieverdacht bestehen, wie die historische und geographische Eingebundenheit vernachlässigt wird. Ästhetik als Ideologie beschreibt Terry Eagleton (1994) 146 Document1 im Hinblick auf die Machtkämpfe und die Durchsetzung des Bürgertums in Europa. Nunmehr muss die Perspektive erweitert werden um einen „postkolonialen Blick“, so wie es die Kuratoren der documenta XI versuchen (Young 2001). Ihr Ansatz integriert eine aktuelle Analyse der ökonomischen Globalisierung (Hardt/Negri 2000) und Kulturtheorien, deren Verfasser von ihrer Biographie her die koloniale Perspektive kennen (Bhabha 1994). Abb. 11: Die Vieldimensionalität von Kunsttheorien Ökonomie Anthropologie Die Internationalisierung des Kunstmarktes und der Kulturindustrie Kunst als symbol.kulturelle Form Soziologie Kunst und die „feinen Unterschiede“ Kunst(theorie) philosophische Bestimmung des Ästhetischen zwischen aisthesis und Reflektion Kunst als Teil kultueller Identität und als Möglichkeit der Unterdrückung Politik: Macht und Herrschaft Philosophie Kunst im Prozess der kulturellen Interessen, der Hybridisierung und Kreolosierung; kulturelle Hegemonie Kulturtheorie 147 Document1 Auch in kulturpädagogischer und -politischer Sicht wird man zukünftig verstärkt einbeziehen müssen, dass schon längst – auch auf nationaler Ebene – der Modus des Kulturellen das Interkulturelle ist (Fuchs 2002 – Culture; Reckwitz 2000). Erst recht gilt dies dann, wenn man Kulturkontakte systematisch plant, also in Prozessen der Interkulturellen Pädagogik bzw. in der Auswärtigen Kulturpolitik (Fuchs 2002 – Kunst, Kultur, Ökonomie und Politik). 3. Das Subjekt im ästhetischen Prozess Paetzold (1990) sieht zwei Aufgaben, die eine philosophische Ästhetik zu leisten hat: die Erklärung von „ästhetischer Erfahrung“ und die Bestimmung dessen, was „Kunst“ heißt. „Ästhetische Erfahrung“ sieht er als Produkt des Zusammenwirkens von Sinneswahrnehmung und Reflexion.11Ästhetische Erfahrung als Einheit von Sinneswahrnehmung und Reflexion ist (nicht nur) bei Paetzold geradezu das Schema von Erfahrung schlechthin. Entscheidend ist ihre besondere Qualität, dass sie sich im Erfahrungsprozess selbst zur Gegenstand der Erfahrung macht.12 Zur Einordnung der beiden von Paetzold genannten Aufgaben der philosophischen Ästhetik braucht man eine Vorstellung darüber, welche Funktionsbereiche sich im – natürlich ganzheitlich agierenden – Subjekt unterscheiden lassen. Man braucht ein Modell der Persönlichkeit (Fuchs 2001). Denken, Fühlen und Handeln sind nach wie vor aktuelle Unterscheidungen (Roth 2002). Andere Autoren fügen den Willen bzw. das Urteilen als eigenständige Dimensionen dazu. Kants drei Kritiken befassen sich bekanntlich mit dem Erkennen, dem Urteilen und Handeln. In der aktuellen Kompetenzforschung (Erpenbeck/Heyse 1999) geht man von folgender Persönlichkeitsstruktur aus, in die die drei anthropologisch und bildungstheoretisch begründbaren Beziehungsdimensionen des Subjekt (zu sich, zur Zeit, zur sozialen und gegenständlichen Umwelt, Fuchs 2000) einbezogen sind (Abb. 12). 148 Document1 Abb. 12: Persönlichkeit, Bewusstheit und Reflexivität bewusstes Verhältnis zu Geschichte und Zukunft (Zeitkompetenz) Wissen Fähigkeiten Fantasie Willen Fertigkeiten bewusstes Verhältnis zu Gesellschaft und Natur (u. a. Sozialkompetenz) Erfahrungen bewusstes Verhältnis zu sich (Selbstkompetenz) Kunst und Ästhetik haben es damit zu tun, dass etwas zur Anschauung (i.w.S.) gebracht wird. Zunächst sind es daher die Sinne und die Sinnesfunktionen im Subjekt, denen entsprechende Gegenstandsqualitäten auf der Objektseite gegenüberstehen. (Abb. 13). Die Funktionsweise der verschiedenen sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten werden aktuell in den Neurowissenschaften untersucht (Roth 2002). Es scheint sicher zu sein, dass rein sensualistische oder abbildtheoretische Konzeptionen von sinnlicher Wahrnehmung falsch sind.13 Sinnliche Wahrnehmung ist ein einheitlicher Prozess des Bewertens, Wahrnehmens, Einordnens und Konstruierens, der sich zudem nur zu einem kleinen Teil im Bewussten abspielt. Es ist zudem an die Ergebnisse der Wahrnehmungspsychologie zu erinnern, dass auch sinnliche Wahrnehmung durch das Prisma bereits gebildeter Begriffe hindurch geschieht (Holzkamp 1973). Mir scheint, dass hier sowohl die Konzepte des „Habitus“ und des „praktischen Sinns“ (Bourdieu), aber auch die Überlegungen des Anthropologen Helmut Plessner zu den nichtdiskursiven Weltzugangs- und Ausdrucksformen des Menschen mit diesen aktuellen Ergebnissen der Hirnforschung kompatibel sind. Dies heißt auch, die sozial- und kulturgeschichtliche Dimension bei den Sinnen zu berücksichtigen, was heißt: Die Sinne verändern sich in Abhängigkeit von Ort und Zeit, konkret: Der Mensch heute sieht, hört, fühlt, schmeckt, riecht anders als der Mensch der Antike oder des Mittelalters (Jütte 2000). Abb. 13: Reflexivität und Gegenstandsbezug der Sinne 149 Document1 KONTEXT: Kultur und Soziales Subjekt mit Organen/Sinnen: Auge Ohr Nase Zunge Haut Objekt mit Gegenstandsqualitäten: Visuelles Akustisches Gerüche Geschmacksqualitäten Taktiles Reflexivität der Sinne Sinnliche Aktivitäten in der künstlerischen Tätigkeit: Sehen Hören Riechen Schmecken Fühlen Sinnliche Wahrnehmung des Menschen ist reflexiv. Dies heißt, dass sich im Prozess der Wahrnehmung ein Dreifaches abspielt: Der Mensch sieht, hört, fühlt etc. etwas, das außerhalb von ihm selbst liegt:: Objektwahrnehmung. Der Mensch spürt sich selbst als Wahrnehmenden im Prozess der Wahrnehmung: Selbstwahrnehmung. Gerade in der Ästhetischen Wahrnehmung nimmt er eine verdichtete und bewertete Form eines (fremden) Wahrnehmungsergebnisses wahr, das zum Zweck des Wahrgenommenwerdens hergestellt wurde: das Kunstwerk. Nimmt man die Ausführungen des letzten Abschnittes über die Aspekte der Entlastung dazu, wird das Resümee von Schmidt (1997, S. 369) verständlich: „Ästhetische Erfahrungen vermitteln kein Wissen über die Welt, sie sind nicht der Inbegriff von Welterschließung noch die blanke Negation hermeneutischer Erschließungsmöglichkeiten von Welt, aber sie halten unsere sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten und intellektuellen Deutungs- und Verstehenskompetenzen offen für die Erfahrbarkeit der Welt. Diese Funktion können ästhetische Erfahrungen erfüllen, insofern ihre aus dem iterativen Zusammenspiel 150 Document1 imaginativer Vorstellungen und semantischer Aneignungsversuchen gespeiste Unverfügbarkeit zu keinem der beiden Pole hin aufgelöst wird.“ Insofern ästhetische Erfahrung die Reflexivität von Wahrnehmung enthält, vermittelt sie an einer entscheidenden Stelle Erkenntnisse über die Wahrnehmung selbst als Quelle von Wissen, vermittelt also Wissen über (den Erwerb von) Wissen bzw. Nichtwissen. Es ist offensichtlich, dass wir es hier mit einer entscheidenden Kulturfunktion zu tun haben. Das Wissen ist – neben der Orientierung an Werten und Einstellungen – entscheidend für unsere Orientierung in der Welt.14 Insofern ist es von großer Bedeutung, über Möglichkeiten zu verfügen, die Mittel, die Orientierungsleistungen erbringen müssen, bewerten zu können.15 Ästhetische Erfahrung ist eine solche Möglichkeit der Bewertung unserer Erkenntnis- und Orientierungsmittel. Ästhetische Erfahrung – als Einheit einer spezifischen Wahrnehmung und Reflexivität – hat als Gegenüber die spezifische Gestalt des (ästhetischen) Objekts (vgl. hierzu Abschnitt 4). Ästhetische Erfahrung, so oben, hat einen bestimmten Modus zur Voraussetzung: die Erwartung einer bedeutsamen Mitteilung in einer von Handlungsnotwendigkeiten entlasteten Situation. Es bedarf also einer spezifischen individuellen Disposition, will man ästhetische Erfahrungen machen. Zu dieser Disposition gehört Neugierde: „Ästhetische Erfahrung“, so Schneider (1996, S. 55; Sperrungen entfernt), „ist eine kontemplative, auf einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand gerichtete Aufmerksamkeitskonzentration, die um der Bewahrung der Eigenheit dieses Gegenstandes willen erfolgt und der evaluativen ebenso wie der existentiellen Wahrnehmung eine neue Perspektive auf ihn eröffnet.“ Die Suche nach Neuem sieht auch der Wahrnehmungspsychologe Walter Schurian (1986, S. 13) als Spezifikum des ästhetischen Verhaltens: „Die Ausgangspunkte und Ziele der Bewegung des Ästhetischen sind vielfältiger Natur, eines jedoch befindet sich in der „Suche nach dem Anderen“. Damit ist die unstillbare Energie des Menschen angesprochen, die ihn unaufhörlich bewegt, allen Dingen um eine jeweils andere Dimension nachzugehen. Das Ästhetische richtet sich letztlich aus auf die anderen Seiten der Wirklichkeit, die unbeleuchteten Ansichten. Es sucht hinter dem Erkannten das Unerkannte, hinter dem Geschauten das Ungeschaute.“ Dies ist also das Eigenartige: Ein geradezu anthropologisch fundierter Drang nach Neuem – und die ebenfalls immer wieder heraustretende Grundangst gegenüber dem Anderen, die bis hin zur Gewalt gegen Fremdes und Fremde führt (Kramer 1993); die Sinnlichkeit, die sich mit 151 Document1 der Oberfläche, dem Schein des Objektes befasst und gleichzeitig hinter dieser Oberfläche das Neue, Unbekannte, Unsichtbare sucht. Der Mensch schwankt offenbar zwischen dem Bedarf an Gewissheit und Tradition und der Offenheit für und Neugier auf Unerkanntes. Vermutlich ist gerade das Ästhetische als das von Zwängen und Erwartungen Entlastete sehr geeignet, diesen Zwiespalt an Bedürfnissen zu tragen. Im Hinblick auf die bislang verwandten Kategorien lässt sich folgende Präzisierung festlegen Abb. 14: Ästhetische Erfahrung Sinnliche Wahrnehmung Ästhetische Wahrnehmung Ästhetische Reflexion Ästhetische Erfahrung Bei Schneider (1998, S. 62) findet sich folgende differenzierte Grafik (Abb. 15), die allerdings die von Paetzold übernommenen Unterscheidungen zwischen Wahrnehmung und Erfahrung nicht übernimmt. Diese Unterscheidung ist jedoch sinnvoll gerade in pädagogischer Hinsicht, da Wahrnehmungsschulung und Reflexionsschulung durchaus unterschiedliche Felder der ästhetischen Bildung sind, die zudem mit unterschiedlichen Methoden gestaltet werden können. Insbesondere gehört zur Reflexion die ästhetische Urteilsbildung, die man eben nicht bei dem spontanen Geschmacksurteil „gefällt mir/gefällt mit nicht“ belassen muss. Auch in ästhetischer Hinsicht lässt sich das Urteilen insofern diskursiv und rational gestalten, als man Begründungen für sein Urteil finden muss. Kant spricht in diesem Zusammenhang von Reflexionsurteilen, und letztlich erwarten wir von der Kunstkritik nicht bloß abschließende Werturteile, sondern die Offenlegung ästhetischer Maßstäbe, die zu dem Urteil geführt haben.16 Dieser Ansatz, ästhetische Urteilsbildung ein Stück weit zu durchleuchten, findet u. a. eine Stützung in der Neurowissenschaft. Diese belegt offenbar, dass nicht nur das Unbewusste beim Menschen das Bewusste eindeutig überwiegt, sondern ebenso das Emotionale das Rationale. Wenn es also richtig ist, dass das Ästhetische eine gute, möglicherweise die einzige Möglichkeit darstellt, das Unbewusste und das Emotionale im Menschen anzusprechen, vielleicht sogar zu entwickeln oder zu „kultivieren“, dann muss man um so mehr jede Möglichkeit nutzen, in der bewusste Rationalität zumindest in Grenzen eingeführt und geformt werden kann.17 152 Document1 Abb. 15: Die unterschiedlichen Gegenstandsbereiche von Aisthetik, Ästhetik und Kunstästhetik Aisthesis (= menschliche Wahrnehmung) GEGENSTAND DER AISTHETIK ästhetische Erfahrung (= ästhetische Wahrnehmung) nichtästhetische Wahrnehmung (identifizierend, verstehend, evaluativ, existenziell) GEGENSTAND DER (ALLGEMEINEN) ÄSTHETIK ästhetische Kunsterfahrung (=ästhetische Wahrnehmung ästhetischer Kunst) ästhetische Naturerfahrung (=ästhetische Wahrnehmung der Natur) GEGENSTAND DER KUNSTÄSTHETIK(=KUNSTPHILOSOPHIE) GEGENSTAND DER NATURÄSTHETIK ästhetische Erfahrung (=ästhetische Wahrnehmung) sonstiger Sinnesdinge nichtästhetische Wahrnehmung ästhetischer Kunst nichtästhetische Wahrnehmung der Natur nichtästhetische Wahrnehmung sonstiger Sinnesdinge GEGENSTAND DER ALLTAGSÄSTHETIK ODER EINER ANDEREN SPEZIALÄSTHETIK 153 Document1 15.05.16 Wie tief man sich im Feld des Unbewusst-Emotionalen und menschheitsgeschichtlich sehr Alten bewegt, zeigten die Überlegungen von Hans-Dieter Gelfert. Er identifiziert vier „Uraffekte“ im Menschen: Eifersucht, Wut, Furcht, Ekel. Diese lassen sich ästhetischen Erlebnisformen zuordnen, so dass sich ein Schema ergibt (Abb. 16). Abb. 16: Uraffekte und das Ästhetische Pflegeverhalten Appetenz Eifersucht Das Schöne Werbungsverhalten Submission Aversion Fluchtverhalten Wut Das Pittoreske Das Erhabene Furcht Dominanz Angriffsverhalten Das Groteske Ekel Quelle: Gelfert 1998, S. 43 Affektgesteuerte Lustvorgänge, so rezipiert Gelfert die Neurowissenschaften, haben ihren Platz im limbischen System. Auf menschlichem Niveau gelingt es „dem gebildeten Menschen“ (S. 54f.), bewusst mit diesen Prozessen der Lust und Unlust umzugehen: Er kann sich spielerisch auf Bedrohung oder Verletzung einlassen, und dies gelingt um so mehr, je intensiver er mit der ästhetischen Gestalt umgehen kann. Schurian (a.a.O., S. 96) bringt die genannten Begriffe und psychischen Befindlichkeiten in folgenden komplexen Zusammenhang (Abb. 17). 154 Document1 15.05.16 Abb. 17: Vielschichtigkeit der psychischen Wahrnehmungen Ebenen der Vielschichtigkeit Psychische Prozesse Komplexität EvolutivÜberbewußtsein symbolische Ebene Ästhetik Reflexive Ebene Planung Sozialisation Individuation Bewußtes Anpassen Organismische Ebene Ästhetische Wahrnehmung Verlangen Inspiration Gestaltung Verhalten Verhalten Gefühle Stoffwechsel Empfindung Organelle Ebene Intrazelluläre Prozesse Dissipative Strukturebene Schwingungen Übergang innen, außen Information Abnahme von Kontextualität Zelluläre Ebene Abnahme von Komplexität Selbstreflexive Ebene Psychische Tätigkeit Empfindung Empfindung Orientierung Schwingung Kontextualität Quelle: Schurian 1986, S. 96 Nun zurück zur ästhetischen Urteilsbildung. Natürlich ist Ausgangspunkt und ständiges Ärgernis in der Diskussion über ästhetische Werturteile der Ausspruch, über Geschmack ließe sich nicht streiten. Offensichtlich ist dies empirisch falsch. Denn vermutlich wird über nichts mehr gestritten als darüber, ob ein bestimmtes Kleidungsstück gefällt, ob einem die Frisur 155 Document1 15.05.16 steht, ob ein bestimmtes Bild „schön“ ist etc. Geschmacksurteile sind zunächst rein subjektiv, können also eigentlich nur vor dem Hintergrund des Erfahrungsspektrums des Urteilenden verstanden werden. Andererseits treten sie oft auf mit einem Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Sie entziehen sich der formalen Logik, und trotzdem hat es immer wieder Bemühungen gegeben, eine Logik solcher Urteile zu entwickeln. Neben der (formalen) Logik ästhetischer Urteile kann man die Frage danach stellen, worauf sich die Urteile eigentlich beziehen und was sie als Grundlage haben. Diese systematische Analyse führt zwangsläufig zu einer Untersuchung der ästhetischen Erfahrung – als Basis des Urteilens -, der Logik ästhetischer Urteile und des Gegenstands, also des (ästhetischen) Objekts. Dies entspricht daher der Gliederung der Arbeit von Otto (1993). Einen Gedanken dieser Arbeit will ich hier skizzieren. Die Ausdrucksqualität von Kunstwerken als auslösendes Moment von Wohlgefallen spielt auch in Ottos Arbeit eine Rolle. Allerdings wird die These vertreten (und begründet), dass nicht notwendigerweise das Urteil, dass in einem Kunstwerk der Ausdruck eines Gefühls gelungen ist, mit dem Empfinden dieses Gefühls zusammenfallen muss. Die Feststellung des Gelingens im Kunstwerk ist vielmehr ein kognitiver Akt, ob das gezeigte „nachvollziehbar, aufschlussreich, einleuchtend oder „stimmig“ ist“ (ebd., S. 193). Die Lust am Schönen wird so – paradoxerweise – zu einer kognitiven Lust, die verbunden ist mit der Freude am Erkennen, Verstehen, Begreifen, Wiedererkennen. Ästhetische Erfahrung ist hier also wesentlich eine kognitive Erfahrung. Einigermaßen konsequent lässt sich mit dieser Position begründen, dass der Gegenstand der ästhetischen Beurteilung die innere Struktur, die Form des Präsentierten ist (S. 195; so auch die Ästhetik Kants). Einen zwar auch „kognitivistischen“ Weg, eine (begrenzte) Objektivität subjektiver ästhetischer Werturteile zu finden, beschreitet Piecha (2002). Sein Ansatz zielt darauf, die individuellen Hintergründe der ästhetischen Bewertung zu entschlüsseln und dadurch intersubjektiv verstehbar zu machen. Die Bewertungsprozesse selber, die stets mit Wahrnehmungsprozessen verbunden sind, beziehen ihre Rationalität aus der Relevanz für das urteilende Subjekt. Dies ist die kognitive Funktion von Emotionen, die notwendig für eine Orientierung in der Welt ist (so ähnlich auch die aktuelle Emotionspsychologie; vgl. Goleman 1997 und de Sousa 1997). Auch Piecha argumentiert mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die von einer vorbewussten Bewertung aller Ereignisse durch das emotionale Zentrum im Gehirn (insbesondere dem limbischen System) ausgehen. 156 Document1 15.05.16 4. Das Objekt Als Gegenstand eines ästhetischen Interesses kommen im Grundsatz zwei Arten an Prozessen oder Dingen in Frage: Artefakte oder Prozesse, die in ästhetischer Absicht gestaltet sind (die man ggf. noch einmal in Kunstwerke oder Design-Gegenstände unterteilen kann), und Dinge und Prozesse des Alltags einschließlich der Natur. Bei letzterem wird man die oben vorgetragene These modifizieren müssen, dass die ästhetische Wahrnehmung eine Wahrnehmung im Hinblick auf die Erwartung einer intendierten Mitteilung ist. Man kann allerdings auch die Bedeutungsfrage stellen, wenn man nicht von einer ästhetischen Gestaltungsabsicht ausgeht. So kann die Natur mit ihrem Reichtum an Formen und Farben natürlich Objekt einer ästhetischen Betrachtung werden, die gemessen an oben vorgestellten Kriterien der Formqualität die Natur anschaut (Böhme 1989, Seel 1991). Doch war es immer schon Anliegen der Ästhetik, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der ästhetischen Betrachtung ästhetischer oder natürlicher Objekte zu untersuchen. Bekanntlich hat Kant in seiner Ästhetik der Naturbetrachtung den Begriff der Erhabenheit vorbehalten. Die Frage nach einer intentionalen Botschaft in der Natur ist sofort mit ontologischen oder theologischen Aspekten verbunden. Denn unterstellt man eine solche Botschaft, so unterstellt man zugleich eine Absicht und einen Schöpfer. Auch wenn man einen solchen nicht unterstellen möchte, macht der ästhetische Blick Sinn, da handlungsentlastende Naturbetrachtung ebenfalls zu dem Genuss an Formen führt und ebenfalls Erkenntnisse über den Zustand der Natur – und sich selbst – gewinnen lässt: „Es geht im Grunde um das „Sichbefinden des Menschen in Umwelten“. Die durch den Menschen veränderte natürliche Umwelt wird für ihn nur deshalb zum Problem, weil er das Destruktive dieser Veränderungen nun am eigenen Leib zu spüren bekommt. Das bringt ihm, dem Menschen, zu Bewusstsein, dass er selbst als leiblich sinnliches Wesen in Umwelten existiert, und zwingt ihn, diese seine eigene Natürlichkeit wieder in sein Selbstbewusstsein zu integrieren.“ (Böhme 1989, S.). Eine Ästhetik der Natur wurde daher in den letzten Jahren auch als ökologische Naturästhetik entwickelt. Denn möglicherweise ist ein ästhetisches Interesse, das die Natur eben nicht unter dem Aspekt der Verwertung und des vordergründigen Nutzens betrachtet, eine wichtige Alternative zu ihrem heutigen Verschleiß. Der Mensch auch als Wesen der Natur kann so genau diesen Aspekt seines Seins studieren – mit durchaus beachtlichem Erkenntniswert. Körper, Leiblichkeit, Sinne: all dies erinnert an die Naturverbundenheit des Menschen – auch als Quelle des Leidens. Es scheint zudem, dass in den Zeiten der Biowissenschaften der Mensch selbst als Gestaltungsobjekt ins Blickfeld gerät, so dass die Frage, was an der Natur überhaupt 157 Document1 15.05.16 noch „natürlich“ ist, zu der wichtigsten Frage insgesamt werden kann. Gerade die Biowissenschaften und die naturwissenschaftlich vorgehenden Neurowissenschaften setzen das Verhältnis von Geistes- und Naturwissenschaften erneut auf die Tagesordnung, da sie um den gleichen „Gegenstand“ konkurrieren. Gestaltete nicht-ästhetische Produkte können ebenfalls einem ästhetischen Zugang unterworfen werden. In der Tat nutzen auch die Künste die Wirkung der Verfremdung, Alltagsgegenstände gegen ihre geplante Verwendungsweise zu verstehen – man erinnere sich an Duchamps ready-mades. Form und Gestalt werden so als Grundmomente menschlicher Existenz erkennbar. Eine Ästhetik des Alltags kann lehren, mit der gegenständlichen Welt bewusst umzugehen (Selle/Boehe 1986). Auch dies ist daher ein Bereich von ästhetischer und kultureller Bildung, hier in der Dimension der Herstellung eines bewussten Verhältnisses zu seiner räumlichen Umgebung. Von besonderem Interesse müssen jedoch Prozesse und Produkte sein, die in ästhetischer Absicht hergestellt werden. Der Begriff des Kunstwerks hat – wie oben erwähnt – eine junge Geschichte. Er war als Begriff kaum durchgesetzt, als schon vielfältige kunstpraktische Versuche stattfanden, die ihn umdeuten oder gar völlig destruieren wollten. Die Definition von Kunst und Kunstwerken ist also ein laufender Prozess. Und jedes Werk ist ein weiterer Beitrag zu diesem Prozess, da Kunst als zunehmend selbstreferentieller Prozess immer auch – und ständig mehr – mit ihren eigenen Produkten über sich selbst und ihre Entwicklung kommuniziert. Zur Entstehung des Kunstwerkbegriffs gehört die Herausbildung der Künstlerprofession und eines spezifisch künstlerischen sozialen Feldes. „Kunst“ ist in dieser Perspektive, was eine ausgewählte Gruppe von Menschen dafür hält. Diese soziologisch klingende Erklärung ist weniger skandalös, als sie beim ersten Lesen erscheinen mag. Denn das Diskursfeld, das sich um die Definition bemüht, ist durchaus fachkundig und erledigt sein Werk vor dem Hintergrund theoretischer Reflexionen und praktischer Entwicklungen. Und: Der Diskurs geschieht unter Bezug auf die hergestellten Dinge und Prozesse. Diese sind immer auf irgendeine Weise sinnlich wahrnehmbar, so dass die Rede von einer „Ontologie des Kunstwerks“ Sinn macht (über lange Jahre vor allem in zwei verschiedenen Ansätzen, die sich zum einen auf Heidegger, zum anderen auf Lukacs bezogen). Inzwischen greift man auch in jüngeren Publikationen auf diesen Begriff wieder zurück. Dass es sinnvoll ist, von einer „Ontologie“ zu sprechen, wurde eine Weile in frage gestellt, etwa seit die Technik leichte Reproduktionsverfahren entwickelt hat: Das „Kunstwerk in Zeiten technischer Reproduzierbarkeit“ (Benjamin 1963) ist in der Tat im Hinblick auf Originalität und Authentizität zu untersuchen. Aktuell ist es die Virtualität der neuen elektronischen Medien, die insbesondere den Dingcharakter und die Ma158 Document1 terialität von Kunstwerken und -prozessen thematisiert 15.05.16 18 (vgl. die etwas ältere Diskussion in Oelmüller 1983). In der kunsttheoretischen Diskussion hat man die in semiotischen Ansätzen ansonsten eher verpönte Rede über eine „Ontologie des Kunstwerks“ letztlich doch akzeptiert, eben weil die Semiotik nach einem sinnlich wahrnehmbaren Artefakt als materiellem Zeichenträger und seiner Bedeutung (Semantik) fragt.19 Gerade die Frage nach der Bedeutung stellt sich für jede Kunstsparte sehr spezifisch. Am schwierigsten ist diese Frage sicherlich bei der Musik zu beantworten (Dahlhaus 1975). Doch zeigen oben vorgestellte aktuelle Antwortversuche auf die Frage nach Kunst produktive Richtungen für möglichen Antworten auf: die Unterstellung einer Bedeutung auf der Basis von Neugierde, allerdings entlastet von der Notwendigkeit zur Einigung; Kunstwerke sind bedeutungsoffen, allerdings nicht bedeutungslos. Die vermutlich ausführlichste Ontologie von (bildender) Kunst hat aktuell der Philosoph Hans Heinz Holz (1996, 1997, 1997) in seiner dreibändigen „Philosophie der Bildenden Künste“ entworfen. Holz war einer der wissenschaftlichen Begleiter der legendären documenta V, so dass die Annahme, seine Kunstphilosophie stütze sich lediglich auf die Klassik mit ihren ausgefeilten und allseits anerkannten Kunstwerken und den ebenso anerkannten „klassischen“ Ästhetik-Standards – und haben auch nur dort Gültigkeit – nicht trägt. Holz versucht, „ursprüngliche Strukturen der Sichtbarkeit als allgemeine Bedingungen der Erfahrung von Gegenständen aufzuweisen und darin die objektive Weise des Sich-Zeigens von Dingen zu erkennen...“ (Bd. V, 1997, S. 7). Den Zusammenhang zwischen Mensch (Abschnitt 3) und (Kunst-)Werk sieht Holz in einer „Korrespondenz von anthropologischen und ontologischen Universalien“ (ebd., S. 12), die sich zwangsläufig durch die Anthropogenese ergibt: Der Mensch wäre nicht lebensfähig, wenn seine Denkstrukturen nicht in irgendeiner Weise mit den Strukturen der Natur übereinstimmen würden. Allerdings braucht er immer wieder (Selbst-)Erkenntnismittel, um die Grundlage seines Seins zu analysieren: „Ich meine nämlich die Reflexionsformen, in denen der Mensch seine gegenständlichen Verhältnisse in den von ihm geschaffenen Werken ausdrückt, sind durch die Daseinsformen der Materie vorgegeben und haben also einen ontologischen Sinn.“ (ebd., S. 13). Ontologie des Seins und Strukturen der Erkenntnis sind also nicht dasselbe, allerdings auf Grund der bloßen Tatsache, dass der Mensch (über-)lebt, eng miteinander verbunden. Es mag überraschen, dass selbst der Idealist Ernst Cassirer (1959, S. 45), der der geistigen Kraft zur Formung den Vorrang gegenüber dem Materiellen gibt, diese auf das Faktum der lebendigen Existenz des Menschen und seine Evolution zurückführt: Auch das Geistige ist Ergebnis eines natürlichen Prozesses, ist quasi die höchste Stufe im immerwährenden Schaffungsprozess der Natur. Kunst wird – nicht nur bei Holz – also zu einem bevorzugten Unter159 Document1 15.05.16 suchungsfeld für die „Funktionsweise“ des Menschen schlechthin: „Das Kunstwerk“, so Holz (a.a.O., S. 13), „entwickelt uns Seinsmöglichkeiten; und diese Möglichkeiten sind die unendlich mannigfaltigen Varianten eines elementaren Repertoires von Strukturen.“. Es geht also um ein Strukturanalyse des Kunstwerkes, die berücksichtigt, dass Kunstwerke Wirklichkeit dreifach in sich aufnehmen können (ebd., S. 16): als Abbild als Ausdruck einer Sache, ohne mit ihr gleich zu sein als Schaffung einer neuen Wirklichkeit, wobei sich die verschiedenen Wirklichkeiten vielfach aufeinander beziehen. Es geht also insgesamt darum, die spezifische Weise zu untersuchen, wie sich Strukturen der Welt, Strukturen des Geistes, Strukturen der Begriffe und schließlich die Strukturen unterschiedlicher Symbolsysteme aufeinander beziehen, hier speziell: die Strukturen der symbolisch-kulturellen Form Kunst. Diese müssen jedoch für jede Kunstsparte und Ausdrucksform gesondert untersucht werden. Das heißt, dass hier die allgemeine Betrachtung über Kunst schlechthin endet und die vielfältigen Theorien der einzelnen Kunstsparten beginnen. 5. Künstlerische Tätigkeiten Diesen Abschnitt kann ich kurz halten, da sich über künstlerische Tätigkeiten nur konkret, das heißt bezogen auf die Praxis in jeder Kunstsparte reden lässt. Es ist also die Praxis des Musizierens, des Theaterspielens und Tanzens, des Dichtens bzw. Lesens, des Malens und Plastizierens sowie generell des Spielens zu untersuchen. In besonderer Weise ist es in pädagogischer Hinsicht wichtig zu wissen, wie sich immer reichhaltiger Praxen und Tätigkeiten im Zuge der Ontogenese entwickeln, d.h. es sind hier die Entwicklungspsychologien der Musik, des Tanzes etc. zuzuziehen. Dies ist dann allerdings kein Gegenstand der Kunsttheorie mehr. Daher hier nur einige Hinweise. Die Ontogenese künstlerischer Tätigkeit ist eingebettet in die gesamte Entwicklung des Kindes. Es sind alle Persönlichkeits-Dimensionen berührt: Die Kognition, die emotional-motivationale und die sensumotorische Dimension. Künstlerische Tätigkeiten hängen mit basalen Lebensfunktionen zusammen und ergeben sich aus diesen: aus der Entwicklung der Sinne, also der – zunächst und natürlich sich entwickelnden – Entwicklung des Hörens, Sehens etc.; aus der Genese der Körpersynchronisation, der Hand-AugeOhr-Koordinierung. Am Beispiel der Musik werden in einem Handbuch (Bruhn/Oerter/Rösing, 1993) im Hinblick auf die Ontogenese des Musikalischen des Menschen etwa abgehandelt: Hören: vor der Geburt; in den ersten Lebensmonaten 160 Document1 15.05.16 Singen und Erkennen von Melodien Rhythmus Tonalität und Harmonie Es wird der soziale Nahraum berücksichtigt mit seinem Einfluss durch Peers, Elternhaus, Schule und Medien bis hin zur Entwicklung einer musikalischen Urteilskraft und der Genese von musikalischen Präferenzen und musikalischem Geschmack. Man kann künstlerische Tätigkeiten einordnen in das System zu entwickelnder Tätigkeiten. Hier bietet sich eine tätigkeitsorientierte Psychologie an, die sich auf die russischen Psychologen Wygotzki (1974) und Leontiew (1982) bezieht und wie sie in (ehemals westlichen) psychologischen Handlungstheorien einbezogen worden ist. Hierbei zeigt sich, dass die oben als philosophische Kategorie der Tätigkeit mit ihren einfach Strukturmomenten Subjekt – Mittel/Tätigkeit – Objekt auch in der Psychologie genutzt werden kann (Holzkamp 1983). Rolf Oerter beschreibt in dem bereits erwähnten Handbuch Musikpsychologie (Bruhn/Oerter/Röring) seine handlungstheoretische Verständnisweise von Musik und menschlicher Entwicklung mit den Kategorien der Leontiewschen Tätigkeitspsychologie (unter Einbeziehung von Piaget), die zudem als Grundprinzipien der Anthropologie bekannt sind (Fuchs 1999), nämlich mit den folgenden (dialektischen) Begriffspaaren: Aneignung/Vergegenständlichung, Subjektivierung/Objektivierung, die er auf einer Vierfeldertafel zueinander in Beziehung setzt (a.a.O., S. 257) . Abb. 18 Aneignung Subjektivierung Objektivierung Vergegenständlichung Musik hören, die der eigenen komponieren, improvisieren, Stimmungslage entgegenüber erlebte Musik sprechen kommt den Aufbau eines Musikstü- Musik werkgetreu spielen ckes beim Anhören rekonstruieren Mit diesem Ansatz lässt sich Musizieren als spezifische Tätigkeit einbeziehen in das System weiterer Tätigkeiten (Kossakowski u.a. 1977). Abb. 19: System von Tätigkeiten Spieltätigkeit Arbeitstätigkeit künstlerische Tätigkeit Lerntätigkeit 161 Document1 15.05.16 gesellschaftpolitische Tätigkeit All diese Tätigkeiten haben die „allgemeinen Strukturmomente“ (Subjekt-Mittel-Objekt) gemeinsam, müssen jedoch in Hinblick auf die Rolle der Intentionalität (Zweckorientierung bei Arbeit und Politik, gemilderte Zweckorientierung beim Lernen, Zweckfreiheit beim Spiel und den Künsten) unterschieden werden (Sieben 2001). Zudem sind alle Tätigkeitsformen sozialgeschichtlich überformt, d. h. sie finden jeweils historisch-konkret unter bestimmten Bedingungen statt, die ein Handlungsrepertoire, gesellschaftlich sanktionierte Handlungsziele, Gegenstände, Frei- bzw. Zwangsräume, Möglichkeiten, Chancen und Einschränkungen bereitstellen (Kuckhermann/Wigger-Kösters 1985). Eine Einordnung der künstlerischen Tätigkeit in die Tätigkeitspsychologie gestattet es zudem, die entwickelten Konzeptionen der Tätigkeitsregulation auf die künstlerische Praxis anzuwenden, also zu fragen, wie sich die Momente der Handlungsregulation in diesem spezifischen Handlungsfeld konkretisieren (Kossakowski u.a. 1977, S. 111ff.) Abb. 20. Abb. 20: Tätigkeitsregulation Erkennen Erleben Streben Behalten Tätigkeit Bewerten Kontrollieren Entscheiden 6. Der Begriff des Symbols als theoretisches Hilfsmittel der Kunsttheorie Ein „Symbol“ verbindet eine (geistige) Bedeutung mit einem (materiellen) Substrat (Cassirer 1990). Es lässt sich auf dieser Grundlage eine Theorie der Künste innerhalb einer Theorie der Symbole entwickeln (Abb. 21). 162 Document1 15.05.16 Abb. 21: Theorie der Künste Sigmatik: gegenständliche Referenz; Syntax: Form und Gestalt materielles Substrat: Zeichenkörper Semantik: Bedeutung; Deutung Pragmatik (Produktion und Rezeption) wahrnehmendes Sinnesorgan: Ohr/Mund Auge Körper Haut Mund Nase (bei Rezeption und Produktion) Sinnesaktivität: Hören/Sprechen Sehen Fühlen/Tasten Schmecken Riechen bei Produktion: Gestalten künstlerische Symbolform/Objekt: Sprache/Dichtung/Musik Malerei/Skulptur/Tanz/ Theater/Gestik/Mimik/ Architektur Erläuterungen Sinnlich wahrnehmbar ist am Symbol die Gestaltung, das gegenständliche Substrat mit seiner spezifischen Materialität und Gestalt. Es lassen sich physikalisch von anderen Symbolträgern unterscheiden: Akustisch wahrnehmbare Töne und Geräusche Visuelles sowie weniger bis gar nicht als elaborierte Kunstformen verbreitet Taktiles, also materielle Oberflächenqualitäten, die durch Fühlen und Tasten erfasst werden, Gerüche und Geschmacksrichtungen. 163 Document1 15.05.16 Es ist offensichtlich, dass das Sehen und Hören und – in Grenzen – das Fühlen (etwa Ertasten von Skulpturen) auf der rezeptiven Seite für die Künste relevant sind. Auf der produzierenden Seite ist es entsprechend die Herstellung von Hörbarem (Musik, gesprochene Dichtung) die Herstellung von Sichtbarem (Bildende Kunst, aber auch Tanz, Theater und Architektur). Der Körper als Ganzes ist beteiligt in der Architektur. In der Formung und Gestaltung dieser sinnlichen Artefakte kommt die ästhetische Dimension zum Ausdruck. Ästhetische Erfahrung, so Abschnitt 3, kommt jedoch erst durch die Hinzufügung von Reflexion zustande. Damit ist zum einem das Verständnis der Formsprache gemeint. Es bezieht sich jedoch auch auf die Bedeutungsdimension, die erst auf der Grundlage von vorhandenem Wissen über mögliche Bezüge entfaltet werden kann. Wie sehr hier soziokulturelles Wissen notwendig ist, sieht man, wenn man die Versuche zum Verstehen alter Funde bzw. von Artefakten fremder Kulturen betrachtet, also in das Feld einer archäologischen Hermeneutik übergeht. In Hinblick auf den letzten Abschnitt lässt sich künstlerische Praxis nicht nur einordnen in Theorien des Symbolischen, sondern auch – aus der Sicht des Subjekts – in Theorien zur (Onto-)Genese von Symbolkompetenzen. Betrachtet man das Symbol als diejenige Relation im Semiotischen Schema (siehe Abb. 4), die die Beziehung Zeichenträger – Bedeutung thematisiert, dann ist die Semiotik die übergreifende Theorie, die die einzelne Dimension des Symbolgebrauchs präziser benennt (wie gesehen: die Formqualitäten des materiellen Symbolträgers in der Syntax, die Rolle des SymbolGebrauchs in der Pragmatik). Musik etwa, die im letzten Abschnitt skizziert wurde, lässt sich daher einordnen in: 164 Document1 15.05.16 Abb. 22: Musik in der Semiotik Pragmatik: Psychologie der musikalischen Tätigkeit; produktiver und rezeptiver Umgang mit Musik; zugleich: soziale Konstitutionsbedingungen des musikalischen Feldes (i.S. von Bourdieu) Syntax: Entwicklung der Formaspekte in der Musik Semantik: „Bedeutung“ in der Musik, so wie sie in der Musikalischen Hermeneutik untersucht wird (z. B. Dahlhaus 1975) Die Tätigkeit, Symbole zu erfinden, also eine geistige Welt („Bedeutung“) mit einem Materiellen zu verbinden und für eine gewisse Dauer mit dieser Verbindung so zu arbeiten, dass das Materielle das Geistige repräsentiert, ist bei Cassirer das Spezifikum des Menschen. Es ist daher durchaus interessant zu sehen, wann in der Phylogenese diese Fähigkeit entsteht. So ist das etwa von Ernst Haeckel formulierte „Gesetz“ von der Parallelität von Onto- und Phylogenese zwar nicht generell anerkannt, wird aber zumindest als heuristisches Instrument immer wieder gerne genutzt (vgl. den Beitrag „Ontogeny and Phylogeny“ der beiden Herausgeber in Lock/Peters 1996, S. 371 ff). Holzkamp (1973, S. 150 ff.) gibt den folgenden Ablauf der Entstehung von Symbolkompetenz an: Zunächst: Vergegenwärtigung von Gebrauchswert-Antizipationen ist eng an auf stoffliche Veränderung gerichtete Tätigkeitsmomente gebunden. Mit der Werkzeugreproduktion ergibt sich eine immer größere Verselbstständigung und verselbstständigte Weitergabe von Wissen. Es entwickelt sich eine selbstständige Übertragung von Wissen über Verfahren der Werkzeugherstellung. Dazu gehört: Allgemeine Eigenschaften der objektiven Welt, die durch Arbeit zutage treten, sind nun nicht mehr bloß praktische Umgangserfahrung, sondern werden zur vergegenwärtigten und in dieser Form tradierbaren Erfahrung. Gebrauchswertbestimmungen, die als Gegenstandsbedeutung im Werkzeug vergegenständlicht sind, werden immer mehr als Symbolbedeutung auf den Begriff gebracht, wobei diese Symbolbedeutung zunächst eng auf die Gegenstandsbedeutung bezogen bleibt. Es entwickelt sich nun die Stufe des Sprachlich-Symbolischen. Ist diese Stufe erreicht, dann geschieht die Wahrnehmung durch den Begriff hindurch. Verständigung über Dinge und Menschen ist nun auch in deren Abwesenheit möglich. (Ebd.). 165 Document1 15.05.16 Man kann nunmehr untersuchen, wie die Entwicklung bei unterschiedlichen Symbolsystemen verläuft. Zwei Themen waren dabei immer schon von besonderem Interesse: die Genese von Sprache (gesprochene und Schriftsprache) und die Genese des Bildgebrauchs und des Zeichnens. An beiden Themen haben Ethnologen, Frühgeschichtler und Entwicklungspsychologen gearbeitet und jeweils die kulturvergleichende, die phylogenetische und die ontogenetische Sichtweise eingenommen. Eine besondere Rolle spielen dabei die mathematischen Konzepte der Zahl und der geometrischen Grundfiguren, weil diese bereits zu einem frühen Zeitpunkt Funktionen der Orientierungen in der Welt übernehmen müssen. Ich will dies hier nicht weiter verfolgen, sondern lediglich darauf hinweisen, wo und wie diese Frage der Genese von Symbolkompetenzen weiter verfolgt werden kann. Neben diesen eher kognitiven Medien (Zahl, Sprache) spielen dabei zunehmend nonverbale Ausdrucksmedien (Gestik, Mimik etc.) eine Rolle, um die sich insbesondere Helmut Plessner verdient gemacht hat und die nunmehr in der Historischen Anthropologie (Wulf 1997 mit zahlreichen Stichworten wie „Geste“, „Rhythmus“, „Bewegung“) untersucht werden. Es liegt auf der Hand, dass gerade diese nichtdiskursiven Modi der Kommunikation und Weltbegegnung in künstlerischem Kontext von entscheidender Bedeutung sind. Sie sind es zudem in der Soziologie, so wie sie insbesondere Bourdieu ausgearbeitet hat: Denn die verinnerlichten Gesten, Haltungen, Bewertungen, Ausdrucksmodi etc. und die Differenzen in den Ausprägungen bei bestimmten sozialen Gruppen („Habitus“) formieren entscheidend das vielfältig gegliederte soziale Feld und entscheiden als „feine Unterschiede“ (Bourdieu 1987) – über den sozialen Rangplatz der betreffenden Person (zur „Geste“ und ihrer Rolle als Mittel der Sinngebung im sozialen Prozess, die mimetisch verstanden werden muß, siehe den Beitrag von Wulf in Wulf 1997, S. 516 ff.). Dieses „gestische Körperwissen“ (ebd., S. 524) entsteht weit gehend unabhängig vom Bewusstsein (siehe die Ausführungen zu den Neurowissenschaften in Abschnitt 2; vgl. Roth 1997, 2001). Man eignet es sich in sozialen Situationen an, es verdichtet sich zu einem „Habitus“ (Bourdieu) und prägt den – ebenfalls weit gehend unbewusst ablaufenden – „praktischen Sinn“ (Bourdieu) als alltagsrelevantes Orientierungsinstrument des Menschen. Auch hier glaube ich, dass zivilisationsgeschichtliche Untersuchungen zur Rolle der Gestik und Mimik (Elias), eine Philosophie der Gestik (Plessner, Flusser), eine Neurowissenschaft des gestischen Körperwissens (Roth) und eine Soziologie der „feinen Unterschiede“ in Gestik und Mimik (Bourdieu) letztlich zusammenlaufen und eine Basis gerade für die „performing arts“ und die zugehörige Pädagogik bieten (Belgrad/Niesyto 2001). 166 Document1 15.05.16 Ein letzter Hinweis. Symbole stehen zwischen Mensch und Welt, sie sind Mittel (also „Medien“) des Weltzugangs. Jede Symboltheorie ist daher eine Medientheorie im allgemeinen Sinne. Ernst Cassirer unterscheidet unterschiedliche symbolische Formen, also spezialisierte Bereiche von Symbolen, die jeweils das Ganze der menschlichen Existenz (die „Welt“) in den Blick nehmen, dies jedoch auf je unterschiedliche Weise tun. Cassirer spricht von einem „Brechungsindex“ einer jeden symbolischen Form. Bildende Kunst nimmt die Welt über „Bilder“ wahr, Sprache hat „Wörter“ und „Sätze“ zur Verfügung, Religion über Vorstellungen und Ideen von „Gott“. Wissenschaft hat spezifische wissenschaftliche Begriffe, etwa den Begriff der Zahl. Es gibt also je abgrenzbare Möglichkeiten, sich mit den symbolischen Formen ein Bild von der Realität (also „Wirklichkeiten“) zu schaffen (Abb.23). Der amerikanische Philosoph Nelson Goodman stützt sich in seiner Symboltheorie auf diesen Gedanken der „Weisen der Welterzeugung“. Das Verständnis von Symboltheorie als Medientheorie findet sich auch in der ambitionierten mehrbändigen Geschichte der Medien von Werner Faulstich (1996, 1997, 1998). Hier (ebenso wie knapper bei Hörisch 2001) wird Mediengeschichte als Kulturgeschichte geschrieben, die von Ritualen, von Tanz, Theater und der Höhlenmalerei über die Schrift- und Buchkultur bis zu den neuen elektronischen Medien reicht (besser – bei Faulstich – reichen wird; bislang ist er erst in der frühen Neuzeit angekommen). Das „Symbol“ verbindet also Medien- mit Kulturgeschichte, Medien- mit Kulturtheorie und schließlich Medien- mit Kulturpädagogik (hierzu Belgrad/Niesyto 2001). Spätestens seit der documenta XI ist zudem klar geworden, dass auch die Kunsttheorie heute nicht mehr ohne Medienästhetik verstanden werden kann (siehe hierzu Reck 1991, 1994; Schell 2000). 167 Document1 15.05.16 Abb. 23: Symbolische Formen als Weisen der Welterzeugung unterschiedliche Wirklichkeiten sprachliche Wirklichkeit Sprache Energien zur Schaffung unterschiedlicher (ideeller) Symbolsysteme als Formen des Erkennens der Realität/der Schaffung spezifischer Wirklichkeiten religiöse Wirklichkeit Religion mythologische Welt Mythos Mensch Kunst ästhetische Wirklichkeit Wissenschaft Technik Wirtschaft Staat wissenschaftliche Wirklichkeit Welt der Technik Bezug zur realen Welt über spezifischen Brechungsindex der symbolischen Formen D I E W E L T Welt der Wirtschaft politische Welt Kultur: Summe der symbolischen Formen 168 Document1 15.05.16 Literatur Belgrad, J./Niesyto, H. (Hg.): Symbol. Verstehen und Produktion in pädagogischen Kontexten. Hohengehren: Schneider-Verlag 2001. Benjamin, W.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1963. Bhabha, H.: Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenberg 2000. Böhme, G.: Für eine ökologische Naturästhetik. Frankfurt/M.: Surhkamp 1989. Böhme, G.: Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. München: Fink 2001. Böhme, H./Matussek, P./Müller, L.: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will. Reinbek: Rowohlt 2000. Bollenbeck, G.: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. München: Insel 1994. Bourdieu, P./Wacquant, Loie J. D.: Reflexive Anthropologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1996 Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987. Bourdieu, P.: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994 (1974). Bourdieu, P.: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M. Suhrkamp 1987/1994. Bourdieu, P.: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Bruhn, H./Oerter, R./Rösing, H. (Hg.): Musikpsychologie. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt 1993 Cassirer, E.: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Berlin 1923 (zuerst 1910). Cassirer, E.: Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Darmstadt: WBG 1953 (1923) / 1953 (1924) / 1954 (1929). (PSF) Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Frankfurt/M.: Fischer 1990 (Original: 1944). Dahlhaus, C.: Beiträge zur musikalischen Hermeneutik. Regensburg: Bosse 1975. Danto, A.C.: Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1984. Eagleton, T.: Ästhetik. Die Geschichte ihrer Ideologie. Stuttgart/Weimar: Metzler 1994. Eagleton, T.: Was ist Kultur? München: Beck 2001. Eco, U.: Das offene Kunstwerk. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1972. Eco, U.: Die Grenzen der Interpretation. München: dtv 1995. Enwezor, O. u. a. (Hg.): Documenta 11 - Plattform 5: Ausstellungskatalog. Ostfildern-Ruit: Contz 2002. Erpenbeck, J./Heyse, V.: Die Kompetenzbiographie. Münster: Vaxmann 1999. 169 Document1 15.05.16 Faulstich, W.: Das Medium als Kult. Geschichte der Medien, Bd. 1; Von den Anfängen bis zur Spätantike (8. Jahrhundert). Göttingen: V & R 1997. Faulstich, W.: Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter. 800 - 1400. Geschichte der Medien Bd. 2. Göttingen: V & R 1996. Faulstich, W.: Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Die Medienkultur der frühen Neuzeit (1400 - 1700). Geschichte der Medien Bd. 3. Göttingen: V & R 1998. Frey, G.: Anthropologie der Künste. Freiburg/München 1994. Fuchs, M./Liebald, Chr. (Hg.): Wozu Kulturarbeit? Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik und ihre Evaluierung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Remscheid: BKJ 1995. Fuchs, M.: Kultur lernen. Eine Einführung in die Allgemeine Kulturpädagogik. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ). Remscheid: BKJ 1994. Fuchs, M.: Kultur Macht Politik. Studien zur Bildung und Kultur der Moderne. Remscheid: BKJ 1998. Fuchs, M.: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998. Fuchs, M.: Mensch und Kultur. Anthropologische Grundlagen von Kulturarbeit und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Fuchs, M.: Die Macht der Symbole. Ein Versuch über Kultur, Medien und Subjektivität. Ms. Remscheid 2000. Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Historische und systematische Studien zu ihrer Genese. Leverkusen: Leske + Budrich 2001. Fuchs, M.: Wozu Kunst? 2001. www.akademieremscheid.de/Publikationen Fuchs, M.: Ethik und Kulturarbeit. 2002. www.akademieremscheid.de/Publikationen Fuchs, M.: Tabubrüche. Das Unbehagen an der Zivilisation. Politik und Kultur 2/02, S. 1. Fuchs, M.: Kunst + Politik = Kulturpolitik? In: Politik und Kultur 4/02. Gehlen, A.: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn: Athenäum 1950. Gehlen, A.: Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei. Frankfurt/M.: Klostermann 1986. Gelfert, H.-D.: Im Garten der Kunst. Versuch einer empirischen Ästhetik. Göttingen: V & R 1998. Gethmann-Siefert, A.: Einführung in die Ästhetik. München: Fink 1995. Goleman, D.: Emotionale Intelligenz. München/Wien: Hanser 1996. Goodman, N.: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1990. Goodman, N.: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Gruber G.: Musikalische Hermeneutik im Entwurf. Laaber 1994. Gumbrecht, H. U./Pfeiffer, K. L. (Hg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Hardt, M./Negri, A.: Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt/M./New York: Campus 2002. 170 Document1 15.05.16 Hauser, A.: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München: Beck 1972. Henrich, D./Iser, W. (Hg.): Theorien der Kunst. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1993. Holz, H. H.: Philosophie der bildenden Kunst. Drei Bände. Bielefeld: Aisthesis-Verlag 1996/1997/1998. Holzkamp, K.: Sinnliche Erkenntnis - Historischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnehmung. Frankfurt/M.: 1973³. Holzkamp, K.: Gesellschaftlichkeit des Individuums. Köln: PRV 1978. Holzkamp, K.: Grundlegung der Psychologie. Frankfurt: Campus 1983. Hörisch, J.: Der Sinn der Sinne. Eine Geschichte der Medien. Frankfurt/M.: Eichborn 2001. Jeune, M.: Musik, Kommunikation, Ideologie. Stuttgart: Klett 1987. Jütte, R.: Geschichte der Sinne. München: Beck 2000. Jurt, J.: Das literarische Feld. Das Konzept Pierre Bourdieus in Theorie und Praxis. Darmstadt: WBG 1995. Kern, A./Sonderegger, R. (Hg.): Falsche Gegensätze - Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2002. Kleimann, B.: Das ästhetische Weltverhältnis. Eine Untersuchung der grundlegenden Dimensionen des Ästhetischen. München: Fink 2002. Kleimann, B./Schmücker, R. (Hg.): Wozu Kunst? Die Frage nach ihrer Funktion. Damstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2001. Kossakowski, A. u. a.: Psychologische Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung im pädagogischen Prozeß. Köln: PRV 1977. Kramer, D.: Zwischen Fremdenangst und Neugier. In: Fuchs, M. (Hg.): Kulturelle Identität. Remscheid: RAT 1993. Kuckhermann, R./Wigger-Kösters, A.: Die Waren laufen nicht allein zum Markt... Die Entfaltung von Tätigkeit und Subjektivität. Köln: PRV 1985. Langer, S. K.: Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Mittenwald: Mäander 1979. Leontiew, A.N.: Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit. Köln: PRV 1982. Lock, A./Peters, Ch. (eds.): Handbook of Human Symbolic Evolution. Exford: Clarendon Press 1996. Luhmann, N.: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995. Luhmann, N.: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997. Merten, K./Schmidt, S.J./Weischenberg, S. (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag 1994. Oelmüller, W. (Hg.): Kolloquium Kunst und Philosophie; 3 Bde. (bd. 1: Ästhetische Erfahrung; Bd. 2: Ästhetischer Schein; Bd. 3: Das Kunstwerk). München, Wien, Zürich: Schöningh/UTB 1981, 1982, 1983. Otto, M.: Ästhetische Wertschätzung. Bausteine zu einer Theorie des Ästhetischen. Berlin: Akademie 1993. Paetzold, H.: Ästhetik der neueren Moderne. Sinnlichkeit und Reflexion in der konzeptionellen Kunst der Gegenwart. Stuttgart: Steiner 1990 171 Document1 15.05.16 Pfütze, H.: Form, Ursprung und Gegenwart der Kunst. frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Plessner, H.: Zwischen Philosophie und Gesellschaft. Bern: Francke 1953. Plessner, H.: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin: de Gruyter 1965. Plessner, H.: Philosophische Anthropologie. Lachen und Weinen. Das Lächeln. Anthropologie der Sinne. Frankfurt/M.: S. Fischer 1970. Plessner, H.: Die verspätete Nation. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974. Plessner, H.: Die Frage nach der Conditio humana. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976. Plessner, H.: Gesammelte Schriften, Bd. VII: Ausdruck und menschliche Natur. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1982. Plessner, H.: Gesammelte Schriften, Bd. VIII: Conditio humana. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1983. Plumpe, G.: Ästhetische Kommunikation der Moderne. Bde. 1 + 2. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1993. Reck, H. U.: Grenzziehungen. Ästhetik in aktuellen Kulturtheorien. Würzburg: Königshausen und Neumann 1991. Reck, H. U.: Zugeschriebene Wirklichkeit. Alltagskultur, Design, Kunst, Film und Werbung im Brennpunkt von Medientheorie. Würzburg: Königshausen und Neumann 1994. Reckwitz, A.: Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms. Weilerswist: Velbrück 2000. Roth, G.: Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999. Roth, G.: Fühlen, Denken, Handeln. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001. Ruppert, W.: Der moderne Künstler. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998. Scheer, B.: Einführung in die philosophische Ästhetik. Darmstadt: Primus 1997. Schell, R.: Medienästhetik. Zu Geschichte und Theorie audiovisueller Wahrnehmungsformen. Stuttgart/Weimar 2000. Schiller, F.: Sämtliche Werke, Bd. V: Erzählungen, theoretische Schriften. München: Hanser 1959. Schmidt, V.: Ästhetisches Verhalten. Anthropologische Studien zu einem Grundbegriff der Ästhetik. Stuttgart: Metzler 1997. Schmücker, R.: Was ist Kunst? Eine Grundlegung. München: Fink/UTB 1998. Schneider, N.: Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung zur Postmoderne. Stuttgart: Reclam 1996. Schröder, G./Breuninger, H. (Hg.): Kulturtheorien der Gegenwart. Ansätze und Positionen. Frankfurt/M.: Campus 2001. Schurian, W.: Kunst im Alltag. Psychologische Untersuchungen zur Kunst zwischen Idividuum und Umwelt. Göttingen/Stuttgart: VAP 1991 JYA 122 Seel, M.: Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1991. Seel, M.: Ästhetik des Erscheinens. München/Wien: Hanser 2000. 172 Document1 15.05.16 Selle, G./Boehe, J.: Leben mit den schönen Dingen. Anpassung und Eigensinn im Alltag des Wohnens. Reinbek: Rowohlt 1986. Sieben, G.: Künstlerisches Handeln - ein Modell für die neue Arbeitsrealität? In: Projektinfodienst Kultur und Arbeit 1/November 2000. Bonn/Remscheid. Sousa, R. de: Die Rationalität des Gefühls. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997 (zuerst 1987). Wenzel, H. (hg.): Typus und Individualität im Mittelalter. München: Fink 1983. Wulf, Chr. (Hg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Weinheim/Basel: Beltz 1997. Wulff, E.: Kulturelle Identität als Lebensform und Lebensbewältigung. In: Fuchs 1992. Wygotski, L.S.: Denken und Sprechen. Frankfurt/M.: Fischer 1974. Zima, P. V.: Literarische Ästhetik. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Tübingen: UTB 1991. Zima, P.: Moderne - Postmoderne. Tübingen: Francke/UTB 1997. Zima, P.: Theorie des Subjekts. Subjektivität und Identität zwischen Moderne und 1 Es gibt immer wieder Werke, die das Geschaffene systematisch dem Auge des Betrachters entziehen: durch Eingraben, Einschließen, Verdunkeln etc. Aber auch hier wird offensichtlich die (Nicht-)Wahrnehmbarkeit thematisiert. 2 Siehe etwa das Themenheft „Postmoderne – Eine Bilanz“ des MERKUR, Heft 594/595, Sept./Okt. 1998. 3 Ich stütze mich dabei auf vorangegangene Überlegungen zur Ästhetik und Kunsttheorie in Fuchs 1999, 2000 (Macht der Symbole) und den Aufsatz „Wozu Kunst?“ (zu finden auf der Homepage www.bkj.de, Schlüsselkompetenzen, Texte. 4 Es gibt in unterschiedlichen Disziplinen (u.a. Philosophie, Soziologie, Psychologie) eine Diskussion über die Abgrenzung verwandt klingender Begriffe wie Aktion, Handlung, Tätigkeit, Praxis etc. Ich gehe hier auf dies Unterscheidung nicht ein (siehe auch Abschnitt 5). 5 Hierbei kommt es gelegentlich zu Konkurrenzen über die jeweiligen „Zuständigkeiten“ zwischen Ästhetik als philosophischer Disziplin und den einzelnen Kunstwissenschaften (vgl. Schmücker 1998, S. 9ff). 6 Dies schließt nicht aus, dass Sujet und Inhalt ebenfalls zu Kunstrevolutionen führten: Die Entdeckung des Porträts etwa – gerade von Nichtadligen – in der Renaissance oder die Entdeckung der Armen und Tagelöhner, etwa bei Courbet. 7 Man sollte hier im Auge behalten, dass es neben intendierten Wirkungen (eben „Funktionen“) auch unbeabsichtigte Wirkungen gibt. Der Wirkungsbegriff ist auf alle Fälle weiter als der Funktionsbegriff. 8 In einem eher alltäglichen Sprachgebrauch ist die Rede von der „Sprache der Kunst“ – die zudem international sein soll – durchaus verbreitet. 9 Dieser Gedanke des Freiheitserlebens taucht in vielen Ästhetik-Konzeptionen auf, oft verbunden mit dem Aspekt, „Freiheit“ als zutiefst menschliche Daseinsform zu reklamieren. So findet Martin Seel (2000) in dem Erscheinenden als Gemeinsames aller ästhetischen Objekte dessen Ausgangspunkt für seinen Ästhetik-Entwurf. Und dieses „Erscheinen“ erfassen die Sinne als „genuine Art der menschlichen Weltbegegnung“ (ebd., S. 9). „Die Aufmerksamkeit für das Erscheinende ist so zugleich eine Aufmerksamkeit für uns selbst.“(ebd.) Kunstbegegnung ist daher eine qualifizierte Weise der Selbstbegegnung des Menschen. Im Kunsterlebnis, so die These, erlebt der Mensch insbesondere, wie er eigentlich sein könnte. 10 Es ist bereits an dieser Stelle mit Plessner darauf hinzuweisen, dass diese – wie jede andere – Funktion bzw. Wirkung von Kunst von der Art und Weise abhängt, wie ästhetische Zeichen menschlichen Ausdruck verkörpern, also dass sie es auf spezifisch ästhetische Weise tun: die Form ist entscheidend. 11 Auch dies ist ein klassischer philosophischer Topos, der Erkennen als Zusammenspiel von Wahrnehmung und Reflexion, von Sinnlichkeit und Begriff erklärt. 12 Dass die Sinne insgesamt reflexiv sind, ist eine Erkenntnis der philosophischen Anthropologie Plessners. 13 Dies hat insbesondere der Konstruktivismus immer schon gesagt: von dem Konstruktivismus bei Kant über die Psychologie Piagets, den mathematisch-philosophischen Konstruktivismus der „Erlanger Schule“ (Paul Lorenzen) bis hin zu den verschiedenen Varianten im Anschluss an Maturana (vgl. etwa Merten 1994). 14 Man kann diese Konzentration auf Wissen, seine Herkunft, Gültigkeit und Relevanz als Thema der documenta XI verstehen; vgl. Fuchs 2002 (documenta). 173 Document1 15.05.16 15 Auch hierin drückt sich ein klassisches anthropologisches Gesetz aus: Die Wirksamkeit des Menschen reicht so weit, wie seine (Arbeits-, Erkenntnis- etc.)Mittel reichen. 16 Die Walser–Reich-Ranicki-Debatte hat u. a. auch diese Fassette, dass die Kunstkritik als bloße Vermittlungshilfe von Literatur sich in den Vordergrund schiebt und die eigentlich produktive Tätigkeit des Autors hoffnungslos überlagert. Weitere Facetten werden beleuchtet in meiner Analyse „Tabubrüche“; Fuchs 2002. 17 Die „Logik“ ästhetischer Wertung untersuche ich in Fuchs 1994, S. 41ff; ethisch-moralische Werte sind Gegenstand in Fuchs 2002 (Ethik). Es handelt sich in beiden Fällen von Bewertung um die Anerkennung von Relevanz im Hinblick auf die Interessenslage des Individuums, also um eine Inbeziehungsetzung objektiv vorhandener Eigenschaften des Dinges/Prozesses (soweit sie erkannt werden) mit subjektiven Bedürfnislagen. Vgl. auch Fuchs 2000 (Macht der Symbole), Abschnitt 3.1.2. 18 Zur wiederentdeckten „Materialität der Kommunikation“ nach ihrer virtuellen Auflösung siehe etwa Gumbrecht/Pfeiffer 1995. 19 Es ist sinnvoll, an die Unterscheidung zwischen einer existierenden Realität (das „Ding an sich“ bei Kant) und „Wirklichkeiten“ zu unterscheiden. Letztere konstruiert der Mensch – allerdings nicht willkürlich – mit Hilfe unterschiedlicher symbolischer Formen, so bei Cassirer, so bei den Konstruktivisten und so auch bei Goodman 1990. 174 Document1 15.05.16 Künste wirken – aber wie? Überlegungen zur Evaluation in der Kulturpolitik Die Frage nach der Wirksamkeit ist heute in aller Munde. Medikamente sollten wirksam sein, politische Reformen sollten es sogar nachhaltig sein. Auch für die Künste – zumindest für die Künstlerinnen und Künstler – ist Wirksamkeit durchaus nicht fremd: SchriftstellerInnen sind nicht unempfindlich gegenüber den Verkaufszahlen ihrer Werke, MalerInnen hätten gerne die öffentliche Aufmerksamkeit für ihre neue Gestaltungsweise, SchauspielerInnen und Regisseure mögen ein gespaltenes Verhältnis zur Theater- oder Filmkritik haben: Die Lektüre der vielleicht noch druckfrischen Zeitung vom Morgen nach der Premiere ist trotzdem Pflicht; immerhin auch ein Indikator dafür, dass man wirkungsvoll agiert hat. Obwohl also die Frage nach Wirksamkeit durchaus zum Kunstdiskurs gehört, tut sich die Kulturpolitik insgesamt recht schwer mit Fragen der Evaluation. Dabei ist es nicht nur die Frage danach, wie eine solche Evaluation stattfinden könnte, die mehr ist als die Diskussion von Einschaltquoten, Platzauslastung oder Auflagenhöhe: Es ist of genug die These, dass die Frage nach Wirkungen oder sogar Funktionen der Kunst insofern zu nahe tritt, als man ihre „Autonomie“ gefährdet sieht. Kunst sei das Nichtgreifbare, das Unbeschreibliche, und jeder Versuch, etwas genauer wissen zu wollen, wozu denn Kunst überhaupt gut sei, ist ein Sakrileg. Das Problem für die Kulturpolitik besteht heute darin, dass man im politischen Streit über Fördermittel immer weniger Rücksicht auf diese Empfindlichkeit nimmt. Nun bin ich außerdem der Meinung, dass unter dem Signum der Kunstautonomie sich zwar zum einen die guten Gründe noch verbergen, die Immanuel Kant seiner Zeit dazu veranlasst haben, von einer „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ in Hinblick auf die Künste zu sprechen und damit philosophisch die These von der Autonomie der Künste begründet zu haben. Zum anderen versteckt sich jedoch eine Menge an Geschichtsblindheit und bisweilen sogar Denkfaulheit hinter dem vorgeschobenen Argument, die Frage nach Wirkungen verletze die Kunstautonomie. Daher in einigen groben Strichen eine Skizze der historischen Entwicklung. Bereits Friedrich Schiller nutzte die Vermutung, im Bereich einer künstlerisch-ästhetischen Praxis sei („autonom“, also wörtlich „selbstgesetzgebend“) Freiheit so zu erleben, dass man auf diese dann auch bei der politischen Gestaltung des Gemeinwesens nicht mehr darauf verzichten könne und entsprechende politische Reformen vorantreibt. Die Loslösung aus der (schlechten) Gesellschaft war 175 Document1 15.05.16 also Bedingung für eine politisch-emanzipatorische Hoffnung in die („autonome“) Kunst. Offenbar ist diese Dialektik schwer zu verstehen: Dass gerade das scheinbar Unpolitische an der Kunst höchste politische Bedeutung hat. Die freiheitlich-demokratische Organisation der Gesellschaft ließ bekanntlich im 19. Jahrhundert in Deutschland auf sich warten. Als Ersatz für eine fehlende politische Partizipation schuf sich das Bürgertum mit dem Aufbau eines dichten Netzes von Kunsteinrichtungen (Konzerthäusern, Theatern, Museen, aber auch entsprechend gestalteten öffentlichen Orten in den Gemeinden) die Möglichkeit zur Einwicklung einer eigenen Identität. Der Kunstbetrieb rund um ein Verständnis von „autonomer“ Kunst, rund um die inzwischen geadelte „Weimarer Klassik“ leistete dies. In seinen imponierenden drei Bänden zur Geschichte des 19. Jahrhunderts hat der Historiker Thomas Nipperdey diese Rolle des sich entwickelnden Kunstbetriebes ausführlich beschrieben. Erstaunlich ist, wie sich trotz dieser leicht zugänglichen Empirie die undifferenzierte Ideologie der „Kunstautonomie“ hat so halten können, dass bis heute Denkverbote in Sachen Wirksamkeit ausgesprochen werden. Der Begriff der „Kunst“ war und ist in Deutschland – auch im internationalen Vergleich – Teil des berühmt-berüchtigten Sonderwegsbewusstseins. Die Entwicklung eines spezifischen Bildes eines „Künstlers“, der all diese Hoffnungen und Enttäuschungen des Bürgers hat tragen müssen, gehört zu dieser These einer Autonomie der Kunst ausdrücklich dazu (vgl. W. Ruppert, Der moderne Künstler, Frankfurt 1998). Damit soll – um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen – nunmehr nicht aus Kunst ein Nachrichtenbulletin, ein Instrument politischer Agitation gemacht werden. Im pädagogischen Gebrauch der Künste weiß man es besser: Der Eigensinn der Künste, das SichEinlassen auf das Ästhetisch-Gestalterische ist die zentrale Ursache für die bildende Kraft von Kunst, für ihre pädagogische Wirksamkeit also. Vermutlich liegt es an dieser Einsicht, dass es in der Pädagogik inzwischen gelungen ist, die Frage der (Bildungs-)Wirksamkeit der Künste auch empirisch aufzugreifen. Dieses war allerdings auch dringend nötig, da die methodisch hochentwickelten Evaluierungsverfahren – etwa im Kontext der PISA-Studien – auch für die Evaluation eines Umgangs mit Künsten eine Herausforderung darstellen. Eine solche empirische Zugangsweise gelingt allerdings nur dann, wenn man den zu untersuchenden „Gegenstand“ (Bildung, Kunst) nicht auf ein solch hohes theoretisches Podest stellt, dass man mit alltagstauglichen Methoden kaum noch heranreicht. In Deutschland ist dies besonders schwierig, wie schon der renommierte Friedensforscher Johann Galtung bei seiner Unterscheidung unterschiedlicher nationaler intellektueller Stile festgestellt hat: Der „teutonische Stil“ liebt hochabstrakte Begriffe, von denen aus dann in kleinschrittiger Ableitung der Weg in die Praxis gesucht – und oft genug verfehlt wird. Sehr viel pragmatischer ist der angelsächsische Stil, 176 Document1 15.05.16 der sich behutsam und schrittweise – und dabei durchaus theoriegeleitet – auch komplexe Zusammenhänge von der Praxis aus schrittweise erschließt. Daher ist es kein Wunder, dass – neben den schon klassischen Studien von Pierre Bourdieu – die vermutlich ergiebigste empirische Studie zur Wirkung der Künste in die Gesellschaft aus Großbritannien kommt (F. Matarosso: Use or Ornament. The Social Impact of Participation in the Arts. Comedia 1997/2000). Mit allen zulässigen (quantitativen und qualitativen) empirischen Methoden werden kulturpolitische Strategien evaluiert, wobei ein eindrucksvoller Katalog von 50 (!) Wirkungen als nachgewiesen gilt. Diese Wirkungen werden u. a. unter die Rubriken „Persönliche Entwicklung“, „Soziale Kohäsion“, „Community Empowerment“, „lokale Identität“ u. a. subsumiert. Eine solche Evaluierung ist natürlich auch in Deutschland möglich und wurde in Ansätzen auch bereits durchgeführt. (Ein Überblick findet sich in Fuchs/Liebald (Hg.): Wozu Kulturarbeit? BKJ 1995). Es ist denkbar, die Auswirkung einzelner Gesetze (in den USA ist die Evaluation aller verabschiedeten Gesetzte verbunden mit einer zeitlichen Befristung längst Usus), einzelner Förderprogramme, kulturpolitischer Strategien – und dies auf allen Ebenen des Staates – ebenfalls auf diese Weise zu überprüfen. Eine Ängstlichkeit im Kulturbereich müsste m. E. nicht gegeben sein, da – wie die englische Studie zeigt – sich durchaus eine Fülle unserer oft arg vollmundig vorgetragenen Wirkungsbehauptungen im Grundsatz bestätigen. Kulturpolitisch bedeutete jedoch ein solcher Paradigmenwechsel weg von bloßer Behauptung hin zur überprüfbaren Wirkungsdiskussion einen erheblichen Rationalitätsgewinn, was vielleicht für die Künste weniger relevant ist, für die (Kultur-)Politik allerdings einen Professionalisierungsschub bedeuten würde. Hinweis: Neben den im Text angegebenen Titeln verweise ich auf meine Skizze „Die Formung des Menschen“ (enthält die Liste der 50 Wirkungen aus der englischen Studie) und auf den Text „Kulturfunktionen der Künste“ auf der Homepage des Kulturrates (www.kulturrat.de) mit zahlreichen weiteren Literaturangaben zur Wirkung von Kunst und zur Evaluierbarkeit von Kultur(politik). 177 Document1 15.05.16 TEIL 2: BERICHTE, REZENSIONEN, KONTEXTE September 2002 Kunst + Politik = Kulturpolitik? Herausforderungen der documenta XI für die aktuelle Politik Die Bewertung der documenta XI ist äußerst widersprüchlich: Für die einen ist diese documenta der Beleg für den Niedergang der Bildenden Kunst. Während man trefflich in der Literatur über Martin Walser oder in der verwandten Architektur über die Neuerrichtung des Stadtschlosses in Berlin streitet und dabei sehr viel Kluges und weniger Kluges über das Verhältnis von Kunst, Gesellschaft und Politik austauscht, scheint diese documenta der Beleg für die gesellschaftliche Unwirksamkeit von Kunst zu sein. Das mag überraschen. Denn noch nie hat sich seit der legendären documenta V die Kunst so sehr gesellschaftlichen Fragen geöffnet. Man betrachte nur einmal die Zentralbegriffe der fünf Plattformen (vier große Diskussionsveranstaltungen weltweit und die Ausstellung in Kassel als 5. Plattform). Es fehlt kaum etwas, was eine kritische Gesellschaftsanalyse, Kulturtheorie und Politik heute diskutieren: Demokratie als unvollendeter Prozess, Rechtssysteme, Kreolisierung, Kolonialisierung und Postkolonialismus, Diaspora und Vertreibung, Xenophobie, Euro- und Androzentrierung und natürlich als großer Rahmen die Globalisierung. Genau, sagen die Kritiker. Die documenta sei zu einem „Sachbuch mit Abbildungsteil“ (so Hanno Rauterberg in der ZEIT vom 13.06.2002) oder zu einem „sozialen Archiv“ (Ingo Arend im FREITAG 38 vom 13.09.02) verkommen. Sie stelle sich als Bebilderung der internationalen Antiglobalisierungsbewegung Attac dar, bei der der Besucher letztlich lieber zu dem angebotenen Eis (wahlweise aus Meer-, Brack- oder Süßwasser, auch eine Kunstaktion) greift und an der Fulda entlangschlendert: man wolle ja schließlich auch mal was Schönes sehen, so der Kasseler Hochschullehrer Rolf Lobeck in FREITAG vom 09.08.2002. Aus der Sicht der Kulturpolitik müssen die verschiedenen Rezeptionsformen und Lesarten interessieren, die gerade diese documenta ermöglicht. Geht es hier doch nicht nur um eines 178 Document1 15.05.16 der größten und traditionsreichsten bildkünstlerischen Ereignisse weltweit zumindest im Hinblick auf Trends, Selbstverständnis und Entwicklungen: Immerhin hatte bislang jede documenta eine große Definitionsmacht darüber, was jeweils „Kunst“ bedeutet. Insbesondere wurde in Kassel immer schon verhandelt, ob und wie Kunst die Kulturfunktionen der Deutung der Lebenswirklichkeit, der Präsentation von Sicht- und Bewertungsweisen menschlicher Lebensbedingungen wahrnehmen will und kann. Denn dieser ganz traditionellen Aufgabe von Kunst, Mittel der Selbstreflexion des Menschen zu sein, fühlt sich der künstlerische Leiter – bei allem Respekt vor ihrer Schwierigkeit – Okwui Enwezor verpflichtet. So schreibt er im Vorwort des 620 Seiten umfassenden, drei Kilogramm schweren Katalogs: „Fünfzig Jahre nach ihrer Gründung sieht die documenta sich erneut mit den Gespenstern einer unruhigen Zeit fortwährender kultureller, gesellschaftlicher und politischer Konflikte, Veränderungen, Übergänge, Umbrüche und globaler Konsolidierungen konfrontiert. Wenn wir diese Ereignisse in ihrer weitreichenden historischen Bedeutung bedenken und ebenso die Kräfte, die gegenwärtig die Wertvorstellungen und Anschauungen unserer Welt gestalten, wird uns gewahr, wie schwierig und heikel die Aussicht der aktuellen Kunst und ihre Position bei der Erarbeitung und Entwicklung von Interpretationsmodellen für die verschiedenen Aspekte heutiger Vorstellungswelten sind.“ Hier äußert sich also eine gewisse Skepsis, ob und wie Kunst heute überhaupt noch in dieser Hinsicht funktionieren kann. Diese documenta wird so zu einem praktischen Forschungsprojekt über Begriffe und Möglichkeiten von Kunst in der heutigen Welt. Für eine Kulturpolitik, die sich in den neunziger Jahren zu großen Teilen als Spezialdisziplin der Betriebswirtschaftslehre verstanden hat, ist eine solche Ambition durchaus ein Schlag ins Gesicht, wird sie doch auf diese Weise von KünstlerInnen und KuratorInnen daran erinnert, dass eine Kunst- und Kulturpolitik, die sich nur noch für die Optimierung der rechtlichen Rahmenbedingungen, der politischen Akzeptanz und des ökonomischen Erfolgs interessiert, den Kontakt zu ihrem genuinen Gegenstand verloren hat – und damit letztlich die Legitimität ihres Arbeitsgegenstandes aufs Spiel setzt. Aber auch eine Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik muss zur Kenntnis nehmen, dass die KünstlerInnen nicht unbedingt auf die Kulturpolitik warten, wenn es um die Selbstvergewisserung in dieser Welt geht. Denn diese documenta präsentiert nicht bloß umfassend „Weltkunst“ im Sinne einer Kunstproduktion aus allen Teilen der Welt, sie zeigt sich zudem unglaublich informiert darüber, welche Theorieangebote zum Verständnis der aktuellen Weltlage in verschiedenen Disziplinen gemacht werden. So mag man intensiv weiter diskutieren, welchen Ertrag diese documenta für die Kunstentwick179 Document1 15.05.16 lung hat: Für die Kulturpolitik ist sie in jedem Fall ein Lehrstück und ein Erprobungsfeld für die eigene Relevanz, denn sie setzt Maßstäbe dafür, wie man nicht nur künstlerisch, sondern auch theoretisch die Auseinandersetzung über die eigene Rolle in der Welt wahrnimmt. Man kann etwa gerade in Deutschland von ihr lernen, dass Gesellschafts- und Kulturdiskurse sowohl wissenschaftlich als auch in den Künsten selbst nicht mehr national geführt werden können (vgl. meinen Beitrag „culture unlimited“ in PuK, Ausgabe 2/02). Dies sagt sich leicht und dies mag man als inzwischen verbreitete Allerweltserkenntnis abtun. Doch zeigen die Ausstellungsobjekte mit Eindringlichkeit, was eine imperialistische Kulturpolitik im Gefolge der Kolonialisierung angerichtet hat – und welche produktiven Strategien es seitens der unterdrückten Kulturen gegeben hat, ein Stück weit sich selber behaupten zu können. Hierbei ist einer der Zentralbegriffe dieser documenta – inzwischen auch ein wichtiger Begriff in einer Kulturtheorie, die nicht aus der Sicht des reichen Westens betrieben wird – ausgesprochen ergiebig: Postkolonialität. Gerade die Perspektiven der WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen aus ehemaligen Kolonien, ihre Suche nach einer eigenen Identität und Sprache angesichts einer brutalen Unterdrückung durch die Kolonialmächte scheint ein gutes Rüstzeug für solche Diskurse zu liefern die wir heute führen müssen, wenn es um die Bewältigung der kulturellen Globalisierung geht. Denn hierbei ist es gut möglich, dass aus ehemaligen Tätern nunmehr Opfer geworden sind, die dankbar Widerstandsstrategien der ehemaligen Opfer übernehmen können. Es geht heute um die Bewältigung einer unvermeidlichen Globalisierung, die die Frage nach dem Lokalen auch als Frage nach kultureller Identität, Heimat, Lebensweise und Tradition stellt. Der Kampf um kulturelle Identität ist heute ein weltweiter Kampf gegen neue Kolonialisierungstendenzen, die mit der Globalisierung verbunden sind und die heute auch die ehemaligen Kolonialmächte betreffen. Hierbei haben die Menschen aus den ehemaligen Kolonien einen Denkvorsprung von einigen Jahrzehnten, der produktiv von allen anderen genutzt werden kann, wenn man etwa fragt: Wie vergewissert man sich seiner selbst, wie sichert man vorhandene, vielleicht von Zerstörung bedrohte Wissensbestände? Damit könnte auch ein Ausweg aus einer Krise des westlichen Selbstbewusstseins gesehen werden, das inzwischen heftig an dem Widerspruch zwischen seiner expansiven Machtbestrebung und der – am heftigsten am 11. 9. 2001 erlebten – Machtlosigkeit leidet. Das Unbehagen an der Zivilisation, das gelegentlich reaktionäre Blüten treibt (vgl. meinen Artikel „Tabubrüche“ in PuK 3/02, S. 1) könnte in den Kunstwerken und den Theorieangeboten der documenta Verständnishilfen finden, die die westliche „Angst vor der Ohnmacht“ (so der Psychoanalytiker HorstEberhard Richter in seinem letzten Buch) nehmen kann. 180 Document1 15.05.16 Eine ganze Reihe von Kunstwerken und Ausstellungsobjekten der documenta setzt sich mit solchen Fragen auseinander, und es ist kein Wunder, dass in Berichten über Kassel immer wieder dieselben Namen fallen. George Adiagbo aus Benin zeigt etwa sein persönliches Lebensarchiv, in dem eine scheinbar wilde Mixtur kultureller, auch und vor allem kulturindustrieller Artefakte rund um seinen Einbaum angeordnet sind. Frédéric Bruly Bouabré, der sich selbst Cheik Nadro – der, der nicht vergisst – nennt, ist gleich mit aberhunderten postkartengroßen Piktografien vertreten, in denen er Figuren und Bilder von Dingen des Alltagslebens und der Mythologie mit ihren französischen Bezeichnungen, aber auch mit gefundenen und erfundenen Sprachzeichen versieht. Er schafft so ein kulturelles Gedächtnis, das – ähnlich wie bebilderte Wörterbücher – Verbindungen zwischen ganz unterschiedlichen Sprachformen und Zeichensystemen herstellt. Systematisch und enzyklopädisch sind auch die Werke westlicher KünstlerInnen: Die fast manisch anmutenden codierten Archive der Hanne Darboven, die geradezu im Zentrum der documenta stehen und zu denen es regelmäßig Konzerte mit ausgeklügelt strengen Vertonungen dieser codierten Systeme gibt. Wie tragfähig sind unsere Wissenssysteme, wie leistungsfähig sind die Bild- und Schriftsprachen, wenn es um Bewahrung, Weitergabe und Entwicklung von Wissen geht? Viele Antworten sind geradezu post-postmodern: nicht mehr die Ästhetik als das völlig „Andere der Vernunft“, aber gerade auch keine bloße Rückkehr zu dem Fortschrittsoptimismus der Moderne. Denn „Moderne“ heißt globaler Kapitalismus, heißt ausgeklügelte Überwachungssysteme, heißt Gleichschaltung der Sinne. Zu all diesem gibt es eindringliche Kunstwerke, die auch bei Vorwarnung unter die Haut gehen. Bemerkenswert ist jedoch die Aufrechterhaltung einiger Prinzipien der frühen Moderne: das Enzyklopädische und Systematische etwa. Es geht in vielen Kunstwerken um Ordnung, sicherlich auch um die Ambivalenz einer aufgezwungenen Ordnung als menschenfeindlicher Macht, aber auch um die anthropologische Notwendigkeit von Ordnung für den Menschen, zur Strukturierung seines Lebens und seiner Welt. So wird diese documenta zwar zu einem eindrucksvollen Beleg für die „Ambivalenz der Moderne“ (Z. Bauman), für ihre zivilisatorischen Errungenschaften ebenso wie für die subtilen Unterdrückungssysteme, die sie mit sich gebracht hat. Sie ist keineswegs bloß antikapitalistisch, antimodernistisch oder Teil einer Antiglobalisierungsbewegung. Man spürt vielmehr das Ringen um die Möglichkeit einer menschlichen politischen Ordnung, wobei man weiß, dass es ein einfaches Zurück nicht geben wird. Dies zeigt sich bei den Kuratoren etwa an dem gemeinsamen Bezug auf die Analyse der „neuen Weltordnung“, die Hardt/Negri in ihrem Buch „Empire“ vorgelegt haben. Präzise wird dort verfolgt, welchen Weg die Entwicklung der politischen Machtausübung gegangen ist in – durchaus spannungsvoller – Beziehung zur Ent181 Document1 15.05.16 wicklung der Ökonomie. Vielleicht sind die Ansätze einer neuen (politischen) Weltordnung in Zeiten der Globalisierung schon erkennbar. Die Kunstobjekte der documenta beanspruchen nicht, solche Visionen aufzuzeigen. Wohl aber setzen sie sich mit unseren Möglichkeiten auseinander, vernünftige Visionen zu entwickeln. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wissen. Kunst will Wissen über Wissen, vermeintliches Wissen und Nichtwissen liefern. Künstlerinnen und Künstler zeigen dies auf dieser documenta mit großer Eindringlichkeit. Denn Wissen schafft Orientierung in der Welt – doch wie weiß ich, was Wissen ist und woher es kommt? Die Sinne als Quelle des Wissens lügen, so sagte es schon der Maler Georges Braque am Ende des 19. Jahrhunderts und markierte das Ende der gegenständlichen Malerei. Dieser Topos des Lügens, die Thematisierung von Wahrheit in Repräsentationen und Darstellungen findet sich als massive Kritik am „Retinalen“, also am Sehen und Sichtbaren etwa in den Überlegungen des Kurators Sarat Maharaj in seinem Katalogbeitrag. Die alten und neuen technischen Medien, überall präsent auf der Ausstellung, lügen sicherlich noch mehr. Wie kann man angesichts dieses notwendigen Misstrauens gegenüber den Sinnen überhaupt noch Leben dokumentieren, Ereignisse zeigen, Probleme zur Anschauung bringen? Die Künste konnten der Wirksamkeit ihrer Methoden noch nie so unsicher sein wie heute, da die Sinne vielfach verstellt sind. Nicht nur die Augen werden manipuliert, auch Ohren, Nase, Tastgefühl. Eine Konsequenz ist es für KünstlerInnen, sich zu den Menschen selbst zu begeben, mit ihnen eine Zeit lang zusammen zu leben, ihre Lebenswelt zu teilen, so wie es als Teilprojekt der documenta der Schweizer Thomas Hirschhorn im Kasseler Norden gemacht hat. Und trotz der unaufhebbaren Unsicherheit ist Wissen notwendig. Eine produktive Konfrontation von unterschiedlichen Wissensformen bietet diese documenta insgesamt: vier vorangegangene Theoriesymposien in unterschiedlichen Weltregionen, quasi völlig ohne Kunst, eine wuchtige Kunstausstellung und ein Katalog, der in den Theoriebeiträgen der KuratorInnen und weiteren Mitstreitern kaum Wünsche und Ansprüche offenlässt. Es ist also auch ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Wissensformen, bei dem Wissenschafts- und Alltagswissen, Wissen aus verschiedenen Teilen der Welt, altes und neues Wissen miteinander konkurrieren. Postkolonialität, Kreolität, kulturelle Identität sind schwierige abstrakte Begriffe. Sie sind jedoch auch mit Händen und Sinnen erfassbare Lebenswirklichkeiten. Die Werke der documenta zerstören sicherlich immer wieder Gewissheiten – das wollte auch die Postmoderne. Sie wollen auch immer wieder neue Gewissheiten schaffen. An dieser Stelle geht die documenta über die bloß destruktive Dimension der Postmoderne hinaus. Diese documenta ist ein Frontalangriff auf Sinne und Intellekt – sofern man sich darauf einlässt. Denn dies ist – auch kulturpolitisch – bedeutsam: Kunst entsteht letztlich durch den Be182 Document1 15.05.16 trachter und seine Rezeption. Dies ist auch ein Thema der KuratorInnen und der KünstlerInnen. Kein Wunder also, dass die Klassiker dieser Auffassung von Kunst bzw. der radikalen Infragestellung des Kunstbegriffs insgesamt, also etwa Walter Benjamin bzw. Marcel Duchamp – zu den am meisten zitierten Autoren/Künstlern gehören. Enwezor wollte die Dominanz des Westens im Kunstbetrieb sprengen. Künstlerinnen und Künstler aus Asien, Afrika und Südamerika nehmen daher einen großen Raum ein. Gezeigt und betrachtet wird deren Kunst jedoch in den Strukturen der documenta, in Kassel, in einem westlichen Land – und dies überwiegend von einem Publikum, das nicht zum ersten Mal auf einer documenta ist. Eine theoretische Grundlage dafür, dass sich eine Kultur dann entwickelt, wenn man ihr einen quasi neutralen „dritten Raum“ zur Verfügung stellt, finden die Kuratoren in der Kulturtheorie von Homi K. Bhabha (The Location of Culture). Es gibt allerdings auch gute Gründe für die Annahme, dass der antikolonialistische Impetus gescheitert ist, dass es nunmehr, wie Rauterberg schreibt, zum Karriereziel auch von Künstlern aus Lagos und Neu-Dehli geworden ist, zur documenta eingeladen zu werden. Die Form und der dann doch nicht neutrale Ort scheinen hier den Inhalt zu besiegen. Doch auch dann wäre die documenta insgesamt nicht gescheitert, sondern könnte dazu dienen, die Kulturpolitik aus ihrem Dornröschenschlaf mit ihrem Bezug auf Verständnisweisen von „Kultur“, „Nation“ oder „Politik“, die schon längst ihre frühere Relevanz und Bedeutung verloren haben, zu wecken. 183 Document1 15.05.16 Auf der Suche nach der verlorenen Poesie Ein kulturpolitischer Streifzug durch die documenta XII Kann man überhaupt noch Neues über die documenta XII schreiben? Inzwischen wurde sie in jedem großen und kleinen Feuilleton und in wichtigen Diskussionsrunden im Fernsehen analysiert, kommentiert, kritisiert, gelegentlich sogar gelobt. Die documenta ist offensichtlich ein Medienereignis, und dies nicht nur für das gehobene Feuilleton. Natürlich gehören größere und kleine Skandale zu einem solchen Event dazu. Die Lokalpresse ereifert sich etwa über pornographische Darstellungen in großformatigen Bildern. Ebenfalls eher lokal war auch die vermutlich versehentliche Entfernung der Kreuzmotive einer chilenischen Künstlerin auf Kasseler Straßen bereits bei Beginn der Ausstellung durch die Straßenreinigung. Überregional kommentiert wurden dagegen die missglückten Aktionen mit den nicht zustande gekommenen Mohnfeldern vor dem Fridericianum, die weggeschwemmten Reisfelder zusammen mit den daher arbeitlosen 1001 Chinesen oder der zusammengebrochene Pavillon von Wei Wei. Ins Gerede gekommen ist diese documenta daher oft nicht so sehr über die künstlerischen Inhalte, sondern wegen eines schlechten Managements. Zu wenig Verzahnung mit der Stadt, so ein Vorwurf. Denn dort hätte man durchaus botanischen Sachverstand gefunden, der aus den jetzt nur sehr vereinzelt zu findenden Mohnblumen vielleicht doch das gewünschte Blumenmeer hätte entstehen lassen können. Dabei ist die documenta gut integriert in diese Stadt. Die Atmosphäre ist geprägt von den zahlreichen, zu einem großen Teil internationalen Gästen, die zwischen den über das Stadtgebiet verteilten Ausstellungsorten schlendern. Die Kasseler selber scheinen allerdings eher distanziert als erfreut zu sein, ganz anders als etwa bei dem Weltkindertheaterfestival in Lingen. Dort kann man es erleben, dass man von Menschen gefahren wird, die ihren Jahresurlaub völlig in den Dienst des Festivals stellen, die mit sichtbarem Stolz von einzelnen Aufführungen und Erlebnissen berichten. Woran liegt es? Ist die documenta zu groß, zu abgehoben, zu weit weg vom Leben der Menschen? Deutschland ist dabei ein guter Ort für solche Großveranstaltungen: 1288 Galerien, 6500 Museen mit über 100 Millionen Besuchern. Die documenta XII ist zudem schon deshalb bürgernah, weil sie – so hat es der Kunsthistoriker Beat Wyss in der Süddeutschen Zeitung festgestellt – wieder deutsch spricht. Man erinnere sich an die letzte documenta (siehe meinen Artikel Kunst + Politik = Kulturpolitik?, PuK 4/2002) und die internationale Gruppe von Kurato184 Document1 15.05.16 ren unter Leitung von Okwui Enwezor. Die documenta-Sprache war Englisch. Die Ausstellung in Kassel war seinerzeit lediglich ‚Plattform 5’, nachdem die vorangegangenen vier Plattformen in Neu-Delhi (Thema Rechtssystem), St. Lucia (Thema Créolité), Lagos (Situation afrikanischer Städte) und Wien/Berlin (Demokratie) alle möglichen Weltthemen in Form von Symposien abgehandelt haben. Politisch wollte sie sein, der Anspruch auf Anerkennung nicht-westlicher Kunst war ein wichtiges Ziel. Kennengelernt hat man in Deutschland als seinerzeit neueste kulturtheoretische Welle den postcolonialen Diskurs. Die documenta wollte vor fünf Jahren nicht nur politisch verstanden werden, sie wollte quasi Politik in deren ureigensten Anliegen überholen. Das war gut gemeint, scheiterte jedoch bereits in ihrem künstlerischen Kern. Denn Hanno Rautenberg stellte zurecht in der ZEIT die Frage, ob ein documenta-Künstler aus Asien oder Afrika, der seinen Wohn- und Arbeitsplatz in eine der westlichen Metropolen wie New York, Paris, London oder Berlin verlegt hat, wirklich zur gewünschten Anerkennung der Kunst aus der Dritten Welt diente oder ob er nicht vielmehr auf diese Weise selbst in das System des westlichen Kunstmarktes integriert wurde. In dieser Form wollte die jetzige documenta XII nicht politisch sein, obwohl die Leitfragen und -themen natürlich auf der Höhe der gesellschaftlichen Diskurse sind: Ist die Moderne unsere Antike? Was ist das bloße Leben? Was sollte ästhetische Bildung leisten? Die documenta XI also als missglücktes Lehrstück in politischer Bildung, die documenta XII dagegen als Wiederentdeckung der genuinen Kräfte der Künste? So einfach ist es nun allerdings nicht. Bei der letzten documenta blieben viele Ausstellungsobjekte im Gedächtnis: der Film aus Persien etwa, bei dem eine Frau allmählich mit einem Baum verschmilzt; die penibel dokumentierten Erinnerungsstücke eines afrikanischen Künstlers; zarte Architekturvorschläge für Städtebauvisionen der Zukunft. Die seinerzeitigen theorie- und kopflastigen ‚Plattformen’ sind zwar gut dokumentiert in einigen Kilos an Büchern, doch werden sie wirklich gelesen? Fast scheint es, als ob sich die Eigenlogik der Kunst gegen das politische Aufklärungsinteresse der Kuratoren von fünf Jahren durchgesetzt hätte. Und heute? Große Erwartungen richteten sich auf den Aue-Pavillion. Feststellen musste man jedoch, dass jede beliebige Industriehalle einen größeren Charme hat. Die missglückten Außeninstallationen wurden schon erwähnt. Eine Wiederkehr der Malerei war angekündigt. Bei meinem Besuch gab es die höchsten Besuchertrauben an dem kleinen Bild von Gerhard Richter, einem der wenigen ‚großen Namen’. Ich erinnere mich an endlose Fotoserien. Eine Kritik an der Digitalfotographie besteht heute darin, dass nicht mehr sorgfältig ausgewählt werden muss, was man fotografiert, weil die Entwicklung des Films nichts mehr kostet. Gleich bei mehreren Ausstellungsobjekten konnte man die Richtigkeit dieser Kritik bestätigt sehen: Endlose Serien immer gleicher Motive. Na185 Document1 15.05.16 türlich haben sich – sicherlich individuell verschieden – Bilder eingeprägt. Das Kanisterschiff im Aue-Pavillion etwa. Oder das Ensemble von Kleidungsstücken, die an Seilen befestigt sind und in die sich mühsam TänzerInnen unter der Anleitung der Choreographin Trisha Brown hineinquälen. Ein gigantisches Trampolin, das nicht die Schwerkraft überwinden hilft, sondern im Gegenteil die Menschen über ihre Kleidung ankettet. Ebenfalls von einer Tänzerin, nämlich von Iole des Freitas, stammt das vielleicht beschwingteste Objekt gleich im Raum daneben: Große Plastikbahnen, die an Edelstahlrohren den Raum durchmessen, eine Art Achterbahn, die sich geschickt durch die Wände den Weg ins Freie bahnt. Ein weiteres Objekt: Ein rotes Seil, das sich spielerisch im Raume schlängelt. Kunst und ihre Präsentation können gar nicht scheitern, denn selbst im Misslingen stecken Botschaften, so ähnlich hat der Kurator einige Fehlschläge und Fehlplanungen kommentiert. Wäre dies so, dann könnte man sich jede Debatte über Kunst und ihre Qualität sparen. Doch unterschätzt diese These die Rolle der Ausstellungsmacher, die gut oder schlecht organisieren können, die für den Beleg ihrer Thesen passende oder unpassende KünstlerInnen ausgewählt haben. So kann man durchaus fragen, ob in der Formulierung der drei bedeutungsschweren Leitprinzipien nicht doch eine gewisse Beliebigkeit steckt, obwohl die Buergel-Maschine im Internet sicherlich freundlich-boshaft einige gute Deutungsangebote liefern würde. Kunst ist eine spezifische Verbindung von Sinnlichkeit und Reflexion, die – und auch dies ist eine Tradition der documenta – für ihre Freiheit, auch und gerade gegenüber dem Markt kämpft. Kann dies gelingen? Beat Wyss ist (in seinem oben bereits zitierten Beitrag) skeptisch. Die größte Konkurrenz der documenta als öffentlich geförderter Ausstellung ist nicht eine andere Ausstellung, sondern sind die Kunstmessen. Ist die documenta XII mit 113 KünstlerInnen nicht klein: Bei der Art Basel sind es immerhin 2000 KünstlerInnen gewesen. Die documenta XII fungiert hier als Karrieresprungbrett. So hat Thomas Hirschhorn sein Denkmal für Georges Bataille 2002 noch in einer Außenstelle in Kassel montiert, dieses Jahr war er der Star in Basel. Der Markt ist überall, auch dort, wo sich die Werke explizit gegen ihn und seine Dominanz richten. Heißt Kulturpolitik, nunmehr zu kapitulieren oder sich bestenfalls um Foren für solche Künstler zu kümmern, die noch nicht im Markt angekommen sind? Trotz dieser eher kritischen Bewertung gibt es einige sehr gute politische Gründe für eine öffentliche Förderung der documenta als einzigartiger Kunstausstellung. 1. Die Breite und Intensität der öffentlichen Debatte zeigt, wie sehr das Ziel eines Diskurses über Kunst, aber auch über die Fragen, mit denen sich Kunst auseinandersetzt, erreicht wird. An dieser Debatte beteiligen sich nicht nur viele Medien und Fachleute, an ihr parti186 Document1 15.05.16 zipieren auch viele Besucher und solche Menschen, die einen Besuch nicht realisieren können. Kunst ist Diskurs über Lebensweisen, dies zeigt auch diese documenta, und Kulturpolitik ist der Versuch, solche Diskurse in Breite und Tiefe anzuregen. 2. Kunst wird heute kaum noch über ihr ‚Wesen’ definiert. Vielmehr hat sich die Kunsttheorie in den letzten Jahrzehnten – nicht zuletzt aufgrund des Scheiterns solcher ‚Wesens’Definitionen spätestens seit den ready-mades von Duchamps – auf die Definition von A. Danto geeinigt, derzufolge Kunst das ist, was ein bestimmter Kreis von Menschen dafür hält. Diese Begriffsbestimmung ist dabei sehr viel weniger beliebig, als es zunächst klingt. Denn der angesprochene Kreis, der über die Definitionsmacht verfügt, ist eine heterogene Gruppe von Künstlern, Hochschullehrern, Kunsttheoretikern, Journalisten, Galeristen, Kunstsammlern, Museumsmenschen und Ausstellungsmachern. Events wie die documenta spielen in diesem fortlaufenden Prozess einer diskursiven Abklärung über das jeweils gültige Kunstverständnis eine wichtige Rolle. Es werden dabei nicht nur Preise für Kunstwerke festgelegt – dies sicherlich auch, da Kunst eben auch ein Markt ist –, es wird auch der Wert der Werke verhandelt. 3. Weil dies so ist, ist es gut, dass es neben den Museen nichtkommerzielle Räume gibt, damit Werte (und durchaus auch Preise) in einem quasi geschützten Raum ausgehandelt werden können. Die documenta (und vergleichbare Ausstellungen) stellen geschützte Räume dar, die die Kunst und die Künstler brauchen. 4. Groß-Ausstellungen sind zudem soziale Events. Sie sind Teil einer Stadtpolitik, die geschickt bei ihrer Entwicklung die Attraktivität des Kunstereignisses nutzen können. Dies ist legitim und steht nicht im Gegensatz zur obigen Schutzthese. 5. Großausstellungen sind zudem Bildungserlebnisse für viele. Selbst wenn man nur aus vordergründiger Motivation („Muss man gesehen haben, um mitreden zu können“) solche Ausstellungen besucht, bleibt diese zweifellos auch vorhandene Facette eher untergeordnet. Als Fazit kann man sagen, dass man die documenta – auch in ihrer Funktion des Dokumentierens, Auswählens, Bewertens – geradezu erfinden müsste, gäbe es sie nicht. Man vergleiche etwa die documenta mit den Festspielen in Bayreuth. Der künstlerische Kern tritt hier fast völlig zurück – bzw. er erscheint dort, wo er auftritt, ausgesprochen wagnerimmanent –, also ohne weitere Bedeutung für die Kunst und Kultur des Landes. Dagegen dominiert Prominenz aus Sport, Medien und Politik, die sich gerne der Öffentlichkeit als kunstbeflissen präsentiert. 187 Document1 15.05.16 Wo hier das öffentliche Interesse an einer Förderung liegen sollte, bleibt – gerade vor dem Hintergrund der oben angeführten Argumente für die documenta – ziemlich unklar. Genießen wir also das Fest der Sinne, die Provokation im Denken, die Kreativität der Objekte, die oft sinnfreien Kommentare der Kuratoren und freuen uns auf die nächste documenta, die vermutlich wieder völlig anders werden will – und doch in vielem ihren Vorgängern gleichen wird. 188 Document1 15.05.16 Die dOCUMENTA 13 Eindrücke und Analysen Früher, so scheint es, war es einfacher, über Kunst zu schreiben. Böse Zungen behaupten etwa, dass Kant seine Schrift zur Ästhetik ohne tiefere Kenntnis über die Künste hat schreiben können. Hegel war sicherlich ein Kenner, doch musste sich auch bei ihm die Kunstreflexion der Logik seines Systems beugen. Immerhin konnte man noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts über das „Wesen der Kunst“ fabulieren, obwohl spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Wechselspiel der Ismen begann. Dabei ging es um nichts weniger, als eine jeweils neue Definition dessen, was Kunst ist, durchzusetzen. Duchamps und Andy Warhol markieren geradezu Revolutionen im Kunstverständnis: Ersterer, weil es ihm gelungen ist mit seinen Ready-Mades Industrieprodukte offiziell als Kunstwerke anerkennen zu lassen, letzterer, weil seine New Yorker Factory in der Tat eine fabrikmäßige Organisation der Kunstherstellung realisierte und die Idee eines auratischen Originals endgültig ad absurdum führte. Seither hat es sich inzwischen weitgehend durchgesetzt: Kunst ist das, was ein Kreis von Experten dafür hält (Kuratoren, Museumsleiter, Sammler, Galeristen, Kritiker, Hochschullehrer, Kunstwissenschaftler und zuletzt: die Künstler selbst). Das Feld der Künste ist ein Feld des Kampfes um Definitionsmacht, Aufmerksamkeit und letztlich auch um Marktwert. Damit verbunden ist eine gravierende Veränderung des Künstlerbildes: Künstler werden selber zu Kuratoren, Kritikern und Unternehmern (so V. Krieger: Was ist ein Künstler? 2007). Und solche, die Kunst eigentlich nur vermitteln sollen, rücken sich gezielt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Galeristen, Kuratoren, Intendanten oder Groß-Kritiker. Die Kunst und die Künstler selbst rücken offenbar immer mehr in den Hintergrund. Teil dieses Event-Betriebes ist seit Jahren die documenta. Natürlich wird hier Einfluss genommen darauf, was als Kunst zu gelten hat. Natürlich werden hier Marktpreise definiert, auch wenn es keine Messe ist. Und natürlich prägen die jeweiligen Kuratoren sehr viel mehr das Gesamtbild als die Kunst und die Künstler. War es dieses Mal anders? Schon im Vorfeld gab es zwischen Kritik und Amüsiertheit heftige Reaktionen auf die blumigen Äußerungen von Carolyn Christov-Bakargiev (CCB). Bei ihrem Vorgänger blühten sogar Internetforen auf, die sich über die oft sinnfreien Äußerungen lustig machten. Und bei der vorletzten documenta (die 11.) trat die eigentliche Kunstausstellung als bloß 5. Plattform eines überambitionierten weltweiten Politikdiskurses, der kein postmodernes und postcoloniales Thema ausließ, fast in den Hintergrund. Dies zumindest geschah dieses Mal nicht. Man registrierte vielmehr überall große Überraschung. Denn es ging tatsächlich um Kunst, um sehr viel Kunst, denn über 150 Künstler/innen bespie189 Document1 15.05.16 len die gesamte Stadt. Viele Frauen, viele (bislang) völlig unbekannte, viele neu entdeckte und einige sogar schon längst verstorbene Künstler wurden präsentiert. Schwer war es schon immer, aufgrund der Komplexität der Ausstellung darüber zu schreiben. Dieses Mal ist es nahezu unmöglich. Es ist wie bei dem Hasen und dem Igel: Immer schon ist die Ausstellung da. Integriert werden Wissenschaften (etwa der Quantenphysiker Anton Zeilinger), sodass die documenta sich gelegentlich präsentiert wie das Deutsche Museum, zumal die Orangerie und das Ottoneum mit ihren naturwissenschaftlichen Ausstellungen fugenlos eingebaut sind. Es sind alle Künste präsent, da viele Künstler geniale Doppelbegabungen sind (Llyn Foulkes, William Kentridge u.a.). Es ist die Einheit von Mensch und Natur angestrebt, sodass letztere ebenfalls – wie allerdings auch schon früher – eingebunden ist. Gleichzeitig zur Kasseler Ausstellung finden Parallel-Aktionen in Kabul statt (Goshka Macuga). Auch Kairo und Banff werden integriert. Natürlich ist die diesjährige documenta auch politisch. Es gibt zahlreiche Diskussionsrunden, Gespräche, Vorträge von Fachwissenschaftlern aller Gebiete. Der Philosoph Christoph Menke hat seinen eigenen Bereich. Die Aufarbeitung des Faschismus (in den letzten Jahren kaum präsent) und der Kolonialzeit ist ein Schwerpunkt. So werden Werke ermordeter oder vertriebener Künstler/innen prominent platziert (z. B. Gustav Metzger). Auch der ganz normale gegenwärtige Wahnsinn zivilisierter Staaten ist Gegenstand, etwa bei der Galgeninstallation von Sam Durant in der Karlsaue, mit der er gegen die Todesstrafe in den USA protestiert. Protest gegen die Pathologien der Moderne: Die Choreographie von Tanzszenen auf Müllhalden und im stark verschmutzten Meer regen den Brechreiz an. „Schön“ ist diese documenta kaum. Mir fehlen ein wenig die poetischen Höhepunkte vergangener documenten. Denn dass das Leben schwer ist, weiß man vielleicht auch selbst schon. Eine Ausnahme ist die Installation von Haegue Yang mit Projektionen auf große rotierende SoffZylinder, die an der Decke hängen. Doch dann wird man wieder in der großen Teilausstellung „The Repair“ von Kader Attia mit nur schwer zu ertragenden deformierten Gesichtern, vom Krieg beschädigt und nur notdürftig wieder hergestellt, konfrontiert. Bei soviel Zivilisationskritik, bei der immer wieder das zerstörte Subjekt, der Einzelne als Spielball destruktiver Techniken und Machtstrategien, gezeigt wird, könnte man eine Totalablehnung der Technik insgesamt vermuten. Doch öffnet sich die documenta-Halle mit den Werken von Thomas Bayrle, der die Ästhetik aufgeschnittenen Motoren oder die Melancholie von Scheibenwischern in nutzloser Aktion zeigt. Kunst stimuliert die Sinne, dies ist vielleicht der letzte Rettungsversuch einer essentialistischen Definition. Doch zur Tradition der Künste – und auch der documenta – gehört, dass sie sich immer wieder der Sinne entziehen. Dies zeigte schon der unsichtbare Kilometer, der zu 190 Document1 15.05.16 Zeiten des OB’s Hans Eichel – heute einer der „Weltgewandten Begleiter“ – eingegraben wurde. Heute verdeckt der hochbetagte Gustav Metzger seine Malereien mit Tüchern, die man erst anheben muss, um sehen zu können. Heute ist gleich in der Eingangshalle anstelle von Werken ein gar nicht so sanfter Luftzug zu spüren und es wird ein Absagebrief von Kai Althoff gezeigt, der erläutert, warum er nicht ausgestellt werden kann. Vieles wäre noch zu erwähnen. Etwa das überaus umfassende Vermittlungsprogramm. Leicht größenwahnsinnig – eine Ironie war nicht zu erkennen – ist das „Buch der Bücher“, eine Zusammenstellung von 100 Notizbüchern quer durch alle Wissens- und Erlebnisbereiche, die von der Kuratorin ausgesucht bzw. von Experten auf ihre Einladung hin verfasst wurden. „Totale Überforderung“ und ein Schrei nach Ordnung war die Reaktion des art-Redakteurs Till Brieger, der sich einem Selbstversuch der Lektüre unterzogen hat. Wie eingangs erwähnt: Es dürfte kaum ein Thema, eine Aktionsform, ein Angebot, eine Expertise, ein Zugangsweg ausgelassen worden sein, ein Rundum-Sorglos-Paket der Kunstaneignung also. Was heißt dies für die Kulturpolitik? Mit einer „reinen“ Kunsttheorie ist Gegenwartskunst nicht zu verstehen. Sie ist viel zu sehr in die Erlebnis-, Event- und Machtprozesse der kapitalistischen Gesellschaft eingebunden, selbst wenn sie dagegen protestiert. Es wird zudem viel Kunst, es werden viele Künstler gezeigt. Kann man all dies würdigen, wenn es so konzentriert daherkommt? Ich kann es nicht. Es zeigt sich die Dominanz der Vermittler. Dies ist nicht bloß in der Bildenden Kunst der Fall: Reich-Ranicki hat seinerzeit gezeigt, dass der Kritiker wichtiger ist als der Autor. Kuratoren zeigen, dass sie wichtiger sind, als die Werke. Der Kunstwissenschaftler und Publizist Christian Demand zeigt, wie gerade in den besten Museen der Kunst der Moderne – etwa im MoMA in New York – alleine durch die Art der chronologischen und thematischen Hängung der Werke eine Ordnung geschaffen wird, die es eigentlich nicht gibt. Kunst braucht Vermittlung, zweifellos. Aber ob sie die heutige Dominanz der Vermittler braucht, ist zu bezweifeln. So spielen ganz aktuell in der Diskussion um das Urheberrecht die beiden eigentlich wichtigen Gruppen im Umgang mit Kunst, nämlich die Produzenten und die Rezipienten, eine sehr viel geringere Rolle als all diejenigen Personen, Berufe, Firmen, die zwischen Künstler und Publikum stehen. Vielleicht ist dies unvermeidbar. Dann sollte man jedoch unsere kulturpolitischen Begründungen sorgsam auf ihre Richtigkeit überprüfen. 191 Document1 15.05.16 „Die Wohlgesinnten“ von Jonathan Littell – Annäherungen an ein Buch Kurz nach dem 11.09.2001 war in einer großen Wochenzeitung zu lesen, dass man nunmehr endlich akzeptieren müsse, dass das grundsätzlich Böse existiere. Man konnte diese Aussage durchaus als zu leichte Kapitulation des Nachdenkens über Ursachen und Gründe für diesen bislang einzigartigen Mordanschlag betrachten. Denn natürlich kamen eine ganze Reihe nachvollziehbarer Gründe in den Sinn: Die World-Trade-Towers als Symbol westlichen Strebens nach Hegemonie, als Symbol der Arroganz der Ökonomie, des Westens, der USA, als Ausdruck einer Verweigerung westlicher Zivilisation und Lebensweise, als gerechte Rache für eine unsägliche Leidensgeschichte von Menschen in Afrika oder Asien, die der Westen verursacht hat. Der Rückbezug auf das schlichtweg Böse konnte so als eine weitere Verweigerung interpretiert werden, eine politisch gewollte weltweite Ungerechtigkeit anzuerkennen. Später konnte diese Argumentation noch dadurch verstärkt werden, dass die Attacken auf das Pentagon und die Zwillingstürme wohlfeilen Anlass geboten haben, unter dem offenbar alles erklärenden Bezug auf die weltweite Terrorismusgefahr im Inneren Bürgerrechte massiv abzubauen und im Äußeren eine militante Aggressionspolitik zu legitimieren. Saskia Sassen hat soeben in ihrem neuesten Buch (Der Katastrophenkapitalismus) aufgezeigt, wie – wieder einmal – politisch geschickt die „Gunst der Stunde“ genutzt wurde, um eine neoliberale Politik ein Stück weiter durchzusetzen. All diese Begründungen haben ihren Sinn, haben ihre Berechtigung, doch lohnt sich trotzdem die Auseinandersetzung mit der These von der Existenz des Bösen. Dabei ist es nicht nur eine theologische Frage, sind es nicht nur religiöse Diskurse, in denen das Böse eine Rolle spielt. Allerdings gehören auch diese in diesen Kontext. In der Neuzeit ist es die Frage nach der Theodizee, die speziell nach dem Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 eine Rolle spielt: Wie kann ein Gott in seiner eigenen Schöpfung zulassen, dass derartig massenhaftes Leid geschieht? Diese Frage erhält ihre besondere Spannung durch die theologische Grundüberzeugung – seinerzeit von Leibniz wieder vehement vorgetragen – wir lebten in der besten aller Welten. Entweder funktioniert die Schöpfung nicht so, wie Gott sie geplant hat. Dann ist er ein schlechter Konstrukteur. Oder er hat dieses Massensterben gewollt. Was für ein Gott ist dies aber dann? Das Böse hat seither immer wieder Theologen und Philosophen fasziniert, möglicherweise mehr als das Gute. Susan Neiman („Das Böse denken“, 2004) lässt eine ganze Reihe von Denkern Revue passieren. Doch ist es inzwischen schon längst nicht mehr das Naturereignis des Erdbebens, auch nicht die Pest oder andere „Geißeln Gottes“. Mit dem 20. 192 Document1 15.05.16 Jahrhundert hat das Böse offensichtlich eine neue Größenordnung erreicht. Die Gas- und Stellungskriege eines erstmals so genannten Weltkrieges und nicht zuletzt die Massenvernichtungen der Nationalsozialisten. Nach Auschwitz könne es keine Lyrik mehr geben, vielleicht weil jegliche Lyrik mit Trost verbunden ist. Vielleicht aber auch, weil jegliche Form einer ästhetischen (oder wissenschaftlichen ) Bearbeitung ein Versuch ist, zu verstehen. Und wer versteht, ist möglicherweise auf dem Wege zu verzeihen. Natürlich sind diese Überlegungen nicht der einzige Zugang zu einem Roman, der trotz seiner 1460 Seiten seit Monaten in den Bestsellerlisten steht. Wie jedes künstlerische Werk ist er offen für die unterschiedlichsten Zugänge, Deutungen und Lesarten. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien einige dieser Lesarten aufgeführt. Der Text ist geschrieben aus der Perspektive eines Ich-Erzählers (Maximilian), der sich gleich am Anfang als ehemaliger SS-Offizier zu erkennen gibt. Am Ende des Krieges gelingt es ihm, in die Identität eines französischen Zwangsarbeiters zu schlüpfen, der in der Folgezeit in Frankreich eine solide bürgerliche Existenz als Unternehmer aufbaut. Sein Vater – auf mysteriöse Weise in seiner Kindheit verschollen – war nach dem ersten Weltkrieg ein Führer einer paramilitärischen rechten Freischärlergruppe, seine Mutter eine Französin aus dem Elsass, die später ihren verschwundenen Mann für tot erklären lässt und einen französischen Unternehmer heiratet. Maximilian hat eine Zwillingsschwester, mit der er zunächst gemeinsam in Südfrankreich aufwächst. Er wird von ihr zu Beginn ihrer Pubertät getrennt, als kindliche Spiele zu zweit zunehmend eine erotische Dimension erhalten. Beide verzeihen ihrer Mutter die Trennung von ihrem Vater nicht. Die restliche Schulzeit verbringt Maximilian in einem Internat. Das Wunschstudium der Literatur wird ihm verweigert. Er studiert Jura (Verfassungsrecht) und wird bereits während des Studiums von seinem Professor für die SS (genauer: den Sicherheitsdienst) als Informant angeworben. Später nach der Promotion steigt er schließlich hauptberuflich in die SS ein. Am Ende des Krieges hat er den Rang eines Obersturmbannführers erreicht. Der Roman erzählt zwar in kürzeren Rückblicken immer wieder wichtige Episoden aus früheren Jahren – etwa homosexuelle Beziehungen im Internat und im Studium –, der Schwerpunkt befasst sich jedoch mit einer detaillierten Darstellung der Zeit zwischen dem zunächst erfolgreichen Beginn des Ostfeldzuges und dem Ende des Krieges in Berlin. Welche Lesarten sind möglich? Eine Lesart ist die eines Bildungsromans: Wie entwickelt sich ein intellektuell hoch begabter Junge zu einem Nationalsozialisten, der unmittelbar in die Massenmorde in Kiew, in Auschwitz und anderswo involviert war? Ein wichtiger – und in der Kritik immer wieder hervorgehobener – Aspekt ist die sexuelle Dimension: Seitenweise wer193 Document1 15.05.16 den deutlich und krass homo-erotische Praktiken beschrieben. In diesen Kontext gehört eine immer wieder explizit beschriebene Rolle von Fäkalien und von Ausscheidungsprozessen. Es ist zudem ein Roman über eine inzestuöse Beziehung von Zwillingsgeschwistern, eine Beziehung zwischen Liebe und Obsession. Es ist ein Roman über eine problematische Mutter/Vater-Kind-Beziehung, über den Verlust des Vaters und dessen Idealisierung mit einem tragischen Ausgang. Eine entscheidende Rolle spielt der Kriegsverlauf aus der Perspektive des SD (Sicherheitsdienst), der im Rücken der Front versucht, die NS-Rassenideologie, also die systematisch Beseitigung vor allem von Juden, aber auch von Zigeunern und anderen zu realisieren. Man lernt die Komplexität der NS-Verwaltung, die Konkurrenzen zwischen den unterschiedlichen NS-Organen (SS, Zivilverwaltung, Partei, Polizei, Wehrmacht etc.) kennen, den Widerstreit zwischen politischen und ökonomischen Zielen. Über viele Seiten hinweg wird in einer in diesem Kontext grausam anmutenden nüchternen Sprache beschrieben, dass auch die Massenermordung von Menschen eine ökonomische Seite hat. Hier tauchen bekannte Größen wie Eichmann auf. Man erfährt vieles über Theorien und Ideologien der Rassen, über unterschiedliche theoretische und ideologische Zugänge. Der Roman liefert antifaschistischen Positionen ebenso Argumente wie er durchaus für intellektuelle Trainingscamps für Neo-Nazis genutzt werden könnte. Denn auf einem gewissen intellektuellen Niveau werden theoretische Grundlagen Nazi-Deutschlands vorgetragen. Wer glaubt, dass sich all dies mit leichter Hand als Unfug wegwischen ließe, möge sich daran erinnern, welch große Nähe es schon in der Weimarer Zeit zwischen einem intellektuellen Rechtskonservatismus, einem Nationalismus und rechter Politik gegeben hat, wie viele Intellektuelle, Wissenschaftler und Künstler (von Heidegger bis Carl Schmitt, von Breker, Jünger, Riefenstahl bis Gottfried Benn, von Vertretern Deutscher Christen bis zu solchen einer Deutschen Mathematik) ihren Beitrag zur ideologischen Absicherung des Nationalsozialismus geleistet haben (und welche bedeutsame Rolle vielen von ihnen bis heute in der Kunst-, Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte zugebilligt wird). Und natürlich ist es ein Roman über Schuld und Moral. Immer wieder weist der Ich-Erzähler darauf hin, wie inkonsequent bürgerlich-zivilisierte Moralvorstellungen sind (wenn etwa das universelle Tötungsverbot mit leichter Hand in Kriegszeiten außer Kraft gesetzt wird). Er verweist auf Probleme der Schuldzuweisung bei den Massenermordungen. Er zeigt, wie viele historische Beispiele es im Umgang mit dem politischen und militärischen Gegner gibt, so dass sich viele NS-Verbrechen – mit der gravierenden Ausnahme des in dieser Form unvorstellbaren systematischen Massenmordes – letztlich als doch nicht so einzigartig darstellen; kurz: Der Autor macht es einer raschen moralischen Bewertung nicht leicht. Bei all diesen 194 Document1 15.05.16 möglichen Lesarten muss jedoch klar bleiben, dass es kein erneutes Fachbuch über den Holocaust ist, keine Analyse des analen Charakters zentraler Akteure, kein Psychogramm eines Massenmordes: Es ist ein gut gelungener Roman, wobei vielleicht dies mit der Zeit ein erneutes Grausen verursacht. Denn natürlich stellt sich mit den vielen Seiten ein Interesse am weiteren Lebensweg der zentralen Figur ein – sogar eine gewisse Sympathie entsteht. Es besteht sogar die Gefahr, dass man sich an die grausigen Rahmenbedingungen dieses Lebensweges gewöhnt. Hieran kann eine politische Bewertung des Romans anknüpfen (eine literarische Bewertung gehört nicht zu meiner Aufgabe und Profession). Eine – gerade auch gesellschaftlich relevante – Dimension von Kunst besteht darin, Möglichkeiten gelingenden oder misslingenden Lebens aufzuzeigen, Möglichkeitswelten alternativer Lebensweisen darzustellen, Kontingenzerfahrungen zu ermöglichen. Robert Musil beschreibt diesen „Möglichkeitssinn“ im 4. Kapital seines „Mannes ohne Eigenschaften“: „Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.“ Dies macht Kunst (u.a.) zu Kultur, nämlich einen Beitrag zur individuellen und gesellschaftlichen Sinnfindung zu leisten. In dieser Hinsicht ist dieser Roman außerordentlich bedeutsam. Denn es sind mir kaum literarische Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus aus der Täter-Perspektive bekannt (die unsäglichen Memoiren ehemaliger Nazigrößen, die – wie diejenigen von Speer – von den Feuilletons hofiert werden, spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle). Die durch die Erzählweise erzwungene Identifikation mit der Hauptperson erzwingt geradezu eine Aufmerksamkeit gegenüber dem explizit formulierten Ziel, die Folgerichtigkeit und moralische „Normalität“ der Handlungen und Denkweise des Ich-Erzählers zu belegen. Insofern ist der Roman eine erheblich größere Herausforderung gegenüber solchen Werken, bei denen das Richtige und Falsche von vornherein feststeht und man sich stets auf der sicheren Seite wähnen kann. Politisch bedeutsam wird das Buch aufgrund der immer wieder zu stellenden Frage danach, wie all dieses Barbarische hat geschehen können. Diese Frage stellt sich hier um so drängender, als der engere Kreis der handelnden Personen gerade keine geifernden Antisemiten wie Julius Streicher sind, sondern auf höchstem Niveau formal gebildete Menschen, die ihren Platon, Sophokles, Kant oder Hegel – erstere sogar im sprachlichen Original – zitieren können. Auch die Studieninhalte der Hauptperson – Verfassungsrecht – geben zu denken. Denn im195 Document1 15.05.16 merhin war der rechtskonservative Weimarer Verfassungstheoretiker Carl Schmitt Parteigänger der Nazis und nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als ein intellektueller Geheimtipp. Der bedeutendste Grundgesetzkommentar stammt von einem erheblich belasteten Verfassungsjuristen, was für einen späteren Bundespräsidenten kein Problem war, als Mitherausgeber eine enge Zusammenarbeit zu pflegen. Dass einige Mitglieder der Bush-Administration, die so genannten Neocons, ihre Ausbildung in Chicago erhalten haben, wo Leo Strauss – zunächst ein Schüler von Schmitt, dann aber von diesem wegen seiner jüdischen Herkunft fallengelassen – lange Jahre lehrte. Das ist nur eine intellektuelle Entwicklungslinie, die sich von der Weimarer Zeit über die Nazi-Zeit bis heute verfolgen lässt. Für fast alle Wissenschaften ließe sich Ähnliches aufzeigen: Nationalsozialismus hatte durchaus eine intellektuelle Dimension, die bei der Auseinandersetzung mit heutigen rechtsextremen Kräften zu berücksichtigen ist. Dass sich hiermit eine Aufgabe für Kultur- und Bildungspolitik stellt, die über einen bloß moralischen Antifaschismus hinausgeht, liegt auf der Hand. Möglicherweise kommt man aufgrund der Rolle von Intellektuellen und Künstlern in der Nazizeit auch zu einer kritischen Bewertung bestimmter Künstler. Es gibt schon seit längerem deutliche Neigungen, Breker, Riefenstahl, Benn, R. Strauß, M. Wigman (oder wie sie alle hießen) bloß noch ästhetisch zu betrachten und zu bewerten. Wer sich verdeutlicht, dass auch Terror-Regime einen Rückhalt bei großen Teilen der Bevölkerung brauchen, dass insbesondere notwendige Funktionseliten intellektuell anspruchsvoll ideologisch „bedient“ werden wollen, wird möglicherweise weniger großzügig gegenüber jenen sein, die genau diese Rolle wahrgenommen haben. Vielleicht kam daher das Buch von Littell zur rechten Zeit. 196 Document1 15.05.16 Sind wir jemals modern gewesen? Kulturpolitische Überlegungen zu deutschen Mentalitäten, zu Thomas Mann und zum Bürgertum Es scheint eine Sehnsucht nach dem Bürgertum oder zumindest nach wohlanständiger Bürgerlichkeit zu geben. Wo sind die Tugenden des seriösen Kaufmanns geblieben, seine Zuverlässigkeit und Redlichkeit, sein Anstand und seine Sparsamkeit? Viele interpretieren die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise unter moralischen Aspekten: als Mangel an Tugenden, die einmal als bürgerliche gegolten haben. Und viele sehen in dem Markt- und Staatsversagen (letzteres, weil es der Staat versäumt hat, klare Regeln zu setzen) eine neue Chance für Kunst und für Religion. Denn beides sind Instanzen der Sinnstiftung und unterbreiten Vorstellungen von der Welt und von sich selbst, die gerade nichts mit dem Shareholder-Value zu tun haben. Vielleicht ist es daher kein Zufall, dass Heinrich Breloer nach seiner großen Thomas-MannBiographie nunmehr das frühe Hauptwerk des vielleicht Bürgerlichsten unter unseren Schriftstellern mit großem Aufwand in die Kinos bringt – auch wenn es sich um eine grandiose Verfallsgeschichte einer Bürgerfamilie handelt. Vielleicht, so die Hoffnung, lässt sich aus dem Verfall dieser Familie dann doch noch etwas lernen, was uns bei unserer heutigen Sinnkrise hilft. Thomas Mann ist auch in einer anderen Hinsicht interessant für uns, weil er nämlich die Ambivalenz des Bürgertums zeigt. Und dieses Bürgertum ist das des Wilhelminischen Kaiserreiches. 1875 wurde er geboren, hat die ersten Jahre in Lübeck, die nächsten Jahre dann in München verbracht, hat also das protestantische und das katholische Milieu kennen gelernt. Früh setzt er seinen Wunsch nach einem Leben als Künstler durch – und erfährt wiederum die Spannungen zwischen dem Dasein als Künstler und als Bürger. Sein frühes Hauptwerk, für das er später den Nobelpreis erhalten soll, vollendet er im Alter von 25 Jahren. Schopenhauer und Anna Karenina, so schreibt er später, sind seine Begleitlektüre während der Abfassung des Romans. Früh hat er seine großen Drei, nämlich Goethe, Schopenhauer und Nietzsche, für sich entdeckt. Dazu kommen Tolstoi und Dostojewski. Diese Vorliebe hält bis ins hohe Alter. Interessant ist Thomas Mann, weil er sich einmischt in die Politik und mit hohem Aufwand nicht nur diese Einmischung begründet, sondern paradoxerweise auf über 400 Seiten beschreibt, warum eine solche Einmischung in die Politik für einen Künstler und Ästheten nur von Übel sei. Dialektisch muss man also schon denken, wenn man sich mit dieser Ikone deutscher Bildung und Kultur auseinandersetzt. Seine politischen Einmischungen sind hoch aktu197 Document1 15.05.16 ell. Denn man lernt sehr viel über ein aktuelles Thema, das ich in einigen Aufsätzen immer wieder angesprochen habe: Den Hang der Deutschen zu einem starken Staat, der selbst in der Kulturpolitik – heute unter dem Label des Kulturstaates – fröhliche Urstände feiert. Wo kommt dieser Hang her und: ist es überhaupt legitim, von einer entsprechenden Mentalität der Deutschen zu sprechen? Ist es in Zeiten, in denen „Vielfalt“ zu einem Leitbegriff nicht nur der Kulturpolitik geworden ist, angemessen, alle über einen Kamm zu scheren? Sicherheitshalber nenne ich daher mein Vorgehen einen „Versuch“. Doch gibt es Vorbilder, die ermutigen. Mme. de Stael versuchte bereits zu Zeiten Goethes, ihren Franzosen die Deutschen zu erklären (De l’Allemagne, 1813). Rund 150 Jahre später ist es ein kluger Amerikaner, der mit weitem Horizont und großer Zuneignung die Finger in die Wunde legt (G. A. Craig: Über die Deutschen, 1982). Norbert Elias liefert uns mit seinem Konzept des Habitus ein wichtiges Verständnismittel und legt „Studien über die Deutschen“, vor allem über Nationalismus und Gewalt, vor. Und nicht zuletzt stößt man auf die tiefschürfenden geistesgeschichtlichen Studien, die Helmut Plessner in seinem holländischen Exil 1935 schreibt und die unter dem Titel der „verspäteten Nation“ erst Mitte der 50er Jahre in Deutschland erschienen – in Sprache und Inhalt bis heute kaum veraltet. Liest man all dies, so drängt sich auf die Titelfrage die Antwort auf: Nein. Doch nun zu Thomas Mann. Im Jahre 1915 veröffentlicht er seine kleine Schrift „Friedrich und die große Koalition“ (Gesammelte Werke, Bd. X, 76ff.), in der er wie viele andere Künstler und Intellektuelle die deutsche Seite im Kriege stützt und viele Argumente für die Notwendigkeit dieses Krieges anführt. Man erinnere sich: Schon im Vorfeld tobte ein Kampf zwischen Vertretern der tiefen deutschen „Kultur“ und der englischen und französischen „Zivilisation“, so dass man von einem „Kulturkrieg“ sprach. Allerdings gab es nicht nur auf Seiten der Alliierten harte Kritiker gerade der kleinen Schrift von Thomas Mann – mit Romain Rolland setzt er sich später ausführlich auseinander. Auch unter den Deutschen gab es Intellektuelle und Künstler, die die Position von Thomas Mann nicht teilten. Sein Bruder Heinrich gehörte zu diesen. Dessen Kritik hat Thomas offenbar heftig getroffen. Denn er schreibt in der Folgezeit ein umfangreiches Buch, die „Betrachtungen eines Unpolitischen“: „Das Buch, in den Kriegsjahren geschrieben, war ein leidenschaftliches Stück Arbeit der Selbsterforschung und der Revision meiner Grundlagen, meiner Gesamt-Überlieferung, welche die einer politikfremden deutschbürgerlichen Geistigkeit war, eines Kulturbegriffs, zu dessen Gestaltung Musik, Metaphysik, Psychologie, eine pessimistische Ethik, ein individualistischer Bildungsidealismus sich vereinigt hatten, der aber das politische Element geringschätzend ausschied“, so Mann in seinem Aufsatz „Kultur und Politik“ (1939; Werke XII, 853 ff.), in dem der nunmehr 198 Document1 15.05.16 Sechzigjährige auf das Werk des Vierzigjährigen zurückblickt. Mentalitätsgeschichtlich sind beide Texte, die 400 Seiten von 1917 und die 10 Seiten von 1939, hoch interessant. Denn der lange Text, brillant geschrieben, zwar nach Mann kein Kunstwerk, aber ein Künstlerwerk, kann quasi als konzise Beschreibung deutsch-bürgerlicher Mentalität, kann als Grundbuch eines reflektierten Konservativismus gelten. Wer den Text liest, kann sich der packenden Sprache kaum entziehen, selbst wenn angesichts der – heute muss man sagen – reaktionären Positionen fast auf jeder Seite der Atem stockt. Beiläufig erfährt man zudem vieles Interessante über Entstehung und Hintergrundüberlegungen vor allem zu den Buddenbrooks und zu Tonio Kröger. Wer glaubt, das Urteil „reaktionär“ sei zu hart, lese bei Mann selbst (zitiert nach Bd. 4 der Gesammelten Werke): „dass es ein Irrtum deutscher Bürgerlichkeit war, zu glauben, man könne ein unpolitischer Kulturmensch sein“ (854), dass der „Weg in die Kulturkatastrophe des Nationalsozialismus mit Politiklosigkeit des bürgerlichen Geistes in Deutschland zusammenhängt“ (854). Und weiter: „Das politische Vakuum des Geistes in Deutschland, die hoffärtige Stellung des Kultur-Bürgers zur Demokratie, seine Geringschätzung der Freiheit … hat ihn zum Staats- und Machtsklaven … gemacht … und ihn in solche Erniedrigung gestürzt, dass man sich fragt, wie er je vor dem Angesicht des Weltgeistes wieder die Augen wird aufschlagen können.“ (857). Und ein letztes Zitat: „Die Frucht seines ästhetischen Kulturbürgertums ist ein Barbarismus der Gesinnung, Mittel und Ziele, wie die Welt ihn noch nie sah;“(860). Diese (selbst-)kritischen Positionen fanden auch Eingang in sein literarisches Werk. So schreibt er während der Abfassung seines Mammutwerkes über Joseph im Jahre 1933 seinen Roman „Lotte in Weimar“, in dem die Politik und speziell Goethes Verhältnis zu den Befreiungskriegen gegen Napoleon eine große Rolle spielen. Dort lässt er Goethes Sohn August zu Lotte sagen: „Ist doch die Politik ihrerseits nichts Isoliertes, sondern steht in hundert Bezügen, mit denen sie ein Ganzes und Untrennbares an Gesinnung, Glauben und Willen… bildet. Sie ist in allem Übrigen enthalten und gebunden, im Sittlichen, im Ästhetischen, scheinbar nur Geistigen und Philosophischen …“ (Werke 2, 604). Man vergesse nie, dass all die später von Mann kritisierten Positionen solche sind, die er selbst mit höchster Sprachgewalt und fulminantem Bildungswissen in seiner frühen Schrift verteidigt. Dort geht es ihm um die „Abwehr ungerechter Ehrenkränkung“, wobei er mit hohem Selbstbewusstsein sich selbst und Deutschland gleichermaßen gekränkt sieht und daher auch beides im selben Aufwasch verteidigt. Bevor einige Kostproben von Positionen gegeben werden, ein Kommentar zu seiner Entschuldigungs- und Bekenntnisschrift aus dem Jahre 1939, geschrieben im amerikanischen Exil. Es schreibt ein inzwischen zur Demokratie – ein 199 Document1 15.05.16 Schimpfwort noch in der frühen Schrift – Bekehrter. Es ist also eine Wende um 180 Grad. Und dies ist aller Ehren wert. Wer allerdings beide Texte vergleicht, spürt in jeder Zeile des ersten Textes das Herzblut, den ganzen Menschen mit seiner Grundüberzeugung. Im zweiten Text dagegen ist es trotz guter und wichtiger Worte eben bloß der Verstand, der die Richtung diktiert, wobei auch der höchst unterschiedliche Aufwand an Buchseiten eine deutliche Sprache spricht. Im ersten Text ist das Ich des Autors allgegenwärtig, im zweiten sind es allgemein „die Bürger“, deren Fehlhaltung er kritisiert. Mann geht so weit, dass er seine frühe Schrift als ersten Schritt seines Bewusstseinswandels definiert. Fast kann man es mit seinen eigenen Worten – bei ihm bezogen auf Tolstoi – kommentieren: „Ich habe ….. das Riesenwerk wieder gelesen, - beglückt und erschüttert von seiner schöpferischen Gewalt und voller Abneigung gegen alles, was Idee, was Geschichtsphilosophie darin ist …“ (503). Er dürfte allerdings der Einzige sein, der in dieser fulminanten Verteidigungsschrift der ganzen politischen Rückständigkeit des deutschen Bürgertums mit seiner flammenden Begründung von Nationalismus und deutscher Besonderheit bereits ein „demokratisches Bekenntnis“ im Ansatz erkennen kann (854). Doch soll man Menschen nicht überfordern, denn Mentalitäten sitzen tief, haben nur begrenzt mit Wissen und Einsicht zu tun. Der Habitus, so Elias und Bourdieu, entsteht eher beiläufig und alltäglich, entsteht en passant. Dafür sitzt er aber um so tiefer. Lesen wir also die „Betrachtungen eines Unpolitischen“ – übrigens eine Redewendung, die Mann von Goethe übernommen hat und die man auch bei Dostojewski findet – als analytisches Psychogramm einer gesellschaftlichen Schicht. Natürlich hat dieser komplexe Text so viele mögliche Lesarten, wie sie noch nicht einmal hier angedeutet werden können. Er liefert eine Apologie des Krieges, des deutschen Nationalismus, des a(nti)politischen Bürgers und Künstlers, der zivilisationsfeindlichen Kultur, der deutschen Tiefe, einer elitär-aristokratischen Vorstellung von politischer Ordnung. Der Krieg: Es ist ein „moralischer Krieg“ (155), er ist Deutschland aufgezwungen worden durch eine Verschwörung des Internationalen Freimaurertums mit dem Ziel, aus Deutschland eine ihm wesensfremde Demokratie westlichen Musters machen zu wollen (54). Die Deutschen werden diese Demokratie niemals lieben können, weil „der vielverschrieene „Obrigkeitsstaat“ die dem deutschen Volke angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt“ (30). Denn: „Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur; und Deutschtum das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur“ (31). Der Deutsche ist friedliebend und speziell ist es das Wilhelminische Kaiserreich. Doch gibt es uneinsichtige Menschen, im Ausland ohnehin (Rolland, 200 Document1 15.05.16 Shaw), aber auch in den eigenen Reihen, die dies negieren, vielleicht sogar: wider besseres Wissen negieren. Thomas Mann schafft für diese die Kunstfigur des „Zivilisationsliteraten“: unpatriotisch, eher französisch und an der Aufklärung orientiert, schreibt Gesellschaftsromane, verrät die deutsche Seele an oberflächliche und unglaubwürdige Werte wie Freiheit und Demokratie. Es fällt nicht schwer, seinen Bruder Heinrich hinter dieser Chiffre zu erkennen. Dessen kritische Psychogramme deutscher Bürgerlichkeit (Prof. Unrat, Der Untertan) passten in diese deutsch-nationale Anhimmelung des Bürgers wenig hinein. Der Zivilisationsliterat ist westlich, ist schlicht undeutsch. Die Demokratie ist ohnehin das Schreckgespenst des deutschen Bürgers: Proleten ohne Abitur und Bildung maßen sich an, den Staat regieren zu können. Einige angelernte Floskeln reichen, um höchste Staatsämter zu erreichen. Interessant ist es, welche Referenzautoren Thomas Mann zuzieht. Goethe, Wagner, Schopenhauer und Nietzsche habe ich schon genannt. Natürlich taucht Schiller, Ehrenbürger des revolutionären Frankreich, nur ein einziges Mal auf, obwohl auch er sich nach der Niederlage gegen Napoleon und dem Ende des Römischen Reiches Deutscher Nation einmal recht nationalistisch geäußert hat: Mögen andere Völker auch militärisch siegreich sein, die Deutschen dominieren im Reich des Geistes. Es war diese Niederlage, die endgültige Besiegelung des Heiligen Römischen Reiches, die den Chauvinismus überschwappen ließ. Auch Fichte gehörte zu jenen, die die Deutschen als Nation gern geeint gesehen hätten und der in seiner Ermutigung der Deutschen den Patriotismus in Richtung Chauvinismus hoffnungslos überzieht. So erläutert er beispielsweise in seiner vierten „Rede an die Deutsche Nation“ (1808), dass die deutsche Sprache ohnehin über allen anderen stehe und deshalb der Deutsche, der eine Fremdsprache erlerne, diese dann besser beherrsche als der Muttersprachler. Doch welche zeitgenössischen Autoren zitiert Thomas Mann? Wer Fritz Stern (Kulturpessimismus als politische Gefahr, 1963) gelesen hat, kennt deren politische Bedeutung: St. Chamberlain und Lagarde zum Beispiel, Nationalisten, Antisemiten, Stichwortgeber für alle, die später in der Weimarer Republik eine unheilvolle Rolle spielten. Dazwischen finden sich immer wieder hoch interessante Passagen, die man heute als Dekonstruktion bezeichnen würde, etwa zur „Tugend“, zum „Bürgertum“, zu „Kunst“ und zu „Literatur“. Von großem Interesse ist auch – fast ein roter Faden – die Auseinandersetzung zwischen Bürger und Künstler, zweier Seelen in der Brust von Thomas Mann. Der Künstler war im 19. Jahrhundert für den Bürger immer ein Doppeltes: Zum einen die höchste Ausprägung von Individualität, also einer zentralen Bürgertugend. Er war aber auch stets Bohème, nicht zugelassener Wunschtraum eines zügellosen Lebens. „Tonio Kröger“ macht gerade dies zum Thema. Und es ist kein Zufall, dass Thomas Mann in der pessimistischen Verfallsgeschichte der Buddenbrooks Scho201 Document1 15.05.16 penhauer als seinen Bezugsautor bestimmt, Tonio Kröger aber im Geiste Nietzsches geschrieben sieht (91). Es gilt wohl auch für ihn selbst: Tonio Kröger als etwas „Ironisch-Mittleres zwischen Künstlertum und Bürgerlichkeit“ zu sehen (ebd.). Für Thomas Mann sind Schopenhauer und Nietzsche zeit seines Lebens die wichtigsten Stichwortgeber. Er liest beide Autoren als Moralphilosophen und Ethiker. Dem Einfluss von Schopenhauer dürfte letztlich auch seine Aversion gegen Hegel zu verdanken sein. Denn dieser hatte als junger Dozent die Mission, den preußischen Staatsphilosophen – seinerzeit auf der Höhe seines öffentlichen Ansehens – vom Throne zu stürzen. Zeitgleich setzte er seine Vorlesungen an, um Hegels Hörer abzuwerben. Das Ergebnis war so katastrophal, dass er seine Universitätslaufbahn beendete, bevor sie begann. Doch bleiben Hegel und der staatsfromme Protestantismus bei einer zentralen Frage tonangebend: Für Thomas Mann war politisches Denken identisch mit Denken in Kategorien des Staates: „Denn Politik ist Teilnahme am Staat, Eifer und Leidenschaft für den Staat“ (149). Dagegen setzte Mann Religion, Philosophie, Kunst, Dichtung, Wissenschaft (ebd.). Politik ist schmutzig und charakterlos: „Dass wir nicht von Politikern … reden, liegt auf der Hand. Das ist ein niedriges und korruptes Wesen …“ (231). „Leben“ wird zur zentralen Kategorie. Es ist diese Lebensphilosophie, die der von ihm wohlwollend zitierte junge Georg Lukacs (103) später in einem Alterswerk als wichtige Verfallslinie des Geistes hin zum Nationalsozialismus beschreibt (Die Zerstörung der Vernunft, 1962). Eine besondere Aufmerksamkeit verdient der Protestantismus. Es wird an vielen Stellen deutlich, wie eng Thomas Mann die Verbindung zwischen Deutschtum und Protestantismus sieht. Der führende Kulturprotestant Ernst Troeltsch wird zustimmend zitiert. Für die Webersche These „Vom Geist des Protestantismus“ (1905) als geistiger, ethisch-moralischer Grundlage und Entstehungsbedingung des Kapitalismus nimmt er selbstbewusst Urheberrechte in Anspruch (145). In der Tat findet sich in dem Konflikt zwischen Thomas und Christian Buddenbrook. Bis in seine fast industriell organisierte Schriftstellertätigkeit verkörpert Thomas Mann selbst diese protestantischen Arbeitstugenden. Kant, eigentlich der „maßgeschneiderte“ Philosoph dieser strengen Ethik, spielt keine Rolle bei Thomas Mann, obwohl er neben Platon der einzige von Schopenhauer akzeptierte Philosoph ist. Nur dort, wo er sich an Schopenhauer anschließt bei dessen These, dass es nicht das Handeln ist, das eine ethisch-moralische Bewertung verdient, sondern die innere Einstellung zur Tat, bekennt er sich zu Kant. Handeln, so könnte man salopp sagen, ist eben nicht sein Ding als Künstler. Häufiger zitiert er Goethe: „Der Handelnde ist immer gewissenlos. Es hat niemand Gewissen als der Betrachtende.“ (579). Dürrenmatt formulierte dies später lakonisch so: „Der Handelnde hat immer Unrecht“. Das deutsche Volk jedoch hat gehandelt, indem es die Reformation hervorbrachte. Gerne 202 Document1 15.05.16 stützt sich Mann auf die These, dass Frankreich die Revolution nötig hatte, eben weil es keine Reformation hatte. Und ausführlich gibt er Überlegungen von Dostojewski wieder, die den Schicksalsweg des deutschen Volkes, die dessen historische Aufgabe als „Protest“ beschreiben. Hier ordnet er sich ein in seinem Protest, eben nicht westlich-modern sein zu wollen. Welche Rolle spielt nun dieses Werk in Hinblick auf unsere mentalitätsgeschichtlichen Thesen? Es beschreibt den Wertehaushalt und die Deutungsmuster des Wilhelminischen Bürgertums und gibt Hinweise darauf, wie diese zustande gekommen sind. Man versteht besser, wieso es „Gesellschaft“ in der Selbstbeschreibung der Deutschen so schwer hatte und weshalb die Blutverbindung der Gemeinschaft den Vorzug bekam. Helmut Plessner musste sich noch Anfang der 20er Jahre eine „Philosophie der Kälte“ vorwerfen lassen, als er 1924 in seiner Jugendschrift „Grenzen der Gemeinschaft“ gegen den Gemeinschaftskult im politischen und sozialen Denken anging. Wichtig sind die Erkenntnisse seines Textes (1959 unter dem Titel „Die verspätete Nation“ erschienen, geschrieben 1935 im holländischen Exil) in Hinblick auf die politischen und kulturellen Folgen dieser Mentalität. Gerade die „Betrachtungen“ von Thomas Mann sind als Bündelung und Intellektualisierung dieser Position Teil dieser unheilvollen Wirkungsgeschichte. Eine zweite Auflage erscheint 1922. Sie kann als Fundgrube und Referenz für all jene gelten, die ihre Probleme mit der Republik, dem Parlamentarismus und der Demokratie von Weimar hatten. Ihr chauvinistisch-nationalistischer Grundtenor fand weite Verbreitung, wobei – durchaus entgegen den Absichten ihres Verfassers – der Weg vom Nationalismus zum Nationalsozialismus nicht immer weit war. Wer die „Betrachtungen“ zugleich mit den langen Passagen in Littells „Die Wohlgesinnten“ liest, in denen NaziIntellektuelle sich ihrer Weltanschauung versichern, kann die Parallelen nicht ignorieren. Für die Funktionseliten im NS-Staat genügten die Streicher-Tiraden im „Stürmer“ eben nicht. Wie klingt etwa ein Abschnitt wie der folgenden: „Der Friede Europas sei … ein deutscher Friede. Der Friede Europas kann nur beruhen auf dem Siege und der Macht des übernationalen Volkes, des Volkes, das die höchsten universalistischen Überlieferungen, die reichste kosmopolitische Begabung, das tiefste Gefühl europäischer Verantwortlichkeit sein eigen nennt. Dass das gebildetste, gerechteste und den Frieden am wahrsten liebende Volk auch das mächtigste, das gebietende sein – darauf, auf der …. Macht des Deutschen Volkes, ruhe der Friede Europas.“ (207). Was heißt dies anderes, als dass am deutschen Wesen die Welt genesen solle? Und so sollte man die „Betrachtungen“ parallel zu Plessners „Verspäteter Nation“ lesen. Denn der umfangreiche Mannsche Text kann geradezu als empirische Unterfütterung der harten Analyse dessen gelten, worin das „Verspätete“, das Anti-Moderne der Deutschen liegt. Natürlich fiel Thomas Mann früh in Ungnade bei den Nazis. Schon in der Weimarer Zeit gelang 203 Document1 15.05.16 ihm der Übergang zu demokratischen Positionen. Doch ließen sich viele später in der Bundesrepublik angesehene Künstler und Wissenschaftler als „nützliche Idioten“ (Lenin) von den Nazis vor den Karren spannen, weil sie von der Illusion ausgingen, sie könnten diese als „nützliche Idioten“ für ihre eigenen politischen Ziele benutzen. Und so machten die Benn, Wigman, Hauptmann, Heidegger, Spranger, Nohl und viele andere erst einmal ihren Frieden mit den neuen Machthabern. Und heute? Die Sehnsucht nach dem starken Staat, um den man sich nicht weiter kümmern muss, der sich dagegen redlich um die Unterstützung von Kunst und Künstlern kümmert: Diese Sehnsucht ist immer noch vorhanden. Ebenso ist es die Sehnsucht nach einer deutschen „Leitkultur“, nach der Sicherung der großen Kulturleistungen früherer Zeiten. Es ist schon erstaunlich, wie naiv man heute über „Kultur“ und „Bildung“ im Geiste des 19. Jahrhunderts reden kann, ohne die Missbrauchs- und Verfallsgeschichte, ohne die schwarzen Seiten beider Leitformeln zur Kenntnis zu nehmen. Lernen könnte man im Hinblick auf beide Begriffe, dass eine rein anthropologische bzw. geistesgeschichtliche Begründung zwar notwendig ist, aber leicht zur bloßen Ideologie verkommt, wenn die Realgeschichte ihrer sozialen Anwendung vernachlässigt wird. „Bildung“ und „Kultur“ sind – wie alle gehaltvollen Begriffe – zwar auch theoretische, aber eben auch politische und ideologische Begriffe (Bollenbeck: „Bildung“ und „Kultur“, 1994; Fuchs: Kulturelle Bildung, 2008). Bis heute sitzen Ideen der „Betrachtungen“ von Thomas Mann tief in unseren Mentalitäten. Zwar haben die Deutschen auf eine Weise ihren Frieden mit der Demokratie gemacht, wie das vermutlich kaum einer nach 1945 erwartet hätte. Aber man lese einmal die Überlegungen zum Kanon der Konrad-Adenauer-Stiftung, man lese die verschiedenen Statements zur „Leitkultur“. Ein anderer Aspekt ist ebenfalls interessant. Ebenso wie Thomas Mann in den „Betrachtungen“ das Deutsche gegen den Westen verteidigt und den Ersten Weltkrieg aus deutscher Sicht zu einem „moralischen Krieg“ erklärt, gab es viele Pro-Amerikaner in Deutschland, die den Krieg der USA („den Westen“) gegen den Irak als „gerechten Krieg“ unterstützten und mit ähnlicher Vehemenz, wie Thomas Mann die Zivilisationsliteraten und Pazifisten schmähte, die Gegner dieses Krieges beschimpften. An der intellektuellen Spitze dieser Bewegung stand seinerzeit die „Zeitschrift für europäische Kultur“, der Merkur. Immerhin hat Thomas Mann seine Irrtümer erkannt und öffentlich korrigiert. Ähnliches war selbst dann nicht aus dem Kreis der Merkur-Ideologen zu hören, als sich so nach und nach alles Gerede über Giftgas im Irak als Lüge herausstellt. Die Lernfähigkeit dieser intellektuellen Spitze des konservativen Bürgertums ist offenbar begrenzter als bei Thomas Mann. 204 Document1 15.05.16 Das Bürgertum: Es war in den letzten 20 Jahren Gegenstand aufwendiger Forschungsprojekte in Bielefeld, Frankfurt und anderswo (vgl. A. Schulz: Lebenswelt und Kultur des Bürgertums im 19. und 20. Jahrhundert, 2005). Es hatte im 19. Jahrhundert die kulturelle Hegemonie erkämpft und dabei eine angemessene Beteiligung an der politischen Gestaltung der Gesellschaft und eine demokratische Politik ausdrücklich nicht betrieben, sondern sogar energisch liberale Tendenzen aus der Zeit vor 1848 zurückgedrängt. Ob deshalb gerade das deutsche Bürgertum aufgrund seiner Geschichte – sofern es überhaupt noch identifizierbar ist – den Weg aus der heutigen Krise zeigen kann, ist daher höchst fraglich. Thomas Mann schreibt, dass er bei seinem Verständnis von Bürgertum an sehr viel ältere Vorstellungen anknüpft. Der Bourgeois, der Wirtschaftsbürger des aufkommenden Kapitalismus, ist es jedenfalls nicht, an den er denkt, wenn er von Bürgern spricht. Es ist auch nicht der Citoyen, der sich seinen Anteil an der Macht erkämpft. All dies ist ihm zu modern, zu westlich. So lässt er in dem Roman „Königliche Hoheit“ (1909) mit S. N. Spoelmann zwar einen Kapitalisten amerikanischer Prägung auftreten. Dessen Funktion besteht jedoch letztlich darin, mit seinen erheblichen Mitteln die vormodernen Strukturen eines kleinen Fürstentums zu bewahren. Es sind nämlich romantische Vorstellungen von Bürgertum und Politik, denen der Autor anhing. Der ganze Text der „Betrachtungen“ ist ein Dokument des konservativen Antimodernismus, der mit der Entwicklung der Gesellschaft nicht klar kommt. Dessen einziges Refugium bleiben dann nur Kunst und Bildung. (Für einen europäischen Vergleich siehe den letzten Band seiner Geschichte des langen 19. Jahrhunderts von Eric Hobsbawm: Das imperiale Zeitalter, 1989). Dies scheint auch in der DDR nicht anders gewesen zu sein. Uwe Tellkamp beschreibt in seinem prämierten Roman „Der Turm“ – vom Verlag mit den Buddenbrooks verglichen – den Verfall einer (Bildungs-)Bürgerfamilie in Dresden, die sich recht gut mit den politischen Verhältnissen arrangiert hat. Auch hier entstehen zaghafte Formen des Protestes erst, als die Behaglichkeit des Lebens in Hausmusik und den großen Werken der Literatur gestört wird. Die Tugenden der Bürgerlichkeit? Vielleicht sind sie doch eher schöne Tagträume und euphemistische Beschreibungen von Wunschbildern als Realität. Bildung, so Goethe, war der Adelsschlag des Bürgertums. Doch hatte diese bei Humboldt noch emanzipatorischen Charakter, war gerade nicht so antipolitisch, wie Mann sie beschreibt. Es wurde jedoch die zentrale Einrichtung ihrer Vermittlung, das humanistische Gymnasium, recht bald zu einer geistlosen Paukschule. Thomas Mann weist selbst darauf hin: Die letzten Kapitel der Buddenbrooks befassen sich fast nur mit der Schule. Er spricht von einer „Verpreußung und Enthumanisierung des neudeutschen Gymnasiums“ (239; vgl. auch G. Ruppelt: Professor Unrat und die Feuerzangenbowle, 2004). Die Schule in einer Gesellschaft hat allerdings stets die Form, die diese 205 Document1 15.05.16 Gesellschaft will. Sie ist zentraler Ort der Habitus-Entwicklung, so dass die Schulgeschichte Aufschlussreiches über die Geschichte dem Mentalitäten verrät. Es ist daher kein Zufall, dass die Veränderung der Schule mit einer Veränderung der Bürgerlichkeit einhergeht. Die Lektüre von Thomas Mann – gerade auch seiner politischen Schriften – lohnt sich. Sie lohnt sich gerade dort, wo er irrt. Denn wenn sich große Geister irren, tun sie dies auf eindrucksvolle Weise, die oft lehrreicher ist als viele politisch-korrekte Ausführungen. Meine These ist, dass die antimoderne Bürgerlichkeit bis heute lebendig ist (Lepenies: Kultur und Politik 2006). Dass der Einfluss des Protestantismus auf unser Denken über Kultur und Bildung lebendig ist. Dass die immer noch aktuelle Affinität zum (Kultur-)Staat wesentlich auf diesen mentalitätsgeschichtlich nachweisbaren langlebigen Einfluss dieser Verbindung von apolitischem Bürgertum und Protestantismus zurückzuführen ist. Die „Betrachtungen“ werden so entgegen ihrer Kernbotschaft, nämlich des Plädoyers, unpolitisch, ja a(nti)politisch sein zu müssen, zu einem eminent politischen Buch. Man kann eben nicht nicht-politisch sein, denn auch dies ist eine politische Haltung, die meist denen nützt, mit denen man nichts zu tun haben will. Dieser Text ist Teil eines umfangreicheren Textes „Die kulturellen Grundlagen der Kulturpolitik“, der in Kürze auf der Homepage des Kulturrates zu finden sein wird. 206 Document1 15.05.16 Künste wirken – aber bei wem? Warum die Kunst ein Publikum und das Publikum die Kunst braucht 1. Problemstellung Ohne Kunst ist menschliches Leben ein unvollständiges Leben! In dieser Aussage steckt nicht nur eine Menge anthropologischer Einsichten, sie ist sogar auf höchster Ebene menschenrechtlich abgesichert. Es gibt aber auch die Umkehrung dieser Aussage: Nur durch Menschen, die die Kunst nutzen, wird diese zur Kunst: Kunst braucht notwendigerweise ein Publikum. Auch diese kunsttheoretische Einsicht ist gut begründet. Eigentlich müsste doch daher alles in bester Ordnung sein. Doch zerstört auch hier die Soziologie und insbesondere die empirischen Nutzerstudien die heile Welt der Theorie: Viele Menschen haben nur begrenzt Kontakt zu dem, was wir zu den Künsten zählen, und vieles an Kunstproduktionen findet nur begrenzt Zuspruch beim Publikum. Vielleicht, so könnte ein Einwand aus der Sicht der Theorie, die sich noch nicht geschlagen geben will, lauten, liegt dies daran, dass wir ein zu enges Verständnis von Kunst haben. In der Tat ist bei der Rede von „Kunst“ oft genug die Dominanz eines Verständnisses festzustellen, das gerade mal 200 Jahre alt ist und seine primäre Gültigkeit nur in Mitteleuropa und sehr stark in Deutschland fand. Denn das Verständnis von „Kunst“ hängt sehr stark von Ort und Zeit ab und es sind die endlosen Debatten über U und E, über Hoch- und Breitenkultur, über Profi- und Laienkunst gerade in Deutschland traditionell besonders intensiv. Man wird also genauer hinsehen müssen bei den Nutzerstudien, aber auch bei der Frage möglicher Kunstwirkungen. Dies soll im folgenden daher etwas ausführlicher dargestellt werden: Eine anthropologische Begründung der Notwendigkeit von Kunst, eine soziologische Analyse der Teilhabe und eine Erörterung der Frage, welche Kunst wer braucht und bekommt. Zum Abschluss werden einige politische und pädagogische Konsequenzen gezogen. 207 Document1 15.05.16 2. Wozu Kunst – die Lehren der Anthropologie Es gibt kaum einen Philosophen, der sich nicht mit Kunst befasst hat, selbst wenn „Kunst“ im heutigen Verständnis erst seit dem 18. Jahrhundert, nämlich seit Alexander Baumgarten, verwendet wird. Man reflektierte vielmehr über Schönheit und Ordnung, über Symmetrie und Proportion. Es war schließlich Kant, der mit seinen drei Kritiken (erneut) die Grundlage für die Dreigliederigkeit der Philosophie gelegt (Erkennen, Handeln und Geschmacksurteil) und damit das Studium des Wahren, Guten und Schönen als zentrale Aufgabe der Philosophie bestätigt hat. Interessant seine Kurzfassung der zentralen Probleme: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und alle drei Fragen münden letztlich in der Frage: Was ist der Mensch? (Offensichtlich hat hier die religiöse Frage die Ästhetik zunächst einmal verdrängt. Möglicherweise hängt jedoch beides mit der Frage nach dem Sinn eng zusammen). Damit wird Anthropologie nicht nur zu einer Art philosophischer Königsdisziplin. Sie gibt durch ihre pure Existenz zugleich eine Antwort auf die gestellte Frage nach dem Menschen: Der Mensch ist offensichtlich dasjenige Wesen, das ständig reflexiv danach fragt, was es denn eigentlich „ist“. Der kanadische Philosoph Charles Taylor spricht daher vom Menschen als dem sich ständig selbst interpretierenden Tier. Viele andere Antworten konkurrieren miteinander bei der Frage, was den Menschen zum Menschen macht: Werkzeuggebrauch und -herstellung, Sprache, Wissenschaft, Politik, Religion und natürlich immer wieder auch die Kunst. Tatsächlich hat man in der Frühgeschichte des Menschen, die für die Beantwortung dieser Frage eine besondere Relevanz bekam, stets Technik, Religion, Erkenntnis und Ästhetik gemeinsam gefunden: Ästhetisch gestaltete Werkzeuge, Wandmalereien an kultisch-religiösen Orten, alte Musikinstrumente. All dies erscheint gerade in der Vermischung von Religion, Ästhetik und Technik verwirrend. Diese Verwirrung löst sich vielleicht ein wenig, wenn man berücksichtigt, dass die Trennung in unterschiedliche Disziplinen nicht der Arbeitsweise unseres Bewusstseins entspricht und neueren Datums ist: Weder hat der frühzeitliche Mensch solche Einzeldisziplinen wie Moralphilosophie oder Erkenntnistheorie gekannt, noch ist diese Trennung im heutigen Alltagsgeschäft des Überlebens relevant. Stets gehen Erkennen, moralisches und ästhetisches Urteilen Hand in Hand. Ernst Cassirer (1990) hat diesen Gordischen Knoten, die Frage also nach der Priorität, in seiner „Philosophie der symbolischen Formen“ gelöst: Er unterschied nämlich (mindestens) acht Weltzugangsweisen des Menschen, nämlich Religion und Mythos, Politik und Technik, Wirtschaft und Sprache und schließlich Wissenschaft und Kunst als gleichberechtigte Weisen, 208 Document1 15.05.16 mit denen der Mensch die Welt erfasst. Gleichberechtigt sind sie, weil sie alle notwendig sind, wobei jede dieser Weltzugangsweisen die Welt unter einem anderen „Brechungswinkel“ erfasst. Möglich wird diese Form der komplexen Welterfassung durch eine Besonderheit, die zeitgleich der Biologe und Philosoph Helmut Plessner (1976) entdeckte und beschrieb: Der Mensch entwickelte in der Anthropogenese die Fähigkeit, quasi virtuell neben sich zu treten und sich selbst zum Gegenstand von Betrachtungen zu machen. Er lebt also gerade nicht mehr (instinktgesteuert) aus seiner Mitte, sondern aus einer „exzentrischen Positionalität“ heraus. Diese Fähigkeit zur Reflexivität ist der Motor der Entwicklung der Menschen, der seither den Verlust seiner automatischen Instinktsteuerung mit der Fähigkeit zu bewusstem handeln kompensiert. Bis heute wird dieser Grundgedanke Plessners bestätigt (Tomasello 2006). Der Mensch kann und muss sein Leben selber führen, muss selber die notwendigen Entscheidungen treffen, die sein Überleben sichern. Kunst ist gleichberechtigter Teil dieses Überlebensprozesses. Die Anthropologie, die es auf abstrakter Ebene mit dem Gattungswesen Mensch zu tun hat, kommt also zum Schluss: Kunst für alle. Und genau dies formuliert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, formuliert der Pakt über soziale, ökonomische und kulturelle Rechte, formuliert die Kinderrechtskonvention. Da Menschrechte nicht teilbar sind, sondern stets universell „für alle“ gelten müssen, haben die politischen Slogans „Bildung für alle“ (Comenius) oder „kulturelle Bildung für alle“ (UNESCO) ein tragfähiges anthropologische Fundament. Gerade im Geburtsjahr Darwins und 150 Jahre nach dem Erscheinen seiner „Entstehung der Arten“, der dreizehn Jahre später die „Abstammung des Menschen“ folgte, sind einige weitere Hinweise interessant, die die Erkenntnisse der Philosophen stützen. So kann man zeigen, dass viele ästhetische Aspekte unmittelbar eine Bedeutung bei dem Kampf ums Überleben haben. Darwin selbst studiert die Rolle der „Schönheit“ bei den Männchen im Tierreich als Faktor bei der Wahl des Sexualpartners. Wem dies zu abwegig erscheint, mag einmal bei Wolfgang Welsch (2004), anerkannter zeitgenössischer Ästhetiker, nachlesen, welch hohe Bedeutung die Entwicklung des ästhetischen Verhaltens bei den Tieren (vor der Entstehung des Menschen) hatte. Hierbei bezieht er sich immer wieder auf die Studie von Darwin. Eher spekulativ formulierte Arnold Gehlen (1950) die These, dass die Herkunft der Musik etwas mit den akustischen Warnsignalen bei der Annäherung eines Fressfeindes zu tun hatte: Als der Mensch Macht über die Gestaltung seiner Lebensbedingungen erworben hatte, konnte er sich gelassen an diese Warnsignale erinnern und dabei eine Freude über die gewonnene Freiheit genießen, nämlich nicht mehr instinktmäßig in einen Fluchtreflex verfallen zu müssen. Der Genuss an Musik wird so aufs engste mit einem Genuss an Freiheit verbunden. Und genau 209 Document1 15.05.16 dies bewirkt Musik bis heute: „In jedem Fall gewinne ich über die Musik eine neue Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber den Anfechtungen und Wirrnissen des Naheliegenden …“, so der Psychologe und Musiker Klaus Holzkamp (1993, 70). Auch eine andere Erklärung der Genese des Ästhetischen wird heute reichlich genutzt: In dem Augenblick nämlich, in dem der Mensch die Bewusstheit über seine Lebensumstände erlangt, wird ihm die ständige Präsenz von Fressfeinden bewusst. Angst ist die Folge, und übermächtige Angst führt letztlich zum Wahnsinn. Hier kommt das Ästhetische ins Spiel: nämlich als expressiver Ausdruck von Emotionen, der diese sozial verhandelbar macht, der ihnen eine gegenständliche Form gibt (Neumann 1996). Ein letzter Befund betrifft die Tatsache, dass nicht alle ästhetische Gestaltung unmittelbar funktional mit Überlebensfunktionen erklärt werden kann. Hier hilft die gut belegte Erklärung der Anthropologin und Ethnologin Ellen Dissanayake (2002) weiter. Ihre These: Ästhetische Gestaltung macht überlebensrelevante Ereignisse oder Dinge des Alltags besonders, hebt sie hervor und emotionalisiert sie. So entstehen Rituale, kultische Ereignisse, geschmückte Werkzeuge und Waffen, so dass indirekt die Ästhetik dann doch Überlebensrelevanz erhält. Es trifft also zu: Ohne Kunst ist menschliches Leben unvollständig, sogar: Ohne Kunst hätte menschliches Leben nicht entstehen können! Doch ist es ein weiter Begriff von Kunst, ist es nicht (nur) die Kunst des europäischen Kulturkanons, die Kunst der Hochkultureinrichtungen. Diese „Kunst“ ist erst im 19. Jahrhundert entstanden und hat sehr viel mit der problematischen Geschichte des deutschen Bürgertums zu tun: Politisch chronisch erfolglos brauchte es Orte zur Stärkung einer eigenen Identität. Und so entstanden Theater, in denen Stücke gespielt werden, bei denen Bürger die früher nur Adligen vorbehaltene große Emotionen erlitten (das bürgerliche Trauerspiel). Es entstanden Museen, die Zeugnis von der kulturellen Kompetenz des Bürgertums ablegen sollten (vgl. Nipperdey 1990). Und es war gerade die „autonome Kunst“, die diesen sozialen und politischen Effekt erzielten. Wer heute also die gerne vollmundig verwendete „Kunstautonomie“ im Munde führt, kolportiert zunächst einmal nur eine 200-jährige Ideologiegeschichte der Kunst. Künste wirken natürlich – inzwischen vielfältig belegt. Und sie wirken vor allem dadurch, dass man sich im Ästhetischen handlungsentlastet („ohne Zweck“, so Kant) verhalten kann. Schiller nutzte dies für seine politische Vision: Wenn der Mensch erst einmal die Freiheit des Handelns in der Kunst gespürt hat, dann überträgt er dies auch auf sein politisches Verhalten. Die Dialektik ist also diese: Gerade die autonome Kunst erfüllt die gewünschte politische Funktion. Der Autonomie-Topos – es geht letztlich immer um die „zunehmende Selbstbefreiung des Menschen“ (Cassirer) – gehört letztlich zur Moralphilosophie, hat etwas mit der Selbstgesetz210 Document1 15.05.16 gebung des Menschen zu tun und ist am besten in Artikel 1 des Grundgesetzes aufgehoben: nämlich in der Würde des Menschen. Kunstwerke haben lediglich eine „geliehene Autonomie“ (He-Autonomie, so F. Schiller) in der oben vorgestellten Bedeutung. Leider ist diese Autonomie zu oft zu einer Legitimationsfloskel verkommen, die nur noch das Betriebssystem Kunst stützen soll. Es liegt auf der Hand, dass dies legitimerweise mit der hier vorgetragenen anthropologischen Begründung nicht statthaft ist. 3. Zur Nutzung der Künste – ein kultursoziologischer Schock Die Anthropologie und Kunstphilosophie haben es jeweils mit dem Menschen an sich und der Kunst an sich zu tun, also Allgemeinbegriffen, die es in der Realität nicht gibt. Auf dieser allgemeinen Ebene ist es leicht, die These einer „Kunst für alle“ zu vertreten. Doch wie steht es mit der tatsächlichen Nutzung. Zwei Wege sind denkbar. Die Frage nach der Nutzung vorhandener Kultureinrichtungen: Wer geht wie oft wohin? Und die Frage nach kulturellen Interessen der Menschen: Wer interessiert sich wie oft wofür und was tut er dann? Zu beiden Fragerichtungen finden sich Studien. Viele Kultureinrichtungen führen Nutzerstudien durch, manche wie die Theater oder Musikschulen sogar regelmäßig. Die Ergebnisse sind bekannt: Es ist kein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, der sich auf den hochsubventionierten Plätzen in den Theatern, Opern- oder Konzerthäusern findet. Auch die Museen, wenn sie nicht gerade von Schulklassen bevölkert werden, erreichen nur ein bestimmtes Publikum. Woran liegt das? Ist es nur das Marketing, das nicht funktioniert? Diese Frage hat natürlich auch die Kultursoziologie beschäftigt. Und hier ist es immer noch der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1987), der unerfreuliche Antworten gibt. In der bislang umfangreichsten empirischen Studie, allerdings schon in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, kam er zu dem Ergebnis, das er selbstbewusst die „vierte narzisstische Kränkung“ der Menschheit nannte. Zur Erinnerung: Kopernikus fügte uns die Kränkung zu, nicht im Mittelpunkt des Universums, noch nicht einmal im Mittelpunkt unseres eigenen Sonnensystems zu stehen. Darwin zeigte, dass die „Krone der Schöpfung“ eher ungeliebte haarige Verwandte hat. Freud schließlich zerstörte den Mythos der Steuerung durch Vernunft: Es waren eher Regionen im unteren Körperbereich, die die Entscheidungen für uns treffen. Und nun Bourdieu. Kunst ist autonom, Kunst befördert das Gute im Menschen, Kunst ist der Weg zur Entfaltung der vollen Humanität: Diese Kernsätze der idealistischen Autonomieästhetik sah er durch seine Studien vollstän211 Document1 15.05.16 dig widerlegt. Jeder Mensch hat seinen Platz in der Gesellschaft – dies klingt harmlos. Jeder Mensch hat spezifische ästhetische und kulturelle Bedürfnisse in Hinblick auf Freizeit, Möbel, Kleidung und Kulturkonsum. Auch dies klingt harmlos. Bourdieu zeigte nun zweierlei: Jeder Platz in der Gesellschaft korrespondiert mit klar identifizierbaren kulturellen Präferenzen. Sage mir, was du kulturell tust, und ich sage Dir, wo Du hingehörst. Dies klingt schon nicht mehr harmlos. Und noch weitreichender ist die (durchaus belegte) These, dass sich ästhetische Präferenzen von Generation zu Generation „fortpflanzen“, so dass im Endeffekt die (für Bourdieu ungerechte Klassen-)Gesellschaft sich durch Kunst und Ästhetik immer wieder identisch reproduziert. Nun sind diese Studien 40 Jahre alt. Gelten sie denn überhaupt noch? Leider muss man diese Frage bejahen: Jede Nutzerstudie zeigt erneut die enge Korrelation zwischen spezifischen Kulturprogrammen und sozialem Milieu. Der verbreitetste Ansatz findet sich in den SINUS-Studien (www.sinus-sociovision.de), die deshalb inzwischen auch als Marketing-Instrument genutzt werden. Mit bestimmten ästhetischen Botschaften erreiche ich ein bestimmtes vorhersagbares Milieu – und grenze die anderen Milieus aus. „Kunst für alle“ funktioniert also nicht, wenn man darunter dasselbe Angebot meint, das alle nutzen sollen. Es ist also zu differenzieren, welche Kunst für wen angeboten wird. Und es stellt sich dann die Frage, ob die zahlreichen Wirkungsbehauptungen (in Fuchs/Liebald habe ich 90 zusammengestellt) wirklich für jede Kunstform und bei jedem Publikum gelten. Doch zunächst ein Blick auf die potentiellen Nutzer. Hier sind es die verdienstvollen Studien des Zentrums für Kulturforschung, etwa das Jugendkulturbarometer (Keuchel/Wiesand 2006). Kulturpessimisten erhalten hier ordentlich Argumentationsfutter. Denn das Interesse Jugendlicher an Angeboten der „Hochkultur“ geht nur selten in den (niedrigen) zweistelligen Bereich. Es ist eher Eminen als Mozart, aber interessanterweise ist es durchaus der Picasso im Museum, der interessiert. Ähnliche Erfahrungen hat man in den Niederlanden gemacht: Jugendliche erhielten Kulturgutscheine für einen Gratisbesuch einer Kulturveranstaltung. Es wunderte sich vermutlich keiner, dass überwiegend Pop und Rockkonzerte genutzt wurden. Natürlich sind unsere Musikschulen voll. Natürlich liefern Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ zahlreiche hochtalentierte Jugendliche. Natürlich gibt es das hochqualifizierte Bundesjugendorchester. Doch ändert dies kaum etwas an dem generellen Befund. Auch wenn man den Blick auf Ältere richtet, so ist es auch dort nicht der Querschnitt, sondern es sind diejenigen, die immer schon Theater und Opernhäuser, Vernissagen und Kunstausstellungen besucht haben. Was tun die Kultureinrichtungen in dieser misslichen Lage? 212 Document1 15.05.16 Man kann die Beantwortung dieser Frage mehrfach angehen (Mandel 2008). Man kann sich im Interesse einer verbesserten Platzauslastung mit geschickteren Marketingstrategien befassen, die vorschlagen, mit passfähigeren Angeboten neue Zielgruppen zu erschließen. Man importiert hierzu – etwa aus dem angelsächsischen Bereich – Ansätze eines „audience developments“. Weiter führt auch die Nicht-Besucherstatistik des Deutschen Bühnenvereins. So teilten jugendliche Nicht-Besucher mit, dass ihnen im Theater die Möglichkeit fehlt, Freunde zu treffen. Man kann daher „Events“ so organisieren, dass sie den vermuteten Unterhaltungsund Sozialbedürfnissen neuer Zielgruppen entgegenkommen (z. B. „Lange Nacht der Museen“). Solche Maßnahmen können betriebswirtschaftlich (bessere Platzauslastung und damit höhere Einnahmen), sie können auch politisch motiviert sein (erhöhte Legitimation der Kulturausgaben durch Erreichen größerer Bevölkerungskreise). Sie können natürlich auch durch die im letzten Abschnitt vorgetragenen Argumente für die Notwendigkeit von Kunst für jeden von uns motiviert sein. Interessant ist der Ansatz von Bourdieu. Zwar glaubte er kaum die vollmundigen Thesen zur Humanisierung durch Kunst. Doch waren die politischen Folgen des ungleich verteilten Kunstkonsums ihm wichtig genug, um auf Abhilfe zu sinnen. Eine Gelegenheit bot sich ihm, als der französische Präsident das Collège de France beauftragte, ein nationales Curriculum zu entwickeln. Bourdieus Ansatz bestand darin, eine Kompetenz im Umgang mit (auch elaborierten) ästhetischen Codes allen SchülerInnen zu vermitteln, so dass familiär bedingte Privilegien ein Stück weit abgebaut werden. Dieser Ansatz entspricht durchaus der demokratischen Vision von Schule in der bürgerlichen Gesellschaft, die immerhin einmal angetreten war, Gleichheit an die Stelle von Standesunterschieden zu setzen. Doch warum sollen Jugendliche Mozart und nicht Eminen lieben? Was macht eigentlich den Unterschied zwischen U und E aus und was an den Künsten entfaltet welche Wirkungen: soziale, individuelle oder politische? Natürlich lässt sich diese anspruchsvolle Fragestellung hier nicht beantworten. Es können lediglich einige Hinweise gegeben werden. Zum ersten: Es gibt und gab lange Zeit mehr Wirkungsbehauptungen als handfeste Belege. Ich selbst habe 1995 90 Wirkungsbehauptungen von Kunst gesammelt, die insgesamt alles versprachen, was toll und wichtig war und die nur einen Schönheitsfehler hatten: Sie waren fast alle ohne irgendeinen Beweis. Andererseits nutzt man ständig politisch und pädagogisch die Künste: Von dem erzieherischen Wert der Jagdszenen auf den Höhlenwänden über die kunstvolle Inszenierung von Brot und Spielen in Rom und den Reichsparteitagen in Nürnberg bis zur Überdominanz ästhetischer Aspekte in der Werbung. Wer Geld ausgibt weiß, dass er es sinnvoll tut. Also muss es eine Wirkung geben. Dies wusste schon Platon, der die Musik 213 Document1 15.05.16 als staatstragend in der Polis akzeptierte, das Theater jedoch als sittenverderbend fortjagen wollte. Doch was ist es an den Künsten, das wirkt? Einige Aspekte: Künste finden in einem sozialen Prozess statt. Die aktuelle Kunsttheorie geht sogar davon aus, dass Kunst erst im sozialen Gebrauch zu einer solchen wird (Bluhm/Schmücker 2002). Für das Theater war dies immer schon selbstverständlich. Denn Theater findet nur dann statt, wenn Person A die Rolle B für die Person C (das Publikum!) spielt. Auch was Kunst ist, wird im Diskurs zwischen denen festgelegt, die etwas davon verstehen: den KünstlerInnen, den Museumsmenschen, Kritikern, Kunstprofessoren, Mäzenen, Kunsthändlern, Ausstellungsmachern. Wer dies nicht glaubt, sei an den permanenten Misserfolg jener erinnert, ein „Wesen“ der Kunst im Werk zu finden. Spätestens seit der Anerkennung der Ready Mades von Duchamps kann keine Rede mehr von einem solch essentialistischen Kunstverständnis sein. Also: Die soziale Inszenierung und Organisation von Kunst ist ein Urheber ihrer Wirkung. Der Besucher stellt sich um auf eine besondere Wahrnehmungssituation. Er nimmt im Modus des Ästhetischen wahr, was es heißt: Er ist handlungsentlastet, er darf sanktionsfrei nach dem Sinn des Ganzen fragen, darf das „freie Spiel seiner Erkenntnisvermögen“ (so Kant und Schiller) genießen und hierbei neue Möglichkeitswelten (Musil) entdecken. Das funktioniert, zweifellos. Es funktioniert bei Ready Mades und bei Picasso, es funktioniert aber auch beim Film, bei Pop und Rock. Und: Es funktioniert auch beim Spiel. Das heißt, auf die ästhetische Qualität als Gestaltqualität des Werkes kommt es hierbei gerade nicht an. Trotzdem stellen sich soziale, politische und Bildungswirkungen ein. Also lassen wir uns auf das Werk ein. Hier ist das Buch des amerikanischen Kunsttheoretikers Shusterman (1994) interessant, der nach den Kriterien und Maßstäben der klassischen Ästhetik populärkulturelle Werke – z. B. Rap – untersucht mit dem Ergebnis, dass selbst eine streng durchgeführte Analyse nach Formgesichtspunkten nicht das erwartete Ergebnis erbringt: Dass sich ästhetische Qualität leicht nach U und E sortieren lässt. Viele Kunsttheorien und Ästhetikkonzeptionen berücksichtigen dies. Schon Kant befasste sich mit der ästhetischen Erfassung der Natur („Erhabenheit“). John Dewey verankerte Ästhetik (ebenso wie das Erkennen) in der Lebenswelt und im praktischen Handeln der Menschen (vgl. Eagleton 1994). Man muss es eingestehen: Die Geschichte der Kunst ist – seit Baumgarten Ästhetik als philosophische Disziplin (sinnliches Erkennen) und einen einheitlichen Kunstbegriff (der Literatur, Musik, Bildende Kunst zusammenfasste) begründet hat – nicht nur eine Abfolge von Theorien: Ein Teil des Nachdenkens über Kunst hat sehr stark ideologischen Charakter und ist eher in Kategorien der Machttheorie von Bourdieu zu verstehen. 214 Document1 15.05.16 Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Wolfgang Petry und Beethoven? In der Tat gibt es erhebliche Unterschiede in der Komplexität der Werke, gibt es demzufolge auch Unterschiede in den bildungsmäßigen Voraussetzungen für eine Rezeption gerade von moderner Kunst. Denn immerhin haben Künstler seit 200 Jahren immer wieder äußerst geschichtsbewusst versucht, das jeweils vorherrschende Verständnis von Kunst zu revolutionieren. Ich glaube, man muss dieses Problem als weitgehend offene Forschungsfrage formulieren. Denn zum einen ist in allen Kunstformen das Problem nicht geklärt, was jeweils „ästhetische Qualität“ bedeutet. Und empirische Studien darüber, welche ästhetische Qualität welche Wirkungen hat, sind mir nicht bekannt. Wenn dies der Fall sein sollte, dann erweist sich die Unterscheidung von U und E als hochideologisch, dann ergeben sich zudem einige kritische Fragen an die öffentliche Kulturförderung. 4. Konsequenzen Für das Thema dieses Textes hat die missliche Forschungssituation einige Vorteile. Denn bleibt es dabei, dass es schwierig wird, in einer ästhetischen Qualitätsperspektive die unterschiedlichen Kunstdarbietungen zwischen U und E zu unterscheiden, dann wäre bildungstheoretisch der Befund der Nutzerstudien wenig aufrüttelnd: Es wäre weitgehend gleichgültig, womit sich der Mensch befasst, Hauptsache, er tut irgendetwas im Bereich der künstlerischästhetischen Praxis. Dies hieße aber, dass einige Vorstellungen über gute und schlechte Kunst, so wie sie auch in Lehrplänen sichtbar werden, überprüft werden müssten. Auch die subjektbezogene Sicht, nämlich aus der Perspektive der ästhetischen Erfahrung des Menschen zu Werturteilen über die Qualität zu kommen, kommt zu keinem anderen Ergebnis. Nun sind diese beiden Perspektiven nicht die einzigen. Zum einen braucht es eine hohe Qualität im Kunstbereich, wenn dieser als Ganzes seine – auch gesellschaftliche – Funktion erfüllen soll, nämlich der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Auch die Profis im U-Bereich haben meist eine gediegene Ausbildung im E-Bereich, zumal in anderen Ländern diese Grenze eine weitaus geringere Rolle spielt (man denke etwa an Leonard Bernstein, der alle Felder bearbeitete). Und schließlich ist auch der Erhalt des Kunstbetriebes ein legitimes Ziel. Denn zum einen bietet dieser den jungen zeitgenössischen Künstlern ein Forum, ihre künstlerische Auseinandersetzung mit der Gegenwart zu präsentieren. Zum anderen ist auch die kulturelle Tradition bewahrenswert. Viele Themen (Geiz, Hass, Liebe, Neid, Gier etc.) sind nämlich zeitlos, weshalb uns auch die Klassiker immer noch etwas zu sagen haben. Nicht zuletzt ist die Bourdieusche soziologische Analyse des Machtfaktors von Belang. Wenn Kunst zur sozialen Gliederung der Gesellschaft beiträgt, so wie es der französische Großmeister beschrieben 215 Document1 15.05.16 hat, dann lohnt es sich in demokratietheoretischem Interesse, gerade auch die elaborierten ästhetischen Codes zu demokratisieren. Literatur Bluhm R./Schmücker, R. (Hg.): Kunst und Kunstbegriff. Der Streit um die Grundlagen der Ästhetik. Paderborn: Mentis 2002 Bollenbeck, G.: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. München: Insel 1994. Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987. Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Frankfurt/M.: Fischer 1990 (Original: 1944). Dissanayake, E.: What is art for? Seattle: Univ. of Washington Pr. 2002 Eagleton, T.: Ästhetik. Die Geschichte ihrer Ideologie. Stuttgart/Weimar: Metzler 1994. Frey, G.: Anthropologie der Künste. Freiburg/München 1994. Fuchs, M./Liebald, Chr. (Hg.): Wozu Kulturarbeit? Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik und ihre Evaluierung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Remscheid: BKJ 1995. Fuchs, M.: Mensch und Kultur. Anthropologische Grundlagen von Kulturarbeit und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Fuchs, M.: Aufbaukurs Kulturpädagogik. Band 2: Kunsttheorie und Ästhetik für die Praxis. Remscheid RAT digital 2005. Fuchs, M.: Kulturelle Bildung. Theorie und Praxis. München: Kopaed 2008 Gehlen, A.: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn: Athenäum 1950. Gethmann-Siefert, A.: Einführung in die Ästhetik. München: Fink 1995. Holzkamp, K.: Musikalische Lebenspraxis und schulische Musik lernen, In: Forum Kritische Psychologie 32, Hamburg: Argument-Verlag 1993. Keuchel, S./Wiesand, A. (Hg.): Das 1. Jugendkulturbarometer "Zwischen Eminem und Picasso". Bonn: ARCult 2006 Mandel, B. (Hg.): Audience Development, Kulturmanagement, Kulturelle Bildung. München: Kopaed 2008 Neumann, E.: Funktionshistorische Anthropologie der ästhetischen Produktivität. Habil. FU Berlin 1996. Nipperdey, Th.: Deutsche Geschichte. 1866 - 1918. Bd. I: Arbeitswelt und Bürgergeist. München: Beck 1990. Plessner, H.: Die Frage nach der Conditio humana. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976. Shusterman, R.: Kunst leben. Die Ästhetik des Pragmatismus. Frankfurt/M.: Fischer 1994 216 Document1 15.05.16 Tomasello, M.: Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006 Welsch, W.: Animal Aesthetics. Contemporary Aesthetics 2 (2004) 217 Document1 15.05.16 Kulturpädagogik zwischen Freiheit und Disziplinierung Überlegungen im Anschluss an Michel Foucault Es fiele leicht, zu dem Thema „Kulturpädagogik und Freiheit“ einige Seiten zu füllen, die ohne tiefergehende Widersprüche in der „Szene“ akzeptiert würden. Denn es entspricht natürlich dem Selbstbild der (Kultur-)Pädagogik, nur das Beste für den Menschen zu wollen – und Freiheit gehört dazu. Konzentriert man sich zudem auf die außerschulische Kulturarbeit, dann könnte man im Brustton der Überzeugung auf die kulturpädagogischen Arbeitsprinzipien in diesem Feld hinzuweisen (Partizipation, Freiwilligkeit, Fehlerfreundlichkeit, Stärkenorientiertheit etc.), die in einem Widerspruch zu dem Zwangscharakter von Schule stehen und geradezu Kulturpädagogik als eine Pädagogik der Freiheit konstituieren. Da der Kernbereich der Kulturpädagogik sich zudem mit ästhetischer Praxis und (z. T.) mit den Künsten befasst, wird die Akzeptanz eines solchen Selbstverständnisses noch größer. Denn die Künste gelten spätestens seit Kant und der idealistischen Autonomieästhetik als genuine Orte der Freiheit. Zugegeben: Gelegentlich brauchen die Akteure in diesem Feld eine solche Bestätigung, auf der richtigen Seite zu stehen, zu den „Guten“ zu gehören. Denn man leidet doch stark unter tatsächlichen oder auch nur vermuteten Marginalisierungstendenzen des eigenen Feldes. Allerdings entstehen so auch Mythen über die eigene Arbeit, die gelegentlich auf ihren Realitätsgehalt überprüft werden müssen. Sonst stellt man eines Tages überrascht fest, dass man auf Sand gebaut hat: Man muss sich gelegentlich auch verunsichern lassen. Für eine solche Verunsicherung der Selbstgewissheit der Kulturpädagogik taugen die Arbeiten von Michel Foucault. Dieser französische Philosoph, Psychologe und Historiker ist zwar schon seit rund zwanzig Jahren tot. Doch erst jetzt scheint er einen Siegeszug durch die deutsche Erziehungswissenschaft zu beginnen. Und dieser Siegeszug ist mit erheblichen Verunsicherungen verbunden (Ricken/Rieger-Ladich 2004). So ist es insbesondere der Subjektbegriff, der in die Kritik geraten ist. Ist es überhaupt noch vertretbar, von einem starken Subjekt auszugehen, das die Welt der Dinge, des Sozialen und letztlich sich selbst so beherrscht, dass es autonomes Steuerungszentrum seines Lebens sein kann? Ist es nicht ständig – und dies ist eine zweite Facette einer foucault-orientierten Zugangsweise – so in einer Vielfalt gesellschaftlicher Unterordnungsstrategien und Machtverhältnisse eingebunden (z.B. Foucault 2005, 546), dass von Autonomie und Freiheit überhaupt keine Rede sein kann, sondern vielmehr eine ständig raffinierter werdende Anpassung an jeweilige gesellschaftliche Verhältnisse unterstellt werden muss? „Regierung“ nennt Foucault das System aller Techniken und Strategien der Füh218 Document1 15.05.16 rung anderer Menschen und auch von sich selbst und eröffnet hiermit ein weites Untersuchungsfeld für die Erforschung der Bedingungen, unter denen die Produktion der jeweils gewünschten Form von Subjektivität stattfindet. Insbesondere hat er sich in seinen Vorlesungen zur „Gouvernementalität“ (ein Kunstwort, das dieses System von spezifischen Führungspraktiken erfasst, wobei es sich nicht nur um die „offiziellen“ Maßnahmen des Staates handelt) mit der Entwicklung der modernen Industriegesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert befasst und hierbei den Liberalismus und Neoliberalismus in seiner „Rationalität“ (also den hinter den einzelnen Führungspraktiken stehenden Denkformen und Logiken) beschrieben (Foucault 2006a und b). Diese Studien erweitern seine frühen Arbeiten zum Gefängnis, zum Krankenhaus und zur Schule, also einzelnen Einrichtungen, anhand derer er gezeigt hat, wie der Kranke, der Straftäter oder der Schüler durch die jeweilige Institution und der durch sie verkörperten Denkweise erst geschaffen werden: Der Mensch wird geformt und zugerichtet durch die Architektur, durch die spezifische Auffassung von Strafe, Krankheit oder Pädagogik, durch einen entsprechenden Blick der jeweiligen Profis. Verbreitet ist die Sichtweise, dass diese historischen Studien über vergangene Zeiten aktuell eine Position der Antipsychiatrie oder der Antipädagogik formulieren (gegen die sich allerdings Foucault immer wieder – ohne großen Erfolg – wehrt; vgl. die zahlreichen Interviews in seinen „Schriften“ zu dieser Thematik). Das Bild vom Menschen, das in der verbreiteten Foucault-Rezeption gezeichnet wird, ist daher ausgesprochen niederschmetternd: Es gebe nicht nur kein handlungsfähiges Subjekt, sondern wir seien vielfach in Unterdrückungssystemen so „total“ (im Sinne von Goffman) integriert, dass jede Form von Eigenständigkeit und Freiheit undenkbar würde. Als Schlussfolgerung ergibt sich in dieser Rezeption, dass Maßnahmen wie Lernverträge, die das lernende Subjekt mit in die Verantwortung für das eigene Lernen nehmen wollen, entwickelte Formen von Partizipation der Lernenden bei der Steuerung der Bildungseinrichtungen nichts anderes als neoliberale Strategien der individuellen Verantwortungszuweisung („Unternehmer seiner selbst“) seien, bei denen alleine der Einzelne die Last gesellschaftlicher Risiken tragen muss (vgl. als ein Beispiel L. Pongratz in Rihm 2003, s. auch Klingorsky 2009). „Im falschen Leben kann es kein richtiges Leben geben“, so seinerzeit Adorno und so eine einflussreiche aktuelle Lesart von Foucault. Für eine emanzipatorische Pädagogik bleibt hier keine Hoffnung. Auch Kulturpädagogik wird so zur raffinierten Speerspitze einer neuen Unterdrückungsform und zur unreflektierten Handlangertätigkeit im Interesse des neoliberalen Regimes. Was tun in dieser ausweglosen Situation? Eine, zugegeben zeitraubende Möglichkeit besteht darin, selbst Foucault zu lesen. Dabei sind es möglicherweise weniger die irritierenden Texte über griechische und römische Selbst-Techniken einer von ihm erneut in die Diskussion ge219 Document1 15.05.16 brachten Lebenskunst, obwohl diese Texte gerade unter der Perspektive von „Bildung als Selbstbildung“, nämlich einer (Individual-)Ethik – verstanden als reflektierter Umgangsweise mit sich und als Arbeit an sich selbst – Sinn machen. Es sind vielmehr die zahlreichen kleinen Schriften und Interviews, in denen er sich immer wieder kritischen Fragen informierter Gesprächspartner stellt (oder auch selbst in die aufschlussreiche Rolle des Interviewers schlüpft, vgl. Nr. 334 in Foucault 2005, Bd. 4). Es stellt sich bei dieser Lektüre durchaus ein Staunen ein. Denn dieser Foucault hat wenig mit dem nihilistischen Misanthropen in der verbreiteten deutschen Rezeption zu tun. Es entsteht vielmehr der Eindruck, als ob – wieder einmal – die subtile Dialektik eines Denkens auf eine eindimensionale Sicht verkürzt wird. Seine Denkweise hat dabei zahlreiche Parallelen zu den Arbeiten seines Kollegen am Collège de France, Pierre Bourdieu. So ist es zunächst ein streng relationales Denken: Begriffe sind Beziehungsbegriffe, müssen es sein, wenn sie Beziehungen erfassen wollen. Und um Beziehungen geht es. Beide beziehen sich hierbei auf den Symboltheoretiker Ernst Cassirer. Insbesondere ist Macht ein Beziehungsverhältnis. Wichtig dabei ist, dass Macht nicht einseitig als – ausschließlich negativ zu beurteilendes – Unterdrückungsverhältnis verstanden wird. Macht ist vielmehr eine soziale Beziehung, die beides tut: Eingrenzen und Ermöglichen, wobei „Täter“ und „Opfer“ nicht klar jeweils einer Seite zuzuordnen sind, und: Macht ist unvermeidbar. Jedes gesellschaftliche Verhältnis, so Foucault (2005, 450), ist ein Machtverhältnis. Zudem gibt es nicht nur ein einziges Machtverhältnis, sondern eine Vielfalt. Bourdieu verwendet hier den Begriff des Feldes, der mir auch bei Foucaults Analytik der Macht anwendbar erscheint. Jeder Einzelne ist zudem Teil verschiedener Felder. Ein weiteres dialektisches Moment ist das Subjekt selbst. Natürlich gibt es Prozesse der Anpassung, da der Einzelne handlungsfähig in einem System bleiben und damit vorgegebenen Regeln folgen muss. Aber gleichzeitig gibt es Aspekte der Autonomie, ist „Subjektivierung“, so bezeichnet Foucault diesen Prozess der Schaffung spezifischer Formen von Subjektivität, auch mit Handlungs- und Entscheidungsfreiheit verbunden. Foucault unterscheidet sehr genau zwischen diktatorischen und demokratischen Systemen, kämpft aktiv gegen Formen von Unterdrückung. Es ist – anders, als deutsche Rezipienten oft den Einruck erwecken – eben nicht gleichgültig, in welchem Regelsystem man lebt. In jedem Fall ist er gegen nostalgische Verklärungen der Vergangenheit, in der Unterdrückungssysteme vielleicht weniger subtil waren (ebd., 334). Dies gilt insbesondere für die Schule. Foucault ist kein Antipädagoge und schon gar kein Vertreter der Entschulung der Gesellschaft. Er beschreibt seine eigene Schule in Poitiers sogar ausgesprochen positiv: „Das Leben in der Schule war eine vor äußeren Bedrohungen ge220 Document1 15.05.16 schützte … Umgebung. Und die Vorstellung, geschützt in einer lernbegierigen Umgebung, in einem intellektuellen Milieu zu leben, hat mich immer fasziniert. Das Wissen muss als etwas funktionieren, was die individuelle Existenz schützt und die Außenwelt zu begreifen erlaubt. … Das Wissen als ein Mittel des Überlebens, dank des Verstehens.“ (Foucault 2005; S. 646, vgl. dagegen 234). Damit unterschlägt er nicht Formen der Unterdrückung. Im Gegenteil. Häufig weist er darauf hin, dass ihn vor allem die Formen von Widerstand interessieren, in denen der Einzelne für seine Handlungsfähigkeit kämpft. Und dieses Kämpfen ist Handlung, ist Praxis, ist Aktivität. Foucault ist zudem kein ausschließlicher Symboltheoretiker. Er ordnet sich selbst – ebenso wie sein gelegentlicher politischer Bündnispartner und Schulfreund früherer Jahre Bourdieu – in die Reihe derer ein, für die die Praxis eine entscheidende Rolle spielt: „Das Subjekt wird nicht nur im Spiel der Symbole konstituiert.“ (Foucault 2005, S. 494). Daher untersucht er eben nicht nur Diskurse auf der reinen Symbolebene. Er analysiert reale Praktiken. Das heroische Subjekt ist sicherlich tot, hat es nie gegeben, höchstens als humanistische Vision idealistischer Denker. Aber der handlungsfähige Einzelne existiert, besser: kann geschaffen werden, oder noch genauer: kann sich selber schaffen. Damit sind wir bei dem späten Foucault, dem Theoretiker der Techniken des Selbst angelangt. Der Einzelne, so Foucault in klassischer philosophischer Tradition, wird zum Subjekt durch die bewusste und gezielte Entwicklung von Selbst- und Weltverhältnissen. Bewusst stimmt er der Konzeption von Habermas zu, der den Einzelnen in seiner Beziehung zur Welt der Dinge („Wissen“) und zur Welt der Anderen („Macht“) sieht. Er ergänzt dies durch die Betonung der Entwicklung eines bewussten Verhältnisse zu sich („Ethik;“ S. 705 in Foucault 2005). Alle drei Beziehungstypen lassen sich nur analytisch von einander trennen: Man weiß natürlich, dass die Herrschaft über Dinge nur über die Beziehungen zu den anderen Menschen erfolgt; und dies impliziert immer auch Beziehungen zu sich, und umgekehrt, so Foucault. Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine klassische Bestimmung von Bildung als Entwicklung einer bewussten Beziehung zu sich, zu anderen, zur Natur und Kultur und zu seiner Geschichte und Zukunft. In jeder der möglichen Dimensionen der Persönlichkeit spielt dabei der Selbstbezug eine entscheidende Rolle: Selbst-Erkenntnis, Selbst-Führung, Selbst-Beziehung. Dies ist es, was – durchaus in klassischer Tradition – den Einzelnen zum Subjekt macht. Diesen Prozessen spürt Foucault im hellenistischen und römischen Denken nach, wobei er die elaborierten Selbsttechniken – die „Sorge um sich“ – am Beispiel der Sexualität aufzeigt. Er zeigt, wie stark diese systematische Arbeit an sich selbst im Mittelpunkt des Denkens stand – lange vor der „Entdeckung des Individuums“ in der Renaissance (Fuchs 2001). Dabei wird der „Bruch“, der sich während der 221 Document1 15.05.16 Renaissance politisch und geistig anbahnt, gerade nicht negiert. Denn in dieser Zeit identifiziert Foucault den Wechsel im Machttypus vom „Gerechtigkeitsstaat“ des Mittelalters zum „Verwaltungsstaat“ der frühen Moderne, bevor sich dann im 19. Jahrhundert der „Regierungsstaat“ durchsetzt (Foucault 2006a und b; vgl. auch die Tanner-Lectures Nr. 291 in Foucault 2005). Die Ethik als Reflexion und Handlungsanleitung führt zu einer „Lebenskunst“, deren Fehlen er für die heutige Zeit beklagt. Foucault also als ein weiterer Alles-Zermalmer, als totaler Kritiker der Vernunft? Häufig nennt er seine wichtigsten philosophischen Lehrmeister. Nietzsche (in Verbindung mit Heidegger) gehört dazu. Er bezeichnet sich selbst als Nietzscheaner. Und doch kommt er immer wieder auf Kant zu sprechen. Insbesondere tut er dies in seiner Auseinandersetzung mit der „Moderne“, was für ihn heißt: Sich selbst zum Gegenstand einer strengen Auseinandersetzung zu machen (Foucault 2005, S. 698). „Was ist Aufklärung?“ – jene kleine Schrift Kants wird gleich mehrfach zum Gegenstand von Ausführungen. Es wird schnell klar: Foucault sieht sich in dieser kritischen Tradition. Denn es geht Kant um die Frage, wie der Mensch aus seiner (selbst geschaffenen) Unmündigkeit heraustreten kann. Und dieser Prozess ist ein doppelter: ein politischer und ein individueller. Entscheidend ist dabei eine kritische Haltung. Foucault ist für die Kulturpädagogik – wie hier nur äußerst grob angerissen werden konnte – in vielfacher Hinsicht ein relevanter Denker, der eine fruchtbare Verunsicherung bewirken kann. Sein dialektischer Ansatz muss immer wieder erarbeitet werden. Dinge und Prozesse sind eben nicht nur gut oder schlecht, richtig oder falsch. Jedes gut gemeinte Projekt kann sich in sein Gegenteil verkehren, jede leichtfertig als Unterdrückung etikettierte Situation birgt möglicherweise das Potential zu Widerstand. Es sind dabei konkret – also auch: mit empirischer Sorgfalt – die Praktiken und Handlungen zu untersuchen. Die bloße Diskursebene ist sicherlich relevant, aber letztlich nur begrenzt entscheidend. Man muss zudem seine Begrifflichkeit einer permanenten Kritik unterziehen. Denn allzu leicht schleicht sich eine Verdinglichung von solchen Erkenntnisobjekten ein, die nur als fließende verstanden werden können, „Identität“, „Kultur“, „Kunst“, „Bildung“, „Subjekt“ werden leicht zu Containerbegriffen deformiert, obwohl die damit erfassten Gegebenheiten nur bewegliche und fließende Relationen sind. Subjektivität ist also möglich, sogar: überlebensnotwendig. Doch ist sie Prozess und nicht fertiges Produkt, ergibt sie sich nicht von selbst, sondern ist Ergebnis von Arbeit an sich selbst. Dies gilt auch und gerade für Freiheit. Freiheit ist keine bloße Idee, sondern lebendige Praxis, und diese Praxis ist das Leben selbst: „Ja, denn was ist die Ethik anderes als die Praxis 222 Document1 15.05.16 der Freiheit, die reflektierte Praxis der Freiheit?“ (Foucault 2005, S. 879). Das heißt insbesondere, aufmerksam zu sein gegenüber Prozessen der Disziplinierung, der „Normalisierung“ (also der Anpassung an vorgegebene Normen), der Kontrolle – gerade auch in emanzipatorisch angelegten Projekten. Offen bleibt m. E. bei Foucault eine nähere Analyse, wie diese Prozesse der Selbstkonstitution (der „Bildung“) erfolgen. Es liegt nahe, hierfür auf das Konzept des Habitus von Bourdieu zurückzugreifen. Allerdings steht m. W. ein gründlicher Vergleich beider wissenschaftlicher Konzeptionen noch weitgehend aus (vgl. Kajetzke 2008). Allerdings hat die „Freiheit“ einen Haken, da bei ihr die Dialektik nicht endet. Denn individuelle Freiheit ist auch die Grundlage für die moderne Form der Machtausübung, so wie sie im Liberalismus entsteht. Denn dieser benötigt zur Ausübung seiner Macht „freie“ Individuen. Freiheit ist die Grundlage für die Beteiligung der Individuen am Marktgeschehen. „Freiheit“ steht hier in enger Verbindung mit Sicherheit, so dass die Aufrechterhaltung von Freiheit zugleich die Entwicklung immer stärkerer Systeme der Sicherheit provoziert, die die Freiheit einengen, allerdings mit hoher Akzeptanz der Betroffenen (s. hierzu auch Schmidt/Woltersdorf 2008). In diesen Kontext passt, dass gerade unter dem offiziell der „Freiheit“ verpflichteten Neoliberalismus die Summe der Reglementierungen und Kontrollen – auch und gerade durch die öffentliche Verwaltung – erheblich zugenommen. Inzwischen gibt es Studien, die zeigen, dass im Großbritannien von M. Thatcher unter dem Slogan des „schlanken Staates“ die Anzahl der Vorschriften um bis zu 50% angewachsen ist. Einige weitere relevante Fragestellungen: Die neoliberale Rhetorik als Denkweise hat inzwischen auch in der Pädagogik Einzug gehalten. Foucault selbst weist mehrfach darauf hin, dass kein Begriff, aber auch keine Praxis sicher sein können, in einer nicht-intendierten Absicht missbraucht zu werden. So gibt es inzwischen eine neoliberale Rhetorik der Selbstermächtigung des Subjekts, die starke Ähnlichkeiten mit einer emanzipatorischen Praxis in der Kultur- oder Sozialpädagogik hat. Der Kompetenzbegriff wird in diesem Kontext gerne verwendet, um eine neoliberale Ausrichtung des Subjekts in Richtung Flexibilität und Employability zu kaschieren. Wird dadurch eine jegliche Verwendung des Kompetenzbegriffs – so wie im Kompetenznachweis Kultur (KNK) der BKJ – obsolet? Tatsächlich ist die Gefahr eines derartigen Missbrauchs vorhanden. Doch ist zum einen an einen respektablen erziehungsphilosophischen Hintergrund des Kompetenzbegriffs im philosophischen Pragmatismus (Dewey, Peirce etc.) zu erinnern. Zum anderen ist mit Foucault daran zu erinnern, dass erst eine exakte Analyse der entspre223 Document1 15.05.16 chenden Praktiken – und nicht der bloße Verweis auf Diskurse – Aufschluss über tatsächliche Wirkungen gibt. Dies wäre sonst eine der häufig anzutreffenden Verkürzungen des Foucaultschen Ansatzes in Studien zur Gouvernementalität auf einen bloß linguistischen Aspekt (Krasmann 2003, 74 ff). Dies gilt m. E. auch für die oft mit allzu leichter Hand und starkem kritischen Gestus vorgetragenen Kritiken an Überlegungen zur Kultivierung der Schule (etwa bei Pongratz). Der KNK zeigt sich in der Praxis als hilfreiches Instrument, die von Foucault gewollte Selbst-Thematisierung und Selbstreflexion der Betroffenen auf ein höheres Niveau zu bringen – auch als ein Mittel, Strategien der Fremd-Regierung aufzudecken. Foucault wäre zudem der erste, der Formen aktiver Partizipation bei der Gestaltung der Institutionen unterstützen würde, so wie sie etwa in Konzeptionen einer Kulturschule entwickelt werden. Man lese nur einmal seine zahlreichen politischen Stellungnahmen in den letzten Jahren, bei denen die Entwicklungen in Polen im Mittelpunkt standen. Natürlich ist ein neoliberales Regime in einer parlamentarischen Demokratie kritisch auf seine neue Domestizierungsqualität zu analysieren. Doch macht es wenig Sinn, keine Unterschiede mehr zwischen den verschiedenen Formen von „Regierung“ zu machen: Foucault war – zumindest in den letzten Jahren – definitiv kein Anarchist, sondern mühte sich ernsthaft um Verbesserungen im laufenden Politikgeschäft. Ein Beispiel aus der Pädagogik (Foucault 2005, S. 722): „Nichts beweist beispielsweise, dass in der pädagogischen Beziehung die Selbstverwaltung die besten Ergebnisse bringt; nicht beweist im Gegenteil, dass das die Dinge nicht blockiert. Also würde ich im Großen und Ganzen Ja sagen…“ (Gemeint ist der Versuch, einen Konsens zwischen denen „da oben“ und denen „da unten“ herzustellen). Kein Freibrief also für eine nur noch idealistisch sich selbst legitimierende Arbeit in und mit den Künsten, aber auch keine wenig hilfreiche Totalkritik einer jeglichen Praxis. Der Handelnde hat immer unrecht, so Dürrenmatt. Aber auch: Es gibt keine Trennung zwischen Denken und Handeln. Sorgfältige Analyse und Kritik muss sein. Doch reine Theorie konstituiert noch keine Praxis. Sie ist noch nicht einmal regulativ, bestenfalls dient sie als kritisches Prinzip (Foucault 2004, S. 722). Der Handelnde ist also zunächst auf sich gestellt, um eine Praxis zu generieren (die der Analytiker dann kritisch betrachten kann). Dabei entwickelt und investiert er seine spezifische Form praktischer Klugheit (techne), die in keinem hierarchischen Verhältnis zur Klugheit des Theoretikers (episteme) steht. In den Praktiken des Führungshandelns kann man die spezifische Rationalität der vorherrschenden Regierungsweise analysieren. Allerdings steht die konkrete Praxis nicht in einer linearen Ableitungsbeziehung sowohl zu dieser Rationalität als auch zu einer allgemeinen Theorie derart, dass man sie am grünen Tisch durch einfache Deduktion ermitteln könnte. Es kommt daher darauf an, dass 224 Document1 15.05.16 mit Hilfe der Theorie Praxis kritisch analysiert wird und die (theoretisch reflektierte) Praxis offen bleibt für diese Analysen. Interessant ist dabei das Wechselspiel, wenn also das theoretische Wissen praktisch wird und wenn praktisches Wissen von der Theorie aufgegriffen und damit verallgemeinert wird (Krasmann 2003, 72ff). Besserwisserei – gleichgültig von welcher Seite – schadet nur. So schreibt Foucault zur Polemik: „Der Polemiker dagegen tritt vor, gepanzert mit Vorrechten, die er von vornherein innehat und die er niemals in Frage stellen lässt. Er besitzt von Grund auf die Rechte, die ihn zur Kriegsführung autorisieren und die aus diesem Kampf ein gerechtes Unternehmen machen; er hat zum Gegenüber nicht einen Partner in der Suche nach der Wahrheit, sondern einen Gegner, einen Feind, der Unrecht hat, der schädlich ist und dessen Existenz bereits eine Bedrohung darstellt. Das Spiel besteht für ihn folglich nicht darin, ihn als Subjekt anzuerkennen, das das Recht hat, auch das Wort zu ergreifen, sondern ihn als Gesprächspartner jedes möglichen Dialoges zu annullieren, und sein letztes Ziel wird nicht sein, sich so gut er es vermag einer schwierigen Wahrheit zu nähern, sondern die gerechte Sache triumphieren zu lassen, deren offenkundiger Träger er von Beginn an ist. Der Polemiker stützt sich auf eine Legitimität, von der sein Gegner per definitionem ausgeschlossen ist.“ (Foucault 2004, S. 725). Eine weitere interessante Fragestellung ergibt sich aus der Überlegung über die jeweils spezifischen Denk- und Rationalitätsformen in der Pädagogik. Comenius etwa versucht, eine Methodologie des pädagogischen Denkens aus einer Übertragung von Prinzipien der Mathematik und der Naturbeobachtung zu gewinnen (immerhin ist es die Zeit Keplers, Kopernikus’ und Galileis). Die Philanthropen versuchen, die Beschreibung der naturwissenschaftlichen Methode Newtons in der Pädagogik zu nutzen und in empirisch ermittelten Fakten mathematisch zu formulierende Gesetzmäßigkeiten zu finden. Offensichtlich wird dabei mit jeder der angewandten Methoden der Erkenntnis-Gegenstand „Erziehung“ in spezifischer Weise konstituiert ebenso wie ein bestimmtes Verständnis von „Natur“ und „Bewegung“ erforderlich war, damit die Newtonsche Methode der Physik greifen konnte. Dominante Denkformen wie der von der Antike überlieferte mos geometricus, die Methode des Rechnens, die Descartes in seiner analytischen Geometrie entwickelte, das kombinatorische Denken, das Leibniz erfand, wurden als dominante Rationalitätsformen nach und nach über ihren ursprünglichen Anwendungsbereich ausgedehnt und auf andere Felder übertragen (vgl. auch Foucault 1971). Herbart etwa wendet systematisch die kombinatorische Methode an. Interessant wäre es nun, die neue Sicht auf die Gesellschaft, die sich gemäß Foucault im 19. Jahrhundert entwickelt und die eng mit dem Begriff der Sicherheit (und der Versicherung) verbunden ist, der wiederum nur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu behandeln ist, in seiner Auswirkung auf die Pädagogik zu untersuchen. Denn der Gedanke des kalkulierbaren (und daher versicherbaren) Risikos ist mit einem spezifischen Bild von Gesellschaft (und da225 Document1 15.05.16 mit auch des Individuums) verbunden und steht am Beginn der Entwicklung des modernen Sozialstaates (Krasmann 2003). Ein Aspekt besteht in der neuen Relevanz von (errechneten) Mittelwerten als Vorgabe einer Norm. Offensichtlich spielt dieser Gedanke zahlenmäßig erfasster Entitäten für eine empirische Wissenschaft eine entscheidende Rolle. In derart empirisch vorgehenden Humanwissenschaften entstehen so Vorstellungen von Normalität (etwa die Gaussche Glockenkurve bei Ergebnissen von Klassenarbeiten). PISA als umfassendes System empirischer Erfassung ist damit mitnichten ein bloßes Abbild des pädagogischen Geschehens, sondern eine politisch einflussreiche Konstituierung von Normen. Dabei werden insbesondere die Abweichungen von der (sozialen) Norm interessant: sei es in kriminologischer, gesundheitlicher oder eben auch pädagogischer Hinsicht (Kajetzke 2008). Zur Erinnerung: Der Kompetenznachweis Kultur hat mit dieser Konstitution des Pädagogischen nichts zu tun. Er konstituiert keine zahlengestützte „Normalität“, setzt keine überindividuellen Normen, quantifiziert nicht komplexe psychische Prozesse. Er hat vielmehr in den letzten Jahren eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung einer anderen pädagogischen Professionalität von LehrerInnen gewonnen. Denn die Zahlen- und RankingOrientierung, die oben erwähnt wurde, spielt in dem verbreiteten herkömmlichen Lehrerhabitus eine wichtige Rolle, da eine quantifizierte Leistungsbewertung, also die Vergabe von Zensuren, für viele geradezu Charakteristikum der Lehrertätigkeit ist („das rote Büchlein“). Damit werden LehrerInnen in der Tat zu wichtigen Agenten eines Dispositivs der Macht, das zu der oben beschriebenen Form von Regierungshandeln gehört. Mit Hilfe des Kompetenznachweises können LehrerInnnen nunmehr lernen, eine Förderung des Lernens und eine Ermutigung dazu zu praktizieren, die sich an den Stärken des Lernenden orientiert. Und in einer solchen Stärkung des Einzelnen sieht letztlich Foucault auch die entscheidende Möglichkeit, „weniger auf eine solche Weise regiert zu werden“. Die Veränderung des Habitus der Lehrenden in Richtung einer Haltung – auch dies eine Foucaultsche Überlegung – ist dabei ein Schlüssel für die Begleitung einer widerständigen Praxis (siehe nächsten Abschnitt). Das Leben, die Künste und die Ästhetik der Existenz Es ist vermutlich dies der – zumindest in pädagogischen Kontexten – meistzitierte Satz von Foucault zum Thema „Subjekt“: „Wenn diese Dispositionen verschwänden, so wie sie erschienen sind, wenn durch irgendein Ereignis, dessen Möglichkeit wir höchstens vorausahnen können, aber dessen Form oder Verheißung wir im Augenblick noch nicht kennen, diese Dispositionen ins Wanken gerieten, wie an der Grenze zum 18. Jahrhundert die Grundlagen des klassischen Denkens es taten, dann 226 Document1 15.05.16 kann man sehr wohl wetten, daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sande.“ (Foucault 1971, S. 462; meine Hervorhebung, M. F.). Genau genommen ist es nur das Bild im hervorgehobenen Satzteil, das immer wieder zitiert wird. Und dieser kurze Hinweis genügt, um Foucault in die Reihe derer zu stellen, die irgendeine wichtige Begrifflichkeit und die von ihr erfasste Sache als beendet erklären: Hegels Rede vom Ende der Kunst, Nietzsches Rede vom Tod Gottes und nunmehr Foucault mit seiner These vom Verschwinden des Menschen. Man könnte nun zwar darauf hinweisen, dass diese These am Ende einer äußerst komplexen Darstellung der Genese und des Niedergangs verbreiteter Denkformen in Philosophie und Wissenschaften steht, in der er zeigt, unter welchen Bedingungen die Art und Weise, wie Wissen gesellschaftlich produziert wird, genau diese das jeweils vorhandene Wissen seinen Gegenstand formt. Foucault ist nämlich Schüler der bekanntesten französischen Wissenschaftshistoriker (Bachelard, Canguilhem) und diese Arbeit gibt seiner späteren Professur am Collège de France den Namen: „Geschichte der Denksysteme“. Er untersucht verschiedene wissenschaftliche Disziplinen (Politische Ökonomie, Biologie und Sprachwissenschaft) nach gemeinsamen Denkformen und identifiziert sie, so dass man ihn jahrelang trotz seines ständigen Protestes für einen Strukturalisten hielt. Bei diesen Untersuchungen zeigt er, dass der „Mensch“ zu einer bestimmten Zeit – vielleicht notwendigerweise – zum Thema wird (vgl. auch Fuchs 1984). Es geht also um Wissen, hier: um ein Wissen, das erst den „Menschen“ als wissenschaftlichen Gegenstand konstituiert. Seine These vom Verschwinden des Subjekts verliert also durch dieses genauere Hinsehen durchaus ihren zugeschriebenen revolutionären Gestus. Denn die Geschichte der Wissenschaften zeigt, wie Themen und Methoden relevant werden und an Bedeutung verlieren, wobei eine Kernfrage darin besteht, welches die Gründe dafür sind. Dies gilt auch für die Pädagogik (Benner/Oelkers 2004). Es handelt sich bei Foucault um eine strenge Historisierung von Wissen, die dazu führt, Selbstgewissheiten über scheinbar zeitlos gültige Wissensbestände zu zerstören. Und es ist damit verbunden ein AntiEssentialismus und Nominalismus, denn man erfasst mit einem derartigen Wissen auch kein zeitlos Seiendes. Es geht also um die kognitive Konstruktion von Welt, und diese ist stark von jeweils sozialen und kulturellen Kontexten abhängig: Der „Mensch“ und das „Subjekt“ sind zeitlich gebundene und vor allem sprachlich konstituierte Konstruktionen (Fuchs 2010). Nun kämpft Foucault sein gesamtes wissenschaftliches Leben gegen zu starke essentialistische Begriffe (wie oben bereits angemerkt). Einer dieser starken Begriffe ist der des „Subjekts“. Auch hier lässt sich zeigen, dass dieses (angenommene) starke und autonome Subjekt, 227 Document1 15.05.16 dem es gelingt, alles seinen Steuerungswünschen zu unterwerfen, so nicht existiert: Das Ende vom Menschen wird so zu einem Ende vom Subjekt. Aber auch hier geht es um das Ende einer bestimmten Konstruktion des Subjekts, die den Realitäten nicht standhält. Viele hat es daher überrascht, als Foucault eine nächste Arbeits-Etappe – es sollte seine letzte sein – ankündigte und seine vorausgegangenen Arbeiten alle als Auseinandersetzung um ein tragfähiges Konzept des Subjektes deutete (vgl. etwa Foucault 2005, S. 461ff. – Zur Genealogie der Ethik). Auch sein Zugang leuchtet in der Logik seiner Arbeiten ein. Er stellt in vielen Interviews seine Konzeption vor: Im Anschluss an die Dreidimensionalität des Weltverhältnisses des Menschen a) zu den Dingen („Wissen“), b) zu den Menschen („Macht“) und schließlich c) zu sich selbst („Selbstsorge“) werden auch drei Subjekttypen konstituiert: Das Subjekt, wie es durch das Wissen konstruiert wird (erste Phase), das Subjekt im Wechselspiel unterschiedlicher Macht- und Unterwerfungsstrategien (mittlere Phase) und schließlich das Subjekt als Schöpfer seiner selbst (letzte Phase; vgl. nur das lange Gespräch mit Ducio Trombadori in Foucault 2005, S. 51ff). Überrascht war man, dass er die Studien zur Moderne Ende der 1970er Jahre (Foucault 2005 a und b) nicht fortgeführt hat, sondern griechische, hellenistische und römische Autoren und deren Methoden des Umgangs mit sich selbst analysierte. Man kann hier eine gewisse Folgerichtigkeit erkennen. Aus einer pädagogischen Perspektive lassen sich etwa notwendige Bereichstheorien identifizieren: eine Theorie der Institutionen (erste Phase), eine kritische Sozialisationstheorie (zweite Phase) und schließlich eine Subjekt- und Bildungstheorie (letzte Phase). Foucaults Weg lässt sich dabei auch mit politischen Erfahrungen erklären. Denn er erlebte wie alle kritischen Denker seiner Generation eine Abfolge von Enttäuschungen: Weder erbrachten die Studentenrevolten, noch die Sozialisten an der Macht, noch die Entwicklungen in China (in anderen sozialistischen Ländern schon gar nicht) die erhofften politischen Bedingungen. Zeitweise war er eng mit linksradikalen maoistischen Zirkeln verbunden, am Ende gab es eine Nähe zu Gewerkschaften. Es könnte sein, dass ihm eine anarchistische und letztlich alternativlose Totalkritik der bürgerlichen Demokratie als Sackgasse erschien, so dass er nach Wegen suchte, zu einer „autonomen“ Lebensweise in bestehenden Systemen zu kommen. Hier finden sich dann die immer wieder zitierten Aussagen über widerständige Praxen oder darüber, „sich nicht so und nicht von denen regieren zu lassen“. Die Entwicklung von Subjektivität sollte nicht mehr Anpassung des Einzelnen von vorgegebenen, auch emanzipatorisch formulierten Normen sein, sondern aufgrund einer selbstbestimmten Praxis erfolgen. Und hierfür schienen die antiken Vorstellungen einer Lebenskunst geeignet zu sein. Insbesondere ästhetische Praxisformen bargen für ihn Potentiale einer solchen Subjektentwicklung. 228 Document1 15.05.16 Mit Fragen der Ästhetik und der Künste hat sich Foucault – auch hier in bester französischer intellektueller Tradition – ständig befasst. Zunächst ist es das kulturelle Leitmedium in Frankreich, die Literatur. Er erklärt sich zwar nicht sonderlich kompetent in der Musik, hegt aber eine lange Freundschaft mit Pierre Boulez. Er trifft sich mit Filmemachern (etwa mit Werner Schröter) und schreibt über Bildende Kunst. Berühmt ist seine Bildanalyse in der „Ordnung der Dinge“ und die Analyse des „Pfeifenbildes“ von Magritte. Es geht hier um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, um Repräsentation und um Trugbilder. Christoph Menke (2003) analysiert sorgfältig die Übungen und Praktiken, wie sie entweder zu einer Disziplinierung oder aber zu einer ästhetisch-existentiellen Konstitution eines (relativ-)autonomen Subjektes führen. Es findet sich hier dasselbe Problem wie bei anderen Strategien der Subjektivierung: Man kann nicht von vorneherein sagen, in welcher Weise die – ggf. sogar dieselben – Praktiken wirken. Die Unterscheidung beider ist nicht leicht. Menke sieht ein entscheidendes Merkmal: „Das Gelingen ästhetischer Tätigkeiten verlangt die Überschreitung jeden vorweg gesetzten Zieles: Sie gelingen gerade, wenn sie zu etwas anderem führen, als was an ihrem Anfang festgelegt wurde“ (ebd., S. 298). Dies macht letztlich die Lebenskunst aus: „Sein Leben wie eine ästhetische Tätigkeit zu sehen…“, also „ein anderer zu werden …“ (ebd.). Die Unterscheidung, ob eine Übung disziplinierend oder ästhetisch-existentiell ist, erfolgt (bei Menke) darüber, dass man sie in einer bestimmten Haltung praktiziert, deren entscheidendes Merkmal „in der ästhetischen Freiheit zur Selbstüberschreitung“ liegt (ebd., S. 299; s. oben den Hinweis auf den KNK). Interessanterweise hat die BKJ in den späten 1990er Jahren aus systematischen Gründen in der Folge eines Forschungsprojektes, bei dem es um Alternativen zu einer damals geforderten, stark betriebswirtschaftlich geprägten Form von Evaluation ging, das Konzept der Lebenskunst zur Konkretisierung des abstrakteren Begriffs der kulturellen Bildung erprobt. Dieses Lebenskunstkonzept ging jedoch nicht auf Foucault zurück, obwohl zu einem späteren Zeitpunkt der Foucault-Anhänger Wilhelm Schmid mit seinem damaligen Verkaufserfolg einer „Philosophie der Lebenskunst“ einbezogen wurde. Die Ursprünge des BKJ-Konzeptes gehen auf Ulrich Baer zurück, der dieses Konzept – ebenfalls ohne Bezug auf Foucault – zum Aufbau seines neuen Fachbereichs Kulturpädagogik in der Akademie Remscheid erprobte. Von Anfang an ergaben sich in der Diskussion dieses Konzeptes zwei Probleme: Zum einen die esoterische Konnotation dieses Begriffs, zum anderen und damit verbunden die Tendenz, Lebenskunst bloß individuell ohne Berücksichtigung sozialer Kontexte zu verstehen: Es ging gerade nicht um die Lebensgestaltung von Besserverdienenden, die sich aus dem Gemischtwarenladen materieller, geistiger und spiritueller Konsumgüter bedienten (BKJ 1999). Es ist 229 Document1 15.05.16 kein Zufall, dass in dieser Zeit der Slogan „Kulturelle Bildung ist soziale und sogar politische Bildung“ verstärkt diskutiert wurde und dem der zweite Band der dreibändigen Dokumentation gewidmet war (BKJ 2000). Innerhalb dieses Kontextes ging es genau um die von Menke beschriebene Dimension der Selbstüberschreitung, wie sich unschwer an den dokumentierten Lebenskunstprojekten erkennen lässt. Interessant ist, dass diese Frage auch im Mittelpunkt der vermutlich bedeutsamsten kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Lebenskunst steht (Kersting/Langbehn 2007). Es geht mir hier nicht um Foucault-Exegese oder darum, ob dieser exakt seine Quellen rezipiert hat (hat er offenbar nicht, ebd. S. 28), sondern es geht darum, ob das Lebenskunstkonzept sozial blind ist und nur für Privilegierte taugt (S. 29). Hierbei wären die Milieu-Studien seines Zimmernachbarn Bourdieu gerade im Hinblick auf die Verteilung und Nutzung des kulturellen Kapitals sicherlich hilfreich. Interessant ist zudem die Frage der Übertragbarkeit antiker Lebenskunstmodelle auf die Moderne. Zentral ist dabei die Frage danach, wie und wann „Autonomie“ unter heutigen Bedingungen möglich ist und wie sie unterstützt werden kann. Es geht also um die von Foucault immer wieder betonte Dialektik von Unterdrückung und Ermöglichung. Es geht um die philosophische Dauerfrage nach dem Verhältnis von Ethik und Ästhetik (vgl. aktuell Elberfeld/Otto 2009). „Autonomie … ist das Vermögen der Selbstbestimmung nach eigenen Gründen.“ so Heidbrink in Kersting/Langbehn 2003, S. 267 und als Fazit seiner Überlegungen: „Autonomie ist ohne Elemente der Heteronomie weder denkbar noch realisierbar.“ (271). Er formuliert vier Kriterien gelingender Autonomie (280 f): 1. Individuen müssen ihre Entscheidungen auf sich selbst zurückführen können. 2. Individuen beurteilen und bilden sich durch kritische Selbstreflexion und effektive Selbstmodifikation. 3. Individuen sollten „mit den Folgen der selbstverantworteten Urteilsbildung und selbstständigen Daseinsgestaltung so umgehen können, dass hieraus keine substantielle Beeinträchtigung des eigenen Lebens entsteht.“ 4. Individuen können mit den Folgen ihres Handelns innerhalb eines bestimmten sozialen Kontextes leben. Dies scheinen mir brauchbare „Evaluationskriterien“ für eine emanzipatorische Kulturpädagogik zu sein. Foucault ist gestorben, bevor er sein Projekt der Selbstsorge bis zur heutigen Zeit hat ausarbeiten können. Es gibt Gründe zu der Annahme, dass er die Frage der sozialen Eingebundenheit, die Frage einer Dialektik von Autonomie und Heteronomie unter den Bedingungen der 230 Document1 15.05.16 Moderne sorgfältig aufgegriffen hätte, zumal seine vorangegangenen Gouvernementaltitässtudien (Foucault 2006a und b) und seine eigene politische Praxis dies getan haben. Wenn es heute Verkürzungen und Einseitigkeiten in der hier angedeuteten Richtung gibt, ist es vermutlich eher ein Problem der Rezeption. Im Hinblick auf Foucault lässt sich daher – so mein Eindruck – Ähnliches formulieren wie Foucault es im Hinblick auf seine Entdeckung von Nietzsche beschrieben hat: Er entdeckte nämlich durch eigene Lektüre einen ganz anderen, einen faszinierenden Denker, der wenig mit jenem Nietzsche zu tun hatte, den er in seinen Philosophievorlesungen an der Universität kennen gelernt hatte. Es ist wichtig in der Kulturpädagogik – gerade in einer solchen, die sich als Pädagogik der Freiheit verstehen will –, Foucault selbst zu entdecken. Literaturhinweise Benner, D./Oelkers, J. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Pädagogik. Weinheim/Basel: Beltz 2004 Braun, T./Kelb, V. (Hg.): Mit Kunst und Kultur Schule gestalten. Remscheid 2009 Bröckling, U. u.a.: Vernunft – Entwicklung – Leben. Schlüsselbegriffe der Moderne. München: Finck 2004 Bröckling, U.: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2007 Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Lernziel Lebenskunst. Konzepte und Perspektiven. Remscheid: BKJ 1999. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Partizipation und Lebenskunst . Beteiligungsmodelle in der kulturellen Jugendbildung. Remscheid: Schriftenreihe der BKJ 2000. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung: Kulturelle Bildung und Lebenskunst - Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Modellprojekt "Lernziel Lebenskunst" Remscheid: BKJ 2001. Elberfeld, J./Otto, M. (Hg.): Das schöne Selbst. Zur Genealogie des modernen Subjekts zwischen Ethik und Ästhetik. Münster: transcipt 2009 Foucault, M.: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1971 Foucault, M.: Dits et Ecrits. Schriften. Vier Bände. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001 - 2005 Foucault, M.: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I. Frankfurt/M.: Suhrkampt 2006a 231 Document1 15.05.16 Foucault, M.: Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006b Fuchs, M.: Untersuchungen zur Genese des mathematischen und naturwissenschaftlichen Denkens. Weinheim/Basel: Beltz 1984. Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Historische und systematische Studien zu ihrer Genese. Leverkusen: Leske + Budrich 2001. Fuchs, M.: Kulturelle Bildung. Grundlagen - Praxis - Politik. München: KoPaed 2008 Fuchs, M.: Slogans und Leitformeln (Arbeitstitel). Wiesbaden: VS 2010 (i.V.) Hechter, D./ Philipps, A. (Hg.): Widerstand denken. Michel Foucault und die Grenzen der Macht. Münster: transcript 2008 Honneth, A./Saar, M. (Hg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2003 Kajetzke, L.: Wissen im Diskurs. Ein Theorienvergleich von Bourdieu und Foucault. Wiesbaden: VS 2008 Kersting, W./Langbehn, C. (Hg.): Kritik der Lebenskunst. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2003 Kessl, F.: Der Gebrauch der eigenen Kräfte. Eine Gouvernementalität Sozialer Arbeit. Weinheim/München: Juventa 2005 Klingorsky, U.: Schöne Neue Lernkultur. Münster: transcript 2009 Krasmann, S.: Die Kriminalität der Gesellschaft. Zur Gouvernementalität der Gegenwart. Konstanz: UVK 2003 Menke, C.: Zweierlei Übung. Zum Verhältnis von sozialer Disziplinierung und ästhetischer Existenz. In: Honneth/Saar 2003 Pongratz, L.: Pädagogik im Prozess der Moderne. Studien zur Sozial- und Theoriegeschichte der Schule. Weinheim: DSV 1989. Ricken, N./Rieger-Ladich, M. (Hg.): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: VS 2004 Rihm, Th.: Schulentwicklung durch Lerngruppen. Opladen: Leske + Budrich 2003 Rihm, Th.: Teilhabe an Schule. Wiesbaden: VS 2008 Schmidt, R./Woltersodrf, V. (Hg.): Symbolische Gewalt. Herrschaftsanalyse nach Pierre Bourdieu. Konstanz: UVK 2008 Timmerberg, V./Schorn, B. (Hg.): Neue Wege der Anerkennung von Kompetenzen in der kulturellen Bildung. Der Kompetenznachweis Kultur in Theorie und Praxis. München: kopaed 2009 232 Document1 15.05.16 Die Schriftsteller und die Gesellschaft Was Kunst denn eigentlich sei, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dass aber eine Aufgabe von Kunst darin besteht, der Gesellschaft und vielleicht auch jedem Einzelnen den Spiegel vorzuhalten, darin sind sich viele einig. Seit es Kunst gibt, zumindest: Seit man über Kunst nachdenkt, taucht diese Aufgabenbeschreibung auf. Kunst schafft Möglichkeitswelten, Kunst ist Teil des Selbstreflexionsprozesses des Menschen, Kunst lässt uns spielerisch erproben, was alles noch sein könnte, wenn es die reale Welt nicht gäbe. Einige halten eine solche funktionale Bestimmung nicht für genügend. Doch nutzt man eine solche häufig dort, wo „Wesensdefinitionen“ nicht (mehr) gelingen wollen. So spricht man etwa auch unter seriösen Wirtschaftswissenschaftlern davon, dass „Geld“ das ist, was Geld tut, was also Geldfunktionen erfüllt. Welches solche Funktionen von Kunst sein könnten, was also Kunst in einer funktionalen Sichtweise ist, darüber denken nicht nur Philosophen, Politiker, Alltagsmenschen und – je nach Kunstsparte unterschiedlich lange – die fachbezogenen Kunstwissenschaften nach: Auch für die Künstler selbst ist es eine ständige Herausforderung, das zu verstehen, was sie eigentlich betreiben. Sie tun dies in Form von Essays, Fachbeiträgen oder in wissenschaftlicher Herangehensweise (denn im Zuge der Autonomisierung der Künste hat es auch eine Akademisierung und Verwissenschaftlichung der Künstlerprofessionen gegeben), sie tun es aber auch mit ihren genuin künstlerischen Mitteln. So malen Maler andere Maler oder sich selbst beim Malen, so schreiben Autoren über andere Autoren – und müssen sich ständig die Frage gefallen lassen, inwieweit ihr neuestes Werk (bloß) autobiographisch ist. Die Künste sind inzwischen selbst – vermutlich waren sie es schon immer – Mittel der Selbstreflexion nicht bloß der Künstler, sondern auch von deren Kunst geworden. Aufschlussreich ist es daher, eine wissenschaftliche und eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Künstlerdasein zu vergleichen. Eher durch Zufall kam es bei mir zu einer Urlaubslektüre von John Irvings etwas älterem Buch „Witwe für ein Jahr“ (1998, deutsch 1999) und einer ambitionierten Studie zur sozialen Lage von Schriftstellern im Südosten Frankreichs von Bernard Lahire („Doppelleben“, Schriftsteller zwischen Beruf und Berufung. 2011). Fast alle Haupt- und Nebenfiguren in dem 800-Seiten-Schmöker des großartigen Erzählers Irving sind Schriftsteller oder haben es mit Schriftstellerei (als Lektor, Verleger, Kritiker, Autor etc.) zu tun. Sie sind unterschiedlich erfolgreich, arbeiten in unterschiedlichen Sparten (Frauenromane, Kinderbücher, Krimis), genießen eine unterschiedliche Anerkennung. Wer die Theorien von Howard Becker (über die „art world“) oder von Pierre Bourdieu über das literarische Feld konkret studieren will, findet hier nahezu alle Elemente. Was Literatur, speziell: Was gute Literatur 233 Document1 15.05.16 ist, ergibt sich in einem Aushandlungsprozess, an dem viele Profis leben (Verleger, Kritiker, Kulturzeitschriften und Journalisten, Lektoren, andere Schriftsteller, Hochschulen etc.) beteiligt sind. Anerkennung erfährt man in den durchaus konflikthaften Auseinandersetzungen im Konkurrenzkampf um Status, Marktanteile und Aufmerksamkeit. Fachliche Reputation geht dabei eher selten einher mit ökonomischem Erfolg. Literatur ist zudem am wenigsten für diejenigen, die sie produzieren, hinreichend ertragreich, um ihren Lebensunterhalt sichern zu können: Es kommen Lesungen, Workshops, Dozenturen, Stipendien dazu, und diese auch nur dann, wenn man das Glück hat, zumindest literaturnah arbeiten zu können. Oft genug ist es der Lebenspartner, eine Erbschaft oder ein völlig fachfremder Brotberuf, der die Existenz sichern muss. Daher stellt sich für viele Autoren – und auch für die genannten Protagonisten in Irvings Roman – immer wieder die Frage der Selbstbezeichnung: Sind sie Autoren, Schriftsteller, Kulturarbeiter, Handwerker? Auch befassen sie sich ständig mit der Frage nach der Organisation ihrer Arbeit und ihrem Vorgehen: Wie systematisch, wie inspiriert gehen sie vor? Woher erhalten sie die Anregungen und wie sichern sie sie sich? Wie häufig können/müssen sie publizieren, um sich selbst gegenüber, aber auch in Hinblick auf eine durchaus vergessliche Leserschaft ihren Autorenstatus zu sichern? Wie viel an Verbiegungen – etwa gegenüber Verlagen, Kritikern, Lesepublikum und Lektoren – sind sie bereit hinzunehmen? Die Schriftstellerfiguren stellen sich alle diese Fragen – und beantworten sie durchaus unterschiedlich. Allerdings zeigt sich bei allen, dass die Schriftstellerexistenz eine absolut prekäre ist – und natürlich flossen auch in dieses Buch erhebliche biographische Daten und persönliche Erfahrungen des Autors Irving ein. All dies findet sich auch – allerdings systematisch mit Daten unterlegt – bei Lahire. Er entwickelt seinen theoretischen Rahmen, wobei heute niemand und schon gar kein französischer Soziologe an Bourdieu (v.a. seinem Buch „Regeln der Kunst“, 2001) vorbei gehen kann. „Feld“, „Habitus“, „sozialer Raum“ zusammen mit den Prozessen der Distinktion, dem Kampf um die Gewinnung von sozialem, kulturellem, ökonomischem und symbolischem Kapital bieten die Hintergrundfolie, auf der Lahire seine – in einigen wichtigen Punkten dann doch von Bourdieu abweichende – Position entwickelt. Es geht ihm zum einen um die Schließung des Desiderats, gründlich die desolaten ökonomischen Rahmenbedingungen des Schriftstellerdaseins zu erfassen. Und er tut dies u.a. durch Analyse der (französischen) Künstlersozialversicherung AGESSA, ihren Zugangsbedingungen und ihrer Mitgliederstruktur. Er tut es durch eine umfangreiche Befragung und in einer größeren Zahl von Einzelinterviews, wobei er sich bewusst ist, dass bereits die Festlegung des Spektrums der Befragten eine definitori234 Document1 15.05.16 sche Bestimmung dessen ist, was ein „Schriftsteller“ ist (z.B. jemand, der mindestens ein Buch in einem anerkannten Verlag publiziert hat). Der Fragebogen hat dabei durchaus beachtliche Ausmaße: 124 Fragen zum Einkommen, zum Familienstand, zur Ausbildung, der eigenen, des Partners und der Eltern (mit dem Ergebnis, dass Schriftsteller kaum aus niedrigen sozialen Schichten kommen und in der Regel von Kind an ununterbrochen selber lesen: ca. 60% lesen über 20 Bücher im Jahr, 30% sogar mehr als 50). Es wird die Haltung zur Literaturkritik, zu Verlagen, zum Buchhandel und zu Verbänden ebenso erkundet wie die organisatorischen und räumlichen Rahmenbedingen des Schreibers. Im Hinblick auf die Einnahmesituation ist die Statistik von AGESSA interessant: Normale Bedingung dafür, Mitglied werden zu können, ist ein Einkommen in Höhe des 900fachen Satzes des durchschnittlichen gesetzlichen Mindestlohnes: 6,6% der Versicherten erzielen ein Jahreseinkommen zwischen 3155 und 6309 €. Immerhin bleiben über 10% zeitweise unterhalb dieses Mindestsatzes. Ca. 55% verdienen zwischen 6310 und 29.184 €, immerhin 0,4% 598.225€ und mehr. Ca. 40% haben als Nebenberuf eine lehrende Tätigkeit. Schriftsteller haben es – etwa im Vergleich mit Bildenden Künstlern, Tänzern, Schauspielern oder Musikern – besonders schwer, sich als eigenständige Profession zu definieren, fehlen doch entscheidende Merkmale, die eine Profession ausmachen – etwa ein klares Berufsbild, relevante Studiengänge mit anerkannten Abschlüssen. Daher ist das Feld derer, die Schriftstellerei betreiben, sehr viel heterogener als in anderen künstlerischen Bereichen. Von Vorteil ist das vermutlich deshalb, weil Schriftsteller dadurch leichter die Möglichkeit haben, in durchaus anerkannten nichtkünstlerischen Berufen ihren Lebensunterhalt zu sichern. Denn bis auf wenige Ausnahmen gelingt es kaum einem Autor, mit literarischem Schreiben sein Geld zu verdienen. So sind sie als Lehrer oder Dozenten oder in anderen kulturnahen Berufen tätig, aber auch in der Wirtschaft, in der staatlichen Bürokratie oder im Journalismus. Viele leben von Auftragsarbeiten, zu denen sie in strenger Abgrenzung von ihrer eigentlich literarischen Tätigkeit auch Essays, Drehbücher oder sonstige Autorentätigkeiten zählen. All dies ist natürlich nicht neu. Wir wissen von Lessings Versuchen, durch eine alleine ästhetischen Kategorien verpflichtete Tätigkeit als Autor oder Theatermacher seine Existenz zu sichern. Es hat nicht geklappt, sodass er schließlich als – wie man weiß: schlechter – Bibliothekar endete. J.- J. Rousseau verdiente sein Geld als Notenkopist, Döblin und Benn waren Ärzte (von letzterem hat Lahire auch den Titel seines Buches geliehen), Musil und Broch waren Techniker und Ingenieure, Kafka schließlich hasste seine Tätigkeit als Versicherungsfachmann, legte jedoch trotzdem höchste Qualitätsansprüche an sich in dieser Tätigkeit (und wurde daher zurecht befördert). Allerdings werden die Widersprüche zwischen der eigentlich 235 Document1 15.05.16 wichtigen literarischen Tätigkeit und der notwendigen Erwerbstätigkeit z. T. heftig erlebt. Nahezu alle Autoren setzen sich mit diesem Problem auseinander, das nicht nur ein Problem der individuellen Lebensgestaltung, sondern aufs engste verbunden ist mit dem Prozess der Autonomisierung des literarischen Feldes. Flaubert („der Inbegriff des Schriftstellers ohne Nebenberuf“; S. 571) hat hierbei eine Schlüsselrolle, weshalb Sartre zwei dicke Bände über ihn schreibt (Der Idiot der Familie) und er auch im Mittelpunkt der kunstsoziologischen Studie von Bourdieu steht. Flaubert gilt deshalb als Schlüsselfigur, weil mit ihm im Kampf um eine eigenständige Setzung ästhetischer Maßstäbe durch die Künstler selbst von diesen ein entscheidender Sieg errungen wird. Allerdings zeigt sich hier die Fragilität des AutonomieKonzeptes: Zum einen ist zu unterschieden die Herausbildung einer eigenständigen „art world“, also des Systems literaturbezogener Institutionen (Akademien, Verlage, Zeitschriften etc.), das allerdings eine erhebliche einschränkende Wirkung auf das literarische Schaffen des einzelnen Autors haben kann. Zum anderen kann damit die Unabhängigkeit des Autors von Kirche und Staat gemeint sein. Auch für die Schriftsteller gilt jedoch, wie für die Bildenden Künstler gezeigt wurde: Die Loslösung von früheren persönlichen Abhängigkeitsbeziehungen (etwa gegenüber den Fürsten) ist verbunden mit einer neuen (abstrakten) Abhängigkeit vom „Markt“: „Genau wie früher sind auch heute das persönliche Vermögen und ein Zweitberuf die sichersten außerliterarischen Garantien für eine literarische Autonomie.“(66). Es ist also weder „die Kunst“ und sicherlich nicht die jeweilige Kunsteinrichtung, die „Autonomie“ für sich geltend machen kann: Es ist stets der Mensch, der produzierende Künstler, der eigenverantwortlich sein künstlerisches Leben gestalten will. Autonomie in der Kunst unterscheidet sich daher nicht grundsätzlich von dem Autonomieverständnis in dem Bereich, in dem sie üblicherweise diskutiert wird: dem Feld des richtigen oder falschen Handelns, dem Feld der praktischen Philosophie also. Ambivalent sind die Positionen der befragen Schriftsteller in Hinblick auf staatliche Unterstützungsprogramme. Einerseits wurde häufig der Vergleich mit Forschung und Wissenschaft zugezogen, Feldern also, bei denen niemand die Notwendigkeit einer staatlichen Förderung in Frage stellt. Daher wäre auch eine staatliche Unterstützung der Künste notwendig. Andere Autoren lehnten jedoch strikt jegliche Form von staatlicher Unterstützung ab, da sie dadurch ihre literarische Integrität gefährdet sehen (Literatur sei am ehesten mit Religion oder Liebe zu vergleichen, so einige Äußerungen, deshalb sei ebenso wie in diesen Bereichen des Liebens oder Glaubens eine staatliche Unterstützung völlig abwegig). Einige Autoren beteiligten sich daher auch nur unter der Bedingung an der Befragung, dass unter keinen Umständen kul- 236 Document1 15.05.16 turpolitische Forderungen nach einer weitergehenden staatlichen Unterstützung auf der Basis der Ergebnisse der Erhebung gestellt werden dürften. Die empirische Erfassung des literarischen Feldes, zu der es heute in Deutschland kein Pendant gibt, ist allerdings nur ein Ziel der Studie des Lyoner Soziologen. Ein zweites Anliegen, für das das Schriftstellerdasein quasi eine Modellfunktion übernimmt, besteht darin, das Lahiresche Konzept multipler Identitäten zu unterfüttern. Lahires Einwand gegenüber Bourdieu besteht darin, dass dieser von einer zu großen Homogenität sowohl bei der Zugehörigkeit des Einzelnen zu einem bestimmten Feld als auch bei dem Vorhandensein eines bestimmten (feldspezifischen) Habitus ausgegangen sei. Vielmehr sei heute Realität, dass sich jeder von uns in verschiedenen Feldern bewegen muss und daher über sehr verschiedene Habitus verfügen müsse. Dies macht das spannungsvolle heutiger Individualität aus, wobei möglicherweise Künstlern mit ihrer Kunst ein Medium zu Verfügung steht, diese Spannungen und Widersprüche zumindest zu bearbeiten. Künstler geben – so auch schon die Vermutungen, die man in Anschluss an die Studien zum modernen flexiblen Kapitalismus von Richard Sennett haben konnte – ein Rollenvorbild für Kreativität, Selbstverantwortung und Umgangsweise mit prekären Verhältnissen. Sie geben aber auch ein Modell dafür ab, wie der Mensch mit diesen Anforderungen umgehen kann. So gesehen haben M. Tillmann und Th. Weber, ersterer zugleich der Übersetzer des Werkes, Recht in ihrem Nachwort: Das Buch ist natürlich aufschlussreich aufgrund seiner bislang umfassendsten Darstellung der sozialen Lage eines bestimmten künstlerischen Berufs. Es ist aber auch deshalb anregungsreich und wichtig, weil es in qualifizierter Weise Fragen aufwirft, die uns alle angehen: Wie geht es dem Individuum, das an den gesellschaftlichen Rollenansprüchen und persönlichen Krisen zu verzweifeln droht? (690). 237 Document1 15.05.16 Von der Notwendigkeit einer Kulturpädagogik Vortrag bei dem Symposium „Theorie der Theaterpädagogik“ vom 23. – 25. März 2001 in Berlin 1. Vorbemerkung Im Zusammenhang mit einer Diskussion darüber, wie eine Theorie der Theaterpädagogik aussehen könnte, deute ich das Thema meines Vortrages wie folgt: Es geht darum, den Nutzen oder sogar die Notwendigkeit einer Theorie der Kulturpädagogik für das theaterpädagogische Theorieprojekt aufzuzeigen. Eine Theorie der Kulturpädagogik verhält sich in dieser Perspektive zu einer Theorie der Theaterpädagogik wie das Allgemeine zum Besonderen19. Die allgemeinere Perspektive bietet sich für mich aufgrund meiner Arbeitskontexte an: Denn sowohl in der Akademie Remscheid (ARS) als auch in der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) ist Theaterpädagogik ein kulturpädagogisches Arbeitsfeld neben Tanz, Musik, Bildender Kunst, Rhythmik sowie Spiel- und Medienpädagogik. Konzept- und Theorieentwicklung in dieser fachübergreifenden Perspektive muss also weit genug sein, um all diese Arbeitsfelder in ihrer Gemeinsamkeit, aber gleichzeitig auch in ihrer jeweiligen Spezifik – auch gegenüber anderen Formen der Jugend(bildungs-)arbeit – zu erfassen. Als methodisches Prinzip ergibt sich daraus für mich, gerade nicht eine größtmögliche Originalität und Einzigartigkeit in der Theorienbildung anzustreben, sondern vielmehr folgendes zu berücksichtigen: I. Eine allgemeine Theorie der Kulturpädagogik sollte sich um größtmögliche Anschlussfähigkeit bemühen, also insbesondere solche Theorien zuziehen, die auch eine Grundlage für die verschiedenen speziellen Bereiche kultureller Bildungsarbeit sein könnten.19 Ich werde daher in diesem Text zunächst das Scheitern des ersten großen Versuchs beschreiben, eine „Kulturpädagogik“ zu etablieren. In einem zweiten Schritt will ich meinen eigenen Versuch skizzieren, eine Theorie der Kulturpädagogik zu entwickeln. In den nächsten Schritten versuche ich, dies auf die Theorie der Theaterpädagogik zu beziehen. Im letzten Teil will ich einige neuere Entwicklungen in der kulturpädagogischen Theorie und Praxis aufzeigen, die nicht ohne die Hilfe der Theaterpädagogik bewältigt werden können. 238 Document1 15.05.16 Ein weiteres Prinzip der folgenden Überlegungen, das sich aus der eigenartigen Mischung von politischer Lobbyarbeit und dem fachlichen Interesse nach seriösen Grundlagen unserer Arbeit in meinen genannten Arbeitskontexten ergibt, ist das folgende: II. Politische Lobbyarbeit und kulturpädagogische Grundlagenforschung schließen einander nicht nur nicht aus, sondern können sich wechselseitig befördern: Eine fundierte kulturpädagogische Konzeption oder Theorie lässt sich für eine überzeugende Lobbyarbeit nutzen; andererseits können kritische Fragen zur Legitimation des Arbeitsfeldes als fachliche Forschungsfragen und Herausforderungen genutzt werden.19 2. Kulturpädagogik in der Weimarer Republik In der Geschichte der Pädagogik wird häufig die Geisteswissenschaftliche Pädagogik, so wie sie im Anschluss an W. Dilthey u. a. von W. Flitner, Nohl und Spranger entwickelt und ausgearbeitet worden ist, „Kulturpädagogik“ genannt. In besonderer Weise wurde dies in einer spezifischen historischen Situation, nämlich nach dem ersten Weltkrieg, relevant19. Es kamen nämlich aus den Schützengräben an Leib und Seele verletzte Männer zurück, auch zurück in die Universitäten, aus denen der Stellungs- und Giftkrieg Zyniker und Nihilisten gemacht hat. Die Sorge, wie aus diesen verletzten Menschen Lehrer werden sollten, die die nachfolgenden Generationen nicht bloß belehren, sondern auch mit Lebensfreude erfüllen sollten, war groß. Drei Personen will ich anführen, die entscheidend waren bei diesem ersten groß angelegten Versuch, mit einer spezifischen „Kulturpädagogik“ eine humanistische normative Basis zu schaffen, die man für die zukünftigen (Gymnasial-)Lehrer für notwendig hielt. Die erste handelnde Person ist Ernst Troeltsch (1865 – 1923). Ernst Troeltsch war Freund von Max Weber und führte – als Theologe und Sozialhistoriker – dessen Studien zur Rolle des Protestantismus19 bei der Entstehung des Kapitalismus fort. Er untersuchte also insbesondere die Frage, inwieweit der Protestantismus mit seinem Menschenbild diejenigen normativen und mentalen Grundlagen gelegt hat, die der Wirtschaftbürger im Kapitalismus benötigt. Innerhalb des Protestantismus gehört Troeltsch zu dem sogenannten „Kulturprotestantismus“, der – sehr selbstbewusst – die Kulturleistung des Protestantismus in der (Genese der) bürgerlichen Gesellschaft sehr hoch bewertet, der den Staat nicht bloß als notwendige Ordnungsmacht, sondern als wichtige Repräsentation des Gesellschaftlich-Allgemeinen und des Sittlich-Guten versteht.19 Insbesondere ist ein solcher sittlicher Staat die richtige Instanz, auch für eine normative Ausrichtung der Gesellschaft zu sorgen. Troeltsch engagiert sich politisch in 239 Document1 15.05.16 der (in heutigen Begriffen) sozialliberalen Deutschen Demokratischen Partei und wird nach dem Krieg als Staatssekretär ins preußische Kultusministerium berufen. Sein Arbeitsschwerpunkt besteht zwar in der Ausarbeitung einer neuen kirchlichen Landesverfassung (da das ursprüngliche Kirchenoberhaupt, der König, nunmehr der Republik hat weichen müssen). Doch engagiert er sich auch bei dem oben skizzierten Mentalitätsproblem des Lehrernachwuchses. Die zweite handelnde Person ist Eduard Spranger (1882 – 1963). Sprangers Lehrstuhl an der Universität in Leipzig wird frei. Daher entwickeln Troeltsch und Spranger die Idee, den wiederzubesetzenden Lehrstuhl einer „Kulturpädagogik“ zu widmen, die die folgenden Aufgaben hat: Sie soll fachübergreifend einen kulturellen Fixpunkt für die auseinander driftenden Fächer formulieren; sie soll professionelle und professionspolitische Grundlage für die Gymnasiallehrer werden; sie soll – auf der Basis der Weimarer Klassik und des Neuhumanismus – eine allgemein verbindliche Weltanschauung bereitstellen. Eine geeignete Person für dieses anspruchsvolle Programm wurde gefunden. Nach der Absage des ursprünglichen Wunschkandidaten Kerschensteiner wurde der Düsseldorfer Gymnasiallehrer Theodor Litt (1880 – 1962) berufen, der sich mit einer zwei Jahre zuvor vorgelegten Kulturphilosophie („Individuum und Gemeinschaft“, zuerst 1919) für diese Aufgabe qualifiziert hat. Die Ausgangsbedingungen für dieses Projekt „Kulturpädagogik“ waren also denkbar günstig: eine Problemlage, die eine Lösung brauchte; eine geeignete personelle Konstellation; ein anspruchsvolles und ausgearbeitetes Theorieangebot; eine Unterstützung durch die Regierung. Das Projekt ist trotzdem gescheitert. Und dieses Scheitern ist ausgesprochen lehrreich für alle weiteren Projekte, die – mit staatlicher Sanktionierung – versuchen, eine „Leitkultur“ durchzusetzen. Denn diese Vorstellung einer einheitlichen und allgemein-verbindlichen Leitkultur – und sei sie noch so humanistisch und „wertvoll“ – verkennt Status und Rolle der Kultur in der entwickelten Gesellschaft: III. Kultur ist heute nur noch als Pluralitätsbegriff zu verstehen: Jede entwickelte Gesellschaft ist ein Zusammenhang vielfältigster Kulturen (Generationen, Ethnien, sozialökonomische 240 Document1 15.05.16 Milieus, Geschlechter, Religionen etc.), so dass sich eine wichtige politische Aufgabe daraus ergibt, diese Pluralität lebbar zu machen. Die Vereinten Nationen nutzen etwa das Motto: „Celebrate the diversity“19. Hieraus ergibt sich sofort als wichtiges Bildungsziel gerade in der kulturellen Arbeit: die Entwicklung von Kompetenz zum Umgang mit kultureller Pluralität. Eine weitere Erkenntnis wird durch die Individualisierungs- und Pluralisierungstendenzen der modernen Gesellschaft erleichtert: „Kultur“ bringt Kontingenz auf den Begriff. Damit ist gemeint, dass die Thematisierung von Kultur entschieden die „Gemachtheit“ des Lebens und der uns umgebenden Welt beinhaltet19. Kultur ist gestaltete Natur, so findet sich bereits in den tusculanischen Schriften von Cicero eine frühe Begriffsbestimmung. Wenn jedoch etwas Menschenwerk ist, dann könnte dieses auch anders sein, als es ist. Denn menschliche Produktion ist nicht „notwendig“, sondern eben immer auch „kontingent“. Gerade die jüngere Entwicklung der Moderne zeigt, dass mit dem Bewusstwerden von Kontingenz die Infragestellung allzu großer Selbstgewissheit verbunden ist, dass es eben nicht notwendig gut ist, so wie es ist. „Kontingenz“ bedeutet hier, ständig (kontrolliert) Zweifel am Zustand der Gegenwart zu äußern, Zweifel an aktuell gültigen Normen und Werten. Gerade die Künste stellen scheinbare Selbstverständlichkeiten in Frage19. Und gerade das Theater hat – etwa in der Technik des Verfremdens von B. Brecht – hierin eine wichtige Traditionslinie: „Als Kulturarbeit akzeptieren wir nur eine Arbeit, die uns diese Regeln (des jeweils „richtigen Verhaltens“; M. F.) vorführt und uns anschließend die Entscheidung überlässt, ob wir uns an sie halten wollen.“19 Daher die These: IV. Kultur thematisiert Kontingenz. Insbesondere ist moderne Kultur eine institutionalisierte Form kontrollierten Selbstzweifelns an der Richtigkeit unseres Handelns. Es liegt m. E. auf der Hand, dass beide Thesen (III und IV) in besonderer Weise für die Kulturform Theater gelten und das Theater daher sehr geeignet ist, die mit diesen Thesen verbundenen Bildungsziele zu realisieren.19 3. Die „neue“ Kulturpädagogik: ein Überblick Was man heute als Kulturpädagogik – in Theorie und Praxis – versteht, hat seine Wurzeln im München der frühen siebziger Jahre.19 Natürlich gibt es – etwa im Kontext der „musischen“ 241 Document1 15.05.16 Bildung – seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht bloß die traditionellen künstlerischen Schulfächer, sondern auch eine starke Betonung von Musik, Spiel und Tanz in der außerschulischen Jugendarbeit. Doch findet in der genannten Zeit ein vielfältiger Paradigmenwechsel statt19: Es geht nunmehr explizit um andere Formen von Pädagogik, es wird das Kind oder der Jugendliche in den Mittelpunkt gestellt – gerade bei Fragen der Gestaltung der Städte. Es geht um die individuelle Seite der pädagogischen Praxis, also um ästhetische Erfahrung der Subjekte – und gerade nicht um die Vermittlung eines Kunst-Kanons.19 Und das Ästhetische an der Erfahrung ist nicht notwendig das Künstlerische, sondern es sind vielfältige Erfahrungen und Wahrnehmungen in sozialen und auch politischen Prozessen, die im Vordergrund stehen. Kunstorientierte Arbeitsformen sind zwar möglich, aber in der Regel eingebettet in spielerische Erkundungen der Stadt, in kindgerechte Inszenierungen von Milieus. Bezogen auf die Geschichte der Ästhetik geht es hier um das Verständnis von Ästhetik als Theorie sinnlicher Wahrnehmung, so wie sie (u. a.) bei Baumgarten entwickelt wurde.19 Man kann sogar die These formulieren, dass in dieser neuen kulturpädagogischen Traditionslinie das Künstlerisch-Ästhetische erst im Laufe der Jahre wieder erobert werden musste.19 Allerdings reicht bereits das Wahrnehmungskonzept als Grundlagenkonzept weit. Denn die Schulung der Sinne, die Anthropologie des Körpers bzw. Leibes schließt eine Sensibilisierung für das Unsichtbare, Unhörbare, für das Verborgene, Versteckte mit ein.19 Kulturarbeit als Arbeit an der Wahrnehmung kann die Aufmerksamkeit auf Vielfalt und Pluralität der Kulturen lenken, auf die unterschiedlichen Möglichkeiten eines „guten Lebens“.19 Eine künstlerisch geformte Wahrnehmung nutzt zudem das Potential der „anschauenden Reflexion“ der künstlerischen Gestaltung19, nutzt die spezifischen Möglichkeiten der Verdichtung und Expressivität. Dies ist inzwischen auch anerkannter Ansatz der Kulturpädagogik: Die Pluralität unterschiedlicher Verständnisweisen der Wahrnehmung und des Sinnlichen schlechthin, die spielerische Eroberung öffentlicher Räume ebenso zu akzeptieren wie die künstlerischen Arbeitsformen im engeren Sinne und dabei rezeptive und produktive Zugangsweisen, offene Projekte und verbindlichere Kursformen als gleichermaßen legitime Arbeitsformen anzuerkennen19. Die Praxis, die sich auf der Basis dieser Selbstverständnisse entwickelt hat, ist vielfältig und heterogen19: Kulturpädagogik findet an unterschiedlichsten Orten statt: Kunst- und Kultureinrichtungen, Jugend- und Sozialeinrichtungen, spezialisierte kulturpädagogische Einrichtungen wie Jugendkunst- und Musikschulen, Medienwerkstätten etc. Sie wird von Menschen unterschiedlichster Professionen organisiert und angeleitet. Sie findet im Kontext von Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik statt. 242 Document1 15.05.16 Der Professionalisierungsgrad ist in den verschiedenen Sparten und Arbeitsfeldern sehr unterschiedlich: Von festen anerkannten Berufsbildern bis zu Tätigkeitsinhalten, bei denen noch unsicher ist, ob daraus Berufsbilder werden. Ebenso unterschiedlich ist daher die Möglichkeit, sich in grundständigem Studium und/oder langfristigen Fortbildungen für eine solche Tätigkeit zu qualifizieren. Auf der Ebene der Wissenschaft gibt es nur stellenweise Indizien dafür, dass diese neue Kulturpädagogik ihren Ruf gegenüber der Kulturpädagogik der 20er Jahre als „Weltanschauungsvermittlung von oben“ verändert hat und als lebendiges Praxis- (und weniger als lebendiges Theorie-)feld akzeptiert wird. So gibt es bislang auch erst einen einzigen Versuch einer Gesamtdarstellung19 von Kulturpädagogik, der von der Theorie über Didaktik/Methodik, der Topographie des Handlungsraumes bis zur Frage der Professionalisierung und der politischen Rahmenbedingungen in dieses Feld mit theoretischem Anspruch einführt. 4. Zur Theorie der kulturellen Bildung als Kern der Kulturpädagogik Im folgenden konzentriere ich mich darauf, Grundlinien einer Theorie der kulturellen Bildung zu skizzieren. Denn: V. Die Theorie der kulturellen Bildung ist der Kern der Theorie der Kulturpädagogik. Eine Theorie der Kulturpädagogik insgesamt wäre komplexer und anspruchsvoller, enthielte – analog zu dem Versuch in „Kultur lernen“ – auch eine Darstellung und Theoretisierung des operativen und institutionellen Feldes. So gehörte etwa zu einer solchen umfassenden Theorie auch eine Theorie kulturpädagogischer Orte: also des Museums, des Theaters, der Musikschule etc., woran man erkennen kann, wie weit entfernt eine solche ambitionierte Theorie noch entfernt ist. Für die Entscheidung, die Perspektive der Bildung in den Mittelpunkt zu stellen und diese unter dem Begriff der kulturellen Bildung zu verhandeln, gibt es gute Gründe. Es gibt zunächst praktische-politische Gründe. Seit den siebziger Jahren, als der Begriff der „kulturellen Bildung“ nach und nach den traditionellen Begriff der „musischen Bildung“ ersetzt hat, hat er sich in den drei relevanten Politikfeldern durchgesetzt: In der Jugendpolitik ist er schon seit langem in den Richtlinien wichtiger Förderprogramme und schließlich auch seit 1990 im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als legitime Arbeitsform der Jugendarbeit eingeführt. 243 Document1 15.05.16 In der Kulturpolitik werden seit 30 Jahren viele inhaltliche Impulse mit Hilfe dieses Begriffes gegeben. Ich erinnere nur an die beiden „Konzeptionen Kulturelle Bildung“ des Deutschen Kulturrates und an die Große Anfrage „Kulturelle Bildung“ im Deutschen Bundestag (Drucksache 11/7670 vom 13. 8. 1990). In der Bildungspolitik – auch und gerade in allgemeinbildenden Schulen – nutzt man zunehmend diesen Begriff als Sammelbegriff für die verschiedenen künstlerischen Schulfächer. Ich erinnere nur an den jüngsten Förderschwerpunkt der Bund-Länder-Konferenz (BLK) „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“19. Auch auf internationaler Ebene findet der Begriff der „Cultural education“ inzwischen Anwendung – und dies, obwohl im Englischen und im Französischen die Bedeutungen von Kultur/Culture/Culture ebenso komplex und uneindeutig sind wie Bildung/formation/education.19 Es gibt allerdings – dies sei zugegeben – auch gute Gründe, gegen diese sprachliche Form „kulturelle Bildung“ zu sein. Nicht zuletzt auch deshalb, weil gerade in der deutschen Geschichte „Bildung“ und „Kultur“ nicht voneinander zu trennen sind19, so dass es sich um eine eigenartige Verdoppelung desselben Sachverhaltes zu handeln scheint. Ich will dies hier nicht weiter verfolgen19, sondern nur darauf hinweisen, dass zum einen durchaus begriffliche Alternativen (etwa „ästhetische Bildung“) ebenfalls – und meist weitgehend synonym – verwendet werden, sich diese bei näherer Analyse aber ebenfalls nicht so eindeutig definieren lassen, wie es wünschenswert wäre: Das Ringen um eine inhaltliche Füllung der jeweils ausgewählten Worthülse müsste also in jedem Fall stattfinden. Doch zunächst ein Hinweis auf theoretische und konzeptionelle Gründe dafür, vom Bildungsbegriff bei der kulturpädagogischen Theorienbildung auszugehen. Gerhard Schulze spricht in seiner Kultursoziologie19 von der „Selbsterhaltungsmentalität“ der großen Kunsteinrichtungen als wichtiger Handlungsrationalität in der Kulturpolitik (die immer wieder notwendige Reformen verhindert). Auch im Bereich der Kulturverbände – und auch in wissenschaftlichen Kontexten – drängen sich ebenfalls immer wieder institutionelle Fragen, Fragen des Strukturerhaltes in den Vordergrund. Der Mensch, um dessen Entwicklung, um dessen Bedürfnisse und Interessen es letztlich geht, tritt in diesen Diskursen oft genug in den Hintergrund. Daher spricht die UNESCO in letzter Zeit verstärkt davon, das „Subjekt im Mittelpunkt“ sehen zu wollen. Und dies ist auch für mich der wichtigste Grund, von „Bildung“ auszugehen. Denn immer noch ist die These richtig, 244 Document1 15.05.16 VI. dass „Bildung“ die subjektive Seite von „Kultur“ thematisiert (ebenso wie Kultur die objektive Seite von Bildung ist), man den notwendigen Blick auf das Ganze unter der Leitlinie „Bildung“ daher aus der parteilichen Perspektive des Subjektes wirft.19 „Bildung“ stellt dann nicht als erstes die Frage, was die Wirtschaft, die Politik oder die Gesellschaft an „Qualifikationen“ von dem Einzelnen braucht, sondern sie fragt danach, was der Einzelne an Kompetenzen, Fähigkeiten, Einstellungen, Dispositionen braucht, um ein „Leben in aufrechtem Gang“ (E. Bloch) zu führen. Es geht also um das handlungsfähige Subjekt, es geht um die Frage, wie die Partizipation des Einzelnen in Prozessen gesellschaftlicher Steuerung erhöht werden kann: Es geht um das je individuelle „Projekt des guten Lebens“. Natürlich ist diese Perspektive kulturell nicht neutral. Man kann zeigen, wie stark die Idee eines handlungsfähigen Subjekts, das eigenverantwortlich und autonom sein Leben gestaltet, zur europäischen Kultur gehört (und auch entschieden protestantisch imprägniert ist).19 Allerdings muss bei aller kulturellen und historischen Relativierung dann darauf hingewiesen werden, dass diese Vorstellung individueller Subjektivität inzwischen insofern als „allgemein menschlich“ anerkannt wird, als es genau dieses Menschenbild ist, das in internationalen Regelwerken (Menschenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention etc.) fast von der gesamten Völkerfamilie akzeptiert wird. VII. „Bildung“ thematisiert daher den Anspruch aller Menschen auf „menschgemäßes“ Leben in normativ anspruchsvoller Form. Doch wie begründet ist diese Norm? Woher weiß man, was „menschgemäß“ ist? An dieser Stelle stellt sich also die Frage nach der Begründung des Menschenbildes, das dem anvisierten ambitionierten Bildungsbegriff unterliegt. Da ich diese Frage als höchst legitim akzeptiere, ist für mich Bildungstheorie nur auf einem reflektierten anthropologischen Fundament zu formulieren. Dieses findet man in der These vom Menschen als einzigem kulturell verfassten Wesen. Mit Helmut Plessner und Ernst Cassirer befindet man sich – so meine ich – philosophisch und humanwissenschaftlich auf sicherem Boden.19 Ich will dies hier nicht ausführen, sondern nur auf zwei zentrale Erkenntnisse hinweisen:19 Helmut Plessner arbeitet in seiner Anthropologie systematisch den Gedanken der „exzentrischen Positionalität“ aus: Der Mensch tritt als einziges Lebewesen (fiktiv oder virtuell) neben sich, tritt aus der für Tiere selbstverständlichen Mitte seiner Lebenswelt heraus und kann daher sich und die Bedingungen seiner Existenz zum Gegenstand der Betrachtung 245 Document1 15.05.16 machen. Die Distanz zu sich ist die Basis für ein reflexives Verhältnis zu sich. Damit bricht jede unhinterfragte Selbstverständlichkeit eines bloß instinkgelenkten Lebens weg, so dass er als zentrale Überlebensaufgabe hat, sein Leben bewusst führen zu müssen. Ernst Cassirer zeigt uns – kompatibel mit diesem Plessnerschen Grundgedanken –, dass der Mensch als „animal symbolicum“ vielfältige Zugangsweisen zur Welt und zu sich entwickelt, die diese Distanz überbrücken: Sprache, Mythos, Religion, Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Politik. Jede dieser Formen hat das Ganze im Blick – freilich auf je spezifische Weise. Keine dieser Formen ist verzichtbar – weswegen es falsch ist, etwa Wissenschaft gegen Kunst auzuspielen19, denn erst ihre Gesamtheit macht „Kultur“ (i. S. von Cassirer) aus. Cassirer lehrt also, Kultur als Pluralitätsbegriff zu verstehen, wobei die notwendige Einheit jeweils im Subjekt vollzogen wird. Dies ist in einem allgemeineren Verständnis die zentrale „kulturelle“ Bildungsaufgabe. Erinnert man sich nun daran, dass eine gut begründete Konzeption von Bildung diese als „wechselseitige Verschränkung von Mensch und Welt versteht“, als Herstellung eines bewussten Verhältnisses des Subjekts zu sich, zu seiner natürlichen und sozialen Umwelt, zu seiner Vergangenheit und Zukunft, dann wird deutlich: Eine so verstandene Bildung verschärft lediglich die Konturen, die bereits die Anthropologie bei der Bestimmung von Menschsein lehrt. VIII. Die zentrale (kultur-)pädagogische Aufgabe besteht darin, dem „Menschgemäßen“ (i. S. von Plessner und Cassirer) zur Entwicklung zu verhelfen.19 Kulturelle Bildungsarbeit könnte dann als (angeleiteter) Entwicklungsprozess des Subjekts in jeder einzelnen symbolischen (=Kultur-)Form verstanden werden. Im engeren Sinne lässt sich jedoch auch eine Fokussierung auf einzelne symbolische Formen – also etwa auf „Kunst“ – begründen. An dieser Stelle ist die Weite des Kulturbegriffs sogar hilfreich: Er verweist darauf, dass der Mensch vielfältige Zugangsweisen zur Welt hat, die alle notwendig und legitim sind. Dies schützt vor Allgemeinvertretungsansprüchen einzelner Disziplinen. Und es erzwingt geradezu, das Spezifische der eigenen Zugangsweise (also der Musik, des Theaters, der Bildenden Kunst) heraus zu arbeiten, also zu zeigen, wie die allgemeinen Kulturfunktionen19 speziell im eigenen Fach realisiert werden. Dies bedeutet, dass sich eine Theorie der Theaterpädagogik im Überschneidungsbereich einer Theorie des Subjekts/Anthropologie und einer Theorie des „Gegenstandes“ Theater – sicherlich auch unter Berücksichtigung der Logik 246 Document1 15.05.16 von Vermittlungsprozessen – entwickeln lassen müßte. Auf der Basis dieser – an anderer Stelle umfassend dargestellten – Überlegungen kann man folgende Definition begründen: IX. Kulturelle Bildung ist Allgemeinbildung, die mit den spezifischen kulturpädagogischen Arbeitsformen (des Theaters, der Musik, des Tanzes etc.) entwickelt wird.19 5. Zur Rolle des Theaters als symbolischer Form Unter den oben bereits eingeführten „Kulturfunktionen“ verstehe ich Prozesse, die notwendig in einem Gemeinwesen stattfinden müssen, da es ein Mindestmaß an Kohärenz – quasi als „sozialen Kitt“ – benötigt. Es handelt sich dabei v. a. um die Möglichkeiten, Bilder von sich zu entwickeln, Gemeinschaftserfahrungen zu symbolisieren, über Medien zu verfügen, die einen Diskurs über Vorstellungen des guten Lebens gestatten, die die Geschichtlichkeit der individuellen und sozialen Existenz erfassen. Man muss nur eine grobe Überprüfung am Beispiel einer beliebigen Wissenschaft, Kunstform oder Religion machen, um zu sehen, dass in der Tat all diese „Kulturmächte“ auf je unterschiedliche Weise derartige Kulturfunktionen erfüllen oder zumindest: Es beanspruchen. Bevor ich einige Überlegungen zum Theater als spezifischer symbolischer Form anstelle, mag man folgende weitere Bestimmung von Bildung betrachten: X. Bildung – oben bereits eingeführt als subjektive Seite der Kultur – kann im Hinblick auf Kulturfunktionen als Fähigkeit verstanden werden, je individuell an diesen Kulturfunktionen zu partizipieren. Kulturfunktionen sind also aus der Sicht des Individuums Bildungsfunktionen. Insofern Theater solche Kulturfunktionen erfüllt, ist eine individuelle Involviertheit in das Theater zugleich die Realisierung theatraler Bildung. Doch nun zur symbolischen Form Theater. Als eine Grundlagentheorie für kulturelle Bildung wurden oben die Anthropologien/Kulturphilosophien von Plessner und Cassirer eingeführt. Offensichtlich realisiert das mimetische, also nachahmende Spiel als bereits früh in der Menschheitsgeschichte auftauchende Handlungsform nahezu maßgeschneidert die „exzentrische Positionalität“: Menschen schlüpfen in Rollen und zeigen sich und anderen bestimmte Handlungsabläufe, oft in vielfältigen Wiederholungen (Rituale). Sie machen damit für sich Situationen und Emotionen erlebbar und kommunizierbar. Sie treten aus der unmittelbaren Lebenssituation heraus und „schau247 Document1 15.05.16 en“ auf sich selbst (so wie es die griechische Wortbedeutung von „Theater“ nahelegt). 19 Diese Form von Mimesis unterscheidet sich von der „anschauenden Reflexion“ im Umgang mit einem Bild, bei dem bewußt in stilisierter Form die Zeit stillgestellt ist. Hier handelt es sich um körperhafte Präsenz im zeitlichen Ablauf. Es ist also kein Wunder, dass Helmut Plessner nicht bloß eine „Anthropologie“ des Schauspielers geschrieben hat 19, sondern auch derjenige war, der nach dem zweiten Weltkrieg die soziologische Rollentheorie in Deutschland eingeführt hat. Denn es ist kein bloß metaphorischer Sprachgebrauch, den Prozess der Sozialisation mit dem Theaterbegriff der „Rolle“ zu konzeptionalisieren, sondern genau dies ist wörtlich zu nehmen (Goffman: „Wir alle spielen Theater“).19 Es ist eben notwendig, die Unmittelbarkeit des eigenen Ich zu verlassen und sich im Sinne einer Perspektivverschränkung mit den Augen anderer zu sehen, wenn man eine persönliche Identität entwickeln will. Das Theater liefert in jüngster Zeit weitere Erklärungsmöglichkeiten für gesellschaftliche Prozesse. So spricht man – eben aufgrund der gewachsenen Relevanz der Postmoderne und der Betonung der Oberfläche und des Scheins – zunehmend von einer „Inszenierung der eigenen Person oder des öffentlichen Lebens“. Die Stadt wird als „Bühne der Sichtbarkeit“ verstanden, bei der bewusst gestaltet wird19, was man zeigen will und was nicht. Generell spielt in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft „Theatralität“ eine zunehmend wachsende Rolle. Hier ist die Postmoderne nur ein letzter kräftiger Akzent: „Dass theatralisches Gebaren durchaus zum Instrumentarium gesellschaftlicher Kommunikation gehört, ist eine über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg zu betrachtende Erscheinung. Beschneidungsriten, zirzensische Spiele, Gottesdienste, Prozessionen, Festumzüge, Aufmärsche, militärische Manöver und Paraden, „Haupt- und Staatsaktionen“, Demonstrationen, Parteitage: Die Inszenierung von Festen, die Architektur, die Stadtgestaltung, ja: das Verständnis allen sozialen Handelns nach Maßgaben des Theaters – oft allerdings in der negativen Bewertung von Verstellung und Manipulation – prägt das Selbstbild der Gesellschaft seit langem“. 19 In dieser Situation war es dann nur noch ein kleiner Schritt zu der umfassenden Inszenierung aller lebensweltlichen Bereiche, so wie sie in jüngster Zeit registriert wird. Bill Clinton gilt in diesem Zusammenhang als erster US-Präsident, dessen Politik – in ihrer Präsentation und in ihren Inhalten – nur noch über ihre Inszenierungsqualität und ihre Akzeptanz beim Publikum gesteuert wird. Theatrale Bildung erhält hier geradezu gesellschaftskritische Bedeutung, denn es ist die spezifische Symbolkompetenz des Theaters, die helfen kann, öffentliche Inszenierungen zu durchschauen. 248 Document1 15.05.16 6. Neue Entwicklungen in der Kulturpädagogik Abschließend will ich auf einige neuere Entwicklungen hinweisen, bei deren Bearbeitung die Theaterpädagogik unverzichtbar ist. 1. Als erstes weise ich auf unser großes Modellprojekt „Lebenskunst“ hin. 19 „Lebenskunst“ hatte u. a. die Bedeutung, die ich eingangs angesprochen habe: Die pädagogischen Prozesse – auch die Prozesse der Lebensbewältigung – aus der Perspektive des Subjekts zu betrachten. Es ist der Einzelne, der – natürlich im sozialen Zusammenhang – sein Leben führen und gestalten muss. Eine wichtige Konsequenz haben die praktischen Projekte, die wir im Rahmen dieses Modellprojekts gefördert haben, erbracht: Es ergibt sich eine Neubestimmung der Rolle der pädagogischen Anleitung. Auch in der außerschulischen Kulturpädagogik sind die Projekte zu oft lehrerorientiert. Dies scheint auch der Theaterpädagogik nicht ganz fremd zu sein, wenn ich mich an die Diskussionen über die Rolle des Spielleiters erinnere. Die Perspektive der „Lebenskunst“ kann hier zu einer kritischen Selbstbesinnung der „Profis“ führen – auch als Teil ihrer pädagogischen Professionalität. 2. Eine zweite interessante Entwicklung bahnt sich möglicherweise in der beruflichen Bildung an. Dort stellt man (erneut) fest, dass es angesichts eines schnellen Wandels in der Wirtschaft immer weniger möglich ist, die berufliche Bildung an jeweils vorhandenen Anforderungsprofilen zu orientieren. Denn nach Abschluss der Berufsausbildung sind diese Qualifikationen schon wieder veraltet. Daher erprobt man nunmehr das Konzept der „Kompetenz“, das sich zwar auch auf zu entwickelnde Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen bezieht, diese jedoch nicht aus externen Anforderungprofilen ableitet, sondern, – vom Subjekt aus! – auf Stärken des Einzelnen bezieht. Ein solcher Ansatz ist für die Kulturpädagogik kompatibel, so dass sich hier neue Kooperationsformen von kultureller und beruflicher Bildungsarbeit ergeben könnten. 3. Mit diesem möglichen Paradigmenwechsel könnte ein neues Verständnis des „Lernens“ einhergehen.19 Gerade der Lernbegriff wird immer noch von einem Verständnis einer eng lehrplanbezogenen und lehrerzentrierten Instruktion geprägt. Lernen aus der Sicht des Subjekts und seiner Entwicklung zu betrachten heißt dagegen: systematisch Situationen herzustellen, in denen der Einzelne oder die Gruppe ihre Stärken entfalten können. Lernen, das weiß man seit langem, registriert es in der Bildungspolitik allerdings erst seit kürzerer Zeit, geschieht nur zu einem kleinen Teil in formalen Lernsituationen: Man schätzt, dass etwa 70 – 80% dessen, was der Mensch kann und können muss, aus informellen und non-formalen Lernprozessen entsteht. Ein neues Projekt der BKJ will daher 249 Document1 15.05.16 kulturpädagogische Lernprozesse auch als solche deutlicher kenntlich machen, so dass auch hier Bestätigungen von Lernerfolgen („Zertifikate“) möglich sind. 4. Die setzt allerdings voraus, dass wir uns erneut mit den Methoden der Erfassung von Bildungswirkungen beschäftigen müssen. Mir scheint, dass quer durch alle kulturpädagogischen Arbeitsfelder hierbei ein erheblicher Mangel besteht, so dass wir – insbesondere mit einem Schwerpunkt bei qualitativen Methoden – in den nächsten Jahren diese Form einer pädagogischen Wirkungsforschung verstärken wollen und müssen.19 Literatur Andraschke, A./Spaude, E. (hg.): Welttheater. Die Künste im 19. Jahrhundert. Freiburg: Rombach 1992. Baecker, D.: Wozu Kultur? Berlin: Kadmos 2000. Baer, U. u.a.: Lernziel Lebenskunst. Spiele - Projekte - Interviews. Seelze: Kallmeyer 1997. Bollenbeck, G.: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. München: Insel 1994. Breyvogel, W. (Hg.): Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität. Bonn: Dietz 1998. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Ästhetik in der kulturellen Bildung. Aufwachsen zwischen Kunst und Kommerz. Remscheid 1997. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Zur Wirksamkeit eines Programms des Kinder- und Jugendplan des Bundes. Remscheid 1997. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Lernziel Lebenskunst. Konzepte und Perspektiven. Remscheid: BKJ 1999. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Partizipation und Lebenskunst . Beteiligungsmodelle in der kulturellen Jugendbildung. Remscheid: Schriftenreihe der BKJ 2000. Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung: Lernziel Lebenskunst - Ergebnisse (Arbeitstitel) Remscheid 2001 (i. E.). Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Frankfurt/M.: Fischer 1990 (Original: 1944). Fisch, J.: Zivilisation/Kultur. In: Brunner, O. u. a. (Hg.): Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache. Bd. 7. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. Fischer-Lichte, E.: Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tübingen/Basel: Francke/UTB 1993. Fischer-Lichte, E.: Theater im Prozeß der Zivilisation. Tübingen/Basel: Francke 2000. Fischer-Lichte, E.: Vom "Text" zur "Performance". Der "Performative Turn" in den Kulturwissenschaften. In Kunstforum..., 2001, S. 61ff. 250 Document1 15.05.16 Fuchs, M./Liebald, Chr. (Hg.): Wozu Kulturarbeit? Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik und ihre Evaluierung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Remscheid: BKJ 1995. Fuchs, M.: Bildung, Kunst, Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der kulturellen Bildung. Remscheid: BKJ 2000 Fuchs, M.: Das Scheitern des Philanthropen Ernst Christian Trapp. Eine Untersuchung zur sozialen Genese der Erziehungswissenschaft im 18. Jh. Weinheim/Basel: Beltz 1984. Fuchs, M.: Kultur lernen. Eine Einführung in die Allgemeine Kulturpädagogik. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ). Remscheid: BKJ 1994. Fuchs, M.: Kultur Macht Politik. Studien zur Bildung und Kultur der Moderne. Remscheid: BKJ 1998. Fuchs, M.: Mensch und Kultur. Anthropologische Grundlagen von Kulturarbeit und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999. Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Historische und systematische Studien zu ihrer Genese. Leverkusen: Leske und Budrich 2001. Holz, H. H.: Philosophie der bildenden Kunst. Drei Bände. Bielefeld: Aisthesis-Verlag 1996/1997/1998. Kinder- und Jugendkulturarbeit in NRW. Düsseldorf 1994. Kirchhoff-Hund, B.: Rollenbegriff und Interaktionsanalyse. Soziale Grundlagen und ideologischer Gehalt. Köln: PRV 1978. Kolfhaus, St.: Von der musischen zur soziokulturellen Bildung - Entwicklungen, Neuansätze und Modelle kultureller Erwachsenenbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Köln/Wien: Böhlau 1986. Krüger, H.-H.: Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft. Leverkusen. Leske und Budrich 1997. Meyer, Th.: Die Inszenierung des Scheins. Essay-Montage. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1992. Our Creative Diversity. Report of the World Commission on Culture and Development. (President: J. Perez de Cuellar). Paris 1995 Pazzini, K.-J./Enders, /Fuchs, M.: Kulturelle Bildung im Medienzeitalter. Bonn: BLK 1999. Plessner, H.: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin: de Gruyter 1965. Plessner, H.: Gesammelte Schriften, Bd. VIII: Conditio humana. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1983. Plessner, H.: Philosophische Anthropologie. Lachen und Weinen. Das Lächeln. Anthropologie der Sinne. Frankfurt/M.: S. Fischer 1970. Schulz, W. K.: Untersuchungen zur Kulturtheorie Theodor Litts. Neue Zugänge zu seinem Werk. Weinheim: DSV 1990. Schulze, G.: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/M.: Campus 1992. Seel, M.: Ethisch-ästhetische Studien. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986. 251 Document1 15.05.16 Steenblock, V.: Theorie der kulturellen Bildung. Zur Philosophie und Didaktik der Geisteswissenschaften. München: Fink 1999. Sting, W.: Wildwuchs und Vielfalt. Kulturpädagogische Arbeit in Metropolen. Texte zur Kulturpolitik. Band 4. Essen: Klartext 1993. Thurn, H. P.: Kulturbegründer und Weltzerstörer. Der Mensch im Zwiespalt seiner Möglichkeiten. Stuttgart: Metzler 1990. Treptow, R.: Bewegung als Erlebnis und Gestaltung. Zum Wandel jugendlicher Selbstbehauptung und Prinzipien moderner Jugendkulturarbeit. Weinheim/München: Juventa 1993 Troeltsch, E.: Gesammelte Schriften. Bd. 1.: Die Soziallehren der christlichen Gruppen und Kirchen (1922). Bd. 3: Der Historismus und seine Probleme (1922). Bd. 4: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie (1925). Aalen: Scienta 1965/1961/1966. Weber, M.: Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus. Textanalyse von 1904/05 mit Zusätzen der zweiten Fassung von 1920. Bodenstein: Athenäum etc. 1993. Welsch, W.: Ästhetisches Denken. Stuttgart: Reclam 1990. Wulf, Chr. (Hg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Weinheim/Basel: Beltz 1997. Zacharias, W.: Entwicklung didaktischer Strukturen in der Kulturpädagogik am Beispiel der Pädagogischen Aktion. Diss. phil. Univ. Hamburg 1993. Zacharias, W.: Kulturpädagogik. Kulturelle Jugendbildung. Eine Einführung. Leverkusen: Leske und Budrich 2001. 252 Document1 15.05.16 253