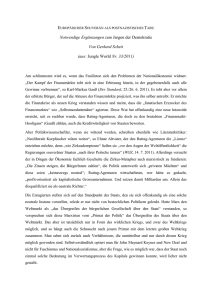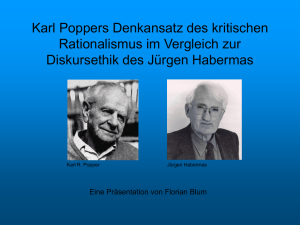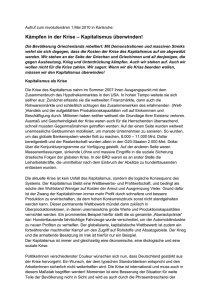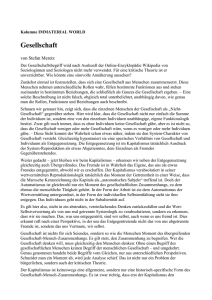Kleinerwerden - Die Freunde Europas und das neue
Werbung

Berthold Franke Kleinerwerden - Die Freunde Europas und das neue Narrativ Männlich, 69 – so hat man sich den durchschnittlichen Europa-Denker unserer Tage vorzustellen. Dieses Durchschnittsalter einiger prominenter Autoren der jüngsten Zeit (Ulrich Beck, Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhoftstadt, Jürgen Habermas, Claus Leggewie, Geert Mak, Robert Menasse, Oskar Negt, Martin Schulz1) entspricht im Übrigen genau dem der Rolling Stones, über deren europäische Überzeugungen nichts bekannt ist. Nichts gegen ältere Herren in der politischen Publizistik, es handelt sich vorwiegend um sympathische und kluge Autoren, die versuchen eine Krise zu erfassen und Ziele zu beschreiben. Ja, in der Mehrzahl wagen sie sogar ein eher altersuntypisches Maß an Engagement und Pathos, weil es in der Tat um etwas Großes geht. So analysieren sie, plädieren, polemisieren für die Erneuerung des Projekts der europäischen Einigung und – verfehlen das Ziel. Mehr als wahrscheinlich ist, dass Alter und Herkunft (das linke bis liberale Pro-Europa-Milieu) dieser einigermaßen willkürlich herausgegriffenen Autoren einen Teil des Problems bilden, das sie publizistisch bearbeiten. In ihren kritischen Interventionen erweist sich nämlich, dass Europa, wohl nicht erst seit der Krise, unterderhand endgültig zu einem Projekt wohlmeinender Intellektueller geworden ist, aus deren Beiträgen, bei aller analytischen Kompetenz und vielen bemerkenswerten Teileinsichten, vor allem eins hervor tritt: politische Ratlosigkeit. Trotz unterschiedlicher Perspektiven und Methoden laufen die ausgewählten Positionen nämlich auf das Gleiche hinaus: eine alarmierende Diagnose (meist in Form des Zugleich von Demokratiedefizit, Renationalisierung des Diskurses und versagender Eliten in Medien und Politik) und das Fehlen konkreter und realistischer Lösungsansätze. So verfestigt sich ein wohl symptomatischer Befund: Während die EU, entstanden als Plan visionärer Staatsmänner der Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, in ihrer größten Krise nurmehr von einem Kreis atemlos von Gipfel zu Gipfel hastender Staatslenker mit Primärorientierung auf nationale Wahlarithmetik verwaltet wird, ist das demokratische Europa eine Utopie darüber mehr oder weniger frustrierter intellektueller Veteranen geworden. Deren vielbeschworenes „Europa der Bürgerinnen und Bürger“ muss derweil ohne den Souverän auskommen, der sich in vielen Mitgliedsstaaten enttäuscht abwendet - entweder weil er (in den reicheren Ländern) glaubt, dass Europa zu viel verlange oder (in den ärmeren Ländern) zu wenig gebe. Die Perspektivarmut der aktuellen Brüsseler Politik, der undemokratische Durchmarsch der intergouvernementalen Exekutive, dazu die Schiefheit des institutionellen Rahmens der Lissabon-Verträge, sind oft genug beschrieben und beklagt worden: die Erweiterung sei zu schnell gegangen, das Parlament habe zu wenig Rechte, der Rat, d.h. die Mitgliedsstaaten setzten im Zweifelsfall alle anderen Institutionen außer Kraft und fällten gezielt schwache Personalentscheidungen, die Großen dominierten die Kleinen, dazu das Stottern des deutsch-französischen Motors usw. Alles nicht falsch und doch wenig erhellend, weil aus den Reihen der Europafreunde zur Lösung nicht viel mehr als der Refrain des Aufrufs zur Re-Enthusiasmierung des mental erschlafften europäischen Bürgers und seiner politischen Eliten ertönt, ganz als ob dem Problem durch wohltönende Appelle beizukommen wäre. Dergleichen wie auch immer gut gemeinte und gut begründete 1 Vgl. Ulrich Beck: Das deutsche Europa Berlin: Suhrkamp 2012, Daniel Cohn-Bendit/Guy Verhoftstadt: Für Europa! München: Hanser 2012, Jürgen Habermas: Zur Verfassung Europas Berlin: Suhrkamp 2011, Claus Leggewie: Der Kampf um die europäisches Erinnerung München: Beck 2011, Geert Mak: Was wenn Europa scheitert München 2012, Robert Menasse: Der Europäische Landbote Wien: Zsolnay 2012, Oskar Negt: Gesellschaftsentwurf Europa Göttingen: Steidl 2012, Martin Schulz: Der gefesselte Riese Berlin: Rowohlt 2013. 1 Interventionen verhallen aber weitgehend folgenlos und verstärken eher das um sich greifende Gefühl der Hilflosigkeit als es zu wenden.1 Also ruft man zur Aktion: Nahezu unüberschaubar ist mittlerweile die Szene der die in die Jahre gekommenen traditionellen Pro-Europa-Vereine und Stiftungen ergänzenden oder aus ihnen hervorgegangenen Bündnisse, Initiativen und Netzwerke, die sich untereinander an Begeisterung und Mobilisierungswillen für die Zukunft Europas geradezu überbieten wollen.2 Solches kommt mal nachdenklicher, mal pfiffiger, mal im Hochglanzformat von potenten Partnern finanziert, mal ganz im Grassroots-Gewand daher. Immer aber findet sich zweierlei: eine Internetaktion (Manifest mit Unterzeichnungsmöglichkeit o.ä.) und eine Folge internationaler Konferenzen mit Schlussteil in Brüssel, wo dann die Riege der üblichen Verdächtigen auftritt, in der Mehrheit ältere Herren, gerne auch in Gesellschaft großer Künstler oder intellektueller Mandarine des Europa-Gedankens. Da hört man dann das vertraute Krächzen des 68er Veterans C-B als Antwort auf die Würdigung des europäischen Kinos durch den Filmemacher W, die freundlich-ernsten Worte des ExKommissionspräsidenten P als Entgegnung auf die kulturkritischen Girlanden des internationalen Großarchitekten K, alles im Live-Stream und später als Podcast oder gar Taschenbuch vielsprachig und weltweit verfügbar gemacht bis zu den Schlussempfehlungen, die regelmäßig in der Forderung nach einer bedeutenden Nachfolgekonferenz im kommenden Jahr gipfeln. Das ist, zumal für einen Neuling in Brüssel, zunächst einmal je nachdem durchaus anregend. Doch schon bei der zweiten oder dritten Veranstaltung stellt sich das ungute Gefühl ein: alles irgendwie richtig und positiv, aber schon viel zu oft gesagt, nichts wirklich Packendes, nichts Neues unter der Sonne. Im Gegenteil, die Inflation vergleichbarer Aktionen macht das Missverhältnis zwischen Ambition und Ertrag umso auffälliger. Man ahnt die Absicht und ist verstimmt - und könnte diese Erfahrung auf den geschätzten 300 bis 400 ähnlichen Veranstaltungen des Brüsseler Jahreskalenders (es gibt ja noch zusätzlich den schwindelerregenden EU-Alltagsbetrieb der Konferenzen, Seminare und öffentlichen Debatten) wiederholen. Die tiefste Ernüchterung erzeugen dann regelmäßig jene Momente, in denen, oft im peinlich anbiedernden Tonfall, ganz besonders die Jugend angesprochen wird. Da hört man lieber gleich die völlig unpädagogischen, dafür durch historische Erfahrung beglaubigten Stellungnahmen von Nachkriegseuropäern der ersten Stunde. Die sind allerdings nicht Ende 60 sondern, wie Jacques Delors und Helmut Schmidt zwischen 85 und 95 Jahre alt.3 Am nächsten Morgen schwirren dann wieder die Hubschrauber über der Brüsseler Oberstadt - die Staats- und Regierungschefs fliegen ein zum nächsten Ratsgipfel und stolpern durch das nächste hektisch aufgestellte Rettungsszenario. Einen symptomatischen Fall im Kreise der sich zur Rettung Europas berufenen Autoren stellt der österreichische Romancier Robert Menasse dar, der, nach langjähriger Ankündigung eines großen Romans aus dem Brüsseler EU-Milieu vorerst mit kleineren Schriften zum Thema auftritt.4 Herzstück seines weniger analytisch als polemisch angelegten Essays ist der Versuch in einer Art dezisionistischer Übersprungshandlung 1 In erfrischender Offenheit beschreiben Cohn-Bendit/Verhofstadt (a.a.O., S. 71) ihren Beitrag auch als "Predigen in der Wüste". 2 Genannt seien hier als Beispiel nur drei der intelligenteren Angebote aus diesem Feld: www.europa-neu-begruenden.de, www.asoulforeurope.eu, www.manifest-europa.eu/allgemein/wir-sind-europa 3 S. Helmut Schmidt und Jacques Delors auf: https://www.youtube.com/watch?v=d84UmSHh4is 4 Robert Menasse: Der Europäische Landbote Wien 2012, s. auch Robert Menasse/Ulrike Guérot: „Es lebe die europäische Republik“ in FAZ 8.3.2013 2 den gordischen Knoten zu durchschlagen, indem er ganz einfach die europäischen Nationalstaaten als Inkarnation des verderblichen Nationalismus abzuschaffen fordert. Menasses Argumentation zeigt in exemplarischer Weise das Dilemma auch vieler anderer, differenzierter argumentierender Autoren: Der nationale Egoismus der Mitgliedsstaaten soll demnach gebrochen werden durch die Vereinigung der europäischen Nationen zu einem wie auch immer supra-nationalen Gebilde. Dass dies auf demokratischem Wege nicht möglich ist, wo die Agenda der Mitgliedsstaaten gerade aus Rücksichtnahme auf deren jeweilige Wahlbevölkerungen, die solchen Plänen zunehmend skeptisch gegenüberstehen, immer nationaler wird, wird von Menasse mehr oder weniger elegant ausgeblendet. Hintergrund der aktuellen Krise ist ja nicht nur, dass die Reichen sich von Europa abwenden, weil sie nicht teilen wollen, sondern dass auch die Ärmeren bzw. bislang von der Krise stärker betroffenen Völker der weiteren Integration immer argwöhnischer gegenüber stehen, weil sie die EU als Agenten ihres Niedergangs wahrnehmen - durchaus in präziser Erfassung des Zusammenhangs. Problem sind also, rein institutionell gesehen, nicht die vom Demos abgekoppelten, sondern die viel zu ängstlich auf ihre Wähler schielenden Mitgliedsstaaten der EU. Menasses Intervention entstammt einer augenscheinlich heftigen Fixierung nicht nur auf sein Heimatland, sondern vor allem auf Deutschland1 und führt zu einem Unsinn der höheren Art: Nation, Nationalismus und deutsches Machtstreben werden in eins gesetzt, worauf in höchster Empörungstonlage („Krieg den Palästen!“) zu einem grundstürzenden Befreiungsschlag gegen die aktuelle Politik des europäischen Rats, vor allem die dort herrschende deutsche Dominanz aufgerufen wird. Proklamiert wird die Nation Europa – und irgendwie das Ende der Kleinstaaterei, die von einem, nicht weiter erläuterten, wohl stark von österreichisch-deutschen Träumen geprägten, „Europa der Regionen“ abgelöst werden soll. Kein Zufall, dass er auf Beispiele aus anderen europäischen Himmelsrichtungen, zum Beispiel aus Polen oder Dänemark großzügig verzichtet, würden doch seine Thesen im Vereinigten Königreich, in Schweden, den Niederlanden oder auch Portugal bestenfalls Kopfschütteln hervorrufen. Und dies nicht deshalb, weil dort die Menschen noch in nationalistischer Verblendung leben, sondern weil sie andere Erfahrungen haben als zum Beispiel die Österreicher oder die Deutschen, deren besondere Verwandtschaft sich gerade hier, beim intellektuellen Unbehagen an den eigenen Nationen erweist. Wer von Europa spricht, sollte wissen, dass es andere Nationalgeschichten gibt als diejenigen der beiden Staaten, die Europas Schicksal vor knapp 100 Jahren zum Entgleisen gebracht haben, und die an dieser und den Folgekatastrophen den Zweifel am Nationalen gelernt haben. So ist Menasses Essay, für den er als Titel nicht weniger als den „europäischen Landboten“ reklamiert, ein Beispiel neuer politischer Romantik in Form eines letztlich ganz unpolitischen Affekts des Missvergnügens an der Wirklichkeit. Dies führt bei den öffentlichen Auftritten des Autors in Brüssel zu eher bizarren Momenten, wenn er seinem Publikum, den versammelten EU-Beamten und Lobbyisten, endlich einmal Balsam in Form von überschwänglichem Lob auf ihre gequälten Seelen spendet, nach der Formel: sie, die allseits zu Unrecht als Eurokraten gemobbten geduldigen Gärtner im Weinberg der europäischen Einigung seien die wahre Avantgarde im Kampf gegen die nationalistisch verblendeten Medien und Machthaber (d.h. vor allem gegen die Berliner Machthaberin!), die Bremser und Denunziatoren des wunderbaren europäischen Einigungswerks. So was tut gut, und der Applaus 1 Leseprobe: „Nach den Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts…hätte man es nicht mehr für möglich gehalten, dass in Deutschland heute so schnell, so wirksam, so fanatisch ein Feindbild produziert werden kann, das vom Industriellen bis zum Hartz-IVEmpfänger nahezu alle in nationalistischem Hass zu einer „Volksgemeinschaft“ vereint, die mit allen Mitteln den „fremden Parasiten“ bestrafen will, der am „gesunden deutschen“ Volkskörper“ schmarotzt.“ 3 ist dem Mann hier so sicher, wie jedem CSU-Funktionär, der auf der Jahreshauptversammlung die Verdienste der Sudetendeutschen beim Nachkriegsaufbau würdigt. Solche Nachrichten aus dem Wiener Kaffeehaus sollen hier vor allem als Beleg für eine gewisse Realitätsverweigerung des Pro-Europa-Milieus stehen. Diese trifft sich durchaus ironisch mit einer bedenklichen Entwicklung in weiten Kreisen des Brüsseler Establishments und dessen Selbstverständnis als verkannte Speerspitze des Fortschritts, die „nur“ durch die Mitgliedsstaaten an der endgültigen Herbeiführung des europäischen Glücks gehindert seien. In einer bösen Zuspitzung könnte hier von einer Art bolschewistischem Wagenburg-Syndrom als Folge der blockierten EU-Demokratie gesprochen werden. Die Lage ist nämlich erheblich komplexer, zumindest ist sie paradox. So gilt einerseits, dass es z.B. eine Zumutung für den europäischen Bürger darstellt, wenn ganz erhebliche Teile der Zukunft der EU am Seidenfaden eines Spruchs einiger Karlsruher Richter in roten Roben hängen. Andererseits bedeutet es zugleich eine Provokation für jeden Demokraten (s. Zustimmung der griechischen Wähler zum Rettungsschirm), wenn ein Club von Staats- und Regierungschefs ohne parlamentarische Kontrolle fundamental in die Souveränität, die Geldbeutel und das Schicksal von Millionen nicht gefragter EU-Bürgern eingreift. „Jedes demokratische Land hat die Politiker, die es verdient. Und von gewählten Politikern ein Verhalten jenseits der Routine zu erwarten, hat etwas Apartes.“1 Diese Diagnose von Jürgen Habermas steht in einem ihm wohl selbst bewussten Widerspruch zu seiner urdemokratischen Idee, die politischen Eliten sollten in einem wagemutigen Schritt ihr Schicksal mit dem Projekt einer weiteren Vertiefung der EU durch nationale Plebiszite im Zusammenhang mit den jeweils kommenden nächsten nationalen Wahlen verbinden. Das Problem der postnationalen Position liegt, neben einer (s. Menasse) historisch fragwürdigen Unterschätzung der Rolle des Nationalstaats bei der Durchsetzung von Demokratie, Recht und Freiheit, nämlich in dem Umstand, dass, schematisch gesprochen, zur Abschaffung des Nationalstaats der Nationalstaat selbst ein letztes Mal zumindest im Akt der Souveränitätsaufgabe handeln muss. Und in der EU wären das mittlerweile 28 solcher Akte. Damit beruht die Habermas vorschwebende Umstellung der EU vom „Elitenmodus“ auf den „Bürgermodus“ auf einer paradoxen Voraussetzung, nämlich der demokratischen Legitimation eines einstweilen den Bürgern mit gutem Grund als elitär geläufigen Projekts. Wenn die Lösung nicht in der „harten“ Politik liegt, werden die sogenannten „weichen Faktoren“ interessant, es ertönt der Ruf nach der Kultur. “La culture nous sortira de la crise”, titelt Le Monde (am 4.12.2012), und die Brüsseler Redenschreiber sortieren ihre Textbausteine für die üblichen Sonntagsbeiträge über Kultur und Politik („Das Gute, Wahre, Schöne in dürftiger Zeit“). Immer wieder stellt sich dabei allerdings ein besonderes Missverständnis ein, das auf einem Spezifikum der Brüsseler Institutionenlandschaft aufbaut. Die EU ist nämlich im Wesentlichen nach Sektoren aufgestellt: Landwirtschaft, Fischerei, Energie etc. strukturieren die Kommission, und entsprechend ist auch das Verständnis von Kultur vorab das eines Sektors, d.h. eines in eigenen ökonomischen und kommunikativen Grenzen und Regeln laufenden Systems. 2 Die Möglichkeit, dass Kultur den dem gesamten Spiel (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft) regelgebenden Rahmen darstellt und kulturelle Impulse damit nicht einfach einem anderen schlecht laufenden System (hier etwa der EUEinigungspolitik) wie eine heilende Medizin zu verabreichen sind, ist in dieser, vom Organigramm der 1 Vgl. Habermas, a.a.O. S.9, Jürgen Habermas: Ein Fall von Elitenversagen In: Der Spiegel 5.8.2013, s. auch Jürgen Habermas: Im Sog der Technokratie Berlin: Suhrkamp 2013 2 Zum Begriff der Kultur in der EU s. Berthold Franke: Kein Allheilmittel. In ifa (Hg.): Kulturreport, Stuttgart 2011, S. 170ff. Die Kulturförderung der EU für die kommende Finanzperiode 2014-2020 ist folgerichtig auch klar auf den Schwerpunkt Creative Industry“ ausgerichtet. Hier findet die Kommission alles, was sie für einen Sektor braucht: Unternehmen, Ausbildung, Wertschöpfung und Jobs. 4 Europäischen Kommission abgeleiteten Vorstellungswelt nicht vorgesehen. Denn genau so soll es laufen: die Menschen, Institutionen und Nationen verstehen sich nicht richtig, man gibt etwas Kultur (Beethoven, Rem Kohlhaas, Sasha Waltz) hinein, und schon wird die Sache. Kultur ist Lebensform, etwas umständlicher ausgedrückt: Kultur ist der Prozess der Formatierung und Tradierung kollektiver Lebenswelten. Kulturen werden als Lebenswelt-Formate beschrieben, als kommunikative Räume des Verstehens mit einer gewissen Dauer und sozialer Reichweite. Das bedeutet aber, dass Kultur weder an sich unschuldig ist, noch irgendwie als Allheilmittel wirken kann, im Gegenteil. Kultur ist entsprechend in all den Fehlern, Unzulänglichkeiten und Behinderungen des europäischen Prozesses wirksam, etwa in Gestalt der Renationalisierung Politischer Kulturen. Insofern ist Europa ein zuvörderst kultureller Prozess, der sich aber den wie geschildert administrativen Interventionen entzieht. Dabei ist die Spur durchaus die richtige, wie z.B. auch eine internationale Umfrage des Goethe-Instituts zeigt, in der „Kultur“ als häufigste Nennung bei der Frage nach mit Europa assoziierten Begriffen erscheint.1 Ein seine kulturellen Quellen und Ziele selbstbewusst und selbstkritisch reflektierender Europadiskurs könnte zum Ausgangspunkt eines neuen Schubs der Integration werden – dies ist der wahre Kern der Hoffnung auf die Kultur. Vorerst erwartet man sich in Brüssel die Antwort aber im Schema eines Missverständnisses, was besonders deutlich wird bei der laufenden Suche nach dem Narrativ. Seit geraumer Zeit wird sie herbeigewünscht, gefordert und angekündigt: die neue, Europa, seine Politiker und Bürger inspirierende und identifizierende „Erzählung“, das Narrativ. Der Kanzlerkandidat will es, das Feuilleton und das EU-Parlament sowieso. Nun will es auch Herr Barroso, und er tut was Präsidenten in so einem Falle tun, er gründet einen Ausschuss. So wird im “Bureau of European Policy Advisors“ des Kommissionspräsidenten schon fleißig gearbeitet.2 Das alte Narrativ - im Wesentlichen die Geschichte der Völker, die sich über Generationen gegenseitig totgeschlagen und dann, endlich belehrt, sich in Frieden zur Zusammenarbeit vereinigt haben - ist erschöpft, ist „auserzählt“. Und jetzt, kurz vor Ende seiner Amtszeit will der Präsident vor die Mikrophone treten und das nach intensiver Beratung eines Expertenkreises erstellte neue Narrativ enthüllen, jene dringend benötigte frische Leiterzählung, die den Enthusiasmus der europäischen Bürgerinnen und Bürger, vor allem der jüngeren Generation, neu entzündet, indem sie ihre Herkunft und Zukunft in einem allgemein verständlichen Kurztext bildhaft und intuitiv überzeugend zusammenfasst. Wenn es denn so einfach wäre! Sinn und Identifikation stiftendende „Erzählungen“ werden nicht konstruiert, schon gar nicht von einem Brüsseler Autorenkollektiv, sondern sie ergeben sich aus konkreter historischer Erfahrung, wie besonders gut zu studieren am alten europäischen Friedens-Narrativ, das als solches so selbstexplikativ ist, das es niemals von offizieller Seite hätte notiert werden müssen. Narrative müssen, sollen sie die Menschen ergreifen, eine positive Zukunft beschreiben. Und Narrative müssen einfach, kurz und plausibel sein. Sie bedürfen, um ihre Wirkung zu erzielen, nicht einmal der Schriftform, sondern funktionieren im Wesentlichen als implizites Kondensat historischer Erfahrung und Zukunftsbeschreibung, das im Prinzip allen zugänglich, verständlich und jederzeit präsent ist, ohne jeweils aus dem Archiv herbeizitiert werden zu müssen. Und: Narrative werden nicht erarbeitet und dann verkündet, sondern sie werden an vielen Orten 1 S. www.goethe.de/europaliste 2 Die Ziele des Projekts sind u.a.: “To produce a new Narrative on Europe based on the principle of >peace through trade<, to create a narrative which will place Europe in a global context according to the new world order, to revive the European spirit and bring the EU closer to its citizens, to show the value of the EU to its citizens, to identify the cultural values that unite citizens across border, to finally formulate this narrative in a manifesto.” S. http://ec.europa.eu/bepa 5 zugleich der Wirklichkeit entnommen und erzählt. Sie leuchten den Menschen spontan ein und verdichten sich zu einem gemeinsamen Vorrat. Kurz: Narrative sind einfach da und erklären sich selbst, sie werden gefunden, nicht erfunden. Klar ist, dass, wenn die Krise eine ökonomische ist, das Narrativ hierzu etwas erzählen muss. Die EU befindet sich offensichtlich in der Falle eines tief liegenden ökonomischen Dilemmas, das sich aus der Begegnung des globalen Kapitalismus mit einem unfertigen Verbund entwickelter Nationalstaaten ergibt, die trotz supranationaler Verbindung weiterhin in Konkurrenz miteinander stehen. Aus dem Prozess der ökonomischen Globalisierung unter kapitalistischen Vorzeichen entsteht derart nahezu zwangsweise ein Mechanismus fortlaufender Deregulierung, ein Phänomen, das der Ökonom Wolfgang Streeck in Bezugnahme auf einen Schlüsseltext des Altstars der neoliberalen Schule, Friedrich von Hayek, als „Hayekisierung“ bezeichnet.1 Demnach hat unter dem Gesetz der durch zwischenstaatliche Konkurrenz sozialstaatlich entkernten Marktwirtschaft entgegen oder zumindest komplementär zu der oft diagnostizierten Brüsseler „Regulierungswut“ in der EU seit geraumer Zeit eigentlich eine „Deregulierungswut“ um sich gegriffen, die in den vergangenen Jahren die Gestalt eines in der Wolle gefärbten neoliberalen Programms angenommen hat. Präzise hat dies ein Kenner der Brüsseler Szene, Jochen Bittner, erfasst, wenn er schreibt, die EU habe das Große (z.B. die Banken) zu klein, das Kleine (z.B. die Glühlampen) zu groß reguliert, ganz als ob der bei den wirklich wichtigen Punkten nicht ausgelebte Tatendrang, sich aus kompensatorischem Aktionismus auf die „kleineren und weicheren“ Politikfelder richte.2 Und genau dies nehmen die Menschen, die unter den Folgen, etwa beim Abbau des Sozialstaats oder der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen leiden, wahr, nämlich die EU als „Liberalisierungsmaschine“ (Streeck). Dabei sollte die europäische Integration und ihr stärkstes ökonomisches Instrument, der Euro, doch Wachstum und „Wohlstand für alle“ bringen. Konzipiert in eher historischer als ökonomischer Perspektive, von Mitterand als Mittel zur endgültigen Zähmung deutscher Hegemonie („la Bundesbank“), von Kohl als Eckstein der Irreversibilität der europäischen Einigung, wird die gemeinsame Währung - welche Ironie der Geschichte! – unter den Bedingungen eines globalen Kapitalismus, der ungleiche Nationalökonomien gnadenlos in den Wettbewerb zwingt, zum Medium des genauen Gegenteils, nämlich der neuen ökonomischen und politischen Vormacht Deutschlands und der Desintegration der EU. Das Versprechen von „Wachstum“als universelles Mantra des kapitalistischen Wirtschaftsdiskurses ist dabei das eigentliche Narrativ des Kapitalismus. Ein balancierter, den kontinuierlichen Produktionsfortschritt statt in gesteigerter Warenproduktion etwa in Form von Arbeitszeitverkürzung realisierender Kapitalismus, ist, da sind sich eigentlich alle Experten einig, vorerst undenkbar. Also kein Ende der Krise ohne Wachstum, so lautet auch in der EU von rechts bis grün das Credo. Hinzu kommt ein Spezifikum der europäischen Selbstwahrnehmung. Geboren in der Stunde des Verlusts seiner geopolitischen Führungsrolle im Kalten Krieg, war die Union für die Nationen Europas, darunter das im Krieg geschlagene Deutschland und die spätestens mit dem Verlust der Kolonialreiche zweitklassig gewordenen Siegermächte Frankreich und Großbritannien ein Vehikel, um im neuen bipolaren Zeitalter noch einmal am Tisch der Großen Platz zu finden. „Size matters“ – die Sorge um die relativ oder absolut schwindende Größe Europas ist ein treibendes Motiv vieler seiner Freunde Europas. Ein Gespenst geht um, die Furcht vor einem schrumpfenden Europa, das im 1 Vgl. Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit Berlin: Suhrkamp 2013 2 Vgl. Jochen Bittner: „So nicht, Europa! Frankfurt/M.: Fischer 2010 6 Verhältnis zu den neuen Riesen in Fernost und anderswo notwendig „zum Spielball anderer Mächte“ wird.1 So spricht der EU-Parlamentspräsident und Vollblut-Europäer Martin Schulz vom „gefesselten Riesen“ und Jürgen Habermas von Aussichten auf ein „musealisiertes und verschweizertes“ Europa, während Daniel Cohn-Bendit und Guy Verhofstadt das düstere Bild eines in 25 Jahren noch ungeeinten Europas zeichnen: „Voneinander isoliert haben wir kein Gewicht mehr, wir würden zerquetscht, und unser soziales Modell würde nicht überleben.“2 Warum eigentlich?, möchte man einwerfen. Stehen wir vor einer militärischen Invasion Chinas? Oder wollen Inder und Brasilianer demnächst unsere freiheitlichen Verfassungen außer Kraft setzen? Vielleicht hilft in dieser Lage ein Blick in die Geschichte. Denn so wie die Geburt des vereinten Europa als Antwort auf die großen Zerstörungen des Krieges und den Verlust der Weltgeltung zu sehen ist, verdankt sich die Entstehung vieler europäischer Demokratien dem Verlust vormaliger Macht und Größe. Am Anfang von Rechtsstaat, Demokratie und Bürgergesellschaft steht in einer verblüffenden Zahl von europäischen Ländern das „Kleinerwerden“. So finden sich in allen europäischen Himmelsrichtungen Nationen, deren einstige territoriale und machtpolitische Größe durch den Verlauf der Geschichte nach unten korrigiert wurde. Als erste fallen einem hierbei, von Spanien und Portugal bis Großbritannien, die einstigen Kolonialmächte in Europas Süden und Westen ein, historische Großreiche, die zu ihrer Zeit nicht weniger als die Weltmacht innehatten. In der Mitte des Kontinents finden wir die Reste der einstigen polynationalen Großmacht Österreich oder auch Deutschland mit seiner katastrophal gescheiterten Ambition auf Vorherrschaft in Europa, beides Länder mit geschrumpften Territorien und deutlich gestutzter Macht. Aber auch die einstigen Großund Regionalmächte Schweden oder Serbien kennen den Verlust vormaliger „Größe“. Kaum je haben Nationen und ihre Herrscher freiwillig Territorium, ökonomische, militärische oder politische Macht aufgegeben. Dennoch wird man in den meisten Fällen von heute aus das Wort vom Verlust kaum noch hören. Als Frage drängt sich daher auf, ob das Ziel, der Sinn und Zweck der EU in der Kompensation einstiger Weltgeltung des Kontinents und seiner führenden Mächte sinnvoll gewählt ist. Können eventuell sogar die europäischen Nationen, die gerade im schließlich akzeptierten „Kleinerwerden“ eine besondere Erfahrung mit sich tragen, aus ihrer jüngeren geglückten Geschichte den Schluss ziehen, dass gerade der kluge Verzicht auf „Größe“ ein vielversprechendes Modell für die Zukunft bedeutet? Das wohl unabwendbare Schicksal des „Kleinerwerdens“, das sich normativ allein schon aus einem Begriff globaler Gerechtigkeit herleitet, nachdem dauerhaft kein Erdteil mehr Anteil pro Kopf am Welthandel für sich beanspruchen kann als ein anderer, ist derart nicht nur als Bedrohung einer europäischen Zukunft zu begreifen, sondern als Zugewinn-Chance. Hieraus wären für die aktuelle Europa-Debatte die richtigen Schlüsse zu ziehen, was zuerst bedeutet, Europa neu auszurichten auf die kreative Gestaltung seiner nicht nur unausweichlichen, sondern vielmehr innovativen Rolle als bewusst und aktiv reduzierender Erdteil. Allein in diesem Perspektivwechsel liegt die Chance einer wirklichen „Neugründung“ (Habermas) der EU: Kleinerwerden nicht als Rückfallszenario in die Kleinstaaterei, sondern als neuer Zielhorizont der nächsten großen Schritte ins vereinigte Europa, der die Träume rückzugewinnender „Größe“ ablöst. Aus der eigenen, gar nicht intendierten, eher als List der Vernunft zu begreifenden Pioniererfahrung des Größenverlusts kann und muss Europa zumindest einen Fingerzeig für die intelligente Gestaltung seiner Zukunft entnehmen, ein Projekt, das dann womöglich auch für weitere Weltgegenden, denen Ähnliches in nicht allzu langer Zeit auch bevorsteht, interessant wird. 1 Vgl. Geert Mak, a.a.O., S. 138 2 Cohn-Bendit/Verhofstadt, a.a.O, S. 82, Habermas: Im Sog der Technokratie a.a.O. S. 124 7 In der Tat wird es nämlich nicht nur in Europa in der nächsten Zukunft darum gehen, das Kleinerwerden zu lernen, sondern in der ganzen Welt. Gewiss wird die Party in den heutigen „Emerging Economies“ in Asien, am Golf oder in Lateinamerika noch ein Weilchen dauern, inklusive guter Aussichten für alle, die als Exporteure davon profitieren. Genauso gewiss ist aber, dass schon lange bevor jeder Chinese einen Flachbildschirm und einen Audi sein eigen nennt, dem globalen Kapitalismus die Puste ausgegangen sein wird. Die Wette gilt: Innerhalb eines höchst überschaubaren Zeitraums, also in wenigen Dekaden, werden allein wegen der globalen Erschöpfung der Ressourcen und der gnadenlosen Folgen der Überlastung der Ökosphäre die Regeln der Welt-Ökonomie komplett umgestellt sein, wahrscheinlich auf eher „kommunistische“, d.h. politisch gesteuerte Mechanismen. Die heute noch allen Entwicklungsszenarios mehr oder weniger naiv unterlegte Rechnung: Aufbau mittelständischer Gesellschaftsschichten und städtischer Infrastrukturen durch Freihandel, Industrialisierung auf Kohlenwasserstoffbasis plus Flughafendrehkreuze etc. wird nicht aufgehen. Noch weit bevor China, Indien oder andere Wachstumschampions unserer Tage auch nur in die Nähe der heute in der westlichen Welt üblichen Standards gekommen sind, werden die wesentlichen Faktoren, auf denen dieses Entwicklungsmodell gebaut ist (und das nur eine Kopie des europäisch-okzidentalen Weges in dramatisch Zeitverkürzung darstellt) nicht mehr wirksam sein. Offen ist allein, ob diese Veränderung als Ergebnis brutaler Verteilungskämpfe oder in kooperativen Verfahren erfolgt. Für Europa heißt das präziser: ob der Wandel ab sofort und aus Realitätssinn angepackt wird oder später – dann aus blanker Not. Anstatt sich, wie in Deutschland noch besonders verbreitet, der Illusion hinzugeben, unsere ökonomische Zukunft könne durch Partizipation an der Industrialisierung bisher armer Länder gewonnen werden, hat Europa die in seinem Schicksal des „Kleinerwerdens“ liegende Chance, sich früher als andere auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Stagnation von Bevölkerungszahlen, von KfzMärkten, Massenkonsum und Ressourcenverbrauch aller Art, dazu steigende Energiepreise sind daher die eigentlich guten Nachrichten aus Europa. Währenddessen wird in den Chefetagen der Weltkonzerne ein letztes Mal der Traum kapitalistischer Urbarmachung bislang unberührter Winkel und Flächen der Erde geträumt,1 und die US-Amerikaner laden zur finalen Wachstums-Runde mit im Fracking-Verfahren aus Schiefersänden gepresstem billigem Rohöl, um ihrer kranken Ökonomie, in der gemäß Leistungsbilanz seit über einer Generation mehr verbraucht als produziert wird, vielleicht noch einmal 20 Jahre Zeit zu kaufen. Gesucht werden weltweit Politiken, Politiker und Politikerinnen die mehr anzubieten haben als die Überwindung der Krise durch „Immer-Mehr-vom-Gleichen“ und die Rückzüge organisieren können. Wenn die Aufrechterhaltung der freiheitlichen Zivilisation unter reduktiven Bedingungen, die Organisation des Übergangs von einer „expansiven in eine reduktive Moderne“2 (Harald Welzer) die Aufgabe der Stunde ist, dann ist es die Leistung eines diese Bewegung erfassenden Narrativs, diesen Prozess der Reduktion und des Kleinerwerdens als Weg zu einer humanen Zukunft Europas zu erzählen. Dabei ist vor allem an den, wie beschrieben positiven Gehalt zu denken, also dass im Kleinerwerden nicht Verlust und Niedergang, sondern der Schlüssel zu einer neuen, kooperativen und humanen, im vollen Wortsinne „vernünftigeren“ Zukunft liegt. Dabei liegt auf der Hand, dass dieser Wandel nicht ohne Verzicht zu haben ist, vor allem nicht ohne Abschied von einer nach Macho-Prinzip auf Größe, Macht und „Hard Power“ gestrickten Politischen Kultur und allen 1 „Mynamar ist einer der wenigen weißen Flecken auf der Weltkarte der Globalisierung, ein Land, das der Kapitalismus noch nicht erobert hat. Es verspricht damit ein letztes Abenteuer für Unternehmer. Myanmar ist so groß wie Texas, hat rund 60 Millionen Menschen und Rohstoffe jeder Art: Öl, Gas, Gold, Kupfer, Jade, Tropenholz. Dazu kommt seine strategische Lage zwischen Indien und China“. Capital, 5.7.2013 2 Vgl. Harald Welzer: Selbst denken Frankfurt/M.: Fischer 2013 8 damit verbundenen Borniertheiten. Denn auch wenn das Kleinerwerden nicht automatisch klüger macht, Größe macht dumm. Klar ist, dass niemand, der so etwas als Ziel verkündet, von Anbeginn die Mehrheiten hinter sich haben wird, jedenfalls nicht innerhalb Europas. Doch von außen wird das „Provincializing Europe“ durchaus nicht als Verlust empfunden, sondern als Wiederherstellung ausgewogener Verhältnisse.1 So sollte man sich bei der Beschreibung der Herausforderungen der neuen Zeit Rat von außerhalb holen - und wird verblüfft immer wieder großes Interesse feststellen. Das Bild Europas in der Welt ist immer noch präsenter, seine Kultur immer noch einflussreicher als die schlimmsten Eurozentriker denken: Beton, Automobil, die Börse, Fernsehen, Exerzierreglement und der Herrenanzug sind europäische Erfindungen mit Welterfolg (um nicht mit der Hochkultur zu beginnen), und immer noch hat Europa in der Summe die größte Ökonomie, den größten Export, die beste Bildung, Sozialstandards und einen Grad an Verwirklichung der Menschen- und Bürgerrechte, die die Fantasien und Sehnsüchte von Milliarden von Menschen, die darüber nicht verfügen, bewegen kann. Deshalb brauchen wir uns um unseren Beitrag zum globalen Dialog über Zukunftsrezepte auch langfristig keine Sorgen zu machen. Das Beste, was wir in diesen Austausch einzubringen haben, ist und bleibt das Potenzial zu einer selbstkritischen Aneignung unserer Geschichte und der Fehlentwicklungen, die uns dorthin gebracht haben, wo wir sind – genauso wie korrespondierend dazu die am häufigsten geäußerte Kritik der skeptischen Beobachter Europas der Anwendung von „double standards“ etwa in Menschenrechtsfragen gilt. Auch Kapitalismus und Demokratie sind europäische Erfindungen. Und wenn wir heute in der EU eine sukzessive Entdemokratisierung durch die Effekte des Kapitalismus erleben, dann hat Europa die Aufgabe, in seiner Tradition der „ständigen Unruhe und Kultur des Infragestellens“ (Julia Kristeva) neue Wege zu beschreiten. Diese kritische Kultur erweist sich nirgends so wie in der Anwendung auf das Eigene, wie Henning Ritter rückblickend auf die Epoche europäischer Vorherrschaft schreibt: „Die kritische Infragestellung des eurozentrischen Weltbildes wurde zur Grundlage der weltbeherrschenden Rolle der europäischen Kultur. Der Selbstzweifel und die Relativierung der eigenen Position schufen die Überlegenheit, die sie untergraben ? wollten.“2 Wenn Europa an diese Tradition anknüpfen kann und den Prozess seines Kleinerwerdens, der schon längst begonnen hat, als Fortschritt gestaltet, dann wird das kleinere Europa nicht nur seine dem neuen Format angemessene Rolle in der Welt finden, sondern auch schon bald in dieser Geschichte ganz selbstverständlich sein neues Narrativ erkennen und anderen damit ein Beispiel geben können. 1 Vgl. Dipesh Chakrabarty: Provincializing Europe Princeton/Oxford: Princeton University Press 2000 2 Henning Ritter: Notizhefte. Berlin Berlin: Berlin Verlag 2010, S. 38f. 9