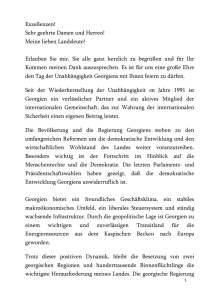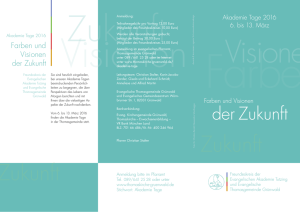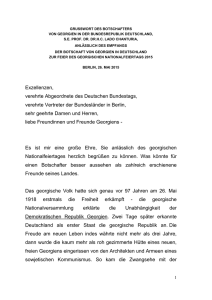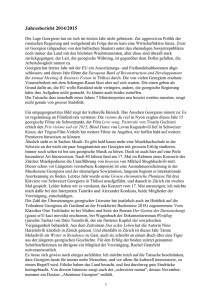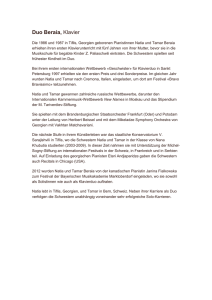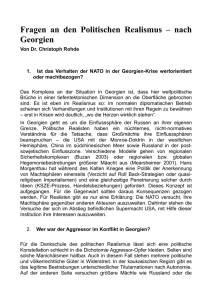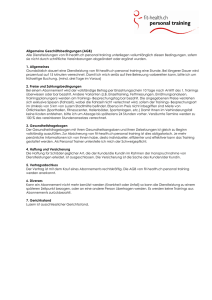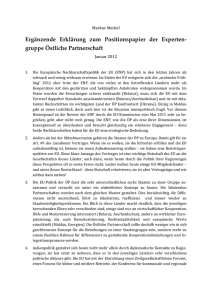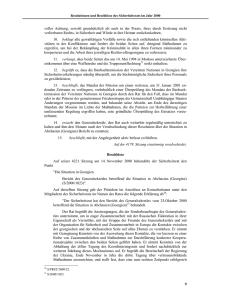Samstag, 29. September 2012 - silkroad
Werbung
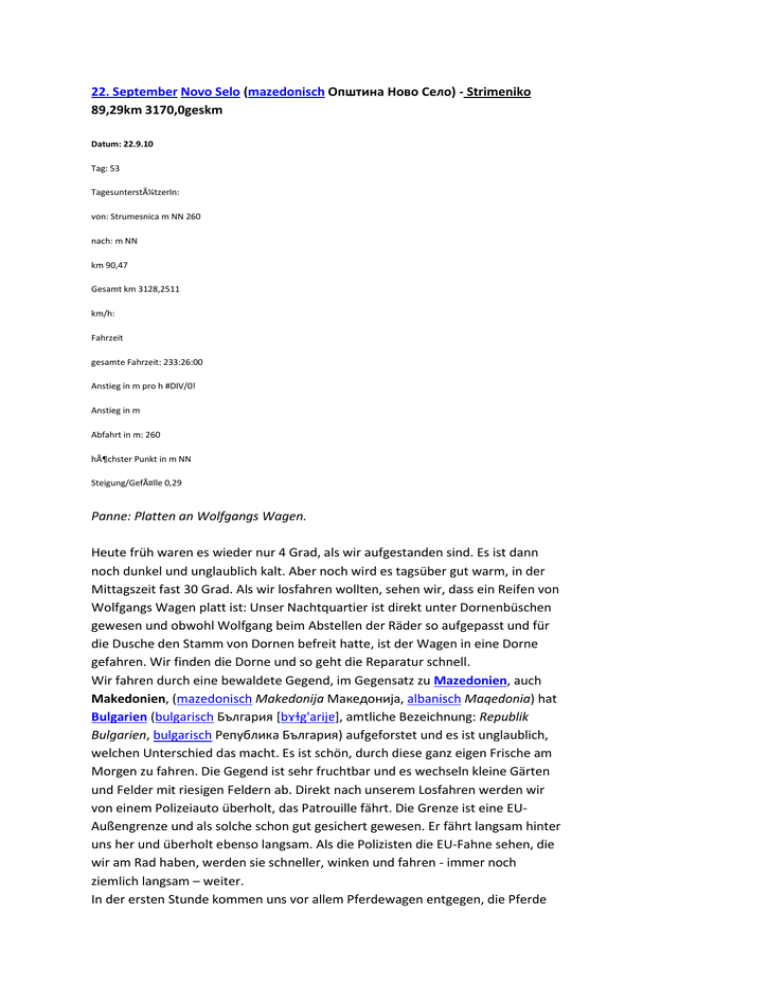
22. September Novo Selo (mazedonisch Општина Ново Село) - Strimeniko 89,29km 3170,0geskm Datum: 22.9.10 Tag: 53 TagesunterstützerIn: von: Strumesnica m NN 260 nach: m NN km 90,47 Gesamt km 3128,2511 km/h: Fahrzeit gesamte Fahrzeit: 233:26:00 Anstieg in m pro h #DIV/0! Anstieg in m Abfahrt in m: 260 höchster Punkt in m NN Steigung/Gefälle 0,29 Panne: Platten an Wolfgangs Wagen. Heute früh waren es wieder nur 4 Grad, als wir aufgestanden sind. Es ist dann noch dunkel und unglaublich kalt. Aber noch wird es tagsüber gut warm, in der Mittagszeit fast 30 Grad. Als wir losfahren wollten, sehen wir, dass ein Reifen von Wolfgangs Wagen platt ist: Unser Nachtquartier ist direkt unter Dornenbüschen gewesen und obwohl Wolfgang beim Abstellen der Räder so aufgepasst und für die Dusche den Stamm von Dornen befreit hatte, ist der Wagen in eine Dorne gefahren. Wir finden die Dorne und so geht die Reparatur schnell. Wir fahren durch eine bewaldete Gegend, im Gegensatz zu Mazedonien, auch Makedonien, (mazedonisch Makedonija Македонија, albanisch Maqedonia) hat Bulgarien (bulgarisch България [bɤɫg'arijɐ], amtliche Bezeichnung: Republik Bulgarien, bulgarisch Република България) aufgeforstet und es ist unglaublich, welchen Unterschied das macht. Es ist schön, durch diese ganz eigen Frische am Morgen zu fahren. Die Gegend ist sehr fruchtbar und es wechseln kleine Gärten und Felder mit riesigen Feldern ab. Direkt nach unserem Losfahren werden wir von einem Polizeiauto überholt, das Patrouille fährt. Die Grenze ist eine EUAußengrenze und als solche schon gut gesichert gewesen. Er fährt langsam hinter uns her und überholt ebenso langsam. Als die Polizisten die EU-Fahne sehen, die wir am Rad haben, werden sie schneller, winken und fahren - immer noch ziemlich langsam – weiter. In der ersten Stunde kommen uns vor allem Pferdewagen entgegen, die Pferde sind gepflegt und die Menschen fahren fast alle zum Fluss hinunter. Erst in der Nähe der Stadt ändert sich das Aussehen der Pferde und die Wagen sehen weniger gepflegt aus und transportieren alles Mögliche. In der Stadt wollen wir Kerzen für unsere Zeltkerze erstehen. Im Laden funktioniert die Verständigung nicht und nach der Zeichnung bekommen wir Kerzen: es sind die Opferkerzen für die Ikonen. Der liebe Gott wird es uns verzeihen, wenn wir sie ganz profan im Zelt am Abend und am Morgen anzünden. Heute haben wir Glück: abgesehen von einer kurzen Strecke sind die Straßen in einem guten Zustand, die eine sogar komplett frisch geteert. Wir sausen der bulgarisch-griechischen Grenze entgegen, die in ihrem Design noch richtig eine Ostblock-Grenze ist. Es ist eine regelrechte Wehranlage. Auf bulgarischer Seite ist gar keine Kontrolle mehr beim Verlassen des Landes, auf griechischer Seite sind strenge Kontrollen – Bulgarien ist noch nicht im Schengen-Abkommen. Unmittelbar hinter dem Schlagbaum beginnt ohne jede Vorwarnung die Autobahn. Wir fahren munter drauflos, denn wir gehen davon aus, dass es gleich eine Alternative gibt. Gibt es auch und nach 500 m sind wir wieder auf der Autobahn. Also bleiben wir drauf. Sie ist nagelneu und auch noch nicht fertiggebaut, denn sie endet ziemlich abrupt und führt hinunter auf eine Straße, die die alte Bundesstraße war und sich am Ende teilt und dort ein ziemliches Verkehrschaos mit viel Polizei verursacht, da es keinerlei Hinweise gibt, welche der zwei Straßen wohin führt (und für die Autofahrer: wo die Autobahn geblieben ist, die eigentlich zu sehen war und nun steht man plötzlich daneben). Wir fragen nach unserem Weg und werden lächelnd auf die Straße nach links hoch verwiesen. Die 10% Steigung nehmen wir inzwischen spielend, es ist noch ein wenig chaotisch als wir oben sind, dann wird klar, es ist wieder der Zubringer zur Autobahn! Inzwischen zeichnen sich dort aber auch andere Straßen ab, so überlegen wir, was wir machen. Wir entscheiden uns gegen die Autobahn, da sie doch nicht ganz in unsere Richtung geht und nehmen die kleine Straße. Mit unserem Theologen-Griechisch arbeiten wir uns durch die Straßenschilder und finden den Weg. Im nächsten Ort halten wir an, um etwas zu essen. Als wir suchend vor einem Café stehen, werde wir auf deutsch gefragt, was wir brauchen. Der Herr – er hat Jahrzehnte in Wuppertal gearbeitet – ruft im nächsten Café an, dort gibt es etwas. Dort übersetzt für uns jemand, der in Stuttgart gearbeitet hat. Es ist ein ganz ruhiges Essen ohne dauernd zu schauen, was mit den Rädern ist. Sehr entspannend nach dem so anderen Balkan. Den Tag fahren wir durch die Flussauen, die riesig sind. Es ist sehr fruchtbar und es wird ganz viel Baumwolle abgebaut. Unsere kleine Straße entpuppt sich auch als große Straße, was für die Infrastruktur am Abend gut ist. In einem Supermarkt bekommen wir Wasser, der zuständige Herr hat 30 Jahre in Garmisch gearbeitet. Es ist faszinierend, auf so viele Menschen hier zu stoßen (alleine im Dorf sind es noch viel mehr gewesen), die so lange so wesentlich Deutschland geprägt und vieles von dem Reichtum und Wohlstand und dem hohen Lebensstandard jetzt ermöglicht haben. Im Alter sind sie dann wieder hier – was irgendwie auch gut zu verstehen ist. Kilometer- und Höhenangaben Griechenland Graphik hier herunterladen Nr Tag Höhe max. ZielortTagesGesamt Höhe Tagesziel/Ort KmH Tageshöhenmeter über km km am NN Tag Orfani 0 84,33 3254,4 240 208 Gravouna 20 91,39 3347 13,6761 341 Komotini 41 89,54 3437,7 14,8867 115 57 Messimvria 3 41,48 3479,7 8,79 138 315 58 Alexandroupoli3 30,8 3511,1 12,437 0 59 Kamriotissa 10 3,9 0 60 Kamriotissa 10 0 61 Kamriotissa 10 0 54 55 56 3515,1 9,08 10 Sonntag, 23. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren erreichen wir erstmals das Meer! Heute sehen wir einen interessanten Bericht über Istanbul. 23. September Serres (griechisch Σέρρες (f. pl.), älter auch Serre Σέρραι; bulgarisch Сяр/Sjar) - Orfani (Greek: Ορφάνι, formerly Ορφάνιον - Orfanion), 84,33 km, 3254,4 Gesamt km Datum: 23.9.10 Tag: 54 TagesunterstützerIn: von: Strimenico m NN nach: Orfani m NN 0 km 84,33 Gesamt km 3212,5811 km/h: Fahrzeit gesamte Fahrzeit: 226:46 Anstieg in m pro h Anstieg in m 240 Abfahrt in m: 240 höchster Punkt in m NN 208 Steigung/Gefälle 0,569 Heute Morgen sind es acht Grad, als wir um sechs Uhr aufstehen. Unser Nachtquartier ist in einem wunderschönen Obstgarten. Wir fahren den ganzen Vormittag durch die Flussauen, zwischendurch werden wir an die Ränder der naheliegenden Hügel geführt, so dass der Weg ein beständiges Auf und Ab ist mit ganz vielen kleinen Orten und Städtchen dazwischen. Es ist Baumwollernte und an den Wegen der geernteten Feldern liegen die weißen Büschel und der Wind spielt mit ihnen. Immer wieder mal sitzen in einer Stadt Tagelöhner und warten auf Arbeit. Nachwievor wechselt kleine Landwirtschaft mit riesigen Betrieben. Es ist eigenartig, nach den Wochen im Balkan mit den einfachen landwirtschaftlichen Geräten jetzt wieder die High-Tech-Geräte zu sehen. Neben Baumwolle werden Zuckerrüben (vermuten wir) geerntet. Außerdem ist Ernte der grünen Oliven. Die Flussarme, die wir überqueren, sind allesamt ausgetrocknet. Als wir um 13:00 in einer Stadt halten, um etwas zu essen und ein wenig ratlos die vielen Cafés anschauen, kommt sofort wieder jemand auf uns zu und fragt uns in Englisch, was wir suchen. Auf diese Weise finden wir ein Restaurant. Heute ist es drückend heiß und es zeigen sich die ein oder anderen Wolken am Himmel. Am Nachmittag wagen wir uns erneut in die Hitze und folgen der Straße in ihren vielen Windungen und Auf und Abs. Es ist nicht ganz vorstellbar, dass das Meer so nah sein soll. Die Landschaft wird abwechlsungsreicher und die Hügel um uns höher. Der höchste Berg hier an der Küste ist bald ganz nah zu sehen. Dennoch ist auch auf jeder neuen erklommenen Anhöhe kein Meer in Sicht. Bald haben wir das Gefühl, am Ende der Welt zu sein und nur noch von antiken Ausgrabungen umgeben zu sein als plötzlich ein Tanklaster uns entgegengebraust kommt. Ermutigt denken wir, der muss irgendwo her kommen und sicherlich nicht aus der Antike! Also kämpfen wir uns weiter gegen den inzwischen aufgekommenen Gegenwind und erfahren Hügel um Hügel. Wie aus dem Nichts sind wir an dem Ort, der laut Karte am Meer sein müsste, der Mündung des Flusses und alles, was wir sehen ist ein im Bau befindliches Autobahnkreuz! Unsere Karte, 20 Jahre jung, hat ganz andere Straßen, hier gibt es wieder andere. Die kleine Straße unserer Karte ist jetzt Autobahn, die große Straße jetzt die kleine. Da wir heute mal keine Autobahn fahren wollen, entscheiden wir uns für die neue kleine Straße, auch wenn wir ursprünglich die Route der heutigen Autobahn nehmen wollten. Heute Abend sind wir froh um die Bauentscheidung der Griechen, denn die Straße am Meer führt uns direkt zum Meer hin und da der Campingplatz bereits auf Winter eingestellt ist, logieren wir jetzt neben einem Apfelbaum am Strand und haben endlich keine Autogeräusche, sondern die Brandung in Hintergrund. Der Ort lebt vom Tourismus und die Saison ist hier vorbei, so dass alle Häuser verrammelt sind und kaum noch Touristen hier sind. Im Sommer ist hier bestimmt viel los. Montag, 24. September 2012 Heute vor zwei JAhren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei JAhren kommen wir am Wegweiser nach Konstantinopel vorbei. Heute schreibt das Auswärtige Amt zu Georgien. Diese Route hatten wir ja geplant und mußten sie aufgeben: Die Lage in Georgien ist – mit Ausnahme der Konfliktgebiete Abchasien und Südossetien - insgesamt ruhig. Insbesondere vor und nach den anstehenden Parlamentswahlen am 1. Oktober 2012 wird empfohlen, Demonstrationen und Menschenansammlungen zu meiden. Während eine Einreise über Land z.B. über die Türkei problemlos erfolgen kann, ist der Reiseverkehr über Land zwischen der Russischen Föderation und Georgien für Ausländer nur erschwert möglich oder gar völlig unterbrochen. Der Grenzübergang Dariali / Hoher Lars an der M3 („Georgische Heerstraße“) konnte von 2006 bis 2011 nur von georgischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen der GUS-Staaten genutzt werden, ist inzwischen aber auch für den internationalen Reiseverkehr wieder geöffnet. Dennoch können Schwierigkeiten beim Grenzübertritt nicht ausgeschlossen werden. Vor allem aber ist hierbei die Sicherheitslage im Nordkaukasus zu beachten: Von Reisen dort wird dringend abgeraten (siehe Reiseund Sicherheitsweise Russische Föderation). Eine Einreise über die georgisch-russische Grenze in die georgischen Konfliktgebiete Abchasien und Südossetien wird seitens der georgischen Behörden weiterhin als illegaler Grenzübertritt geahndet (siehe unten). 1. Sicherheit in den Landesteilen Südossetien und Abchasien und in der Nähe der Verwaltungsgrenzen Beide Gebiete befinden sich nicht unter der Kontrolle der Regierung in Tiflis. In den Gebieten und an deren Verwaltungsgrenzen sind russische Truppen stationiert. Die Situation in den Konfliktregionen kann sich jederzeit ändern. Informieren Sie sich daher auch über die lokalen Medien. Das georgische „Gesetz über die besetzten Gebiete“ untersagt Reiseverkehr, wirtschaftliche Aktivitäten, Erwerb von Grund und Boden bzw. Immobilien sowie andere Aktivitäten in Abchasien und Südossetien mit nur wenigen Ausnahmen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Geld- oder Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Es wird daher dringend geraten, sich im konkreten Fall rechtzeitig über die entsprechenden Regelungen zu informieren, und die notwendige Zustimmung der georgischen Regierung einzuholen – Hinweise und Erlaubnis zur Einreise geben das Georgische Außenministerium (Externer Link, öffnet in neuem Fensterwww.mfa.gov.ge) und das Ministerium für Reintegration (Externer Link, öffnet in neuem Fensterwww.smr.gov.ge). Abchasien: Von Reisen nach Abchasien wird grundsätzlich abgeraten. Wegen der schwierigen Sicherheitslage, insbesondere im Bezirk Gali nahe der Waffenstillstandslinie bzw. Verwaltungsgrenze, wird unbedingt empfohlen, die Reisenotwendigkeit sehr sorgfältig zu prüfen und die vorherige Zustimmung des georgischen Außenministeriums einzuholen. Die Autonome Republik Abchasien in Nordwest-Georgien gehört völkerrechtlich zu Georgien, steht seit 1993 aber nicht mehr unter der Kontrolle der georgischen Regierung. Die Sicherheitslage in diesem Landesteil ist seitdem prekär. Es kommt zu Zwischenfällen. In einigen Teilen der Region liegen teils nicht gekennzeichnete Minenfelder. Abchasien ist für den internationalen Reiseverkehr gesperrt. Eine legale Ein- und Ausreise in bzw. aus dem Gebiet heraus ist gemäß dem „Gesetz über die besetzten Gebiete“ über die russisch-georgische Grenze in Abchasien nicht möglich – es sei denn in besonderen Ausnahmefällen mit vorheriger Zustimmung der georgischen Regierung. Ein ungenehmigter Grenzübertritt (z. B. am Grenzübergang Psou) wird von den georgischen Behörden als illegaler Grenzübertritt nach Georgien behandelt. Bei anschließender Weiterreise über die Waffenstillstandslinie bzw. Verwaltungsgrenze in benachbarte georgische Landesteile bzw. beim Ausreiseversuch über reguläre georgische Grenzübergänge drohen daher Festnahme und Strafverfahren. Auch bei späteren Reisen nach Georgien droht die Verweigerung der Einreise, sollte sich aus dem Pass ergeben, dass zuvor auf illegalem Wege nach Abchasien/Georgien eingereist wurde. Südossetien: Vor Reisen nach Südossetien und in die unmittelbare Nähe der Konfliktregion wird ausdrücklich gewarnt. Für eine Einreise in die Region sollte die Zustimmung des georgischen Außenministeriums eingeholt werden. Das Gebiet Südossetien gehört völkerrechtlich zu Georgien, steht seit 1993 aber nicht mehr unter dem Einfluss der georgischen Regierung. Die Lage in Südossetien ist weiterhin prekär und unübersichtlich. Trotz der Bemühungen zur Umsetzung des Waffenstillstandes nach dem Krieg 2008 kommt es insbesondere in der Umgebung der Verwaltungsgrenzen von Südossetien noch zu bewaffneten Zwischenfällen. Es besteht in diesem Gebiet auch weiterhin eine erhöhte Gefahr durch Minen und nicht explodierte Munition, da es während des Krieges von Kampfhandlungen betroffen war. Auch Südossetien ist für den internationalen Reiseverkehr gesperrt. Eine legale Einund Ausreise in bzw. aus dem Gebiet heraus (Roki-Tunnel) ist über die russischgeorgische Grenze nicht möglich. Ein Grenzübertritt wird von den georgischen Behörden als illegaler Grenzübertritt behandelt. Bezüglich der möglichen Konsequenzen gilt das oben zu Abchasien Gesagte. 2. Sicherheit im übrigen Georgien Die Lage im übrigen Georgien ist insgesamt ruhig. Gegen die Nutzung der Hauptverbindungsstraße zwischen Ost und West (M 1), die relativ nahe an Südossetien vorbei führt, bestehen keine Bedenken. Ebenso gibt es keine Bedenken gegen die Nutzung der sogenannten „Alten Georgischen Heerstrasse“(M3), die ebenfalls nahe an Südossetien vorbei auch in das Skigebiet Gudauri führt. In der Vergangenheit vereinzelt erfolgte oder verhinderte Sprengstoffanschläge in Vororten von Tiflis gebieten besondere Vorsicht. Es wird insbesondere vor und nach den georgischen Parlamentswahlen am 1. Oktober 2012 empfohlen, Demonstrationen und Menschenansammlungen zu meiden. Georgien liegt in einer Region seismischer Aktivität. Ein Erdbeben in Tiflis forderte im Jahr 2002 fünf Todesopfer; ein Erdbeben ca. 150 km von Tiflis entfernt erreichte im Jahr 2009 den Wert 6,2 auf der Richter-Skala. Kriminalität Grundsätzlich gilt in allen größeren Städten Georgiens, dass die gleichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, die auch in Metropolen anderswo angewandt werden. In Tiflis gibt es gelegentlich Berichte über Raubüberfälle und Taschendiebstahl. Reisende sollten entsprechende Vorkehrungen treffen, sich bei Dunkelheit nach Möglichkeit nicht alleine auf der Straße aufhalten und auf eine angemessene Sicherung ihrer Unterkünfte achten. Einsame Strecken sind zu meiden. Bei einem Überfall sollte wegen nicht zu unterschätzender Gewaltbereitschaft kein Widerstand geleistet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften – obwohl in Georgien legal – in der georgischen Gesellschaft weniger ausgeprägt ist als in Westeuropa. Daher sind auch gewalttätige Übergriffe auf Homosexuelle und gleichgeschlechtliche Paare, insbesondere bei öffentlichem Zeigen ihrer gegenseitigen Zuneigung nicht auszuschließen. 24. September Orfani (Greek: Ορφάνι, formerly Ορφάνιον - Orfanion) – Kavala (griechisch Καβάλα (f. sg)), 91,39km, 3347 Gesamtkm Datum: 24.9.10 Tag: 55 TagesunterstützerIn: von: Orfani m NN 0 nach: Gravouna m NN 20 km 91,39 Gesamt km 3303,9711 km/h: 13,67 Fahrzeit 06:40 gesamte Fahrzeit: 240:06:00 Anstieg in m pro h 9,15 Anstieg in m 61 Abfahrt in m: 41 höchster Punkt in m NN 341 Steigung/Gefälle 0,11 Die Nacht ist taghell, so hell ist der Vollmond, der durch Berge ungehindert scheinen kann. Selbst am Morgen ist der Mond noch da und wir brauchen keine Stirnlampen. Die Sonne muss sich durch eine Wolkendecke arbeiten, bis sie zu sehen ist. Bis auf einen Angler ist niemand am Strand. Wir haben die Nacht mit den Wellengeräusch sehr genossen. Die Straße führt uns immer wieder ans Meer und ein paar Meter über dem Meer entlang. Es ist eine sehr schöne Küste, die beinahe unberührt ist. Die parallel gebaute Autobahn nimmt der Bundesstraße den Verkehr und es ist so sehr außerhalb der Saison, dass fast alles geschlossen hat. Es ist alles schön, bis plöztlich die Schilder unserer Straße grün werden und eh wir uns versehen, sind wir schon wieder auf einer Autobahn gelandet! Die durch einen plötzlichen zugeschriebenen Identitätswandel zur Autobahn mutierten Straße verlassen wir und sehen beim Abfahren, dass sie aus der Gegenrichtung direkt als Autobahn ausgeschildert ist. Das ist schon eine lustige Verkehrsplanung. Auf diese Weise werden wir durch die Orte geführt und entdecken den ersten geöffneten Campingplatz. Wir wollen aber weiter nach Kavala (griechisch Καβάλα (f. sg)). Plan: Mit einem Schiff auf eine der Inseln und mit dem Schiff zu einem anderen Hafen weiter im Osten wieder auf das Festland. Unsere Karte verzeichnet eine Menge Linien, die Homepage der Reedereien auch. Vor Ort sieht das dann ein wenig aus wie bei einem vielen bekannten Bahnunternehmen, wo viele Verbindungen einfach gestrichen sind. Also essen wir dort nur zu Mittag in einem Restaurant, in dem Busladungen voller griechischer Senioren und japanischer Touristen abgeladen werden. Wir hatten uns ja mit unserer Japanflagge eine aufgeregte Gruppe japanischer Touristen vorgestellt, aber die Guten waren von allem anderen so überwältigt, dass sie selbst, als wir an ihnen vorbeigeschoben haben, die Flagge erst spät entdeckt haben. Die Straße zur nächsten Stadt verwandelt sich innerhalb weniger Kilometer erneut in eine Autobahn. Inzwischen sind wir ja routiniert und fahren mit dem Hinweis auf den nächsten Ort auf die nächste Bundesstraße- Diese bleibt Bundesstraße- Unser Plan, an der nächsten Tankstelle auf eine aktuelle Karte zu schauen, scheitert: an der nächsten Tankstelle hängt eine Karte, die vielleicht fünf Jahre jünger ist als unsere. Sie hat den Vorteil, dass der geplante Verlauf der Autobahnen eingezeichnet ist und wir sehen, dass eine Autobahn, die unsere Karte noch hat, nicht mehr geplant ist. Es ist interessant, dass sich die Wahnehmung von Ländern an zum Teil skurrilen Einzelheiten festmacht: die Frage, ob es beim Einkaufen Tüten umsonst gibt oder sie gekauft werden müssen, ob es Alternativen zu Autobahnen gibt, ob Tankstellen Wasser und Kaffee haben, wie die Ladenöffnungszeiten sind, natürlich wesentliche Frage wie: ist die Umgebung Minenfrei? Aber das ist ja bereits eine Frage, die sich in einem Kontext stellt, in dem sich viele andere Fragen auch stellen. Wir sind auf jeden Fall seit Slowenien (slowenisch Slovenija) in Tütenländern und unsere Mülltütenfrage stellt sich nicht mehr. Nun sind wir seit Mazedonien, auch Makedonien, (mazedonisch Makedonija Македонија, albanisch Maqedonia), amtlich Republik Mazedonien bzw. Republik Makedonien (maz. Republika Makedonija Република Македонија, alb. Republika e Maqedonisë) auch in Autobahnländern, aber mit viel Toleranz. Am Abend bekommen wir Wasser an der Tankstelle und stellen erneut fest, dass die Menschen hier an Tankstellen und in Läden deutlich wortkarger sind als am Fluss. Einen Schlafplatz finden wir in einer abgeernteten Obstplantage, nachdem wir fast zwei Stunden nur an Industrie und Ölraffinerien vorbeigefahren sind. Das Hinterland der Küste hat wenig von der Romantik der Küste, es ist der logistische und arbeitgebende Faktor. Das Barometer fällt innerhalb einer Stunde dramatisch, wir sind gespannt, was das hier bedeutet und haben alles sturm- und regensicher verpackt. Dienstag, 25. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren werden wir in Xanthi (griechisch Ξάνθη [ˈksanθi] (f. sg), türkisch İskeçe, bulgarisch Sketscha Скеча) überfallen. 25. September Kavala (griechisch Καβάλα (f. sg)) – Komotini (griechisch Κομοτηνή (f. sg), türkisch Gümülcine, bulgarisch Гюмюрджина/Gjumjurdschina), 89,54km, 3437,7 Gesamt km Datum: 25.9.11 Tag: 56 TagesunterstützerIn: RUSTER, THOMAS UND ADELHEID von: Gravouna m NN 20 nach: Komotini m NN 41 km 89,54 Gesamt km 3393,5111 km/h: 14,88 Fahrzeit 06:00 gesamte Fahrzeit: 246:06:00 Anstieg in m pro h 11,17 Anstieg in m 67 Abfahrt in m: 46 höchster Punkt in m NN 115 Steigung/Gefälle 0,13 Bis auf einen leichten Regen hat der Barometersturz am Tag zuvor nur zur Folge, dass es bewölkt ist. Mit angenehmen Temperaturen und leichtem Gegenwind fahren wir munter los mit dem erreichbaren Ziel vor Augen, in zwei Tagen auf dem Schiff zu sein. Da ahnen wir noch nicht, dass der Tag eine ganz andere Wendung nehmen wird. Alles ist gut, bis wir in der ersten ernstzunehmenden Stadt uns verirren. Zunächst aber begrüßt uns in der Stadt ein durchaus ernstzunehmendes Straßenschild mit einem Richtungspfeil: Konstantinopel. Etwas 50m weiter steht eine Moschee. Wir fahren durch die Stadt, die ziemlich bunt und chaotisch wirkt und finden den Weg nicht zurück auf die Bundesstraße. Da wir die Richtung wissen und, dass wir die Bahn überqueren müssen, tun wir das in der Stadt und landen in einem zunächst „normal“ aussehenden Stadtviertel bis wir dann feststellen, dass der Stadteil fest in der Hand von Roma ist. Wir fahren weiter und die Straßen werden immer enger und die Menge der Kinder, die uns folgt, immer größer. Wir sind bereits wieder auf einer großen Straße, als wir den zweiten Fehler des Tages begehen: wir drehen um, da wir in die andere Richtung müssen. Eine Straße, die wie eine Verbindungsstraße aussieht, entpuppt sich als Labyrinth durch das Roma-Viertel. Die Horde Kinder wird inzwischen angeführt von einem Jugendlichen, der geistig behindert wirkt, aber körperlich absolut fit und immer schwankend zwischen uns beschützend und angreifend. Die Situation wird immer bedrängender und wir müssen da ja nun wieder raus. Auf dem Rad sitzend können wir uns nicht wehren, absteigen können wir nicht, nur schreien und beim Stehenbleiben schreien und Kinderhände wegschubsen. Es ist furchtbar. Das Geschrei ist immer hin so laut, dass aus einem Haus eine resolute Roma-Oma angerannt kommt, selber mit einer Dachlatte bewaffnet und für einen Moment hat sie die Kinder in Schach. Wir fahren los und haben es beinahe geschafft, als der Jugendliche im Affenzahn hinter uns her gerannt kommt. Wir beschleunigen noch mehr, aber er hat Wolfgangs Wagen erwischt und hält ihn fest. Wir sind gezwungen, wieder stehen zu bleiben. Erneut sind wir umringt von der Horde Kinder, diesmal ungeschützt. Wir schreien und schlagen um uns, aber es hilft nichts, egal wie ich mich wehre, der Jugendliche reißt mir die Seitentasche vom Leib, indem er so daran reißt, dass der Gürtel (aus Leder) zerrissen ist. Zum Glück ist nichts wesentliches da drinnen gewesen. In dem Augenblick war die Horde beschäftigt und wir ziehen ab. An der Tankstelle holen wir erst mal Luft und versuchen uns vom Schreck zu erholen. Bei der Planung und vor der Reise haben uns Menschen vor Serbien (serbisch Србија/Srbija anhören?/i) und Bosnien (bosn., kroat. und serb. Bosna; kyrill. Босна) und vor allem Albanien, amtlich Republik Albanien (albanisch Shqipëri/Shqipëria oder Republika e Shqipërisë) gewarnt (an Ländern in Europa), keiner vor Ländern der EU… Bei der Weiterfahrt sind wir mit dem nächsten Problem konfrontiert: den Hunden. Diese sind hier um so vieles aggressiver und laufen auf die Straße und in den Verkehr hinein. Daher liegen am Rand eine Menge Kadaver. Nur sind wir kein Auto und müssen einige Male rasante Ausweichmanöver starten. Wir fahren weiter und kommen an unser Ziel, deutlich wachsamer und immer Hunde und Kinder im Blick habend. Wieder sind wir in einem Land, in dem es Rechtssysteme gibt, die mit dem staatlichen Rechtssystem wenig zu tun haben. Während dies in Albanien, amtlich Republik Albanien (albanisch Shqipëri/Shqipëria oder Republika e Shqipërisë) uns als Reisende eher schützt, in Mazedonien, auch Makedonien, (mazedonisch Makedonija Македонија, albanisch Maqedonia), amtlich Republik Mazedonien bzw. Republik Makedonien (maz. Republika Makedonija Република Македонија, alb. Republika e Maqedonisë) nicht betrifft, ist es hier ein Rechtssystem, in dem nur ausweichen geht. Auffallend ist weiterhin gewesen, dass in jedem Ort eine Moschee (arabisch مسجدmasdschid, DMG masǧid ‚Ort der Niederwerfung‘) mit Minarett (selten Minar[1] , richtiger arabisch منارةmanāra ‚ursprünglich: Leuchtturm‘) zu sehen ist und der Muezzin (arabisch مؤذّنmu'adhdhin, DMG muʾaḏḏin) auch rufen darf. So stehen auf einer einen Straßenseite die Kirchen und auf der anderen die Moschee und wir fragen uns, wie wohl das Miteinander sich gestaltet. Wenn dann noch als dritte Gruppe Roma dazu kommen, hat so eine Kleinstadt direkt eine sehr eigene Dynamik. Wie eine Parallelgesellschaft, die durch so ein klar umgrenzten Stadtteil entsteht, in irgendeiner Form integriert oder was auch immer werden kann, wirft ganz eigene Fragen auf. Wir sind auf jeden Fall froh, dass am Abend vor dem Supermarkt nur zwei Kinder stehen und außerdem Security und wir mit viel Mühe einen Schlafplatz in einem Baumwollfeld hinter Büschen finden, wo weit und breit keine frei laufenden Hunde oder Kinder zu sehen sind. Morgen ist es eine kurze Strecke und diesmal sind wir wirklich reif für die Insel! Mittwoch, 26. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren fahren wir die anstrengendste, aber auch schönste Etappe in Europa. 26. September Komotini (griechisch Κομοτηνή (f. sg), türkisch Gümülcine, bulgarisch Гюмюрджина/Gjumjurdschina) – Messimvria, 41,48 km, 3479,7 Gesamt km Datum: 26.9.10 Tag: 57 TagesunterstützerIn: von: Komotini m NN 41 nach: Messimvria m NN 3 km 41,48 Gesamt km 3434,9911 km/h: 8,79 Fahrzeit 04:42 gesamte Fahrzeit: 250:48:00 Anstieg in m pro h 29,36 Anstieg in m 138 Abfahrt in m: 176 höchster Punkt in m NN 315 Steigung/Gefälle 0,76 1. Panne: Platten an Gundas Hinterrad durch Dornen 2. Panne: Wolfgangs Badelatschen fallen dem Schlamm und seinem Gewicht zum Opfer. In dieser Nacht ist ein Gewitter mit heftigem Regen über uns weggezogen. Es hat zur Folge, dass sich unser Baumwollfeld in einen Schlammort verwandelt hat, der zudem noch die Herausforderung in sich hat, dass Mäuse den Boden mit zahlreichen Gängen unterhöhlt haben. Ständig sacken wir mit den Füßen tiefer, am Abend noch in trockenen Boden, jetzt in Schlamm. Zudem hat der Dornenstrauch diesmal in Gundas Hinterrad einen Loch provoziert. Wir schaffen es, unter erschwerten Bedingungen dennoch um 9:00 aufzubrechen. Wir können das Zelt nur zu einer Seite öffnen, da auf der einen Seite der Dornenstrauch ist. Auf der anderen Seite beginnt direkt eine Reihe Baumwollpflanzen, um die wir herumbalanzieren – immer in der Gefahr, in der Mäuseetage zu landen. Dazu stürmt es und der Himmel ist zur einen Seite pechschwarz, zur anderen sogar manchmal blau. Wir stürzen uns in den Wind und müssen uns jede Stunde abwechseln, da es sonst nicht zu schaffen ist, vorne zu fahren. Der Wind ist beinahe irrwitzig. Nach drei Stunden kommen wir an der Abzweigung an, wo der Weg an der Küste beginnt. Wir haben je eine unterschiedliche Vorstellung vom Weg und beide bestimmt eine andere Vorstellung vom Zustand gehabt. Am Beginn des Weges steht ein Informationsschild über die geologischen und archäologischen Schätze am Weg. Nach einer Stunde und knappen drei Kilometern machen wir Rast in einem wunderschönen alten Olivenbaumgarten und kochen Nudelsuppe. Uns ist klar, dass wir die Hafenstadt nicht erreichen werden, sondern mit viel Glück das nächste Dorf und sind einigermaßen gefrustet, da wir uns sehr auf den freien Tag gefreut hatten. Nachdem sich aber an der Situation nichts mehr ändern lässt und wir wenigstens so viel Wasser haben, dass wir es bis zum Abend recht gut schaffen, fahren wir nach einer Mittagspause weiter. Der Weg ist in einem abenteuerlichen Zustand, für Geländewagen wahrscheinlich ok. Wir schleichen den Weg entlang und müssen anhalten, um die Schönheit wahrzunehmen. Immer wieder gibt es Ausgrabungen antiker Städte und irre Steinformationen. Das Meer ist nah und oft zu hören. Wir fahren langsam, aber beständig weiter und wenn es gar nicht mehr geht, schieben wir halt. Zum Teil müssen wir schieben, weil der Weg so schlecht ist, zum Teil weil es so steil ist. Nicht mehr fahrbar ist mittlerweile ausgedehnt auf 18%. Irgendwann sehen wir das Dorf in einer Bucht vor uns und nach weiteren 1,5 Stunden sind wir da. Auf dieser Strecke sollte die Autobahn gebaut werden und in der Nähe des Dorfes ist auch schon begonnen worden, die Trasse in den Berg zu sprengen. So ist immer wieder eine Bergsprengung zu sehen und an einer Stelle ist auch die Straße schon gebahnt worden, dann aber abgebrochen an einer Stelle, wo es sicherlich eine Brücke über ein kleines Delta gegeben hätte. So ist dieser Streifen Küste sicherlich einer der wenigen ursprünglichen in Griechenland (griechisch Elláda, Ελλάδα [ɛˈlaða]; formell Ellás, Ελλάς ‚Hellas‘; amtliche Vollform Ellinikí Dimokratía, Ελληνική Δημοκρατία Hellenische Republik[5]) und von einer wilden Schönheit. Uns tut es gut nach gestern, weder Hunde noch Kinder auf dem Weg anzutreffen. Am Abend sind wir im Strandteil des Dorfes, dort gibt es einen Campingplatz, der aber keinerlei sanitäre Anlagen hat, einige Ferienhäuser und einen Garten mit Wohnmobilen und einer Dusche. Wir wissen nicht so recht, was das ist, schlagen da aber unser Nachtlager auf. Die Hafenstadt werden wir dann morgen erreichen. Heute haben wir noch Ideen entwickelt, wie wir unser Gepäck besser sichern können, ohne dass es zu viele neue Handgriffe sind. Denn je länger wir die Situation im Roma-Dorf Revue passieren lassen, desto deutlicher wird, wie viel Glück wir hatten. Jetzt sind die Gepäckstücke, die nicht durch Schlösser gesichert sind, weil sie immer am Rad bleiben, mit den Fahrradschlössern ganz einfach, aber effektiv gesichert. Donnerstag, 27. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren kämpfen wir wieder einmal mit den Dornen. 27. September Messimvria – Alexandroupoli (griechisch Αλεξανδρούπολη (f. sg), älter auch Alexandroupolis Αλεξανδρούπολις, türkisch Dedeağaç, bulgarisch Dedeagatsch Дедеагач, gr. bis 1920 Dedeagats Δεδέαγατς) 30,8km. 3511,1 Gesamtkm Datum: 27.9.10 Tag: 58 TagesunterstützerIn: Thomas Pröpper von: Messimvria m NN 3 nach: Alexandroupoli m NN 3 km 30,8 Gesamt km 3465,7911 km/h: 12,43 Fahrzeit 02:28 gesamte Fahrzeit: 253:16:00 Anstieg in m pro h 2,84 Anstieg in m 7 Abfahrt in m: 7 höchster Punkt in m NN 3 Steigung/Gefälle 0,05 1. Panne: der andere Reifen an Wolfgangs Wagen ist platt. Die Dornen leisten ganze Arbeit! In den anderen Reifen stecken auch noch Dornen. Der Morgen ist sonnig und klar und nachdem wir gesehen haben, dass „normale“ Autos den vor uns liegenden Weg befahren haben, haben wir die Hoffnung, dass der Weg nicht mehr ganz so schlimm wird. Es beginnt direkt mit einer Steigung und nach der ersten Bucht geht es mit der nächsten Steigung weiter. Im Fahren-Schieben-Takt erreichen wir die Vorboten des Dorfes: eine asphaltierte Straße. Zuvor sind wir an einer funktionierenden Quelle vorbei gekommen, nachdem die einzige, die wir gestern gesehen haben, versiegt war. Wir folgen dem Asphaltweg und fahren direkt auf eine Ausgrabungsstätte zu, die durch einen Zaun gesichert ist. Es ist ein großes Gelände am Meer. Der Nachteil: die Straße wird umgeleitet über den Hügel mit 18%. Es ist irre heiß und wir haben einfach keine Lust und schieben. Danach geht die Straße in sanften Hügeln am Meer entlang. Es gibt zwei große Kasernen auf dem Weg. Ansonsten fällt uns hier wieder auf was uns bereits in Komotini (griechisch Κομοτηνή (f. sg), türkisch Gümülcine, bulgarisch Гюмюрджина/Gjumjurdschina) und den Weg danach aufgefallen ist: die Häuser sind mit riesigen Zäunen und Mauern gesichert, selbst bei Mehrfamilienhäusern ist ein Gitter vor dem Eingang. Noch vor der Stadt sehen wir unser Schiff – wir sind 40 Minuten zu spät! Am Hafen erfahren wir die Abfahrtzeiten der nächsten Tage und trinken das teuerste Bier unserer Reise in einer völlig überschickten Bar. Es gibt einen Campingplatz direkt am Meer, unser erster Campingplatz seit Tamsweg! Wir können alles aufhängen, trocknen und lüften lassen und selber ins Meer gehen (nur Gunda). Jetzt gibt es ein paar freie Tage! Freitag, 28. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren sind wir endlich auf der Insel! Mittwoch, 29. September 2010 21.-28. September 2010 - 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 28. September Alexandroupoli (griechisch Αλεξανδρούπολη (f. sg), älter auch Alexandroupolis Αλεξανδρούπολις, türkisch Dedeağaç, bulgarisch Dedeagatsch Дедеагач, gr. bis 1920 Dedeagats Δεδέαγατς) – Kamariotissa (griechisch Καμαριώτισσα (f. sg)), 3,9km, 3515,1 Gesamtkm Datum: 28.9.10 Tag: 59 TagesunterstützerIn: AK Biblischer Tanz von: Alexandroupoli m NN 3 nach: Kamriotissa m NN 10 km 3,9 Gesamt km 3469,6911 km/h: 9,08 Fahrzeit 00:25 gesamte Fahrzeit: 253:41:00 Anstieg in m pro h 24,00 Anstieg in m 10 Abfahrt in m: 3 höchster Punkt in m NN 10 Steigung/Gefälle 0,33 Pannen: Am Morgen ist zunächst das Hinterrad von Gunda platt, dann auch das von Wolfgang, das Geflickte von Gunda wieder platt und dann das Geflickte von Wolfgang. Die Dornen tun immer noch ihre Arbeit. Zudem fällt beim Flicken auf, dass der Mantel von Gundas Hinterrad durch die schlechten Straßen bereits einen Schaden hat obwohl es ein neuer Mantel ist (und der alte nach über 5000 Kilometern auf Straßen nichts hatte). Wir werden in Instanbul wohl einen neuen kaufen müssen. So fahren wir mit weichem Reifen die nur 3 Kilometer zum Hafen und diesmal bekommen wir das Schiff. Die Überfahrt dauert gute 2 Stunden und wir sehen unsere Geo-Strecke noch einmal vom Meer aus. Um das Schiff spielen für einen kurzen Moment Delphine, sonst sind es vor allem die Möwen, die absahnen. Auf der Insel finden wir eine kleine Pension und werden die zwei Tage mit Ausruhen, Fahrräder flicken und schrauben, Wäsche waschen und Planung verbirngen. Mittwoch, 29. September 2010 Thermaikos Kolpos ^ Thrakikon Pelagos Mittwoch, 29. September 2010 Schwarzes Meer ^ Adria ^ Aegaeis Samstag, 29. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren besuchen wir das Heiligtum der Kabiren (griechisch Κάβειροι (Kabeiroi), die großen (Götter), die Mächtigen lat. Cabiri) Wikipedia: Kabiren waren chtonische Gottheiten, die besonders auf den nordägäischen Inseln Samothrake und Lemnos verehrt wurden. Sie fanden aber auch in Ägypten und Phönizien Verehrung. Die Griechen entlehnten diesen Geheimkult offenbar von den Phrygiern. Obwohl die Herkunft der Bezeichnung "Kabiren" semitisch, genauer gesagt phönizisch ist ("kabir" bedeutet "groß"), deutet nichts darauf hin, dass auch der Kult seine Ursprünge in Phönizien hat. Ursprünglich handelte es sich zunächst um nur zwei Götter: ein älterer, nachmals als Hephaistos oder (in Böotien) mit Dionysos zugeordnet, und ein jüngerer, Kadmilos oder Kasmilos genannt und vielfach mit Hermes oder dem thebanischen Kadmos oder dem troischen Dardanos identifiziert. Als ihre Verehrung mit dem Kult der Demeter und Kora oder der Rhea in enge Verbindung getreten war, erschien auch eine weibliche Kabirin. Von den vier überlieferten Götternamen, die aus Mysterien der Kabiren, wahrscheinlich aus Theben bekannt sind, Axieros, Axiokersa, Axiokersos und Kadmilos, wurde behauptet, sie bezeichneten Demeter, Persephone, Hades und Hermes. Auf Samothrake waren sie Beschützer der Seefahrer und Schiffbrüchigen. Die Kabiren von Lemnos erscheinen als drei Söhne des Hephaistos und der Kabeiro und waren Schmiede, darum wurden sie Hephaistoi genannt, was sie in die Verwandtschaft zu den Telchinen rückt, jenen göttlichen Künstlern, die die ersten Götterstatuen nach menschlichem Bild aus Erz geformt haben sollen. Das antike Samothráke liegt seit alters an einem für Nautik und Fernhandel bedeutenden Punkt: Da eine ständige Meeresströmung aus den Dardanellen in die Ägäis läuft, sammelten sich hier die Segelschiffe, die einen günstigen Wind für die Durchfahrt ins Schwarze Meer abzuwarten hatten. In dieser Situation waren sie eine leichte Beute für Piraten. Samothrake soll nach Herodot von Pelasgern, nach anderen Quellen vom Thrakischen Stamm der Kabeiroi oder durch Dardanos mit Arkadiern und Troern kolonisiert worden sein. Historisch gesichert ist eine Kolonisierung durch Aioler aus Lesbos um 700 v. Chr., die auf Samothrake einen Stadtstaat (Polis) begründeten. In der Schlacht bei Salamis (480 v. Chr., dritter Perserkrieg) kämpften die Bewohner von Samothrake auf Seiten der Perser, danach wurden sie (tributpflichtige) Bundesgenossen der siegreichen Athener, bis zu deren Niederlage im Peloponnesischen Krieg gegen Sparta. Nach der Eroberung des Perserreiches durch Alexander den Großen, im Hellenismus, war Samothrake ein bedeutendes Heiligtum für die (die Seefahrt beschützenden) Dioskuren, das von den (daran geostrategisch interessierten) ägyptischen Pharaonen aus dem Haus der Ptolemaier reich ausgestattet wurde; es war also auch zugleich ein bedeutender Handelsplatz (vgl. Delos). Mit dem Ende der Diadochen-Reiche geriet die Insel unter römische Herrschaft. Im ersten vorchristlichen Jahrhundert, nach den marianischen Bürgerkriegen, wurde der an Weihgeschenken reiche Tempelbezirk von Seeräubern geplündert. In der Apostelgeschichte (Apg 16,11) wird Samothraki namentlich erwähnt: „Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake, und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis“. Mittelalter und Neuzeit Samothraki stand nach dem Untergang des Römischen Reiches unter byzantinischer, venezianischer und genuesischer Herrschaft. Ab 1457 gehörte die Insel zum Osmanischen Reich und bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zum Wilajet Dschesair, der türkische Name der Insel ist Semadirek. Infolge der Balkankriege fiel Samothraki 1912 an Griechenland, und stand 1941 bis 1945 unter bulgarischer Oberhoheit. Gemäß dem Vertrag von Lausanne und dem Vertrag von Montreux ist die Insel demilitarisiert. Seit Ende der 1950er Jahre arbeiteten viele Samothraker als Gastarbeiter unter anderem bei Mercedes, und ein schwäbischer Einfluss ist auch jetzt noch an Einzelzügen der Ortschaften bemerkbar. Im Raum Stuttgart und Waiblingen leben und arbeiten mehr Samothraker als anderswo in Deutschland. 29. September Samothraki (griechisch Σαμοθράκη (f. sg) ‚thrakisches Samos‘, türk. Semadirek) Heute Morgen haben wir unsere Wäschelogistik weitergeführt und ganz mutig auf dem Balkon aufgehangen, obwohl es nach Regen aussieht. In der Nacht hat es bereits geregnet, der erste Regen seit dem Frühjahr. Irgendwie ziehen wir den Regen mit uns mit…. Danach haben wir versucht, Informationen über einen Bus zu bekommen und wissen nun, dass um 14:00 ein Bus über die Insel fährt, so können wir uns die antiken Stätten anschauen und die Räder morgen erst wieder in Ordnung bringen. Freie Tage bedeuten vor allem Räder und sonstiges Equipment wieder in Ordnung bringen, Internet finden und wenn es dann Postkarten gibt, Postkarten schreiben. Wir nehmen den Bus um 14:00 und haben die romantische Vorstellung, dass es an der Ausstellungsstätte einen Ort und etwas zu essen gibt. Wir werden an der Ausgrabung rausgelassen und bis auf eine Herde Ziegen sind wir die einzigen, die dort herumlaufen. Wir wandern wacker mit unseren Badelatschen den steinigen Weg zur antiken Wasseraufbewahrung hinauf und wieder hinunter und gehen anschließend zur nächsten Ausgrabungsstätte. Dort gibt es ein Museum und einen Menschen, der den Eintritt einsammelt. Das Heiligtum des alten Ritus ist wunderbar in die Landschaft eingebunden und es ist ein Genuss, sich die verbleibenden Reste anzuschauen. Da der Bus erst am Abend dort wieder vorbeikommt, laufen wir kurzentschlossen zurück – immer noch in unserer „amerikanischen“ Wanderbekleidung an den Füßen. Nach 1,5 Stunden sind wir zurück und stürzen uns hungrig in die nächste Taverne. Sonntag, 30. September 2012 Heute vor zwei Jahren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei Jahren melden wir den Verlust des Passes ans Einwohnermeldeamt. Samstag, 11. Dezember 2010 Kilometer- und Höhenangaben Griechenland Graphik hier herunterladen Nr Tag Höhe max. ZielortTagesGesamt Höhe Tagesziel/Ort KmH Tageshöhenmeter über km km am NN Tag Orfani 0 84,33 3254,4 240 208 Gravouna 20 91,39 3347 13,6761 341 Komotini 41 89,54 3437,7 14,8867 115 Messimvria 3 41,48 3479,7 8,79 138 315 54 55 56 57 58 Alexandroupoli3 30,8 3511,1 12,437 0 59 Kamriotissa 10 3,9 0 60 Kamriotissa 10 0 61 Kamriotissa 10 0 3515,1 9,08 10 30. September Samothraki (griechisch Σαμοθράκη (f. sg) ‚thrakisches Samos‘, türk. Semadirek) Heute haben wir dem Einwohnermeldeamt den Verlust des Passes gemeldet und sonst unsere Logistik sortiert. Dazu gehörte dann auch die weiteren Löcher in den Schläuchen zu flicken. Der Mantel an meinem (Gundas) Rad ist hinten ziemlich mitgenommen, da hoffen wir in Istanbul [ˈˀi.stan.buːl] (türkisch İstanbul [isˈtɑnbul]) Ersatz zu finden. Die ruhigen Tage haben sehr gut getan Montag, 1. Oktober 2012 Heute vor zwei JAhren Hier geht´s zu unserer Homepage www.silkroad-project.eu Heute vor zwei JAhren fahren wir über die hochgesicherte Grenze an der Mariza, auch Maritza geschrieben (bulg. Марица, griechisch Έβρος / Evros, lat. Hebrus, türk. Meriç Nehri). Heute entdecken wir einen interessanten Film über die Jesiden (kurdisch: ئ ێزی دی, Êzîdî; alternative Schreibweisen: Yeziden, Eziden[1] Wikipedia: Während die ältere religionsgeschichtliche Forschung die jesidische Religion zunächst als eine Abspaltung vom Islam oder als eine „iranische“ Religion zu verstehen versuchte, wird in jüngerer Zeit der eigenständige, wenn auch auf einem komplexen Prozess der Adaption von Elementen anderer Religionen beruhende Charakter der jesidischen Religion betont. Die Verwandtschaft der kosmogonischen Vorstellungen mit dem Zoroastrismus führt zur Annahme, dass hier eine ursprüngliche Verwandtschaft bestehen könnte. Weitere Elemente werden auf das orientalische Christentum, besonders die nestorianische Eucharistie, den Mandäismus, den Manichäismus und die Gnosis bezogen. Nach Ansicht der Jesiden soll ihre Religion älter sein als das Christentum und sich aus dem altpersischen Mithras-Kult oder aus den Kulten der Meder entwickelt haben. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Jesiden von Außenstehenden teilweise als „Teufelsanbeter“ bezeichnet.[3] Diese Fremdbezeichnung beruht darauf, dass europäische Reisende sich auf die Berichte der Muslime in der Nachbarschaft der Jesiden bezogen. Für die islamische Umgebung waren die Jesiden andersgläubig und es war die Bezeichnung „Teufelsanbeter“ entstanden, da die religiösen Regeln unverstanden blieben. Lehre und Kosmogonie Die Religion der Jesiden ist monotheistisch. Der allmächtige Gott erschuf die Welt aus einer Perle. Nach einiger Zeit formten sieben heilige Engel aus dieser Perle die Welt mit allen Himmelskörpern. Jesiden führen ihre Abstammung allein auf Adam, nicht auf Eva, zurück und leiten daraus ihre Exklusivität ab. Gott wäre schwach, wenn er noch eine zweite Kraft neben sich dulden würde. Folglich fehlt in der jesidischen Theologie die Personifizierung des Bösen. Jesiden sprechen den Namen des Bösen (arabisch Schaitan) nicht aus, weil das Zweifel an der Allmacht Gottes bedeuten würde. Damit einher geht auch die Vorstellung, dass der Mensch in erster Linie selbst für seine Taten verantwortlich ist. Aus jesidischer Sicht hat Gott dem Menschen die Möglichkeit gegeben, zu sehen, zu hören und zu denken. Er hat ihm den Verstand gegeben und damit die Möglichkeit, für sich den richtigen Weg zu finden. Die Jesiden glauben, dass das Leben nicht mit dem Tod endet, sondern dass es nach einer Seelenwanderung einen neuen Zustand erreicht. Der neue Zustand ist abhängig von den Taten im vorherigen Leben. In diesem Zusammenhang spielt für einen Mann der „Jenseitsbruder“ (biraye achrete) und für eine Frau die „Jenseitsschwester“ (chucha achrete) eine wichtige Rolle. Unter den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft sucht man sich zu Lebzeiten einen Bruder oder eine Schwester für das Jenseits aus. Diese Wahlgeschwister übernehmen im Jenseits gegenseitig die moralische Mitverantwortung für ihre Taten und in der Totenzeremonie „begleiten“ sie den Verstorbenen auf dem Weg zur neuen Bestimmung. Nach den jesidischen Vorstellungen bestand die Verbindung der Jenseitsgeschwister bereits im vorherigen Leben und wird auch im künftigen Leben weiter bestehen. Überlieferungen Das Jesidentum beruft sich auf keine heiligen Schriften. Die Vermittlung religiöser Traditionen und Glaubensvorstellungen beruht ausschließlich auf mündlicher Überlieferung. In der Literatur über die Jesiden werden zwei Bücher erwähnt, das Buch der Offenbarung, das Kitêba Cilwe, und die Schwarze Schrift, das Mishefa Reş. Beide Bücher wurden 1911 und 1913 veröffentlicht,[4] wobei wohl nicht alle Glaubensvorstellungen der Jesiden vollständig authentisch wiedergegeben sind. Sie gelten in der Iranistik als Aufzeichnungen durch Nicht-Jesiden, enthalten aber authentisches Material, das unter Jesiden auch schon vorher bekannt war. Der Glaube wird überwiegend durch Lieder (so genannte Qewals) und Bräuche weitergegeben. Hilmi Abbas veröffentlichte einige der bisher nur mündlich überlieferten altkurdischen Legenden im Jahre 2003 in einer Ausgabe unter dem Titel Das ungeschriebene Buch der Kurden.[5] Das Buch beschreibt die Schöpfungsgeschichte aus jesidischer Sicht und die mythische Wanderung des kurdischen Volkes von Osten in den Westen in das heutige Kurdistan. Taus-i Melek Der Pfau ist bei den Jesiden heilig und dient als deren religiöses Symbol Eine zentrale Bedeutung in den jesidischen Glaubensvorstellungen hat Taus-i Melek, der „Engel Pfau“, dessen Symbol ein Pfau ist. Nach der jesidischen Mythologie hat er in besonderer Weise der Allmächtigkeit Gottes gehuldigt und wurde deshalb von Gott zum Oberhaupt der sieben Engel erkoren. Zwar wollte er sich dem Mythos nach selbst einmal zum Gott erheben, fiel deswegen in Ungnade, doch er bereute seine Vermessenheit und büßte dafür in der Hölle.[6] Seine Schuld wurde ihm schließlich vergeben, seither dient er Gott als Wächter der Welt sowie als Mittler und Ansprechpartner zu den Gläubigen. Nach der Schöpfungsgeschichte der Jesiden ist Taus-i Melek, den Gott mit sechs weiteren Engeln aus seinem Licht schuf, an der gesamten Schöpfung, an dem göttlichen Plan, aktiv beteiligt. „Wir glauben, dass er ein stolzer Engel ist, der rebellierte und deswegen von Gott in die Hölle verbannt wurde. Er blieb dort 40.000 Jahre, bis seine Tränen das Feuer der Unterwelt auslöschten. Jetzt hat er sich mit Gott versöhnt.“ – Halil Savucu, Vorsitzender der „Plattform[7] Ezidischer Celler“[8] Scheich Adi Das Grab von Scheich Adi in Lalisch im Irak Eine zweite wichtige Gestalt für die Jesiden ist der als Reformer geltende Scheich Adi aus dem 11./12. Jahrhundert. Die Religionswissenschaft identifiziert ihn mit dem sufischen Mystiker Scheich Adî Ibn-Musafîr (1075–1162), der nach seiner Zwangsislamisierung wieder in die jesidische Gemeinschaft eintreten wollte und deswegen von den Muslimen verfolgt wurde. Für die Jesiden ist Scheich Adi eine Inkarnation des Taus-i Melek, der kam, um das Jesidentum in einer schwierigen Zeit neu zu beleben. An seinem Grab in Lalisch findet jedes Jahr vom 6. Oktober bis 13. Oktober das „Fest der Versammlung“ (Jashne Jimaiye) statt. Jesiden aller Gemeinden aus den Siedlungs- und Lebensgebieten kommen zu diesem Fest zusammen, um ihre Gemeinschaft und ihre Verbundenheit zu bekräftigen. Häufig erschweren oder verhindern politische Umstände die Pilgerfahrt nach Lalisch, die eine Pflicht für jeden Jesiden ist. Aus Lalisch bringen die Jesiden geweihte Erde mit, die mit dem heiligen Wasser der Quelle Zemzem (in Lalisch, nicht mit dem muslimischen Samsam zu verwechseln) zu festen Kügelchen geformt wurde. Sie gelten als „heilige Steine“ (Sing. berat) und spielen bei vielen religiösen Zeremonien eine wichtige Rolle. Scherfedin Scherfedin ist der Sohn von Scheich Hassan (al-Hasan ibn Adi), einem Neffen von Scheich Adi, und ein jesidischer Volksheld. Um das Jahr 1254 n. Chr. kam es zu einem Konflikt zwischen Scheich Hassan und dem Statthalter von Mosul, Badr al-Din Lulu. Im Sindschar-Gebiet versammelten sich jesidische Krieger. Nach der Niederlage der Jesiden nahmen Badr al-Dins Männer Scheich Hassan fest und hängten ihn in Mosul am Tor auf. Des Weiteren wurde Lalisch angegriffen. Scherfedin sandte den Jesiden in Lalisch eine Botschaft, die zu Zusammenhalt, Verteidigung und Bewahrung der jesidischen Religion aufrief. Er wurde bei dem erneuten Kampf getötet. Seine Botschaft wurde zur religiösen Hymne der Jesiden: Şerfedîna, Şerfedîna, Şerfedîna ji dînê me ye Şerfedîna Mîra li dîwanê Élem bidin Êzidxanê qewîn bikin vê îmanê Şerfedîna ji dînê me ye. Das Kastensystem Das jesidische Kastensystem wurde von Scheich Adi begründet. Vor dieser Reform gab es bei den Jesiden kein Kastensystem. Hintergrund der Einführung war der Versuch, die jesidische Religion vor dem Eindringen des Islam zu sichern. Das jesidische Kastensystem hat kaum Ähnlichkeiten mit dem hinduistischen Kastensystem. Die einzige Gemeinsamkeit ist die Geburt in eine Kaste und das Heiratsverbot zwischen Angehörigen verschiedener Kasten. Sonst unterscheiden sich die beiden Kastensysteme stark voneinander. So ist jeder Jeside unabhängig von seiner Kastenzugehörigkeit gleich an persönlichen und wirtschaftlichen Rechten und Pflichten geboren. Kein Jeside ist aufgrund seiner Kaste besser oder schlechter als andere. Im Jesidentum kann jeder unabhängig von seiner Kaste oder Geschlecht jeden Beruf frei wählen. Man unterscheidet hierbei zwischen der Kaste der Scheichs, der Kaste der Pirs und der Kaste der Muriden (allgemeinen jesidischen Gläubigen). Die Scheichs und Pirs sind religiöse Führungskräfte (Geistliche) und müssen die jesidische Religion unter den Gläubigen aufrechterhalten, Zeremonien (bei Festen, jesidische Taufe bei Neugeborenen und bei Beerdigungen) durchführen, Gläubigen in der Not helfen sowie Streitereien zwischen Jesiden beseitigen. Obwohl diese Aufgaben die Angehörigen der Scheichs und Pirs machen müssen, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Kasten. Die Scheichs haben in der Gemeinschaft noch eine administrative Aufgabe. Sie müssen bei politisch-sozialen Aufgaben für die Gemeinschaft tätig werden. Sie sind also nach außen und innen Vertreter der Gemeinschaft und müssen Probleme sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Gemeinschaft lösen. Die Scheichs und Pirs sind neben den Mir (Fürst, Oberhaupt der Jesiden), Priesterinnen und Priester von Lalisch, Hüter der Religion und für jeden jesidischen Gläubigen Ansprechpartner. Die Kaste der Muriden ist die dritte und größte Kaste. Die Jesiden in dieser Kaste teilen sich in Stämme auf, bei denen die Heirat der Angehörigen untereinander kein Problem ist. Auch diese haben Pflichten, nämlich zur Erhaltung der Religion beizutragen und sich gegenseitig in der Not zu helfen. Es ist Pflicht für jeden Jesiden unabhängig von seiner Kaste, seine Kinder religiös zu erziehen und ihnen die jesidische Kultur und Bräuche beizubringen. Die jesidischen Siedlungsgebiete waren und sind räumlich voneinander getrennt. Aus organisatorischen Gründen hat Scheich Adi festgelegt, dass sowohl die Angehörigen der Pirs als auch der Scheichs sich auf die jesidischen Stämme in Abhängigkeit zu deren Größe aufteilen sollen. So bekam jeder Stamm seine Scheichs und Pirs. Dadurch gibt es in jedem Siedlungsraum für jede Gruppe jesidischer Gläubigen eines Stammes die zuständigen Pirs und Scheichs. Bei Problemen können sich die Gläubigen jedoch auch an Pirs und Scheichs wenden, die für andere Stämme zuständig sind. Jesidische Stämme Im Jesidentum gibt es viele Stämme. Die Stämme haben Sippencharakter und sind Ergebnisse des Zusammenhalts von Nachfahren bestimmter Gründungsväter und des engen Zusammengehörigkeitsgefühls von Jesiden in bestimmten Gebieten Kurdistans. Die Angehörigen der Stämme sehen sich in der Pflicht, anderen Stammesangehörigen zu helfen. Die Heirat zwischen Angehörigen unterschiedlicher jesidischer Stämme ist erlaubt. Verbreitung Die Jesiden haben ihr traditionelles Siedlungsgebiet im Verbreitungsgebiet der Kurden. Noch im Mittelalter bekannten sich nach jesidischer Überlieferung die meisten Kurden zum Jesidentum. Unter anderem waren viele Adlige laut Şerefhan ursprünglich Jesiden. Die erste Völkermordwelle an ihnen durch die Osmanen zu Anfang des 19. Jahrhunderts und vor allem der Völkermord an Armeniern und Jesiden während des Ersten Weltkrieg zwang die Jesiden zur Flucht nach Armenien und Georgien. Seit den 1980er Jahren wanderten sie auch nach Mittel- und Westeuropa sowie Nordamerika aus. Es gibt keine offizielle Zählung der Jesiden. Ihre Zahl wird weltweit auf 800.000 geschätzt.[9]. Den Hauptanteil stellen die irakischen Jesiden (160.000–350.000). In Deutschland leben etwa 60.000, im restlichen Europa kommen noch etwa 65.000 hinzu. In den USA und Kanada leben einige Tausende Jesiden, meist aus dem Irak. Im Kaukasus (Armenien und Georgien), in Russland und im Iran leben einige Zehntausend und in Syrien einige Tausend, in der Türkei nur noch wenige Hundert. Die Jesiden stellen heute also unter den mehrheitlich muslimischen Kurden eine religiöse Minderheit dar. Jesiden im Irak Das Hauptverbreitungsgebiet der Jesiden ist der Nordirak. Die Jesiden siedeln überwiegend westlich des Tigris in der Provinz Ninawa. In Ninawa konzentrieren sich die Jesiden um dem Dschabal Sindschar mit der gleichnamigen Stadt Sindschar. In der Stadt Mosul selbst leben auch viele Jesiden. Ein kleiner Teil lebt in der Provinz Dahuk. Nicht allzu weit von Mosul entfernt befindet sich Lalisch, das religiöse Zentrum der Jesiden. Nahe bei Lalisch residiert in Baadhra das weltliche und geistliche Oberhaupt der Jesiden, der Mir, der auch Schaichan Mire Schaichan genannt wird. Zählungen und Schätzungen von türkischer, britischer und irakischer Seite aus den 1920er Jahren ergaben einen jesidischen Anteil von 4 % bis 7 % an den irakischen Kurden, was heute bei gleich bleibendem Anteil 160.000 bis 350.000 Personen entspräche. Manche Maximalschätzungen gehen heute von bis zu 550.000 jesidischen Gläubigen aus. Die Jesiden machen schätzungsweise 1 % der irakischen Bevölkerung aus. Seit 1991 ist die jesidische Gemeinschaft im Irak zweigeteilt. 90 % der irakischen Jesiden leben in irakisch verwaltetem und nur etwa 10 % in kurdisch verwaltetem Gebiet. Nach Angaben des UNHCR verfügen die Jesiden im Irak nicht über eine eigene Interessenvertretung im gegenwärtigen zentralirakischen Regierungsgefüge, nachdem das frühere Ministerium für Religionsangelegenheiten zugunsten dreier neugeschaffener Ressorts für die Angelegenheiten der Schiiten, Sunniten und Christen aufgelöst wurde [10]. Seit dem Ende des Irakkrieges sind die Jesiden gezielt zur Zielscheibe fundamentalistischer Moslems geworden. Sie müssen um ihr Leben fürchten. Das führt dazu, dass die Jesiden aus dem Irak in Massen nach Europa und Nordamerika flüchten. Am 14. August 2007 verübten Terroristen aus dem Umfeld der al-Qaida vier Anschläge in den ausschließlich von Jesiden bewohnten Dörfern El Khatanijah und El Adnanijah. Die Anschläge forderten insgesamt über 500 Todesopfer, Hunderte wurden verletzt.[11] Die Tat gilt als Racheakt für die 15 Tage zuvor verübte Ermordung des 17-jährigen jesidischen Mädchens Du’a Khalil Aswad, das, angeblich wegen eines Übertritts zum Islam, von ihrem eigenen Clan gesteinigt wurde. Die al-Qaida in Mossul hatte darüber hinaus in einer Fatwa verboten, den Jesiden Essen zu geben, wodurch sich die Lebensmittelversorgung in den jesidischen Dörfern dramatisch verschlechterte. Die Zusage der Amerikaner und der kurdischen Regionalregierung, bald Lebensmitteltransporte zu schicken, nutzten Terroristen für einen Anschlag.[12][13] Diese gegen die Jesiden gerichteten Anschläge waren die folgenschwersten seit Beginn des Irakkriegs.[14] Jesiden in der Türkei In den letzten 30 Jahren haben die Jesiden in großen Auswanderungswellen die Türkei verlassen. Sie lebten überwiegend in Südostanatolien. Laut dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht liegt seit 2003 keine staatliche Gruppenverfolgung der Jesiden vor.[15] Jesiden in Syrien In Nordsyrien, hier besonders in Afrin, und in Nordost-Syrien, hier besonders in und um die Stadt Qamischli und im Gouvernement Al-Hasaka, leben Jesiden in Syrien – vgl. als Illustration Qîbar. Allerdings ging ihre Zahl beträchtlich zurück, für 1990 wurden 12.256 gezählt und Ende 2008 nur noch 3.357. Ein wesentlicher Grund dafür ist die verstärkte Auswanderung nach Europa. Jesiden im Iran Im Iran gibt es einige Tausend Jesiden. Im Iran sind als Religionen nur der Islam und, mit wesentlichen Einschränkungen, das Christentum, der Zoroastrismus und das Judentum erlaubt. So müssen die Jesiden ihre Religionszugehörigkeit und -ausübung geheim halten. Sie leben anonym auf dem Land und vor allem in größeren Städten. Jesiden in der Diaspora Kaukasus Es gab insgesamt drei Fluchtwellen der Jesiden aus dem Osmanischen Reich in den Kaukasus, nach Georgien und Armenien. Die erste geschah im 18. Jahrhundert. Zur zweiten Fluchtwelle kam es während des Russisch-Türkischen Krieges 1877–1878. Die dritte und größte Fluchtwelle ereignete sich am Anfang des 20. Jahrhunderts, während des Ersten Weltkrieges.[16] Auslöser der Flucht waren die gezielte Verfolgung, Unterdrückung und Massaker an Jesiden und anderen Volksgruppen im osmanischen Reich. Nicht selten unterstützten moslemische Kurden und osmanische Behörden diese Verfolgungen und Massaker. Die Jesiden, die selbst Opfer der Osmanen waren, schützten die Armenier während des Ersten Weltkrieges, indem sie diese in ihren Häusern versteckt hielten. Dieser Schutz der Armenier durch die Jesiden bildete eine Grundlage für das Zusammenleben von Jesiden und Armeniern in Armenien. Vor dem Zusammenbruch der UdSSR um 1990 lag die Zahl der Jesiden in Georgien bei 22.000, in Armenien bei 60.000. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam es aber zu wachsendem Nationalismus in beiden Staaten und die Situation für die Jesiden und andere Minderheiten verschlechterte sich. Die Zahl der Jesiden ging im Zeitraum zwischen 1989 und 1997 in Georgien auf 1.200 und in Armenien auf 18.000 zurück. Viele Jesiden flüchteten nach Europa und Russland. In Georgien sind die Gründe der Flucht vielfältig. Die Jesiden beklagen massive Übergriffe durch Polizisten und Beamte, Mordvorwürfe, Körperverletzungen, Falschanschuldigungen, Hass und zu Unrecht negative Berichte der Presse und öffentliche Äußerungen von Politikern. Die Jesiden haben keine Chance auf höhere Posten und Gleichbehandlung bei der Verwaltung und medizinischen Versorgung. Auch haben sie keine Chance auf höhere Bildung und ein höheres Einkommen. Die Flüchtlinge berichten über Erpressung, Bedrohung und Verfolgung durch die Polizei. Den Jesiden in Georgien wird der Bau von jesidischen Gebetshäusern verboten. Sie sind in Georgien weder in Parlament noch Regierung vertreten, so dass ihre Forderungen nach einem normalen Leben kein Gehör finden. Zur Sowjetzeit wurden Garantiemandate an die Jesiden vergeben; nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurden sie aber wieder abgeschafft.[16] In Armenien bilden die Jesiden mit 1,3 % an der Gesamtbevölkerung die größte Minderheit.[17] Da ihnen nach dem Zusammenbruch der UdSSR keine Garantiemandate mehr zustehen, sind sie im Parlament nicht vertreten. In Russland wurde das Jesidentum erst Ende Juli 2009 offiziell als Religionsgemeinschaft und somit als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Seit 1990 sendet "Radio Jerewan"(=Öffentliches Radio Armeniens)[18] täglich eine halbe Stunde lang die Sendung Stimme der Jesiden in kurdischer Sprache. In der Redaktion der Radiosendung wird die jesidische Wochenzeitung, die ebenfalls Stimme der Jesiden heißt, verfasst. Sie erscheint in armenischer Sprache. In Armenien darf in jesidischen Schulen kurdisch gelehrt werden. Europa und Amerika Eine bedeutende Zahl von Jesiden lebt zurzeit in Europa, hauptsächlich in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und besonders in Deutschland. Einige wenige leben in Schweden, Dänemark, Österreich und in außereuropäischen Staaten,[19] wie in den USA und Kanada. Deutschland Zunehmende Repressionen trieben Jesiden in den 1980ern vor allem aus der Türkei zur Flucht nach Deutschland. In Deutschland leben schätzungsweise 60.000 Jesiden,[20] vorwiegend in den Bundesländern Niedersachsen und NordrheinWestfalen. Hier bilden sie häufig größere Gemeinden. Bedeutende Gemeinden befinden sich in Hannover, Oldenburg, Celle, Bielefeld, Halle (Westf.), Emmerich am Rhein, Rees, Kalkar und Kleve und zunehmend in Mecklenburg-Vorpommern. 2007 wurde der Zentralrat der Yeziden in Deutschland[21] gegründet, der sich die „Förderung und Pflege religiöser und kultureller Aufgaben der yezidischen Gemeinden“ und „die Vertretung der gemeinsamen politischen Interessen der yezidischen Gemeinschaft“[21] zum Ziel gesetzt hat. Im Februar 2011 entstand die Gesellschaft für Christlich-Ezidische Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung.[22][23] Der mit den Gegebenheiten vor Ort vertraute Orientalist Gernot Wießner der Universität Göttingen erwirkte mit einem Gutachten beim Verwaltungsgericht Stade 1982 die Anerkennung der Jesiden als Flüchtlinge. 1993 hat sich dieser Status vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg allgemein durchgesetzt. Auf politischer Ebene bereitete 1989 Herbert Schnoor in seiner Amtszeit als Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen den Weg für ein Bleiberecht der Jesiden. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker, bei der Wießner Beiratsmitglied ist, hat sich als Menschenrechtsorganisation für die Jesiden eingesetzt. In den letzten Jahren flohen vermehrt Jesiden aus dem Irak nach Deutschland.[24][25][26] Feleknas Uca, die von 1999 bis 2009 Die Linke im Europaparlament vertrat, ist Jesidin. Der Jeside Ali Atalan gehört als Abgeordneter der Fraktion der Linken im Landtag von Nordrhein-Westfalen an. Durch die strikten Heiratsvorschriften des jesidischen Glaubens und die modernen Einflüsse in der Diaspora entstehen zunehmend starke Spannungen, insbesondere zwischen jungen Frauen und den älteren Familiengliedern. Der traditionelle Brautpreis, der vor der Hochzeit durch die Familie des Mannes zu entrichten ist, beträgt in den deutschen Diasporagemeinden bis zu 70.000 €.[27] Auch in Deutschland kam es unter Jesiden zu Fällen von Zwangsheirat (bei beiden Geschlechtern). Der Anteil von Jesidinnen an Frauen, die sich aufgrund einer bevorstehenden Zwangsheirat an Beratungseinrichtungen wandten, lag in einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei 9,5 %.[28] Auch Blutrache zwischen verfeindeten Großfamilien und mutmaßliche Ehrenmorde wurden öffentlich. So wurde die Tötung der Jesidin Arzu Özmen im erstinstanzlichen Strafurteil gegen fünf ihrer Geschwister ausdrücklich als „Ehrenmord“ bezeichnet. Das Auswärtige Amt schreibt zu Georgien: Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 1. Oktober 2012 organisieren die großen politischen Lager Kundgebungen in Tiflis und in anderen Städten, bei denen mit einer sehr hohen Anzahl von Teilnehmern und entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, Demonstrationen und Menschen-ansammlungen zu meiden. Während eine Einreise über Land z.B. über die Türkei problemlos erfolgen kann, ist der Reiseverkehr über Land zwischen der Russischen Föderation und Georgien für Ausländer nur erschwert möglich oder gar völlig unterbrochen. Der Grenzübergang Dariali / Hoher Lars an der M3 („Georgische Heerstraße“) konnte von 2006 bis 2011 nur von georgischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen der GUS-Staaten genutzt werden, ist inzwischen aber auch für den internationalen Reiseverkehr wieder geöffnet. Dennoch können Schwierigkeiten beim Grenzübertritt nicht ausgeschlossen werden. Vor allem aber ist hierbei die Sicherheitslage im Nordkaukasus zu beachten: Von Reisen dort wird dringend abgeraten (siehe Reiseund Sicherheitsweise Russische Föderation). Eine Einreise über die georgisch-russische Grenze in die georgischen Konfliktgebiete Abchasien und Südossetien wird seitens der georgischen Behörden weiterhin als illegaler Grenzübertritt geahndet (siehe unten). 1. Sicherheit in den Landesteilen Südossetien und Abchasien und in der Nähe der Verwaltungsgrenzen Beide Gebiete befinden sich nicht unter der Kontrolle der Regierung in Tiflis. In den Gebieten und an deren Verwaltungsgrenzen sind russische Truppen stationiert. Die Situation in den Konfliktregionen kann sich jederzeit ändern. Informieren Sie sich daher auch über die lokalen Medien. Das georgische „Gesetz über die besetzten Gebiete“ untersagt Reiseverkehr, wirtschaftliche Aktivitäten, Erwerb von Grund und Boden bzw. Immobilien sowie andere Aktivitäten in Abchasien und Südossetien mit nur wenigen Ausnahmen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Geld- oder Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Es wird daher dringend geraten, sich im konkreten Fall rechtzeitig über die entsprechenden Regelungen zu informieren, und die notwendige Zustimmung der georgischen Regierung einzuholen – Hinweise und Erlaubnis zur Einreise geben das Georgische Außenministerium (Externer Link, öffnet in neuem Fensterwww.mfa.gov.ge) und das Ministerium für Reintegration (Externer Link, öffnet in neuem Fensterwww.smr.gov.ge). Abchasien: Von Reisen nach Abchasien wird grundsätzlich abgeraten. Wegen der schwierigen Sicherheitslage, insbesondere im Bezirk Gali nahe der Waffenstillstandslinie bzw. Verwaltungsgrenze, wird unbedingt empfohlen, die Reisenotwendigkeit sehr sorgfältig zu prüfen und die vorherige Zustimmung des georgischen Außenministeriums einzuholen. Die Autonome Republik Abchasien in Nordwest-Georgien gehört völkerrechtlich zu Georgien, steht seit 1993 aber nicht mehr unter der Kontrolle der georgischen Regierung. Die Sicherheitslage in diesem Landesteil ist seitdem prekär. Es kommt zu Zwischenfällen. In einigen Teilen der Region liegen teils nicht gekennzeichnete Minenfelder. Abchasien ist für den internationalen Reiseverkehr gesperrt. Eine legale Ein- und Ausreise in bzw. aus dem Gebiet heraus ist gemäß dem „Gesetz über die besetzten Gebiete“ über die russisch-georgische Grenze in Abchasien nicht möglich – es sei denn in besonderen Ausnahmefällen mit vorheriger Zustimmung der georgischen Regierung. Ein ungenehmigter Grenzübertritt (z. B. am Grenzübergang Psou) wird von den georgischen Behörden als illegaler Grenzübertritt nach Georgien behandelt. Bei anschließender Weiterreise über die Waffenstillstandslinie bzw. Verwaltungsgrenze in benachbarte georgische Landesteile bzw. beim Ausreiseversuch über reguläre georgische Grenzübergänge drohen daher Festnahme und Strafverfahren. Auch bei späteren Reisen nach Georgien droht die Verweigerung der Einreise, sollte sich aus dem Pass ergeben, dass zuvor auf illegalem Wege nach Abchasien/Georgien eingereist wurde. Südossetien: Vor Reisen nach Südossetien und in die unmittelbare Nähe der Konfliktregion wird ausdrücklich gewarnt. Für eine Einreise in die Region sollte die Zustimmung des georgischen Außenministeriums eingeholt werden. Das Gebiet Südossetien gehört völkerrechtlich zu Georgien, steht seit 1993 aber nicht mehr unter dem Einfluss der georgischen Regierung. Die Lage in Südossetien ist weiterhin prekär und unübersichtlich. Trotz der Bemühungen zur Umsetzung des Waffenstillstandes nach dem Krieg 2008 kommt es insbesondere in der Umgebung der Verwaltungsgrenzen von Südossetien noch zu bewaffneten Zwischenfällen. Es besteht in diesem Gebiet auch weiterhin eine erhöhte Gefahr durch Minen und nicht explodierte Munition, da es während des Krieges von Kampfhandlungen betroffen war. Auch Südossetien ist für den internationalen Reiseverkehr gesperrt. Eine legale Einund Ausreise in bzw. aus dem Gebiet heraus (Roki-Tunnel) ist über die russischgeorgische Grenze nicht möglich. Ein Grenzübertritt wird von den georgischen Behörden als illegaler Grenzübertritt behandelt. Bezüglich der möglichen Konsequenzen gilt das oben zu Abchasien Gesagte. 2. Sicherheit im übrigen Georgien Die Lage im übrigen Georgien ist insgesamt ruhig. Gegen die Nutzung der Hauptverbindungsstraße zwischen Ost und West (M 1), die relativ nahe an Südossetien vorbei führt, bestehen keine Bedenken. Ebenso gibt es keine Bedenken gegen die Nutzung der sogenannten „Alten Georgischen Heerstrasse“(M3), die ebenfalls nahe an Südossetien vorbei auch in das Skigebiet Gudauri führt. In der Vergangenheit vereinzelt erfolgte oder verhinderte Sprengstoffanschläge in Vororten von Tiflis gebieten besondere Vorsicht. Es wird insbesondere vor und nach den georgischen Parlamentswahlen am 1. Oktober 2012 empfohlen, Demonstrationen und Menschenansammlungen zu meiden. Georgien liegt in einer Region seismischer Aktivität. Ein Erdbeben in Tiflis forderte im Jahr 2002 fünf Todesopfer; ein Erdbeben ca. 150 km von Tiflis entfernt erreichte im Jahr 2009 den Wert 6,2 auf der Richter-Skala. Samstag, 11. Dezember 2010 Kilometer- und Höhenangaben Türkei Graphik hier herunterladen Nr Tag Tagesziel/Ort Höhe max. Zielort Tages Gesamt Höhe KmH Tageshöhenmeter über km am km NN Tag 62 Ipsala 10 54,51 3570,4 15,05 148 57 63 Develiyenice 110 76,85 3648,3 12,3 890 269 64 Tekirdag 2 49,21 3698,4 11,94 494 294 65 Selimpasa 2 75,26 3774,9 12,26 571 106 66 Istanbul 29 57,23 3833,1 12,48 552 199 67 Istanbul 29 0 68 Istanbul 29 0 69 Istanbul 29 0 70 Istanbul 29 0 71 Istanbul 29 0 72 Orhangazi 104 31,25 3864,3 11,4 350 342 73 Osmaneli 93 66,56 3931,9 12,6 353 369 74 Bilecik 516 40,94 3973,1 9,82 453 567 75 Bilecik 516 0 76 Milhangazi 240 73,18 4047,4 11,54 953 691 77 Kapikaya 179 26,3 241 78 Subasi 607 45,44 4117,1 8,58 1125 833 79 Cayirhan 658 66,22 4184,2 10,55 900 896 80 Baypazari 565 35,19 4219,9 10,2 306 742 81 Sincan 801 67,78 4288,9 10,65 863 1206 82 Cancaya 1113 44,71 4334,8 11,2 560 1155 83 Cancaya 0 84 Cancaya 0 85 Cancaya 0 86 Cancaya 0 87 Cancaya 0 88 ankara 0 4071 10,8 268 89 Yaglipinar 1081 44,09 4379,8 11,13 345 1166 90 Kurutlutepe 907 101,47 4483,2 16,98 623 1203 91 Aksaray 948 97,21 4582,2 15,12 123 965 92 Numunegocmen 1134 79,15 4662,8 14,28 353 1281 93 Pozanti 787 78,73 4743 15,71 494 1567 94 Gülek 984 37,91 4781,6 9,44 721 1424 95 Beyramil 121 34,7 986 96 Incirlik 32 84,79 4902,8 15,21 61 137 97 Osmanye 137 67,73 4971 14,37 137 127 98 Nurdagi 945 48,53 5019,8 9,59 939 973 99 Gaziantep 862 80,01 5100,4 11,89 874 1126 100 Birecik 381 64,39 5165,1 15,7 265 876 101 Sanli Urfa 535 84,24 5249,5 11,25 1047 817 102 Sanli Urfa 4816,9 16,43 158 0 103 Sanli Urfa 104 Tanyeli 596 84,96 5335,3 13,79 319 728 105 Kiziltepe 509 88,66 5424,5 14,58 249 610 106 Nusaybin 456 82,44 5507,4 13,71 91 530 107 Cizre 370 86,04 5594 670 13,44 309 1. Oktober Samothraki (griechisch Σαμοθράκη (f. sg) ‚thrakisches Samos‘, türk. Semadirek) – İpsala (griech. Κύψελα, Kypsela) 54,51 km, 3570,4 Gesamtkm Datum: 01. Okt.10 Tag: 62 TagesunterstützerIn: von: Kamriotissa m NN 10 nach: Ipsala m NN 10 km 54,51 Gesamt km 3524,2013 km/h: 15,05 Fahrzeit 03:37 gesamte Fahrzeit: 257:18:00 Anstieg in m pro h 40,92 Anstieg in m 148 Abfahrt in m: 148 höchster Punkt in m NN 57 Steigung/Gefälle 0,54 Die Fähre bringt uns wieder an Land. Dort starten wir nach einem mäßig gutem Essen in Richtung Türkei (amtlich Türkiye Cumhuriyeti (T.C.), deutsch Republik Türkei). Trotz des Gegenwindes kommen wir gut voran, es ist aber auch eine Strecke mit wenig Höhenmeterunterschieden. Wir müssen um das Delta der Mariza, auch Maritza geschrieben (bulg. Марица, griechisch Έβρος / Evros, lat. Hebrus, türk. Meriç Nehri) herumfahren. Am Ende landen wir wieder auf der Autobahn um die letzten Kilometer bis zur Grenze zu fahren. Wir haben kein Interesse an Experimenten inwieweit die kleine Straße am Ende dann doch zur Grenze führen würde. Sie hätte es getan, aber eine Weile auf einer gut asphaltierten, begradigten und durch einen Zaun gegen Hunde gesicherten Straße zu fahren ist durchaus wohltuend. Die Grenze ist ein Hochsicherheitstrakt. Wir durchqueren die griechische Grenze und müssen die Mariza, auch Maritza geschrieben (bulg. Марица, griechisch Έβρος / Evros, lat. Hebrus, türk. Meriç Nehri) überqueren. Mitten im Fluss ist die Grenze und wir kommen genau zur Wachablösung auf griechischer Seite. Dazu wird die Fahne ausgerollt. Auf beiden Seiten sind hohe Zäune. Beide Seiten sind bewaffnet bis an die Zähne. Auf türkischer Seite werden wir ausgesprochen freundlich empfangen und müssen dort durch weitere Kontrollen. Insgesamt ist der Grenzstreifen fast 3 km lang. Hinter der Grenze fällt uns als erstes auf, dass die Felder viel mehr Wasser haben und ganz viele Vögel zu hören sind. Wir beschließen in der nächsten Stadt in ein Hotel zu gehen, da es schon fast dunkel ist. Es ist ein etwas abenteuerliches Hotel und wir sind froh, dass wir eine eigene Ausrüstung mit Schlafsack und Handtüchern dabei haben, da beides nicht vorhanden ist. Es sind 230 km bis Istanbul [ˈˀi.stan.buːl] (türkisch İstanbul [isˈtɑnbul]), das ist eine überschaubare Länge. Bisher haben wir auf türkischer Seite noch keine Bunker gesehen, auf griechischer Seite waren sehr viele, wenn auch längst nicht so viele wie in Albanien, amtlich Republik Albanien (albanisch Shqipëri/Shqipëria oder Republika e Shqipërisë), da waren alle zwei Meter ein Bunker zu sehen.