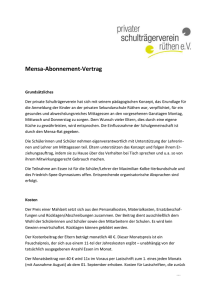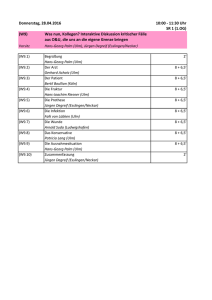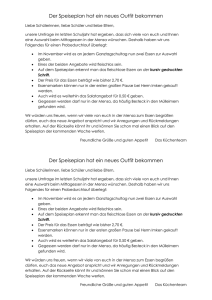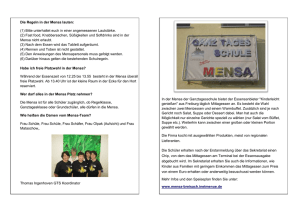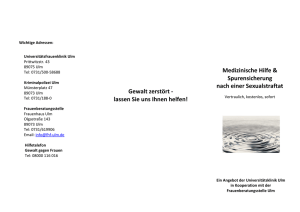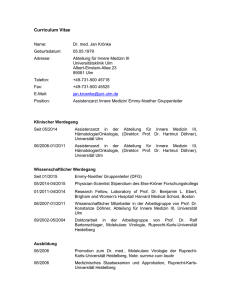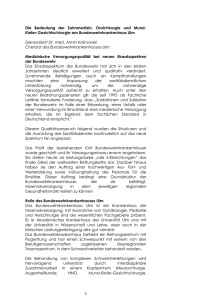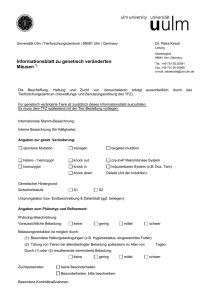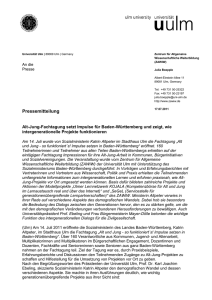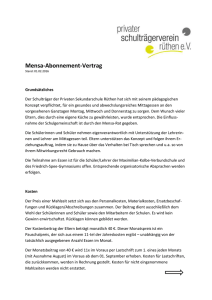Anekdoten - Studentenwerk Ulm
Werbung

Anekdoten aus alten Studentenwerkszeiten, aufgeschrieben vom ehemaligen Geschäftsführer des Studentenwerks Ulm 1974 - 2008 Dipl.-Ing. Günter Skrzeba „Die Rechtsaufsicht und nur die Rechtsaufsicht...“ ...wollte der AStA der Universität Ulm bei den Beratungen zur Gründung eines Studentenwerks Ulm in Studentenparlament und Senat dem Kultusministerium per Satzung zubilligen. Und so schien es das Kultusministerium auch zunächst zu akzeptieren. „Dann macht Euch Euren Dregg alleene!...(I)“ soll der sächsische König bei seiner Abdankung am 13. November 1918 erklärt haben. Daran dachten wohl die Studierendenvertreter, als das Kultusministerium diese Zusage wieder einkassierte, der Senat der Universität einen Vertreter der Ulmer FachhochschulStudierenden im Kuratorium ablehnte, stattdessen einen Vertreter der Universitätsgesellschaft vorsah und die Studenten daraufhin ihre Mitarbeit an der Satzung einstellten. Die Errichtungsverordnung des Ministeriums erging schließlich am 10. Mai 1972. „Dann macht Euch Euren Dregg alleene!...(II)“ dachten sich auch die gewählten Mitglieder von Vorstand und Kuratorium, als sie in einer gemeinsamen Sitzung „aus Protest gegen die Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden Studentenwerksgesetzes für Baden-Württemberg“ am 09. Dezember 1974 zurücktraten, nicht ohne vorher die noch laufende Probezeit des Geschäftsführers als für beendet zu erklären. Das Amts-Mitglied des Kuratoriums, der leitende Verwaltungsbeamte (Kanzler) der Universität erklärte seine Sympathie mit dem Rücktritt, konnte aber aus Rechtsgründen diesen Schritt selber nicht mittun. Ironie des Schicksals: 25 Jahre später, spielte derselbe, nunmehr als Referatsleiter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst tätig, bei der Novellierung des Studentenwerksgesetzes in die von ihm in Ulm noch bekämpfte Richtung, die Rolle eines Vorkämpfers. Hausverbot für den künftigen Hausherrn... Das Studentenwerksgesetz vom 04. Februar 1975 übergab die Verantwortung mit einer Übergangszeit zu Beginn des Wintersemesters 1975/76 am 01. September 1975 für alle staatlichen Fachhochschulen an die nun regionalisierten „Universitäts“-Studentenwerke. Die Pädagogische Hochschule folgte am 01. Januar 1976. Für die beiden zentralen Landesstudentenwerke der Fachhochschule beziehungsweise der Pädagogischen Hochschule war danach kein Raum mehr. Auf besonderen Wunsch eines Studierenden der Fachhochschule Ulm (jetzt Hochschule Ulm) besuchte ich im Sommersemester 1975 einmal die Mensa der Fachhochschule , um die seiner Meinung nach viel bessere Essenqualität persönlich zu erleben. Bei der Gelegenheit wechselte ich auch einige Worte mit dem Mensaleiter und wies auf die kommenden Veränderungen hin. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten: Es war ein geharnischtes Schreiben des Rektors der Fachhochschule samt Hausverbot für die Mensa. Al- lerdings erledigte sich das drei Monate später von selbst mit der Übernahme der Mensa durch das Studentenwerk. „Die rechte und die linke Hand...“ Bei der Übernahme der Fachhochschul-Mensen machten wir uns mit den uns vorgeschriebenen Berechnungsmethoden für die Essenpreise der Hochschulbediensteten keine Freunde. Das Ministerium hat durch Erlass vom 08. Juli 1971 bei den Bediensteten der Fachhochschulen nur einen Aufschlag von 1 DM auf die Studentenpreise verlangt. Uns hingegen wurde durch Erlass desselben Ministeriums vom 13. August 1971 vorgeschrieben, den Preis nach den Vorschriften für Betriebsverpflegung zu berechnen. Die „Begeisterung“ für unsere Preise ist durchaus nachvollziehbar und so hatten wir schnell das Etikett der unfähigen Verschwender weg. „Ein Stellvertretender Landtagspräsident verirrt sich...“ Mit dem Studentenwerksgesetz wurde 1975 auch das Ziel der Regionalisierung und klaren Aufgaben- und Verantwortungsabgrenzung verfolgt. Da war kein Raum mehr für die beiden existierenden zentralen Landesstudentenwerke für die Fachhochschule und für die Pädagogische Hochschule. Es sollte neben den dann neuen Studentenwerken bei den neun Unis keine weiteren mehr geben. Damit wollte sich ein Abgeordneter, Stellvertretender Landtagspräsident und Professor der schon sehr alten und etablierten Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd nicht abfinden und brachte den Abänderungsantrag für ein Studentenwerk Schwäbisch Gmünd ein. Von seiner Idee ließ er sich durch das Kultusministerium nur abbringen gegen die Zusage einer starken Zweigstelle am Ort. Daraufhin nahm er mit uns Kontakt auf, um seinen Besuch bei uns zu vereinbaren, und hatte auch schon einen passenden Zweigstellenleiter im Auge. Leider tauchte er zum vorgesehenen Termin bei uns nicht auf und war auch erst etwa zwei Stunden danach wieder im Landtag erreichbar. Mein besorgter Anruf über seinen Verbleib löste starken Groll bei ihm aus und den Vorwurf, nicht im Haus gewesen zu sein, als der Stellvertretender Landtagspräsident kam. Des Rätsels Lösung: Er hatte sich schlicht verlaufen und stand vor der richtigen Zimmernummer, aber im falschen Festpunkt. Danach fiel sein/unser Verhältnis zu uns natürlich unter den Nullpunkt. Später erfuhren wir im Kultusministerium, ihm sei nie eine örtliche Zweigstelle zugesagt worden. „Macht Euch doch nicht in die Hosen wegen Eurer Unkündbarkeit“... meinte „unser“ Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kunst auf einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsführer in Konstanz, als bei einer Prüfung durch den Rechnungshof die Auswirkungen der Organstellung der Geschäftsführer thematisiert wurden. Der Rechnungshof hatte u.a. neben einer Regelung für ein pauschales Jahresgehalt auch die Nichtanwendung von § 53 Abs. 3 BAT und damit die Abschaffung der Unkündbarkeit für die Geschäftsführer gefordert. Der Minister hatte dem 1987 im Landtag „unter Wahrung erworbener Rechte im Einzelfall“ zugestimmt. Als der Referatsleiter selbst allerdings 1988 zum Kaufmännischen Direktor des Universitätsklinikums Mannheim gewählt wurde, erreichte er, dass seine bis dahin als Beamter im Landesdienst erworbene beamtenrechtliche Unkündbarkeit unangetastet blieb. „Der Ulmer Exot...“ Anfang der 70er Jahre beschloss die Landesregierung im Hochschulgesamtplan II (HGPII) einen starken Ausbau der Hochschulen. Das galt auch für die Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd, die schon seit über 100 Jahren besteht und in einem älteren, nicht wirklich erweiterbaren Gebäude in der Innenstadt untergebracht war. Neben einer winzigen Cafeteria im Hochschulgebäude gab es auch eine total unzulängliche, immer überfüllte und eigentlich unzumutbare Mensa in einiger Entfernung im historischen „Prediger“. Dort war es so eng, dass z.B. auch die Fensterbretter als Sitzgelegenheiten genutzt wurden. Im Rahmen der Errichtung des neuen Stadtteils „Oberbettringen“ wurde deshalb vom staatliche Hochbauamt eine neue Hochschule samt Mensa (Kapazität: 2.400 Mittagessen) gebaut. Nur dumm, dass der komplette HGPII reduziert wurde, als die Mensa gerade im Rohbau stand und alle Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände bereits ausgeschrieben waren. Jetzt war nur noch von einer Kapazität von höchstens 1.200 Essen die Rede. Im Gast- und Lagerbereich konnten Flächen an die Pädagogische Hochschule und das Landesarchiv abgetreten werden, im Vorbereitungs-, Küchen- und Spülbereich war das leider nicht möglich. Dieser Bereich war flächenmäßig größer, als das gesamte Mensenprovisorium der Universität Ulm. Leider wurden keine kleineren Maschinen eingebaut, sondern nur jede zweite. (Die anderen lagerten jahrelang bei der „Leitbaudienststelle“ in Stuttgart-Vaihingen und mussten vorrangig bei Beschaffungsmaßnahmen berücksichtigt werden.) So kam es dazu, dass etwa für die eine, riesige Spülmaschine fünf Personen benötigt wurden. Auch die direkt unter Decke angebrachten Heizkörper in den Räumen trugen nicht gerade zur Wirtschaftlichkeit bei. Die Unwirtschaftlichkeit dieser Mensa war, auch wegen der wenigen hundert Esser täglich, geradezu sprichwörtlich. Bei einem Gespräch der Geschäftsführer im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit Minister Engler und Abgeordneten nahm neben mir ein freundlicher Herr Platz, der sich als Vorsitzender des Finanzausschusses vorstellte. Als er meine Funktion erfuhr, reagierte er spontan mit dem Spruch: „Ach Sie sind der Ulmer Exot mit seiner teuren Mensa in Schwäbisch Gmünd.“ „Kostenlose Sauna für den ganzen Stadtteil?...“ Der neue Stadtteil „Oberbettringen“ in Schwäbisch Gmünd wurde von einem einzigen Generalunternehmer errichtet. Das hatte sicherlich Vorteile, aber auch mindestens einen Nachteil. Plötzlich stellten wir dort eine erhöhte Nachfrage in der damaligen Sauna des frisch errichteten Studentenwohnhauses durch Personen fest, die ihre Studienzeit eigentlich schon längst hinter sich haben müssten. Das Rätsel lösten wir nach einiger Zeit mithilfe des Schlüssels unserer gegenüber dem Wohnheim wohnenden Mensa-Leiterin. Der passte nämlich auch in der Haustür des Wohnheims. Das durfte doch wohl nicht wahr sein. Nun brauchten wir nur noch einen Sachverständigen, der uns den Fehler in der Schließanlage bestätigte. Als wir dann endlich einen gefunden hatten, stellte der fest, dass zwar die Toleranzen eingehalten worden waren, aber dass die Summe aller Toleranzen sich nur in eine Richtung addierte. Dieses Ergebnis machte den Hersteller nicht gerade gewogen, die offensichtlich fehlerhafte Schließanlage im Wohnheim kostenlos auszutauschen. Wir konnten ihn aber dann doch noch überzeugen, nachdem wir ihm mitgeteilt hatten, dass wir das Thema unter Nennung aller Einzelheiten auf der nächsten Wohnheimtagung des Deutschen Studentenwerks diskutieren wollten. Schließlich bekamen wir kostenlos eine neue, sehr moderne Schließanlage, die unser Hausmeister austauschte – und alle waren zufrieden, außer vielleicht den Nassauern, also den fremden Saunierern. „Passt, wackelt und hat Luft...“ Das Studentenwohnhaus in Schwäbisch Gmünd haben wir beim Übergang der Zuständigkeiten auf uns vom Studentenwerk Stuttgart „geerbt“. Der Bau war begonnen worden vom Pädagogischen Hochschul-Studentenwerk, ging treuhänderisch auf den Rektor der Pädagogischen Hochschule über, gelangte zum Stuttgarter Studentenwerk und dann zum Studentenwerk Stuttgart. Es ist ein Hochhaus mit 13 Stockwerken und 278 Zimmern. Die Außenverkleidung bilden große Eternitplatten. Es steht über der Stadt und ragt weit über die Umgebung hinaus. Nach rund 20 Jahren hatte es der Wind geschafft: Eine Platte lockerte sich und fiel herunter – zum Glück ohne Personenschaden. Die Kontrolle durch einen Bausachverständigen ergab, dass das angewendete Befestigungssystem Bohrung, Dübel, Schraube zu viel Spiel hat. Danach wurde die Außenverkleidung regelmäßig überprüft und mittlerweile im Rahmen einer Sanierung ersetzt. Ach so, die Baufirma existiert nicht mehr. „Zu kurze Leiter bei der Feuerwehr...“ Obwohl die Feuerwehr unseres Wissens die Baupläne vor dem Bau geprüft hat, erhielten wir nach vielen Jahren die Mitteilung, dass man keine Leiter habe, die bis in die obersten Stockwerke reicht. Man empfahl, diese Stockwerke nicht mehr zu belegen. Na ja. „RAF-Schlupfwinkel Studentenwohnhaus Schwäbisch Gmünd?...“ Zu Hoch-Zeiten der RAF fand irgendjemand es wohl „cool“ anonym bei der Polizei anzurufen und zu melden, im Studentenwohnhaus seien RAF-Angehörige „untergetaucht“. Das führte spät nachts zu einer Durchsuchung durch die Bereitschaftspolizei Göppingen. Gefunden wurde natürlich nichts und Niemand, aber es war eine große Unruhe erzeugt worden. War vielleicht genau das die Absicht des Informanten? „Kein Anschluss unter dieser Nummer?...“ Bevor das Handy Allgemeingut wurde, war das Telefonieren drahtgebunden und teuer. Um keiner Anfechtung Vorschub zu leisten, hatten wir deshalb z.B. im Wohnhaus der ehemaligen Hochschule der Gestaltung in Ulm, das 20 Jahre vom Studentenwerk betrieben wurde, nur einen „halbamtsberechtigten“ Anschluss an die Telefonzentrale der Universität Ulm. Man konnte also nur hinein telefonieren, aber nicht hinaus wählen - so dachten wir jedenfalls. Eines Tages erhielten wir jedoch zwei saftige Telefonrechnungen für handvermittelte Auslandsgespräche mit Voranmeldung nach Südamerika auf diesen Apparat. Des Rätsels Lösung? Das Gespräch wurde von der Telefonzelle vor dem Haus auf diesen Apparat angemeldet. Da beide angerufenen Rufnummern identisch waren, und einmal der richtige Name des Auftragsgebers angegeben war, konnte der Übeltäter ermittelt und zur Kasse gebeten werden. Cleverer waren da schon die Studierenden im Wohnheim Gutenbergstraße, denn sie wurden nie erwischt. Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, hatten wir dort von der Telekom Telefonzellen mit Münzfernsprechern aufstellen lassen. Dieser Service war für uns kostenlos, wir mussten nur für einen bestimmten Monatsumsatz einstehen, bzw. auf diesen ausgleichen. Das funktionierte längere Zeit wunderbar, bis auf einmal die Einnahmen hinter den vertelefonierten Einheiten zurück blieben. Alle Prüfungen seitens der Telekom erbrachten kein Ergebnis. Alles schien in technisch in Ordnung zu sein. Schließlich löste sich das Rätsel doch noch: Bei den Geräten lag der eingeworfene Münzvorrat auf einer schiefen Ebene und war durch ein Sichtfenster einsehbar. Die Münzen fielen nacheinander durch eine sich öffnende Klappe in den Kassenbehälter. Ganz am unteren Ende des Sichtfensters war ein winziges, mit bloßem Auge kaum sichtbares Loch angebracht worden, nur so groß, dass eine Ministecknadel durchgeschoben werden konnte, die bei sich öffnender Klappe die Münze zwar daran hinderte in die Kasse zu fallen, aber trotzdem den Zahlimpuls auslöst. Daraufhin wurde das Sichtfenster durch einen Streifen aus gehärtetem Spezialstahl ersetzt. Nun mussten alle Gespräche wieder bezahlt werden – die Telefonzellen verloren an Attraktivität, bis wir sie schließlich ganz aufgaben. „Sodom und Gomorrha im ‚Farbkasten’?...“ Als der Bau des Wohnhauses in der Gutenbergstraße ab 1974 mit rund 300 Zimmern begonnen hatte, diskutierte man längere Zeit in der Lokalzeitung über die Farben des Außenanstrichs (weiß und gelb), was manche scheußlich fanden. Andere regten sich aber noch mehr darüber auf, dass dort „Männchen und Weibchen“ ohne Kontrolle auf demselben Flur leben würden. „Eine baden-württembergische Einrichtung in Bayern, das geht nicht...“ Bereits im Jahre 1979 wurde klar, dass es für uns im Unigebäude keine weiteren Räume geben würde und dass wir bis zum Bezug eines noch zu errichtenden Mensa/Verwaltungsgebäudes irgendwo anders unterkommen mussten. Unter Einbeziehung aller möglichen staatlichen, kommunalen und privaten Stellen machten wir uns also auf die Suche. Der Leiter der Abteilung Wohnen wurde auch bald fündig – in Neu-Ulm, jenseits der Donau und damit in Bayern. Wegen der üblichen Bezuschussung der Miete durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mussten wir mit ihm über das neue Domizil sprechen. Eigentlich passte alles so weit und wurde auch akzeptiert, bis wir sagten, dass es in Bayern liegt. Da war es aus mit der Zustimmung. Wir kamen dann in der Neuen Straße in Ulm unter, etwas teurer zwar, aber immerhin im Ländle. Vielleicht wollte das Ministerium ja auch nur mögliche Konflikte mit dem Freistaat vermeiden, wenn wir wichtige Dokumente auf dessen Territorium mit dem kleinen badenwürttembergischen Landessiegel siegelten. Das Siegel mit dem kleinen Landeswappen Das Studentenwerk Ulm war seit dem Tag seiner Errichtung eine „rechtsfähige landesunmittelbare Anstalt des Landes Baden-Württemberg mit dem Recht der Selbstverwaltung“. Als ich 1974 nach Ulm kam, gab es zwar einen stinknormalen Absenderstempel, aber kein Landessiegel. Das empfand nicht nur ich als einen Mangel, sondern auch die UniVerwaltung. Also „bastelte“ ich gemeinsam mit einem Beamten aus einem Universitätssiegel eine Vorlage für ein korrektes Siegel mit dem „kleinen Landeswappen“ und beauftragte einen zugelassenen Stempelhersteller in Stuttgart mit der Herstellung. Nach kurzer Zeit kam das Siegel und wurde fortan auch angemessen verwendet. Nun wussten wir in Ulm nicht, dass der Stempelhersteller von jedem Siegel einen Musterabdruck an das Staatsarchiv nach Karlsruhe schicken muss, welches dann dessen Rechtmäßigkeit prüft. Mit einigen Jahren Verzögerung kam es, wie es kommen musste: Das Staatsarchiv fragte beim Kultusministerium nach eben dieser Rechtmäßigkeit. Und die wiederum war bei einer Einrichtung wie der unsrigen von der Zustimmung des Ministerpräsidenten durch Rechtsverordnung abhängig. Also „verordnete“ das Ministerium uns sofort ein Verbot jeder weiteren Benutzung. Einige Zeit später wurde dann allerdings jedem Studentenwerk im Lande das „kleine Landessiegel“ zugebilligt. Damit war auch unser Gebrauch nun legitimiert. „Wetten, dass? – auf schwäbisch...“ Die Unterbringung der BAföG-Abteilung war schon immer problematisch. Einerseits sollte sie möglichst „kundennah“ sein, andererseits brauchte sie wegen der vertraulichen finanziellen Daten der Studierenden mehr Bürofläche als andere Bereiche. Ursprünglich war sie im „Grünen Hof“ untergebracht, dem Verwaltungsgebäude der Universität im Zentrum von Ulm. Dann kam sie provisorisch ins Unigebäude, zog mit uns 1980 „vorübergehend“ in die Ulmer Innenstadt um - und blieb dort am längsten. Bei Planung und Bau der Mensa konnten wegen des „eingefrorenen“ Budgets für sie keine zusätzlichen Flächen eingeplant werden. Auch die Universität sah sich außerstande, Flächen bereitzustellen. Das ließ den damaligen Leiter des Unibauamts nicht ruhen und er wettete während einer „Klinikroutine“ (Besprechung) im Kultusministerium mit dem Kanzler, dass die BAföG-Abteilung in der Universität untergebracht werden könne, ohne dass dafür Flächen hergeben werden müssten. Das Ergebnis kann man noch heute „bewundern“: Dafür wurde einfach der Ruhe- und Erholungsbereich für die Studierenden im Forum (bei O25 neben dem Mensaeingang), mit einem inneren Stockwerk auf Metallstelzen überbaut – und fertig. Na ja, ganz so einfach war es nicht. Zunächst musste der dort besonders dicke Betonboden um ca. 30 cm abgetragen werden. Dann mussten die Stelzen konstruiert, geprüft und zugelassen werden. Und schließlich wurde ein Stockwerk in Leichtbauweise auf einem Holzboden darüber gesetzt. Ein paar Limitationen gibt es natürlich auch. So sind die Räume recht niedrig, die Aktenschränke dürfen nur an bestimmten Stellen stehen und eine relativ geringe Fußbodenlast darf nicht überschritten werden. Auch die Zugangstreppe ist für Rollstuhlfahrer und bestimmte Behinderte unüberwindlich. Deshalb wurde für diese direkt darunter ein ebenerdiger Raum mit Rollstuhlrampe geschaffen. Und so zog die BAföG-Abteilung nach Fertigstellung in die neuen Räume um. Damit hatte der Bauamtschef die Wette gewonnen! Allerdings war die Fläche nicht erweiterbar und daher musste die Abteilung wegen der stark gestiegenen Studierenden- und Fallzahlen nach einigen Jahren wieder heraus aus der Universität, wieder hinein in die Stadt, nun aber in ein ehemaliges Polizeigebäude in der Karlstraße. Wie lange noch? Wer weiß...In die bisherigen Räume zog jedenfalls die Wohnhausverwaltung ein. „Eine Kinderkrippe? Natürlich, aber wohin damit?...“ Sehr schnell war allen Beteiligten klar, eine Kinderkrippe für studentische Kinder von 0 bis 3 Jahren, also unterhalb des Kindergartenalters wurde gebraucht, damit studierende Mütter sobald als möglich nach der Niederkunft wieder studieren können. Dafür war natürlich auf dem Universitätsgelände einen Bauplatz samt Gelände für die Außenanlagen notwendig. Den zu finden war gar nicht so einfach, denn bei aller Begeisterung für die Kinderkrippe durfte diese natürlich den weiteren Ausbau der Universität nicht behindern. Es durften für diese auch weder Bäume gefällt werden, noch sollte sie zu abgelegen sein. „Leerstellen“ auf den Geländeplänen waren meist nicht wirklich leer, sondern wurden für irgendwelche Ausbauten vorgehalten. Nach längerem Suchen fand man endlich einen geeigneten Platz in der Albert-EinsteinAllee. Das Unibauamt plante für uns in Amtshilfe den Bau und alles ging seinen Gang. Wirklich? Zum Glück wohnte damals der Chef des Bauamts im Amt und machte oft ausgedehnte Spaziergänge über das Gelände. Dabei fiel ihm eines Tages auf, dass dort, wo er die künftige Kinderkrippe vermutete, plötzlich eine Baustelle eingerichtet wurde. Erstaunt ging er der Sache nach, und stellte fest, dass der Platz zum Teil mit Baumaterialien für die unterirdischen AWT-Anlage ([Unterirdische] Automatische Wagentransport-Anlage zwischen dem Versorgungszentrum Medizin [VZM] und den Kliniken) belegt war. Es ist nicht überliefert, wie er das im Amt geregelt bekam, aber der Bau der Kinderkrippe erfolgte danach planmäßig. Irgendwann kurz vor der Fertigstellung ging der Bauunternehmer zwar in die Insolvenz, aber dank der abgesicherten Verträge des Bauamts wurde das Gebäude ohne Einbußen oder Verluste für das Studentenwerk planmäßig errichtet. Und so erfreut sich die Kinderkrippe dort nun schon seit 25 Jahren großer Nachfrage und Beliebtheit. „Geheimnisvolle Prüfungsergebnisse des Rechnungshofs (LRH)?“... Natürlich wussten wir, dass es einen Landesrechnungshof in Karlsruhe gibt, kannten auch aus den Erzählungen der Kollegen wahre Horrorgeschichten über ihn, hielten diese aber für maßlos übertrieben. Denn uns schien der Landesrechnungshof überhaupt nicht zu kennen. Dann erfuhren wir so nach 1980 gerüchtweise von irgendwelchen Prüfungen auch in Ulm und – natürlich – von gravierenden Beanstandungen. Da sich die Sticheleien der Universitätsbediensteten häuften, ohne dass wir Näheres erfuhren, schrieb ich den Landesrechnungshof an und bat um eine Erklärung. Die Antwort haute mich um, denn wir erfuhren, die Universität sei als Bewilligungsbehörde des Studentenwerks geprüft worden und „dass die Universität dem Studentenwerk sicher die dieses betreffenden Teile des Prüfungsberichts überlassen“ würde. Daraufhin forderten wir den Bericht offiziell bei der Universität an und erhielten ihn. Zu unserer großen Erleichterung beschäftigte er sich fast ausschließlich mit Vorkommnissen vor dem 1. Januar 1973, also mit der Zeit, als die Universität sozusagen noch in vorauseilender Amtshilfe Tätigkeiten einen Studentenwerks ausführte, da das Studentenwerk erst nach diesem Termin seine Arbeit unter eigenem Namen aufnahm. Nach einiger Zeit verlangte dann die Innenrevision der Universität von uns Stellungnahmen zu Maßnahmen, die dieselben Universitätsbeamten höchst selbst in ihrer damaligen Funktion in der Wirtschaftsabteilung der Universität als „Ersatz-Studentenwerker“ getan oder gelassen hatten. Damit kamen die bei uns natürlich nicht weit. Und so schlief das Ganze irgendwann irgendwie ziemlich schnell wieder ein. „Bibliothek mit Essenausgabe oder Mensa mit Buchausleihe?...“ Getreu dem Motto, dass auch Rom nicht an einem einzigen Tag erbaut worden ist, sollte die Mensa in der „Baustufe C“ errichtet werden. Das schien zwar gut gemeint zu sein, war aber wirklich nicht sachgerecht. Schließlich gab es Studierende und Hochschulpersonal und damit auch eine Nachfrage – zumal es nirgendwo auf dem Universitätsgelände irgendeine Möglichkeit der anderweitigen Versorgung gab als in den vorhandenen Provisorien. Sonst musste man in die Stadt hinunter fahren, mindestens aber nach Ulm-Lehr. Mal abgesehen von der Baukantine, die aber zum Abschluss der Bauarbeiten der „Baustufe B“ geschlossen wurde. Die Universitätsbibliothek war damals provisorisch im Gebäude des ehemaligen Klosters in Ulm-Wiblingen untergebracht. Das war natürlich auf Dauer nicht tragbar – und das nicht nur aus Gründen der Logistik. Auch die Bibliothek sollte in der „Baustufe C“ errichtet werden. Kluge Menschen im Unibauamt kamen auf den Gedanken, beide Bauvorhaben miteinander zu verbinden und so Synergie-Effekte auszunutzen. Eine erste Planung im Bereich Nord der Universität erbrachte keine günstige Lösung. Eine zweite Planung im Bereich der Universität Süd erschien erfolgreicher und war schon ziemlich weit gediehen, da meldete sich plötzlich der Landesrechnungshof. Er hatte die kurz vorher neu errichtete Mensa für die Universität Konstanz geprüft. Aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden die Ulmer Pläne angefordert. Dies bedeutete im Ergebnis das Aus für deren Realisierung... „Die Mensa: Auf dem Berg und über dem ‚Täle’...“ Bei der Untersuchung des Baugrunds für die vorgesehene Universität Ulm auf dem Oberen Eselsberg wurde im Süden des Geländes ein Bereich namens „Täle“ gefunden, ein Geländeeinschnitt, heute noch südlich der heutigen Bushaltestelle Universität Süd Richtung Stadt zu erkennen. Auf diesem Baugrund sollte wegen der Verwerfungen und Instabilitäten unter der Oberfläche nach Möglichkeit niemals bebaut werden. Und warum steht die Mensa jetzt auf dem „Täle“? Nach Aufgabe der Absicht, die Mensa in Kombination mit der Universitätsbibliothek zu errichten, wurden die Planungen für eine eigene Mensa im Bereich Süd, vor der „Baustufe A“ vorangetrieben und ein Wettbewerb ausgeschrieben. Der Wettbewerb wurde ausgeschrieben, weil sich die Ulmer Architektengruppe beim Staatssekretär im Finanzministerium (FM) darüber beklagt hatte, noch niemals Aufträge für die Universität erhalten zu haben. Auch die Auswertung dieser Ausschreibung ergab nichts Neues für die Ulmer, die mit ihren Vorschlägen auf den hinteren Plätzen landeten. In die Endauswahl kamen vielmehr zwei Vorschläge von auswärtigen Architektenteams. Der eine Vorschlag beinhaltete einen auf Stelzen stehenden Kubus, direkt an die Universität gesetzt. Der andere Vorschlag war nach Art einer Torte aus einzelnen Stücken zusammengesetzt und vor die Universität gebaut, mit dieser durch einen überdachten Gang verbunden. Der erste Vorschlag hatte den besseren Standort, dafür gefiel uns der zweite optisch besser. Uns war natürlich klar, dass bei den knappen Mitteln als erstes der überdachte Gang gestrichen würde. Die Auswirkungen wären für den Betrieb eine Katastrophe. Staatliche Mittel waren zwar immer knapp, aber in diesem Fall kam hinzu dass diese Baumittel aus dem Mensen-Sonderprogramm zu Ende der siebziger Jahre stammten, das eigentlich schon längst ausgelaufen war und nicht fortgeschrieben, also der Teuerung angepasst werden konnte. Glücklicherweise fand die Endauswahl bei einer Sitzung mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vor Ort an einem 15. Januar bei typischem Ulmer Winterwetter mit starken Wind, Schnee und Glatteis statt, so dass auf die Frage der Ministerialbeamten nach dem Grund für einen direkten „Anbau“ der Mensa an die Universität nur aus dem Fenster gedeutet werden musste. Die Entscheidung fiel dann auch wunschgemäß aus. Bei der Feinplanung kam das Unibauamt auf den Gedanken, der Anlieferhof für die Mensa könnte auf einen „Wendehammer“ verkleinert werden, wenn die Lagerflächen anderswo angelegt wären und Waren dort angeliefert würden. Ein weiterer Vorteil wäre die Verringerung der Lagerfläche. Dazu müsste eigentlich nur die Lagerfläche im Versorgungszentrum Medizin (VZM) vergrößert, die Mensa an die AWT-Anlage angeschlossen und der Bau einen bestimmten Standort bekommen. Man ahnt es schon. Das alles ging ziemlich schief: Der Anschluss an die AWT-Anlage bedingte eine Verlagerung des Gebäudes, und zwar direkt auf das „Täle“. Die Planungsstelle für medizinische Universitätsbauten in Freiburg (PMU) vermochte leider die Notwendigkeit einer vergrößerten Lagerfläche zugunsten unserer Mensa nicht zu erkennen. Bis auf einige Testfahrten kamen niemals Waren in unserem AWT-Haltepunkt an. Allerdings konnten einzelne Teile dieses Haltepunktes als Ersatzteile verwendet werden. Wegen der Lage auf dem „Täle“ konnte das Mensagebäude nicht fest mit dem Universitätsgebäude verbunden werden. Es erhielt stattdessen eine elastische Verbindung zum Universitätsgebäude. Die langsame Verbreiterung dieser elastischen Verbindung kann man beobachten. Überdies erhielt die Mensa eine erdbebenfeste Bodenplatte und aus Stabilitätsgründen ein besonders hohes Untergeschoss. Der unsinnige Absicht, die Nutzung dieser Flächen technisch zu verhindern wurde zum Glück fallen gelassen, denn wir haben sowie schon viel zu wenig Lagerflächen. „Lager für brennbare/gefährliche Flüssigkeiten in der Mensa?...“ Mit dem projektierten Anschluss der Mensa an die AWT-Anlage sah das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine gute Möglichkeit, dort auch ein Lager für diese bedenklichen Flüssigkeiten einzurichten. Das konnte durch mein Monitum verhindert werden, dass ich als Chemiker die Verantwortung dafür ablehne und gleichzeitig die wörtliche Protokollierung dieses Einspruchs forderte. Den Lagerraum erhielt die Universität aber später dennoch – allerdings nur für ungefährliche Lehrzwecke. „Kein Raum für den Alarm-Raum...“ Auch im Mensabereich ging es recht eng und knapp zu. So konnten wir es uns nicht leisten, den als Alarmzentrale mit allerlei Elektronik bestückten Raum direkt vor der Anlieferrampe zu „vergeuden“. Wir benötigten einfach einen kleinen Raum für die Warenannahme durch den Lagerverwalter. Unmittelbar an die Rampe schloss seitwärts ein breiter Durchgang im Niveau 1 der Universität an. Als wir darum baten, davon ca. 3 – 4 qm für unseren Lagerverwalter zu erhalten, wurde das abgelehnt und mit Sicherheitsbedenken und Notausgangregeln begründet. „Da kann man nichts machen“, dachten wir und hatten Verständnis, bis - ja bis dann plötzlich ein rund 40 qm großer Raum für die Lehre abgetrennt wurde. Wie wir doch noch zu dem Raum für unseren Lagerverwalter kamen? Wir hängten die Elektronik des Alarmraums hinter der ersten verschließbaren Tür der Rampe auf. Und da hängt sie immer noch. „Frustration statt Konversion bei den Stadtvätern?...“ Nach Ende des Kalten Krieges und dem daraus folgenden Abzug amerikanischer Soldaten aus Baden-Württemberg wurden viele Militäreinrichtungen überflüssig, darunter auch zahlreiche Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte. Diese wurden vom Bund, dem Eigentümer, in erster Linie den Ländern, den Kommunen und vereinzelt auch den Studentenwerken zum Kauf mit anschließender gemeinnütziger Verwendung angeboten. Leider geschah das in unserem Bereich nicht in Ulm, wo wir dringenden Wohnungsbedarf hatten, sondern nur in Schwäbisch Gmünd, wo die Lage auf dem Wohnungsmarkt ungleich entspannter war. Dort lag allerdings eine Kaserne direkt hinter dem Zaun des Parkplatzes der Pädagogischen Hochschule und damit in einmalig günstiger Lage. Der Leiter unserer Wohnungsabteilung schaute sich die angebotenen Gemeinschaftsunterkünfte ziemlich genau an. Wir wollten unbedingt vermeiden, dass es uns wie einem anderen Studentenwerk im Land erging, wo es weder Baupläne noch statische Berechnungen gab, bei den vorausgegangenen Renovierungen geschlampt worden war und die Flure wegen der Notwendigkeit für die Soldaten, dort feldmarschmäßig nebeneinander hergehen zu müssen, viel zu breit und damit für studentische Wohnzwecke ziemlich nutzlos waren. Letzteres traf auch auf die Unterkünfte in Schwäbisch Gmünd zu, wo auch noch jedes einzelne Maß im ZollSystem (in Inch also) und die absolute Ausrichtung auf US-Sicherheitsvorschriften hinzukam. Bei der geschilderten örtlichen Wohnungslage verhielten wir uns daher sehr zurückhaltend. Daraufhin wurden wir zum Plenum des Gemeinderats ein- nein eher vorgeladen. Wir merkten bald, dort herrscht Ordnung und jeder beantragt zunächst das Wort beim Oberbürgermeister, bevor er einen Laut von sich gibt. Trotz aller Bedrängungen, Versprechungen und sonstigem Druck blieben wir standhaft beim „Nein“. Schließlich verabschiedete uns der Oberbürgermeister mit den Worten: „Sie hören noch von mir“. Was aber nicht geschah. „Die Mensa in Schwäbisch Gmünd und die ‚Schullastenvermischung’...“ Da hatten wir also bei der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd eine neue Mensa mit allen Schikanen. Was fehlte, waren Studierende und Bedienstete in ausreichender Zahl. Die Versorgung der Studierenden der damaligen ziemlich kleinen Fachhochschule für Design am Ort durch uns machte den Kohl auch nicht so recht fett. Fast gegenüber der Mensa, also auch im neuen Stadtteil Oberbettringen gelegen, da erwuchs uns eine starke Nachfrage. Dort hatte nämlich der Ostalbkreis ein berufliches Schulzentrum mit einigen Tausend Schülern neu errichtet – jedoch ohne Verpflegungseinrichtungen. Lag es da nicht nahe, dass diese Schüler in unserer Mensa...? So dachten wir, die Leitung der Pädagogischen Hochschule, die Schüler, die Öffentlichkeit, die Lokalzeitungen, der Kreistag des Ostalbkreises usw. Nur das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) dachte anders. Es fürchte die sogenannte „Schullastenvermischung“ wie der Teufel das Weihwasser und lehnte die Zulassung der Schüler ganz einfach ab. Da half zunächst auch keine Resolution im Kreistag in der das MWK aufgefordert wurde das angeblich unwillige Studentenwerk anzuweisen, endlich die Schüler zum Essen zuzulassen. Die Schüler kamen trotzdem, wenn auch inoffiziell und ließen sich öfters von Studierenden das Essen zu deren Preis von der Theke mitbringen. Also mussten wir die Studentenausweise kontrollieren. Dasselbe war auch beim Bierverkauf nötig, da nicht alle über 18 Jahre alt waren. Geraucht wurde zum Glück außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Das mit dem Essen konnte aber unmöglich so weitergehen. Und so mischten sich gegen Ende des Jahres die Studierenden der Pädagogischen Hochschule ein, streikten für die Zulassung der Schüler und versorgten sich kurzzeitig selbst. Nach einem Fernsehbeitrag drehte die Stimmung im MWK. Es wurde in kurzer Zeit eine Kabinettsvorlage erstellt, in der die allgemeinen Bedingungen für die Zulassung von Schülern aller Schulgattungen zum Essen in den Mensen der Studentenwerke festgelegt wurden. Nun gab es noch Probleme mit einem gerechten Preis für die Schüler. Wir wollten diesen am Studentenpreis mit einem geringen Aufschlag (nach einer Grenzkostenrechnung) festlegen, wurden jedoch genötigt, einen „deutlich höheren Preis für das Schüleressen“ zu errechnen. Dabei sollte eine zusätzliche Küchenkraft nur für die Schüleressen mit eingerechnet aber nicht eingestellt werden. Das scheiterte aber an den bekannten, tatsächlichen Verhältnissen. Und so erhielten wir schließlich doch einigermaßen freie Hand beim Schülerpreis. Wieso die Umsetzung des Kabinettsbeschlusses in einen Erlass und dessen Zusendung dann noch über drei Wochen dauerte, während die Schüler immer noch ausgeschlossen waren und dagegen protestierten, das konnte sich auch im MWK niemand erklären... „600 Koteletts – unbezahlbar?..“ in den ersten Jahren des selbst kochenden Provisoriums war natürlich die Nachfrage nach Essen relativ gering. Entsprechend klein fielen die Bestellungen aus. Lebensmittel wurden grundsätzlich in Ulm gekauft. Als dann die Universität eine Tagung ausrichtete, deren Teilnehmer wir versorgen sollten und für die wir bei unserem ortsansässigen Metzger Fleisch bestellten, fühlte der sich genötigt, wohl in Sorge um seine Einnahmen, bei uns anzurufen und zu zweifeln: „Jungens, Ihr habt da 600 Koteletts bestellt, könnt Ihr die überhaupt bezahlen“? Konnten und taten wir natürlich auch, aber danach hatte der Metzger prompt einen verlässlichen Abnehmer weniger. „Das ‚Konto Hunderttausend’...“ Seit der Inbetriebnahme der Universitätsbauten auf dem Oberen Eselsberg gab es natürlich einen Bedarf an Speisen und Getränken auch außerhalb der Öffnungszeiten des Buffets im Provisorium. Am besten, da war man sich einig, wären doch Automaten für Kalte Speisen, Kaffee, Schokolade, Tee, alkoholfreie Getränke und Bier sowie Geldwechsler. Aber wie finanzieren, denn Geld für die Investitionen hatte die Universität nicht? Vom Kultusministerium war nichts zu erwarten und Sponsoren gab es auch nicht. Nach einigem Überlegen setzte man sich mit einer örtlichen Brauerei in Verbindung. Das Ergebnis der Verhandlungen war das Konto 100.000, aus dem die Automaten, Wechsler und Reparaturen bezahlt werden konnten. Die Gegenleistung? Die Universität musste sich verpflichten für den Bedarf auf dem Oberen Eselsberg ausschließlich Softdrinks der Brauerei sowie natürlich deren Bier zu den „allgemeinen“ Preisen einzukaufen. Die vereinbarte Abnahmemenge sah auf den ersten Blick ganz harmlos aus: 6.000 Hektoliter Bier. Das waren aber immerhin 1,2 Millionen Halbliterflaschen. Bei der Menge hatte sich die Brauerei am Umsatz bei einem Ulmer LKW-Hersteller orientiert und diesen stark nach unten abgerundet. Aber natürlich war der wirkliche Umsatz völlig enttäuschend, denn tagsüber wurde kaum Bier getrunken und abends waren die Studenten eher in der Stadt als auf dem Berg. Außerdem war der „allgemeine“ Preis recht hoch und nicht konkurrenzfähig. Schließlich „erbte“ das Studentenwerk diesen Liefervertrag ohne wirkliche Aussicht, die Abnahmemenge jemals voll erfüllen zu können. Aber irgendwann ging die Brauerei in die Insolvenz – und damit endete auch das Abenteuer „Konto Hunderttausend“. „Preisfrage: Das beliebteste Urlaubsland der Studierenden ist?...“ Das war immer sehr deutlich aus der Menge an falschen Münzen in den Automaten und Geldwechslern nach den Semesterferien zu ersehen. Dann waren dort nämlich gehäuft Münzen aus aller Herren Länder zu finden. Nur leider war der reale Wert dieser Münzen meist geringer als die Münze, die sie dem automatischen Münzprüfer vorspiegelten. Mit Einführung des Euro sank die Zahl dieser Münzen kurzzeitig, doch nun kamen sie von weiter her und manchmal waren es so viele, dass einzelne Münzsorten zeitweise vollständig gesperrt werden mussten. „Wie lange bleiben Sie noch?...“ ...fragte der Chef des Technischen Betriebsamts (TBA) der Universität, in deutlicher Anspielung auf die kurze Amtszeit meines Vorgängers, als es einmal wieder in einer Sitzung im Unibauamt zu Planung und Bau der Mensa hoch her ging. Im Kreis der vielen Teilneh- mern aus der Universität und dem Unibauamt musste man als Einzelkämpfer die Interessen des Studentenwerks schon ziemlich offensiv vertreten, wenn man ernst genommen werden wollte. Aber nach einiger Zeit hatte man sich aneinander gewöhnt, vertraute sich gegenseitig und kam eigentlich immer recht gut miteinander aus. Das galt auch für den erwähnten Beamten, der bedauerlicherweise das Pensionsalter nicht erreichte. „Klüger als die Henne (mit den goldenen Eiern)? Leider nicht!...“ Obwohl die Universitäten nach den geltenden Bestimmungen jahrelang für die Studentenwerke die Funktion der Bewilligungsbehörde nach der Landeshaushaltsordnung (LHO) hatten, spielte die Musik natürlich im Stuttgarter Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK). Die Universitäten fungierten offensichtlich nur als Puffer, denn zu entscheiden gab es in Haushaltsfragen vor Ort so gut wie nichts und auch die Kommunikation von unten nach oben und in Gegenrichtung lief direkt. Das passte den Universitäten ganz und gar nicht und so schafften sie es nach langem Kampf, dieses Verfahren abzuschaffen. Das Ministerium fungierte fortan direkt als Bewilligungsbehörde, will heißen, für uns änderte sich eigentlich nur der Absendername der Haushaltsbescheide. Haushalt, das funktionierte so: Die Studentenwerke stellten nach den jährlich im Sommerhalbjahr vom MWK erlassenen detaillierten Vorschriften einen möglichst alle Eventualitäten des kommenden Jahres abdeckenden Wirtschaftsplan auf. Dieses in der Regel umfangreiche Zahlenwerk wurde an das MWK geschickt und man wartete auf die dortige Einladung zu einem Haushaltsgespräch. In dem Gespräch saß man dann bei der Behandlung jeder Abteilung dem Referenten und jeweils einem frischen, stets bestens vorbereiteten Sachbearbeiter gegenüber. Auf alle Fragen waren sofortige Antworten nötig, im Zweifel oder bei Unklarheiten wurde (zumindest zunächst einmal) gekürzt. Dabei waren auch Kürzungsforderungen des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) oder bzw. des Finanzministeriums, die bei Aufstellung des Plans noch gar nicht bekannt waren, gleich mit zu berücksichtigen. Beliebt war anfangs, uns bei den Verhandlungen vorzuhalten, ein anderes Studentenwerk könne dieses oder jenes viel besser oder kostengünstiger oder ähnliches. Dagegen half allerdings die Strategie, die Pläne mit allen Kollegen auszutauschen und trotz des Gesamtumfangs und -gewichts bei den Verhandlungen immer dabei zu haben. Das ließ diese Art von Vergleichen relativ schnell verstummen. Manche der verlangten Kürzungen und Einsparungen waren aber auch wie nicht von dieser Welt: So wurde beispielsweise kolportiert, beim Verlassen des Besprechungszimmers nach einem internen Kürzungsgespräch im MWK hätte man „unserem“ Referatsleiter noch schnell hinterher gerufen: „Sie müssen bei den Mensen noch eine Million einsparen!“ Auf seine Frage, wie das denn gehen soll, habe man ihn nach der Gesamtzahl der Mensaessen des nächsten Jahres gefragt. Da er antwortete „rund 10.000.000“, sei damit der ab jenem Jahr erhobene Zubereitungskostenanteil von 10 Pfennig pro Essen geboren worden. Damit war die jahrelange Übung abgeschafft, dass die Studenten beim Mensaessen nur den Wareneinsatz trugen. Oder: Einmal vergaßen wir bei einigen Investitionen, die Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Eine Korrektur wurde uns nicht zugestanden. Der Fehlbetrag musste erwirtschaftet werden. Und schließlich: Da wir in der Verwaltung stets sehr dünn besetzt waren, und sich dieser Trend mit Inkrafttreten des Studentenwerksgesetzes 1975 noch verstärkte, setzten wir schon sehr früh Computer ein. Die Universität ermöglichte uns zum Glück einen einfachen, direkten Zugang dazu, genauso wie ihren eigenen Einrichtungen. Dass wir die Wirt- schaftspläne schon ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre per EDV erstellten, war daher Ehrensache. Es mussten jedes Jahr auch die Ergebnisse der Vorjahre wieder angegeben werden, eine nervige und eintönige Fleißarbeit. Bei den Personalkosten wollten wir dem MWK keinerlei Spielräume für Kürzungen geben und entwickelten daher ein komplettes Programm für die Bruttogehälter, in dem wir die personenbezogenen Kosten für jeden einzelnen Mitarbeiter ausgeben konnten – wirklich und wahrhaftig an den Bedingungen der einzelnen Personen fixiert. Wir waren also gut gerüstet für die Wirtschaftsplanverhandlungen. Man ging wie gewohnt die einzelnen Positionen durch, alle Fragen des Sachbearbeiters des MWK wurden zufriedenstellend beantwortet, Widersprüche oder Unklarheiten gab es keine. Wir waren hochzufrieden, bis der Sachbearbeiter uns nach einem allgemeinen Lob am Schluss der Verhandlung fragte: „Können Sie nicht trotzdem noch 100.000 DM einsparen?“ Offensichtlich musste der Sachbearbeiter einen Einsparungsbetrag bei jedem Studentenwerk vorweisen, koste es, was es wolle. „Nur begrenzte Zeit: Außenstelle Geislingen der Hochschule Ulm...“ „Ulmer Geld regiert die Welt“ – das musste auch Graf Ulrich der V. von Helfenstein 1396 erkennen, als er auf Grund von Geldproblemen die bereits 1382 an Ulm verpfändete Stadt Geislingen/Steige samt dem mittleren Filstal bei einem Schuldenstand von 123.439 Gulden an die Freie Reichsstadt Ulm abtreten musste. Erst Napoleon setzte der Zugehörigkeit 1803 ein Ende. Als die Hochschulen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre von der Politik ermuntert wurden, Außenstellen zu gründen, war klar, die Fachhochschule Ulm gründet eine Außenstelle in Geislingen. Klar war auch, dass wir diese Studierenden zu betreuen hatten. Nicht klar war uns allerdings von vornherein, dass der Rektor der Fachhochschule Nürtingen aus Geislingen stammte und diese dort ebenfalls eine Außenstelle gründete. Beide Außenstellen wurden 1988 gegründet und vom Ministerpräsidenten bei einer gemeinsamen Veranstaltung eingeweiht. Das für die Fachhochschule Nürtingen zuständige Studentenwerk Hohenheim übertrug uns für die Nürtinger Außenstelle in Geislingen vertraglich seine Aufgaben. Wir fuhren auf dem Weg nach Schwäbisch Gmünd sowieso über Geislingen, und daher war der Mehraufwand bei Beratungen (wie z.B. beim BAföG) für uns relativ gering. Die Wohnungssituation in Geislingen war nicht so angespannt wie anderswo und daher kam der Bau eines Wohnhauses auf absehbare Zeit nicht in Betracht. Die Mittags-Verpflegung subventionierten wir in einer angesehenen Werkskantine in der Nähe der beiden Außenstellen. Zwei Außenstellen? Ja, denn die gesetzlichen Möglichkeiten für eine gemeinsame Außenstelle waren nicht gegeben. Also arbeiteten beide selbständig und unabhängig voneinander. Im Laufe der Zeit verlor sich die Bindung der Geislinger Außenstelle an die Hochschule Ulm jedoch mehr und mehr, und so wurde diese 1999 schließlich ganz aufgegeben und mit der Nürtinger Außenstelle vereinigt. Das Studentenwerk Hohenheim kündigte den Vertrag mit uns und betreute von da ab „seine“ Studierenden selbst. „Die Herausgabeklagen des PH-Studentenwerks...“ Durch die Verlagerung der Betreuungsaufgaben für die Pädagogische Hochschule auf die regionalen Studentenwerke war das frühere Pädagogische Hochschul-Studentenwerk, ein e.V., nicht aufgelöst oder untergegangen, sondern existierte weiter. Wenn nun auch ohne staatliche Aufgaben betrieb es wohl noch ein Wohnheim, eine Kinderkrippe usw. Nach Inkrafttreten des Studentenwerksgesetzes besann es sich darauf, dass die regionalen Studentenwerke sich bei der Übernahme der Mensen und Cafeterien an seinem Eigentum bereichert hätten. Es verklagte deshalb jedes einzelne Studentenwerk auf Herausgabe von Kaffeemaschinen und Essenmarkenautomaten. Offensichtlich waren die Bewilligungsbescheide des Kultusministerium in diesem Punkt mindestens so auslegungsfähig, dass es seine Klagen vor den Landgerichten landauf, landab gewann. Spätestens vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart stimmten die Kollegen dann auf Anraten des Gerichts einem Vergleich zu – wir auch. Doch während die Kollegen sich auf einen finanziellen Ausgleich verständigten und die Geräte behielten, stellten wir diese zum Abtransport bereit, denn die Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd stand sowieso vor dem Umzug in den Neubau und der vollständigen Aufgabe des alten Gebäudes in der Innenstadt. Meines Wissens wurden die Geräte aber nie angeholt. Das war ja auch deutlich unbequemer als der Geldeingang auf dem Bankkonto... „Wer den Schaden hat...“ Weil die Mensa für die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd viel zu groß ausgefallen war, ließen wir die übergangsweise im Institutsgebäude A des PH-Neubaus betriebene Cafeteria in die Mensa verlegen, denn dort musste sowieso ein Cafeteria sein – und zwei konnten wir uns nicht leisten. Der verglaste Kioskbereich wurde 1:1 in die Mensa verlagert. Nun war aber die Raumhöhe dort viel höher als im Institutsgebäude wofür er nach Maß gefertigt war. So bestand für uns die Gefahr des Überkletterns, nicht jedoch für das Bauamt. Eines Tages geschah genau das: Unbekannte hatten einige Mensa-Tische aufeinandergestellt, so die Glaswand überstiegen, den Kiosk leer geräumt und nach dem Abschrauben der Türscharniere wieder verlassen. Danach erhöhte das Bauamt die Glaswand bis an die Decke. Sah nicht gerade schick aus, war aber wirkungsvoll. In unserem Kiosk in der Uniklinik Michelsberg waren zwar die Glaswände gleich bis an die Decke gebaut worden, doch leider waren die Scharniere der Glastür falsch herum angebracht worden und konnten mit einem simplen Schraubenzieher von außen abgeschraubt werden. Das erkannte ein Unbekannter, führte es durch und labte sich an den Vorräten. Dieser Kiosk hatte zur Krankenversorgung auch samstags und sonntags an den Nachmittagen geöffnet. Plötzlich stimmte dort die Kasse nicht mehr. Egal, welche Mitarbeiterin oder welche Mitarbeiterinnen dort tätig waren. Es war wie verhext! Was auch immer wir anstellten, nachprüften oder ausprobierten, das Ergebnis hieß immer „Geld fehlt“. Dann, eines Tages nach dem Kassenabschluss, machten wir nur eine einzige Buchung, schlugen die Kasse wieder ab – und staunten. Wir hatten tatsächlich eine Kassendifferenz! Des Rätsels Lösung: Die mechanische Registrierkasse stellte sich aus unbekannten Gründen beim Kassenabschluss plötzlich nicht mehr auf 0,00 DM, sondern immer etwas darüber also, z.B. auf 7,68 DM. Dieser Betrag fehlte also beim nächsten Abschluss schon einmal. Ein anderes Geheimnis des Kiosks dagegen konnte nie aufgeklärt werden: Eines Montagmorgens waren plötzlich die Tageseinnahmen des vorhergehenden Freitags und Samstags aus dem angeblich verschlossenen Tresor verschwunden. Eine Prüfung durch die Kripo ergab nichts außer der Feststellung, dass weder der Tresor noch die Flurtür in der Nähe durch einen Nachschlüssel oder gar mit Gewalt geöffnet worden sind. Auch die Vernehmung des Personals erbrachte nichts. Schließlich gaben wir auf. Geringe tägliche Kassendifferenzen sind eigentlich ganz normal. Stimmen die Kassen plötzlich bei jeder Abrechnung, klingeln die Alarmglocken bei den Verantwortlichen. Wir erlebten das plötzlich flächendeckend. Dazu muss man wissen, dass der „X-Abschlag“ nur die Summe der Einnahmen anzeigt, während der „Z-Schlüssel“ zusätzlich die Speicher ausdruckt und dann alle auf 0,00 stellt. Wir hatten daher alle „X-Schlüssel“ eingezogen, um solche „Probe-Abschläge“ zu verhindern. Bei einer Kassen-Wartung bekam jemand mit, dass der Techniker mit dem „Z-Schlüssel“ einen „X-Abschlag“ machte. Die Neuigkeit sprach sich blitzartig herum und wurde sofort angewendet. Daraufhin ließen wir die X- Stellung ganz außer Betrieb nehmen, hatten danach ab sofort wieder Kassendifferenzen und waren glücklich und zufrieden. „Nur zur vorübergehenden Nutzung: Wohnhäuser bei der HfG...“ Die private Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) mit staatlicher Anerkennung war ab 1953 außerhalb der Stadt auf dem Kuhberg, am Hochsträß nach Art eines Campus wie in den USA, errichtet worden. Wegen der Lage weit vor der Stadt wurden auch Mensa, Wohnungen und Dozentenhäuser gleich mit gebaut. Die von der Geschwister Scholl Stiftung getragene Hochschule von Weltruf stellte ihren regulären Studienbetrieb zwar Ende 1968 ein, ermöglichte aber den vorhandenen Studierenden noch den Abschluss. Die letzten von ihnen verließen daher die Hochschule erst 1972. Dann standen die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude längere Zeit leer und waren in der exponierten Lage Wind und Wetter ausgesetzt. Die Stiftung konnte sie später mithilfe des Landes sanieren und anschließend bis 2007 an die Universität Ulm vermieten. Wir konnten nach erfolgter Renovierung die 16 Atelierwohnungen in zwei Trakten, zwei weitere Wohnungen und 30 Einzelzimmer im Wohnturm anmieten. Der Mietpreis ging eigentlich ganz in Ordnung, aber die Betriebskosten (Heizung!) waren exorbitant hoch und führten jedes Jahr aufs Neue im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) zu langen Diskussionen über angebliche Verschwendung. Errichtet zu Zeiten weit vor Erfindung des Begriffs „Ölkrise“, waren die denkmalgeschützten Gebäude wirklich sehr schön anzusehen, aber wirklich nicht wirtschaftlich zu betreiben. Insbesondere die mangelhafte Isolierung und die Atelierwohnungen mit ihren frei schwebenden Fußböden (also im 1 Stockwerk ohne Erdgeschoss) waren daran beteiligt. Nach Auslaufen des Mietvertrages über 20 Jahre mit der Stiftung zum 30.11.1996 gaben wir die Häuser auf. Die Stiftung wollte die Häuser nämlich nach eigener Renovierung künftig selbst bewirtschaften. Uns erbrachte das jedenfalls einen größeren Betrag an nicht gebrauchten Renovierungsrücklagen, der nun für andere Wohnprojekte eingesetzt werden konnte. Der „II. Bauabschnitt“ der HfG-Wohnungen direkt daran anschließend im „Wohngebiet Lindenhöhe“ blieb uns zum Glück vollständig erspart. Ende der 80er Jahre war ein Investor aufgetaucht, welcher zunächst uns, dann der Stadt anbot, Studentenwohnraum zu schaffen. Er hatte ein Grundstück oder zumindest Zugriff darauf in der Innenstadt, an dem der Stadt gelegen war und das konnte er gegen das Grundstück „Lindenhöhe“ eintauschen. Die Bauauflage dort aber war und blieb: Studentenappartements bauen. Nun hatte er allerdings bei den Investoren für eine rentable Kapitalanlage im hochwertigen Wohnungsbau geworben. Nach Fertigstellung stellte sich heraus, dass die angeblichen Studentenappartements für die Studenten viel zu teuer und daher an diese auch nicht vermietbar waren. Es fanden sich aber natürlich auf dem freien Wohnungsmarkt Mieter und insbesondere auch Mieterinnen. Als die Stadt erfuhr, dass dort gar keine Studenten wohnten, wurden die Wohnungsbesitzer zu einer Änderung der Mieterstruktur verpflichtet. Aus deren Sicht sollte das Studentenwerk die Häuser nun einfach komplett anmieten, und das damit verbundene Risiko tragen. Das verbot sich aber schon wegen des für Studenten in der Regel unerschwinglichen Mietzinses und für Nichtstudenten waren wir sowieso nicht zuständig. Also arrangierten die Investorensprecher ein Gespräch beim Oberbürgermeister, um auf uns Druck auszuüben und auf pauschale Anmietung des Komplexes zu drängen. Das Gespräch verlief aber nicht nach Wunsch, denn zum einen war der Oberbürgermeister auf unserer Seite und sah den wirtschaftlichen Unsinn und das Risiko für uns ein. Zum anderen war einer der anwesenden Investorensprecher Mitarbeiter des Verwaltungsratsmit- glieds aus der Wirtschaft in unserem Studentenwerk, und das hatte immer und jederzeit die Wirtschaftlichkeit im Sinn. So wurde es also nichts mit der Anmietung als Studentenwohnheim durch das Studentenwerk. „Schlechte und gute Zigaretten – gibt’s die tatsächlich?...“ Die Unikliniken Michelsberg und Safranberg sind aus städtischen Kliniken hervorgegangen. Mitte der siebziger Jahre waren der Um- und Ausbau sowie die Umorganisation von der Stadt in die Universität im vollen Gange. Wir erhielten am Michelsberg eine Ausgabemensa für Essen aus der Klinikküche samt Speisesaal mit kleiner Cafeteria und einem Kiosk. Essen wurde an Studierende und andere Hochschulangehörige ausgegeben. Der Kiosk diente auch der Krankenversorgung und war auch an den Wochenenden geöffnet. Als wir unsere Einrichtungen eröffneten, schloss gleichzeitig ein vorher jahrelang privat betriebener Kiosk auf dem Klinikgelände. Die Betreibern setzte sich zur Ruhe, erhielt aber vom Ärztlichen Direktor der Klinik die Erlaubnis, einen Zigarettenautomaten an der Außenwand eines Gebäudes hängen zu lassen. Nach einiger Zeit bekam sie von der damals noch städtischen Klinikverwaltung die Aufforderung, den Automaten zu entfernen, da er sich mit dem Gesundheitsgedanken einer Universitätsklinik nicht vertrage. Selbst zwar Raucherin, sah sie das trotzdem ein und ließ den Automaten unverzüglich abhängen. Sehr erstaunt war aber die Tochter der ehemaligen Betreiberin, als sie einmal zufällig an diesem Gebäude vorbei kam und dort ein Zigarettenautomat hing. Es stellte sich heraus, dass der Automat dort zugunsten einer Firma angebracht war, die in der Klinik für die Versorgung mit Getränken usw. in den Krankenzimmern zuständig war. Der Firmeninhaber war u.a. Betreiber von Zeitungs- und Getränkekiosken an einer ganzen Reihe von zentralen Punkten in der Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt und saß auch im Gemeinderat. Auf ihre Anfrage bei der mittlerweile für die Klinik zuständigen Grundstücksabteilung der Universität, ob denn die Zigaretten des Herrn Stadtrats weniger gesundheitsgefährdend seien, als die ihrer Mutter wurde dies verneint und der Stadtrat zur sofortigen Demontage aufgefordert, was auch umgehend geschah. Dieser Unternehmer hatte sich übrigens bei einer Ausschreibung der Stadtverwaltung für die Versorgung in den Krankenzimmern gegen uns durchgesetzt. Was ihn aber nicht daran hinderte, später bei uns wegen einer Erhöhung unserer Abgabepreise am Kiosk vorzusprechen - allerdings vergeblich. „Die Wandermillion...“ Nach Inkrafttreten des Studentenwerksgesetzes 1975 mussten für die auf uns übergegangenen Einrichtungen Mietverträge mit der staatlichen Liegenschaftsverwaltung abgeschlossen werden. Dabei stellte sich heraus, dass unsere Vorgängereinrichtung bei den Fachhochschulen im ganzen Land Mieten nicht oder nicht in voller Höhe bezahlt hatte. Diese Fehlbeträge wurden von der Liegenschaftsverwaltung nun bei den neu zuständigen Studentenwerken barsch eingefordert. Das war nach den Übergangsvorschriften des Gesetzes zwar möglich, empfanden wir aber als einen besonders unfreundlichen Akt und beantragten beim Kultusministerium den Fehlbetrag, da wir an der Malaise unschuldig waren. Das Ministerium hatte nach einigem hin und her ein Einsehen, beantragte beim Finanzministerium rund eine Million DM - und erhielt sie auch. Wir ließen diese Million nun solange zwischen Studentenwerken, staatlicher Liegenschaftsverwaltung, Finanzministerium und Kultusministerium hin und wandern, bis jedes Studentenwerk einmal dran war und sie wieder abgegeben hatte. Damit waren die Mietschulden beglichen und erledigt. „Haben Sie denn nicht genügend eigene Sorgen?...“ Auch im Nachbarbundesland Bayern gründeten Hochschulen Außenstellen, so auch die Fachhochschule Kempten im Jahre 1994 in Neu-Ulm. Zwar war gesetzlich das Studentenwerk Augsburg für Neu-Ulm zuständig, aber wir waren natürlich ungleich näher dran, nämlich nur kurz über die Donau und hatten dort zudem aus ehemaligen USMilitärbeständen von der Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft (NUWOG) zwei Häuser angemietet. Da das Studentenwerk Augsburg auch unserer Meinung war, sprachen wir mit ihm seit 1992 zunächst über Art und Umfang der Betreuung durch uns sowie die Erstattung der entstehenden Kosten. Konkret ging es zunächst um die Bearbeitung des BAföG, die Mittagsverpflegung und das Wohnen. Danach fuhren wir zu einer Besprechung über unseren Pläne und Vereinbarungen in das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK). Während der zuständige Referent des Referats „Studentenwerke“ uns voll unterstützte, waren die übrigen Beteiligten des Gesprächs durchaus geteilter Meinung. Ich erinnerte daran, dass wir ständig über Europa sprachen, da durfte doch unser Schritt über die Donau letztlich nicht an kleinlichen Landesbedenken scheitern. Am Ende der Besprechung jedenfalls war klar, das uns das MWK für eine Betreuung in Neu-Ulm keine unüberwindlichen Steine in den Weg legen würde. Wir mussten jedoch eine konsequente Kostenrechnung zusichern – aber das für uns sowieso eine Selbstverständlichkeit. Abschließend stand zusammen mit unserem Referenten aus dem MWK ein Besuch beim zuständigen Ministerium in München an. Dort war man für eine Betreuung durch uns sehr aufgeschlossen, wies aber auf einige Besonderheiten bzw. Bedingungen hin, dass z.B. das BAföG über das landeseigene Bayerische BAföG-Programm zu berechnen sei, dass die Subvention des Mensa-Essens für bayerische Studierende anderen Regeln folgt Auch der landeseinheitliche Studentenwerksbeitrag in Bayern sollte für die Studenten im geplanten gemeinsamen Studiengang mit der Fachhochschule Ulm (Wirtschaftsingenieurwesen) eingehalten werden Die weiteren Betreuungsleistungen (Kinderkrippe, Psychologische Beratung, Versicherungen usw.) waren durchweg identisch oder zumindest vergleichbar. Die aufgezeigten Unterschiede und Probleme schienen nicht unüberwindlich. Schwieriger waren allerdings die Formalien. Man glaubte in München nämlich, dass ein Staatsvertrag zur Regelung dieser Fragen sowie über die direkte Zusammenarbeit der Hochschulen über die Donau hinweg, im bayerischen Landtag nicht ganz unproblematisch wäre. Die beiden Ministerien verständigten sich daher darauf, dass beide Minister beim Festakt zur Errichtung der Neu-Ulmer Außenstelle am 5. Oktober 1994 ein „Verwaltungsabkommen zwischen Bayern und Baden-Württemberg über die Zusammenarbeit der Fachhochschulen Ulm und Neu-Ulm“ unterzeichnen sollten, in dem alle Hochschulfragen geregelt wurden, aber auch das „Zusammenwirken des Studentenwerkes Ulm und des Studentenwerkes Augsburg bei der Betreuung der Studenten der Fachhochschule Neu-Ulm“. So geschah es dann auch. 1998, vier Jahre später, wurde die Außenstelle Neu-Ulm dann zur eigenständigen Fachhochschule, mittlerweile Hochschule Neu-Ulm. Übrigens, wie man sich doch irren kann: Im Mai 1993 schrieb das Münchener Ministerium, dass für den Endausbau der Fachhochschule Neu-Ulm „derzeit von 400 Studienplätzen ... ausgegangen“ wird. Am 13. November 2012 berichtete die Rektorin dem Ministerpräsidenten bei dessen Besuch in der Hochschule, von „derzeit 3.160 Studierenden“. Ein weiterer Ausbau sei deshalb unabdingbar. „Baden-Württemberg – Bayern – BW – BY – BW – BY - BW - BY...“ Nein, hier wird nicht das Marschieren geübt, sondern auf diese Weise soll „die Zuordnung der Förderungsfälle bei Doppelimmatrikulationen an den Hochschulen Ulm und NeuUlm“ erfolgen. Dadurch soll eine gleichmäßige Aufteilung auf die beiden Bundesländer und damit eine gerechte Verteilung der tatsächlichen Kosten gewährleisten. Ein derartiger „Klimmzug“ ist erforderlich, da § 56 Abs. 4 BAföG eigentlich keinen gegenseitigen Ausgleich der Länder bei den Einnahmen oder den Bearbeitungskosten vorsieht. „Semesterticket auf baden-württembergisch oder auf bayerisch...?“ Bei Einführung des Semestertickets in Ulm zum Wintersemester 1998/99 fiel auf, dass es in Bayern landesweit ein anderes Verfahren gibt als bei uns, nämlich die Einkomponentenlösung. Dabei zahlt jeder Studierende einen am Studienort einheitlichen Solidarbeitrag. Der Studentenausweis gilt daher für ein ganzes Semester als ÖPNV-Ticket. Wir hier im Land haben dagegen die Zweikomponentenregelung, d.h. jeder zahlt einen relativ geringen örtlichen Solidarbeitrag und erhält dafür eine Grundleistung. Das eigentliche Semesterticket für die volle Leistung muss extra erworben werden und wird durch einen Dauerfahrschein dokumentiert. Welches Verfahren gerechter ist? Kommt ganz darauf, was im Vordergrund steht, der Solidaritätsgedanke oder der Einzelfall... „Geheime Adressen...?“ Eines Tages kam eine Sendung an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) in Stuttgart, an das richtige Postfach adressiert und korrekt frankiert mit dem Vermerk zurück „Empfänger in Stuttgart unbekannt“. Aus der zweiten Unterschrift konnten wir entnehmen, dass der Zusteller sich auch gleich seine Diagnose selbst bestätigt hatte. Wir hielten das für einen schlechten Scherz, denn das MWK in Stuttgart gab es damals schon seit über 20 Jahren und fragten beim Bonner Postministerium an, fügten dem Brief aber nur eine Kopie der Vorderseite der „verirrten“ Sendung bei. Das war auch gut so, denn unser Schreiben kam dort nur als leerer Briefumschlag an, wie wir bei einem Anruf aus Bonn erfuhren. Wieso wussten denn diese Postler, wer der Absender war? Ganz einfach aus der verschlüsselten Registriernummer unseres zur der Freimachung verwendeten Freistemplers. Die Bonner waren eben findiger als ihre Stuttgarter Kollegen. Im zweiten Anlauf kam der Brief schließlich unversehrt und mit komplettem Inhalt in Bonn an. Schließlich wurden wir darüber aufgeklärt, dass man ein Päckchen eben nicht an das Postfach schicken darf, egal wie groß es auch sein mag. Das war also unser Fehler, Aha! Wer ahnt denn auch so etwas? Zum Ausgleich unseres Portoverlustes sollten wir im Antwortbrief 10 Briefmarken vorfinden. Da waren aber 20 Stück drin. Dieses Mal reklamierten wir allerdings nicht. Wenn schon das MWK in Stuttgart manchem Postler unbekannt ist, was sollen wir denn als kleines Studentenwerk sagen, wenn Eilboten der Post in Ulm unsere Adresse nicht kennen oder nicht finden? Als die EDV der Finanzverwaltung (ED-Fin) in Stuttgart die Ergebnisse der EDV-Läufe des BAföG noch auf CD zurücksandte, musste das ziemlich schnell gehen, da zur Erhaltung der Datenkonsistenz keine Eingaben gemacht werden durften, während die Daten außer Haus waren. Die BAföG-Abteilung wartete also sozusagen PC bei Fuß händeringend auf die CD. Deshalb wählte die ED-Fin auch eine relativ teure Zustellungsart der Post: „DHL-Express mit Zustellung vor 10:00 Uhr“. Das klappte bei uns aber fast nie. Meist erhielten wir die dringende CD über die gewöhnliche Hauspost der Universität. Manchmal landeten die CDs auch in irgendwelchen Briefkästen, irgendwo in den weitläufigen Universitäts-Gebäuden auf dem Eselsberg, egal, welcher Inhabername auf dem Briefkasten stand. Manchmal kam sie auch erst nach Tagen an. Ganz, ganz vereinzelt nur fanden wir auch schon mal eine CD tatsächlich in unserem Briefkasten. Zwar telefonierten wir nach jeder falschen Zustellung wieder aufs Neue mit der DHLZentrale im Donautal, schickten natürlich auch zum leichteren Auffinden mehrere Fotos über unsere Adresse James-Franck-Ring 8 dorthin, aber es half alles nichts: Die Nichtzusteller waren einfach nicht zu überzeugen, dass das wirklich und wahrhaftig unsere Adresse ist. Vielleicht kamen sie auch durch die Schranke bei der Haltestelle „Universität Süd“ durcheinander, die alle Fahrzeuge außer den Bussen an der Durchfahrt hindert. Bemerkenswert fanden wir übrigens, dass wir nach einigen Monaten unserer „Dauerbeschwerde“ eigentlich nur noch dann jemanden in der Filiale im Donautal erreichten, wenn wir unsere Rufnummer beim Anruf unterdrückten... „Stuttgart-Tagesfahrtenspezial – mit der Deutschen Bundesbahn...“ Auch zu Zeiten als die Deutsche Bahn noch ein Staatsbetrieb war und Fahrscheine einzeln auf Pappkärtchen gedruckt wurden, gab es schon das eine oder andere Sonderangebot. Wir liebten für unsere damals noch zahlreichen Besuche im Kultusministerium am meisten eine Variante, die einen kostenlosen Besuch in der „Wilhelma“, dem Zoo, einschloss. Als wir unserem Gesprächspartner einmal davon erzählten, forderte er uns auf, nach dem Gespräch wirklich noch in den Zoo zu gehen. Wir ließen dass dann aber, denn wir haben gerade an dem Tag im Kultusministerium schon „Zirkus“ genug genossen. Gern kauften wir auch eine Sonderfahrkarte zum Stuttgarter Flughafen, die (irrtümlich?) mit einem blauen Längsstreifen auf der Vorderseite als Rückfahrkarte gekennzeichnet war. Wir fuhren aber nie damit bis zum Flughafen, denn in der Regel hatten wir nach den Gesprächen genügend Stoff, um „in die Luft“ zu gehen. „Geheimnisse unter der Erdoberfläche...“ Nach Abriss des Hotels „Michelsberg“ an der Frauensteige (gleich hinter der Eisenbahnstrecke Ulm – Stuttgart), erhielten wir das dem Land gehörenden Areal zum Bau eines Studentenhauses. Da das Gelände als problematischer Baugrund galt, ließen wir auf dringendes Anraten der Bauverwaltung eine Bodenuntersuchung an dem Hanggrundstück durch eine Augsburger Spezialfirma vornehmen. Außer einigen Kleinigkeiten fand man aber nichts weiter, keine besonderen Felsformationen, keine Hinterlassenschaften des schweren Bombenangriffs auf Ulm 1944, keine Höhlen oder Verwerfungen – einfach nichts. Als dann aber der Bagger anrückte und die Baugrube aushob, fand man doch etwas: Einen riesigen Gewölbekeller, der wohl einer längst vergangenen und vergessenen Brauerei einmal als Lager für Eis oder Bier gedient hatte. Das Gebäude wurde auch an dieser Stelle durch einen Betonpfeiler bis tief in den Grund sicher gebaut, aber leider fehlen bis heute die Mittel zur Öffnung und Herrichtung des gesamten Gewölbekellers. Es gab natürlich auch traurige Ereignisse. Hier ist ein besonders tragisches: „SEK und Bereitschaftspolizei als Mensa-Tester...“ Eines Morgens im Frühsommer des Jahres 2007 drang ein junger Mann, ehemaliger Student, nach einem Tötungsdelikt in der Familie mit einer Pistole bewaffnet in die Universität ein, um sich Zyankali zur Selbsttötung zu beschaffen. Da er dann aber plötzlich im Gewirr der Räume und Gänge verschwunden war, riegelte die herbeigerufene Bereitschaftspolizei und das SEK den gesamten Gebäudekomplex hermetisch ab, ließen die Cafeterien schließen, verboten den Aufenthalt auf Fluren und Gängen, ließen niemanden mehr ins Gebäude oder heraus und durchsuchten die gesamte Universität nach dem jungen Mann. Auch der Busverkehr von und zur Universität wurde vorübergehend eingestellt. In der Mensaküche konnte der Kochbetrieb aber nicht so einfach eingestellt werden und so wurde deshalb zu Ende produziert. Mangels anderer Kundschaft ließ der Leiter unserer Speisebetriebe, der sich außerhalb befand und auch nicht mehr ins Gebäude hereingekommen war, die Polizeibeamten zum kostenlosen Mittagessen einladen. Denen hat das anscheinend sehr gut geschmeckt, denn sie versprachen bestimmt wieder zu kommen, was wir aber dankend ablehnten. Nach einigen Stunden wurde die „Quarantäne“ dann endlich wieder aufgehoben. Der junge Mann wurde schließlich nahe Lehr tot aufgefunden.