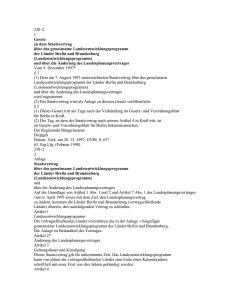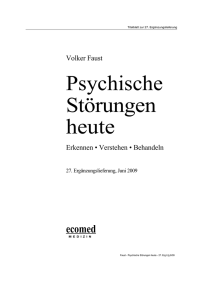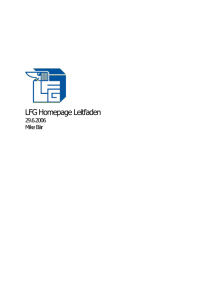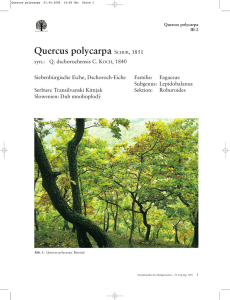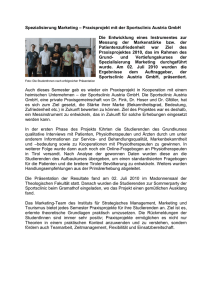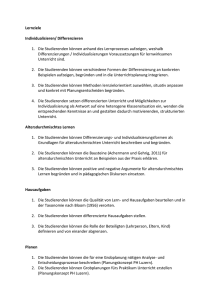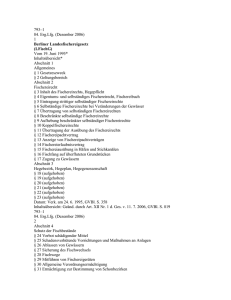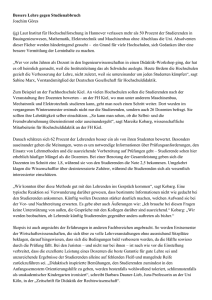LFG – Runde „Forschung am Kremesberg“
Werbung

LFG – Runde „Forschung am Kremesberg“ Mit Schreiben vom 8.März 2011 hat die Rektorin der VetmeduniVienna, Frau Dr.Hammerschmid, alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses zu einer ersten – von Prof.Marc Drillich initiierten – Diskussionsrunde zum Thema „Forschung am LFG“ eingeladen. Das Lehr- und Forschungsgut der Universität am Kremesberg bietet einen sehr attraktiven Rahmen sowie eine gute Basis für Forschungsvorhaben. Die Initiative von Prof.Drillich, Möglichkeiten zu diskutieren, wie das LFG verstärkt in Forschungsprojekte eingebunden werden kann, war der Anstoß, in einer ersten Runde mit Vertretern der Uni, sich dieses Themas anzunehmen. Während des Treffens am 10.Mai 2011 wurde unter der Leitung von Prof.Drillich in einer zunächst ersten Runde die derzeitige Situation am LFG dargestellt. Dr.Pohl, der Leiter des LFG, schilderte anschließend den aktuellen Stand der Einrichtungen der Höfe Kremesberg, Medau, Haidlhof und Rehgras und die bereits vorhandenen Infrastrukturen. Im weiteren Verlauf der Gesprächsrunde wurden von Seiten aller Teilnehmer Möglichkeiten und Bedürfnisse zur Steigerung der Forschungsleistungen thematisiert. Dabei wurden auch diverse Kooperationsmöglichkeiten angesprochen. Nach ausführlicher Diskussion des Bedarfs für zukünftige Projekte wurde die erste gemeinsame LFG-Runde mit der Übereinkunft zu weiteren, konkreten Gesprächen abgeschlossen und mit einer kurzen Führung durch die Räume der Bestandsbetreuung beendet. Herr Prof.Drillich, was war die ursprüngliche Idee von Ihrer Seite, eine solche Initiative gerade zur jetzigen Zeit zu ergreifen? Prof.Drillich: Schon seit Beginn meiner Arbeit an der Vetmeduni hatte ich nach Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder den Eindruck, dass das Vernetzen von Projekten – gerade im Forschungsbereich eine absolute Notwendigkeit – im konkreten Fall einiger Forschungsprojekte am Lehr- und Forschungsgut nicht optimal genutzt wurde und sicher verbessert werden könnte. Die vorhandenen Forschungsleistungen am LFG sind zudem weder universitätsintern noch für die interessierte Öffentlichkeit sichtbar. Dies war letztendlich das Hauptargument, das mich veranlasst hat, diese Thematik an das Rektorat mit einem konkreten Vorschlag in Form der Einrichtung einer ersten sog. “LFG-Runde“ vor Ort zu starten. Die gut besuchte Gesprächsrunde am letzten Dienstag hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg hoffentlich in die richtige Richtung geht. Wie sollte das langfristige Ziel für die Universität zu diesem Thema bei optimaler Ausnutzung der Ressourcen am LFG aussehen? Prof.Drillich: Kurzfristiges Ziel sollte sicherlich sein, zu zeigen, dass mit den vorhandenen Ressourcen international anerkannte Forschung betrieben werden kann. Mittelfristig sollten die auch vorhandenen Defizite, wie wir sie zum Teil in der LFG-Runde identifiziert haben, ausgebessert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Dies kann gegebenenfalls auch mit Investitionen am LFG verbunden sein. Der vorhandene gute Grundstock sollte jedenfalls noch intensiver genutzt werden, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt einer vermehrten Zusammenarbeit. Von mehreren Einrichtungen genutzte oder nutzbare Investitionen, die langfristig Projekten dienen, sind besser nachvollziehbar und schaffen die Grundlagen für die Zukunft des LFG als Forschungseinrichtung. Am wissenschaftlichen Output, d.h. Publikationen, Dissertationen unter Beteiligung des LFG , muss sich das LFG dann allerdings auch objektiv messen lassen. Bei den Überlegungen zur Verbesserung des Forschungsstandortes LFG ist jedoch auch immer zu berücksichtigen, dass hier auch fast das ganze Jahr über eine intensive Ausbildung der Studierenden stattfindet. Forschung und Lehre gleichzeitig nebeneinander stattfinden zu lassen, bedarf einer umsichtigen Planung – und kann manchmal auch zum Spagat führen. Gibt es bestimmte Forschungsbereiche, die Sie aus Sicht der „Bestandsbetreuung“ gerne am Lehr- und Forschungsgut umgesetzt sehen würden? Prof.Drillich: An aktuellen Projekten läuft am LFG zur Zeit eine Studie aus dem Bereich „Erkrankungen des Uterus des Rindes“, in der wir zytologische und bakteriologische Proben aus der Gebärmutter des Rindes untersuchen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Frau Prof.Ehling-Schulz, Lebensmittelmikrobiologie, durchgeführt. Fruchtbarkeitsstörungen sind ein Bereich, der gerade in Milchviehbetrieben größte Praxisrelevanz aufweist und mir daher bei meiner Tätigkeit im Rahmen der Bestandsbetreuung ganz besonders wichtig ist. Weitere Studien zu diesen Themen sind sowohl am LFG als auch auf „normalen“ landwirtschaftlichen Betrieben gerade in Vorbereitung. Seit knapp einem Jahr sind Sie nun mit der Abteilung Bestandsbetreuung der Klinik für Wiederkäuer am Kremesberg angesiedelt – wie geht es Ihnen dabei? Konnten Sie Ihre Vorstellungen und Pläne zur Bestandsbetreuung in dem von Ihnen geplanten Ausmaß bereits verwirklichen? Gibt es Wünsche für die Zukunft? Prof.Drillich: Es ist uns innerhalb kurzer Zeit – nicht zuletzt dank der hervorragenden Unterstützung durch den Leiter des LFG, Herrn Dr.Pohl – gelungen, die Abteilung Bestandsbetreuung am Lehr- und Forschungsgut zu etablieren. Auch die Ausstattung der Räumlichkeiten schreitet zügig voran, sodass meine Mitarbeiter und ich uns am LFG sehr wohl fühlen. Als Wunsch für die Zukunft möchte ich eine noch weiter verbesserte Nutzung des LFG in der Lehre äußern. Hierbei kann die Anwesenheit meiner Abteilung vor Ort sicher dazu beitragen, entsprechende Konzepte umzusetzen. Mir ist es beispielsweise ein besonderes Anliegen, den Studierenden mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihr Wissen im Nutztierbereich zu vertiefen. Das LFG bietet den Studierenden vor Ort eine sehr gute Infrastruktur und jederzeit hilfsbereite Mitarbeiter. Wenn wir es schaffen, darüber hinaus den Studierenden neben der Arbeit im Stall und am Tier ein Konzept zum Selbststudium anzubieten, bin ich überzeugt davon, dass das LFG bald nicht mehr aus der Ausbildung der Studierenden an der Vetmeduni wegzudenken ist und darüber hinaus auch international als vorbildhaft angesehen wird. Das Feedback der Studierenden zeigt uns, dass es der Abteilung Bestandsbetreuung seit ihrer Etablierung am LFG gelungen ist, das Spektrum der Ausbildung im Nutztierbereich positiv erweitert zu haben. Dazu zählen nicht nur die Ausbildung am LFG, sondern auch die Ausfahrten auf „echte“ landwirtschaftliche Betriebe. Wenn man insgesamt das LFG mit seinen Einrichtungen nicht nur hinsichtlich des Bereichs „Wiederkäuer“ betrachtet, sondern auch den nun in Angriff genommenen Neubau des Schweinestalls berücksichtigt, glaube ich, dass wir hier einen sehr leistungsstarken Standort der Vetmeduni haben werden. Sehr geehrter Herr Prof.Drillich, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre weiteren Arbeiten am LFG! (Das Gespräch führte Dr.M.Kisling, LFG Kremesberg, am 12.Mai 2011)