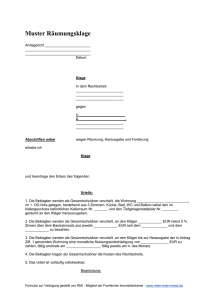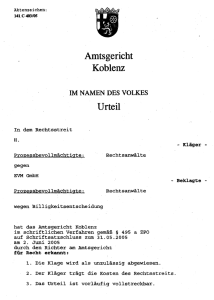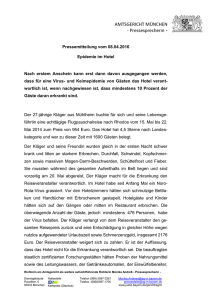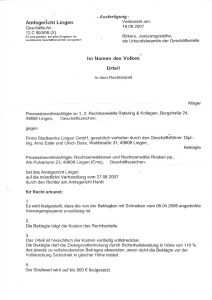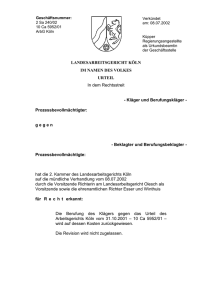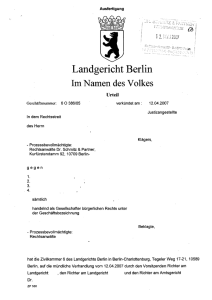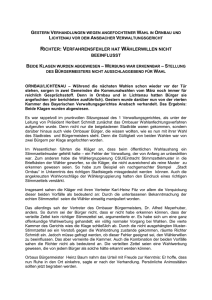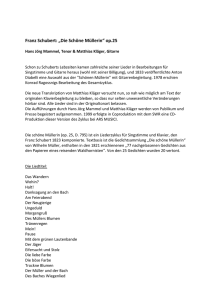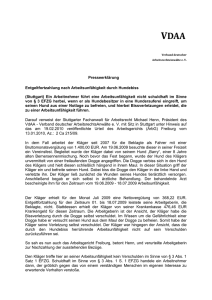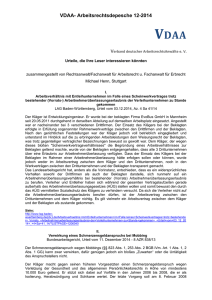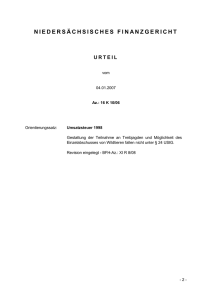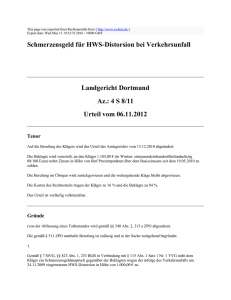Es besteht ein berechtigtes Interesse des Klägers
Werbung

Anspruch auf Herausgabe der Mitgliederdaten: http://www.datenschutz-praxis.de/fachwissen/fachartikel/anspruch-auf-herausgabe-dermitgliederdaten-an-ein-vereinsmitglied/ Nach Meinung der Kölner Richter steht dem Kläger ein Anspruch auf Herausgabe der Mitgliederliste zu, wenn und soweit er ein berechtigtes Interesse im Sinne der vereinspolitischen Ziele darlegen kann und diesem Begehren keine überwiegenden Interessen des Vereins oder der betroffenen Vereinsmitglieder entgegenstehen. http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2011/27_O_142_11_Urteil_20110927.html Landgericht Köln, 27 O 142/11 Datum: 27.09.2011 Gericht: Landgericht Köln Spruchkörper: 27. Zivilkammer Entscheidungsart: Urteil Aktenzeichen: 27 O 142/11 Tenor: Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger eine vollständige Liste der Mitglieder des Beklagten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mit Vor- und Nachnamen, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) und (soweit bekannt) E-Mail-Adresse in Form einer elektronischen Datei (Excel-Datei) herauszugeben. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,00 €. 1 1 T A T B E S T A N D: 2 Der Kläger nimmt den Beklagten, einen überregional bekannten Sportverein mit mehr als 50.000 Mitgliedern, unter Hinweis auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, Beschl. v. 21.06.2010 – II ZR 219/09, auf Herausgabe aller Mitgliederdaten in Anspruch. 3 Der Kläger ist seit dem 1. Dezember 2001 Mitglied des Beklagten. Nach der letzten Mitgliederversammlung des Beklagten vom 17.11.2010, bei der 3119 Mitglieder anwesend waren, bildete sich unter Beteiligung auch des Klägers eine „Mitgliederinitiative FCReloaded“. Der Kläger und die Initiative streben eine umfassende Änderung der Satzung des Beklagten an, für Einzelheiten auf die Anlage K2 zur Klageschrift, Bl. 9-19 GA, Bezug genommen wird. Für den Satzungsvorschlag der „Mitgliederinitiative FC-Reloaded“ wird auf die Anlage K3 zur Klageschrift, Bl. 20-45 GA, Bezug genommen. Zu diesem Zweck streben der Kläger und die „Mitgliederinitiative FC-Reloaded“ die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung an. 4 Mit Schreiben vom 10.01.2011 forderte der Kläger den Beklagten auf, dem durch den Kläger benannten Treuhänder Herrn Rechtsanwalt N, O-Straße, ####1 Köln, die vollständige Mitgliederliste herauszugeben, um entsprechend für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und die Satzungsänderung werbend an die Mitglieder herantreten zu können. Mit der Herausgabe der Mitgliederliste erklärte sich der Beklagte mit Schreiben vom 17.01.2011 grundsätzlich einverstanden, jedoch sollte die Weitergabe nur an einen von dem Beklagten oder dem Präsidenten des OLG Köln zu benennenden Treuhänder erfolgen, der sich verpflichtet, die Daten vertraulich und ausschließlich zur Abwicklung des Minderheitsbegehrens zu verwenden und die von dem Kläger verfassten Mitteilungen vor dem Versand auf werbenden, abwerbenden oder strafrechtlich relevanten Inhalt zu prüfen. Mit Schreiben vom 21. Januar und 4. Februar 2011 forderte der Beklagte seine Mitglieder auf, mitzuteilen, ob sie der geplanten Übermittlung der Mitgliederdaten jeweils widersprechen. Von dieser Möglichkeit machten bisher rund 14.000 Mitglieder Gebrauch. Eine Übermittlung der Mitgliederdaten an den Kläger ist bisher nicht erfolgt. Ein Antrag auf Streitentscheidung gemäß § 25 Abs. 1 c) der Satzung wurde durch den Vereinsbeirat in der Sitzung vom 23.03.2011 nicht zur Entscheidung angenommen; für die Einzelheiten wird auf das Schreiben des Vorsitzenden des Vereinsbeirats Herr T vom 30.03.2011, Anlage K15 zum Schriftsatz der früheren Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 05.07.2011, Bl. 151-152 GA, Bezug genommen. 5 Der Kläger ist der Ansicht, dass er als Ausfluss seines Mitgliedschaftsrechts einen Anspruch auf Herausgabe der vollständigen Mitgliederliste des Beklagten an sich selbst habe. Der 2 Beklagte habe auch kein Mitspracherecht bei der Auswahl und der Ausgestaltung der Beauftragung eines Treuhänders, wenn man nur einen Anspruch auf Herausgabe an einen Treuhänder annehme. Ein etwaiger Widerspruch von Vereinsmitgliedern gegen die Weitergabe der Daten sei unbeachtlich. 6 Der Kläger beantragt, 7 1. den Beklagten zu verurteilen, dem Kläger die vollständige Mitgliederliste des Beklagten mit Vor- und Nachnamen, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) und (soweit bekannt) E-Mail-Adresse und differenziert nach stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitgliedern in Form einer elektronischen Datei (Excel-Datei) herauszugeben; 8 hilfsweise: 9 2. den Beklagten zu verurteilen, an Herrn Rechtsanwalt N, O-Straße, ####1 Köln, als Treuhänder die vollständige Mitgliederliste des Beklagten mit Vor- und Nachnamen, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) und (soweit bekannt) E-Mail-Adresse und differenziert nach stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitgliedern in Form einer elektronischen Datei (Excel-Datei) herauszugeben; 10 hilfsweise: 11 3. den Beklagten zu verurteilen, an Herrn Rechtsanwalt N, O-Straße, ####1 Köln, als Treuhänder die vollständige Mitgliederliste des Beklagten mit Vor- und Nachnamen, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) und (soweit bekannt) E-Mail-Adresse und differenziert nach stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitgliedern in Form einer elektronischen Datei (Excel-Datei) herauszugeben, mit der Maßgabe, dass die bei dem Beklagten eingegangenen Widersprüche von Mitgliedern gegen ihre Adressweitergabe in der Datei markiert sind und die Widersprüche (in Form von Postkarten und sonstigen Dokumenten oder Dateien) ebenfalls an den Treuhänder herausgegeben werden. 12 Der Beklagte beantragt, 13 3 die Klage abzuweisen. 14 Der Beklagte ist der Ansicht, der Klage fehle im Hinblick auf die in der Satzung vorgesehene Streitentscheidung durch den Vereinsbeirat das Rechtsschutzbedürfnis, wenn nicht sogar die Einrede der Schiedsabrede durchgreife. 15 Auch wenn er grundsätzlich zur Herausgabe der Mitgliederdaten an den Kläger verpflichtet sei, müssten die Belange des Datenschutzes bei der konkreten Ausgestaltung der Herausgabe der Daten gewahrt werden. Dies sei bei einer Herausgabe an den Kläger oder einen von ihm benannten Treuhänder nicht ausreichend sichergestellt. 16 Wegen aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind, ergänzend Bezug genommen. 17 ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 18 Die zulässige Klage ist im Wesentlichen begründet. 19 Die Klage ist zulässig. 20 Dabei kann dahinstehen, ob die Regelung in § 25 Abs. 1 c) der Satzung („Der Vereinsbeirat entscheidet … über Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und Organen des Vereins betreffend Angelegenheiten des Vereins, wenn und soweit ein Antrag an ihn herangetragen wird“) als Einrichtung eines Schiedsgerichts im Sinne der §§ 1029 ff. ZPO verstanden werden muss und den Erklärungen des Beklagten als Erhebung der Einrede des Schiedsgerichts zu verstehen ist. In diesem Falle wäre für den vorliegenden Streit eine Kompetenz des Verwaltungsbeirats zur Streitentscheidung nicht vorgesehen, denn es fehlt an einem Streit zwischen Mitgliedern und Organen des Vereins betreffend Angelegenheiten des Vereins, handelt es sich doch um einen Anspruch eines Vereinsmitglieds gegen den Verein, nicht gegen eines seiner Organe. Zudem hätte sich die Schiedsvereinbarung als undurchführbar im Sinne von § 1032 Abs. 1 ZPO erwiesen, weil der Vereinsbeirat, wie sich aus dem Schreiben seines Vorsitzenden vom 30.03.2011 ergibt, die Anrufung eines staatlichen Gerichts als vorrangig ansieht und eine eigene Entscheidung endgültig abgelehnt hat. 4 21 Der Klage fehlt danach auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil die Möglichkeit einer vereinsinternen Streitentscheidung nicht besteht. Das Rechtsschutzbedürfnis fehlt auch nicht deshalb, weil der Beklagte seine Pflicht zur Herausgabe der Mitgliederdaten an den Klägern grundsätzlich einräumt, denn die Parteien haben sich – zuletzt auch in der mündlichen Verhandlung – über die hier entscheidende Ausgestaltung im Einzelnen nicht einigen können. Der Kläger hat danach ein Interesse an einer gerichtlichen Klärung des Anspruchsumfangs. 22 Die Klage ist im Wesentlichen begründet. Der Kläger hat Anspruch auf Herausgabe der Mitgliederdaten, allerdings nur soweit die Mitglieder stimmberechtigt sind. 23 Dem Mitglied eines Vereins steht ein Anspruch auf Offenbarung der Namen und Anschriften der Mitglieder des Vereins zu, wenn es ein berechtigtes Interesse darlegen kann, dem kein überwiegendes Interesse des Vereins oder berechtigte Belange der Vereinsmitglieder entgegenstehen. Ein berechtigtes Interesse eines Vereinsmitglieds, Kenntnis von Namen und Anschriften der übrigen Mitglieder zu erhalten, kann auch außerhalb des unmittelbaren Anwendungsbereichs des § 37 BGB bestehen, wenn das Mitglied nach dem Umständen des konkreten Falles die in der Mitgliederliste enthaltenen Informationen ausnahmsweise benötigt, um das sich aus seiner Mitgliedschaft ergebende Recht auf Mitwirkung an der Willensbildung im Verein wirkungsvoll ausüben zu können. Vereinsmitglieder müssen sich auch nicht darauf verweisen lassen, mit anderen Mitgliedern über Internetforen oder die Mitgliederzeitung in Kontakt zu treten oder auf anderem Wege zu verfolgen. Vielmehr muss es dem Mitglied überlassen bleiben, auf welchem Weg und an welche Mitglieder es herantreten will, um - aus seiner Sicht - Erfolg versprechend auf die vereinsrechtliche Willensbildung Einfluss nehmen zu können. Sind die Informationen, die sich das Mitglied durch Einsicht in die Unterlagen des Vereins beschaffen kann, in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert, kann es zum Zwecke der Unterrichtung einen Ausdruck der geforderten Informationen oder auch deren Übermittlung in elektronischer Form verlangen (BGH, Beschl. v. 21.06.2010 – II ZR 219/09; zustimmend Schöpflin in: BeckOK BGB (Bamberger/Roth), Stand: 01.03.2011, § 38 BGB Rn. 19; zweifelnd: LG Köln, Beschl. v. 21.01.2011 – 13 S 294/10, n.v.). 24 Dabei ist es dem Mitgliedern eines Vereins grundsätzlich nicht verwehrt, auch selbst Einsicht in die Mitgliederliste zu nehmen bzw. die Übermittlung der dort enthaltenen Informationen in elektronischer Form an sich selbst zu verlangen, sofern sie ein berechtigtes Interesse darlegen und ihrem Interesse nicht überwiegende Interessen des Vereins oder berechtigte Belange der Vereinsmitglieder entgegen stehen (BGH, Beschl. v. 25.10.2010 – II ZR 219/09, Juris Tz. 6). 25 5 Die Voraussetzungen des Herausgabeanspruchs liegen hier vor. Der Kläger kann seine Mitgliedschaftsrechte, hier seine Anregungen zu einer Satzungsänderung in einer (außerordentlichen) Mitgliederversammlung, angesichts der Mitgliederstruktur des Beklagten nur effektiv wahrnehmen, wenn er den Mitgliedern außerhalb der Mitgliederversammlung seine Anliegen bekannt machen kann. Dies ergibt sich aus der großen Zahl der Mitglieder in Verbindung mit den in der Satzung vorgesehenen Mitgliederquoren. Der Antrag auf Satzungsänderung kann gemäß § 15 Abs. 2 neben dem Vorstand, dem Verwaltungsrat oder dem Vereinsbeirat nur von zwei Zehnteln der stimmberechtigten Mitglieder gestellt werden; er muss zudem so rechtzeitig gestellt werden, dass er mit der Tagesordnung der Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden kann, und muss im Wortlaut bei Einberufung der Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Dies bedeutet tatsächlich, dass ein Vereinsmitglied für eine Satzungsänderung außerhalb der Mitgliederversammlung die Zustimmung von mehreren Tausend der stimmberechtigten Vereinsmitglieder gewinnen muss, um überhaupt eine Befassung der Mitgliederversammlung ohne Unterstützung durch ein Vereinsorgan erreichen zu können. Damit ist die entscheidende Hürde für Satzungsänderungen benannt, die aus dem Kreis der Mitglieder initiiert werden sollen. Um dieses Mitgliederquorum erreichen zu können, ist der Kläger darauf angewiesen, an die stimmberechtigten Mitglieder außerhalb der Mitgliederversammlung gezielt herantreten zu können. Um sein Mitwirkungsrecht an der vereinsinternen Willensbildung wirkungsvoll ausüben zu können, bedarf der Kläger hier daher der Kenntnis von Namen und Anschriften der anderen Vereinsmitglieder. Daneben kommt dem für Satzungsänderungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 der Satzung bestehende Mehrheitserfordernis von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen keine zusätzliche Bedeutung zu. Ebenfalls keiner Prüfung bedarf, ob die Anliegen des Klägers eilbedürftig sind und die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfordern, die nur von zwei Zehnteln der Mitglieder verlangt werden kann. 26 Die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs ist nicht rechtsmißbräuchlich. Die angestrebten Satzungsänderungen, die im Kern auf eine stärkere Beteiligung der anderen Vereinsorgane neben dem Vorstand zielen, verfolgen keinen sitten- oder gesetzeswidrigen Zweck. Ob die Satzungsänderungen sinnvoll oder gar notwendig sind, ist nicht Voraussetzung des Auskunftsanspruchs, der gerade eine Diskussion der Vereinsmitglieder über Sinn und Notwendigkeit ermöglichen soll, und bedarf daher keiner Prüfung. 27 Aus den genannten Grundlagen des Auskunftsanspruchs, der eine wirksame Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte ermöglichen soll, folgt zugleich seine Beschränkung auf die Daten derjenigen Mitglieder, die zur Mitwirkung an der Entscheidungsfindung berechtigt sind. Gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 der Satzung haben jugendliche Mitglieder kein Stimmrecht; dies sind gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung solche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie können also bei einer Satzungsänderung nicht abstimmen. Minderjährige können zudem gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung nicht den Organen des Beklagten angehören. 6 28 Der Herausgabe der Daten an den Kläger selbst stehen auch Gesichtspunkte des Datenschutzes nicht entgegen. Solche schützenswerten Belange sind nicht erst dann ausreichend gewahrt, wenn die Herausgabe der Mitgliederliste an einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Treuhänder erfolgt, das Mitglied selbst also keinen Einblick in die Liste erhält. Dementsprechend hält etwa der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im „Faltblatt zum Datenschutz im Verein“, herausgegeben von den Landesbeauftragten für den Datenschutz der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Stand: Februar 2002, die Herausgabe einer Mitgliederliste oder eines Mitgliederverzeichnisses regelmäßig für im Vereinsinteresse erforderlich. Die Vereinsmitglieder sind mit ihrem Beitritt zum Beklagten, der einen bestimmten Zweck verfolgt, in eine gewollte Rechtsgemeinschaft zu den anderen, ihnen weitgehend unbekannten Mitgliedern des Beklagten getreten. Die anderen Vereinsmitglieder haben es deshalb jedenfalls hinzunehmen, dass andere Vereinsmitglieder in berechtigter Verfolgung vereinspolitischer Ziele an sie herantreten. Die Übermittlung der Daten an ein Vereinsmitglied ist für den Beklagten gemäß § 28 Abs. 8 BDSG i.V.m. § 28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG auch ohne Einwilligung der Mitglieder zulässig. Ein Widerspruchsrecht sieht § 28 BDSG nur in Absatz 4 im Falle der Weitergabe für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung vor. Dabei ist der Auskunftsanspruch nicht auf die Herausgabe an einen aufgrund seines Amtes, etwa als Rechtsanwalt oder Notar, zur Amtsverschwiegenheit verpflichteten Treuhänder beschränkt; der Schutz der Daten wird vielmehr dadurch ausreichend gewährleistet, dass das Vereinsmitglied die Mitgliederdaten nur ihm Rahmen seines berechtigten Auskunftsinteresses nutzen darf, wie sich aus § 28 Abs. 5 BDSG ergibt und durch den Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 43 Abs. 1 Nr. 4 BDSG sanktioniert wird. Im Zivilrecht besteht kein Anlass, durch praeter legem zu entwickelnde Konstruktionen einen vermeintlich höheren Datenschutzstandard zu sichern, als ihn der Gesetzgeber des Bundesdatenschutzgesetzes für erforderlich gehalten hat. 29 Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 2, 709 ZPO. 30 Streitwert: 6.000,00 € Datenschutz im Verein: Anspruch auf Herausgabe der Mitgliederdaten? „ Wer einem Verein beitritt, muss damit rechnen, dass seine Daten unter Umständen bei anderen Vereinsmitgliedern landen. Denn ein Verein ist eine Rechtsgemeinschaft, in der jedes 7 Mitglied an alle anderen herantreten kann - sofern es berechtigterweise vereinspolitische Ziele verfolgt. So entschied zumindest das Landgericht Köln. Datenschutz im Verein - entscheidend ist nicht nur "auf'm Platz" Der Kläger, ein Vereinsmitglied des 1. FC Köln mit mehr als 50.000 Mitgliedern, verlangte vom Verein die Herausgabe der kompletten Mitgliederliste, um eine umfassende Änderung der Vereinssatzung in die Wege zu leiten. Unter Beteiligung des Klägers war dazu auf der letzten Mitgliederversammlung des Vereins von Ende 2010 die „Mitgliederinitiative FC-Reloaded“ ins Leben gerufen worden. Außergerichtliche Aufforderung, die Mitgliederdaten herauszugeben Der Kläger forderte den Verein im Januar 2011 auf, einem als Treuhänder fungierenden Rechtsanwalt die vollständige Mitgliederliste herauszugeben. Ziel sei es, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen und für eine Satzungsänderung zu werben. Zu den geforderten Mitgliederdaten zählten Vor- und Nachnamen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort sowie (soweit bekannt) die E-Mailadresse. Der Verein ist grundsätzlich einverstanden, aber … Mit der Herausgabe der Mitgliederliste erklärte sich der Verein kurzfristig vom Grundsatz her einverstanden. Allerdings sollte die Weitergabe nur an einen Treuhänder erfolgen, den entweder der Verein oder der Präsident des Oberlandesgerichts Köln benennt. Der Treuhänder sollte sich weiterhin dazu verpflichten, die Mitgliederdaten vertraulich und ausschließlich zur Abwicklung des Minderheitsbegehrens zu verwenden. Zusätzlich sollte der Treuhänder den Inhalt des Minderheitsbegehren vor dem Versand auf werbende, abwerbende oder strafrechtlich relevante Inhalt prüfen. Zudem forderte der Verein sozusagen proaktiv seine Mitglieder auf mitzuteilen, ob sie der geplanten Übermittlung der Mitgliederdaten widersprechen. Von dieser Möglichkeit machten rund 14.000 Mitglieder Gebrauch. Herausgabe nur an Treuhänder und nur unter verschärften Bedingungen? 8 Da sich die Parteien außergerichtlich nicht einigen konnten, musste das Landgericht (LG) Köln entscheiden. Der Kläger ist der Meinung, dass er einen Anspruch auf Herausgabe der vollständigen Mitgliederliste hat, und zwar an sich selbst. Und selbst wenn man einen Treuhänder verlangen würde, so stehe dem Verein kein Mitspracherecht bei der Auswahl und der konkreten Ausgestaltung der Beauftragung zu. Schließlich sei ein etwaiger Widerspruch von Vereinsmitgliedern gegen die Weitergabe der Daten nicht wirksam. Diese Auffassung teilte der Verein nicht. Vielmehr vertritt er die Auffassung, dass – auch wenn er grundsätzlich zur Herausgabe der Mitgliederdaten an den Kläger verpflichtet sei – auf jeden Fall die Belange des Datenschutzes gewahrt werden müssten. Dies sei aber bei einer Herausgabe an den Kläger oder an einen von ihm benannten Treuhänder nicht sichergestellt. Die gerichtliche Entscheidung: Der Verein muss die Mitgliederdaten herausgeben Das LG Köln hat den Kläger in seinem Begehren bestätigt – jedenfalls insoweit, als es sich um die Herausgabe der Daten stimmberechtigter Mitglieder handelt. Nach Meinung der Kölner Richter steht dem Kläger ein Anspruch auf Herausgabe der Mitgliederliste zu, wenn und soweit er ein berechtigtes Interesse im Sinne der vereinspolitischen Ziele darlegen kann und diesem Begehren keine überwiegenden Interessen des Vereins oder der betroffenen Vereinsmitglieder entgegenstehen. Es besteht ein berechtigtes Interesse des Klägers Das berechtigte Interesse des Klägers besteht nach Auffassung des LG Köln darin, seine ihm aufgrund der Mitgliedschaft zustehenden Rechte wirkungsvoll ausüben zu können. Dazu zähle insbesondere das Recht auf Mitwirkung an der Willensbildung im Verein. Dabei müssen sich die Vereinsmitglieder nach Meinung des LG Köln auch nicht darauf verweisen lassen, mit anderen Mitgliedern über Internetforen, die Mitgliederzeitung o.ä. in Kontakt zu treten. Vielmehr liege es beim Mitglied zu entscheiden, auf welchem Weg und an welche Mitglieder es wie herantreten will, um auf die vereinsrechtliche Willensbildung Einfluss zu nehmen. Initiierung der Wahrnehmung von Mitgliederrechten ist nur außerhalb der Mitgliederversammlung möglich Das Bestreben zu einer Satzungsänderung könne der Kläger nach Einschätzugn des LG Köln angesichts der Mitgliederstruktur des Beklagten nur wahrnehmen, wenn er den Mitgliedern außerhalb der Mitgliederversammlung seine Anliegen bekannt machen kann. Dies ergebe sich aus der großen Zahl der Mitglieder und der in der Satzung vorgesehenen Anzahl an notwendigen Stimmen für eine Satzungsänderung. Dafür seien nämlich zwei Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 9 Das bedeute in der praktischen Konsequenz, dass ein Vereinsmitglied für eine Satzungsänderung außerhalb der Mitgliederversammlung die Zustimmung von mehreren Tausend der stimmberechtigten Vereinsmitglieder gewinnen muss, um überhaupt eine Befassung der Mitgliederversammlung ohne Unterstützung durch ein Vereinsorgan erreichen zu können. Der Kläger will seinen Auskunftsanspruch auch nicht anderweitig missbrauchen Die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs sei insbesondere auch nicht rechtsmissbräuchlich. Denn die angestrebte Satzungsänderung, die im Wesentlichen auf eine stärkere Beteiligung der anderen Vereinsorgane zielten, verfolgten keinen sitten- oder gar gesetzeswidrigen Zweck. Ob die Satzungsänderungen sinnvoll oder gar notwendig sind, sei gerade nicht Voraussetzung des Auskunftsanspruchs, sondern Gegenstand der Diskussion der Vereinsmitglieder. Datenschutz steht der Herausgabe der Mitgliederliste nicht entgegen Nach Auffassung des LG Köln stehen der Herausgabe auch keine datenschtzrechtlichen Bedenken entgegen. Denn die Vereinsmitglieder sind mit ihrem Beitritt zum Verein, der einen bestimmten Zweck verfolgt, in eine Rechtsgemeinschaft zu den anderen, ihnen weitgehend unbekannten Mitgliedern des Beklagten getreten. Die anderen Vereinsmitglieder hätten es insofern hinzunehmen, dass andere Vereinsmitglieder in berechtigter Verfolgung vereinspolitischer Ziele an sie herantreten. Es ist keine Einwilligung nötig Auch sei die Herausgabe der Daten unabhängig von einem Widerspruch der Mitglieder zulässig. Dazu bemüht das LG Köln die Regelungen aus § 28 Abs. 8 und 6 BDSG. Demzufolge sehe § 28 BDSG nur in Absatz 4 eine Widerspruchsmöglichkeit vor – und zwar im Falle der Weitergabe für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung. Ein Treuhänder ist nicht erforderlich Schließlich könne der Verein auch nicht verlangen, dass die Herausgabe nur an einen zur Verschwiegeneit verpflichteten Treuhänder erfolge. Denn nach Einschätzung der Kölner Richter sei der Schutz der Daten bereits dadurch ausreichend gewährleistet, dass das Vereinsmitglied die Mitgliederdaten nach § 28 Abs. 5 BDSG nur ihm Rahmen seines berechtigten Auskunftsinteresses nutzen darf. Würde das Vereinsmitglied die Daten anderweitig nutzen, würde dies durch den Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 43 Abs. 1 Nr. 4 BDSG ausreichend sanktioniert. Fazit Die Argumentation zu § 28 Abs. 8 BDSG überzeugt nur bedingt. Das liegt zunächst daran, dass es gar nicht um die Herausgabe besonderer Arten personenbezogener Daten – auf den § 28 Abs. 8 referenziert – ging. Insofern hätte sich eine Abwägung eigentlich an § 28 Abs. 2 Nr. 10 2 BDSG orientieren müssen. In einer Abwägung nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 BSG hätten dann auch die Widersprüche der anderen Vereinsmitglieder berücksichtigt werden müssen. Weiterhin ließe sich unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Datensparsamkeit (nach § 3a BDSG) auch darüber streiten, ob die Herausgabe der E-Mailadresse erforderlich war. Denn das Anschreiben des Klägers hätte auch auf dem Postweg verschickt werden können. Es kommt wie meist auf den Einzelfall an Die Entscheidung darf – angesichts der vielen unterschiedlichen Ausprägungen von Vereinen und deren Zielen – nicht als „Freibrief“ für die „unkontrollierte“ Herausgabe von Mitgliederdaten verstanden werden. Im entschiedenen Fall ging es „nur“ um einen Sportverein. Wenn aber z.B. ein politisch orientierter Verein betroffen gewesen wäre, wäre eine Abwägung zwischen dem Herausgabeanspruch eines Mitglieds und der Rechte der dadurch betroffenen anderen Mitglieder durchaus komplexer. Denn „politische Überzeugungen“ stellen besondere persönliche Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 BDSG dar und unterliegen besonderem Schutz. Daher ist immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls abzustellen. Der Urteil des LG Köln vom 27.09.2011 (Az. 27 O 142/11) ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2011/27_O_142_11_Urteil_20110927.htm l „ Datenschutz im Verband: Darf ein Verband die Mitgliederliste an seine Mitglieder herausgeben? Probleme des Datenschutzes gewinnen auch innerhalb von Verbänden zunehmend an Bedeutung. Dieses Thema wurde auch in der letzten Sitzung des DGVM-Ausschusses für Recht und Management (ARMA) behandelt. In dieser Sitzung wurde mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass die Herausgabe von Mitgliederlisten innerhalb der eigenen Organisation rechtlich 11 unproblematisch sei. Angesichts einer (vorläufig nicht rechtskräftigen) Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg ist es jedoch erforderlich, diese Problematik kritischer als bisher zu betrachten. Der Fall In einem bundesweiten Verbraucherschutzverein mit mehr als 50.000 Mitgliedern hatte es internen Krach gegeben. Eine Anzahl opponierender Vereinsmitglieder hatte die Herausgabe von Mitgliederlisten verlangt. Anlass hierzu war gewesen, dass der Verein eine Satzungsänderung in der Mitgliederversammlung beschlossen hatte, die nach Ansicht der Opponenten unwirksam war, weil nach ihrer Meinung nicht alle Vereinsmitglieder zu der Mitgliederversammlung eingeladen worden waren. Um die Wirksamkeit der Ladung nachprüfen zu können, verlangten die Opponenten von dem Verein die Herausgabe einer vollständigen Mitgliederliste mit Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sämtlicher Vereinsmitglieder. Erste Runde: Landgericht Hamburg Eine entsprechende Klage der Opponenten wies das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 3.1.2008 (Aktenzeichen: 319 O 135/07) zunächst ab. Zu dem Herausgabebegehren führte das Landgericht aus: “Eine Anspruchsgrundlage für die von den Klägern geltend gemachten Herausgabebegehren ist nicht ersichtlich. Die Rechtsprechung räumt Vereinsmitgliedern beim Vorliegen besonderer Umstände lediglich ein Recht auf Einsicht in die Mitgliederkartei ein. Ausdrücklich verneint wird jedoch ein Anspruch auf Übersendung sowie auf Herausgabe einer Aufstellung aller Namen und Anschriften. Dieser Auffassung schließt sich das Gericht an. Einzelnen Personen oder auch einer Personengruppe bei Vereinsstreitigkeiten die Namen und Anschriften sowie Mailadressen aller Mitglieder zu übergeben, verbietet sich schon aus Datenschutzgründen. Durch eine solche Herausgabe würde ein Verein nämlich jegliche Kontrolle über die Daten seiner Mitglieder verlieren und diese müssten befürchten, dass ihre Daten zu Zwecken verwendet würden, mit denen sie nicht einverstanden sind. In Ausnahmefällen, wie bei der beabsichtigten Einberufung einer Mitgliederversammlung auf Verlangen einer Minderheit (§ 37 BGB) mag es begrenzte Einsichtsrechte von Vereinsmitgliedern geben. Ein solcher Ausnahmefall liegt jedoch hier nicht vor. Zudem begehren die Kläger wesentlich mehr als eine Einsicht, sie verlangen in ihrem Antrag . die Herausgabe der Daten an sich oder einen Treuhänder. Eine Ausnahmesituation, die dies rechtfertigen könnte, ist nicht ersichtlich.” Zweite Runde: Oberlandesgericht Hamburg Mit diesem Urteil waren die Opponenten nicht zufrieden und zogen in die nächste Instanz. Mit einigem Erfolg: Das OLG entschied, dass die Kläger die Herausgabe der Mitglieder an einen Treuhänder verlangen können (Urteil vom 27.8.2009, Aktenzeichen: 6 U 38/08). Das OLG begründete die – einigermaßen überraschende – Entscheidung wie folgt (Hervorhebungen durch die Red.): “Die Berufung der Kläger hat . Erfolg, soweit sie . die Herausgabe der Mitgliederliste an einen Treuhänder verlangen. a) Der Anspruch folgt unmittelbar aus der Mitgliedschaft der Kläger im Verein. Die Mitgliedschaft verkörpert die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Mitgliedschaftsrechte und -pflichten und die Stellung des Mitgliedes im Rechtsverhältnis zu dem Verein (vgl. Soergel/Hadding, BGB, 13. Aufl., § 38 Rn 15). Aus diesem Rechtsverhältnis gehen die einzelnen Mitgliedschaftsrechte hervor, insbesondere Mitverwaltungsrechte wie das Recht des 12 einzelnen Vereinsmitglieds auf Teilnahme an der vereinsinternen Willensbildung. Dazu zählen das Recht auf Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und dort das Rederecht, Auskunftsrecht, Stimmrecht und aktive Wahlrecht sowie das in § 37 BGB geregelte Recht einer Minderheit, eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Mitgliederversammlung als das oberste Organ des Vereins ist damit das primäre Forum für die Ausübung der Mitverwaltungsrechte der einzelnen Mitglieder. Die Rechtsausübung ist aber nicht generell auf die Mitgliederversammlung beschränkt. Der Senat folgt den Stimmen in der Literatur, die dem einzelnen Vereinsmitglied außerhalb der Mitgliederversammlung bei einem berechtigten Interesse jedenfalls das Recht auf Einsicht der Bücher und Urkunden des Vereins einschließlich der Mitgliederliste einräumen (vgl. Sauter/Schweyer/Waldner, aa0, Rn 336; Reichert, aa0, Rn 1183; Soergel/Hadding, aa0, § 38 Rn 17.) Eine solche Einsichtnahme kann notwendig sein, um das Vereinsmitglied überhaupt in die Lage zu versetzen, seine Mitverwaltungsrechte in der Mitgliederversammlung geltend zu machen. Das Einsichtsrecht rechtfertigt sich deshalb aus einem notwendigen Vorbereitungsanspruch des Mitglieds. Dass sich dieses Recht nicht auf eine Ausübung in der Mitgliederversammlung beschränkt, erklärt sich schon daraus, dass sich bei dieser Gelegenheit die Einsicht in die Bücher regelmäßig schon aus technischen Gründen nicht bewerkstelligen lässt. Im Hinblick auf die Einsicht in die Mitgliederliste wird zwar oft das Argument herangezogen, es würde einzelnen Mitgliedern anderenfalls unmöglich, von dem Minderheitenrecht gem. § 37 BGB Gebrauch zu machen, vor allem in größeren Vereinen, in denen sich die wenigsten Mitglieder persönlich kennen (vgl. Sauter/Schweyer/Waldner, aaO, Rn 336; Reichert, aaO, Rn 1183). Daraus lässt sich aber nach Auffassung des Senats nicht der Schluss ziehen, für die Einsichtnahme in die Mitgliederlisten stets zu verlangen, dass sie für ein bereits konkret beabsichtigtes Minderheitsverlangen benötigt wird. Denn § 37 BGB gewährt einer Minderheit nur das zusätzliche Recht, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen zu lassen. Das kann aber nicht dazu führen, die ansonsten bestehenden Mitverwaltungsrechte der Mitglieder zu beschneiden. Das gilt erst Recht angesichts der Tatsache, dass § 37 Abs. 1 BGB ein Quorum von 10 Prozent der Mitglieder vorschreibt. § 6 Abs. 2 S. 2 der alten Satzung des Beklagten . verlangte sogar einen schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder. Da der Beklagte rund 50.000 Mitglieder hat, hätten danach für eine außerordentliche Mitgliederversammlung über 16.000 Mitglieder zu einem schriftlichen Minderheitsverlangen bewegt werden müssen. Die entsprechende Bestimmung in der neuen Satzung in § 7 Abs. 1 S. 2 sieht in Übereinstimmung mit § 37 BGB nunmehr zwar nur noch ein Quorum von mindestens 10 Prozent der Mitglieder vor . . Das sind aber auch noch 5.000 Mitglieder. Die Kläger können das für eine Einsicht in die Mitgliederliste notwendige berechtigte Interesse für sich in Anspruch nehmen. Entgegen der Darstellung des Beklagten geht es den Klägern nicht darum, allgemeine Meinungsäußerungen an mehr als 50.000 Adressaten zu verbreiten. Sie haben vielmehr schlüssig ihren Eindruck dargelegt, dass sich der Beklagte unter der neuen Führung vom Verbraucherschutz immer mehr entferne und sich zunehmend den Interessen der Versicherungswirtschaft annähere. Ob diese Einschätzung der Kläger berechtigt ist oder nicht, kann der Senat nicht beurteilen. Es lässt sich jedenfalls nicht feststellen, dass diese Bewertung nur vorgeschoben und von vornherein ausgeschlossen ist. Das erklärte Ziel der Kläger ist es, weitere Mitglieder von ihrem Einsatz gegen die ihrer Ansicht nach falsche Kursänderung zu überzeugen, so dass sie an zukünftigen 13 Mitgliederversammlungen teilnehmen und im Sinne der klägerischen Anliegen abstimmen, sei es zu Einzelfragen der Satzungsänderungen oder bei der Wahl der Führungsgremien. Der Senat teilt die Ansicht des OLG Saarbrücken, dass ohne Kenntnis der übrigen Mitglieder die Organisation einer Opposition gegen die Vereinsführung einschließlich einer Kandidatur für Führungspositionen oder eine vereinsinterne Wahlwerbung nicht möglich ist (OLG Saarbrücken NZG 2008, 677 f). Auf diese Weise wird im Übrigen auch wieder der Zusammenhang zur – ordentlichen oder außerordentlichen – Mitgliederversammlung, dem zentralen Forum des Meinungsaustauschs, hergestellt. b) Es besteht kein Grund, dem einzelnen Vereinsmitglied zwar die Einsicht in die Mitgliederliste zu gewähren, aber einen Anspruch auf deren Übersendung zu versagen (so auch OLG Saarbrücken NZG 2008,677, 678; BayVGH, Beschluss vom 05.10.1998, Az. 21 ZE 98.2707, 21 CE 98.2707, Tz. 13 (zit. nach juris); vgl auch Reichert, aaO, Rn 1183: ” .u.U. auf einen EDV-Ausdruck”). Soweit sich Sauter/Schweyer/Waldner für ihre gegenteilige Meinung auf eine Entscheidung des Kammergerichts beziehen (aaO, Rn 336), überzeugt das nicht, weil das Kammergericht in dem zu § 40 GmbHG ergangenen Beschluss die Zurückweisung auf den fehlenden Verfügungsgrund der Eilbedürftigkeit stützt (KG, NZG 2005, 83). Jedenfalls bei einem großen Verein wie dem Beklagten mit rund 50.000 Mitgliedern macht eine bloße Einsichtnahme in die Mitgliederliste wenig Sinn. Die Rechte des Beklagten und der übrigen Vereinsmitglieder sind durch die Übersendung der Mitgliederliste überdies nicht wesentlich mehr berührt als bei einem Einsichtsrecht. Die dadurch anfallenden Kosten hat allerdings gern. § 811 Abs. 2 BGB analog das Vereinsmitglied zu tragen, das die Herausgabe verlangt (vgl. OLG Saarbrücken NZG 2008, 677, 678). Die Kostenübernahme haben die Kläger . bereits berücksichtigt. c) Dem berechtigten Interesse der Kläger an der Herausgabe der Mitgliederliste stehen keine überwiegenden schutzwürdigen Belange der übrigen Vereinsmitglieder entgegen. Diese können zwar in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt sein, weil die Mitgliederliste Angaben über ihre Namen, Anschriften und e-mail Adressen enthalten. Es handelt sich somit um personenbezogene Daten, die in den in § 1 beschriebenen Anwendungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) fallen. Dessen Schutzbestimmungen sind auch dann zu beachten, wenn man § 31 GenG, der den Mitgliedern einer Genossenschaft ein jederzeitiges Einsichtsrecht in die Mitgliederliste gewährt, auf den Verein übertragen will (so Sauter/Schweyer/Waldner, aaO, Rn 336). § 31 GenG geht zwar gern. § 1 Abs. 3 BDSG den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes vor. Das kann aber nicht gleichermaßen bei einer nur entsprechenden Anwendung von § 31 GenG auf das Vereinsrecht gelten (vgl. Reichert, aaO, Rn 2574). Wie bereits dargelegt, dient die Offenbarung der Mitgliederdaten dazu, den Klägern die Wahrnehmung ihrer Mitverwaltungsrechte zu ermöglichen. Ob der Verein zur Herausgabe im Einzelfall unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten berechtigt ist, richtet sich nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BDSG. Danach ist das Übermitteln personenbezogener Daten als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässig, wenn es der Zweckbestimmung eines vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient, soweit es zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. 14 Nach Ziffer 3.1.3 der Information der Landesbeauftragten für den Datenschutz der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zum Datenschutz im Verein ist die Offenbarung von Mitgliederdaten für solche Zwecke wegen der Pflicht des Vereins, die Ausübung satzungsmäßiger Minderheitsrechte zu ermöglichen, regelmäßig im Vereinsinteresse erforderlich, ohne dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Mitglieder entgegenstehen . . Der Senat verkennt zwar nicht, dass sich diese Aussage der Informationsschrift, die auf einem Merkblatt des Innenministeriums von Baden-Württemberg beruht, unmittelbar auf Regelungen in Vereinssatzungen bezieht, die für Anträge auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung etc. eine bestimmte Mindestzahl von Mitgliedern verlangen. Aus den bereits dargelegten Gründen ist im vorliegenden Fall das berechtigte Interesse der Kläger auf Herausgabe der Mitgliederliste aber auch ohne eine unmittelbar beabsichtigte außerordentliche Mitgliederversammlung gegeben. Auf der anderen Seite kann über den Wunsch einzelner Mitglieder, ihre persönlichen Daten anderen Vereinsmitgliedern grundsätzlich nicht zur Verfügung zu stellen, nicht hinweggegangen werden. Die Mitgliedschaft bei dem Beklagten, der als Verbraucherschutzorganisation die Interessen der Versicherungsnehmer vertritt, berührt zwar keinen sonderlich sensiblen Bereich wie etwa die Mitgliedschaft in einer politischen Partei, einer Gewerkschaft oder einer Selbsthilfegruppe Suchtkranker. Dennoch muss das etwaige Interesse einzelner Mitglieder an der Geheimhaltung ihrer Daten respektiert und bei der Übersendung der Mitgliederliste beachtet werden. Das ist vorliegend dadurch gewährleistet, dass die Herausgabe an einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Treuhänder beantragt wird, der zum einen die in den Listen enthaltenen Daten nicht an die Kläger weitergeben darf und der zum anderen die ihm von einzelnen Mitgliedern aufgegebenen Untersagungen oder Einschränkungen zu beachten hat .. . Um den übrigen Vereinsmitgliedern Gelegenheit zu geben, solche Untersagungen oder Einschränkungen an den Treuhänder zu erteilen, ist ihnen allerdings vorab eine Widerspruchsmöglichkeit zu eröffnen (vgl. Gola/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz, 9. Aufl., § 28 Rn 27). Dazu wird der Beklagte den Mitgliedern das Urteil bekannt zu geben haben. Ein gesondertes Schreiben an jedes Mitglied wird hierzu nicht nötig sein. Vielmehr genügt eine entsprechende Information in den Vereinspublikationen, dem 8.-Info, dem Newsletter und dem Informationsportal im Internet. Selbst wenn man die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht an den Regeln des § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG für vertragsähnliche Vertrauensverhältnisse messen will, so würde die Übergabe der Mitgliederliste nicht am Datenschutz scheitern. Die Kläger wären dann zwar als Mitglieder des Vereins im Verhältnis zum Beklagten als Dritte i.S.v. § 28 Abs. 3 Nr. 1 BDSG anzusehen (vgl. Reichert, aaO, Rn 2574). Auch nach dieser Bestimmung ist aber eine Datenübermittlung an Dritte zulässig, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen können und schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Die Abwägung der widerstreitenden Interessen kann auch in diesem Zusammenhang nicht dazu führen, den Klägern die Mitgliederliste vorzuenthalten. Die berechtigten Interessen der übrigen Vereinsmitglieder werden dadurch geschützt, dass ihnen die Verpflichtung des Beklagten zur Herausgabe der Mitgliederliste bekannt gegeben wird, sie die Möglichkeit haben, der Offenbarung ihrer Daten zu widersprechen, der Treuhänder diese Weisung zu beachten hat und die Kläger selbst ohnehin keine Einsicht in die Liste nehmen können. d) Die auf einem berechtigten Interesse der Kläger beruhende Herausgabe der Mitgliederliste verletzt auch keine entgegenstehenden Belange des Beklagten selbst. Der Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung der Daten oder einer Verbreitung von rufschädigenden 15 Äußerungen wird dadurch begegnet, dass der Treuhänder die Mitteilungen, die die Kläger den übrigen Mitgliedern des Beklagten zukommen lassen möchten, darauf überprüft, ob sie einen werbenden Inhalt im Sinne von kommerzieller Werbung oder einer Abwerbung haben und ob sie gegen Strafvorschriften verstoßen . e) Die Kläger müssen sich nicht entgegenhalten lassen, sie könnten ihr Anliegen genauso gut verwirklichen, indem sie ihre an die übrigen Mitglieder gerichteten Informationen in der Vereinszeitung B.-Info, dem Newsletter und im Internetportal veröffentlichen. Da sich die Kritik der Kläger gerade gegen die gegenwärtige Vereinsführung richtet, müssen sie die Gelegenheit erhalten, sich unmittelbar an die Vereinsmitglieder zu wenden, ohne dass eine vorherige Kontrollmöglichkeit durch den Vorstand besteht, wie dies bei den Vereinsmedien der Fall ist. Die vom Beklagten aufgezeigten Alternativen sind daher nicht gleichwertig. Das gilt auch für den neu eingerichteten Mitgliederbeirat. Dort mögen einzelne Probleme intern beraten werden können, der Beirat bietet aber kein Forum, in dem die Kläger die übrigen Mitglieder in ihrer Gesamtheit – soweit sie nicht widersprechen – erreichen können.” Anmerkung Das OLG Hamburg sieht die Herausgabe der Mitgliederliste an einen Treuhänder als praktikable Lösung an. Diese Annahme dürfte sehr optimistisch sein. Zwar hat das einzelne Mitglied nach dem OLG-Urteil ein Widerspruchsrecht gegen die Verwendung seiner eigenen personenbezogenen Daten, doch muss es diesen Widerspruch auch in geeigneter Weise geltend machen können. Besonders bei mitgliederstarken Verbänden, die einige hunderttausend oder sogar Millionen Mitglieder (ADAC!) haben, dürfte diese Widerspruchsmöglichkeit zu erheblichen Schwierigkeiten führen. In dieser Hinsicht bleiben viele Fragen offen. Bei großen Organisationen dürften die von den Auskunftssuchenden zu tragenden Kosten erhebliche Größenordnungen erreichen. Möglicherweise wird diese Kostenlast eine gewisse Bremswirkung entwickeln. Das OLG Hamburg hat folgerichtig die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Das OLG hält die bisher höchstrichterlich noch nicht entschiedene Frage, ob einzelne Vereinsmitglieder die Offenbarung von Daten der übrigen Mitglieder bei berechtigtem Interesse auch unabhängig von einem konkreten Minderheitsbegehren verlangen können, für eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung. Mit Recht. Auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs darf man gespannt sein. (WE) 16