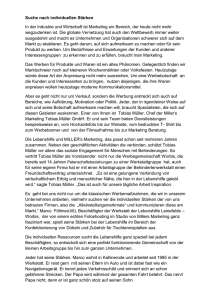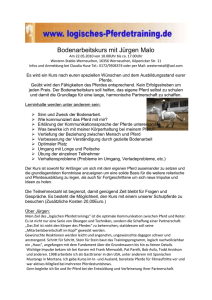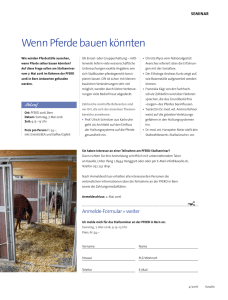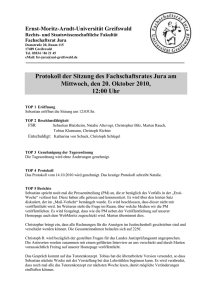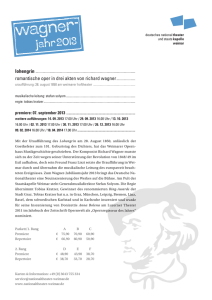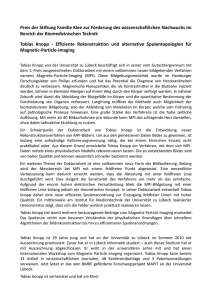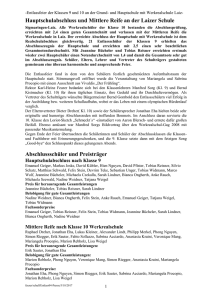Staub einer Fee
Werbung

„Staub einer Fee“ Eleonora, die magische Bewacherin Prolog Was war das für ein Gefühl? Plötzlich fühlte ich die Schwerelosigkeit in mir...War ich nicht eben noch auf festem Boden gewesen? Warum war es so, als ich meine Sinne ausschweifen ließ, ja, mir es so vorkam, als ob ich fliegen würde? Der Wind strich durch mein Haar, es war, als ob eine leise Brise mich kitzeln würde. Die Ärmel meines weiten Kleides streiften meine Haut, die eine Gänsehaut bekam. Langsam bekam ich es mit der Angst. Ich hatte doch nur vor Müdigkeit die Augen geschlossen. Es war im Wald, ich war erschöpft, lehnte mich gegen einen Baumstamm. Und ich war darüber wohl eingeschlafen….Aber, war ich das? Ich traute mich nicht, meine Augen zu öffnen. Na gut. Ein ganz kleines bisschen vielleicht. Meine Wimpern hoben sich und das Lid öffnete sich einen winzigen Spalt. Ein großes, lebhaft blickendes Auge, das bis vorhin noch verträumt gewesen war, wurde noch viel größer, als es sah, was sich ereignete. Ich flog. Ich flog tatsächlich. Eine Landschaft, tausende von Metern unter mir, zog unter meinen Füßen vorbei. Es sah alles so klein aus. So als ob ich die Welt beherrschen würde. Aber es war schön dies zu träumen, denn ich wusste, dass ich bald wieder aufwachen und mich an diesen Traum würde erinnern können. Allerdings vermochte ich nicht zu erahnen, warum ich eigentlich über weite Wiesen und Felder zog. Dazu noch mit einer rasenden Geschwindigkeit. Es war, als ob mir meine Sinne etwas zeigen wollten. Etwas Geheimes. Etwas Mystisches. Wie kam ich nur darauf? Ich war doch nur eine gewöhnliche Elfe. Aber die geheimnisvolle und übernatürliche Kraft flüsterte es mir ein, ja, zwang mich fast dies als gegebenen Fakt zu akzeptieren. Ich wurde immer schneller. Unter mir sah ich die Wolken auf den endlosen Weiten noch schneller vorbeiziehen. Meinen Schatten konnte ich nur erahnen. Ich flog über Täler, Wiesen, Flüsse, die mit atemberaubendem Rauschen und Donnern in ungeahnte Tiefen rauschten, 2 über Weiden und Dörfer. Manchmal sogar Städte, die riesig mit ihren dicht zusammengedrängten Häusern mir oft Angst einjagten. Ich hatte Städte noch nie gemocht. All dies zog in einer mir atemraubenden Geschwindigkeit an meinen Augen vorbei, und ich vermochte alles doch noch mitzubekommen, jedes Detail, jeder große Stein auf dem bergigen Hügel unter mir. Nun der Sand der Landstraße zu meiner Rechten, inmitten der unendlichen Weite eines saftigen Haines. Ich nahm alles wahr. Jetzt war es schon ein Meeresrauschen, das hinter hohen Klippen über die ich flog, gegen die Küste krachte. Aber mich riss der Wind aus meinen Gedanken, der nun immer heftiger an mir zerrte, mein Haar ins Gesicht wehte, meine Hände und Beine kälter werden ließ. Es war wie auf der Flucht vorhin. Nun hörte ich tief in mein Innerstes, lauschte der Spur der Gefahr, die in der Luft lag. Aber sie war anders, nicht real, nur hintergründig. Die Kraft führte mich. Ich brauchte nichts zu tun. Meine himmelblauen, durscheinenden Flügel glitzerten in der Sonne, als ich sie betrachtete. Nur um zu sehen, dass sie kaum schlugen, da ich bemerkte, dass der Wind mich ganz allein über das Meer trug. Wo auch immer er mit mir hin wollte. Aber ich schien schneller als er zu sein. Es war wie ein Sog, einen Sog, der mich anzog um mir etwas zu zeigen. Schon war ich in der Nähe einer Küste, die Wellen unter mir spritzten und schäumten, ganz so, als ob sie sich über meinen Besuch erzürnen würden. Ein unbekanntes Eiland erstreckte sich vor meinen Augen. Ich verlor an Höhe. Ich merkte es daran, dass ich meinen Schatten auf dem Erdboden sah. Ein großer, märchenhafter Wald streckte seine Ausläufer direkt vor mir aus. Er erinnerte mich an mein Zuhause, aber gleichzeitig bekam ich Angst. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Die Küste war schon längst nicht mehr in Sichtweite. Der Wald nahm mein gesamtes Sichtfeld ein, führte und zog mich zu ihm hin. Dort war etwas, dass mich rief. Auch wurde ich langsamer. Aber es geschah noch viel mehr, denn in dem Moment, an dem ich am Horizont dieses Gefildes einen unglaublich riesenhaften Baum 3 entdeckte, verschleierte sich mein bisher klarer Blick und Nebel tasteten nach mir. Meine Sicht verdüsterte sich immer mehr. Der Wind hatte plötzlich aufgehört an mir zu ziehen. Ich merkte es in dem Moment, als ich fiel. Auf einmal war die Strömung, die mich bis hierher gezogen hatte, mit all seiner übermenschlichen Macht verschwunden. Die Magie, die mich geleitet hatte, war, von einem Moment auf den anderen weg. Ich verlor meinen Halt, den Halt den ich so sehr brauchte. Verzweifelt versuchte ich, meine Flügel zum Schlagen zu bringen, doch sie gehorchten mir nicht in Ansätzen. Wie denn auch, ich hatte ja auch keine Magie mehr. Ich hatte sie auf meiner Flucht verloren. Noch immer hörte ich in Gedanken die grausamen Schreie meiner Verfolger. Aber das war jetzt eh unwichtig, ich würde heute noch auf andere Art und Weise sterben. Es war schon zu spät. Als ich ins Bodenlose trudelte, gen Bäumen, die mich im Tod bedecken würden, bemerkte ich das Rauschen von Schwingen. Keinen Flügeln wie meinen. Ich sah eine große Feder den Himmel herabschweben, sie kam aus gewaltiger Höhe und wirbelte direkt vor meinem Sichtfeld herum. Was war das für ein Ort, in dem Engel verkehrten? Was war das nur für ein Wald? Warum fühlte ich die Magie dieses Forstes und konnte sie dennoch nicht benutzen? Ich fiel und fiel. Meter um Meter. Und ich fragte mich, wo war ich nur gelandet? Dieser Platz musste ziemlich dunkel sein. Ich schloss meine Augen. 4 Kapitel 1 L’Eden Ich spürte den leisen Gutenmorgengruß meiner Heimstätte schon als ich hochfuhr, mit einem stummen Schrei auf den Lippen. Ich erwachte mit angstverzerrten Gesicht und schreckgeweiteten Augen. Nun war ich schon wieder an einem seltsamen Ort. Nein, seltsam war dies hier bestimmt nicht, nur für Fremde. Es war mein Zuhause. Aber es war ein wenig ungewöhnlich. Die Dunkelheit umhüllte mich, aber sie war durchbrochen vom schummrigen rosaroten Licht. Eine seltsame Mischung. Aber das war so, wenn man in einer Tulpe lebte. Blumen waren schon immer mein Zuhause gewesen. Sie waren meine Gemächer zum Schlafen. Aber jedes Jahr, wenn der Winter kam, musste ich mit Baumstämmen oder großen Pilzen mit mächtigen Hüten Vorrang nehmen. Sie waren nicht halb so komfortabel wie die weichen, schönen Blütenblätter von Tulpen, die sich des Nachts sorgsam um dich schlossen und man sich am Morgen den süßen Tau des Kelches als Frühstück genehmigen konnte. Das war schon ein komischer Traum gewesen. Doch an den davor konnte ich mich nicht mehr erinnern. Es war so verstörend gewesen. Ich sah nur noch Bruchstücke. Ich wusste, dass ich vor etwas geflohen war, aber was es war, konnte ich nicht mehr in mein Gedächtnis zurückzurufen. Eine Weile blieb ich noch so liegen und sannte über den vorigen „Traum“ nach, doch je mehr ich es versuchte, mich darauf konzentrierte, erfahren zu wollen, wer oder was mir solchen Schrecken eingejagt hatte, war es so, als würden diese Stücke noch viel schneller verblassen und sich mir 5 entziehen. Doch mein zweiter war so real gewesen. Beängstigend. Ich konnte mich stechend scharf an ihn erinnern. Doch warum fiel es mir so einfach? Dieser Wald war so bizarr gewesen. Fremd und furchteinflößend. Aber warum nur war ich im Traum auf einer Flucht gewesen? Es beschäftigte mich so sehr, dass ich mich noch einmal auf meinem Lager umdrehte und angestrengt nachdachte. Ich wusste es nicht, es gab keine Veranlassung zu einer Flucht, ich konnte mich an keinen Grund erinnern. Normalerweise ging das gut mit dem Erinnern. Selbst die kleinsten Dinge, die eigentlich nicht wichtig waren, merkte ich mir. War wohl Langeweile oder ein Tick. Und das Wichtige vergaß ich immer… Megara sagte dies immer zu mir. Meine beste Freundin und gleichzeitig Gefährtin auf meinen langen Streifzügen durch den verzauberten Wald, auch „L’Eden“ genannt, konnte mich immer aufmuntern. Und sie brachte einen immer zum Lachen! Sie war treu und lieb, konnte aber ihre Meinung nie zurückhalten. Manchmal plapperte sie drauflos, ohne an andere oder ihre Gefühle zu denken. Ganz abgesehen von den Konsequenzen die das haben könnte. Vielleicht konnte sie mir bei dieser Geschichte auch weiterhelfen. Ich erhob mich von meinem weichen Lager und breitete meine winzigen Flügel aus. Es war schon viel zu spät geworden und ich machte mir Vorwürfe, ewig über einen einzigen Traum nachgegrübelt zu haben. Den Silber- und Goldstaubbeutel legte ich mir auch noch um, denn der Tanz war heute und ich durfte nicht zu spät kommen. Sonst würde Megara wieder böse auf mich sein und ich wollte ihr keinen Grund geben, wieder ein Wettrennen als Gegenleistung auf den verspiegelten Auen gegen sie zu fliegen. Die verlor ich nämlich immer. 6 Die Auen waren ihr Reich. Dort lag auch ihr Haus, ein uralter Baum mit unglaublich vielen Astlöchern und Hohlräumen, von Moos und Efeu bewachsen, aber mit perfekter Aussicht, nämlich auf den Teich der Jahrtausende. Dort hatte die Königin der Elven einem Königssohn ein Schwert gegeben, das die Welt in der wir leben befreit hatte von der Dunkelheit. Das Schwert war ein magisches und mächtiges Relikt, das die Macht hatte, die Welt zum Guten zu bekehren. So erzählte man es sich jedenfalls. Die Dunkle Zeit, auch P’orilo genannt, war eine grausame und dunkle Epoche gewesen, in der niemand sicher war. Selbst Elfen konnten sich nicht verstecken und jede magische Kreatur musste in Furcht Leben. Die Elvin T’iana hatte den Hain mit einem ewigwährenden Bann beschützt, der keiner nichtmagischen Kreatur das Eintreten in unser Reich gestattete, während in der Welt außerhalb noch immer das Chaos herrschte. Aber dies war eine längst vergessene Sage, nur die alten Elfen und Feen erinnerten sich noch an diese mythenumrankte Legende. Und die Elven gab es ja schon lange nicht mehr. Und auch das sagenumwobene Schwert war schon seit mehr als nun fast einem Jahrtausend verschollen. Doch die Auen und der Teich der Jahrtausende erinnerten uns an die Elvin T’iana und das magische Schwert. Also hatte Megara eine der ersten Adressen des gesamten Waldes ergattert. Und eine geschichtsträchtige noch dazu. Ich stieß mich vom Boden meiner rosafarbenen Stätte ab, um in den azurblauen, leicht bewölkten Himmel aufzusteigen. Es ging nicht so gut, denn ich fühlte mich wieder ein wenig schwächlich. Es war wirklich höchste Zeit für den Tanz. Langsam durchschwebte ich mein Reich, mein vertrautes Zuhause, in dem ich geboren wurde. 7 In dem ich sterben würde, aber bis dahin sollten noch Jahrhunderte vergehen, jedenfalls solange dieser Wald noch die Kraft haben würde, zu existieren, denn selbst Magie hält sich nicht ewig. Ich flog an den magischen Quellen vorbei und steuerte auf die verspiegelten Auen zu, direkt auf den See, von dem vor nunmehr einem Jahrtausend die Welt gerettet worden war. Denn das magische Schwert der Elvin hatte das Schicksal der Menschen wieder in eine richtige Richtung gelenkt, so dass sich dessen Rasse aufrecht erhalten konnte. Bis jetzt. Am Ufer wartete bereits Megara auf mich. Sie wirkte leicht nervös. Man sah es an dem leicht hellgrünen Ton ihrer Wangen, sie waren dem sonst vorherrschenden Tannengrün ihrer Haut gewichen. Entweder war ihr speiübel oder sie war bleich vor Schock. Ihr welliges Haar legte sich in unzähligen Locken um ihre schmalen Schultern. Als sie mich herannahen sah, hob sie ihre langen Arme hoch über ihren Kopf um mich zu begrüßen. »Eli! Warum hast du so lange gebraucht? Die Sonne ist doch schon längst aufgegangen. Wir hatten gesagt zur dritten Stunde! – Janea ist schon wieder weg! Du hättest dich beeilen sollen!« Nach dieser Anschuldigung breitete sie aber trotzdem die Arme aus, um mich zu umarmen. »Ich weiß wirklich nicht, was in mich gefahren ist, liebste Schwester!«, erwiderte ich. Bitte sag nicht, wir fliegen. Bitte nicht! So nahm ich meinen Mut zusammen: »Dann machen wir den Tanz aber trotzdem heute?« Megara sah mich mit einem misstrauischen Blick an. »Müssen nicht?« wir Ein denn Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, das tausend sterbliche Mädchen vor Neid erblassen lassen würde. Ihre Anmut war einfach unglaublich. »Hast du etwa Angst, zu 8 versagen? Glaubst du, du schaffst das nicht? Komm Eli, wir sind die Ausgewählten und du weißt doch, dass ich den Tanz so gerne mit dir machen will!« Ein schwaches Lächeln von meiner Seite. »Und außerdem: Spürst du nicht auch, wie die Kraft nachlässt? Ich brauche ganz dringend einen Schub, ich konnte heute kaum aufstehen«, setzte sie noch zusätzlich hinzu. Mit einem großen Seufzer gab ich auf. Ich versuchte zu erklären: »Ja, es ist schon gut...Ich hab bloß schlecht geträumt.« – »Wirklich? – War es sehr schlimm? Aber sei froh, dass es nur ein Traum war, Eli. Sonst könnte ich nicht darüber lachen, dass du so spät gekommen bist!«, feixte sie. Ja, manchmal war sie wirklich fies. Aber Blätterfeen hatten das so an sich. Den ganzen Tag nichts zu tun außer Borkenkäfer aufzuziehen. Passte irgendwie zu mir, eine dermaßen schräge Freundin zu haben. Ich konnte stolz auf mich sein, eine Blätterfee gewonnen zu haben. Ich hatte dazu fast vergessen zu erwähnen, dass Blätterfeen sehr tanzwütig sind. Kommt bestimmt von der mangelnden Ablenkung. Aber sie war nun mal die beste der Jungelfen. Streber. So sollte man auch Megara, besonders als Fee immer mit Respekt begegnen. Denn wenn sie etwas sagte, meinte sie es auch so. Denn eine Blätterfee kann nichts anderes als die Wahrheit sagen. Vielleicht fiel es den anderen dadurch so schwer, sich mit Meg zu unterhalten? Es war immer etwas schwierig, wenn sie beispielsweise nebenbei anmerkte, dass dein Haar heute wieder besonders fettig aussah. Mit ihr war es hin und wieder kompliziert, aber das hinderte mich nicht daran, sie immer damit aufzuziehen. Zum Beispiel konnte man keinen Rosennektar mit ihr stehlen. Immer wenn wir nicht leise genug flogen und das Klingeln der Luft uns verriet und die Raupen, die sich an den Wildrosen rekelten uns entdeckten, konnte Megara nur gestehen, sich am wohlschmeckenden, süßen Honig mit mir vergriffen zu haben, wenn die Ältesten herannahten und uns einzeln verhörten. Irgendwie hatte ich mir mit der Zeit den 9 Titel als „Nektarpflückerin“ eingehandelt. Aber mit den Jahren war sie gut im Umgehen von derart „direkten Antworten“ geworden. Nur bei Ja- oder Nein-Fragen wurde sie durchaus auch mal sauer, weil sie die Antwort preisgeben musste, die eigentlich vertuscht werden sollte. So war sie immer noch größtenteils das liebe, unschuldige Feenkind geblieben und ich die böse Anstifterin, die alle Feen und Elfen in der Umgebung zu Unsinnigkeiten überredete. Na gut, ein wenig Wahrheit könnte dran sein. Aber nur ein wenig! Ich landete auf einem großen Stein, auf dem Megara stand und schon begann sich aufzuwärmen. Sie spannte ihre Flügel an und ließ sie flattern, während sie selbst dabei immer wieder vor sich hin murmelte: »Und eins zwei drei – Wiege – ein vier fünf – drehen…« – Ich schaute sie schon längst nicht mehr schräg an, denn auch ich war beschäftigt, die aufkommende Unruhelosigkeit mit mir zu vereinbaren. Ich konnte nicht lange genug auf einem Punkt verweilen. Mit tänzelnden Schritten begann auch ich immer wieder die Formel für die richtigen Tanzschritte zu murmeln. War die vierte Drehung nach dem Ausfallschritt? Oder überkreuzten sich einfach nur die Fußspitzen? Schon wieder wurde ich mir unsicher. Mein Gedächtnis war so lückenhaft! Als wir die Tanzstunden bekommen hatten, hielt ich es für wichtig. Das war ja mal wieder klar. Ich kann unter Druck einfach nicht arbeiten! Schon durchbrach das leise Flattern der Flügel der Ältesten meine Konzentration. Sie waren zu dritt. Unsere Tanzlehrerin, eine alte Fee, die den Ruf genoss, die schönste Blumentänzerin in L’Eden zu sein, schloss zu uns auf. »Seid ihr auch wirklich vorbereitet? Ihr wisst, dass dies heute keine Probe sein wird!«, ermahnte sie uns streng, aber dennoch auf eine mütterliche Art und Weise. Megara bejahte sehr eifrig. Sie war wirklich sehr aufgeregt, aber das gehörte bei ihr dazu. Je aufgeregter meine Gefährtin war, desto besser die Leistung, die sie letztendlich erbrachte. Ich nickte nur stumm und bereitete mich auf die Schmach vor, mal wieder neben meiner Freundin wie das letzte Mauerblümchen auszusehen. Das kann ja heiter werden… 10 So sollte es also beginnen. Wir stießen uns mit einer Bewegung, die bei Megara grazil aussah und bei mir grazil aussehen sollte, vom Boden ab, um unseren Tanz zu eröffnen. 11 Kapitel 2 Torleo In einem fernliegenden Land, viele Tagesreisen von L’Eden, kroch zu diesem Zeitpunkt ein zierlicher Sonnenstrahl aus den Wolken, um seinen Weg hinab auf den Boden der Erde zu finden. Dieser ersten Morgenstrahl, der sich bemühte, durch die äußerst dichten Wolkengebilde zu dringen, gelangte als Erstes in das Königreich spendete er Molon. einem Dort kargen Landstrich, der so flach wie ein Meer ohne Wellen war, sein Licht. Es gab weder viele Bäume, noch ein Flussdelta. Doch Herden voller Kühe grasten in der ganz sanft geschwungenen Ebene, die ein großes Tal zwischen zwei Gebirgen bildete. Es war mehr eine kleine Kluft denn alles andere. Es gab viele Felder. Ein kleines Dorf schmiegte sich an den einzigen Ausgang dieses Kessels. Das Tal, das von seinen Bewohnern, „die Brücke”, Torleo, genannt wurde, hatte es gut. Doch Rauch in der Ferne hatte, seit dieser vor zwei Tagen erschienen war, dessen Einwohner in Furcht versetzt. Der beginnende Morgen im Dorf war wie immer neblig. In einer kleinen Bauernkate, am Rande dieses Dorfes Torleos gelegen, knarrte das Gartentor im Wind. Das Haus sah sehr alt aus. Seine Wände waren schief, die Scheune war letztes Jahr abgebrannt. Der dazugehörige Hof war in schlechtem 12 Zustand. Das Wohnhaus an sich war klein und ausgebessert. Eine Rosenhecke, die sich beinahe über die halbe Behausung zog, verborg fast vollständig ein kleines Fenster, das ein kleines und einfaches Schlafzimmer hinter sich behielt. Ein Junge mit Namen Tobias wälzte sich unruhig auf dem Bett umher. Sein sonnengebräuntes Gesicht, mit vielen winzigen Sommersprossen, verzog sich ungewollt während seines Schlafes. Sein dunkelbraunes und ungekämmtes Haar stand in allen Richtungen ab, die Augen waren zusammengekniffen. Draußen wurde es langsam heller, und der Junge schlug sich noch immer auf seinem Feldbett von einer Seite zur anderen. Er träumte schlecht. Außerhalb des Zimmers polterte es leise. Nach einer Weile brutzelte das Feuer und der würzige Geruch von aufgewärmter Suppe durchzog alle Räume. Es gab drei davon. Als die einzige gusseiserne Pfanne heraus gewühlt wurde, wachte Tobias auf. Das Scheppern hatte ihn geweckt. Erschreckt fuhr er hoch. Er wusste eine Zeitlang nicht, wo er war, bis er bemerkte, dass der schreckliche Alptraum, den er gehabt hatte, nicht der Wirklichkeit entsprach. Er nahm seine Umgebung nun deutlicher wahr, war aber immer noch beunruhigt. Schon wieder so ein Traum. Er kommt immer wieder…Vielleicht ist es eine Botschaft? Visionen? Ja, das würde gut zu mir passen. »Tobias! Komm sofort her, du musst die Eier fertig braten!« Wer das wohl war? Natürlich seine herzallerliebste Mutter. Sein Vater war schon auf den Feldern, er würde ihm später etwas zum Essen mitbringen, wenn er selbst zur Arbeit gehen würde. Unwillig verzog der Junge sein Gesicht und brachte es fertig, gleichzeitig ein herzhaftes Gähnen zustande zu bringen. Seine Mutter war schon immer zu allen Menschen dermaßen nett und rücksichtsvoll gewesen. Allerdings hatte es sein Vater erst nach der Hochzeit mit ebenjener gemerkt, nachdem er einmal vergessen hatte, 13 den Stall der Scheune auszumisten. Seitdem musste er dort schlafen. Er fragte sich bis heute, wie er nur dazu gebracht worden war, sie als seine Frau zu nehmen. Er wusste nur noch, dass es eine durchzechte Nacht gewesen war. Vollmond. Nur konnte er seit letztem Jahr nicht mehr in der Scheune schlafen, da ein Waldfeuer sie völlig abgebrannt hatte. Und nun konnte er dem Hausdrachen nicht mehr entkommen. Tobias ebenfalls nicht. Deshalb verbrachten die Männer unter der Knechtschaft und Schreisucht dieser äußerst reizenden Frau ihre Zeit lieber auf den Feldern oder auf Märkten. Zu denen man wirklich lange hinfahren musste. Gottseidank. Seine Kindheit oder fast abgeschlossene Kindheit, denn er war sechzehn, war unter seiner Mutter nicht wirklich förderlich gewesen. Bis auf die Tatsache, dass er ohne Probleme eine Großfamilie bekochen könnte. So hievte sich Tobias missmutig aus dem Bett und begann sich anzuziehen. Müde rieb er sich die Augen. Langsam glaubte er wirklich verrückt zu werden. Er nahm sich seine Kleidung, ein einfaches Leinenhemd und –Hose und zog diese sich fröstelnd über. Er beeilte sich, denn die Eier in der Wohnküche rochen schon etwas angebrannt. Schnell schlängelte er sich durch den Spalt zwischen Tür und Bett. Er musste sich beim Durchqueren des Türrahmens wie immer sehr ducken, da er nicht der Kleinste war. Schon längst hatte er aufgehört, sich über Beulen am Kopf zu beklagen. In der Wohnküche angekommen nahm er sich sofort der Pfanne an, in der die Eier schon beträchtlich vor sich hin brutzelten und wendete sie schnell. Verstohlen blickte er aus dem Fenster. Seine Mutter unterhielt sich – wie die andere Hälfte des Tages auch - mit der Nachbarin. Rasch zog er das Essen vom Feuer und mit spitzen Fingern balancierte er die Pfanne mit den Spiegeleiern hinüber zum alten und morschen Esstisch, der von zwei langen Sitzbänken umgeben war. Die Blumen auf dem Tisch mussten mal wieder ausgewechselt werden. Er deckte auf und rief nach seiner Mutter, die grollend wie ein kurz vor dem Ausbruch stehender Vulkan ins Haus zurückkam. 14 Kaum betrat sie den Raum, fing sie auch schon an zu fluchen: Die Radieschen der Frau seien viel größer als ihre; die Katze war mal wieder verschwunden und nun verbreiteten sich die Mäuse schneller als die Pest und ähnliches. Ihr Sohn nahm sich nur die Kelle und zwei Teller und begann die Suppe aufzutragen, während seine Mutter weiter zeterte. Die Ruhe in Person. »Was hast du heute vor?« - »Nicht viel. Essen bringen. Arbeiten. Vielleicht noch auf den Markt, aber ich glaube eher nicht, da es spät werden wird auf den Feldern.« Sie nickte nur und begann schnell und hastig die sehr heiße Suppe zu löffeln. Kalt kochen ging ja nicht, aber beschweren tat sie sich trotzdem. Innerlich schüttelte Tobias laut aufseufzend den Kopf. Wo war er nur gelandet? Als sie aufgegessen hatte, erhob sie sich sofort unruhig von der Bank und begann in der Küche auf und ab zu gehen. Wie jeden Morgen sah ihr sein Sohn gelassen zu und schlürfte weiter sein Süppchen. Nun kam der amüsante Teil, das, warum er sich jeden Morgen aus dem Bett quälte. Seine Mutter schnappte sich die nächstbeste Zange / Fleischermesser /Knüppel oder etwas ähnlich Geeignetes zum Erschlagen und begann, wie eine Wilde auf die Fliegen im Raum loszugehen: »Ich krieg euch ihr kleinen Biester, ihr fliegt mir nicht nochmal in meinen Erdbeerkompott von letzter Woche! Ihr habt nichts besseres zu tun außer euren Dreck rumliegen zu lassen!« Mit diesen Manöver seiner Mutter und einem Schulterzucken von seiner Seite, mit Lachkrämpfen geschüttelt, die am besten vertuscht werden sollten, verabschiedete sich Tobias täglich von ihr. Schnell verließ er das Haus, denn das Frühstück für den Vater war schon bereit. Er packte flink seine Sachen zusammen und flüchtete aus der Tür. Während er immer noch von Weitem das laute Rumsen, wenn etwas auf Holz krachte und das Fluchen, das immer darauf folgte, lauschte, ging er schnellen Schrittes die Allee, die vom Dorf weg führte, entlang. Die Sonne stand bereits höher am Himmel, als er erwartet hätte und die meisten der Nebel hatten sich schon verzogen. Er wusste nicht warum, aber Tobias mochte Nebel. Sie wirbelten im Sonnenlicht und wirkten mysteriös, ganz besonders wenn sie 15 sich fast am Boden befanden, ganz so, als ob sie etwas verstecken wollten, das sich auf einem zu schlich. Uhh, Gänsehaut. Gleichzeitig so nah und ungreifbar. Weiter ging es, immer geradeaus, bis zu einem großen Holzgatter, an dem er das Paket für seinen Vater ablegte und laut pfiff. Aus der Ferne hörte man ein lautes »Hooo!«, was die Ochsen, die den Ackerpflug zogen, anwies, stehen zu bleiben. Sein Vater war den ganzen Tag alleine draußen auf diesem einzigen Stück Land, was ihm geblieben war. Tobias stellte sich an das Gatter und sein Vater kam auf ihn zu: »Hast du schon gehört, was die Nachbarn reden? Im anderen Tal soll es einen Aufstand gegeben haben, der König hat alles blutig niederschlagen lassen…« Natürlich hatte es Tobias schon mitbekommen, denn wenn man in einer Schmiede arbeitete, bekam man schon so einiges mit. Reisende waren die erste Quelle von Torleo und die Schmiede einer der wenigen Orte, die das Dorf attraktiv machten. Und auch nur weil es im Umkreis dieses Tales kein einziges Dorf mehr gab, außer Zenobo, den anderen Flecken auf der gegenüberliegenden Seite. Seit der letzten Woche qualmte es von da und es lag etwas Schweres in der Luft. Verrat. Zenobo schien eins der Widerstandsdörfer der Rebellen zu sein, die sich gegen das Königreich wehrten. Natürlich war das dumm von den Widerstandskämpfern gewesen, sich dermaßen offensichtlich in einem Dorf aufzuhalten. Nun musste es dafür bezahlen. Gegen den König zu kämpfen kam für Tobias nie in Frage. Was hatte er schon damit am Hut? Er war doch eh nur ein gewöhnlicher Bauernjunge, der sein Leben lang nichts anderes tun würde außer hart zu arbeiten. Ein wenig Widerstand würde niemals etwas an diesem Zustand ändern. Außer vielleicht die Höhe der Abgaben, die regelmäßig von den Bauern entrichtet werden mussten und die Familie deshalb schon seit über einem Jahrzehnt am Hungertuch nagen ließ. Bessergesagt, seitdem er geboren wurde. Manchmal war es schwer für ihn zu ertragen, dass andere reisen 16 und gehen konnten, wohin sie wollten, während er noch immer arbeitete. Er würde jahrein und jahraus dasselbe tun. Das wusste Tobias, und deshalb suchte er sich die einzige Arbeit, die ihm im Leben bisher fasziniert hatte. Die Arbeit mit Metall. Seitdem er einmal als kleiner Junge einen großen Ritter mit Schwert und Rüstung gesehen hatte, wollte er auch einer sein. Nur leider waren die elterlichen Mittel begrenzt gewesen und er leistete eifrig Revolte in Form von Tobsuchtanfällen und Weinkrämpfen, was ihn aber nie davon abhielt, trotzdem an seinem Traum weiter festzuhalten. Deshalb hatte er sich auch bei einer Schmiede als Lehrling beworben. Metall faszinierte ihn halt, was konnte er schon dagegen tun? Und selbst wenn es nur Hufeisen formen war, er liebte die Arbeit mit Amboss und Hammer. Kopfschüttelnd nahm er nun die traurige Nachricht, die man schon allgemein vermutet hatte, entgegen: »Ja, ich hab davon gehört, mein Meister vermutete es bereits. Ich habs auch gedacht, aber wer hier will das schon glauben?« Ein bekümmertes Nicken vom Vater, dessen Gesicht mit zahlreichen Falten übersät war. Er war ein Mann, der sich zu viel Sorgen machte. Wegen Rücksicht und Taktgefühl war er immer schon der Vermittler in Streitdingen innerhalb der Gemeinde gewesen. Man hielt ihn für sehr weise, was auch zu seiner Statur passte, er war hager, klein und sehnig, sagte nie sehr viel. Er hielt sich aus den Dingen raus, die ihn nichts angingen, war also unparteiisch. Ein stiller und genügsamer Mensch mochte man meinen. Kein Wunder, warum er es ewig mit seiner Frau ausgehalten hatte, denn Geduld war eine Tugend, die er perfekt beherrschte. Worauf er wartete, hatte bisher niemand rausfinden können. Tobias reichte ihm das Essen über den Zaun und rannte schnell zurück, denn die Schmiede lag mitten im Dorf. Der Sand sprang um seine Beine, als er die Füße immer schneller aufsetzen ließ, da er merkte, dass er sich verspätete. Doch er kam nicht weit. Auf einmal war auf der Straße kein Durchkommen mehr. Ein riesiges Pferd versperrte ihm den Weg. Und auf ebendiesem saß ein Mann der ihm viel Angst einjagte. Er hatte langes und fettiges schwarzes Haar, dass sich in Strähnen über eine 17 kaum gewölbte Stirn und ein schmales, kantiges ergoss, Gesicht welches die kaltherzigen Augen kaum zu verdecken mochte. Haut fast war Seine weiß. Er erinnerte ihn an einen Geier, da er einen Ausdruck um den Mund aufwies, als hätte er etwas schlechtes gegessen und wäre dabei, zu überlegen, ob er es ausspucken würde oder nicht. Abfällig blickte er auf den Jungen herab. »Wo geht’s hier zur Schmiede? Weißt du, wo sie sich befindet? Mach schnell, ich hab keine Zeit für kleine Leute für dich!« Als Tobias ihn sah, wunderte er sich noch, dass so ein Mann wie er überhaupt auf dieses riesenhafte Pferd gekommen war. Laut schnaubend stand es vor ihm und trampelte unruhig von einem Fuß auf den anderen. Der etwas kleinwüchsige Mann mit dem eiskalten Blick hatte alle Mühe es zu bändigen. Es musste ununterbrochen stundenlang gelaufen sein, da es schweißüberströmt und laut schnaufend vor Tobias stand. Es schien sehr erschöpft, aber auch wütend und gleichzeitig sehr aufgeregt. Tobias fürchtete sich vor ihm, aber noch viel mehr Grauen flößte ihm das strenge Gesicht des Mannes ein. Eingeschüchtert schaute er hoch zu ihm, der einen großen schwarzen Mantel um die Schulter trug und böse dreinblickte. »Ja, natürlich kann ich, mein Herr…Natürlich kann ich Ihnen die Schmiede zeigen, ich arbeite dort. Wenn Sie mir folgen würden…«, stammelte er und setzte sich in Bewegung. Er wollte unbedingt weg von ihm. Doch viel nützte es nicht, denn er musste feststellen, dass dieser bohrende Blick nun in seinem Nacken ruhte. Das Pferd setzte sich fiebrig in Gang und trabte seitlich neben Tobias her. Es schnaufte laut, und Schaum hatte sich am Maul gebildet, die lange zottelige Mähne hing in langen Strähnen den muskulösen Hals hinab. Aber als der Junge sich endlich 18 traute, genauer hinzusehen, sah er ein leuchtendes braunes und warm dreinblickendes Auge, das ihn erpicht musterte. Ein Zwinkern folgte. Nein, das war nur Einbildung, dachte er erschrocken und schaute schnell wieder woanders hin, nur nicht zum Pferd, dessen Halsansatz gerade da anfing, wo Tobias Kopf endete…Wie war der Mann da nur hochgekommen, mit einer Leiter? Auf einem Baum geklettert? Tobias glotzte das Pferd an und fragte sich, warum so ein Tier womöglich neue Hufeisen brauchte, denn es sah so aus, als ob ebenjene mit Leichtigkeit alles kleinkriegten, was unter ihnen kam. Und ob die Hufeisen die Größten wären, die der Meister je hätte machen müssen. Wahrscheinlich. Das Schweigen war unangenehm. Das Pferd keuchte und trabte immer noch laut und weithin vernehmlich den Feldweg zum Dorf entlang, Tobias‘ Sandalen knirschten auf dem Sand. Und der Mann schaute sehr stur und zielstrebig geradeaus. Ein Gespräch hätte die Situation bestimmt aufgelockert. Endlich kamen sie an der Schmiede an. Der Mann stieg ab und ließ das Pferd vom Stallburschen fortführen, der es füttern und tränken sollte. Der Meister kam aus der Schmiede um zu sehen, was passierte. Er hielt ein großes Tuch in den Händen, mit dem er sich Hände säuberte. Eine Sorgenfalte bildete sich auf seiner Stirn. Er war klein und breit gebaut, ein richtiger Schmied mit langen und muskulösen Armen. Und Trinken konnte er auch, er hielt den Dorfrekord für 10 Bier innerhalb von einer Stunde und war wohl einer der Verantwortlichen, die seinen Vater Tobias‘ Mutter kennenlernen ließen. Er war gewissermaßen ein Freund der Familie, der immer noch guten Ton auf den Genuss von Alkohol am Abend legte. Seine mit den Jahren grau gewordenen Haare passten aber nicht zu den ausdrucksstarken Bewegungen des Schmieds. Seine Mimik war aber im Moment eher eine steinerne Maske. Die rosigen Wangen spiegelten in diesem Moment keine Heiterkeit und Lebenslust wieder, sondern waren ernst und entschlossen. Mit festem Schritt ging er auf den Mann zu, der dabei war, sich den Mantel von der Schulter zu werfen und ihm den nächstbesten Jungen in die Arme fallen zu lassen. Der Mann sagte mit lauter und mit Verachtung strotzender Stimme zu niemand 19 bestimmtes: »Ich erwarte mein Pferd morgen wieder, an genau dieser Stelle. Doch zuerst führt mich jemand zum Gasthaus, ich bin müde!« Mit einem Fingerzeig deutete er auf Falkhir, Tobias‘ Meister: »Du da! Hol mir einen her, der was von Pferden versteht! Ich brauche einen, der dieses Ungetüm hier bändigt, es frisst mir noch die Haare vom Kopf mit seiner dauernden Unruhe. Zweimal hätt mich der verdammte Gaul heute beinahe abgeworfen! Und neue Hufeisen braucht das Monster auch.« Der Meister stand in der Ecke und wunderte sich. Noch nie war er so schlecht angeredet worden. Seine Gesichtszüge verhärteten sich noch mehr. Er ging so nahe an den Mann heran, dass er nur noch eine Armbreit von diesem entfernt war und sprach mit ruhiger, aber einem drohenden Unterton in der Stimme: »Mein Herr, ich weiß wirklich nicht wer Sie sind, doch mit einem Gruß würden Sie sich auch keine Feinde machen«. Mit diesen Worten drehte sich Falkhir um und ließ den verdattert dastehenden Mann alleine mit seinem nun noch mehr steinhart gewordenen Gesicht. Er kam drei Schritte weit. Denn auf einmal stand er vor Tobias‘ Meister. »Wenn das eine Drohung hätte sein sollen, würde ich mich in Acht nehmen, was Sie wem sagen, die Rollen sind hier streng verteilt, Schmied. Wenn sie nicht wissen, wer ich bin, sollten Sie schnell Kenntnis darüber einholen.« All dies wurde mit einer sehr beleidigten und nicht zu vergessen bedrohlichen Körperhaltung vorgetragen. Der Schmied zuckte auffällig zurück, angesichts solch einer unheilschwangeren Aggressivität. »Zum Gästehaus geht es hier entlang mein Herr, die Betten sind schon für Sie hergerichtet und ein Glas Wein wird Ihnen bald von meiner Frau gebracht werden, da seien Sie versichert.«, brachte er mit einer halbgeschockt dreinblickenden Miene hervor. »Schön, dann werde ich gehen. Und achtet bloß auf mein Pferd, dass es nicht alle Stuten verrückt macht!« Da haben sich ja zwei gefunden. Währenddessen sich diese amüsante Szene, die den meisten Angestellten der Schmiede Angst einjagte und sie stocksteif auf dem Hof stehen ließ, abspielte, stand Tobias am Tor des Stalles und 20 beobachtete das große schwarze Pferd, wie es vom Stallmeister abgesattelt werden sollte. Die Leute, die bisher gegafft hatten, machten sich auch wieder an ihre Tätigkeiten. Lene, die Tochter des Hauses, nahm auch wieder ihren Korb mit Früchten auf und verschwand im Wohnhaus des Meisters. Die Schmiede gehörte zu einem großen Hof mit Gasthaus und einer etwas reicheren Bauernfamilie, die relativ viel Macht in Torleo besaß. Das waren die Genters. Sie hatten eine Tochter, die in Tobias‘ Alter war, und manchmal spielten sie und Tobias miteinander, doch seitdem er die Lehre angefangen hatte, war keine Zeit, da mit dem Beginn der Ausbildung viele Pflichten auf den Sohn vom Vater abfielen, so dass Tobias immer viel zu tun hatte und es wenig Zeit zum Spielen blieb. So ging sie auch dieses Mal einfach an ihm vorbei. Und würdigte ihn keines Blickes. Mädchen. Pah. Verbittert stand der Junge in der Stalltür und überlegte, was er für heutige Aufgaben bekommen würde, als er noch einen Blick zu dem unheimlichen Mann, der sich mittlerweile auf den Weg zum Gasthaus, das im selben Hof wie die Schmiede war, begeben hatte. Mit großem und starkem Schritt trat er voran, eine beunruhigende Erscheinung, der Junge, der den Umhang des Fremden trug, stolperte unsicher hinter ihm her. Er trug schwarze Reitkleidung und ein dunkelbraunes, aus Wildleder bestehendes Wams. Seine Stiefel, die bis über die Knie reichten, trugen Sporen. Das lange Haar glänzte in der Sonne des kommenden Mittags und gab ihm ein eingebildetes Aussehen. Mit der einen Hand durch das gelige Haar streichend, staubte er sich mit der anderen die Reitkleidung ab und sagte etwas unverständliches in Tobias‘ Richtung. Doch dies kam nicht bei dem Jungen an, gab es doch auf der anderen Seite des Platzes, der mit grobem Kopfsteinpflaster ausgelegt war, ein Wiehern des schwarzen Pferdes. Es lenkte Tobias‘ Aufmerksamkeit wieder zurück zu dem Hengst, war es doch das größte Pferd, was er je gesehen hatte. Mit aufgerissenen Augen verfolgte er das Szenario, was sich ihm darstellte. Der Hengst bäumte sich auf und entriss mit einem Ruck die Zügel dem Stallmeister. Bockend und mit den Hufen ausschlagend riss es sich los und war drauf und dran vom Hof zu rennen. Doch schon sammelten 21 sich in Windeseile Männer, die einen großen Halbkreis um das wildgewordene Pferd bildeten und versuchten, es einzukreisen. Sie verringerten den Abstand zwischen sich immer mehr, doch der Hengst bemerkte dies und wurde nur noch panischer. Seine Augen wurden unbändig und traten hervor und wie von Sinnen galoppierte es los und schlug sich einen Weg durch die Horde der kräftigen Männer, zwei davon zu Boden stoßend. Hart schlugen sie auf dem Pflaster auf. Tobias, der auch zu ihnen gelaufen war, um Unterstützung zu leisten, war mit einem Satz schon auf dem Weg gen Hoftor, wo er sich gegen das Gatter warf und mit einem kräftigen Schwung das Tor ins Schloss fallen ließ. So konnte das Pferd nicht ausbüchsen, denn er war schneller als jenes gewesen. Doch nun hatte er ein Problem. Das Pferd hatte offenbar nicht wirklich mitbekommen, dass das Gatter zugesperrt worden war und raste direkt auf den Jungen zu. Mit entsetzengeweiteten Augen und einem lauten »Ohhh, nein!!!« von Tobias Seite und einem Aufschrei unter den Männern galoppierte es immer weiter auf ihn zu. Tobias warf schützend die Arme vor sein Gesicht und wendete sich mit dem Oberkörper ab. Er schloss die Augen und wartete auf irgendetwas. Ja, auf irgendetwas. Doch es kam nichts. Ein paar Sekunden lang nichts. Es war still geworden. Komplett still. Nur ein leichter Windhauch war das einzige, was er spüren konnte, Tobias war vor Angst noch komplett gelähmt. Zögernd, langsam, öffnete er vorsichtig eins seiner Augen und drehte sich ein wenig herum. Da. Schon wieder ein Luftzug. Und ein Schnauben. Vor ihm stand das Pferd. Und atmete ihn an. Ein und aus. Ein und aus. Ganz ruhig, ganz ruhig, versuchte er sich zu beruhigen. Doch irgendwie war nicht er der Ruhige, sondern das Pferd. Denn friedlich wie ein unbescholtener Engel stand es direkt vor Tobias und rührte sich keinen Millimeter. Interessiert und mit seinen großen nussbraunen Augen sah es auf ihn herab. Na ja, es war ja auch der Überlegene in der Geschichte. Wer konnte denn wen innerhalb von zwei Sekunden zu Brei trampeln? Der Junge wagte es nicht, sich zu rühren. Allerdings wurde es wohl langsam dem Pferd zu bunt, stand es doch schon seit knapp einer halben Minute still, denn langsam hatten sich die Männer 22 wieder gesammelt und standen nun abseits am Hofzaun, nicht weit vom Gatter entfernt. Ungeduldig werdend, aber immer noch eine ungeahnte Freundlichkeit ausstrahlend, beugte es seinen Kopf herab und stupste, unerwartet zärtlich, seinen Kopf an Tobias Schulter. Mit einem leisen Wiehern rieb er zweimal sehr sanft seinen Kopf an ihn. Der Junge erwachte aus seiner Erstarrung. Sein Schock in den Augen wich nun einem verdatterten Blick und einem großen Fragezeichen in seinem Kopf. War das Pferd nicht eben noch wütend und unruhig gewesen? Warum war es jetzt auf einmal so gefasst? Ganz vorsichtig hob er eine Hand an den Hals des Tieres. Ein leichtes Zittern ging durch den Körper des riesigen Geschöpfs, als er ihn dort berührte. Das Fell war, obwohl es sehr kurz und seidig war, sehr weich, wenn auch Tobias viele kleine Narben an der Kruppe entdeckte. Sonst passierte nichts. Langsam streichelte er das Pferd und genoss für ein paar Sekunden die Wärme und Ruhe, die es ausstrahlte. »Tobias? Ist alles in Ordnung mit dir?« - das war der Stallmeister. Er hatte sich schnell wieder berappelt und sorgte sich nun um das Wohl des Jungen. Das Pferd war nicht das Erste, aber auch nicht das Letzte gewesen, dass einen ausgewachsenen Mann wie ihn zu Boden gestoßen hatte. So eines aber von der einen auf die andere Sekunde so gebändigt zu sehen, verblüffte aber selbst ihn. Etwas unwirsch, aber dennoch mit bewundernden Blicken schaute er nun, indem er sich ein paar Schritte gen Junge und Pferd bewegte, ob sich die Lage wirklich entspannt hatte. Noch immer war Tobias, zwar etwas fahrig, aber dennoch zum Reden bereit, mit dem Streicheln des Pferdes beschäftigt. Nun wandte er sich voll und ganz dem herankommenden Stallmeister zu, der misstrauisch noch immer die Szenerie musterte. »Bleib lieber weg von dem Tier, Junge. Der ist scheinbar unberechenbar.« 23