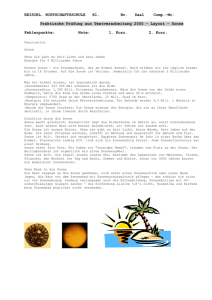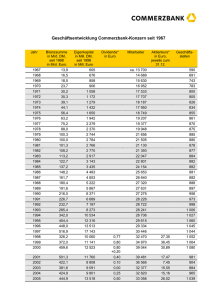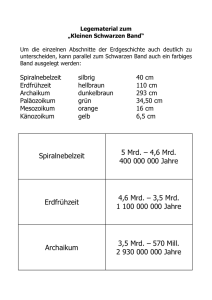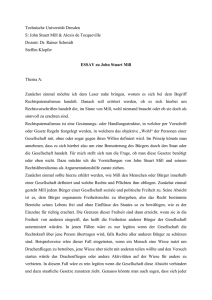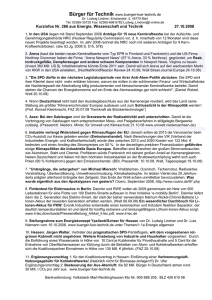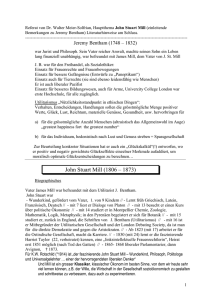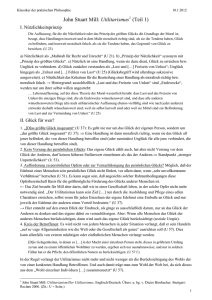Vorlesung Ethik, Jena, Folien 6
Werbung
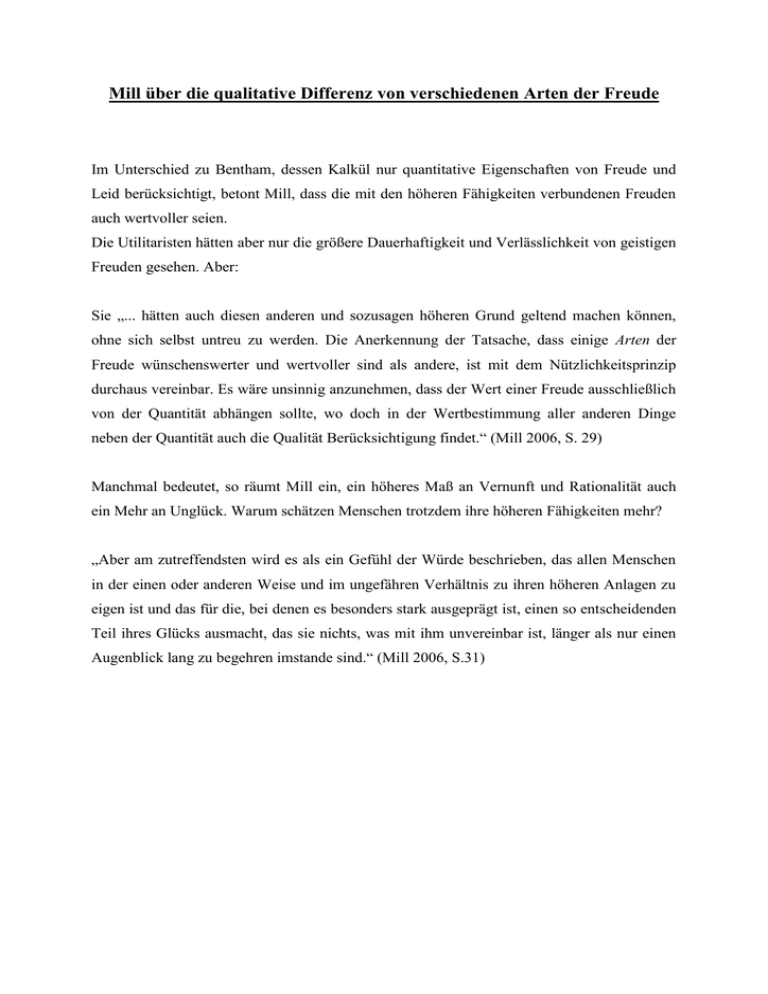
Mill über die qualitative Differenz von verschiedenen Arten der Freude Im Unterschied zu Bentham, dessen Kalkül nur quantitative Eigenschaften von Freude und Leid berücksichtigt, betont Mill, dass die mit den höheren Fähigkeiten verbundenen Freuden auch wertvoller seien. Die Utilitaristen hätten aber nur die größere Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit von geistigen Freuden gesehen. Aber: Sie „... hätten auch diesen anderen und sozusagen höheren Grund geltend machen können, ohne sich selbst untreu zu werden. Die Anerkennung der Tatsache, dass einige Arten der Freude wünschenswerter und wertvoller sind als andere, ist mit dem Nützlichkeitsprinzip durchaus vereinbar. Es wäre unsinnig anzunehmen, dass der Wert einer Freude ausschließlich von der Quantität abhängen sollte, wo doch in der Wertbestimmung aller anderen Dinge neben der Quantität auch die Qualität Berücksichtigung findet.“ (Mill 2006, S. 29) Manchmal bedeutet, so räumt Mill ein, ein höheres Maß an Vernunft und Rationalität auch ein Mehr an Unglück. Warum schätzen Menschen trotzdem ihre höheren Fähigkeiten mehr? „Aber am zutreffendsten wird es als ein Gefühl der Würde beschrieben, das allen Menschen in der einen oder anderen Weise und im ungefähren Verhältnis zu ihren höheren Anlagen zu eigen ist und das für die, bei denen es besonders stark ausgeprägt ist, einen so entscheidenden Teil ihres Glücks ausmacht, das sie nichts, was mit ihm unvereinbar ist, länger als nur einen Augenblick lang zu begehren imstande sind.“ (Mill 2006, S.31) Mill über die inneren Sanktionen Im Unterschied zu Bentham gibt es nach Mill zur Durchsetzung des Prinzips der Moral auch innere und nicht nur äußere Sanktionen. Diese inneren Sanktionen sind grundlegender und bestehen immer in einem subjektiven Gefühl – der Gewissenhaftigkeit des Menschen: Es ist „ ... ein Gefühl in uns, eine mehr oder weniger starke Empfindung der Unlust, die sich bemerkbar macht, sobald wir unserer Pflicht zuwiderhandeln ... Dieses Gefühl, insoweit es uneigennützig ist und sich auf den reinen Gedanken der Pflicht, nicht auf eine ihrer besonderen Ausprägungen oder einen bloßen Begleitumstand richtet, macht das Wesen des Gewissens aus.“ (Mill 2006, S. 85 f.). Die Grundlage für das Gewissen ist ein natürliches und starkes Gemeinschaftsgefühl: „Das gemeinschaftliche Leben ist dem Menschen so natürlich, so notwendig und so vertraut, dass er sich niemals – es sei denn in einigen ungewöhnlichen Fällen oder durch einen bewussten Akt der Abstraktion – anders denn als das Glied eines Ganzen denkt;“ (Mill 2006, S.95) Der Mensch könne sich gar keinen Gesellschaftszustand vorstellen, in dem die Interessen der anderen gänzlich missachtet würden: „Gleichsam instinktiv gelangt er dazu, sich seiner selbst als eines Wesens bewusst zu werden, dem es selbstverständlich ist, auf die anderen Rücksicht zu nehmen.“ (Mill 2006, S. 97). Mill über sekundäre Prinzipien Die Tatsache, dass Mill als Reaktion auf das Anwendungsproblem des obersten Moralprinzips so genannte sekundäre Prinzipien oder Regeln vorsieht, wird als eine Tendenz hin zu einem Regelutilitarismus gedeutet. Diese sekundären Prinzipien sind nichts anderes als tradierte, in der Erfahrung begründete Moralvorstellungen. Mill hält die Anwendung solcher sekundären Regeln trotzdem sowohl für vereinbar mit dem Nutzenprinzip als auch mit der Verbesserungsfähigkeit der Moral: „Aber die Regeln der Moral für verbesserungsfähig zu halten heißt nicht, sich über die mittleren allgemeinen Prinzipien hinwegzusetzen und jede einzelne Handlung unmittelbar am obersten Prinzip prüfen zu wollen. Es ist nicht einzusehen, warum die Anerkennung eines ersten Prinzips mit der Einbeziehung sekundärer Prinzipien unverträglich sein soll.“ (Mill 2006, S. 73). Mill über den Begriff der Gerechtigkeit Gegen den Einwand, dass nicht Nützlichkeit, sondern Gerechtigkeit das Kriterium für das moralisch Richtige sei und dass es ein natürliches Gerechtigkeitsgefühl gebe, das nicht einem Gefühl der Nützlichkeit entspräche, möchte Mill zeigen, dass Fälle von Gerechtigkeit immer auch Fälle von allgemeiner gesellschaftlicher Nützlichkeit sind. Mit dem angeblich natürlichen Gefühl der Gerechtigkeit geht kein klarer Begriff der Gerechtigkeit einher. Nur das Nutzenprinzip kann in Streitfragen eine klare Antwort geben. Das Gerechtigkeitsgefühl ist eigentlich nur der Wunsch nach Strafe und Vergeltung für ein Unrecht. Es hat an sich keinen moralischen Gehalt und wird zu einem moralischen Gefühl nur durch eine Verbindung mit dem Gemeinschaftsgefühl: „Für sich genommen hat dieses Bedürfnis keinen moralischen Gehalt. Das einzig Moralische an ihm ist, dass es ausschließlich den Gemeinschaftsgefühlen untergeordnet ist und nur durch diese geweckt wird. Das bloß natürliche Gefühl würde uns unterschiedslos gegen jegliches Verhalten zornig werden lassen, das uns unangenehm ist; aber geläutert durch das Gemeinschaftsgefühl wird es nur in der Richtung wirksam, in der es dem allgemeinen Wohl dient. Wenn der Gerechte in Zorn gerät, dann gegen den Schaden, der der Gesellschaft zugefügt wird, nicht gegen den (und sei er noch so schmerzlich), der ihn selber trifft, es sei denn, er und die Gesellschaft hätten ein gemeinsames Interesse daran, ihn zu verhindern.“ (Mill 2006, S. S. 155). Der gesellschaftliche Gesamtnutzen ist deshalb die einzig mögliche Rechtfertigung für soziale Ungleichheit: „Alle Menschen haben ein Recht auf gleiche Behandlung, außer dann, wenn ein anerkanntes Gemeinschaftsinteresse das Gegenteil erfordert. Daher wird jede soziale Ungleichheit, deren Nutzen für die Gesellschaft nicht mehr einsichtig ist, nicht nur zu einer Unzuträglichkeit, sondern zu einer Ungerechtigkeit und nimmt eine so tyrannische Erscheinungsform an, dass manche sich wundern, wie man sie jemals hat dulden können.“ (Mill 2006, S. 189). Probleme des klassischen Handlungsutilitarismus Das Problem der Vergleichbarkeit: Wie können Freude und Leid intraindividuell und zwischen den Individuen objektiv verglichen werden? Das Problem der Wissenslücke: In der alltäglichen Handlungspraxis ist unser Wissen über die Situation und die Konsequenzen lückenhaft. Dies kann zu falschen moralischen Urteilen führen. Das Gerechtigkeitsdefizit: Mit demselben Gesamtnutzen können sehr unterschiedliche Verteilungen von Gütern einhergehen, die mehr oder weniger gerecht sind. Der Utilitarismus kann zwischen diesen unterschiedlichen Verteilungen nicht moralisch unterscheiden. Der fehlende intrinsische Wert von Personen: Ist es kohärent, subjektive Empfindungszustände von Personen als den angestrebten Zweck der Moral aufzufassen, aber zugleich die Personen selbst nur in ihrer Funktion als Träger dieser Zustände zu sehen? Das Problem der Überforderung durch Überparteilichkeit: Das Ideal des unparteiischen und allwissenden Beobachters, von dessen Standpunkt die moralische Bewertung erfolgen soll, überfordert real handelnde Menschen.