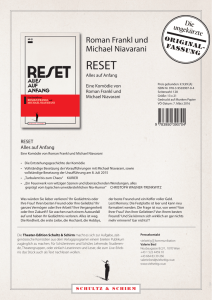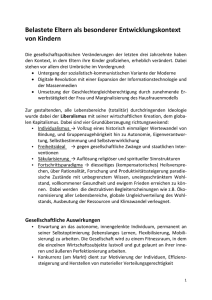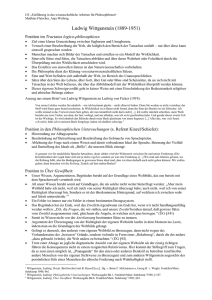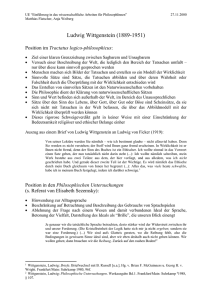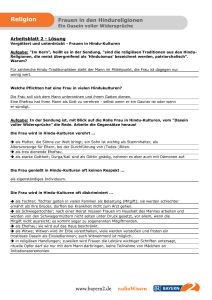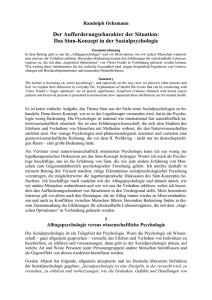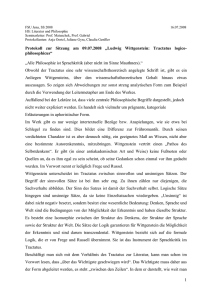Wimmer_Sinn des Lebens
Werbung

Essay „Der Sinn des Lebens“ für „Emotion“ 2013 Sie haben sich noch nie Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht? Herzlichen Glückwunsch, möglicherweise sind Sie damit schon auf dem besten Weg. Weil die Abwesenheit der quälenden Frage bedeuten könnte, dass die Antwort darauf schon in ihnen wohnt. Oder frei nach Ludwig Wittgenstein: „Die Lösung des Problems merkt man am Verschwinden des Problems.“ Wittgenstein war einer der späteren in der Geschichte der Philosophie, der versucht hat, den Menschen das Grübeln abzunehmen. Herauszufinden, warum wir, in die Welt geworfen, uns nicht, wie alle anderen Lebewesen, damit begnügen, die Art zu erhalten, uns zu ernähren, zu vermehren, den Nachwuchs groß zu ziehen und gegebenenfalls das Revier zu verteidigen. Sondern hoffen, unser Dasein könnte eine Bedeutung haben. Und unglücklich werden, wenn uns der Bezug dazu abhanden kommt. Als zoon logon echon, vernunftbegabtes Wesen, haben die antiken Denker den Menschen definiert und sich als erste den Kopf darüber zerbrochen, wie man aus dem Dilemma herauskommt, selbst das Rätsel und gleichzeitig hoffentlich dessen Lösung zu sein. Die Geistesgeschichte hat seither einige Schleifen gedreht bei der Suche nach Sinnstiftung, hat wechselweise das Ich oder die Gemeinschaft, weltliche Leere oder spirituelles Streben in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt und oft genug ratlos daneben gestanden, wie Ludwig Marcuse, der schrieb: „Der Sinn des Lebens ist ein sinnvolles Wort; aber es lässt sich nichts Sinnvolles aussagen.“ Noch Fragen? Eine vielleicht: was geht mich das alles an? Hochtrabende Gedankengebäude, tiefgründiger Existentialismus, kann ich nicht einfach mein Leben leben, so gut es eben geht? Und dabei gar nicht wissen wollen, was sich hinter allem verbirgt? Klingt oberflächlich gut, ist aber wenig praxisorientiert. Weil uns alle beizeiten die Zweifel an anfallen, zumeist nicht in den besten Momenten, die wir erleben. Es muss kein dramatischer Augenblick, keine unvorhergesehene Katastrophe sein, der man gegenüber steht. Einfach nur einer dieser Tage. Seltsam fremde Kinder krakeelen durch eine Wohnung, die noch nie so ausgesehen hat, wie man sich ein schönes Zuhause einstmals erträumte. Die Kollegen kassieren mit lässiger Selbstverständlichkeit Lob für ein erfolgreiches Projekt, welches man selbst maßgeblich vorangebracht hat. Der Mann bringt Blumen in der falschen Farbe. Man verabscheut zartes Rosa und denkt: Das hat doch alles keinen Sinn. Man beginnt über das eigene Leben nachzudenken, wenn sich vieles falsch anfühlt, obwohl alles ganz gut aussieht. Dabei hoffte man doch, begriffen zu haben, wie viel Glück man hat und was einem Euphorie beschert: neue Schuhe, guter Sex, Entspannung im Yoga, erfüllte Reiseträume, die entzückende Brut. Ein paar Ziele sind abgehakt, man lebt in sicheren Bahnen, aber irgendwas fehlt. Etwas, das einem das Gefühl gibt, mit sich und der Welt im Einklang zu sein, eine Aufgabe zu haben in einem größeren Zusammenhang (den man aber auch noch nicht richtig verstanden hat). Das grundsätzliche Missverständnis geht genau an diesem Punkt los. Denn Glückssuche und Sinnstiftung sind nicht dasselbe, es fühlt sich zwar beides gut an, doch das Glück ist, wie man manchmal ahnt, oder vielleicht auch schon schmerzhaft erfahren durfte, ein flüchtiger Begleiter. Ich kann mich gut erinnern, als ich, selbst im besten Familiengründungsalter, einem befreundeten Paar, das ich länger nicht gesehen hatte, auf der Straße begegnete, die weibliche Hälfte trug einen stolzen Babybauch. Auf meinen erstaunten Blick hin, sagte sie lachend: „Das geht ganz einfach.“ Ich ahnte damals schon, dass es nicht immer so einfach geht, hatte diverse erfolglose Arztbesuche hinter mir und dachte: „Ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr habt.“ Ich habe lange damit gehadert, dass das größte Glück, wie man es so gerne nennt, mir versagt geblieben ist, zumal nicht wenige der beseelt stillenden Damen in meinem Umfeld gleichzeitig fest der Überzeugung waren, endlich ihre Bestimmung gefunden zu haben. Ihren Sinn im Leben. Ich will nicht in Abrede stellen, dass ein Kind aufzuziehen eine große, das Leben prägende Erfahrung ist. Aber jetzt, ein gutes Jahrzehnt später, habe ich nicht mehr das Gefühl vom Leben betrogen worden zu sein. Genauso wenig wie meine Freundinnen mit Nachwuchs behaupten würden, das große Los gezogen zu haben. Der jüdische Psychiater und Neurologe Viktor Frankl hat das größte nur vorstellbare Leid erfahren und daraus seine Lebensphilosophie destilliert. Er überlebte die Gefangenschaft in den Konzentrationslagern der Nazis, seine Frau, seine Eltern und sein Bruder wurden umgebracht. 1946 veröffentlichte er das Buch: „...trotzdem Ja zum Leben sagen“, ein weltweiter Bestseller, der Titel der englischen Fassung spricht das Kernthema noch deutlicher an: „Man’s Search for Meaning“. Frankl hat in den Lagern mit vielen verzweifelten Lebensmüden gesprochen, er hat sie ermutigt, ihr Dasein weiterhin als Herausforderung zu begreifen. Zu realisieren, wer oder was in der Zukunft auf sie wartet, seien es Menschen oder Aufgaben. Frankl schreibt: "Die geistige Freiheit des Menschen, die man ihm bis zum letzten Atemzug nicht nehmen kann, lässt ihn auch noch bis zum letzten Atemzug Gelegenheit finden, sein Leben sinnvoll zu gestalten.“ „Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefunden werden.“ Der Sinn des Lebens wird also nicht in der Schicksalslotterie verteilt, wir haben es selber in der Hand, unserem Leben Bedeutung zu verleihen. Das klingt zunächst ganz schön schwergewichtig, könnte auch Beklemmungen auslösen, ähnlich der Art, die sich bei mir einstellen, wenn ich über Projekte nachdenke, die eine Menge Arbeit und Organisation erfordern. Sowas wie: mein Bürozimmer von Grund auf ausmisten und endlich Ordnung in Buchhaltung und Bücherregale bringen. Zu monumental der Gedanke, da fange ich lieber gar nicht erst an. Nach der gescheiterten Familiengründung habe ich nach ähnlich mächtigen, neuen Aufgaben gesucht, sah mich Mutter-Teresa-artig als freiwillige Wohltäterin, wollte Hausaufgabenhilfe geben und Patenschaften übernehmen. Und ich muss es leider zugeben: Medaillenverdächtiges soziales Engagement steht immer noch auf meiner Todo-Liste. Ich übe mich derweil in flächendeckender Freundlichkeit für meine Umwelt, bekoche meine Liebsten, bespaße meine Neffen und Nichten, versuche loyale Kollegin zu sein oder fürsorgliche Tochter, liebende Ehefrau und zuverlässige Freundin, ganz nach Viktor Frankls Maßgabe: "Die Aufgabe wechselt nicht nur von Mensch zu Mensch – entsprechend der Einzigartigkeit jeder Person – , sondern auch von Stunde zu Stunde, gemäß der Einmaligkeit jeder Situation.“ Ich vollbringe dabei keine Großtaten, aber ernte Lächeln und warme Gefühle, die tiefer gehen, als jedes Lob für eine gute Leistung oder das Wellness-Wochenende, mit dem man sich selbst belohnt. Der neuere Stand der Forschung sieht das übrigens genauso. Glück sucht man für sich allein, Sinn findet man mit den anderen, das ist die Quintessenz dessen, was Psychologen und Soziologen bei der großflächigen Betrachtung moderner Gesellschaften beobachten. Nichts von dem, was in den letzten Jahrzehnten als erstrebenswert erachtet wurde, die sichere Existenz, die erfolgreiche Karriere, Haus und Hof, hübsche Kinder und das selbstoptimierte Ich dazu, kann die letzte Leerstelle füllen. Die Mehrheit der Amerikaner bezeichnet sich in Umfragen als glücklich und relativ sorgenfrei, aber fast die Hälfte empfindet ihr Leben als bedeutungsarm. Der Anteil derer, die sich in Deutschland als zufrieden bezeichnen ist keinen Deut höher als in der beschwerlichen Nachkriegszeit. Und die Zahl der Depressiven steigt. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Klein hat sich vor zehn Jahren als Buchautor mit „Die Glücksformel“ sehr erfolgreich einen Namen gemacht, seine jüngste Veröffentlichung ist dessen zeitgemäße Fortsetzung. Es heißt: „Der Sinn des Gebens“, fordert die Rehabilitierung des Gutmenschen und die Gesundung der Gesellschaft durch Altruismus. Tilo Welsche, Professor für Philosophie, kommt bei der Frage nach dem Glück, gestellt von der Wochenzeitung Die Zeit, auch auf den tieferen Sinn: „Sinn ist die Erfahrung,...etwas zu tun, das nicht bloß für mich wichtig ist, sondern um eines anderen willen gut ist, dessen Bedürftigkeit gleich viel zählt.“ Zu guter Letzt sind die glaubhaftesten Fürsprecher dieser Theorie vor allem jene, die uns bei der Betrachtung des Lebens eine gute Zeit voraus sind. Menschen auf dem Sterbebett. Das amerikanische Magazin Life hat in dem Buch „The Meaning of Life“ unterschiedlichste Menschen dazu zu Wort kommen lassen. Unter anderem Leah de Roulet, eine Sozialarbeiterin, die tödlich erkrankte Krebspatienten betreut: „Am Ende reduziert sich das Leben auf eine einzige Frage: Habe ich genug geliebt?“