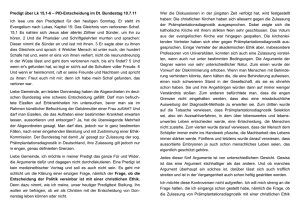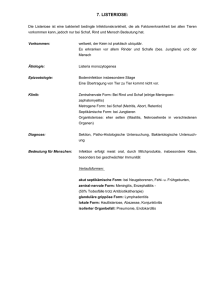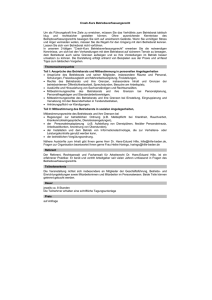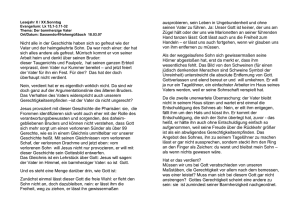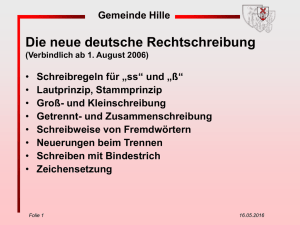Predigt Dr. Petra Bahr - Berliner Stadtmission
Werbung

Predigt zum Sommerfest der Berliner Stadtmission 25. August 2013 Dr. Petra Bahr Vom verlorenen Schaf Lukas 15,1-7: Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er’s findet? Und wenn er’s gefunden hat, so legt er sich‘s auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Plötzlich war sie weg. Eben noch ging sie an ihrer Hand. „Mama, fester“, bat Hille immer, wenn sie so unterwegs waren. Dann sollte sie die rechte Hand fester um die kleine Hand der jüngsten Tochter schließen. Die anderen drei trödelten und ärgerten einander ein paar Meter hinter ihnen. Sie zogen sich wechselseitig an den Haaren. „Hey, lass das“, hörte sie von hinten. „Du Blödkopf“, rief die andere Stimme. Nichts Ernstes, das das Eingreifen erforderte. Geschwisterstreit aus Langeweile und Aufregung. Unsere kleine Familienkarawane nannten sie den Treck. Vier Kinder, fünf Rollkoffer, Rucksäcke, Taschen, Kuscheltiere. Was so zusammenkommt auf einer Familienreise zu den Großeltern. Doch plötzlich war sie weg. Eben noch hatten sie sich alle zusammen die gelben Plakate im Bahnhof angesehen. Gleis 7. „Gibt es im Intercity auch Klos?“ fragte Frieder. Er hüpfte von einem Bein aufs andere. Das Klo musste schon früher her. Sie suchten die Rollkoffer, Rucksäcke, Taschen und Kuscheltiere zusammen. „Noch zehn Minuten“, rief die Mutter und hob eine Giraffe vom Boden auf. Hier wird doch irgendwo eine Toilette sein. Da rief die Älteste. „Mama, Hille ist weg.“ Ärger steigt in ihr auf. Können die Kinder denn nicht einmal machen, was sie sagt? Sie schaut sich um. Irgendwo hier in der Nähe muss sie sein. Vielleicht bei der japanischen Reisegruppe mit den lustigen Fähnchen auf den Sonnenhüten? Oder hinter der Säule neben dem Schaufenster mit den Süßigkeiten in den Auslagen? Der Ärger verwandelt sich langsam in etwas anderes. „Cool bleiben“, denkt sie sich. Mit ihren kleinen Beinchen kann sie nicht weit sein. Sie ist erst drei. „Mama, da ist sie“, ruft Frieder. Doch der kleine Wuschelkopf hinter dem silbernen Rollkoffer ist nicht Hille. Das Kind sieht nur so aus. „Hille!“ ruft sie zum zwanzigsten Mal. Sie hört die Furcht in ihrer eigenen Stimme. Die Großen hören sie auch. „Mama, wir können sie doch suchen!“ „Wir können die Bahnhofspolizei verständigen.“ „Mama, bestimmt spielt sie Verstecken mit uns.“ Sie hört die Stimmen ihrer Großen wie von ferne. Angst kriecht den Rücken hoch und klemmt sich am Hals fest. „Ihr bleibt hier und rührt Euch nicht vom Fleck“, ruft sie den drei Kindern zu und rennt los. Sie nimmt zwei Stufen auf einmal zum Gleis. Da ist Hille nicht. Sie läuft zur Brüstung und versucht, sich einen Überblick über das Bahnhofsgewusel zu schaffen. Wo könnte das Kind nur hingelaufen sein? Bilder schießen in ihren Kopf. Was kann einer Dreijährigen alles passieren. Wo kann sie runterstürzen, wo sich verletzen. Fernsehbilder von Kindern kommen hoch, niedliche Wesen mit rosa Schleife, die entführt wurden, um dann Jahre später wieder aufzutauchen. Tot. Sie erinnert sich an die grausigen Geschichten, die sich im Laufe des Lebens im hinteren Teil des Kopfes gespeichert haben. Was wäre wenn? Sie fragt Passanten und Reisende: „Haben Sie ein kleines Mädchen gesehen? Sie ist uns verloren gegangen.“ „In diesen Minuten, als Hille uns im Berliner Hauptbahnbahnhof verloren gegangen war, hat sich mein ganzes Leben zusammengezogen auf dieses eine Kind“, erzählt die Mutter später. „Alles andere wurde gleichgültig. Nichts war mehr wichtig. Alles um mich herum verschwand, die ganze Welt im Nebel“, sagte sie. „Ich hatte nie im Leben eine solche Angst. Die Angst war so kalt und so groß, dass ich kaum noch atmen konnte. Die schlimmste halbe Stunde meines Lebens.“ Hille ist wieder aufgetaucht. Schlafend fand ein junger Mann sie auf den roten Ledersitzen in der Lounge des Hauptbahnhofs. Und weil der selbst kleine Geschwister hat, alarmierte er die Bahnhofspolizei. Jetzt ist die Geschichte von Hille eine Anekdote für Familienfeiern. „Wisst ihr noch, wie es war, als wir Dich am Tag des Ferienbeginns im Hauptbahnhof verloren haben?“ werden die älteren Kinder die Jüngste ärgern. Alle werden lachen. Und die Mutter wird für eine Minute wieder spüren, wie die Panik in Erleichterung umschlug, als sie ihr viertes Kind endlich wieder in die Arme schließen konnte. Sie erinnert sich noch genau an diesen Moment. „Nicht so feste, Mama“, war das erste, was das verschlafene Kind zu ihr gesagt hat. Haben Sie schon mal jemanden verloren? Ein Kind im Gewimmel einer vollen Einkaufsstraße? Den dementen Großvater im Supermarkt, als Sie eben nur die Milch aus dem Regal holen wollten? Den Freund in den Fanmassen des Fußballstadions? Dann können Sie sich an das Gefühl der Beklemmung erinnern. An die Panik, die das Herz bis zum Hals schlagen lässt. An den kalten Schweiß in den Handflächen. Manchmal reicht ja schon weniger als ein verlorengegangener Mensch, um die Angst zu spüren. Wenn der Autoschlüssel weg ist und in einer halben Stunde ein wichtiger Termin ansteht. Wenn ein Schmuckstück so vom Erdboden verschwunden ist wie sonst nur die Socken im Wäschekorb. Kennen sie diesen Moment, wo Sie an nichts anderes mehr denken können als an den Gegenstand, den sie verloren haben? Vielleicht wäre es klug, einmal durchzuatmen und die Suche etwas ruhiger anzugehen. Aber wir sind wie besessen von dem, was uns fehlt. So fühlt sich Gott, wenn ein Mensch verloren geht. Wie eine Mutter, die ihre Jüngste im Berliner Hauptbahnhof vermisst. Sie finden das maßlos und übertrieben? Dann sind Sie in guter Gesellschaft mit den Menschen, die die Bemühungen Jesu um die Verlorenen übertrieben fanden. Muss er denn mit denen essen, die ihr Essen aus Mülltonnen holen? Muss er den guten Wein mit denen teilen, die Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen? Wie kann er seinen Arm nur um die legen, die so streng riechen, dass einem der Appetit vergeht. Muss er mit Kindern spielen, während wichtige Honoratioren der Stadt sich die Ehre geben? Muss er mit Prostituierten reden, wenn unsere Ehefrauen dabei sind? So fragen die Leute im Lukasevangelium. Die Evangelisten sind manchmal ziemlich schonungslos, wenn es darum geht, Wahrheiten zu überliefern. Sie überliefern auch die bösen und zynischen Kommentare. Kommentare, die von uns sein könnten. „Sind diese Menschen es wert, dass ein so begnadeter Redner und Wundertäter sich so um sie sorgt?“ fragen sie. Vielleicht denken Sie auch: Sollte Jesus seine Energie nicht für Anderes einsetzen? Für die Gutwilligen, für die Interessierten, für die, die ihr Leben auch ändern wollen? Ist bei manchem nicht Hopfen und Malz verloren? Vergebliche Liebesmühe? Stehen da Aufwand und Ertrag noch in einem Verhältnis? So reden wir, die wir uns an Kosten-Nutzen-Kalküle so gewöhnt haben, dass sie auch unsere Moral längst bestimmen. Ja, sagt Jesus. Gott sorgt sich. Um die, die verloren zu gehen drohen, um die, die am Rand der Gesellschaft leben, um die, die ihr Leben nicht mehr im Griff haben, um die, die sich im Laufe ihres Lebens selbst verloren haben, sorgt er sich noch mehr. Dann erzählt er die Geschichte von dem Schäfer, der eine ganze Schafherde stehen lässt, um das eine zu suchen, das sich verirrt hat. Ohne diese Suchaktion hätte das Schaf in der Wildnis keine Chance. Wölfe warten schon auf eine Gelegenheit. Als der Schäfer das kleine Schaf findet, nimmt er es auf den Arm wie ein Kind und trägt es zur Herde zurück. Und als er zurückkommt, feiert er ein Fest mit seinen Freunden. Ungefähr so laut und fröhlich, wie wir heute unser Sommerfest feiern. Jesus hätte auch die Geschichte von Hille, ihrer Mutter und ihren Geschwistern erzählen können. Man stelle sich vor, ein freundlicher Passant hätte der Mutter in ihrer Panik gesagt: ach, nehmen sie es locker, sie haben ja noch drei Kinder. Oder: ach, ist doch nur ein kleines Mädchen. Diese Bemerkung würden wir niemandem durchgehen lassen. Weil die Liebe zu einem Kind unbedingt ist. Weil jedes Kind einzigartig ist. Weil nichts schrecklicher ist, als sein Kind zu verlieren. In der Bibel wird Gottes Liebe zu uns immer wieder mit der Liebe einer Mutter oder eines Vaters verglichen. Deshalb taugt die Geschichte von Hille auch zu einem Gleichnis. Gott sucht uns wie Hilles Mutter das kleine Mädchen. Mit Leidenschaft und Ungeduld, mit einer Ausschließlichkeit, die nur Liebende fühlen, ja sogar mit Panik im Nacken. Sie würde keine Ruhe geben, bis sie ihr Kind wieder in die Arme geschlossen hat. So ruhelos ist Gott. Er kann sich ein Leben ohne uns einfach nicht vorstellen. Und er weigert sich, sich unseren Zynismus zu eigen zu machen. Dieser Zynismus steckt übrigens auch in vielen großen Philosophien des Abendlandes. Gott, ein unbewegter Beweger, der unberührbar die schrecklichen und schönen Verläufe der Welt betrachtet? Gott, eine anonyme Energie, die nur die spüren, die sich mit religiösem Leistungssport in höhere Sphären aufschwingen? Die Bibel erzählt vom Gott der Passion. Passion heißt Leiden und Leidenschaft. Wer liebt, kommt um die Passion nicht herum. Jesus weiß das. Er ist mit Gott so eng verbunden, dass er den Menschen ihre falschen Gottesbilder austreiben will. Gott hat eine Passion für das Verlorene. Gott ist nicht gefühllos. Er ist ungeduldig und zärtlich. Davon erzählt die Geschichte vom verlorenen Schaf. Oder die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Allerdings haben die Geschichten einen Haken. Niemand will gerne zu den Verlorenen gehören. Nicht mal Kinder. Als Hille in der Bahnhofslounge gefunden wurde und in den Armen ihrer Mutter lag, fragte sie erstaunt mit Blick auf ihre Geschwister: „Warum weint ihr denn?“ „Na, weil du verloren warst und wir Dich wiedergefunden haben.“ „Aber ich war doch gar nicht verloren. Ich habe doch nur geschlafen und gewartet, dass es endlich losgeht“, sagte das kleine Mädchen erstaunt. Fühlen Sie sich verloren? Es gibt ja viele Arten, verloren zu gehen. Manchmal verlieren Menschen den Boden unter den Füßen. Sie verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnungen und die Menschen, die ihnen was bedeuteten. Ein Blick in die Augen dieser Menschen offenbart die Leere und die Traurigkeit. Oft sieht man Menschen aber gar nicht an, dass sie sich verloren fühlen. Auch in einem schicken Großraumbüro kann man verloren gehen. Oder sich verloren fühlen. Allein und unverstanden. Oder wütend und gekränkt. Ja, man kann sich sogar selbst verlieren. In einem Leben, das ganz anders aussehen sollte als geplant und in dem man sich selbst fremd fühlt. Im Dickicht der Anforderungen, zwischen denen man die Sonne nicht mehr sieht. In einer Beziehung, die den Namen schon lange nicht mehr verdient. Es kostet Überwindung, sich einzugestehen, dass man verloren zu gehen droht. Wer fragt schon gerne nach dem Weg, wenn er sich verlaufen hat? Lieber sind wir bei denen, die keine Hilfe brauchen, die allein und stolz und selbstbewußt durchs Leben schreiten. Jesus kennt diese Haltung. Deshalb erinnert er uns: „Ich sage Euch: so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.“ „Kann mich bitte jemand suchen?“ Dieser Satz erfordert Mut. Und eine andere Art von Gebet. Natürlich schadet es nicht, Gott zu suchen. Aber das erste Gebet müsste eigentlich anders lauten: „Such mich, Gott!“. Das ist die Pointe von Gottes Leidenschaft für die Verlorenen. Nicht wir müssen ihn finden, er sucht uns. Er kann nicht anders. Und er lässt nichts unversucht. Wie die Mutter von Hille.