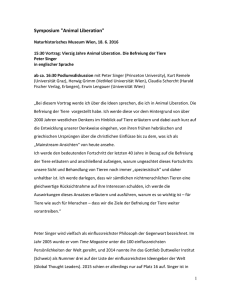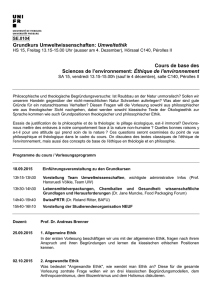Tierschutz, Erbe der Humanität
Werbung

Zum 90. GeburtstaG von G. m. teutsch „Tierschutz, Erbe der Humanität“* Heike Baranzke Katholisch-theologische Fakultät, Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Deutschland In der lemmaliste des von Gotthard Martin teutsch 1987 publizierten „lexikon der Tierschutzethik“ findet sich ein heute altertümlich anmutendes, aber überaus aufschlussreiches Stichwort: „Humanität“. In dem Artikel spannt teutsch den Bogen von der lateinischen humanitas über die epoche des Humanismus bis hin zum „Artegoismus“, zu dem es einen eigenen kürzeren Artikel gibt, der mit dem Hinweis auf eine „Sonderform des menschlichen A[rtegoismus]“ endet, „was man in den USA ‚Speziesismus’ nennt, das Gefühl einer mit dem Menschen verbun* Teutsch, 1995, S. 3 Altex 25, 4/08 denen Überlegenheit, die dem Menschen innerhalb der ihn umgebenden Natur ein unangefochtenes Willkürrecht verleiht“. Heute, gut drei Jahrzehnte später, ist der „Speziesismus“ als Kritik an einer anthropozentrisch verengten ethik in aller Munde, während man die „Humanität“ in der (tier-)ethischen literatur vergeblich sucht. Eher finden sich in heutigen Stichwortverzeichnissen eintragungen zu trans- oder Posthumanismus. Konnte teutsch unter dem Stichwort „Humanität“ noch „Menschlichkeit“ als eine wertschätzende Haltung im Sinne ei- ner „Solidarität gegenüber Mitmensch und Mitgeschöpf“ vom „anthropozentrische[n] Humanismus als Ausdruck der Selbstüberhebung des Menschen“ unterscheiden, wurde wenig später die Gleichheit der tiere „beyond humanity“ (Cavalieri und Singer, 1994) ausgerufen. Wer sich als tierethiker auf der Höhe der Zeit auf den Menschen beruft, der steht rasch unter Anthropozentrikverdacht und wird darüber belehrt, dass der Mensch nichts anderes sei als ein tier unter anderen tieren. Dies mag aus zoologischer Perspektive zwar eine Binsenweisheit sein, doch vermag die Zoologie leider keine Antworten auf ethische Fragen, was und 337 Zum 90. Geburtstag von G. M. Teutsch aus welchem Grund ich dies tun soll, zu liefern. Daran ändert sich im Übrigen auch nichts, wenn man Zoologie nicht nur systematisch, sondern auch in historischer Perspektive als Evolutionsbiologie betreibt. Humanität ist keine biologische Kategorie. 1. „Speziesismus“ – das naturalistische Selbstmissverständnis Wesentlicher Motor der sich seit den 1960er Jahren im anglophonen Raum formierenden neuen Tierrechtsbewegung ist die gnadenlose Nutzbarmachung der Tiere im industriellen Maßstab. Rachel Carson brachte in „Silent Spring“ (1962) die Ausrottung vieler Tierarten, insbesondere der Vögel, durch den gedankenlosen Einsatz der Agrargifte ins Bewusstsein; Ruth Harrison führte in „Animal Machines. The New Factory Farming Industrie“ (1964) die Zustände der industriellen Nutztierhaltung vor Augen; der britische Tierpsychologe Richard Ryder lieferte in „Animals, Men, and Morals“ (1972), in seiner Monografie „Victims of Science“ (1975) und „In Defence of Animals“ (1985) erschreckende Innenansichten über Tierversuchsanordnungen in Tierlaboratorien. Schon 1969 hatte Ryder den Begriff „Speziesismus“ in Analogie zu „Rassismus“ geprägt, um die Diskriminierung und Ausbeutung von Tieren anzuklagen. Peter Singer machte Ryders Begriff zum „Kern“ seiner „Animal Liberation“ (1975) und bringt ihn auf die These, „dass die Diskriminierung von Lebewesen allein aufgrund ihrer Spezies eine Form von Vorurteil ist, ebenso unmoralisch und nicht vertretbar wie die Diskriminierung aufgrund der Rasse unmoralisch und nicht vertretbar ist“. (Singer, 1982, 269) Das Bewusstsein der biologischen Artzugehörigkeit, ein Vertreter der Spezies homo sapiens sapiens zu sein, wird als Grund für den Ausschluss der Tiere aus der abendländischen Ethik diagnostiziert. Der moderne TherapieVorschlag lautet: der Mensch solle sich endlich als Tier unter Tieren, als Mitglied unter moralisch Gleichen und den Artunterschied als ethisch irrelevant begreifen. Jedes Humanitätsbewusstsein gerät so generell unter Speziesismusverdacht. 338 Fraglich ist, ob Singers und Ryders Anamnese und Diagnose nicht zu kurz greifen und sie daraufhin die falsche Therapie verordnen. Bis ins 19. Jahrhundert bezeichnete „Mensch“ nie einfach ein biologisches, sondern ein zur Humanität bestimmtes Lebewesen, dessen Wesen metaphysisch, theologisch oder naturphilosophisch fundiert wurde. Daher wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die „moralische Sonderstellung des Menschen […] in der Geschichte der Ethik mit Gottesebenbildlichkeit, Personalität, Handlungs-, Vernunft- oder Kommunikationsfähigkeit oder einer geschichtsteleologischen Sonderstellung des Menschen begründet“ (Düwell, 2006, 435) wurde – nicht aber mit seiner kruden biologischen Artzugehörigkeit, die tatsächlich nichts als eine ethisch belanglose empirische Tatsache ist. Daraus einen ethischen Grund der Bevorzugung zu machen, hieße dann, einen Sein-SollensFehlschluss zu begehen. Außerdem liegt ein anachronistischer Fehlschluss vor, wenn der vormodernen Ethikgeschichte ein Argumentieren mit einem neuzeitlichen Artverständnis unterstellt wird. Folgenschwerer als diese Methodenfehler wirkt sich allerdings die dem Speziesismusvorwurf zugrunde liegende naturalistische Anthropologie aus, – nämlich auf eine irreführende Ursachenanalyse einerseits und auf die Erosion des humanitären Fundaments einer tierethischen Begründung andererseits. Letzteres zeigt sich insbesondere an dem so genannten marginal case-Argument, dem Vergleich der kognitiven Fähigkeiten von geistig noch unentwickelten oder stark eingeschränkten Menschen mit meist hoch entwickelten Tieren, in der Absicht, Tiere an dem zumindest theoretisch hohen, durch Menschenwürde und Menschenrechte begründeten Schutzstandard von Menschen teilhaben zu lassen, ohne zu realisieren, dass man damit an dem humanitären Ast sägt, auf dem die Tierethik selbst sitzt. Jean-Claude Wolf bringt es auf den Punkt, wenn er das Revolutionäre der Tierrechtsethik darin bestimmt, dass es „aus den gleichen Gründen unmoralisch ist, Menschen und Tiere grausam zu behandeln und zu töten. […] Daraus geht hervor, dass die Tierethik kein Anhängsel, kein Nebenzweig der Ethik, sondern eine zentrale Weichenstelle für die Art der Begründung in der Ethik überhaupt ist.“ (Wolf, 1992, 19) Peter Singer hat die brisante Zweischneidigkeit einer empirisch basierten moralischen Gleichheitsargumentation schon in der „Befreiung der Tiere“ thematisiert: „Ein Schimpanse, ein Hund oder ein Schwein etwa wird ein höheres Maß an Bewusstsein seiner selbst und eine größere Fähigkeit zu sinnvollen Beziehungen mit anderen haben als ein schwer zurückgebliebenes Kind oder jemand im Zustand fortgeschrittener Senilität. Wenn wir also das Recht auf Leben mit diesen Merkmalen begründen, müssen wir jenen Tieren ein ebenso großes Recht auf Leben zuerkennen oder sogar ein noch größeres als den erwähnten zurückgebliebenen oder senilen Menschen. Dieses Argument kann auf zwei Arten ausgelegt werden. Man könnte es so sehen, dass es das Recht von Schimpansen, Hunden und Schweinen und einigen anderen Arten auf Leben bestätigt und dass wir eine schwere moralische Verfehlung begehen, wenn wir diese töten, selbst wenn sie alt und leidend sind und wir die Absicht haben, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Man könnte das Argument aber auch so auffassen, dass die schwer Zurückgebliebenen und hoffnungslos Senilen kein Recht auf Leben haben und aus ganz trivialen Gründen getötet werden dürfen, wie wir gegenwärtig die Tiere töten.“ (Singer, 1982, 40) Abgesehen von der Tatsache, dass das Menschenrecht auf Leben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) Art. 3 nicht mit den angeführten Merkmalen begründet wird, sondern damit, dass gemäß Art. 1 AEMR alle Menschen „frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ sind, präsentiert der Ethiker Peter Singer diese beiden Auslegungsmöglichkeiten vom Standpunkt eines theoretischen, unbeteiligten Beobachters als zwei logisch gleichgewichtig erscheinende moralische Möglichkeiten, nämlich entweder die Tiere auf Menschenrechtsniveau zu heben oder den Schutz geistig eingeschränkter Menschen auf das Niveau von Versuchs- und Altex 25, 4/08 Zum 90. Geburtstag von G. M. Teutsch Schlachttieren abzusenken. Dann plädiert Singer für eine „mittlere Position“, indem er in der Gründungszeit der Bioethik als neuer wissenschaftlicher Disziplin sein Tierschutzanliegen mit durch neuartige medizinisch-technische Entwicklungen induzierten medizinethischen Problembereichen kurzschließt. „Was wir brauchen, ist eine mittlere Position, die den Speziesismus vermeidet, die aber das Leben der Zurückgebliebenen und Senilen nicht auf die Stufe stellt, der heute das Leben von Schweinen und Hunden zugerechnet wird, und das Leben von Schweinen und Hunden auch nicht so sakrosankt macht, dass wir es für falsch halten, sie aus hoffnungslosem Elend zu erlösen. Was wir tun müssen, ist, die nichtmenschlichen Lebewesen in unsere Sphäre moralischer Belange einzubeziehen und aufzuhören, ihr Leben als für welche trivialen Zwecke auch immer verfügbar zu betrachten. Gleichzeitig kommen wir vielleicht, wenn wir einmal die Tatsache erkannt haben, dass die Zugehörigkeit eines Wesens zu unserer Spezies als solche nicht immer ausreicht, um das Töten dieses Wesens als falsch zu erweisen, zu einem Überdenken unserer Vorgehensweise, menschliches Leben um jeden Preis zu erhalten, selbst wenn keine Aussicht auf ein sinnvolles Leben oder eine Existenz ohne schreckliche Schmerzen besteht.“ (Singer, 1982, 40) Diese Form der empirisch basierten Mittelwertbildung ist nur unter der Voraussetzung eines naturalistischen Menschenbildes möglich, wonach der Mensch nichts anderes ist als ein empfindungsfähiges Tier unter anderen Tieren. Damit ist aber der Ausgangspunkt von Ethik, ja von Philosophie überhaupt als einer methodisch geleiteten Reflexion auf die conditio humana, in der wir uns immer schon vorfinden und von der wir nur in einem schlechten Sinne abstrahieren können, von vornherein verfehlt. Zu der conditio humana gehört auch der Anfangspunkt einer jeden Ethik, nämlich dass uns unsere immer schon vorliegende Handlungspraxis „frag-würdig“ werden kann, wir uns also als Wesen erfahren, die sich nach dem „was“ und dem Altex 25, 4/08 „warum“ ihres Handelns selbst befragen. Darin liegt wenn nicht ein menschliches Spezifikum, so zumindest ein Charakteristikum, das zwar in anthropologischen und ethischen Ansätzen unthematisiert, gleichsam im toten Winkel bleiben kann, dennoch aber den unhintergehbaren Ausgangspunkt menschlicher Reflexionstätigkeit bildet. Ethik als Teil neuzeitlicher Philosophie findet hier ihren einzig möglichen adäquaten Ausgangspunkt, von wo aus die Beziehungen zu sich selbst, zu seinesgleichen und zu allen anderen Weltgegenständen in je konkreten Situationen angemessen rekonstruiert und reflektiert werden können. Diese unhintergehbare Voraussetzung im praktischen Subjekt riecht im Zeitalter „positiver voraussetzungsloser Wissenschaft“ nach Metaphysik. Eine metaphysikfreie Ethik aber weiß sich allein empirischen Data und deren logischkohärenter Verknüpfung verpflichtet. Folgerichtig wird die Bedeutung von „Mensch“ auf die rein deskriptive biologische Artbezeichnung homo sapiens sapiens reduziert, d.h. es wird ein rein biologisches Menschenbild vorausgesetzt, woraus sich die „antispeziesistische“ Frage ergibt: „Wenn Versuche an geistig zurückgebliebenen, verwaisten Menschen falsch sind, warum sind dann Versuche an nichtmenschlichen Lebewesen nicht falsch? Welcher Unterschied besteht zwischen den beiden außer der schlichten Tatsache, dass der eine biologisch gesehen ein Mitglied unserer Spezies ist, der andere aber nicht? Das aber ist mit Sicherheit kein moralisch relevanter Unterschied, ebenso wenig wie die Tatsache, dass ein Lebewesen nicht Angehöriger unserer Rasse ist, ein moralisch relevanter Unterschied ist.“ (BT 93; vgl. 35f.) Zu Recht wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass hier trotz der insbesondere aus deutscher Sicht faschistoid anmutenden Konsequenzen dieses bioethischen Denkens weder Peter Singer noch anderen ähnlich argumentierenden Tier- und Bioethikern eine faschistische Gesinnung unterstellt werden darf. Ganz im Gegenteil liegt vielmehr ein Selbstmissverständnis über den eigenen unhin- tergehbaren Standpunkt vor, und zwar um einer humanitär ausgerichteten Ethik willen, die auch die Empfindungs- und Leidensfähigkeit, mithin sentientistische und pathozentrische Perspektiven zu integrieren vermag. Eine solche Ethik darf den Menschen nicht als ein körperloses, sondern muss ihn als ein verleiblichtes, leidens- und empathiefähiges Vernunftund Moralsubjekt reflektieren. Genau daran aber mangelt es der abendländischen Ethiktradition tatsächlich. Dennoch sollte auch nicht vergessen werden, dass gerade die anthropozentrische Position in der Neuzeit die entscheidenden praktischen Impulse für den „humanistischen“ Tierschutz gab (s.u. 2). 2. Unteilbarkeit der Ethik statt Ethik der Gleichheit Ganz nebenbei macht Peter Singer eine für unsere dominierende Ethiktradition aufschlussreiche Beobachtung und stellt fest: „Es ist signifikant, dass Diskussionen über Gleichheit und Rechte in der Moral – und politische Philosophie fast immer formuliert werden als Probleme menschlicher Gleichheit und menschlicher Rechte. Das hat die Auswirkung, dass die Frage der Gleichheit von Tieren sich dem Philosophen oder seinen Studenten niemals als Frage an sich stellt – und dies ist bereits ein Hinweis für das Versagen der Philosophie in der Herausforderung akzeptierter Überzeugungen.“ (Singer, 1982, 264) Es ist zeitgeschichtlich nicht uninteressant, dass diese Äußerung in eine Zeit fällt, in der John Rawls bis heute einflussreiche „Theory of Justice“ (1971) lebhaft diskutiert wird. Explizit konzediert Rawls, dass er sich außer Stande sieht, Tiere in seiner „Theorie der Gerechtigkeit“ zu integrieren (vgl. Rawls, 1979, 556). Diese Einschätzung teilt gegenwärtig mit ausdrücklichem Bedauern nicht nur Ernst Tugendhat (1997, 105), sondern auch zuvor schon David Hume sowie der Begründer der Vertragsethik Epikur, dessen zentraler Grundsatz lautet: „Für all jene Lebewesen, die keine Verträge abschließen konnten zur Verhütung gegenseitiger Schädigung, gibt es kein Recht (Gerechtigkeit) oder Unrecht (Ungerechtes).“ (Diog. Laërtius X 150, XXXII). Da sich Gerechtigkeit im Schließen und Hal339 Zum 90. Geburtstag von G. M. Teutsch ten von Verträgen manifestiert und Tiere dazu nicht in der Lage sind, bleiben sie aus den reziproken Vertragsgemeinschaften ausgeschlossen. Aber nicht nur die Vertragsethik bleibt ein exklusiv menschliches Unterfangen, auch in der aristotelischen Tugend- und in der stoischen Naturrechtsethik bleiben Tiere – von Natur aus – außen vor. Zu Tieren kann es diesen Ethiken gemäß kein Freundschafts- und kein Rechtsverhältnis geben. Der Grund liegt darin, dass Tiere sich vom Menschen in einem wesentlichen Punkt unterscheiden: sie sind vernunftlos, sind von Natur aus nicht mit einer Vernunftseele ausgestattet. Das aber ist für die griechischen und hellenistischen Ethiken gewissermaßen die Eintrittskarte in die moralische Gemeinschaft der diesbezüglich Gleichen, weil moralische Beziehungen in der griechischen Ethik nur als symmetrische Beziehungen denkbar sind. Alle Wesen, die mangels Vernunftseele nicht in eine symmetrische Beziehung zu anderen Vernunftwesen, sprich zu Menschen und Göttern, treten können, können nicht Mitglieder der moralischen Rechtsgemeinschaft werden. In drastischer Weise drückt Augustinus die Konsequenzen von solch exklusiven, sich aus rein symmetrischen Beziehungen konstituierenden Moralgemeinschaften für Tiere aus. In den „katholischen und manichäischen Sitten“ wendet er gegen das Tötungsverbot der Manichäer ein: „Wir sehen es nämlich und nehmen es an den Lauten wahr, wenn Tiere mit Schmerz sterben, was freilich der Mensch im Tier geringschätzt, weil er mit ihm, das natürlich keine Geistseele hat, durch keine Rechtsgemeinschaft verbunden ist.“ Schon in vorsokratischer Zeit wurde aus der intellektualistischen Gleichheitskonzeption der Ethik die weitere Schlussfolgerung gezogen, dass die Götter die vernunftlosen Tiere und Pflanzen ausschließlich um des menschlichen Vorteils und Genusses willen geschaffen hätten, – eine Auffassung, die als stoische Anthropozentrik sprichwörtlich wurde und sowohl die abendländische ethische Tradition als auch die Alltagseinstellung prägte. Vernunftskeptikern und Tierliebhabern wie Sextus Empiricus, Plutarch oder Montaigne blieb angesichts dieser fest gegründeten Gleichheitsideologie von der Antike bis in die frühe Neuzeit nichts anderes übrig, als Tiere als dem 340 Menschen Gleiche zu behandeln, d.h. eine der menschlichen Vernunft zumindest ähnliche, nur graduell verschiedene Vernunft der Tiere zu behaupten. Dieser vernunftskeptische Gradualismus spiegelt sich im marginal case-Argument und sucht seit dem 19. Jahrhundert in der Evolutionsbiologie neue weltanschauliche Unterstützung. In der Neuzeit tritt eine neue philosophische Herausforderung hinzu, nämlich die einflussreiche Automatentheorie der Tiere von René Descartes, aufgrund der den Tieren nun nicht nur die Vernunftund Sprachfähigkeit, sondern auch noch die Empfindungsfähigkeit bestritten wird. Seit dem 18. Jahrhundert wiederholt sich nun der Kampf um die empfindungsfähige Tierseele gegen den von einer objektivierenden Wissenschaft erhobenen Anthropomorphismusvorwurf wiederum als ein Anerkennungskampf im Gleichheitsparadigma: Das Tier wird dem Menschen hinsichtlich der Empfindungsfähigkeit als gleichartig erwiesen. Empfindungsfähigkeit löst den Vernunftbesitz als Eintrittskarte in die moralische Gemeinschaft der Gleichen ab, wie es Peter Singer mit der „boundary of sentience“ programmatisch für die moderne Tierethik auf den Punkt bringt: „Wenn ein Wesen leidet, kann es keine moralische Rechtfertigung dafür geben, dass man sich weigert, dieses Leiden zu berücksichtigen. Ganz gleich, welches die Natur dieses Wesens ist, das Prinzip der Gleichheit erfordert, dass sein Leiden ebensoviel gilt wie ähnliches Leiden – soweit rohe Vergleiche gezogen werden können – irgendeines anderen Wesens. Wenn ein Wesen nicht fähig ist zu leiden oder Freude oder Glück zu empfinden, dann gibt es auch nichts zu berücksichtigen. Damit ist die Grenze der Empfindungsfähigkeit […] die einzig vertretbare Grenzlinie für unsere Anteilnahme an den Interessen anderer. Diese Grenzlinie gemäß irgendeinem anderen Merkmal wie Intelligenz oder Rationalität zu ziehen, hieße, sie ganz willkürlich zu ziehen.“ (Singer 1982, 27f.) Ein Grundproblem dieser Argumentationsstrategie ist, dass sie der Ausschließungslogik des ethischen Gleich- heitsparadigmas verhaftet bleibt, die sie in der intellektualistischen Variante eigentlich zu bekämpfen angetreten ist. Halten wir es aber wirklich für eine richtige Aussage, dass die Ethik zum Umgang mit nichtempfindungsfähigen Tieren, Pflanzen und andern Dingen direkt nichts zu sagen hat und diese Entitäten dem außermoralischen Nutzenkalkül im Interesse der empfindungsfähigen Lebewesen überlässt? Liegt hier nicht ein zu enges, alles Nichtempfindungsfähige instrumentalisierendes Ethikverständnis zugrunde? Noch ein anderes Problem ergibt sich aus der Logik des Gleichheitsparadigmas: das Problem des ethischen Egalitarismus, nämlich dass die Interessen von Mensch und Maus grundsätzlich gleich wiegen. Diesem entzieht sich Singer in seiner „Praktischen Ethik“ (1979) durch eine sekundäre Differenzierung in Form seines Präferenzutilitarismus, der neben der Empfindungsfähigkeit als Eintrittskarte in den moralischen Club noch eine zweite höhere Hürde einbaut, die ein jedes empfindungsfähige Individuum zu nehmen hat, wenn es der schmerzlosen Tötung entkommen will: es muss direkt oder indirekt – z.B. durch zukunftsbezogene Wünsche – ein Interesse am Weiterleben zeigen. Insbesondere im Hinblick auf das Lebensrecht differenziert sich die moralische Gemeinschaft der Gleichen doch wieder in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aus, in der ein jedes Individuum sich sein Existenzrecht durch ein bestimmtes empirisches Merkmalsprofil erst einmal verdienen muss und diesen Anspruchsplatz durch Verlust seiner profilierenden Fähigkeit wieder einbüßen kann. Eine Reihe andere Interessenethiker neben Singer folgen dieser nachträglichen Differenzierung der moralischen Gemeinschaft der Gleichen, wie z.B. Michael Tooley, Dieter Birnbacher, Norbert Hoerster. Statt der Leistungs- und Ausschlusslogik des Gleichheitsparadigmas zu folgen, kann man auch von einer alles umfassenden moralischen Gemeinschaft der Ungleichen ausgehen oder – in den Worten Gotthard M. Teutschs – die „Unteilbarkeit der Ethik“ voraussetzen. Der Vorteil dieser moralischen Argumentationsfigur ist, dass erst einmal jede Entität mit einem grundsätzlichen Anspruch auf moralische Berücksichtigung ausgestattet ist. Statt Altex 25, 4/08 Zum 90. Geburtstag von G. M. Teutsch sich diesen Anspruch durch ein bestimmtes Leistungsprofil verdienen zu müssen, bedarf jeder Eingriff in die Sphäre einer Entität der ethischen Rechtfertigung. Das Ungleichheitsparadigma gehorcht somit nicht einer Leistungslogik, sondern dem Primat von Abwehrrechten vor Fremdnutzungsansprüchen. Es kehrt gewissermaßen die Beweislast um. Dabei gehen in die ethische Rechtfertigung des Eingriffs empirische Informationen sowohl über das Bedürfnisprofil des potentiellen Nutznießers als auch über dasjenige der potentiell geschädigten Entität ein und eröffnen die Möglichkeit der begründeten Abwägung und Abstufung der im Spiel befindlichen Interessen, Güter und Werte. In diesem Sinne zitierte Teutsch schon vor mehr als zehn Jahren zustimmend dem Umweltengagierten Jürgen Dahl, der schrieb: „Es macht einen Unterschied, ob man von der Voraussetzung ausgeht, dass Tötung, Nutzung und Verbrauch von Tieren prinzipiell erlaubt sind und nur die äußersten Grenzen der Quälerei zu ermitteln wären, oder ob man umgekehrt den Verbrauch von Tieren für unzulässig hält und jede Ausnahme argwöhnisch daraufhin überprüft, wie unumgänglich sie denn wirklich ist.“ (Teutsch 1994/95, 102) Über solche Abwehrrechte hinaus ermöglicht der Ansatz auch eine Erweiterung auf Fürsorgeverpflichtungen für solche Lebewesen und unbelebte Entitäten, an denen partielle und rechtfertigbare Nutzungsansprüche angemeldet wurden. Ungleichheitsethiken kennen somit nicht nur ethisch relevante symmetrische Beziehungen zwischen Gleichen, sondern auch asymmetrische Fürsorgebeziehungen zwischen Ungleichen. Dieser Grundfigur folgt – allerdings begrenzt auf empfindungsfähige Wesen – z.B. die Ethik der Verpflichtung zur Anderinteressenbeachtung von Dietmar von der Pfordten (1994). Ein weiterer Vorteil des ethischen Ungleichheitsparadigmas neben der Befreiung von der ausschließenden Leistungsprofilierung ist, dass die Sonderstellung vernünftiger verpflichtungs- und rechtfertigungsfähiger Lebewesen, unter denen wir nur Menschen kennen, rekonstruierbar ist, während Gleichheitsethiken Altex 25, 4/08 dafür keinen systematischen Ort bereithalten, sondern den ethisch essentiellen Unterschied zwischen moralischen Akteuren und Betroffenen – „moral agents“ und „moral patients“, wie es im Anschluss an den Tierrechtsphilosophen Tom Regan heißt – eine unwesentliche Nebensächlichkeit nennen. So sieht sich Peter Singer beispielsweise herausgefordert zu beteuern: „Ich habe nie die absurde Behauptung aufgestellt, es gäbe keine bedeutsamen Unterschiede zwischen normalen erwachsenen Menschen und anderen Tieren. Ich sage nicht, dass Tiere fähig sind, moralisch zu handeln, sondern dass das moralische Prinzip der gleichen Berücksichtigung der Interessen für sie ebenso gilt wie für den Menschen.“ (1982, 251) Bei Singer findet sich aber keine Entfaltung der ethischen Bedeutung dieses offensichtlich doch bedeutsamen Unterschieds „zwischen normalen Menschen und anderen Tieren“; – seine Formulierung legt eher die empirische Nivellierung dieser moralischen Differenz nahe statt die praktische Subjektivität menschlicher Wesen systematisch zu reflektieren. Es ist aufschlussreich, dass Teutsch, so sehr es ihn auch zu der Forderung einer Gerechtigkeit für Tiere „bis hin zu einer prinzipiellen Schonungspflicht mit selbstverständlich gefordertem Vegetarismus“ (1986, 323) drängt, den Gleichheitsgrundsatz in Anwendung auf Tiere „entsprechend weiter gefaßt“ sehen möchte, „etwa als Forderung, Gleiches gemäß seiner Gleichheit gleich, Verschiedenes gemäß seiner Verschiedenheit entsprechend anders zu bewerten und zu behandeln“. (1986, 325) Faktisch haben Ungleichheitsparadigmen in der abendländischen Geschichte für den Tierschutz weit effektiver gewirkt als die Gleichheitskämpfe, nämlich in Form von biblisch inspirierter Barmherzigkeitsethik und mitgeschöpflicher Verantwortung, die sich noch in der Zweckbestimmung des deutschen Tierschutzgesetzes findet. Im schöpfungstheologischen Rahmen gilt alles Geschaffene als gutes Geschöpf mit prinzipieller Daseinsberechtigung. Der Mensch ist einerseits als Geschöpf in dieser Schöpfungsgemeinschaft eingeschlossen, andererseits – insbesondere in reformatorischer Lesart – als verantwortungsfähiges und verantwortungspflichtiges Geschöpf herausgehoben und dem Schöpfer für den Nutzen und Umgang mit der Schöpfung rechenschaftspflichtig. Selbst Aufklärungsphilosophen wie Immanuel Kant oder der unbekanntere Wilhelm Dietler folgen einem humanistischen Ideal in ihren tierethischen Konzepten – und damit einem Ungleichheitsparadigma (Ingensiep und Baranzke, 2008, s. Bespr. in diesem Heft). Es ist besonders Teutschs Verdienst, diese von reformatorischen Dissidentenbewegungen getragene Ethik der Mitgeschöpflichkeit (vgl. Stichwort „Mitgeschöpflichkeit“ in Teutsch, 1987; Teutsch, 1995; Röhrig, 2000) nachdrücklich in der deutschen Tierschutzdiskussion in Erinnerung gehalten zu haben – übrigens u.a. auch unter dem Stichwort „Humanität“ im „Lexikon der Tierschutzethik“ (1987) sowie im Wissenschaftlichen Beirat des Beauftragten für Umweltfragen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kirchenamt, 1991). In Deutschland war es insbesondere der Pietismus, der die Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf vor dem Schöpfer nicht nur theoretisch gefordert, sondern auch in praktischer Tierschutzarbeit umgesetzt hat. Christian Adam Dann und Albert Knapp sind nur zwei von vielen protestantischen Geistlichen, die als Vordenker, Gründer und Leiter deutscher Tierschutzvereine zu nennen sind, um in diesem Rahmen die christliche Nächstenliebe auch auf die nichtmenschlichen Geschöpfe auszuweiten (vgl. Jung, 2002). Noch Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben hat vom Pietismus entscheidende Impulse erfahren, wie insbesondere seine Tierschutzpredigten verraten. In England und den Vereinigten Staaten von Amerika haben besonders die Puritaner und die Quäker den Tierschutz als asymmetrische Fürsorgeethik, das stewardship-Modell, gefördert, wie andere Studien zeigen (Gharpure, 1935; Jung, 2002; Wiedenmann, 1996). Anlässlich der Diskussion um den schweizerischen Verfassungsbegriff der „Würde der Kreatur“ trug Teutsch (1995) eine Vielzahl christlicher Quellen für die weithin vergessene Tradition der „geschöpflichen Würde“ zusammen, die für ihn letztlich integraler Bestandteil und Resultat einer „zu Ende gedachten Humanität“ (1995, 13) darstellt. Nicht zuletzt dieses Poten341 Zum 90. Geburtstag von G. M. Teutsch tial hat sich historisch und systematisch als ein „expandierender Humanismus“ (Ingensiep, 2006) entfaltet, der den Menschen „und die Tiere“ in einer asymmetrischen Verantwortungsgemeinschaft prinzipiell Ungleicher integriert. Literatur Aurelius Augustinus (1998). Über die Lebensführung in der Katholischen Kirche und Über die Lebensführung der Manichäer, zwei Bücher. Übers. v. Elke Rutzenhöfer. Berlin: FU, Diss., Mikrofiche-Ausgabe. Baranzke, H. (2002). Würde der Kreatur? Die Idee der Würde im Horizont der Bioethik. Würzburg: Königshausen & Neumann Baranzke, H. (2006). Tierethik. In M. Düwell, M. H. Werner und Ch. Hübenthal (Hrsg.), Handbuch Ethik, 2. Aufl. (288-292). Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag. Cavalieri, P. und Singer, P. (Hrsg.) (1994). Menschenrechte für die Großen Menschenaffen. München: Goldmann Verlag (engl.: The Great Ape Project. Equality beyond Humanity. London 1993). Diogenes Laertius (21967). Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Philosophische Bibliothek Bd. 53/54. Hamburg: Meiner Verlag. Düwell, M. (2006). Moralischer Status. In M. Düwell, M. H. Werner und Ch. Hübenthal (Hgs.): Handbuch Ethik, 2. Aufl.(434-439). Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag. Gharpure, N. K. (1935). Tierschutz, Vegetarismus und Konfession. München. Ingensiep, H. W. (2009 i.E.). Speziesismus. [mensch] Zeitschrift für Philosophische Anthropologie Jg. 1. Ingensiep, H. W. (2006). Expandierender Humanismus, Holismus und Evolution. In K. Köchy und M. Norwig (Hrsg.), Umwelt-Handeln. Zum Zusammenhang von Naturphilosophie und Umweltethik (49-68). München: Alber Verlag. Ingensiep, H. W. (1997). Personalismus, 342 Sentientismus, Biozentrismus – Grenzprobleme der nicht-menschlichen Bioethik. Theory Bioscience. Formerly: Biologisches Zentralblatt 116, 169191. Ingensiep, H. W. und Baranzke, H. (2008) Das Tier. Stuttgart: Reclam Verlag. Jung, M. H. (Hrsg.) (2002). Christian Adam Dann. Albert Knapp. Wider die Tierquälerei. Frühe Aufrufe zum Tierschutz aus dem württembergischen Pietismus. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (Hrsg.) (1991). Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Ein Diskussionsbeitrag des Wissenschaftlichen Beirats des Beauftragten für Umweltfragen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschand. Hannover. EKD-Texte 41. Rawls, J. (1979). Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag (engl. A Theory of Justice 1971). Röhrig, E. (2000). Mitgeschöpflichkeit. Die Mensch-Tier-Beziehung als ethische Herausforderung im biblischen Zeugnis. In der Theologiegeschichte seit der Reformation und in schöpfungstheologischen Aussagen der Gegenwart. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. Scharmann, W. (2000). The Great Ape Project – Menschenrecht für die Großen Menschenaffen. In ALTEX 17/4, 221-224. Singer, P. (1994). Praktische Ethik. Stuttgart: Reclam Verlag 2. rev. u. erw. Aufl. Singer, P. (1982). Befreiung der Tiere. Eine neue Ethik zur Behandlung der Tiere. München: F. Hirthammer Verlag. Teutsch, G. M. (1995). Die „Würde der Kreatur“. Erläuterungen zu einem neuen Verfassungsbegriff am Beispiel des Tieres. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt. Teutsch, G. M. (1994/95). Leben und Tod der Tiere nach dem Gleichheitsgrund- satz. Ein Bericht über die Diskussion im deutschsprachigen Raum. Scheidewege 24, 92-105. Teutsch, G. M. (1987). Mensch und Tier. Lexikon der Tierschutzethik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Teutsch, G. M. (1986). Nachwort zur deutschen Ausgabe. In P. Singer (Hrsg.), Verteidigt die Tiere. Überlegungen für eine neue Menschlichkeit (320-333). Wien: Ullstein Verlag. Teutsch, G. M. (1984). Tierschutz als Geschichte menschlichen Versagens. In Ursula M. Händel (Hrsg.), Tierschutz. Testfall unserer Menschlichkeit (3949). Frankfurt a. M.: Fischer. Teutsch, G. M. (1975). Soziologie und Ethik der Lebewesen. Eine Materialsammlung. Bern, Frankfurt a. M.: Peter Lang. Tugendhat, E. (1997). Wer sind alle? In A. Krebs (Hrsg.), Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion (100-110). Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag. Von der Pfordten, D. (1994). Ökologische Ethik. Zur Rechtfertigung menschlichen Verhaltens gegenüber der Natur. Reinbek bei Hamburg: rowohlt Verlag. Wiedenmann, R. E. (1996). Protestantische Sekten, höfische Gesellschaft und Tierschutz. Eine vergleichende Untersuchung zu tierethischen Aspekten des Zivilisationsprozesses. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 48. Jg., 35-65. Wolf, J.-C. (1992). Tierethik. Neue Perspektiven für Menschen und Tiere. Freiburg, Schweiz: Paulus Verlag. Korrespondenzadresse Dr. Heike Baranzke Seminar für Moraltheologie Katholisch-Theologische Fakultät Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn Am Hof 1 53513 Bonn Deutschland E-Mail: [email protected] Altex 25, 4/08