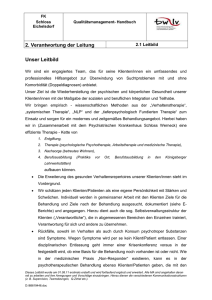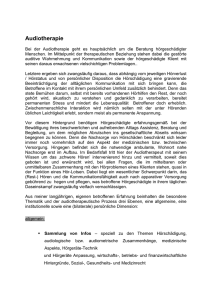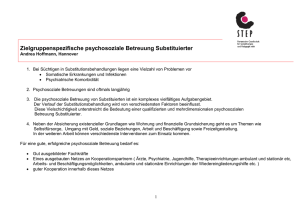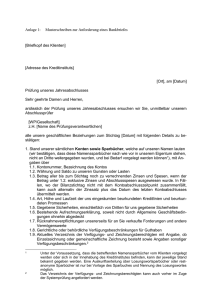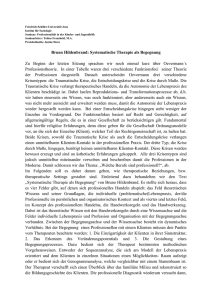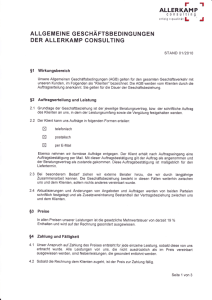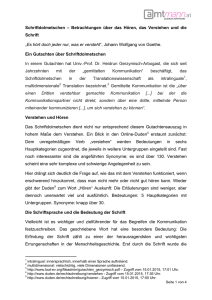Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten
Werbung

Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Miriam Hailer Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................................................ 1 2 Behandlungssetting – Der Vertrag zur Integrierten Versorgung nach §140 a ff. SGB IV ... 2 3 Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) – Ein Überblick .................................................. 3 3.1 Epidemiologie .............................................................................................................. 3 3.2 Ursachen ...................................................................................................................... 4 3.3 Diagnostik .................................................................................................................... 5 3.4 Symptomatik................................................................................................................ 6 3.5 Therapie ....................................................................................................................... 8 3.5.1 Pharmakotherapie ................................................................................................ 9 3.5.2 Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT)............................................................. 10 3.5.2.1 Behandlungsmodule ................................................................................... 11 3.5.2.2 Therapeutische Grundannahmen ............................................................... 11 3.5.2.3 Behandlungsstufen ..................................................................................... 12 3.5.2.4 Fertigkeitentraining (Skillstraining) ............................................................. 15 3.5.2.5 Empirische Befunde zur DBT ....................................................................... 16 3.5.3 Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) ................................................ 16 3.5.3.1 Grundlagen.................................................................................................. 16 3.5.3.2 Der therapeutische Prozess ........................................................................ 17 3.5.3.3 Vorteile der TFP........................................................................................... 18 3.5.3.4 Empirische Befunde zur TFP ....................................................................... 19 3.5.4 Systemische Familientherapie ........................................................................... 20 3.5.5 Psychoedukation ................................................................................................ 22 3.5.5.1 Allgemeines ................................................................................................. 22 3.5.5.2 Spezielles zur Borderline-Störung ............................................................... 24 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 3.5.6 4 5 Schematherapie ................................................................................................. 26 Angehörigenarbeit ........................................................................................................... 28 4.1 Ist Angehörigenarbeit sinnvoll? ................................................................................. 28 4.2 Selbsthilfe .................................................................................................................. 30 4.3 Psychoseseminar ....................................................................................................... 31 4.4 Psychoedukation ....................................................................................................... 32 4.5 Angehörigenvisite ...................................................................................................... 33 4.6 Angehörigen-Informationstage ................................................................................. 34 4.7 Systematische Angehörigenberatung in den UPD Bern ............................................ 35 4.8 Familientherapeutische Intervention ........................................................................ 36 4.9 Need-adapted-Treatment ......................................................................................... 38 4.9.1 Ursprung ............................................................................................................. 38 4.9.2 Behandlungsprinzipien ....................................................................................... 38 Angehörigenarbeit bei Borderline Persönlichkeitsstörung .............................................. 40 5.1 Eigenschaften von Familien von Menschen mit einer Borderline- Persönlichkeitsstörung ......................................................................................................... 41 6 5.2 Dialectical Behavioral Therapy – Family Skills Training ............................................. 42 5.3 Psychoedukation ....................................................................................................... 43 5.4 Family Connections.................................................................................................... 44 5.5 Familientherapie ........................................................................................................ 45 Empirischer Teil ................................................................................................................ 46 6.1 Fragestellung und Hypothesen .................................................................................. 46 6.2 Untersuchungsdesign ................................................................................................ 48 6.2.1 Erstellung des Erhebungsinstrumentes ............................................................. 48 6.2.2 Datenerhebung .................................................................................................. 48 6.2.3 Datenschutz ........................................................................................................ 49 6.2.4 Validität .............................................................................................................. 49 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 7 8 9 6.2.4.1 Interne Validität .......................................................................................... 49 6.2.4.2 Externe Validität.......................................................................................... 51 6.2.5 Reliabilität........................................................................................................... 51 6.2.6 Datenanalyse ...................................................................................................... 52 Stichprobe ........................................................................................................................ 55 7.1 Biografische Daten ..................................................................................................... 55 7.2 Krankheitsbezogene Daten........................................................................................ 57 7.3 Aktuelle Betreuungs- und Therapiesituation ............................................................ 60 7.4 Angehörigenbezogene Daten .................................................................................... 61 7.5 Angehörigenkontakte ................................................................................................ 65 Ergebnisse ........................................................................................................................ 72 8.1 Hypothese 1 ............................................................................................................... 72 8.2 Hypothese 2 ............................................................................................................... 74 8.3 Hypothese 3 ............................................................................................................... 77 8.4 Hypothese 4 ............................................................................................................... 78 8.5 Hypothese 5 ............................................................................................................... 79 Diskussion ......................................................................................................................... 81 9.1 Methodische Aspekte ................................................................................................ 81 9.2 Stichprobe.................................................................................................................. 82 9.3 Hypothese 1: .............................................................................................................. 83 9.4 Hypothese 2 ............................................................................................................... 84 9.5 Hypothese 3 ............................................................................................................... 85 9.6 Hypothese 4 ............................................................................................................... 86 9.7 Hypothese 5 ............................................................................................................... 88 10 Fazit .................................................................................................................................. 88 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? ANHANG: Literaturliste Statistische Auswertung Stat-up Fragebogen „Einbeziehung der Angehörigen von psychisch Kranken in die ambulante Versorgung bei Vincentro“ Erklärung nach § 31 Abs. 7 RaPo Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 1 Einleitung In der alltäglichen Arbeit mit psychiatrisch Erkrankten in der Integrierten Versorgung haben wir häufig mit Klienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung Kontakt. Im Rahmen des Konzeptes spielt die Arbeit mit dem sozialen Netz der Betroffenen eine große Rolle. Immer wieder fällt es auf, dass Angehörige von Klienten mit einer BorderlinePersönlichkeitsstörung mit anderen Augen betrachtet werden. Es gibt subjektiv mehr Vorbehalte über „krankmachende“ Beziehungen zu den Angehörigen als bei Klienten mit anderen psychiatrischen Diagnosen. Auch stehen manche Angehörige von Borderline-Erkrankten unter „Täterverdacht“, was jedoch häufig nur ein Verdacht ist. Diese Vorbehalte machen die Arbeit mit den Angehörigen von Borderline-Erkrankten manchmal sehr schwierig. Trotzdem spielt die Einbeziehung des sozialen Netzes auch durch die verkürzte Aufenthaltsdauer in psychiatrischen Krankenhäusern eine wichtige Rolle, da dadurch die Patienten mehr Zeit zu Hause verbringen und so auch in akuteren Phasen von Angehörigen betreut werden. (vgl. Spießl et al., 2006, S. 2459) Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Konzept der Integrierten Versorgung der Techniker Krankenkasse, der KKH Allianz (NwpG) und einiger Betriebskrankenkassen (SeGel) wieder. Hierbei ist es konzeptionell festgelegt im Rahmen des Need-Adapted-Treatment das Netzwerk der Klienten, und damit auch die Angehörigen, miteinzubeziehen. Ziel der Arbeit ist es, sowohl diagnosenspezifische Unterschiede bezüglich der Häufigkeit und auch der Qualität des Kontaktes zu den Angehörigen, einerseits von den Klienten selbst andererseits von den Therapeuten, zu untersuchen. Auch sollen die Gründe für die Nichteinbeziehung auf diagnosespezifische Unterschiede untersucht werden. Ebenfalls soll überprüft werden, ob sich die eventuell vorhandene eigene psychische Erkrankung der Angehörigen im Kontakt zu den Klienten und zu den Profis widerspiegelt. Um die Hypothesen zu überprüfen werden die Mitarbeiter der leistungserbringenden Einrichtung Vincentro zu den Kontakten ihrer Klienten zu den jeweiligen Angehörigen befragt. Auch sollen die Mitarbeiter den Kontakt der Klienten zu den Angehörigen hinsichtlich der Qualität einschätzen. In einem weiteren Punkt sollen die Mitarbeiter den eigenen Kontakt zu Angehörigen bewerten. Es wird ebenfalls abgefragt, warum zu manchen Angehörigen kein Kontakt besteht. 1 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Im theoretischen Teil soll die Borderline–Störung näher beschrieben werden. Auch sollen aktuelle Konzepte der Angehörigenarbeit, sowohl allgemein, als auch auf die BorderlineStörung fokussiert, erläutert werden. 2 Behandlungssetting – Der Vertrag zur Integrierten Versorgung nach §140 a ff. SGB IV Die Techniker Krankenkasse (vgl. Ruprecht, 2010, S. 85f) hat mit dem „Netzwerk psychische Gesundheit“ (NwpG) einen Referenzvertrag zur integrierten Versorgung neu entwickelt. Das NwpG soll die teilweise lückenhaften und schlecht vernetzten ambulanten Versorgungsstrukturen komplettieren und den Weg für eine verbesserte ambulante wohnortnahe Versorgung ebnen. Die Hauptziele des Vertrages für die Versicherten sind der Erhalt der Patientenautonomie, die Förderung der Selbstbestimmung mit dem Ziel des „Recovery“, das Verhindern von Chronifizierung, die Einbeziehung der Angehörigen, eine ambulante Versorgung statt einer stationären Versorgung, soweit möglich, und die Sicherung eines kontinuierlichen Behandlungsablaufes durch sektorübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Auf Seiten der Krankenkassen soll eine sukzessive Umlenkung der Geldflüsse vom stationären in den ambulanten Bereich durch eine Umsteuerung von stationären auf ambulante, integrierte und wohnortnahe Versorgungsformen stattfinden. Dies soll zu einer verbesserten Qualität der Versorgung von psychisch kranken Menschen bei stabilen oder sogar sinkenden Gesamtkosten führen. Hierzu stehen den Versicherten und auch ihren Angehörigen folgende Angebote zur Verfügung: - zwei persönliche Bezugsbegleiter - telefonische Beratung und schnelle Terminvergabe - bei Bedarf Hausbesuche im Sinne des Need-Adapted-Treatment (vgl. Aderhold, Greve; 2010) - verschiedene Behandlungsmodule, welche je nach Bedarf ergänzend zur Behandlung beim Facharzt und Psychotherapeuten zum Einsatz kommen: Häusliche psychiatrische Krankenpflege, Soziotherapie, Psychoedukation, Intensivbetreuung, Rückzugsräume und KurzzeitPsychotherapie - verbesserte fachärztliche Anbindung 2 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? - 24 Stunden erreichbares Krisentelefon - umfassendes Case-Management 3 3.1 Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) – Ein Überblick Epidemiologie Grundsätzlich kann man sagen, dass die Lebenszeitprävalenz von Persönlichkeitsstörungen in der Bevölkerung auf 5% bis 10% geschätzt wird. Auch in neueren Untersuchungen werden diese Daten bestätigt. (vgl. Maier et al. 1992; Reich et al. 1989; Weissman 1993; Zimmermann, Coryell, 1990 zit. nach Barnow, 2008, S. 61) Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung speziell liegt die Lebenszeitprävalenz bei 0,4% bis 4,6% (vgl. Barnow, 2008, S. 61). Jedoch erfüllen in der Population psychiatrischer Patienten 30% bis 50% der Betroffenen die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung (vgl. Fydrich et al. 1996, 1996 zit. nach Barnow, 2008, S. 63) Zum Verlauf von Persönlichkeitsstörungen lässt sich sagen, dass man früher von einer sogenannten Drittelregel ausgegangen ist: Demnach soll es bei einem Drittel zu einem ungünstigen Verlauf, bei einem Drittel zu einem moderaten Verlauf mit allerdings erheblichen Einschränkungen auf der Beziehungsebene und beim letzten Drittel zu einem günstigen Verlauf mit ausreichender oder sogar guter Lebensbewältigung kommen (vgl. Tölle, 1986 zit. nach Barnow, 2008, S. 64f.) Gunderson und Kollegen (2000) der Collaborative Longitudinial Study of Personality Disorders fanden jedoch im 18 Monate Follow-up eine Remissionsrate von 40% bei Patienten mit einer Borderline–Störung. Nach 48 Monaten betrug die Remissionsrate bei Borderline-Störungen 60% (vgl. Barnow, 2008, S. 65). Lieb et al. (2004) beschreiben verschiedene komorbide Achse–I–Störungen bei der Borderline-Störung: • Angststörungen 80% • Affektive Störungen 80% • Alkohol – Drogen: 80% • Schlafstörungen: 70% • Somatoforme Störungen: 60% • Essstörungen: 45% • Zwangsstörungen: 30% 3 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 3.2 Ursachen Laut Bohus (2002, S.13) handelt es sich bei der Entstehung einer Borderline – Persönlichkeitsstörung um ein multifaktorielles Geschehen: • Psychosoziale Komponenten: Als empirisch gesicherte Risikofaktoren für die Entstehung einer Borderline- Persönlichkeitsstörung gelten: - weibliches Geschlecht bzw. Sozialisierung - frühe Erfahrung von sexueller Gewalt - körperliche Gewalt und Vernachlässigung durch primäre Bezugspersonen - Gewalterfahrung im Erwachsenenalter Weiterhin scheint neben den oben genannten Gründen, das Fehlen einer zweiten Bezugsperson, einer Schutz und Sicherheit gewährenden Person, welche insbesondere die Wahrnehmung der Betroffenen teilt und deren Emotionen bestätigen könnte, als Risikofaktor gesichert zu sein. Trotz der hohen Mißbrauchsrate ist der kausale Zusammenhang zwischen erlebter Traumatisierung und Entwicklung einer BPS nicht geklärt. Der Bogen der belastenden Faktoren lässt sich jedoch weit spannen: Angefangen bei der Überforderung im Umgang mit einem vulnerablen und stressanfälligen Kind bis hin zur komplexen Traumatisierung durch primäre Bezugspersonen. Das Resultat daraus sind zwischenmenschliche Schemata welche von Misstrauen, Angst, Schuld und Scham geprägt sind. Viele Patienten sind in einem familiären Umfeld mit chaotischen Strukturen aufgewachsen (vgl. Rentrop et al., 2007, S. 10). • Genetische Komponenten: Seit Mitte der 90er Jahre liegen für die Gesamtheit der Persönlichkeitsstörungen Befunde aus Zwillingsstudien vor, welche den Nachweis eines starken genetischen Einflusses erbringen. Die Konkordanzraten liegen bei eineiigen Zwillingen ca 55%, bei zweieiigen bei 14% (vgl. Schepank 1996, zit. nach Bohus, 2002, S. 13). Weitere Studien geben eindeutige Hinweise auf einen substanziellen genetischen Einfluss. Es lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen (vgl. Maier, Hawellek, 2011, S. 69ff): 4 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? - Die Konkordanzrate für die Diagnose Borderline–Persönlichkeitsstörung eineiiger Zwillinge liegt zwischen 35% und 38%, für zweieiige Zwillinge bei 7% bis 19% (Torgersen et al. 2000 zit. nach Meir, 2011, S. 70). - Die Größe des genetischen Einflusses hängt vom Behandlungsstatus ab. Eine Rekrutierung der Zwillinge aus der Allgemeinbevölkerung gibt niedrigere Werte von 35% (Torgersen, 2008) als die Auswahl der Zwillingspaare über einen im Krankenhaus behandelten Indexfall mit dieser Diagnose, die mit 57–69 % Varianzaufklärung stärkere genetische Einflüsse erbringt (Torgersen, 2000). - Die Höhe des gentischen Einflusses ist – zumindest unter europäischen Bedingungen – relativ unabhängig vom kulturellen Hintergrund (Distel, Rebollo–Mesa et al., 2009) 3.3 Diagnostik Grundsätzlich stellt die Diagnostik einer Persönlichkeitsstörung höhere Anforderungen an den Diagnostiker, als die der meisten Achse–I–Störungen, was darin begründet ist, dass die Symptome meist schlechter beobachtbar sind und stark mit dem Selbst- und Beziehungserleben in Verbindung stehen. Deshalb ist der Einsatz von testdiagnostischen Instrumenten zu empfehlen (vgl. Doering, 2011, S. 303). Die klinische Diagnostik erfolgt international mittels zwei Klassifikationssystemen: der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen der WHO (ICD-10) und dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (DSM-IV). In diesen werden deskriptiv orientierte diagnostische Kriterien, von denen eine bestimmte Anzahl erfüllt sein muss, damit die Diagnose vergeben werden darf beschrieben. Beide Diagnosesysteme beinhalten sowohl allgemeingültige diagnostische Kriterien für alle Persönlichkeitsstörungen, als auch spezifische Kriterien für die einzelnen Persönlichkeitsstörungen welche in der nachfolgenden Abbildung 2.1 dargestellt werden (vgl. Doering, 2011, S. 304). 5 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Abbildung 2.1: Allgemeine diagnostische Kriterien für die Persönlichkeitsstörungen der ICD–10 und des DSM- IV (vgl. Doering, 2011, S. 305) 3.4 Symptomatik Auf der klinischen Ebene lässt sich nach Bohus (2002, S. 7 ff) die Symptomatik von PatientInnen mit BPS in fünf Problembereiche gliedern: • Affektregulation: Bei den meisten Forschergruppen steht derzeit das Defizit in Affektregulation im Vordergrund. Die meisten diagnostischen Kriterien können als direkte Auswirkung der Störung oder als Versuch, diese zu kompensieren, verstanden werden. Dies betrifft sowohl die niedrige Reizschwelle für die Auslösung von Emotionen, als auch das hohe Erregungsniveau. PatientInnen erleben „überflutende Emotionen“, „Gefühlswirrwarr“ oder zeitgleich unterschiedliche Gefühle. Als Gemeinsamkeit zwischen den meisten PatientInnen lässt sich beschreiben, dass sie mehrmals täglich starke aversive Spannungszustände erleben, welche häufig sehr schnell einschießen und dann viele Stunden anhalten können. Etwa 60% der PatientInnen 6 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? entwickeln während dieser Zustände dissoziative Symptome. Zahlreiche dysfunktionale Verhaltensmuster, wie z.B. Selbstverletzungen werden als Bewältigungsversuche eingesetzt. Entgegen dieser Phasen dieser hohen Anspannung erleben die Patientinnen auch häufig einsetzende Episoden der emotionalen Taubheit (numbness), also vollständig fehlender Gefühlswahrnehmung. Auch diese wird als äußerst quälend beschrieben, da sie mit einem ausgeprägten Verlust des Identitätsgefühls einher geht (vgl. Bohus, 2002, S. 7 f). • Selbst und Selbstbild: Es wird von den PatientInnen über ein tiefgreifendes Gefühl von Unsicherheit der eigenen Identität und Integrität berichtet. Auf der beschreibenden Ebene berichteten ca 70% der PatientInnen, kein sicheres Gefühl zu haben, „wer sie wirklich sind“, „weit entfernt von sich zu sein“ oder „abgeschnitten von sich selbst“ zu sein (vgl. Bohus, 2002, S. 7). • Psychosoziale Integration: Eine grundlegende Wahrnehmung von Patientinnen ist es, „anders zu sein als alle anderen“, „isoliert und abgeschnitten“ und „einsam, verlassen und unberührt von allen anderen“ zu existieren. Im zwischenmenschlichen Bereich sind besonders Schwierigkeiten mit der Regulation von Nähe und Distanz deutlich ausgeprägt. Die ausgeprägte Angst, verlassen zu werden lässt die Patientinnen häufig Abwesenheit mit Verlassenheit verwechseln, weshalb sie versuchen wichtige Bezugspersonen permanent an sich zu binden. Jedoch löst auch die Wahrnehmung von Nähe und Geborgenheit ein hohes Maß an Angst, Schuld und Scham aus. Lange und schwierige Beziehungen mit häufigen Trennungs- und Wiederannäherungsprozessen sind die Folge. Diese alternierende Aktivierung konträrer Grundannahmen scheint eines der auffälligsten Verhaltensmuster bei Borderline–PatientInnen zu sein (vgl. Bohus, 2002, S. 7f). • Kognitive Funktionsfähigkeit: Untersuchungen zeigen, dass ca. 60% der PatientInnen eine ausgeprägte dissoziative Symptomatik entwickelt, was sowohl Depersonalisations- als Derealisationserleben beinhaltet. Diese sind häufig nicht an bestimmte Auslöser gekoppelt, sondern generalisiert bzw. werden durch physiologische Anspannung ausgelöst. Charakteristisch für diese Phasen sind vor allem der die mangelnde Wahrnehmung der eigenen Emotionen, die Verzerrung des Raum-Zeit7 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Gefühls, ein ausgeprägtes Gefühl von Fremdheit und vor allem der Kontrollverlust über die Realität. Auch kommen häufig Flashbacks, d.h. szenisches Wiedererleben von traumatisierenden Ereignissen, hinzu (vgl. Bohus, 2002, S. 8f). • Verhaltensebene: 70% bis 80% aller PatientInnen berichten über selbstschädigende Verhaltensmuster in der Vorgeschichte. Am häufigsten sind sicherlich Schnittverletzungen, welche nicht auf bestimmte Körperregionen beschränkt sind. Häufig ist „head-banging“, also das Schlagen des Kopfes gegen eine harte Fläche. In 80% der Fälle spüren die PatientInnen während der Selbstverletzung keinen Schmerz. Übereinstimmend berichten PatientInnen, dass sie nach wenigen Minuten ein tiefgreifendes Gefühl der Entspannung, Entlastung, Ruhe und Geborgenheit einstellt. Körper- und Schmerzempfinden stellt sich ca. 20 Minuten nach der Selbstverletzung wieder ein. Ein weiteres auffälliges Verhaltensmuster ist Hochrisikoverhalten, wie z.B. Balancieren auf Brückengeländern, Rasen auf der Autobahn oder Sitzen auf Bahnschienen. Die sehr häufig beobachtete Essstörung kann als einerseits dysfunktionale Affektregulation verstanden werden, führt jedoch auch zu ausgeprägten Affektschwankungen sowie Störungen auf der kognitiven Ebene. Ebenso beobachtbar ist mangelnde Flüssigkeitszufuhr, welche sich manchmal auf ein bis zwei Liter pro Woche reduziert. Ca. 20% der PatientInnen nutzen selbstverletzendes Verhalten um subeuphorisches Erleben auszulösen. Diese PatientInnen berichtet über Anhebung der Stimmung, Verbesserung der Konzentration bis hin zu lustvollem Erleben. Das sog. „strangling“ (Würgen) kann unter diesem Hintergrund gesehen werden. Drogenmißbrauch (40%), Promiskuität, Pseudologie, pathologisches Kaufverhalten, Zwangshandlungen und aggressive Durchbrüche sind als weitere dysfunktionale Verhaltensmuster zu nennen (vgl. Bohus, 2002, S. 9f). 3.5 Therapie Grundsätzlich lassen sich in der Therapie der Borderline-Störung zwei große Schulen beschreiben. Zum einen die kognitiv-behavioristischen Ansätze, zu welchen die von Linehan entwickelte dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) gehört, und die psychodynamischen An8 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? sätze unterscheiden. Hier ist besonders die übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) zu erwähnen. Zusätzlich praktische Anwendung finden die systemische Familientherapie bei BorderlineStörungen, und die Schematherapie, sowie die Psychoedukation bei Borderline-Störungen. 3.5.1 Pharmakotherapie Die aktuell vorhandene Evidenz zur Pharmakotherapie ist derzeit eher unbefriedigend, auch steht sie nicht im Einklang mit der klinischen Praxis. Lange gab es keine Messinstrumente, welche für diese Patientengruppe eine valide und präzise Messung ermöglicht hätten; erst seit Beginn der 2000er Jahre wurden einige Messinstrumente entwickelt, welche sich eng an den DSM-IV–Kriterien orientieren und künftig eine präzisere Ergebnismessung ermöglichen. Grundsätzlich sind derzeit keine Medikamente auf dem Markt, welche explizit auf die spezifischen Borderline-Symptome wie Anspannungszustände, affektive Instabilität, Dissoziationen, Impulsivität, Angst vor dem Verlassenwerden oder chronischen Gefühlen der Leere zugeschnitten sind. Gute Effekte haben sich jedoch für Aripiprazol, Topiramat und Lamotrigin, weniger gute Effekte für Olanzapin, Valproinsäure und Omega-3-Fettsäuren ergeben. Isolierte Effekte liegen für Antipsychotika der ersten Generation (Haloperidol und Flupentixol) und das trizyklischen Antidepressivum Amitriptilin vor. Eine Zusammenfassung aller bislang in randomisierkontrollierten Studien bestätigten Wirksamkeitsbefunde gibt Abbildung 2.2. 9 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Abbildung 2.2: Signifikante Wirksamkeitsbefunde aus randomisiert–kontrollierten Studien (vgl. Stoffers, Lieb; 2011; S. 863) 3.5.2 Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) Die DBT wurde in den 1980er Jahren von Marsha M. Linehan als störungsspezifische Therapie für Borderline-Patienten mit chronischer Suizidalität entwickelt. Sie basiert auf einer neurobehavioralen Theorie und den Wirkprinzipien der empirisch-wissenschaftlichen Psychotherapie. Die DBT gilt als das wissenschaftlich am besten abgesicherte Verfahren zur Therapie der Borderline-Störung, weshalb die Einstufung der Wirksamkeit auf Ia durch die S2-LeitlinienKommission „Persönlichkeitsstörungen“ eingestuft ist. 10 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Laut mehreren Studien kann vor allem bei schweren Störungsbildern innerhalb kurzer Zeit eine Verbesserung der Verhaltenskontrolle und des emotionalen Erlebens bewirkt werden, was sich in guter Therapiecompliance, Reduktion von Suizidversuchen, Selbstverletzungen und Hospitalisierungsraten nieder schlägt. Auch kann eine klinisch relevante Reduktion von komorbider Achse–I–Störungen nachgewiesen werden (vgl. Bohus, 2011, S. 619 f). 3.5.2.1 Behandlungsmodule Die DBT orientiert sich vor allem im ambulanten Bereich an vier Modulen • Einzeltherapie • Telefonberatung • Skills-Training in der Gruppe • Supervision Die Einzeltherapie erstreckt sich meist über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren mit einer Behandlungsstunde pro Woche. Zur Lösung eventuell lebensbedrohlicher Krisen soll der Therapeut im Rahmen seiner Möglichkeiten telefonisch erreichbar sein. Zeitgleich besucht die Patientin einmal wöchentlich für ein bis zwei Stunden ein Fertigkeitentraining, welches sich an einem Manual orientiert und über sechs Monate geht. Ebenfalls wöchentlich sollte eine Supervisionsgruppe stattfinden, in welcher der Austausch zwischen Einzel- und Gruppentherapeut erfolgt. Der Einsatz von Video bzw. Tonträgeraufzeichnung der Therapiestunden gilt als eine adäquate Supervision für unverzichtbar (vgl. Bohus 2011, S. 620). 3.5.2.2 Therapeutische Grundannahmen Neben den strukturellen Gegebenheiten spielt sicher die therapeutische Haltung, wie sie Linehan in den „Grundannahmen“ formuliert hat, eine entscheidende Rolle um die Therapiecompliance zu verbessern. • Borderline-PatientInnen versuchen, daß Beste aus ihrer gegenwärtig verheerenden Situation zu machen • Borderline-PatientInnen wollen sich verbesssern • Borderline-PatientInnen müssen sich stärker anstrengen, härter arbeiten und stärker motiviert sein, um sich zu verändern, dies ist ungerecht • Borderline-PatientInnen haben ihre Probleme in der Regel nicht selbst verursacht, aber sie müssen sie selbst lösen 11 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? • Das Leben suizidaler Borderline-Patientnnen ist so, wie es gegenwärtig gelebt wird, in der Regel unerträglich • Borderline-PatientInnen müssen neues Verhalten im relevanten Kontext lernen • PatientInnen können in der Dialektisch-Behavioralen Therapie nicht versagen. • Therapeuten, die mit Borderline-PatientInnen arbeiten, brauchen Unterstützung • Der therapeutische Kontext sollte so gestaltet sein, dass dysfunktionales Verhalten gelöscht und funktionales Verhalten verstärkt wird (vgl. Bohus, 2011, S. 620). Die ersten beiden Annahmen vergegenwärtigen dem Therapeuten die grundsätzliche Bereitschaft der Patientin etwas zu verbessern. Die dritte Annahme fordert von Therapeuten und Patienten Sorgfalt, Rücksichtnahme und Kraft für die anstehende Veränderung. Die vierte Annahme, verbalisiert einen häufig sehr hinderlichen Standpunkt der Patientinnen. Die fünfte Annahme soll als Appell an die Empathie des Therapeuten verstanden werden, Verständnis für die oft ausweglos erscheinende Situation des Patienten aufzubringen und an seine Courage alles zu tun, um die Situation zu verändern. Die sechste Annahme verdeutlicht die Notwendigkeit die erlernten Fähigkeiten (Skills) auch während emotionaler Belastung und starkem Stress zu trainieren. Die siebte Grundannahme zeigt eigentlich eine selbstverständliche therapeutische Situation, denn niemand wird auf die Idee kommen, das Versagen einer Chemotherapie einem an Krebs leidenden Patienten anzulasten. Falls also Therapiefortschritte stagnieren oder es zu Abbrüchen kommt, so ist die „Schuld“ im therapeutischen Konzept, den eigenen Ressourcen, der Supervision oder der mangelnden Ausbildung des Therapeuten zu suchen. Die achte Grundannahme formuliert schließlich das Recht und die Notwendigkeit einer fachlichen und emotionalen Unterstützung des Behandelnden (vgl. Bohus, 2002, S. 19 f). 3.5.2.3 Behandlungsstufen Die gesamte Therapiezeit untergliedert sich in eine Vorbereitungsstufe und drei Behandlungsstufen mit jeweils unterschiedlichen Behandlungszielen (vgl. Bohus, 2011, S. 624 ff): 12 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? • Vorbereitungsstufe - Diagnostik - Aufklärung über das Störungsbild - Operationalisierung des Krisen generierenden Verhaltens - Klärung der gemeinsamen Behandlungsziele - Klärung der Behandlungsfoki und der Methodik der Dialektisch-Behavioralen Therapie - Behandlungsvertrag, Non-Suizid-Vertrag - Verhaltensanalyse des letzten Suizidversuchs - Verhaltensanalyse des letzen Therapieabbruchs •Therapiestufe I: Schwere Probleme auf der Verhaltensebene - Verbesserung der Überlebensstrategie (Umgang mit suizidalen Krisen) - Verbesserung der Therapiecompliance (Umgang mit Verhaltensmustern, welche die Fortsetzung oder den Fortschritt der Therapie verhindern) - Verbesserung der Lebensqualität (Behandlung von schwerwiegenden Achse-IStörungen) - Verbesserung der Verhaltensfertigkeiten (Skills) •Therapiestufe II: Probleme des emotionalen Erlebens - Verbesserung von dysfunktionalen erlernten und automatisierten emotionalen Reaktionsmustern (insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich) •Therapiestufe III: Probleme der Lebensführung - Integration des Gelernten und Neuorientierung Die Reihenfolge der Stufen sollte dringend eingehalten werden. Innerhalb der Stufe sind die zu bearbeitenden Therapieziele hierarchisch orientiert, d.h. wann immer ein höher geordneter Problembereich auftritt, muss er bearbeitet werden. Auch während der gesamten Therapiedauer strukturiert sich die Dialektisch-Behaviorale Therapie in Entscheidungsalgorithmen. 13 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Der Therapeut ordnet die jeweiligen Verhaltensmuster der Patientin noch vorgegebenen hierarchischen Prinzipien. Die einzelnen Problembereiche und Unterbereiche der Therapiestufe I sind ebenfalls hierarchisch gegliedert (vgl. Bohus, 2011, S. 624 ff): 1. Suizidales Verhalten - suizidales Krisenverhalten - massive Suizidimpulse, Suizidvorstellungen und Suiziddrohungen 2. Therapiezerstörende Verhaltensweisen - Verhaltensweisen, die den Fortbestand der Therapie stark gefährden - Verhaltensweisen, die den Fortbestand oder Fortschritt der Therapie anderer Patienten verhindern 3. Krisengenerierendes Verhalten - schwerwiegende Selbstverletzungen - Hochrisikoverhalten - unbehandelte schwerwiegende medizinische Probleme - aggressive Durchbrüche - ungeplante stationäre Notaufnahmen - schwerwiegende soziale Probleme 4. Therapiestörendes Verhalten - Verhalten, welches den Fortschritt der Therapie behindert - Non-Compliance - Verhalten, das zum Burn-out des Therapeuten oder des Teams führt - dysfunktionale Regeln oder Verhaltensmuster des Teams 5. Verhaltens- und Erlebensmuster, welche die Lebensqualität erheblich einschränken - Verhaltensweisen, die direkt zu unmittelbaren Krisensituationen führen - leicht zu verändernde Verhaltensweisen - Verhaltensweisen, die in direktem Zusammenhang mit übergeordneten Zielen und mit allgemeinen Lebensprinzipien der Patientin stehen 14 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 3.5.2.4 Fertigkeitentraining (Skillstraining) Das Skillstraining erstreckt sich über ein Jahr, wobei da Programm dabei zweimal wiederholt wird. Diese Wiederholung hat sich bewährt, da besonders am Anfang die kognitive Aufnahmefähigkeit aufgrund von Dissoziation und hoher Anspannung vermindert sein kann. Ziel des Skillstrainings ist es, spezifische Fähigkeiten zu vermitteln, zu üben und zu generalisieren. Es handelt sich jedoch keinesfalls um eine interaktive Gruppe. Zwischenmenschliche Schwierigkeiten sollen so schnell wie irgendwie möglich geklärt werden oder in der Einzeltherapie besprochen werden, ebenso individuelle Krisen. Diese Trennung ist strikt einzuhalten da sonst rasch „Mutationen“ zur prozessorientierten Gruppe einsetzen. Modalitäten wie z.B. Fehlzeiten sollten vorab eventuell auch im Behandlungsvertrag festgelegt werden (vgl. Bohus, 2002, S. 72 ff). Das gesamte Programm gliedert sich in vier Module, für jedes sollen etwa acht Sitzungen veranschlagt werden (vgl. Bohus, 2002, S. 72 ff). - innere Achtsamkeit - Stresstoleranz - Emotionsmodulation - zwischenmenschliche Fähigkeiten Basierend auf der Philosophie und Methodik des Zen integriert die Dialektisch-BehavioraleTherapie Übungen in die Behandlung, deren Wirksamkeit auf physiologische und psychologische Aspekte der inneren Anspannung mittlerweile auch empirisch nachgewiesen werden konnte. Innere Achtsamkeit zielt auf die Balance von Gefühl und Vernunft, um auf diese Weise intuitives Selbstverständnis zu stärken. Ziel der „Was“-Fähigkeiten der inneren Achtsamkeit ist Bewusstheit im Alltag. Gemeint ist damit beobachtende Zugewandheit zu sich selbst, den Dingen der Welt, ohne sich in die emotionalen Belange zu verstricken. Die „Wir“-Fähigkeiten setzen sich zusammen aus der „nicht-bewertenden Beobachtung“, der Konzentration und dem wirkungsvollen Handeln. Mit Konzentration ist gemeint, zu lernen Kontrolle über die Aufmerksamkeit zu erlangen, die Fähigkeit zu entwickeln, sich nicht von Gedanken oder Bildern aus der Vergangenheit ablenken zu lassen und sich nicht in Grübeleien verstricken zu lassen. Wirkungsvolles Handeln 15 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? beschreibt effektives, zielgerichtetes Handeln, unter Anwendung der jeweils gegebenen Regeln und Ausschöpfung der maximalen Möglichkeiten. Die Fertigkeiten zur Stresstoleranz greifen die Essenz der inneren Achtsamkeit auf, sie sind allesamt dialektisch organisiert: „Veränderung durch Akzeptanz“. Hierbei geht es bei der DBT darum, Schmerzen auf annehmende Weise zu ertragen. Fähigkeiten der Emotionsregulation sollen auf eine Stabilisierung der emotionalen Befindlichkeit hinarbeiten. Im letzten Modul des Skillstraining, dem üben der zwischenmenschlichen Fähigkeiten, sollen die interpersonellen Fähigkeiten in ihrer Anwendung in spezifischen Situationen verbessert werden. (vgl. Bohus, 2002, S. 72 ff). 3.5.2.5 Empirische Befunde zur DBT Im Rahmen einer kontrollierten randomisierten Studie zur DBT im Vergleich mit unspezifischer psychotherapeutischer Behandlung (TAU) fanden Linehan et al. (1991, 1993, 1994) bereits nach vier Monaten eine signifikante Überlegenheit der DBT hinsichtlich Abnahme der Selbstschädigung, des medizinischen Risikos der Selbstverletzungen sowie der stationären Behandlungstage. Auf der psychopathometrischen Ebene, das heißt Depressivität, Suizidvorstellungen und Hoffnungslosigkeit, zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bei den beiden Behandlungsgruppen. Diese zeigten sich jedoch im Bereich der sozialen Integration. Die Abbruchrate lag bei TAU bei 58%, bei der DBT bei 17%. In einer von Christoph et al. veröffentlichten Liste, welche alle empirisch validierten Therapiekonzepte auflistet, wird die DBT als einziges Behandlungskonzept für BorderlineStörungen als „probably efficacious eingestuft (vgl. Bohus, 2002, S. 119 f). 3.5.3 Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) 3.5.3.1 Grundlagen Ausgangspunkt der objektpsychologischen Therapiemethode ist die Vorstellung, dass die Schwierigkeiten des Patienten als im Hier und Jetzt erfolgte Wiederholungen von pathologischen, internalisierten Beziehungen aus der Vergangenheit zu verstehen sind. Es bleiben unbewusste Konflikte in Form von Objektbeziehungen in der Persönlichkeit zurück, weshalb sie nicht nur bis in die Gegenwart wirksam sind, sondern auch immer wieder nachvollzogen 16 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? werden. Im Gegensatz zu gesunden oder neurotischen Personen sind die Objekt- aber auch die Selbstrepräsentanzen des Borderline-Patienten geprägt vom zentralen Phänomen der Spaltung und nicht integriert. Dies wird auch als Identitätsdiffusion bezeichnet. Das oberste Ziel der TFP ist es nun, die zentralen Bereiche der internalisierten Objektbeziehung des Patienten zu verändern, die zu den sich ständig wiederholenden, maladaptiven Verhaltensauffälligkeiten sowie chronischen affektiven und kognitiven Störungen führen. Das Verfahren der TFP zielt also auf strukturelle und nur indirekt auf symptomatologische Veränderung. Dies geschieht durch die Arbeit an der Übertragung und am Widerstand durch Deutung dieser Tendenzen. Deutung ermöglicht integrierende Internalisierung abgespaltener Anteile (vgl. Dammann et al.; 2001; S. 63f). Vorrangige Aufgabe in der Therapie ist es, den psychischen Konflikten innerhalb des therapeutischen Rahmens Raum zu geben. Da die Arbeit mit der Übertragung eine zentrale Rolle einnimmt, deutet der Therapeut Agieren und Somatisierung innerhalb der therapeutischen Beziehung als Übertragung. Aufgrund des Agierens müssen in der Therapie den Verhaltensweisen, welche die Therapie gefährden, Grenzen gesetzt werden. Dies erfolgt zu Beginn durch einen Behandlungsvertrag. Die Rahmenbedingungen der Therapie führen in der Regel zu einer deutlichen Reduktion autodestruktiver Verhaltensweisen, bevor eine intrapsychische Integration erreicht wurde. Sowohl beim Agieren wie bei der Somatisierung wird durch therapeutisches Vorgehen versucht, das Symptom innerhalb der Übertragung in einen analysierbaren Zustand zu bringen. Deuten heißt hier vorrangig, Objektbeziehungen bewusst zu machen, welche unbewusst erlebt werden und sich entweder im Agieren oder in körperlichen Symptomen äußern (vgl. Clarkin et al; 2002; S. 17 ff). 3.5.3.2 Der therapeutische Prozess Mit Hilfe kognitiver Klärung versucht der Therapeut zuerst zu verstehen, was der Patient wahrnimmt und wie dieses Erleben zu seinen Gefühlen in Verbindung zu setzen ist. Eine Klärung in diesem Sinne orientiert sich an folgenden Kommunikationskanälen: - Inhalt des verbalen Diskurses - nonverbale Kommunikation und nonverbales Verhalten - Gegenübertragungsreaktionen, die im Therapeuten wachgerufen werden 17 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Jeder dieser drei Kanäle bring unterschiedliche und voneinander abgespaltene Aspekte der inneren Welt des Borderline-Pateinten zum Ausdruck. Die Haltung des Therapeuten ist die der Neutralität, was nicht zu verwechseln ist mit Gleichgültigkeit oder Kälte, gegenüber den Kräften, die in den Konflikten des Patienten zum Tragen kommen. Ausgenommen hiervon sind Situationen, in denen das Verhalten des Patienten über ein bestimmtes Maß an Destruktivität oder Selbstdestruktivität hinaus geht. Die Neutralität des Therapeuten fördert einerseits die Reaktivierung der charakteristischen Objektbeziehungsdyaden, hilft dem Patienten jedoch in einem zweiten Schritt, Selbstanteile wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu integrieren, welche er zuvor nicht bewusst tolerieren konnte, sondern diese projizieren oder agieren musste. Trotz der Schwierigkeit, den Prozess im Sinne einzelner Phasen zu definieren, lassen sich bestimmte Behandlungslinien ausmachen: In der Anfangsphase besteht die Hauptaufgabe darin, dass affektive Chaos auszuhalten und die Wechsel zwischen Affektstürmen, verbalisierten primitiven Phantasien oder primitiven Inszenierungen anzunehmen. Dieser Phase folgen die Identifizierung der Selbst- und Objektrepräsentanzen, die sich aus dem Zustand extremer affektiver Aufladung oder aber affektiver Leere destillieren lassen. In einer forgeschritteneren Phase der Behandlung geht es darum, zu untersuchen, auf welche Art und Weise eine spezifische Objektbeziehungsdyade durch eine andere abgewehrt werden soll. Diese Dyaden werden zur Integration und Modulierung der inneren Welt des Patienten systematisch gedeutet (vgl. Yeomans, Diamond; 2001; S. 549f). 3.5.3.3 Vorteile der TFP Trotz einiger theoretischer Grenzen, die die Objektbeziehungstheorie aus heutiger Sicht aufweist, haben sich einige Vorehen durchaus bewährt: • Die große Nähe zwischen dem klinischen Phänomen und den theoretischen Konzeptionen • Es kann erklärt werden, warum eine Persönlichkeit auf verschiedenen Strukturniveaus funktioniert, z.B. kommt es bei der Borderline–Persönlichkeit unter regressiven Einflüssen zu einer schweren Dekompensation, in anderen Zeiten funktioniert der gleiche Mensch jedoch durchaus gut. Der Ansatz, Persönlichkeitsanteile zu differenzieren geht auf Freuds Arbeit zurück 18 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? • Externe Beziehungserfahrungen und internalisierte Objektbeziehungen können in Verbindung gebracht werden. Umgekehrt kann von internalisierten Objektbeziehungen wieder auf externe Beziehungsgestaltungen, wie z.B. aktivierte Rollenbeziehungen und interpersonelle Probleme, geschlossen werden. • Die Objektbeziehungstheorie bietet die Möglichkeit, Verbindung zu anderen Vorstellungen des mentalen Funktionierens herzustellen, wie z.B. Repräsentationen, Schemata, Bindungstheorie oder zur „Theory of mind“ (vgl. Dammann; 2001; S. 64). 3.5.3.4 Empirische Befunde zur TFP Laut Yeomans und Diamond (2011;S. 552 f) wurde am „Personality Disorders Institute“ der Cornell University, New York, wurden bisher drei Studien zur TFP durchgeführt, um die Wirkung auf Symptomatologie, soziale Anpassung, Inanspruchnahme psychiatrischer und allgemeinemedizinischer Dienste, Bindungsorganisation und Mentalisierung bei Patienten mit Borderline-Personlichkeitsstörung zu untersuchen. In der ersten Studie wurden Borderline-Patientinnen mit mindesten zwei Episoden suizidalen oder selbstverletzenden Verhaltens in den 12 Monaten vor Therapiebeginn untersucht. Die TFP führte bei 20 Patientinnen zu signifikanten Veränderungen in einer Reihe zentraler Problembereiche. Das Risiko suizidaler Handlungen ging signifikant zurück, auch der allgemeine medizinische Status verbesserte sich signifikant. Nach 12 Monaten TFP wiesen 52,9% der Patientinnen nicht mehr die Kriterien einer Borderline-Störung auf. Ebenfalls ging die Zahl der Notaufnahmen, stationären Aufnahmen und der Krankenhaustage signifikant zurück. Veränderungen in den Bereichen des „reflective functioning“ und des Bindungsmodus waren ebenfalls signifikant. In der nachfolgenden Vergleichsstudie wurden zwei Patientengruppen untersucht: eine Gruppe wurde ein Jahr lang mit TFP behandelt, die anderen mit herkömmlichen Therapieverfahren. Hier ist die Zahl der Notaufnahmen und stationären Aufenthalte in der TFPGruppe signifikant niedriger. Das allgemein verbesserte Funktionsniveau (GAF) war in der TFP deutlich besser. Um die Wirksamkeit der TFP im Vergleich mit anderen manualisierten Verfahren zu untersuchen wurde eine randomisierte Vergleichsstudie durchgeführt. ES wurden drei Therapieverfahren in ambulanten Stichproben über einen Zeitraum von einem Jahr gegenübergestellt: Die TFP, die Dialektische-Behaviorale Therapie und die psychodynamisch orientierte supportive Therapie. Im Hinblick auf Symptomatologie und GAF erwiesen sich 19 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? alle drei Verfahren als hilfreich. In jeder Gruppe zeigten sich signifikante Verbesserungen hinsichtlich „Depression“, „Angst“, „allgemeines Funktionsniveau“ und „soziale Anpassung“. Zu signifikanten Verbesserungen im Bereich „Suizidalität“ kam es nur bei der Gruppe der TFP und der DBT, die Bereiche „Wut“ und „Impulsivität“ verbesserten sich nur in der Gruppe TFP und der supportiven Therapie verbesserten. In den Bereichen „Reizbarkeit“ und „Verbale/Körperliche Angriffe“ zeigten sich nur Veränderungen bei der TFP. Die mithilfe der TFP behandelten Borderline-Patientinnen zeigten einen im Ergebnis höheren Durchschnittswert auf der „Reflective-Functioning“- Skala. Dies bedeutet für die klinische Arbeit, dass die größere Fähigkeit über sich und andere nachzudenken, zu weniger inadäquaten Zuschreibungen führen sollte, was die Motive anderer Menschen angeht, wie es charakteristisch für Borderline-Patienten ist. So wird die Abwärtsspirale von Fehlinterpretationen und daraus resultierenden negativen Reaktionen aus der Umwelt durchbrochen (vgl. Yeomans, Diamond; 2011; S. 552 f). 3.5.4 Systemische Familientherapie Untersuchungen von Reich und Cierpka (2011, S.795) haben ergeben, dass folgende familiäre Einflüsse auf die Entwicklung von Borderline-Störungen im Gegensatz zu anderen Patientengruppen als maßgeblich gezeigt haben: • Prolongierte frühe Trennungen und Verluste von wesentlichen Beziehungspersonen • Gestörtes elterliches Involviertsein in die Beziehung zum späteren Patienten. Oft ist die Beziehung zur Mutter hochkonflikthaft, distanziert und unbezogen, der Vater ist häufig nicht präsent oder in die Konflikte zwischen späterem Patient und Mutter einbezogen. Häufiger findet man gestörte Beziehungen zu beiden Elternteilen als nur zu einem Elternteil. • Erfahrungen von verbaler und emotionaler Misshandlung sind extrem verbreitet, diese sind häufiger als bei Depressiven und Achse-I–Persönlichkeitsstörungen. - Auch Erfahrung körperlicher und sexueller Misshandlung sind sehr verbreitet. Hinsichtlich der körperlichen Misshandlung unterscheiden sich Borderline-Patienten nicht von Vergleichsgruppen, jedoch deutlich hinsichtlich sexuellem Missbrauch. • Körperliche Vernachlässigung ist nicht sehr verbreitet, dafür emotionale Vernachlässigung umso häufiger. 20 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Meist kommen mehrere dieser Störungen zusammen. Auch gibt es Hinweise auf eine ausgeprägte widersprüchliche elterliche Kommunikation in den Familien im Gegensatz zu anderen Patienten und normalen Kontrollgruppen. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch, dass Menschen mit einem „schwierigen“ Temperament vulnerabler sind. Nach Reich und Cierpka (2011, S.798) lassen sich drei Subtypen von Familien annehmen, wobei dazuzusagen ist, dass die Familienmitglieder, welche an einer Borderline-Störung erkranken, die Familiendynamik ihrer Familie mit beeinflusst haben. Sie verinnerlichen familiäre Beziehungsmuster, zu deren Entstehung sie selbst durch ihre eigene Vulnerabilität und ihre dysfunktionalen Versuche, die angstvollen und aggressiven Affekte zu bewältigen, als Kind beigetragen haben. (siehe Abb. 2.3) Abbildung 2.3: Klinische Typologie der Familien mit Borderline-Patienten (vgl. Reich, Cierpka; 2011; S. 797) Eine häufigere Einbeziehung der Angehörigen in der Arbeit mit Borderline-Patienten erscheint besonders angebracht, da sich die Störung in der Interaktion darstellt und somit die Familiendynamik beeinflusst. Die Familientherapie bietet hier einen Ansatzpunkt, da sie sich mit den Veränderungen der innerfamiliären Interaktionen befasst. Besonders besteht die Indikation, wenn: - der Patient Kind oder Jugendlicher ist, da innerfamiliäre Konflikte die Weiterentwicklung behindern können und viele Borderline-Störungen deutliche Vorläufer in der Kindheit oder Adoleszenz haben - wenn die Familie sich aktuell in einer Krise befindet, welche alle Mitglieder betrifft - wenn mehrere Familienmitglieder eine Störung aufweisen 21 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? - wenn die Familientherapie eine zusätzliche Unterstützung zu anderen therapeutischen Maßnahmen übernimmt - wenn die Familientherapie eine andere psychotherapeutische Maßnahme vorbereiten soll - wenn die Familie der Einzelbehandlung des Patienten misstraut und sich ständig einmischt. Manchmal ist es sinnvoll, wenn man die Angehörigen zu einigen Sitzungen dazu holt, um Unsicherheiten und Ängste zu besprechen. Grundsätzlich lassen sich in der Literatur aufgrund der ausgeprägten Flexibilisierung der möglichen Anwendung kaum Kontraindikationen für die systemische Therapie benennen. Absolute Kontraindikationen sind nicht bekannt (vgl. von Sydow et al. 2007, S. 28). 3.5.5 Psychoedukation 3.5.5.1 Allgemeines Der Begriff „Psychoedukation“ wurde in den 1990er Jahren in den USA geprägt und ist vor allem für chronisch psychisch kranke Menschen geeignet. Das Ziel ist die Verbesserung der Compliance und damit verbunden auch die Verminderung von Rückfällen. Zudem erhofft man sich eine Verbesserung der Krankheitsverläufe. Ursprünglich war der Begriff als eine von Profis bestimmte Unterrichtung in Form von Vorlesungen und Frontalunterricht zu verstehen (vgl. Behrend, Krischke, 2005, S. 16). Daley et al. meinten allerdings, dass von Psychoedukation erst gesprochen werden kann, wenn zusätzlich zur Wissensvermittlung auch die individuellen Bewältigungsfähigkeiten, Selbsthilfekompetenzen wie auch die Selbstbefähigung gefördert werden (vgl. Daley et al., zit. nach Behrend, Krischke, 2005, S. 17). Neben den oben genannten Beschreibungen des Begriffes Psychoedukation soll hier noch eine Definition eingeführt werden, die auf Psychoedukation bei psychiatrischen Störungen fokussiert ist: 22 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? „Psychoedukation ist eine pädagogische Behandlungsform der sekundären Prävention in der Medizin (Psychiatrie), die darauf zielt, das Verhalten von Patienten und / oder Angehörigen in einem gesundheitsfördernden Sinn zu beeinflussen. Zentrales Moment ist die strukturierte Vermittlung präventiv relevanter Information durch Experten. Dazu kommt der Einsatz behavioraler Elemente (Verhaltensmodelle) zur Umsetzung der vermittelten Inhalte in praktische Fertigkeiten. Psychoedukation bezieht die Erfahrungen der „Edukationsteilnehmer“ in den Lernprozess ein. Psychoedukation konzentriert sich auf pragmatische Problembewältigung und grenzt sich damit gegen beziehungsorientierte Ansätze psychotherapeutischer Verfahren ab. Im Unterschied zu Selbsthilfegruppen spielen Experten eine zentrale Rolle. In der Praxis werden psychoedukative, psychotherapeutische und selbsthilfeorientierte Ansätze häufig kombiniert.“ (Buttner, 1996, S. 41-42) Die Arbeitsgruppe Psychoedukation hat in ihrem Konsensusbuch Themen zusammengefasst, die in einer psychoedukativen Gruppe bearbeitet werden sollen: Es sollen allgemeines Hintergrundwissen wie z. B. Information zur Symptomatik und zum Krankheits- und Gesundheitsbegriff (Diagnose, Prodromalphase, Warnsignale, Plus- und Minussymptomatik, postpsychotische Depression, persistierende Symptomatik usw.), aber auch Daten zur Epidemiologie und zum Verlauf erarbeitet werden. Außerdem sollen die wesentlichen Therapieformen besprochen werden, wie z. B. Pharmakotherapie, Umgang mit Nebenwirkungen, psycho- und soziotherapeutische Hilfemöglichkeiten usw. Ebenso soll praktisches Handlungswissen, wie z. B. Auslösefaktoren, Warnsignale, Bewältigungsstrategien, Krisenpläne usw. erarbeitet werden. Auf zentrale emotionale Themen, wie z. B. Schamgefühle, Stigmatisierung, Hoffnungslosigkeit und Resignation, Suizidalität, Sinnfrage, Hadern mit dem Schicksal, muss eingegangen werden. Positiv erlebte Aspekte psychotischen Erlebens und das Spannungsfeld zwischen Idealisierung und Pathologisierung der Psychose sollen besprochen werden (zit. nach: Behrend et al,. In: Behrend, Schaub, 2005, S. 123-125). Compliance steht als Begriff im Mittelpunkt der Ziele psychoedukativer Interventionen und ist definiert als: „Compliance – Verbesserung; bedeutet im wesentlichen Aufbau und Aufrechterhaltung einer angemessenen Therapiemotivation.“ (Petermann, 1998, S. 12) In der Medizin wird Compliance als „die Übereinstimmung des Verhaltens eines Menschen in Bezug auf die Einnahme eines Arzneimittels, die Befolgung einer Diät oder die Art, wie je- 23 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? mand seinen Lebensstil ändert, mit einem ärztlichen oder gesundheitlichen Rat.“ (Haynes et al,. 1982, zit. nach Rabovsky, Stoppe, 2006, S. 313) definiert. Durch die Unzufriedenheit, die diese Interpretation des Compliance–Begriffs auslöste, aber auch das unterschiedliche Verständnis der Arzt–Patienten–Beziehung, gab es Bemühungen, den Begriff Compliance durch bessere Ausdrücke wie z.B. Concordance oder Adherence zu ersetzen. Trotz der möglicherweise besseren Begrifflichkeiten hat sich der Begriff der Compliance durchgesetzt und wird deshalb in der Literatur meist verwendet (vgl. Arnold, 2005, S 4-5). 3.5.5.2 Spezielles zur Borderline-Störung Amerikanischen Schätzungen zufolge sind 10% aller Menschen, welche sich in ambulant psychiatrischer Behandlung befinden, von einer Borderline-Störung betroffen. Bei den stationär behandelten Patienten weisen ca. 20% eine Borderline–Störung auf. Bei ca. 80% der Borderline-Patienten kommt es innerhalb eines Jahres zu einer erneuten stationären Aufnahme. Für das Gesundheitssystem stellt die Borderline-Störung damit einen enormen Kostenfaktor dar. Die Entwicklung von psychoedukativen Programmen für Borderline-Störungen und deren Angehörigen basiert auf dem Wissen über die Effektivität der kognitiven Verhaltenstherapie, den Erfahrungen in der Behandlung schizophrener Störungen und auch den Daten über das psychosoziale Umfeld. Auch fördert der Wechsel hin zum biosozialen Modell eine Veränderung im Versorgungssystem und ermutigt zur Entwicklung psychoedukativer Ansätze (vgl. Rentrop et al., 2007, S. 11). Trotzdem besteht weiterhin die grundsätzliche Diskussion inwieweit die Diagnose „Persönlichkeitsstörung“ mit dem Patienten offen kommuniziert werden soll. Es bestehen Befürchtungen, dass der Patient demoralisiert und stigmatisiert werden könnte. Auch beziehen sich die Befürchtungen auf die Übertragung und Gegenübertragung sowie auf die Ich-Syntonie der Persönlichkeitsstörung, was dazu führe, dass Patienten nicht möchten, dass ihre Persönlichkeit zum Gegenstand der Therapie gemacht wird. Befürworter der offenen Kommunikation beziehen sich ebenso auf die Ich-Syntonie, die zunehmenden Informationsbedürfnisse von Patienten und Angehörigen und auch das Recht auf Aufklärung und Information. Ebenso beziehen sie sich auf klärende, emotional entlastende und Hoffnung vermittelnde Aspekte, welche sich durch die Definition einer psychischen Störung und deren wirksame Behandlungsmöglichkeiten ergeben.Die Aufklärung über 24 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? eine Diagnose ist die Vorraussetzung dafür, dass ein Patient Entscheidungsprozesse, welche seine Behandlung betreffen, aktiv mitgestalten können (vgl. Schmitz, 2011, S. 767). Ziel der Psychoedukation bei Patienten mit einer Borderline-Störung kann nicht wie bei Programmen für schizophren oder bipolar erkrankte Menschen auf der Informationsvermittlung bzw. der Compliance-Förderung liegen, auch wenn Psychopharmaka eine wichtige Rolle in der Behandlung der Borderline-Störung spielen. (vgl. Rentrop et al. 2007, S. 11 f.) „Psychoedukation bei Borderline-Störung muss die Einsicht in eine zeitaufwändige und anstrengende Auseinandersetzung mit der eigenen Problematik bahnen, dabei Stütze sein und Hoffnung vermitteln, um der bei Betroffenen weit verbreiteten Tendenz einer fatalistischen Einschätzung ihrer Prognose entgegenzuwirken.“ (Rentrop et al, 2007, S. 12) Grundsätzlich versteht sich Psychoedukation für Borderline-Störungen als Teil eines umfassenden psychotherapeutischen Behandlungskonzeptes. Erstmals mit der Erkrankung konfrontierten Patienten soll Hilfestellung gegeben und Menschen, welche aus den Behandlungssystemen herausgefallen sind, eine Wiederannäherung an eine ihrer Störung angemessenen Therapie erleichtert werden. (vgl. Rentrop et al, 2007, S. 15) • Einschlusskriterien für Patienten Grundsätzlich kann ein großer Teil der Patienten an einer störungsspezifischen psychoedukativen Gruppe teilnehmen. Trotzdem müssen laut Rentrop folgende Kriterien erfüllt sein: - ausreichende deutsche Sprachkenntnis - Intelligenz im Bereich der Normalbegabung - freiwillige Teilnahme - basale Fertigkeiten hinsichtlich Frustrationstoleranz und Sozialverhalten - Information des Betroffenen über seine Diagnose - weitgehende psychische Stabilität hinsichtlich eventuell vorhandener komorbider psychischer Störungen, insbesondere dissoziativer Störungen oder psychotischer Krisen - Möglichkeit, eine Vereinbarung über die Gruppenteilnahme zu schließen - therapeutische Vereinbarung hinsichtlich Umgang mit Suizidalität (vgl. Rentrop et al, 2007, S. 17) 25 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? • Themenschwerpunkte Da es für die meisten Borderline-Patienten eine erhebliche Herausforderung darstellt sich der Situation einer Therapiegruppe zu stellen, sollte bereits das Kommen an sich validiert werden. Im Folgenden soll für die Teilnehmer transparent gemacht werden, dass - die psychoedukative Gruppe keine psychodynamische Gruppentherapie darstellt - gemeinsam Informationen gesammelt und diskutiert werden - Grundlageninformationen für die weitere Therapie vermittelt werden - psychoedukative Gruppen therapeutisch wirksam sind (für Borderline-Störungen jedoch noch nicht empirisch gesichert) - Die organisatorischen Rahmenbedingungen sollen ebenfalls deutlich gemacht werden Folgende Themenschwerpunkte werden im Rahmen der Psychoedukation behandelt: (vgl. Rentrop et al, 2007, S. 44 f.) 1. Treffen: Vorstellung der Teilnehmer, Organisatorisches, Aktuelle Probleme 2. Treffen: Krankheitsbegriff und Symptomatik 3. Treffen: Biosoziales Krankheitsmodell 4. Treffen: Komorbidität 5. Treffen: Medikamente und Nebenwirkungen I (Antidepressiva und Moodstabilizer) 6. Treffen: Medikamente und Nebenwirkungen II (Neuroleptika und Benzodiazepine) 7. Treffen: Krisenintervention und Notfallplan 8. Treffen: Psychotherapie I (DBT) 9. Treffen: Psychotherapie II (TFP) 10. Treffen: Offene Fragen, Wiederholung, Zukunftsperspekitive 3.5.6 Schematherapie Während sich die kognitive Verhaltenstherapie bei den sogenannten Achse–I–Störungen als erfolgreich erwiesen hat, versucht die Schematherapie, Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie mit anderen Therapiemethoden zu kombinieren um auch Achse I–Störungen behandeln zu können. Selbst wenn keine ausgesprochene Persönlichkeitsstörung vorliegt, werden viele Achse–I–Störungen durch unvorteilhafte Verhaltensweisen, die im Rahmen der 26 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Persönlichkeitsentwicklung erworben wurden, hervorgebracht. Bei vielen Achse–I– Störungen bestehen im Hintergrund auch Persönlichkeitsveränderungen, welche dazu führen, dass nach einer erfolgreichen symptomatischen Behandlung rasch wieder Symptome auftreten, wenn nicht auch die Persönlichkeitsstruktur mit behandelt wird. (vgl. Roediger; 2009; S. 13) In einer mit 86 Patienten durchgeführten Studie, bei der ein Teil mit Schematherapie, der andere Teil mit der übertragungsfokussierten Psychotherapie behandelt wurde, zeigten beide Gruppen eine deutliche Verbesserung der Symptomatik. Die Schematherapie war jedoch der übertragungsfokussierten Therapie signifikant in allen Ergebniskriterien überlegen. Diese Ergebnisse stellten sich in den Bereichen Remission der Borderline-Störung, klinisch relevante Verbesserung und auch der Kosteneffektivität ein. (vgl. Jacob et al., 2011, S. 651) Die Schematherapie ist eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie, welche speziell für Patienten mit schwierigen interpersonellen Mustern entwickelt wurde. Sie ist gekennzeichnet durch die Berücksichtigung emotionaler und biografischer Aspekte und durch eine Integration verschiedener therapeutischer Schulen (Kognitive Verhaltenstherapie, humanistische Therapie, Gestalttherapie, Psychodynamik). Grundsätzlich ist sie keine spezielle Behandlungsmethode der Borderline-Störung, jedoch wurde für sie eine spezielle Störungs- und Behandlungsmethode entwickelt (vgl. Roediger, 2009, S. 13f). Schemata sind als alles beeinflussende Lebensthemen definiert, welche aus Kognitionen, Emotionen, Erinnerungen und Wahrnehmungen bestehen. Maladaptive Schemata bestehen typischerweise auf schwierigen oder traumatischen Kindheitserlebnissen, in welchen zentrale Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, häufig in Verbindung mit einer Veranlagung, die die Entstehung und Aufrechterhaltung problematischer Muster fördert. Wenn diese Schemata aktiviert werden entstehen intensive Gefühle wie z.B. Angst oder Trauer (vgl. Roediger, 2009, S. 13f). Bei der Borderline-Störung sind häufig die Schemata „Missbrauch/Misstrauen“, „Unzulänglichkeit/Scham“, „Abhängigkeit“ und „Probleme im Umgang mit Grenzen“ zu finden. Das dysfunktionale Copingverhalten kann so ausgeprägt sein, dass es in einer Situation die Interaktion des Betroffenen vollständig dominiert, d.h. der Patient kann kaum Distanz dazu gewinnen und die Reflexion fällt sehr schwer. Dieses Phänomen hat zur Entwicklung des Modusmodells beigetragen. Schemamodi sind definiert als diejenigen Schemaoperationen, die 27 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? in einer Person zum aktuellen Zeitpunkt vorherrschen. Daher sind Modi Affektzustände oder „Selbst-Anteile“, die vorrübergehend Gedanken, Gefühle und Verhalten dominieren. Während Schemata eher eindimensionale Eigenschaften sind, entsprechen Modi Zuständen, welchen gleichzeitig mehrere Schemata zugrunde liegen können. Die Modi können in vier Kernkategorien unterteilt werden: - kindliche Modi drücken starke Emotionen aus - die bei den maladaptiven Kindermodi mit der Nichterfüllung von Bedürfnissen assoziiert sind. - Dysfunktionale Elternmodi repräsentierten internalisierte Reaktionen der Eltern auf den Patienten in seiner Kindheit. - Der Modus des gesunden Erwachsenen repräsentiert funktionales Erleben und Handeln (vgl. Jacob et al, 2001, S. 641 ff). Die Borderline-Störung ist durch vier dysfunktionale Modi charakterisiert: - Modus des verlassenen oder missbrauchten Kindes, häufig auf der Basis von kindlichen Missbrauchserfahrungen - Modus des ärgerlichen oder impulsiven Kindes, mit dem die zentrale Bedeutung der Emotion Wut oder Borderline-typische impulsive Verhaltenweisen abgebildet werden - Modus des strafenden Elternteils, bedingt durch die strafende und/oder zurückweisende familiäre Umgebung - Modus des distanzierten Beschützers, dies ist der meist vorherrschende Bewältigungsmodus zum Umgang mit dem emotionalen Leid, mit dem sich die Patienten vor den negativen Gefühlen der anderen Modi schützen (vgl. Jacob et al, 2001, S. 641 ff). 4 4.1 Angehörigenarbeit Ist Angehörigenarbeit sinnvoll? Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Angehörigen in die Behandlung mit einzubeziehen, da durch die differenzierte Kenntnis und auch durch die Berücksichtigung ihrer emotionalen Belastungen Überforderung vermieden werden und dadurch hohe Expressed-Emotion-Levels, und die damit verbundenen Rückfallraten, vermieden werden kann. (vgl. Schmid et al. 2005, S. 28 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 272) Durch die Einbeziehung der Angehörigen kann die Rezidivrate bei schizophrenen Psychosen um ca. 20% gesenkt werden (vgl. Schmid et al., 2003, S. 118 ff.) Angehörige haben vielfältige Belastungen in verschiedenen Bereichen: - Ängste und Sorgen infolge mangelnder Informationen - Unsicherheit und Überforderung mit den Symptomen der Erkrankung - Sorgen bezüglich der Behandlung des Patienten - Hilflosigkeit und Ohnmacht - Einsamkeit und Alleinverantwortung - Nicht-Ernstgenommen-Werden - Zukunftsängste - Gefühle der Einschränkung in der eigenen Autonomie und Abgrenzungsprobleme - Hoffnung und Enttäuschung - Trauer und Verlusterleben - Angst vor Rückfall und Suizid - Schamgefühle und Angst vor Stigmatisierung - Entmutigung - Schuldgefühle - Ärger und Enttäuschung - veränderte Rollen und Rollenkonflikte - Probleme mit der gemeinsamen Sexualität - Angst vor eigener Erkrankung bzw. Vererbung an die eigenen Kinder (vgl. Schmid et al., 2005, S. 272) Die meisten Untersuchungen, welche sich mit den Belastungen von Angehörigen beschäftigen, beziehen sich auf Angehörige schizophrener Patienten. Umfassende Untersuchungen zu anderen Diagnosen existieren kaum, es ergeben sich jedoch Hinweise, welche eher gegen störungsspezifische Belastungen sprechen. Eher zeigen Untersuchungen, dass die Schwere der Erkrankung mit dem Belastungserleben der Angehörigen zu tun hat, weniger mit der Art der Erkrankung. Andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass neben den störungsspezifischen Aspekten auch andere Aspekte wie z.B. das Kommunikationsverhalten mit dem erkrankten Angehörigen bedacht werden sollen. 29 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass es sinnvoll erscheint mit den eher störungsspezifischen Aspekten zu beginnen, da besonders am Anfang das Bedürfnis nach Informationen besonders hoch ist. Im Verlauf der Erkrankung geht es mehr um die beziehungsspezifischen Aspekte (vgl. Wittmund et al. 2005, S. 233 ff). 4.2 Selbsthilfe Von Image der Familie als Verursacher schizophrener Erkrankungen bis hin zum mitwirkenden Partner oder Co-Therapeuten in der Versorgung war es ein langer Weg. Dem gewachsenen Selbstvertrauen der Angehörigen, dem Zusammenschluss zu Gruppen oder Verbänden, welche die Interessen der Familien vertreten, ist dies mit zu verdanken. Dies ist jedoch nicht nur dem Willen der Angehörigen, sondern auch der Struktur des Versorgungssystemes zuzuschreiben, da die Familien immer erforderlich waren. Je mehr sich die Versorgung im Sinne der Psychiatrieenquete weiter entwickelte, also im Sinne einer Enthospitalisierung, einer gemeindenahen Versorgung und auch einem selbstbestimmten Leben für die Erkrankten, umso größer wurde die Rolle der Angehörigen. In Familien mit einem psychisch erkrankten Menschen stellt der Kontakt zu anderen betroffenen Familien häufig eine wichtige Hilfe dar. Seit Ende der 1960er Jahre treten die Angehörigen vermehrt in die Öffentlichkeit. Zu dieser Zeit war dies oft die einzige Möglichkeit für Familien von Patienten sich über die Erkrankung zu informieren und über die damit verbundenen Ängste und Sorgen zu sprechen. 1985 wurde der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (BApK) gegründet. Zu diesem Zeitpunkt waren für die Angehörigen die Auswirkungen der Psychiatriereform wie z.B. der Enthospitalisierung deutlich. Krankenhausaufenthalte wurden kürzer, die Nachsorgeeinrichtungen waren jedoch nur spärlich vorhanden, die Last der Betreuung wie es heute z.B. im Betreuten Wohnen oder in Tagesstätten erbracht wird, lag zu dieser Zeit in den Familien. Auf diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Idee von Selbsthilfegruppen bei Angehörigen auf großes Interesse stieß. Heute arbeiten die Angehörigen-Landesverbände in den einzelnen Bundesländern selbstständig, mit jeweils unterschiedlichen Strukturen und Schwerpunkten, wobei die oberste Priorität immer die Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Familien ist. Hierzu zählen als Kernaufgabe die Beratung und das Zusammenführen von Angehörigen, der Erfahrungsaustausch und die erlebte Solidarität (vgl. Straub, 2007, S. 297). 30 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Im Leitbild des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker e.V. werden die Aufgaben folgendermaßen dargestellt: Wir setzen uns gegenüber politisch Verantwortlichen im Einzelnen für folgende Ziele ein: - Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen - Gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von somatisch und psychisch Kranken - Eine medizinische Versorgung psychisch Kranker, die sich am Stand der Forschung orientiert und die sowohl psychisch Kranke wie auch ihre Angehörigen ernst nimmt - Ein niederschwelliges, gemeindenahes und vernetztes Versorgungsangebot, das sich an den Bedürfnissen der Schwerkranken orientiert. Dieses Angebot soll von den primären Kostenträgern und nicht von den Trägern der Sozialhilfe finanziert werden. - Die Anpassung der Gesetzgebung an die besonderen Bedürfnisse psychisch Kranker - Eine berufliche und soziale Sicherung, die psychisch Kranken und ihren Familien nicht nur einen ausreichenden Lebensstandard sichert, sondern ihnen auch die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. (Straub, 2007, S. 19) 4.3 Psychoseseminar Das Konzept des trialogisch orientierten Psychose-Seminars im Sinne eines gleichberechtigten Erfahrungsaustausches zwischen Betroffenen, Angehörigen und professionellen Helfern wurde 1989 in Hamburg entwickelt und hat sich seither in Deutschland verbreitet. 2005 gab es laut Internetrecherche 170 Psychoseseminare, welche zu 2/3 von psychosozialen Hilfsvereinen oder Sozialpsychiatrischen Diensten ausgerichtet werden. Meist finden sie im Rahmen eines Großgruppenseminars von ca 30-70 Teilnehmern in zwei bis vierwöchigem wöchigem Rhythmus statt. Im Idealfall findet eine trialogisch reflektierte Begegnung der verschiedenen Mitglieder einer Familie auf neutralem Boden statt, was zu mehr gegenseitigem Verständnis und größerer Toleranz beitragen kann. Vor allem für Menschen auf der Suche nach der Sinnkontinuität bezüglich ihres krankheitsbedingten Erlebens können Psychose-Seminare ein wichtiges Glied innerhalb der psychosozialen Versorgung sein. 31 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Meist kann davon ausgegangen werden, dass das „Pflichtprogramm“ bereits absolviert wurde und sich die Teilnehmer mit anderen Schicksalsgenossen austauschen wollen um deren Erfahrungen für sich zu nutzen. Der im Psychoseseminar stattfindende Austausch über die Chancen und Grenzen der heutigen Therapiemöglichkeiten kann ermöglichen, dass durch einen ehrlichen und offenen Diskurs ein Behandlungsmodus gefunden wird, welcher Mut und Hoffnung macht. Trotzdem darf nicht vergessen werden, das ein solches Großgruppenseminar für akut Erkrankte eine enorme Überforderung darstellen kann, weshalb in der Regel mehr oder weniger stabile Patienten an diesem Setting teilnehmen (vgl. Bäuml et al, 2007, S 271 ff). Aus Angehörigensicht kann man sagen, dass die Schilderungen anderer Angehöriger über ihre Nöte und Sorgen oft sehr viel authentischer und nachvollziehbarer als die Unmutsäußerungen der eigenen Familienmitglieder empfunden werden. Die meisten Angehörigen bringen ihren unverbesserlichen Glauben, dass Besserung möglich ist, immer wieder zum Ausdruck, was für viele Betroffene sehr beruhigend wirken kann. Dies kann zu einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Angehörigen durch die Betroffenen führen. Angehörige erleben Betroffene nicht nur als chronisch krank, sondern oft als sehr selbstbewusst, schlagfertig und dadurch nicht auf den ersten Blick als Betroffene identifizierbar. Auch diese Erfahrung lässt viele Angehörige weiterhin Hoffnung auf Besserung haben (vgl. Bäuml et al, 2007, S. 289 f). 4.4 Psychoedukation Die meisten psychiatrischen Erkrankungen betreffen automatisch auch die Angehörigen. Über die Hälfte der entlassenen Patienten wohnen nach der Klinikentlassung wieder bei ihren Angehörigen. Um die Ängste, Sorgen und auch die Niedergeschlagenheit der Patienten besser verstehen zu können, ist es sinnvoll wenn die Angehörigen über die Erkrankung informiert werden. Um zum Beispiel zu unterscheiden ob eine Antriebslosigkeit eine Auswirkung der Erkrankung oder eine Nebenwirkung der Medikamente ist braucht man fundiertes Wissen. Angehörige welche nicht ausreichend informiert sind laufen Gefahr, sich überkritisch, feindlich oder zu überbesorgt (High-Expressed-Emotions-Kriterien) zu äußern. Ausreichend informierte Angehörige können Symptome besser deuten, mehr Verständnis für Belastungen zeigen und dadurch zu richtiggehenden „Co-Therapeuten“ werden, was psychoedukative Angehörigengruppen eigentlich unumgänglich macht. Durch mehr Verständnis und gemeinsames Aushalten können sie viel Stabilität und Zuversicht vermitteln 32 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? und dadurch zu einem verbesserten Familienklima beitragen, was den Verlauf der Erkrankung günstig beeinflussen kann. Durch Angehörigengruppen können jedoch nicht nur die Patienten sondern auch die Angehörigen profitieren. Das Stresslevel wird reduziert, die Belastung sinkt. Es kann durch den Kontakt zu anderen Angehörigen die eigenen Bewältigungsstrategien erweitert werden und mehr Sicherheit im Umgang mit Krisen erlangt werden. Im Rahmen der Münchner PIP-Studie werden dazu wöchentlich oder 14-tägig Gruppen für Angehörige angeboten, an welchen meist die Key-Angehörigen (dem nahestehendsten Angehörigen) teilnehmen. Natürlich sind die Gruppen auch offen für weitere Angehörige und Freunde. Vorher wird selbstverständlich das Einverständnis der Patienten eingeholt. Der Schwerpunkt der Gruppen liegt in der Informationsvermittlung über Krankheitsbegriff, Symptome, Ursachen der Erkrankung, die medikamentöse Behandlung, weitere Therapiemaßnahmen, Frühwarnzeichen und den Umgang mit der Erkrankung. Rehospitalisierungs- und Rückfallraten wurden im 9- und 18-Monats-Follow-up im Vergleich zur Standardversorgung deutlich reduziert und das psychosoziale Funktionsniveau deutlich verbessert. Auch eine verbesserte Compliance konnte festgestellt werden (vgl. PitschelWalz, Bäuml, 2007b, S. 115 ff). 4.5 Angehörigenvisite Durch die Verlagerung von Angehörigengesprächen wird der Kontakt zu den Angehörigen Teil eines Konzeptes, welches auch überprüfbar und modifizierbar wird. Im Krankenhaus Berlin-Neukölln findet die Angehörigenvisite 14-tägig auf der Station statt. Sie werden von Pflegepersonal, durch die Ärzte und durch Plakate auf dieses Angebot aufmerksam gemacht. Die Initiative geht jedoch gerade beim Erstkontakt von den Therapeuten aus. In einer Liste, welche beim Pflegepersonal ausliegt, können sich die Angehörigen eintragen. Die Visite findet in einem ansprechend ausgestatteten Raum statt. Alle Teilnehmer sitzen gemeinsam um einen Tisch, zeitlich stehen 20 Minuten zur Verfügung. Zu Beginn können die Angehörigen aktuelle Fragen, Anregungen aber auch Kritik anbringen. Die Angehörigenvisite wird vom Oberarzt oder dem behandelnden Arzt moderiert, auch weitere Mitarbeiter wie z.B. Sozialpädagogen, Ergotherapeuten usw. können an der Angehörigenvisite teilnehmen. Bei Bedarf besteht das Angebot einen zweiten Termin zu vereinbaren. Im Klinikum Neukölln wurde die Angehörigenvisite von 269 Patienten und 666 Angehörigen wahrgenommen. Die Frequenz reicht von einem bis zu zehn Kontakten. 33 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Bei den Angehörigen sind vor allem Partner (158-mal), Mütter (117-mal) und Kinder (103mal) vertreten. Ziel der Visite gemeinsam mit Patienten und Angehörigen ist es eine gemeinsame Sicht der Dinge zu entwickeln, eine weitgehende Übereinstimmung in Bezug auf die langfristige Behandlung zu erreichen, Missverständnisse in Ruhe auszuräumen und auch Kritik gelassen entgegen zu nehmen (vgl. Fähndrich et al., 2001, S. 115 ff). 4.6 Angehörigen-Informationstage Im Bezirksklinikum Regensburg finden zweimal jährlich jeweils samstags sogenannte „Angehörigen-Informationstage“ statt. In den Vorträgen werden folgende Themenbereiche besprochen: - Symptome der Psychose - Ursachen - medikamentöse Behandlung - Psychotherapie und Umgang mit der Erkrankung - Frühwarnzeichen und Rückfallverhütung - soziale und berufliche Integration Neben diesem Vortragsteil besteht auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Es wurden insgesamt 42 Angehörige eingeladen, wovon dann 21 Angehörige teilnahmen. Sowohl den anwesenden Angehörigen, aber auch den nicht anwesenden Angehörigen wurde der „Fragebogen zur Erfassung krankheitsbezogener Einstellung von Angehörigen“ (KEA) von Bäuml et al. ausgehändigt bzw. zugeschickt. Im Fragebogen für die teilnehmenden Angehörigen gab es die Möglichkeit den Angehörigen–Informationstag zu bewerten, im Fragebogen für die nicht anwesenden Angehörigen wurde an dieser Stelle nach Gründen für die NichtTeilnahme gefragt. Teilnehmende Angehörige geben vorher signifikant weniger häufig an, das Wesen der Erkrankung zu verstehen, gleichzeitig sind sie weniger häufig deprimiert. Sie berichten signifikant häufiger, dass das Klima zu Hause häufig gespannt sei und machen sich tendenziell auch häufiger Selbstvorwürfe. Gespräche mit dem behandelnden Arzt oder Therapeut sind für alle Angehörigen die wichtigsten Informationsquellen. Insgesamt kann gesagt werden, dass Angehörigen–Informationstage eine gute und ökonomische Möglichkeit sind, viele Angehörige zu erreichen. Einen hohen Stellenwert sollte hier- 34 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? bei das persönliche Gespräch zwischen Angehörigen und dem behandelnden Arzt oder Therapeuten einnehmen (vgl. Rothbauer et al. 2001, S. 118 ff). 4.7 Systematische Angehörigenberatung in den UPD Bern Übergeordnetes Ziel der Angehörigenarbeit in den UPD Bern ist es laut Troxler (2005, S 1f), die Angehörigen aktiv mit einzubeziehen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Zusatzangebote eingerichtet, welche auf die Bedürfnisse und die spezifische Problematik der Angehörigen zugeschnitten sein müssen und dazu beitragen, die emotionale, physische, soziale und auch finanzielle Belastung zu verringern und die Lebensqualität zu verbessern. Teilziele sind sowohl die Entlastung der Angehörigen, eine Rezidivprophylaxe zur Verringerung der stationären Aufnahmen durch Psychoedukation, die Förderung der Kooperationsbereitschaft zwischen Angehörigen, Betroffenen und professionellen Helfern, die Entlastung des Behandlungsteams und der Abbau von Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen. Praktisch sollen Einzel-, Eltern-, Paar- und Familiengespräche ein integrativer Teil des Behandlungsplanes in den UPD Bern darstellen, weshalb die Angehörigenarbeit sowohl in die Behandlungskonzepte der Stationen und Einrichtungen wie auch im Aufnahmeverfahren Beachtung finden soll. Es sollen diagnosenunspezifische Angehörigen–Seminare, eine Langzeitgruppe für Angehörige, ein Seminar für Angehörige von Demenzkranken, das psychoedukative Gruppenprogramm für Angehörige, das Gruppenangebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Beirat und die Aufrechterhaltung und Förderung des Kontaktes zu Selbsthilfeorganisationen weiterhin beibehalten werden. Zusätzlich sollen folgende Angebote neu eingerichtet werden: - eine Angehörigensprechstunde mit einer AngehörigenberaterIn (auch für Angehörige von noch nicht stationär aufgenommenen Patienten) - ein psychoedukatives Gruppenprogramm für Angehörige von Schizophrenierkrankten - ein psychoedukatives Gruppenprogramm für Angehörige von Patienten mit einer affektiven Erkrankung - alle Angebote sollen auf der Homepage der UPD Bern aufgeführt werden - eine Angehörigenbroschüre - Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen zum Thema „Angehörigenarbeit“ für UPDMitarbeiter 35 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? - Multiprofessionelle Interventionsgruppen mit dem Ziel der Kompetenzförderung in der Arbeit mit Angehörigen - Erarbeitung und Umsetzung von Forschungsthemen im Bereich Angehörigenarbeit 4.8 Familientherapeutische Intervention In den in letzter Zeit entwickelten verhaltenstherapeutisch orientierten psychoedukativen Familieninterventionsprogrammen, welche das Vulnerabilität-Stress-Bewältigungs- Kompetenz-Modell zur Grundlage haben, sind weniger ätiologisch, sondern mehr sekundärpräventiv und rehabilitativ orientiert, sodass vor allem die Erhöhung der Lebensqualität der Familie im Vordergrund steht (vgl. Pitschel-Walz, Bäuml; 2007, S. 160f). In ihrem Aufbau unterscheiden sich die Programme durchaus, jedoch haben sie einige gemeinsame therapeutische Grundprinzipen: (vgl. Glynn et al. 2006. S. 454) - Verständnis, Sympathie und Empathie für die Familienmitglieder - Vermittlung von Informationen - Keine Schuldzuschreibung und keine Pathologisierung der Familienmitglieder - Unterstützung der persönlichen Entwicklung aller Familienmitglieder - Förderung von Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten - Förderung der Medikamentencompliance und Abbau von Stress - Verminderung von Stress - Unterstützung der Maßnahmen zur Redukation von Drogen- und Alkoholkonsum - Bedürfnisorientirtes, individuelles Vorgehen - Ermutigung der Familien zur Erweiterung ihres sozialen Netzwerkes - Mut und Hoffnung machen - eine langfristige Perspektive 36 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Familientherapeutische Interventionen können sowohl mit einzelnen als auch mit mehreren Familien durchgeführt werden, welche in der Tabelle 3.1. dargestellt sind. Tabelle 3.1: Familientherapeutische Interventionen (vgl. Pitschel-Walz, Bäuml, 2007, S. 162 ff) Autor, Jahr Programm Schwerpunkt Therapiedauer Goldstein et al. 1978 Krisenorientierte Familientherapie Einfluss auf die Psychopathologie 6 Wochen und die Rezidivrate Anderson, Hogarty, Psychoedukatives Familientraining 2 Jahre Falloon, Boyc, Mc Gill Verhaltenstherapeutisch 2 Jahre (mindestens 9 1984 tierte Familientherapie Monate) Barrowcough, Tarrier Verhaltenstherapeutische Famili- 2 Jahre (mindestens 9 1987 enintervention Monate) Mc Farlane 2002 Psychoedukatives multifamiliales Frühwarnzeichen, Aktivierung sozia- Programm ler Netzwerke, Vereinbarung von Reiss 1981 orien- 2 Jahre Zielen, Psychoedukation, Problemlösetraining Berger, Friedrich, Gunia 2004 Psychoedukative Familientinter- vention (PEFI) Informationsvermittlung, Frühwarn- 10 Wochen zeichen, Krisenplan, Kommunikationsstrategien, Problemlösekonzept, Hahlweg et al. 2006 Hager, Held 2000 Verhaltenstherapeutisch orien- Verhaltensanalyse, Informations- tierte psychoedukative Familien- vermittlung, Kommunikationstrai- betreuung ning, Problemlösetraining Optimal Treatment Project Informationsvermittlung, 2 Jahre (mindestens 1 Jahr) Kommunikationstraining, Problemlösetraining, Training lebenspraktischer Fähigkeiten, Training spezifischer Strategien, Frühwarnzeichentraining, Krisenmanagement In verschiedenen Metaanalysen (Pharoah et al., 2003, Pilling et al., 2002, Pitschel-Walz et al, 2001, Shadish et al., 1997) konnte nachgewiesen werden, dass durch Familienintervention die Rückfallraten reduziert, die Compliance erhöht, die soziale Anpassung erhöht und die emotionale Familienatmosphäre verbessert wird. In welcher Form die Familien einzubeziehen sind ist wissenschaftlich noch nicht endgültig nachgewiesen. Die Arbeiten von Mc Farlane legen nahe, dass multifamiliale Ansätze bessere Ergebnisse hinsichtlich Rückfallraten erbringen, wobei die Analyse von Pilling et al. leichte Vorteile für das Einzelsetting erbrachte. 37 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Insgesamt scheinen die Angehörigen von beiden Interventionsstrategien zu profitieren (vgl. Pitschel-Walz, Bäuml, 2007, S. 169). 4.9 Need-adapted-Treatment Es handelt sich hierbei um ein komplexes Behandlungskonzept für schizophrene Erkrankungen, in welchem die Einbeziehung der Angehörigen bzw. des sozialen Netzwerkes allgemein eine wichtige Rolle spielt. 4.9.1 Ursprung Das Konzept des Need-Adapted-Treatment (NAT) wurde in über 25 Jahren im finnischen Turku durch Yrjö Alanen und seinen Mitarbeitern vorwiegend für „Störungen aus dem Schizophreniespektrum“ entwickelt. In vielen Entwicklungsschritten wurden die spezifischen Behandlungselemente psychodynamische Individualtherapie, stationäre Psychiatrie als therapeutische Gemeinschaft, familientherapeutische Intervention, selektive und niedrig dosierte Neuroleptikatherapie in das Konzept integriert. Während der Entwicklungszeit wurde die Methode laufend durch Studien begleitet und konnte gute Ergebnisse vorweisen. Die Patienten wurden mit deutlich weniger Neuroleptika behandelt, besonders die familientherapeutische Intervention zeigte sich als besonders wirksam (vgl. Aderhold, Greve 2010). 4.9.2 Behandlungsprinzipien Im Rahmen des nationalen finnischen Schizophrenieprojektes wurden Grundprinizipien, formuliert. Aus diesen Prinzipien ergeben sich weitere Besonderheiten des Konzeptes: (vgl. Aderhold, Greve; 2010) Grundprinzipien 1. Therapieversammlung Die Therapieversammlung stellt die zentrale therapeutische Intervention dar. Sie hat diagnostischen, informativen und therapeutischen Charakter. Alle Entscheidungen werden hier mit dem gesamten Netzwerk des Patienten vorab diskutiert. 2. Sofortige Hilfe Nach einem Anruf, der nicht vom Patienten kommen muss, findet innerhalb von 24 h das erste Netzwerktreffen statt. 38 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 3. Einbeziehen des sozialen Netzwerkes Von Beginn an werden Familienmitglieder und andere wichtige Bezugspersonen mit einbezogen. Dieses Netzwerk wird grundsätzlich als Ressource angesehen, weshalb versucht wird, diese immer nutzbar zu machen. Wichtig ist es, dass zu diesen Netzwerktreffen auch andere professionelle Helfer eingeladen werden. Soweit er dies möchte, soll der Patient selbst möglichst an jeder Sitzung teilnehmen. 4. Flexible Einstellung auf die Bedürfnisse Da jeder Fall einzigartig und einmalig ist, gibt es kein standardisiertes Behandlungsprogramm. Die Methoden müssen an das individuelle Umfeld und die Lebensweisen des Patienten angepasst werden. 5. Gemeinsame Verantwortung Die Verantwortung für die Organisation der Therapieversammlung liegt hier im psychiatrischen Hilfesystem. Hier wird definiert, wer weiter zum System des Patienten zählt. 6. Psychologische Kontinutität Therapeutenwechsel und auch Therapieabbrüche sollen weitgehend vermieden werden. Verschiedene Therapiemethoden sollen in einen gemeinsamen Gesamtprozess integriert werden. 7. Aushalten von Unsicherheit Um Verstehen und einen Prozess zu ermöglichen, soll möglichst auf vorschnelle Festlegungen (Diagnosen) und dadurch auch auf die – für Professionelle – gewohnte Sicherheit verzichtet werden. Das Ertragen von Unsicherheit wird durch ein als sicher erlebtes Setting erleichtert, in dem jeder gehört wird. Diagnosen und Krankheitskonstrukte sind Prozeduren, die zwar vermeintliche Sicherheit schaffen, durch den Zugang über die individuellen Problemlagen des Betroffenen wird dafür aber vor allem für diesen selbst und seine Angehörigen Sicherheit geschaffen. 8. Förderung des Dialoges Der Schwerpunkt der therapeutischen Konversation liegt in der Förderung von offenen Dialogen zwischen Familie und dem weiteren sozialen Netzwerk, welche als gemeinsames Nachdenken zu verstehen sind. Durch diese Art der Kommunikation soll eine größere Kompetenz für die eigene Lebensgestaltung und mehr Handlungsfähigkeit entstehen. 39 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Weitere Besonderheiten sind: (vgl. Aderhold, Greve, 2010) - Antipsychotische Medikation in geringer Dosierung Neuroleptische Medikation soll bei Ersterkrankten in den ersten drei bis vier Wochen vermieden werden. Benzodiazepine sind bei Ängsten und Schlafstörungen Mittel der Wahl. Da die Einnahme von Antipsychotika mit Unsicherheit und Ambivalenz verbunden ist, sollte diese in drei Therapieversammlungen diskutiert werden. Dann erst wird eine Entscheidung gemeinsam getroffen. Studienergebnisse belegen, dass bei Patienten, welche in der ersten psychotischen Krise keine Neuroleptika benötigten, auch in späteren Krisen auf sie häufig verzichtet werden kann. - Integration verschiedener Therapieformen Hierunter wird ein „Sich-Ergänzen“ der therapeutischen Herangehensweisen verstanden, Zum Kern gehören jedoch Einzeltherapie, Kunsttherapie und Arbeitstherapie. - Psychodynamisch orientierte Einzeltherapie Diese Art der Therapie ist besonders für autonomere Personen geeignet, die bereits nicht mehr in ihrer Familie leben. Sie wurde als wirksam evaluiert, jedoch mit geringeren Effekten als familientherapeutische Intervention. - Kognitiv–behaviorale Einzeltherapie Die Wirksamkeit der kognitiv-behaviorale Einzeltherapie wurde für Positiv-Symptome wie Halluzinationen und Wahnerleben bestätigt. Auch wird sie in den englischen NICE-Leitlinien von 2009 als obligates psychotherapeutisches Verfahren in Kombination mit Familientherapie gefordert. (vgl. National Institute for health and clinical excellence, 2009, S. 7) 5 Angehörigenarbeit bei Borderline Persönlichkeitsstörung Insgesamt gibt es kaum Literatur zu Angehörigen eines Betroffenen mit BorderlinePersönlichkeitsstörung. In einer Pubmed–Datenbankrecherche zu „Angehörige Borderline Persönlichkeitsstörung“ fanden sich null Ergebnisse. Die Suche mit „Relatives Borderline Personality Disorder“ ergab zwar 790 Ergebnisse, welche sich jedoch aber zum Großteil auf den Zusammenhang mit anderen psychiatrischen Erkrankungen oder auf den Zusammenhang von elterlichem Verhalten und der Entstehung einer Borderline-Störung beziehen. Bei der 40 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Suche nach „Relatives Schizophrenia“ gab es 10836 Ergebnisse. Dieses Ergebnis verdeutlicht, wie wenige Veröffentlichungen sich mit der spezifischen Problematik der Angehörigen bei Borderline-Persönlichkeitsstörung beschäftigen. 5.1 Eigenschaften von Familien von Menschen mit einer Borderline- Persönlichkeitsstörung Sansone et al. (2009) haben in ihrem Artikel vor allem die Psychopathologie von Angehörigen von Borderline-Patienten und die Einbeziehung der Familien beschrieben. Im Vergleich von Angehörigen von nicht psychiatrischen Patienten in der Kontrollgruppe und den erweiterten Familien von Borderline-Angehörigen hatten die Angehörigen der Borderline-Erkrankten signifikant höhere Raten an Depressionen, Substanzmissbrauch und dissoziale Charakterzüge. Im Vergleich mit Angehörigen von Menschen mit anderen Persönlichkeitstörungen und Angehörigen von schizophren Erkrankten hatten sie ein größeres Risiko für affektive oder impulsive Störungen. In weiteren Untersuchungen wurden die Angehörigen der Borderline-Erkrankten mit denen von affektiv Erkrankten und den Angehörigen von nicht psychiatrischen Patienten verglichen. Hier waren die Angehörigen der Borderline-Erkrankten ebenfalls deutlich häufiger von affektiven Störungen und Achse-II-Störungen betroffen. In einer zusammenfassenden Veröffentlichung beschrieben White et al.(2003), dass bei Angehörigen von Borderline-Erkrankten scheinbar keine familiäre Häufung von schizophrenen oder depressiven Störungen vorzufinden ist, jedoch durchaus Impulskontrollstörungen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Es scheint also vier häufige Bereiche familiärer Auffälligkeiten zu geben: Affektive Störungen, Impulskontrollstörungen, Substanzmißbrauch und Achse-II-Störungen inklusive BorderlineStörungen. Angehörige von Borderline-Erkrankten wurden laut Sansone und Sansone (2009; S. 19 ff) von ihren erkrankten Angehörigen als negativ, überkontrollierend, uninteressiert, unempathisch, konfliktreich, invalidisierend, kritisch, ablehnend, wenig pflegend, wenig emotional, emotional zurückhaltend, überbeschützend und feindselig beschrieben. Damit stehen diese in einem unschönen Licht, wobei eine potenzieller Konfundierung durchaus die verzerrte Wahrnehmung der Patienten sein kann. Für die Einbeziehung der Angehörigen lassen sich aus den beschriebenen Studien verschiedene Hinweise ableiten: 41 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? - In Familien von Borderline-Erkrankten trifft man häufiger auf Menschen mit affektiven Störungen, Impulskontrollstörungen, Substanzmissbrauch und Achse-II-Störungen inklusive der Borderline-Störung. - Eltern sind häufiger im Handeln übermäßig involviert, emotional jedoch sehr wenig. - Mütter sind eventuell sehr egozentrisch, wenig fürsorglich, inkonsistent und übermäßig involviert. - Väter werden häufig negativ wahrgenommen, vor allem wenn sie Täter von sexuellem Mißbrauch waren. - Kinder von Borderline-erkrankten Müttern können emotional- und verhaltensgestört sein, wie die größere Anzahl von psychiatrischen Diagnosen bestätigt. All diese Ergebnisse zeigen, dass die Einbeziehung von Angehörigen bei BorderlineStörungen mit großer Sorgfalt durchgeführt werden muss (vgl. Sansone, Sansone; 2009; S. 19 ff). Auch sollte beachtet werden, dass eine Studie von Hoffman et al. (2003, S. 469 f) ergeben hat, dass ein größeres Wissen über die Borderline-Störung bei Angehörigen zu einer höheren Belastung, negativem Stress, Depressionen und einer vermehrten Feindseligkeit gegenüber dem Patienten führt. 5.2 Dialectical Behavioral Therapy – Family Skills Training Angelehnt an die DBT welche in der Behandlung der Patienten eine tragende Rolle einnimmt wurde von Hoffmann et al. (1999, S. 399 ff) auch ein Programm für die Angehörigen entwickelt. Ziele sind, den Angehörigen das Verhalten von Borderline-Patienten zu verständlicher zu machen, allen Familienangehörigen eine angenehme Atmosphäre zu ermöglichen und ihnen Möglichkeiten der Emotionsregulation und der verbesserten zwischenmenschlichen Kommunikation näher zu bringen. Es ist als Add-on zur Therapie des Betroffenen zu sehen und sollte auch relativ früh in der Therapie eingesetzt werden. Es gibt verschiedenen Ansätze, wie das Family Skills Training eingesetzt werden kann: - Es kann nur für bestimmte Zielgruppen wie z.B. misshandelnde Männer eingesetzt werden. - Es kann genutzt werden um z.B. Partnern oder Familienangehörigen Skills beizubringen um den Therapieerfolg bei den Borderline-Klienten zu erhöhen. 42 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? - es können Module aus der DBT, und dem dem übertragungsfokussierten Therapieansatz verwendet werden, um besonders auf der Ebene der Umwelt zu intervenieren. Insgesamt scheint die Einbeziehung der Angehörigen auf die oben genannte Weise besonders wichtig, da die ätiologische Hypothese der DBT den Einfluss der Umwelt auf die Entwicklung der Borderline-Verhaltensweisen betont. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Biologie, individuellem Verhalten und der Umwelt. Ein weiterer wichtiger Grund scheint zu sein, dass Angehörige von Borderline-Patienten eigene emotionale Empfindlichkeiten haben und oft in invalidisierenden Verhältnissen aufgewachsen sind. Aus diesen Gründen komplettiert das Family Skills Training die Therapie des Betroffenen, da sie die individuelle Ebene und die Umwelt, und damit die Angehörigen, mit einbezieht. Insgesamt werden nahezu die gleichen Inhalte vermittelt, wie in der individuellen DBT. Die Angehörigen sollen im Rahmen der Gruppensitzungen die Erkrankung an sich kennenlernen, aber auch die biopsychosoziale Theorie von Emotionen und ihrer Dysregulation und der möglicherweise invalidisierenden Umgebung. Deshalb gibt es für Angehörige ein gesondertes Modul, welches sich „structuring the environment“ nennt. Hier wird vermittelt, wie man als Angehöriger eine Umwelt schaffen kann, in welchem Betroffene gemeinsam mit ihren Familienangehörigen ihre Skills einüben können. Damit sollen die Rückfälle der Betroffenen weniger häufig werden, wozu es jedoch noch keine signifikanten Ergebnisse gibt, von Angehörigen jedoch bereits gespürt wird. 5.3 Psychoedukation Wie bei anderen Erkrankungen spielen die Angehörige bei der Borderline-Störung eine wichtige Rolle, besonders, da bei der Borderline-Störung der Verlauf lange andauernd sein kann. Stress kann, besonders bei emotionaler Dysregulation, Krisen verursachen kann, welche die psychosozialen Funktionen deutlich beeinträchtigen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse zu psychosozialen Faktoren im Hintergrund der BPS ist deshalb mit großer Sicherheit anzunehmen, dass das familiäre System oft einen labilisierenden, stressindizierenden Charakter hat. Wenn es gelingt die Bedingungen im familiären Umfeld zu optimieren, sollte damit ein wichtiger Beitrag zur Stressreduktion geleistet werden. Von Seiten der Patienten sind die Familienbeziehungen oft chaotisch und turbulent. Therapeutische Ansätze einer Veränderung der familiären Situation werden selten in Erwägung gezogen, zudem die Wirksamkeit noch unzureichend untersucht ist. Auf der Angehörigensei43 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? te lassen sich ebenfalls bestimmte Besonderheiten feststellen. Das Zusammenleben mit Familienmitglied mit einer Borderline-Störung kann negative Auswirkungen haben: Neben der Schwierigkeit mit der emotionalen Gefühlswelt zurecht zu kommen, treten eventuell auch juristische, finanzielle oder andere psychosoziale Probleme auf. Familien sind mit ihrem Problem oft isoliert und erfahren kaum Unterstützung. Auch besteht häufig die Sorge, für die Erkrankung verantwortlich gemacht zu werden. Der emotionale Austausch in der Gruppe, welche sich in zweiwöchigem Abstand trifft, kann hier sehr hilfreich sein. Der Therapeut soll eine neutrale und nicht wertende Haltung einnehmen. Die Fokussierung sollte eher zielorientiert sein, er sollte die Angehörigen unterstützen mit ihren erkrankten Angehörigen zu einer günstigen, funktionalen Veränderung im familiären System zu kommen (vgl. Rentrop, 2007, S. 125). Ziel der Psychoedukation ist es, Informationen zu vermitteln, die Vermittlung der dialektischen Haltung (Balance zwischen Akzeptanz der Störung und Zuschreibung der Verantwortung für das eigene Verhalten), Motivation der Angehörigen eigenes Verhalten zu verändern, Vermittlung von Fertigkeiten, Knüpfen von Kontakten zu anderen Angehörigen und die Anleitung zur Selbsthilfe. Die vermittelten Fertigkeiten sollen als Anleitung zum Umgang mit dem Störungsbild, zur Verbesserung der intrafamiliären Kommunikation und zum Krisenmanagement den Angehörigen eine Unterstützung sein (vgl. Rentrop, 2007, S. 125). 5.4 Family Connections Family Connections ist ein Programm, welches auf der DBT und auf DBT for Familys basiert. Es beinhaltet Informationen über die Borderline-Störung, Bewältigungsstrategien, innerfamiläre Strategien und die Vermittlung von Möglichkeiten ein Unterstützungsnetzwerk für Angehörige zu bilden. Family Connections ist ein 12-wöchiges Programm, welches strukturell dem Family-to-Family Programm der National Alliance for the Mentally Ill´s nachempfunden ist. Es beinhaltet Themen wie z.B. die Belastungen von Angehörigen und die damit verbundenen Probleme (emotionale Dysregulation, Selbstverletzung, instabile Stimmung und auch die Beziehungsschwierigkeiten). Das Training soll nahe am Manual von Fruzzetti und Hoffman angelehnt sein. Es beinhaltet die Teilnahme am Programm als Gruppenmitglied, 20 Stunden Training, um eine Gruppe zu leiten und eine wöchentliche Supervision, nachdem die Angehörigen begonnen haben, eige44 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? ne Gruppen zu leiten. Es stehen auch Mentoren zur Verfügung, welche telefonisch kontaktiert werden können. Das Family Connections Program ist in sechs Module aufgeteilt: 1. Modul: Informationen über die Erkrankung 2. Modul: Psychoedukation über die Entstehung, die Behandlung, die Komorbiditäten und eine Einführung bzgl. der Emotionen 3. Modul: Individuelle Skills und Beziehungsskills 4. Modul: Family Skills, um die Beziehungen zu verbessern 5. Modul: Genaue und effektive Selbstdarstellung 6. Modul: Krisenmanagement Evaluationen zeigen, dass das Level der Belastung und der Trauer durch das Family Connections Program abgenommen haben, die eigene Beherrschung über die Dauer des Programmes jedoch zugenommen hat (vgl. Hoffman et al, 2005, S. 217 ff). 5.5 Familientherapie Das Modell von Glick et al. (1999, S 238 ff) beschreibt ein Modell, das Patienten und die Familie nicht getrennt behandelt, sondern beide zusammen. Bisher liegen keine empirischen Ergebnisse zur familientherapeutischen Behandlung der BPD und ihrer Angehörigen vor, sodass die Empfehlungen meist auf klinischer Erfahrung beruhen. Die Ziele sind: - Informationen über die Erkrankung zu vermitteln - Familien die Bewertung von praktischer und emotionaler Unterstützung zu vermitteln - negative expressed-emotions zu vermindern - familiäre und eheliche Beziehungen zu verbessern, weniger Fokussierung auf die Psychopathologie - Verstrickungen und die Phantasie auf Rettung durch Ehepartner oder Eltern zu vermindern - verbesserte Compliance - dem Patienten zu helfen die individuellen und familiären Grenzen zu respektieren Wichtig ist es, dass die Familie motiviert ist, ein gewisses Maß an Möglichkeiten hat Affekte zu regulieren, Angst auszuhalten, Projektionen zu kontrollieren und die Behandlung nicht abzuwerten. 45 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Grundsätzlich kann Familientherapie durchgeführt werden, wenn der Patient kognitiv dazu in der Lage ist und er davon profitiert. Sie kann gleichzeitig zur Einzeltherapie stattfinden. Auch ist es wünschenswert, dass der Einzeltherapeut auch die Familientherapie durchführt. Wobei hier Psychoedukation, systemische Familientherapie oder psychodynamische Therapie eingesetzt werden kann, je nachdem welcher Ansatz hilfreich ist. Da die Familie den Betroffenen beeinflusst und umgekehrt, ist es sinnvoll diese in die Therapie mit einzubeziehen. Auch muss die Familie auf den Fakt vorbereitet werden, dass die Bedingungen lebenslang sein können. Familientherapie kann zu einer verbesserten Kommunikation, weniger Konflikten und weniger Belastungs- und Schuldgefühlen führen. Auch zeigt die Studie von Marcinko und Bilic (2020, S. 257 ff) dass Patienten, welche mit Familientherapie behandelt wurden, eine signifikante Verbesserung hinsichtlich schädigendem Verhalten, Selbstgerichtetheit, Depression und Suizidalität zeigten als die Kontrollgruppe. Die Familiendynamik veränderte sich positiv 6 6.1 Empirischer Teil Fragestellung und Hypothesen Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, inwieweit sich verschiedene Merkmale bezüglich von Angehörigenkontakten diagnosenspezifisch unterscheiden. Es soll erhoben werden, wie häufig die Angehörigen in die Versorgung bei Vincentro mit einbezogen werden. Wenn Angehörige vorhanden sind, wird abgefragt, wie der Kontakt des 46 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Klienten zu den Angehörigen, und der Kontakt der Profis zu den Angehörigen, von Professionellen bewertet wird. Auch sollen Gründe für die Nichteinbeziehung von Angehörigen untersucht werden. Fragestellung dieser Arbeit ist es, inwieweit die Diagnose eines Klienten die Kontaktaufnahme bzw. die Nicht-Kontaktaufnahme und die Bewertung des Kontaktes sowohl vom Klienten als auch von den Profis zu den Angehörigen beeinflusst. Es sollen folgende Hypothesen genauer untersucht werden: Hypothese 1: Die Qualität des Kontaktes der Klienten zum Angehörigen selbst unterscheidet sich bei Patienten mit einer F60.3 von denen von Patienten mit F2 oder F3 Diagnosen. Hypothese 2: Die Einschätzung der Profis über die Qualität des Kontaktes der Klienten zu den Angehörigen und auch die Bewertung des eigenen Kontaktes zu den Angehörigen aus Sicht der Profis bei Borderline-Patienten unterscheidet sich von der Bewertung und Einschätzung zu F2 und F3Diagnosen. Hypothese 3: Angehörige von Patienten mit einer F60.3 werden seltener kontaktiert als Angehörige von Patienten mit einer F2 oder F3-Störung. Hypothese 4: Die Gründe für die Nichteinbeziehung der Angehörigen von F 60.3-Patienten unterscheiden sich von denen bei Klienten mit einer F2 oder F3-Störungen. Hypothese 5: Die psychische Erkrankung der Angehörigen verringert die Qualität des Kontaktes zu den Klienten und den Therapeuten wieder. 47 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 6.2 Untersuchungsdesign 6.2.1 Erstellung des Erhebungsinstrumentes Im ersten Schritt wurden alle Fragen aufgelistet, welche mittels des Instruments beantwortet werden sollen und im Fragebogen thematisch sortiert. Im nächsten Schritt wurde der Fragebogen mit dem Hr. Dr. Bäuml besprochen und entsprechend angepasst. Danach wurden die Fragen in 4 Ebenen gegliedert: - Ebene 1: Angaben zum Klienten - Ebene 2: Kontakt des Klienten zum Angehörigen und die Einschätzung des Profis diesbezüglich - Ebene 3: Einschätzung des Kontaktes vom Profi zum Angehörigen durch den Profi - Ebene 4: Falls kein Kontakt zu den Angehörigen besteht, sollen hier Gründe dafür angegeben werden. Zuerst wurden die Fragen inhaltlich gegliedert, d.h. die Ebenen wurden für drei mögliche Angehörige abgefragt, Ebene 4 allgemein. Beim Pre-Test wurde jedoch deutlich, dass auch die Ebene 4 für jeden Angehörigen unterschiedlich sein kann, d. h. es kann durchaus unterschiedliche Gründe geben, warum zu bestimmten Angehörigen kein Kontakt besteht. Deshalb wurde der Fragebogen umstrukturiert, sodass die Ebene 1 gleich geblieben ist und die Ebenen 2 bis 4 für jeden Angehörigen einzeln abgefragt werden, um unterschiedliche Gründe für die Nichteinbeziehung besser explorieren zu können. Danach wurden die Fragen nochmal auf ihre Auswertbarkeit überarbeitet, es wurde z.B. versucht, die Antwortskalen möglichst für alle Fragen gleich zu gestalten bzw. zumindest die gleiche Menge an Antwortmöglichkeiten festzulegen. Abschließend wurde die Nummerierung für die Codierung in SPSS vorgenommen. 6.2.2 Datenerhebung Die Datenerhebung geschah durch die Mitarbeiter von Vincentro München. Vor Herausgabe der Bögen an die Mitarbeiter wurden diese in der Teambesprechung gemeinsam durchgegangen, um eventuelle Unsicherheiten bzgl. der Bearbeitung zu besprechen. 48 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? In die Untersuchung eingeschlossen wurden alle Versicherten der Techniker Krankenkasse und der KKH Allianz, welche vor dem 1.7.2012 eingeschrieben wurden. Insgesamt wurden die Fragebögen für 590 mögliche Klienten ausgegeben. Es kam zu einem Rücklauf von 416 Fragebögen (70,51%). 6.2.3 Datenschutz Insgesamt waren ca. 700 Klienten von verschiedenen Krankenkassen zum Stichtag 1.7.2012 in der Integrierten Versorgung eingeschrieben. Aufgrund der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bestimmter Krankenkassen wurden nur die Patienten der Techniker Krankenkasse und der KKH Allianz in die Untersuchung aufgenommen. Die Versicherten unterschreiben in der Teilnahmeerklärung die Erlaubnis die Daten anonym für wissenschaftliche Zwecke zu verwenden. Auch im Kooperationsvertrag der Techniker Krankenkasse und der Awolysis GmbH ist der Passus enthalten. Ebenso ist dort nochmal verdeutlicht, dass es keiner weiteren Erlaubnis der Patienten bedarf. Trotzdem wurde die Untersuchung mit der Techniker Krankenkasse und der Geschäftsführung der Awolysis GmbH nochmal abgestimmt und die mündliche Erlaubnis dazu eingeholt. Die aus dem Dokumentationssystem entnommenen Patientendaten wurden anonymisiert bearbeitet, d.h. den Namen wurden entsprechende Nummern zugewiesen, welche auch zur Dateneingabe im SPSS verwendet wurden. Die Mitarbeiter erhielten Fragebögen welche mit dem Namen der Patienten und der zugehörigen Nummer versehen waren. Nach dem Ausfüllen wurde der Name der Patienten entfernt, sodass nur noch durch die Verfasserin der Arbeit nachzuvollziehen war welcher Fragebogen welchem Patienten zugeordnet ist. Diese Liste wurde separat aufbewahrt. 6.2.4 Validität Insgesamt gelingt es nur selten, beide Gültigkeitskriterien in einer Untersuchung perfekt zu erfüllen. Meist wirkt sich eine verbesserte Interne Validität negativ auf die externe Validität aus, umgekehrt gilt dies genauso (vgl. Bortz, Döring, 2003, S. 56). 6.2.4.1 Interne Validität Intern valide ist die Untersuchung, wenn die Ergebnisse eindeutig interpretierbar sind. Sie sinkt mit wachsender Anzahl plausibler Alternativerklärungen für die Ergebnisse. Intern valide ist eine Untersuchung, wenn Veränderungen in den abhängigen Variablen eindeutig auf 49 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? den Einfluss der unabhängigen Variablen zurückzuführen sind bzw. wenn es neben der Untersuchungshypothese keine besseren Alternativerklärungen gibt. (vgl. Bortz, Döring, 2003, S. 56) Laut Bortz und Döring (2003, S 56 f) hängt die interne Validität von bestimmten Einflussfaktoren ab: - Statistische Regressionseffekte: Die Stichprobe wurde zufällig ausgewählt. Lediglich Einschränkungen bzgl. der Verallgemeinerbarkeit (siehe 6.2.4.2 Externe Validität) sind vorhanden. - Selektionseffekte: Gruppen wurden anhand der Diagnose gebildet, sodass hier keine Selektion stattgefunden hat. Sobald F60.3. diagnostiziert war, wurde dies als Hauptdiagnose verwendet. Dann wurden zuerst alle Achse-II-Störungen, dann die Achse-I-Störungen als Hauptdiagnose angesehen. - Experimentelle Mortalität: Da die Untersuchung nicht über längeren Zeitraum durchgeführt wurde, kann es auch hier nicht zu Verfälschungen durch veränderte Teilnahmebereitschaft kommen. Die Untersuchung ist also intern valide, da die Untersuchungsergebnisse für oder gegen die Hypothese sprechen und auch Alternativerklärungen nicht plausibel erscheinen. (vgl. Bortz, Döring; 2003; S. 504 ff.) Auch ist die Konfundierung, also den Zusammenhang verzerrende Störgrößen ausgeschlossen. Häufige Confounder sind neben dem Alter das Geschlecht, die Rauch- und Trinkgewohnheiten und der sozioökonomische Status. (vgl. Weiß, 2010, S. 257) Das Rauch- und Trinkverhalten wurde nicht erhoben. Das Alter, das Geschlecht, der CGI und der sozioökonomische Status sind über alle Gruppen hinweg relativ gleich, sodass diese Merkmale die Ergebnisse nicht verzerren. Die Untersuchung wurde auf Störvariablen, also alle vergessenen Variablen, welche in der Untersuchung nicht erfasst wurde, die abhängige Variable jedoch beeinflussen könnten, un50 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? tersucht. (vgl. Bortz, Döring; 2003, S. 16) Die Medikamenteneinnahme der Klienten wurde nicht untersucht, diese könnte die Qualität des Kontaktes zu den Angehörigen jedoch mit beeinflussen. Die Medikamenteneinnahme wurde allerdings für keine der Diagnosengruppen erfasst. Laut Bortz und Döring (2003, S. 16 f) ist es nicht möglich, alle Variablen zu erheben und ein kleiner Rest an Störvariablen ist tolerierbar. Es sollen Trends aufgezeigt werden, was sich auch in der Formulierung von wissenschaftlichen Hypothesen als Wahrscheinlichkeitsaussagen widerspiegelt. Für deren empirische Überprüfung wurde das Verfahren des Signifikanztests entwickelt. Für diese Untersuchung wurde ein Signifikanzniveau von 5% festgelegt, d.h. p<0,05. 6.2.4.2 Externe Validität Extern valide ist eine Untersuchung, wenn die Ergebnisse über die untersuchten Personen hinaus verallgemeinerbar sind, d.h. je repräsentativer die Stichprobe ist umso höher ist, die externe Validität (vgl. Bortz, Döring; 2003; S. 57). In dieser Untersuchung könnte die Verallgemeinerbarkeit eingeschränkt sein, da die Stichprobe lediglich aus Versicherten der Techniker Krankenkasse und der KKH Allianz besteht. Diese Versichertengruppe repräsentiert höchstwahrscheinlich nicht die durchschnittliche Bevölkerung Deutschlands. Aus der praktischen Erfahrung im sozialpsychiatrischen Bereich lässt sich sagen, dass die meisten Menschen in der Eingliederungshilfe bei der AOK versichert sind. Auch ist die Teilnahme an der Integrierten Versorgung relativ hochschwellig, da die Versicherten zuerst von der Krankenkasse angerufen werden, dann eine Interessensbekundung unterschreiben müssen und im Verlauf zu einem Informationsgespräch eingeladen werden. Dann muss eine relativ umfangreiche Teilnahmeerklärung und eine Erklärung zum Datenschutz unterschrieben werden. Dies ist für viele von psychischen Störungen betroffenen Menschen eine hohe Hürde, welche eventuell ab einem bestimmten Schweregrad der Erkrankung zu einer Nicht-Einschreibung führen. 6.2.5 Reliabilität Die Reliabilität ist das Maß für die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse unter ähnlichen Bedingungen. Viele Angaben sind durch subjektive Einschätzungen des jeweiligen Untersuchers geprägt oder hängen von anderen Rahmenbedingungen ab. (Weiß, 2010, S. 293 f) 51 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Auch in dieser Untersuchung ist es durchaus möglich, dass zu einem anderen Zeitpunkt oder auch durch das Ausfüllen der Fragebögen durch einen anderen Mitarbeiter andere Ergebnisse zustande gekommen sind, da die Angaben ja auf einer subjektiven Einschätzung beruhen. 6.2.6 Datenanalyse Die Auswertung der Daten wurde mittels des Statistikprogrammes SPSS 20 vorgenommen. Die Auswertung der Daten, welche über die deskriptive Statistik hinaus geht, wurde von Stat-up (vgl. Stuckart, Stat-up, siehe Anhang S. 6ff) vorgenommen. Um die gelieferten Daten in ein SPSS-Format zu bringen, wurden Datentransformationen durchgeführt. Alle durchgeführten Manipulationen wurden als SPSS-Syntax und R-Code dokumentiert und können nachvollzogen werden. Es wurden folgende Datenaufbereitungsschritte durchgeführt: Restrukturierung der Excel Tabellen und Zusammenführen der Excel Tabellen Variablen und Wertelabels vergeben Qualitätsüberprüfung von Daten wurde durchgeführt Allen Variablen wurden passende Skalen (metrisch, nominal oder ordinal) zugeordnet Falls für weitere Berechnungen notwendig, wurden String-Variablen in numerische Variablen umkodiert und den Ausprägungen von kategorialen Variablen wurden sinnvolle Wertelabels zugewiesen. Zur Datenanalyse wurden folgende statistische Tests verwendet: - Kruskal-Wallis-Test: Ziel ist der Vergleich der Lageparameter (Median) einer mindestens ordinal skalierten, nicht normalverteilten Variablen zwischen mehreren Gruppen bzw. die Prüfung von Ergebnissen der Varianzanalyse, wenn die zu untersuchenden Variable nicht normalverteilt ist. Voraussetzung hierfür ist es, dass die Daten haben mindestens ordinales Messniveau haben und die Stichprobenvariablen unabhängig sind. Nullhypothese: H0: Die Verteilung der Zielvariable ist in den Gruppen gleich, d.h. auch dass sich die zentralen Tendenzen der Stichproben sich nicht unterscheidet. 52 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Alternativhypothese: H1: Die Verteilung der Zielvariable unterscheidet sich bei mindestens 2 Gruppen. Testentscheidung: Lehne H0 ab, falls p-Wert < 0,05; dabei beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit 5%. Falls der p-Wert > 0,05 ist, kann man davon ausgehen, dass zwischen den Gruppen keine signifikante Unterschiede bestehen. - Korrelationskoeffizient Der Korrelationskoeffizient wird zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen zwei metrischen oder ordinalen Merkmalen verwendet. Er ist normiert auf das Intervall von -1 bis 1. Ein negativer (positiver) Wert des Koeffizienten gibt einen gegensinnigen (gleichsinnigen) Zusammenhang zwischen den Merkmalen an. • Nullhypothese: H0: Es besteht kein Zusammenhang • Alternativhypothese: H1: Es besteht ein Zusammenhang Testentscheidung: Lehne H0 ab, falls p-Wert < 0,05 (damit wurde gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen den Merkmalen besteht); dabei beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit 5%. Falls der p-Wert > 0,05 ist, wird die Nullhypothese beibehalten. Der klassische Korrelationskoeffizient nach Pearson misst die Stärke des linearen Zusammenhangs zwischen zwei metrischen Merkmalen. Die rangbasierten Korrelationskoeffizienten nach Spearman und Kendall messen die Stärke eines monotonen Zusammenhangs zwischen zwei metrischen oder ordinalen Variablen. Die Variablen müssen dabei nicht unbedingt normalverteilt sein. Beide Koeffizienten basieren nicht auf den Daten selbst, sondern auf deren Rängen. Wenn der Korrelationskoeffizient, nach Pearson oder Spearman, den Wert 0 aufweist, so hängen die beiden Merkmale überhaupt nicht (linear bzw. monoton) voneinander ab Spearman-(Rang-)Korrelationkoeffizient Der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient eignet sich als Teststatistik für einen Test auf Unabhängigkeit (dazu müssen die Stichprobenvariablen unabhängig sein und eine stetige Verteilung muss vorliegen) - Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest Das Ziel ist die Überprüfung, ob zwei Merkmale einer Stichprobe unabhängig sind 53 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Vorrausetzung dafür ist es, dass zwei kategorisierte oder kategoriale Merkmale und unabhängige Stichprobenvariablen vorhanden sind. Nullhypothese: H0: Merkmale X und Y sind unabhängig Alternativhypothese: H1: Merkmale X und Y sind nicht unabhängig Testentscheidung: Lehne H0 ab, falls p-Wert < 0,05; dabei beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit 5%. Falls der p-Wert > 0,05 ist, kann man davon ausgehen, dass die Merkmale X und Y unabhängig sind. - Mehrebenenanalyse bzw. logistisches gemischtes Modell: Lineare gemischte Modelle treffen die Annahme, dass zusätzlich zu den populationsübergreifenden Effekten („was gilt generell für die betrachtete Population?“) auch individuenspezifische Abweichungen von diesen Populationseffekten („Was gilt speziell für diese Person, auf Grund seiner Individualität?“) vorliegen können. Diese Abweichungen können sowohl in individuenspezifischen Modellkonstanten als auch in individuenspezifischen Regressionsparametern bestehen. Erstere beschreiben beispielsweise verschiedene individuelle „Einschätzung des Verhältnis zu Angehörigen“ Levels. Zusätzlich dürfen die individuenspezifischen Effekte wie auch die Schätzfehler der einzelnen Person korreliert sein. Formal lässt sich das gemischte lineare Modell auch allgemein in Matrizen-Form darstellen1: 𝐘 = 𝐗 𝞫 + 𝐙𝞬 + 𝞮 mit 𝐗 und 𝐙 : feste bekannte Designmatrizen (d.h. Matrizen von unabhängigen Variablen, die populationsübergreifend und/oder individuenspezifisch wirken können) : Vektor der festen (populationsübergreifenden) Effekte : Vektor der zufälligen (individuenspezifischen) Effekte 54 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? : Kovarianzmatrix der Schätzfehler, also Cov( , ) : Kovarianzmatrix der zufälligen Effekte, also Cov( , ) Lineare Gemischte Modelle werden verwendet bei einer stetigen Zielgröße. Falls die Zielgröße binäre ist, also nur 2 Ausprägungen hat muss das Modell darauf angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt über die Setzung eines Links der dazu führt, dass für die Zielgröße nur 2 Ausprägungen sinnvoll definiert sind. Das angepasste Modell nennt sich logistisches gemischtes Modell. 7 Stichprobe Insgesamt wurden Daten von 416 Klienten ausgewertet. Hiervon sind 96 (23,1%) mit einer F2/F25 Störung, 215 (51,7%) Klienten mit einer F32/33/34/31 Störung, 22 Klienten (5,8%) mit einer F4/F43.1 Störung, 47 Klienten (11,3%) mit einer F60.3 und 31 Klienten (7,5%) mit einer weiteren F6 Diagnose. Im Weiteren werden ausschließlich nur noch Personen betrachtet bei denen eine F2, F3 oder F 60.3 Diagnose gestellt wurde. Der Dropout liegt hier bei 13.32%. 7.1 Biografische Daten Die Altersstruktur und die Geschlechterverteilung zeichnet sich folgendermaßen ab: Tabelle 7.1: Altersstruktur und Geschlechterverteilung (N=416) Merkmal Merkmals Gesamt F2/F25 F32/33/34/31 F60.3 ausprägung N=416 n= 96 (23,1%) n = 215 (51,7%) n = 47(11,3%) [n] [n] [%] [n] [N] Geschlecht [%] [%] [%] Weiblich 278 66,8 58 60,4 150 69,8 39 83,0 Männlich 132 31,7 37 38,5 65 30,2 6 12,8 Fehlend 6 1,4 1 1,0 0 2 4,3 Alter 19 – 29 28 6,6 2 2 11 5,3 9 21,4 M = 45,96 30 – 39 110 26,3 27 28,1 45 20,9 18 38,4 SD = 12,73 40 – 49 115 27,6 27 28,0 63 29,4 11 23,4 50 – 59 87 20,8 22 22,9 47 22,9 4 8,5 60 – 69 46 11.1 10 10,2 31 14,6 0 0 55 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? 70 – 80 19 4,6 6 6,1 13 6,1 0 0 Fehlend 11 2,6 0 0 3 1,4 4 8,5 Insgesamt zeigen sich Unterschiede hinsichtlich des Alters und der Geschlechterverteilung zwischen den Diagnosen. In der Gruppe der F60.3 zeigt sich ein höherer Anteil weiblicher Klienten (83,0%) und auch ein jüngeres Durchschnittsalter mit 38,4 % in der Altersgruppe von 30-39 Jahren bei einem Mittelwert von 45,96 Jahren. Der Chi-Quadrat-Test (p=0.009) zeigt, dass eine Abhängigkeit zwischen dem Geschlecht und der Hauptdiagnose vorliegt. Der nicht parametrische Kruskal-Wallis Test (p<0.000) zeigt, dass es signifikante Unterschiede bezüglich des Alters in den Gruppen gibt. Tabelle 7.2: Finanzielle Situation und Familienstand Merkmal Merkmals Gesamt F2/F25 F32/33/34/31 F60.3 ausprägung N=416 n=96 23,1%) n = 215 (51,7%) n=47(11,3%) [n] [n] [%] [N] [%] [N] [%] [%] Finanzielle Situati- Sozialleistungen 71 17,1 14 14,6 30 14,0 14 29,8 on Rente 98 23,6 32 33,3 47 21,9 11 23,4 Gehalt 198 47,6 39 40,6 117 54,4 16 34,0 Familiäre Hilfe 37 8,9 10 10,4 18 8,4 4 8,5 Vermögen 1 0,2 0 0 1 0,5 0 0 Unbekannt 11 2,6 1 1,0 2 0,9 2 4,3 Allein lebend 163 39,2 39 40,6 69 32,1 23 48,9 Partnerschaft 89 21,4 14 14,6 48 22,3 16 34,0 Verheiratet 102 24,5 25 26,0 64 29,8 5 10,6 Geschieden 35 8,4 11 11,5 18 8,4 3 6,4 Verwitwet 14 3,4 5 5,2 9 4,2 0 0 Unbekannt 13 3,1 2 2,1 7 3,3 0 0 Ja 144 34,6 34 35,4 86 40,0 6 12,8 Nein 259 62,3 58 60,4 125 58,1 40 85,1 Fehlend 13 3,1 4 4,2 4 1,9 1 2,1 Anzahl der Kinder, 1 68 46,3 18 54,5 38 43,7 4 66,7 wenn Kinder 2 62 42,2 8 24,2 40 46,0 2 33,3 M = 1,69 3 13 8,8 6 18,2 7 8,0 0 0 SD = ,80 4 3 2,0 1 3,0 1 1,1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,7 0 0 1 1,1 0 0 Nicht zutreffend 269 Familienstand Kinder 63 128 41 In der Tabelle 7.2 zur finanziellen Situation wird deutlich, dass in jeder Diagnosegruppe die meisten Klienten Gehalt beziehen. Der nächstgrößere Anteil an Klienten bezieht Rente. Der 56 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Chi-Quadrat-Test (p= 0.047) zeigt, dass es eine Abhängigkeit zwischen der finanziellen Situation und der Hauptdiagnose gibt. Was den Familienstand angeht, lässt sich ein Unterschied innerhalb der Gruppen berechnen. Die Klienten mit einer F2-Störung leben häufiger alleine (40,6%) als jene mit affektiven Störungen (32,1%). Auch Klienten mit einer F60.3 leben häufiger alleine (48,9%) als der Durchschnitt (39,2%) aller Klienten. Jedoch haben sowohl die Klienten mit einer F2–Störung (35,4%) und die Klienten mit einer F3-Störung (40%) häufiger Kinder als Klienten mit einer F60.3 (12,8%). Im Durchschnitt haben alle Klienten 1,69 Kinder. Der Chi-Quadrat-Test (p=0,026) zeigt auch hier, dass es eine Abhängigkeit zwischen der Hauptdiagnose und dem Familienstand gibt. Tabelle 7.3: Migrationshintergrund Merkmal Merkmals Gesamt F2/F25 F32/33/34/31 F60.3 ausprägung N=416 n=96 n=215 n=47 [N] [%] (23,1%) [N] (51,7%) [%] [n] (11,3%) [%] [n] [%] Migrations- Ja 58 13,9 22 22,9 22 10,2 3 6,4 hintergrund Nein 303 72,8 60 62,5 166 77,2 37 78,7 Unklar 50 12,0 14 14,6 25 11,6 7 14,9 Fehlend 5 1,2 0 0 2 0,9 0 0 In der Tabelle 7.3 lässt sich erkennen, dass 13,9 % aller Klienten in der Stichprobe einen Migrationshintergrund haben. Mit 22,9% sind diese Klienten in der Gruppe F2 am häufigsten vertreten, in der Gruppe F3 mit 10,2% und in der Gruppe F60.3 mit lediglich 6,4%. Der ChiQuadrat-Test (p= 0.002) zeigt eine Abhängigkeit von Hauptdiagnose und dem Merkmal Migrationshintergrund. 7.2 Krankheitsbezogene Daten Nachfolgend werden die krankheitsbezogenen Daten der Diagnosengruppen dargestellt. Tabelle 7.4: Krankheitsbezogene Daten Merkmal Diagnose gesichert Merkmals Gesamt F2/F25 F32/33/34/31 F60.3 ausprägung N=416 n=96 n=215 n=47 (23,1%) (51,7%) (11,3%) [N] [%] [n] [%] Ja 254 61,1 54 56,3 121 56,3 41 87,2 Nein 128 30,8 26 27,1 60 37,2 6 12,8 Fehlend 34 8,2 16 16,7 14 6,5 0 0 57 [n] [%] [n] [%] Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Mehrere Diagno- Ja 152 36,5 18 18,8 66 30,7 39 83,0 Nein 257 61,8 75 78,1 148 68,8 8 17,0 Fehlend 7 1,7 3 3,1 1 0,5 0 0 Zweitdiagnose F2/25 2 1,4 1 5,6 0 0 0 0 Wenn Ja F32/33/34/31 62 40,8 6 33,3 5 7,6 29 74,4 F4/43.1 62 40,8 7 38,9 46 69,7 5 12,9 F6 3 2,0 0 0 0 0 3 7,7 F1 17 11,2 2 11,1 11 16,7 2 5,1 F5 6 3,9 2 11,1 4 6,1 0 0 sen Nicht zutreffend 164 - 78 - 149 - 8 - Drittdiagnose F2/25 0 0 0 0 0 0 0 0 Wenn ja F32/33/34/31 6 20,7 0 0 0 0 5 45,5 F4/43.1 15 44,8 1 100,0 4 55,5 4 36,4 F6 0 0 0 0 0 0 0 0 F1 8 27,6 0 0 3 33,3 2 18,2 F5 2 6,9 0 0 2 22,2 0 0 Nicht zutreffend 387 - 95 - 206 - 36 - Erkrankungsdauer 1 Jahr 6 1,4 2 2,1 3 1,4 0 0 M = 3,93 2-5 Jahre 65 15,6 8 8,3 47 21,9 2 4,3 SD = 1,97 5-10 Jahre 68 16,3 15 15,8 34 15,8 7 14,9 10-15 Jahre 71 17,1 24 25,0 35 16,3 7 14,9 > 15 Jahre 189 45,4 46 47,9 87 40,5 29 64,4 Fehlend 17 4,1 1 1,0 9 4,2 2 4,3 Ja 74 17,8 12 12,5 29 13,5 20 42,6 Nein 316 76,0 75 78,1 176 81,9 25 53,2 Fehlend 26 6,3 9 9,4 10 4,7 2 4,3 Anzahl Suizidversu- 1 35 56,5 5 55,6 16 69,6 7 41,2 che 2 17 27,4 4 44,4 3 13,0 6 35,3 Wenn Ja 3 4 6,5 0 0 3 13,0 1 5,9 M = 1,90 4 3 4,8 0 0 1 4,3 2 11,8 SD = 1,75 5 1 1,6 0 0 0 0 0 0 10 2 3,2 0 0 0 0 1 5,9 N. zutreffend 354 - 87 - 192 - 30 - Suizidversuch Anzahl 0 47 12,5 5 5,7 32 16,1 0 0 fenthalte Klinikau- 1 99 26,3 20 23,0 60 30,2 2 4,9 Wenn Ja 2 93 24,7 15 17,2 60 30,2 9 22,0 M = 2,49 3 61 16,2 20 23,0 25 12,6 11 26,8 SD = 2,42 4 26 6,9 7 8,0 9 4,5 6 14,6 5 18 4,8 6 6,9 5 2,5 4 9,8 6 10 2,7 4 4,6 2 1,0 3 7,3 7 7 1,9 3 3,4 1 0,5 2 4,9 8 7 1,9 3 3,4 3 1,5 1 2,4 10 5 1,3 2 2,3 1 0,5 2 4,9 12 1 0,3 0 0 0 0 1 2,4 14 1 0,3 1 1,1 0 0 0 0 16 1 0,3 1 1,1 0 0 0 0 20 1 0,3 0 0 1 0,5 0 0 58 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Nicht zutreffend 39 - 9 - 16 - 6 - Anzahl der 1 10 2,4 3 3,1 7 3,3 0 0 Diagnosen 2 124 29,8 17 17,7 57 26,5 29 61,7 M = 2,18 3 22 5,3 1 1,0 10 4,7 5 10,6 SD = ,63 4 7 1,7 0 0 0 0 5 10,6 5 1 0,2 0 0 0 0 0 0 Fehlend 252 60,6 75 78,1 141 65,6 8 17,0 1 91 37,9 21 21,9 49 22,8 7 14,9 2 53 22,1 13 13,5 27 12,6 9 19,1 Anzahl psychiat- risch stationärer 3-5 60 25,0 26 27,1 15 7,0 13 27,7 enthalte: Auf- >5 37 15,0 19 19,8 6 2,3 10 19,1 Wenn ja Nicht zutreffend 176 17 17,7 118 54,9 8 17,0 1 83 37,9 6 6,3 56 26,0 9 19,1 2 52 22,1 5 5,2 29 13,5 8 17,0 hthalte: 3-5 22 25,0 0 0 13 6,0 6 12,8 Wenn Ja >5 8 14,2 1 1,0 4 1,9 2 4,3 M = 1,73 N. Zutreffend 251 84 87,5 113 47,4 22 46,8 CGI Nicht krank 2 0,5 0 0 2 0,9 0 0 M = 4,45 Grenzfall 14 3,4 1 1,0 11 5,1 1 2,1 SD = 1,24 Leicht krank 65 15,6 13 13,5 41 19,1 5 10,6 Mäßig krank 104 25,0 21 21,9 65 30,2 3 6,4 Deutlich krank 91 21,9 23 24,0 44 20,5 12 25,5 Schwer krank 61 14,7 24 25,0 17 7,9 10 21,3 Extr.Sch.Krank 15 3,6 5 5,2 3 1,4 5 10,6 Fehlend 64 15,4 9 9,4 32 14,9 11 23,4 M = 2,18 SD = 1,16 Anzahl psychoso- matischer Aufen- SD = ,872 In der Gruppe der F60.3–Störungen gibt es deutlich mehr Zweit- und Drittdiagnosen (83%), als in den beiden Vergleichsgruppen (F2 mit 18,8% und F3 mit 30,7%). Bei der BorderlineStörung ist die am häufigsten anzutreffende Zusatzdiagnose die affektive Störung (74,4% derer die mehrere Diagnosen haben). Auch ist in dieser Gruppe die Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1.) mit 10,3% bei der Zweitdiagnose und 27,3 % bei der Drittdiagnose häufiger zu finden als in den Vergleichsgruppen (F2 mit 0% sowohl in Zweit-oder Drittdiagnose, F3 mit 9,1% bzw. 22,2%). Hier belegt der Chi-Quadrat-Test (p<0.000), dass eine Abhängigkeit zwischen der Hauptdiagnose und dem Merkmal, ob es mehrere Diagnosen gibt, vorliegt. Auffällig ist, dass in der Gruppe der F60.3-Störungen die Erkrankungsdauer mit 64,4% bei über 15 Jahren deutlich höher als bei den F2-Störungen (47,9%) und den F3-Störungen (40,5%). Wichtig hierbei ist es, die Altersstruktur zu beachten, da die Klienten mit F60.3- 59 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Störungen deutlich jünger sind. Im Mittel liegt die Erkrankungsdauer bei 11,2 Jahren. Der Chi-Quadrat-Test (p= 0.009) zeigt, dass eine Abhängigkeit zwischen den Merkmalen vorliegt. Auch bezüglich der Suizidversuche gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen. In der Gruppe der F60.3 haben 42,6% der Klienten einen Suizidversuch unternommen. In der Gruppe der F2-Störungen nur 12,5% bei den F3-Störungen 13,5%. Auf alle Diagnosen bezogen sind es insgesamt 17,8% der Klienten mit einem Suizidversuch. Der Chi-Quadrat-Test (p< 0.000) zeigt eine Abhängigkeit zwischen Hauptdiagnose und dem Merkmal Suizidversuch. Im Mittel sind die Klienten 2,49 Mal in einer Klinik behandelt worden. Hier ist zu sehen, dass in der Gruppe der F60.3-Störungen die Anzahl der Klienten mit häufigen Klinikaufenthalten zunimmt. Klienten mit einer F 60.3–Störung werden häufiger in einer psychosomatischen Klinik behandelt, als Patienten mit einer F2- Störung. Hier zeigt sich, dass bei den F60.3Störungen die Anzahl der Klienten mit mehreren Klinikaufenthalten höher ist. Durch den ChiQuadrat-Test (P< 0.000) wird ein Zusammenhang zwischen der Hauptdiagnose und der Anzahl der stationären psychiatrischen Aufenthalte belegt, für die stationären psychosomatischen Aufenthalte (p= 0.353) gilt dies jedoch nicht. Der CGI, also die Einschätzung der Schwere der Erkrankung, liegt im Mittel bei 4,45. Bei den F2- und den F60.3-Störungen zeigt sich jedoch eine Verschiebung hin zu den höheren Werten. Bei den F2- und den F60.3-Störungen liegt der größte Anteil bei 5 (deutlich krank), bei den F3-Störungen bei 4 (mäßig krank). Auch hier zeigt der Chi-Quadrat-Test (p< 0.000) eine Abhängigkeit von CGI und Hauptdiagnose. 7.3 Aktuelle Betreuungs- und Therapiesituation Die aktuelle Betreuungs- und Therapiesituation der Klienten in den jeweiligen Gruppen stellt sich wie Tabelle 7.5. zeigt, folgendermaßen dar: Tabelle 7.5: Betreuungs- und Therapiesituation Merkmal Merkmals Gesamt F2/F25 F32/33/34/31 F60.3 ausprägung N=416 n = 96 (23,1%) n = 215 (51,7%) n = 47(11,3%) [N] [n] [n] [N] [%] [%] [%] [%] SPDI Ja 27 von 416 (6,5%) 8 von 96 (8,3%) 9 von 215 (4,2%) 5 von 47 (10,6%) BEW Ja 17 von 416 (4,1%) 8 von 96 (8,3%) 4 von 215 (1,9%) 4 von 47 (8,5%) Tagestätte Ja 21 von 416 (5,0%) 12 von 96 (12,5%) 5 von 215 (2,3%) 1 von 47 (2,1%) Psychotherapie Ja 181 27 von 96 (28,1%) 104 26 von 47 (55,3%) von 416 (43,5%) von (48,4%) 60 215 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Psychiater Ja 360 von 416 90 von 96 (93,8%) (86,5%) 185 von 215 42 von 47 (89,4%) (86,0%) Ergotherapie Ja 17 von 416 (4,1%) 5 von 96 (5,2%) 6 von 215 (2,8%) 4 von 47 (8,5%) Gesetzl.Betreuung Ja 17 von 416 (4,1%) 7 von 96 (7,3%) 4 von 215 (1,9%) 3 von 47 (6,4%) TWG Ja 4 von 416 (1,0%) 1 von 96 (1,0%) 2 von 215 (0,9%) 1 von 47 (2,1%) Die Auswertung der Daten bezüglich der aktuellen Therapie- und Betreuungssituation zeigt, dass die Stichprobe relativ homogen ist. Klienten mit einer F60.3-Störung sind deutlich häufiger (55,3%) in Psychotherapie, als die Klienten mit einer F2-Störung (28,1%). Auch besuchen diese Klienten häufiger eine Tagesstätte (12,5%) als die beiden Vergleichsgruppen. Insgesamt nehmen Klienten mit einer F3-Störung am seltensten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (BEW, SpDi, Tagesstätte) in Anspruch. Auch hier zeigen Chi-Quadrat-Tests, dass es bezüglich der Hauptdiagnose und der Anbindung an BEW (p=0.015), der Anbindung an eine Tagesstätte (p=0.001) und der Anbindung an einen Psychotherapeuten (p=0.001) eine Abhängigkeitgibt. Für die Merkmale Anbindung an einen SpDi (p=0.149), die Anbindung an eine Psychiater (p=0.187), die Anbindung an eine Ergotherapie (p=0.178) und die Anbindung an eine gesetzliche Betreuung (p=0.05) gibt es bezüglich der Hauptdiagnose keinen Zusammenhang. 7.4 Angehörigenbezogene Daten Bei den F2-Störungen haben 97,9% der Klienten Angehörige, bei den F3-Störungen 92,6% und bei den F60.3-Störungen 97,9%. Der Chi-Quadrat-Test zeigt (p=0.199) dass es keine Anhängigkeit zwischen der Gruppe und dem Vorhandensein von Angehörigen gibt. In der der Tabelle 7.6 wird die Anzahl der Angehörigen und die Häufigkeit des Kontaktes zu den Angehörigen dargestellt. Tabelle 7.6: Wie viele Angehörige sind vorhanden und wurden diese kontaktiert? Key- F2 / F25 F32 / 33 / 34 / 31 n = 96 n = 215 F 60.3 n = 47 Angehöri- Angehöri- Angehöri- Angehöri- Angehöri- Angehöri- Angehöri- Angehöri- Angehöri- ger ger ger kontak- ger ger kontak- ger kontak- ger ger kontak- ger kontak- vor- Kon- vor- vor- handen taktiert tiert % handen tiert tiert % handen tiert tiert % 93 27 29,35 198 47 23,73 46 11 23,91 Angehöriger 61 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Angehöriger II 47 7 14,89 84 8 9,52 29 3 10,34 Angehöriger III 12 1 8,33 27 1 3,70 8 1 12,5 Gesamt 152 35 23,0 309 56 18,1 83 15 18,07 Durchschnittliche 1,58 1,43 1,76 Anzahl Angehörige Obige Tabelle zeigt, dass im Durchschnitt bei den F2-Störungen 1,58 Angehörige vorhanden sind, bei den F3-Störungen 1,43 Angehörige und bei den F60.3–Störungen 1,76 Angehörige. Auch zeigt sich, dass die Key-Angehörigen am häufigsten kontaktiert wurden. Insgesamt wurden bei den F2-Störungen 23%, bei den F3 Störungen 18,1 % und bei den F60.3Störungen 18,07% der Angehörigen kontaktiert. Die Tabelle 7.7 zeigt das persönliche Verhältnis der Klienten zu den jeweiligen Angehörigen. Tabelle 7.7: Verhältnis der Angehörigen zum Klienten Merkmal Merkmals Gesamt F2/F25 F32/33/34/31 F60.3 ausprägung N=416 n=96 n=215 n=47 [N] [%] (23,1%) [N] (51,7%) [%] (11,3%) [n] [%] [n] [%] Verhältnis Key- Mutter 98 25,6 23 25,0 48 23,4 15 31,9 Angehöriger zum Vater 23 6,0 6 6,5 8 4,1 6 12,8 Partner 58 15,1 6 6,5 30 15,2 11 23,4 Ehepartner 98 25,6 23 25,0 60 30,5 7 14,9 Schwester 19 5,0 5 5,4 11 5,6 1 2,1 Bruder 19 5,0 10 10,9 6 3,0 1 2,1 Tochter 25 6,5 4 4,3 16 8,1 2 4,3 Sohn 26 6,8 12 13,0 10 8,1 0 0 FreundIn 6 1,6 1 1,1 4 5,1 1 2,1 Ex-Partner 11 2,9 2 2,2 6 2,0 1 2,1 Nicht zutreffend 33 - 4 - 18 - 2 - Verhältnis Angehö- Mutter 55 30,2 16 34,0 20 23,8 10 34,5 riger II zum Klien- Vater 28 15,4 6 12,8 10 11,9 9 31,0 ten Partner 9 4,9 1 2,1 6 7,1 2 6,9 Ehepartner 3 1,6 0 0 3 3,6 0 0 Schwester 15 8,2 5 10,6 5 6,0 1 3,4 Bruder 18 9,9 5 10,6 9 10,7 3 10,3 Tochter 19 10,4 6 12,8 12 14,3 0 0 Sohn 22 12,1 4 8,5 15 17,9 1 3,4 FreundIn 6 3,3 1 2,1 3 3,6 1 3,4 Ex-Partner 7 3,8 3 6,4 1 1,2 2 6,9 Nicht zutreffend 234 - 49 - 131 - 18 - Mutter 12 20,3 3 25,0 5 18,5 2 25,0 Klienten Verhältnis Angehö- 62 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? riger III zum Klien- Vater 10 16,9 2 16,7 3 11,1 3 37,5 ten Partner 1 1,7 0 0 0 0 0 0 Ehepartner 0 0 0 0 0 0 0 0 Schwester 14 23,7 1 8,3 8 29,6 0 0 Bruder 6 10,2 2 16,7 3 11,1 1 12,5 Tochter 6 10,2 1 8,3 5 18,5 0 0 Sohn 3 5,1 1 8,3 1 3,7 0 0 FreundIn 6 10,2 1 8,3 2 7,4 2 25,0 Ex-Partner 1 1,7 1 8,3 0 0 0 0 Unbekannt 357 - 84 - 188 - 39 - Bei allen Diagnosegruppen sind die Mütter und nachfolgend die Ehepartner oder Partner meist Key-Angehörige. In der Gruppe der F60.3 zeigt sich, dass auch die Väter mit 12, 8% deutlich häufiger als Key-Angehöriger angegeben wurden, als in den Vergleichsgruppen. Auch beim Angehörigen II sind die Mütter am häufigsten angegeben. Auch hier sind mit 31% in der Gruppe F60.3 die Väter deutlich häufiger vertreten als in den Vergleichsgruppen. Insgesamt zeigt sich, dass beim Angehörigen II Geschwister deutlich häufiger genannt werden, als beim Key-Angehörigen. Partner hingegen werden deutlich weniger als Angehöriger II genannt. Eher scheint es, dass sie wenn vorhanden, Key-Angehöriger sind. Auffällig ist es auch, dass Kinder in der Gruppe F60.3 deutlich weniger vertreten sind, als in den Vergleichsgruppen. Auch beim Angehörigen III sind Mütter noch häufig vertreten, es zeigt sich jedoch, dass in den Gruppen F2 und F3 die Väter deutlich häufiger genannt wurden. Hier sind Geschwister wieder häufiger genannt, als beim Key-Angehörigen oder beim Angehörigen II. Es zeigt sich auch, dass beim Angehörigen III mehr Freunde genannt werden, als bei den anderen beiden Angehörigengruppen. Auch wurde im Rahmen der Untersuchung erhoben, ob die Angehörigen selbst psychisch erkrankt sind, und wenn ja, welche Diagnose sie haben. Insgesamt sind in allen Vergleichsgruppen 98 (18,01%) Angehörige selbst erkrankt. Bei den F2- Störungen sind es 40 (26,31%), bei den F3-Störungen 48 (15,33%) und bei den F60.3-Störungen 10 (12,04%). Chi-QuadratTest zeigt mit einem p-Wert von 0,235 keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer psychischen Erkrankung des Angehörigen und der Hauptdiagnose des Klienten. Auch hinsichtlich der Anzahl der psychisch Erkrankten Angehörigen und der Haupt- 63 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? diagnose des Klienten zeigt der Chi-Quadrat-Test mit einem p-Wert von 0,294 kein Abhängigkeit. In den Tabellen 7.8, 7.9, 7.10 und 7.11 wird dargestellt, welche Diagnose die psychisch erkrankten Angehörigen haben. Tabelle 7.8: Diagnosen der erkrankten Angehörigen F2, n= 152 Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 93 n = 47 n = 12 N = 152 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Diagnose, wenn F1 0 0 2 4,25 1 8,33 3 1,97 Angehörige F2 4 4,30 3 6,38 1 8,33 8 5,26 erkankt F3 5 5,37 3 6,38 0 0 8 5,26 F4 2 2,15 0 0 0 0 2 1,31 F5 0 0 0 0 0 0 0 0 F6 0 0 0 0 0 0 0 0 F0 0 0 1 2,12 2 16,66 3 1,97 Nicht zutreffend 82 88,17 39 82,97 8 66,66 128 84,21 Auffällig ist es hier, dass die Angehörigen III häufiger selbst erkrankt sind als die beiden anderen Angehörigengruppen. Auch unterscheidet sich die Verteilung der Diagnosen. Während Key-Anghörige eher F2, F3 oder F4-Störungen haben, kommt die F1-Diagnose nur bei Angehörigem II und III vor. Tabelle 7.9: Diagnosen der erkrankten Angehörigen F3, n = 309 Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 198 n = 84 n = 27 N = 309 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Diagnose, wenn F1 2 1,01 0 0 0 0 2 0,64 Angehörige F2 1 0,50 0 0 2 7,40 3 0,97 erkankt F3 22 11,11 7 8,33 2 7,40 31 10,03 F4 1 0,50 0 0 0 0 1 0,32 F5 1 0,50 0 0 0 0 1 0,32 F6 5 2,52 0 0 0 0 5 1,61 F0 1 0,50 0 0 0 0 1 0,32 Nicht zutreffend 165 83,33 77 91,66 25 92,59 265 85,76 Bei den Angehörigen der F3- diagnostizierten Klienten ist auch unter den Angehörigen die F3-Störung deutlich überrepräsentiert. Alle anderen Diagnosen sind relativ gleich verteilt, wobei noch ein kleiner Anstieg bei den F6-Störungen liegt. Tabelle 7.10: Diagnosen der erkrankten Angehörigen F60.3, n = 83 Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 46 n = 29 n=8 N = 83 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Diagnose, wenn F1 2 4,34 1 3,44 0 0 3 3,61 64 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Angehörige F2 2 4,34 0 0 0 0 2 2,40 erkankt F3 2 4,34 1 3,44 0 0 3 3,61 F4 0 0 0 0 0 0 0 0 F5 0 0 1 3,44 0 0 1 1,2 F6 1 2,17 0 0 0 0 1 1,2 F0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nicht zutreffend 39 84,78 26 89,65 8 100,00 73 87,95 Bei den Klienten mit einer F 60.3 zeigt sich, dass die Key-Angehörigen häufiger erkrankt sind, als die anderen Angehörigen. Ausgeglichen ist hier jedoch die Diagnosenverteilung zwischen F1, F3 und F3. Tabelle 7.11: Diagnosen der erkrankten Angehörigen alle Vergleichsgruppen, n = 544 F2 F3 F60,3 n = 152 n = 309 n = 83 Gesamt N = 544 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Diagnose, wenn F1 3 1,97 2 0,64 3 3,61 8 1,47 Angehörige F2 8 5,26 3 0,97 2 2,40 13 2,38 erkankt F3 8 5,26 31 10,03 3 3,61 42 7,72 F4 2 1,31 1 0,32 0 0 3 0,55 F5 0 0 1 0,32 1 1,2 2 0,36 F6 0 0 5 1,61 1 1,2 6 1,10 F0 3 1,97 1 0,32 0 0 4 0,73 Nicht zutreffend 128 84,21 265 85,76 73 87,95 466 85,66 Über die Vergleichsgruppen hinweg wird deutlich, dass Angehörige am häufigsten an einer affektiven Störung (7,72%) erkrankt sind. Mit 2,38% ist die F2-Störung die am zweithäufigsten vorhandene Diagnose. Danach folgen mit 1,47% die F1-Störungen und die Persönlichkeitsstörungen mit 1,10%. In der Gruppe F2 war ein Angehöriger (0,65%) „Täter“, in der Gruppe F3 zwei Angehörige (0,64%) und in der Gruppe F60.4 ebenfalls ein Angehöriger (1,45%). Hier ist jedoch zu bedenken, dass es hier womöglich eine hohe Dunkelziffer gibt, da die Angaben auf dem Wissen der Therapeuten beruhen und die Klienten eventuell auch lediglich nicht davon berichtet haben. 7.5 Angehörigenkontakte In den Tabellen 7.12, 7.13, 7.14 und 7.15 wir die Qualität der Angehörigenkontakte erläutert. Tabelle 7.12: Qualität der Angehörigenkontakte F2 Merkmal Merkmalsausprägung Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 93 n = 47 n = 12 N= 152 [n] [%] [n] 65 [%] [n] [%] [n] [%] Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Einschätzung des Belastend / eher belastend Kontaktes zum Unterstützend / eher Angehörigen aus unterstützend Klientensicht Nicht zutreffend Einschätzung des Belastend / eher belastend Kontaktes zum Unterstützend / eher Angehörigen aus unterstützend Therapeutensicht Nicht zutreffend Einschätzung des Hilfreich / eher hilfreich Kontaktes von Wenig hilfreich / gar nicht Vincentro zum hilfreich Angehörigen Nicht zutreffend 14 14,58 17 36,17 5 41,66 36 23,68 72 77,42 27 57,44 6 50,00 105 69,08 10 10,75 3 6,38 1 8,33 11 7,24 17 18,28 18 38,30 3 25,00 38 25,00 68 73,12 25 53,19 8 66,66 101 66,45 11 11,83 4 8,51 1 8,33 16 10,52 21 77,8 5 62,5 1 100,0 27 77,14 6 22,2 3 37,5 0 0 9 22,86 69 - 39 - 11 - 119 - Zu der Qualität der Angehörigenkontakte lässt sich sagen, dass die Key-Angehörigen der Klienten mit einer F2-Störung aus Klientensicht (14,58%) weit weniger belastend sind als die Angehörigen II (36,17%) oder die Angehörigen III (41,66%). Dies unterscheidet sich jedoch beim Angehörigen III von der Einschätzung der Therapeuten. Hier halten nur 25,00% diese für belastend. Der persönliche Kontakt der Therapeuten zu den Angehörigen wird, soweit vorhanden, über alle Angehörigen mit 77,14% als meist hilfreich eingeschätzt. Tabelle 7.13: Qualität der Angehörigenkontakte F3 Merkmal Einschätzung Kontaktes Angehörigen Merkmalsausprägung des Unterstützend aus unterstützend Klientensicht Einschätzung Kontaktes Belastend / eher belastend zum / Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 198 n = 84 n = 27 n = 309 [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] 54 27,27 30 35,71 7 25,93 91 29,45 133 67,17 50 59,52 18 66,66 201 65,04 28 14,14 4 4,76 2 7,40 17 5,50 59 29,80 32 38,09 9 33,33 100 32,36 eher Nicht zutreffend des zum Belastend / eher belastend Unterstützend / eher 66 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Angehörigen aus Therapeutensicht unterstützend 125 63,13 45 53,57 16 59,26 186 60,19 31 15,66 7 8,33 2 7,41 23 7,44 Nicht zutreffend Einschätzung des Hilfreich / eher hilfreich 32 72,8 6 75,0 1 100,0 39 69,64 Kontaktes von Wenig hilfreich / gar nicht 12 27,3 2 25,0 0 0 14 30,36 Vincentro zum hilfreich Angehörigen Nicht zutreffend 171 76 26 256 Die Angehörigenkontakte der Klienten mit einer F3-Störung werden gesamt zu 29,45% als belastend beschrieben, lediglich beim Angehörigen II gibt es eine Abweichung mit 35,71%. Auch in der Einschätzung der Therapeuten spiegelt sich dies wider. Die Einschätzung des direkten Kontaktes zu den Angehörigen wird im Gesamten zu 69,64 % als hilfreich eingeschätzt. Tabelle 7.14: Qualität der Angehörigenkontakte F60.3 Merkmal Einschätzung Kontaktes Angehörigen Merkmalsausprägung des Unterstützend aus unterstützend Klientensicht Einschätzung Kontaktes Angehörigen Belastend / eher belastend zum / Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 46 n = 29 n=8 N = 83 [n] [%] [n] [%] [n] [%] [N] [%] 14 30,43 16 55,17 4 50,00 34 40,96 29 63,04 13 44,82 4 50,00 46 55,42 4 8,70 0 0 0 0 3 3,61 14 30,43 14 48,27 4 50,00 32 38,55 30 65,21 12 41,38 4 50,00 46 55,42 eher Nicht zutreffend des Belastend / eher belastend zum Unterstützend aus unterstützend / eher Therapeutensicht Nicht zutreffend 3 6,52 3 10,34 0 0 5 6,02 Einschätzung des Hilfreich / eher hilfreich 5 50,0 2 66,7 1 100,0 8 53,33 Kontaktes von Wenig hilfreich / gar nicht 5 50,0 1 33,3 0 0 6 46,67 Vincentro zum hilfreich 37 - 26 - 7 - 69 - Angehörigen Nicht zutreffend Die Angehörigenkontakte der Klienten mit einer Borderline-Störung werden beim KeyAngehörigen zu 30,43%, beim Angehörigen II zu 55,17% und beim Angehörigen III 50,00% als belastend eingeschätzt. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung der Therapeuten wider. Der direkte Kontakt wird in der gesamten Gruppe mit 53,33% als hilfreich beschrieben. Tabelle 7.15: Qualität der Angehörigenkontakte Gesamt Merkmal Einschätzung Kontaktes Merkmalsausprägung des zum Belastend / eher belastend Unterstützend / F2 F3 F60.3 n = 152 n = 309 n = 83 Gesamt N = 544 [n] [%] [n] [%] [n] [%] [N] [%] 36 23,68 91 29,45 34 40,96 161 29,60 eher 67 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Angehörigen aus Klientensicht Einschätzung Kontaktes Angehörigen unterstützend 105 69,08 201 65,04 46 55,42 352 64,71 11 7,24 17 5,50 3 3,61 31 38 25,00 100 32,36 32 38,55 170 31,25 101 66,45 186 60,19 46 55,42 333 61,21 Nicht zutreffend des Belastend / eher belastend zum Unterstützend aus unterstützend / eher Therapeutensicht Nicht zutreffend 16 10,52 23 7,44 5 6,02 41 7,54 Einschätzung des Hilfreich / eher hilfreich 27 77,14 39 69,64 8 53,33 74 69,81 Kontaktes von Wenig hilfreich / gar nicht 9 22,86 14 30,36 6 46,67 29 30,19 Vincentro zum hilfreich 119 - 256 - 69 - 461 - Angehörigen Nicht zutreffend Im Vergleich der Diagnosegruppen zeigt sich, dass der Kontakt der Klienten zu den Angehörigen bei der Gruppe F60.3 mit 40.96% deutlich belastender erlebt wird, als bei der Gruppe F2 mit 23,68% oder der Gruppe F3 29,45%. Die Einschätzung der Therapeuten hingegen unterscheidet sich nur bei der Gruppe F2, hier wird der Kontakt mit 25,00% als weniger belastend eingeschätzt als in der Gruppe F3 (32,36%) oder der Gruppe F60.3 (38,55%). Der direkte Kontakt hingegen wird, wenn vorhanden, bei der Gruppe F2 (77,14%) hilfreicher eingeschätzt als in den beiden Vergleichsgruppen. Die Tabellen 7.16, 7.17, 7.18 und 7.19 zeigen die Begründungen für die Ablehnung des Kontaktes zu den Angehörigen sowohl aus Klienten- aus Therapeuten und aus Angehörigensicht. Tabelle 7.16: Mit welcher Begründung wurde der Kontakt abgelehnt? F2-Diagnosen Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 93 n = 47 n = 12 N = 152 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [N] [%] Kein Kontakt abgebrochen 2 2,15 2 4,25 1 8,33 5 3,28 Ablehnung Kein Nutzen 15 16,13 8 17,02 6 50,00 29 19,07 Klient: Retraumatisierung 0 0 1 2,13 1 8,33 2 1,32 Logistische Gründe 2 2,15 4 8,51 0 0 6 3,95 dung Kontakt Begrün- 68 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Kein 1 1,08 0 0 0 0 1 0,65 Autonomiewunsch 22 23,66 13 27,66 2 16,66 37 24,34 Belastung f. Angehörige 4 4,30 0 0 0 0 4 2,63 Nicht zutreffend 50 53,76 19 40,43 2 16,66 68 44,73 Kontakt abgebrochen 1 1,07 1 2,13 0 0 2 1,31 Ablehnung Kein Nutzen 0 0 1 2,13 0 0 1 0,65 Angehöriger: Retraumatisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung Logistische Gründe 0 0 0 0 0 0 0 0 Autonomiewunsch 0 0 0 0 0 0 0 0 Profi-Kontakt unerwün. 3 3,22 1 2,13 1 8,33 5 3,23 Nicht zutreffend 92 98,92 44 93,61 11 91,66 144 94,73 Kein Kontakt Unerfüllte Erwartungen Kontakt abgebrochen 0 0 0 0 0 0 0 0 Ablehnung Profi: Kontakt Logistische Gründe 3 3,22 2 4,25 1 8,33 6 3,94 Begründung Kein Nutzen 5 5,38 4 8,51 0 0 9 5,92 Retraumatisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Autonomiewunsch 0 0 0 0 0 0 0 0 Nicht realisierbar 5 5,38 2 4,25 0 0 7 4,60 Noch verfrüht 2 2,15 0 0 0 0 2 1,31 Klient verbietet Kontakt 2 2,15 1 2,13 0 0 3 1,97 Nicht zutreffend 81 87,10 38 80,85 11 91,66 125 82,23 In der Gruppe F2 zeigt sich, dass die Klienten, so sie denn den Kontakt ablehnen, meist als Grund den „Autonomiewunsch“ (24,34%) oder „Kein Nutzen“ (19,07%) angeben. Andere Gründe werden deutlich weniger genannt. In der Gruppe F2 sind lediglich von 7 von 152 Angehörigen der Kontakt abgelehnt worden. 5 (3,23%) nannten den Grund „Kein Kontakt zu Profis gewünscht“. Durch die Professionellen wurde der Kontakt am häufigsten (5,92%) wegen dem Grund „Kein Nutzen“ abgelehnt bzw. nicht aufgenommen. Mit 4,62% wurde als zweithäufigster Grund „Nicht realisierbar“ angegeben. Tabelle 7.17: Mit welcher Begründung wurde der Kontakt abgelehnt? F3-Diagnosen Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 198 n = 84 n = 27 n = 309 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Kein Kontakt abgebrochen 8 4,04 5 5,95 1 3,70 14 4,53 Ablehnung Kontakt Kein Nutzen 34 17,17 18 21,42 4 14,81 56 18,12 Klient: Retraumatisierung 3 1,52 2 2,38 2 7,40 7 2,26 Logistische Gründe 10 5,05 7 8,43 2 7,40 19 6,14 Unerfüllte Erwartungen 4 2,02 0 0 0 0 4 1,29 Autonomiewunsch 45 22,73 30 35,71 12 44,44 87 28,15 Belastung f. Angehörige 1 0,51 1 2,38 0 0 2 0,64 Nicht zutreffend 110 28,06 21 25,00 6 22,22 119 38,51 Kontakt abgebrochen 1 0,51 0 0 0 0 1 0,32 Begrün- dung Kein Kontakt 69 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Ablehnung Kein Nutzen 1 0,51 0 0 0 0 1 0,32 Angehöriger: Retraumatisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung Logistische Gründe 0 0 0 0 0 0 0 0 Autonomiewunsch 0 0 0 0 0 0 0 0 Profi-Kontakt unerwün. 4 2,02 1 2,38 0 0 5 1,61 Nicht zutreffend 192 96,96 83 98,80 27 100,00 302 97,73 Kein Kontakt abgebrochen 0 0 0 0 0 0 0 0 Ablehnung Profi: Kontakt Logistische Gründe 9 4,55 4 4,76 0 0 13 4,20 Begründung Kein Nutzen 23 11,61 7 8,43 3 11,11 33 10,67 Retraumatisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Autonomiewunsch 2 1,01 1 2,38 0 0 3 0.97 Nicht realisierbar 16 8,08 7 8,43 2 7,40 25 8,09 Noch verfrüht 8 4,04 3 3,57 0 0 11 3,55 Klient verbietet Kontakt 8 4,04 9 10,84 3 11,11 20 6,47 Nicht zutreffend 149 75,25 53 63,09 22 81,48 204 66,02 In der Gruppe der F3 wird meist durch die Klienten mit den Gründen „Autonomiewunsch“ (28,15%) und „Kein Nutzen“ (18,12%) der Kontakt abgelehnt. Andere Gründe werden mit weitaus geringerer Häufigkeit genannt. Auch in dieser Gruppe zeigt sich, dass die Angehörigen selbst nur sehr selten (2,27%) den Kontakt ablehnen, wenn dann jedoch auch meist mit dem Grund „Kein Kontakt zu Profis gewünscht“ (1,61%). Profis lehnen in der Gruppe F3 am häufigsten mit dem Grund „Kein Nutzen“ (10,67%) ab. Zweithäufigster Grund ist „Nicht realisierbar“ (8,09%) und „Klient verbietet den Kontakt“ (6,47%). Tabelle 7.18: Mit welcher Begründung wurde der Kontakt abgelehnt? F60.3-Diagnosen Key-Angehöriger Angehöriger II Angehöriger III Gesamt n = 46 n = 29 n=8 n = 83 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Kein Kontakt abgebrochen 1 2,17 1 3,45 0 0 2 2,41 Ablehnung Kein Nutzen 4 8,69 4 13,79 2 25,00 10 12,04 Klient: Retraumatisierung 2 4,34 3 10,34 0 0 5 6,02 Logistische Gründe 2 4,34 4 13,79 0 0 6 7,22 Unerfüllte Erwartungen 1 2,17 1 3,45 0 0 2 2,41 Autonomiewunsch 12 26,09 10 34,48 4 50,00 26 31,33 Belastung f. Angehörige 1 2,17 0 0 0 0 1 1,20 Nicht zutreffend 24 52,17 16 55,17 2 25,00 31 37,35 Kontakt abgebrochen 0 0 1 3,45 0 0 1 1,20 Kontakt Begrün- dung Kein Kontakt 70 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Ablehnung Kein Nutzen 0 0 0 0 0 0 0 0 Angehöriger: Retraumatisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung Logistische Gründe 0 0 0 0 0 0 0 0 Autonomiewunsch 0 0 0 0 0 0 0 0 Profi-Kontakt unerwün. 1 2,17 0 0 0 0 1 1,20 Nicht zutreffend 46 97,83 28 96,55 8 100,00 81 98,79 Kein Kontakt abgebrochen 0 0 0 0 0 0 0 0 Ablehnung Profi: Kontakt Logistische Gründe 0 0 2 6,89 0 0 2 2,41 Begründung Kein Nutzen 5 10,86 3 10,34 0 0 8 9,64 Retraumatisierung 1 2,17 0 0 0 0 1 1,20 Autonomiewunsch 0 0 0 0 0 0 0 0 Nicht realisierbar 2 4,34 1 3,45 0 0 3 3,61 Noch verfrüht 3 6,52 0 0 0 0 3 3,61 Klient verbietet Kontakt 4 8,69 1 3,45 0 0 5 6,02 Nicht zutreffend 32 67,39 22 75,86 8 100,00 61 73,49 In der Gruppe F60.3 lehnen die Klienten mit 62,65% am häufigsten den Kontakt ab. Mit 31,33 % wird auch hier der „Autonomiewunsch“ am häufigsten genannt. Am zweithäufigsten wird auch hier der Grund „Kein Nutzen“ (12,04%) genannt. Durch die Angehörigen wird auch hier nur in 2 Fällen der Kontakt abgelehnt. Die Gründe sind hier entweder „Kontakt zum Klienten abgebrochen“ oder „Kein Kontakt zu Profis gewünscht“. In der Gruppe F60.3 lehnen die Profis mit 9,64% mit dem Grund „Kein Nutzen“ am häufigsten den Kontakt ab. Auch hier zeigt sich, dass mit 6,02% der zweithäufigste Grund „Klient verbietet den Kontakt“ ist. Mit jeweils 3,61% werden die Gründe „Nicht realisierbar“ oder „noch verfrüht“ genannt. Tabelle 7.19: Mit welcher Begründung wurde der Kontakt abgelehnt? Im Vergleich aller Diagnosen F2 F3 n = 152 F60.3 n = 309 Gesamt n = 83 n = 544 Merkmal Merkmalsausprägung [n] [%] [n] [%] [n] [%] [n] [%] Kein Kontakt abgebrochen 5 3,28 14 4,53 2 2,41 21 3,86 Ablehnung Kein Nutzen 29 19,07 56 18,12 10 12,04 95 17,46 Klient: Retraumatisierung 2 1,32 7 2,26 5 6,02 14 2,57 Logistische Gründe 6 3,95 19 6,14 6 7,22 31 5,69 Unerfüllte Erwartungen 1 0,65 4 1,29 2 2,41 7 1,29 Autonomiewunsch 37 24,34 87 28,15 26 31,33 150 27,57 Belastung f. Angehörige 4 2,63 2 0,64 1 1,20 7 1,29 Nicht zutreffend 68 44,73 119 38,51 31 37,35 219 40,25 Kontakt abgebrochen 2 1,31 1 0,32 1 1,20 4 0,74 Kontakt Begrün- dung Kein Kontakt 71 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Ablehnung Kein Nutzen 1 0,65 1 0,32 0 0 2 0,37 Angehöriger: Retraumatisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung Logistische Gründe 0 0 0 0 0 0 0 0 Autonomiewunsch 0 0 0 0 0 0 0 0 Profi-Kontakt unerwün. 5 3,23 5 1,61 1 1,20 11 2,02 Nicht zutreffend 144 94,73 302 97,73 81 98,79 527 96,86 Kein Kontakt abgebrochen 0 0 0 0 0 0 0 0 Ablehnung Profi: Kontakt Logistische Gründe 6 3,94 13 4,20 2 2,41 21 3,86 Begründung Kein Nutzen 9 5,92 33 10,67 8 9,64 50 9,19 Retraumatisierung 0 0 0 0 1 1,20 1 0,18 Autonomiewunsch 0 0 3 0.97 0 0 0 0 Nicht realisierbar 7 4,60 25 8,09 3 3,61 35 6,43 Noch verfrüht 2 1,31 11 3,55 3 3,61 15 2,76 Klient verbietet Kontakt 3 1,97 20 6,47 5 6,02 28 5,15 Nicht zutreffend 125 82,23 204 66,02 61 73,49 394 72,42 Im Vergleich der Gruppen zeigt sich, dass in der Gruppe der F60.3 die Klienten häufiger mit dem Grund „Autonomiewunsch“ (31,33%) den Kontakt ablehnen als die beiden Vergleichsgruppen. Der Grund “Retraumatisierung“ wird in der Gruppe F60.3 mit 6,02% von den Klienten häufiger genannt als in der Gruppe F2 (1,32%) oder der Gruppe F3 (2,26%). Die Ablehnung durch die Angehörigen ist über die Gruppen hinweg sehr selten. Lediglich in der Gruppe F2 wird der Kontakt zu den Profis mit 3,23% häufiger als in den anderen Gruppen angegeben. Bei Ablehnung durch die Profis zeigt sich als häufigster Grund „Kein Nutzen“ in allen Gruppen (9,19%), in der Gruppe F2 wird dieser jedoch mit 5,92% seltener genannt als in der Gruppe F3 (10,67%) und der Gruppe F60.3 (9,64%). 8 Ergebnisse Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse der Datenanalyse in Zusammenhang zu den aufgestellten Hypothesen gesetzt werden. 8.1 Hypothese 1 Die Qualität des Kontaktes der Klienten zum Angehörigen selbst unterscheidet sich bei Patienten mit einer F60.3 von denen von Patienten mit F2 oder F3 Diagnosen. (komplette Auswertung siehe Anhang Stat-up, S. 25ff) 72 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Aufgrund der in der Literatur (Sansone, Sansone, 2009, S19 ff) beschriebenen Merkmale der Familien von Betroffenen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung lässt sich annehmen, dass dadurch der Kontakt zu den Betroffenen schlechter ist, als bei den Angehörigen von Patienten mit F2- oder F3-Störungen. Es zeigen sich signifikant höhere Raten von Depressionen, Substanzmissbrauch und dissozialen Charakterzügen bei Angehörigen von BorderlinePatienten im Vergleich zu nicht psychiatrischen Patienten. Im Vergleich zu Angehörigen mit anderen Persönlichkeitsstörungen und Angehörigen von schizophren erkrankten Menschen zeigt sich ein erhöhtes Risiko für affektive oder impulsive Störungen. Insgesamt wurden die Angehörigen von Borderline-Patienten eher negativ beschrieben. Diese beschriebenen Merkmale lassen darauf schließen, dass der Kontakt von den Klienten selbst bei den Patienten mit einer Borderline-Störung als weniger unterstützend beschrieben werden, als in den Vergleichsgruppen F2 und F3. Abb. 8.1: Abhängigkeit des Kontaktes zu den Key-Angehörigen, Angehörigen II und Angehörigen III zueinander (siehe Anhang stat-up, S. 25) Der Spearman Korrrelationskoeffizient zeigt, dass die Antworten bezüglich der Frage: „Wie wird der Kontakt zu den Angehörigen vom Klienten selbst beschrieben?“ zwischen dem KeyAngehörigen, dem Angehörigen II und dem Angehörigen III in einen signifikant positiven Zusammenhang stehen. Wenn der Kontakt zu einem Angehörigen als gut eingeschätzt wird, dann ist die Einschätzung bezüglich des Kontaktes zu den anderen Angehörigen auch eher positiv. Dies verhält sich bei einer negativen Einschätzung ebenso. Es scheint also so, dass 73 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? jeder Klient ein individuelles Level hat, wie er die Angehörigenkontakte einschätzt welches von der Diagnose erstmal unabhängig ist. Abb. 8.2: Mittelwert der Einschätzung bezüglich der Frage: „Wie wird der Kontakt zum Angehörigen vom Klienten beschrieben?“ der drei Angehörigen pro Klient (siehe Anhang stat-up, S. 27) Der Boxplot zeigt, dass der Mittelwert in den drei Vergleichsgruppen bei 3 liegt. Jedoch ist die Streuung bei der Gruppe F2 eher nach oben in Richtung „hilfreich“ verschoben, d.h. der Kontakt tendenziell eher positiv bewertet. In der Gruppe F3 ist die Streuung ziemlich gleichmäßig, bei der Gruppe F60.3 jedoch verlagert sich die Streuung eher in Richtung „wenig hilfreich“. Dies zeigt auch die statistische Berechung mittels einem logistischen gemischten Modell. Die Einschätzung in der Gruppe F2 unterscheidet sich von der Gruppe F60.3, die Gruppe F3 unterscheidet sich jedoch nicht von der Gruppe F60.3. In der Gruppe F2 ist die Chance auf einen „eher unterstützenden oder unterstützenden“ Kontakt zum Angehörigen um den Faktor 876 höher als in der Gruppe F60.3. Die Hypothese 1 konnte durch die statistischen Berechungen also bestätigt werden, d.h. die Borderline-Patienten bewerten den Kontakt zu ihren Angehörigen signifikant (p=0.045) belastender als die Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung. Bei Patienten mit einer affektiven Störung hingegen gibt es keinen Unterschied (p=0.640). 8.2 Hypothese 2 Die Einschätzung der Profis über die Qualität des Kontaktes der Klienten zu den Angehörigen und auch die Bewertung des eigenen Kontaktes zu den Angehörigen aus Sicht der Pro- 74 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? fis bei Borderline-Patienten unterscheidet sich von der Bewertung und Einschätzung zu F2 und F3-Diagnosen. (komplette Auswertung siehe Anhang stat-up, S. 30 ff) Aufgrund der Annahme von Hypothese 1 wurde vermutet, dass die Profis den Kontakt zu den Angehörigen von Patienten mit einer Borderline-Störung belastender einschätzen, als bei den Patienten mit einer F2- oder F3-Störung. Abb 8.3: Korrelationen bezüglich der Frage „Wie wird der Kontakt vom Klienten zum Angehörigen aus Therapeutensicht eingeschätzt?“ (siehe Anhang stat-up, S. 30) Die Antworten auf die Frage „Wie schätzen Sie den Kontakt zum Angehörigen aus Klientensicht ein?“ stehen bezüglich des Key-Angehörigen, des Angehörigen II und des Angehörigen III in einem signifikant positiven Zusammenhang zueinander. Wenn also der Kontakt zu einem Angehörigen als eher unterstützend eingeschätzt wird, so ist dies bei den weiteren Angehörigen eher der Fall. Dies entspricht der Einschätzung des Kontaktes von den Klienten direkt zu den Angehörigen. 75 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Abb. 8.4: Mittelwert der Einschätzung bezüglich der Frage: „Wie wird der Kontakt zum Angehörigen vom Therapeuten bewertet?“ der drei Angehörigen pro Klient (siehe Anhang stat-up, S. 32) Hier zeigt der Boxplot einen Mittelwert, der bei 3 liegt. Die Streuung ist ebenfalls bei den F2Diagnosen eher in Richtung „unterstützend“, bei den F3-Diagnosen relativ gleichmäßig verteilt und bei den F60.3-Diagnosen ist die Streuung eher in Richtung „belastend“ gewichtet. Die Berechnung einer möglichen Abhängigkeit mittels dem logistischen gemischten Modell zeigt, dass trotz der ungleichmäßigen Streuung, kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Bewertung der Qualität des Kontaktes vom Klienten zu den Angehörigen aus Therapeutensicht und der Hauptdiagnose (bei F2 p=0,150, bei F3 p=0.975) besteht. Hinsichtlich der Frage:„Wie schätzen Sie den Kontakt zum Angehörigen aus Ihrer Sicht hinsichtlich der Betreuung des Klienten ein?“ zeigt der Boxplot, dass der Median bei den F2und F3-Diagnosen bei 1 („hilfreich“) und bei den F60.3 bei 2 („eher hilfreich“) liegt. 76 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Abb. 8.5: Median bezüglich der Frage: „Wie sehen Sie den Kontakt zu dem Angehörigen aus Ihrer Sicht hinsichtlich der Betreuung der Klienten?“ (siehe Anhang stat-up, S. 36) Hier zeigt sich, dass die Streuung bei den F2 und den F3-Patienten meist von „hilfreich“ bis „eher hilfreich“ liegt. Bei den F60.3-Patienten liegt der Median mit 2 am ehesten bei „eher hilfreich“, die Streuung ist jedoch sowohl in Richtung „hilfreich“ als auch in Richtung „weniger hilfreich verteilt“. Dies zeigt, dass bei den F2- und F3-Diagnosen der direkte Kontakt zu den Angehörigen als tendenziell positiver eingeschätzt wird. Aufgrund geringer Angaben bei den Angehörigen II und III kann hier lediglich eine aussagekräftige Angabe zum Key-Angehörigen gemacht werden. Das logistische gemischte Modell ist hier nicht geeignet. Der Kruskal-Wallis-Test zeigt für den Key-Angehörigen mit einem p-Wert von 2,368 keine Abhängigkeit zwischen der Bewertung des direkten Kontaktes zu den Angehörigen durch die Profis und der Hauptdiagnose des Klienten. Aufgrund der statistischen Berechnungen lässt sich Hypothese 2 nicht bestätigen. Es zeigt sich, dass die Einschätzung des Kontaktes vom Klienten zu den Angehörigen aus Therapeutensicht unabhängig ist von der Hauptdiagnose des Klienten. Ebenfalls unabhängig von der Hauptdiagnose ist die Einschätzung des direkten Kontaktes zu den Angehörigen aus Therapeutensicht hinsichtlich der Betreuung des Klienten. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass lediglich zum Key-Angehörigen eine Aussage getroffen werden kann. Die Vermutung, dass aufgrund der beschriebenen Eigenschaften von Angehörigen von Borderline-Patienten der Kontakt vom Therapeuten negativer bewertet wird und der direkte Kontakt sich schwieriger gestaltet, kann also nicht bestätigt werden. 8.3 Hypothese 3 Angehörige von Patienten mit einer F60.3 werden seltener kontaktiert als Angehörige von Patienten mit einer F2 oder F3-Störung. (komplette Auswertung siehe Anhang stat-up, S. 41 ff) Aufgestellt wurde diese Hypothese, daß es in der praktischen Arbeit so scheint, als das zu den Angehörigen von F2- oder F3-Patienten häufiger Kontakt besteht als zu den Anghörigen der Borderline-Patienten. 77 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Hinsichtlich der Quantität, zeigt der Chi-Quadrat-Test mit einem p-Wert von 0,466, dass es keine Abhängigkeit zwischen dem Vorhandensein eines Kontaktes von Vincentro zum Angehörigen bezogen auf alle Angehörigen und der Hauptdiagnose gibt. Auch hinsichtlich der Häufigkeit eines Kontaktes von Vincentro zum Angehörigen pro Klient besteht keine Abhängigkeit zur Hauptdiagnose des Klienten. Dies zeigt der Chi-Quadrat-Test mit einem p-Wert von 0,525. Abschließend lässt sich sagen, dass es keinen Unterschied bezüglich des Vorhandenseins des Kontaktes zu den Angehörigen und auch bezüglich der Anzahl der Kontakte zwischen den Gruppen F2, F3 und F60.3 gibt. Die Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Es besteht also kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Hauptdiagnose und der Häufigkeit des Kontaktes bzw. der Anzahl des Kontaktes von Vincentro zu den Angehörigen. Die Angehörigen werden unabhängig von der Diagnose des Patienten gleich häufig kontaktiert. 8.4 Hypothese 4 Die Gründe für die Nichteinbeziehung der Angehörigen von F 60.3-Patienten unterscheiden sich von denen bei Klienten mit einer F 2 oder F3-Störung. (komplette Auswertung siehe Anhang stat-up, S. 46 ff) Zu den Gründen für eine Nicht-Einbeziehung der Angehörigen von Borderline-Patienten konnte keine Literatur gefunden werden. Aus der praktischen Erfahrung entwickelte sich die Hypothese, dass aufgrund der schwierigen familiären Verhältnisse und der möglichen Missbrauchserfahrungen bei Borderline-Patienten auch die Gründe für die Nicht-Einbeziehung der Angehörigen sowohl aus Klienten-, aus Angehörigen- und aus Profisicht sich diagnosenspezifisch unterscheiden. Die statistische Auswertung zeigt, dass kein signifikanter Zusammenhang bezüglich des Grundes der Ablehnung des Kontaktes vom Profi zum Angehörigen und der Hauptdiagnose besteht. Dies gilt sowohl bei Betrachtung für alle Angehörigen gemeinsam (p=0.516), als auch bei getrennter Betrauchtung für Key-Angehörige (p=0,322), Angehörige II (p=0,627) und Angehörige III (p=0,365). Bei genauerer Betrachtung der Daten zeigt sich jedoch, dass insgesamt die Gründe „Autonomiewunsch“ und „Kein Nutzen erwartet“ über alle Diagnosen und alle Angehörigen am meisten als Grund für eine Nicht-Einbeziehung angegeben wurden. Bei der Gruppe F60.3 ist 78 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? der „Autonomiewunsch“ im Verhältnis zur Anzahl der Angaben häufiger angegeben als in den Gruppen F2 und F3. Bei Ablehnung des Kontaktes durch die Angehörigen kann aufgrund einer sehr geringen Anzahl der Antworten (17) keine verallgemeinerbare Aussage getroffen werden. Der ChiQuadrat-Test ergibt für die gegebenen Antworten einen p-Wert von 0,678 für alle Angehörigen gemeinsam und zeigt somit keine Abhängigkeit. Für die einzelnen Angehörigen zeigt der Chi-Quadrat-Test keine Abhängigkeiten für den Key-Angehörigen (p= 0,868), für den Angehörigen II (p= 0,504). Zum Angehörigen III wurde keine Angabe gemacht. Bei den Gründen der Profis für die Nicht-Einbeziehung der Angehörigen ergibt sich ebenfalls für alle Angehörigen gemeinsam kein signifikanter Zusammenhang (p=0,473). Für den KeyAngehörigen (p=0,414) und für den Angehörigen II (p=0,807) lässt sich ebenfalls kein signifikanter Zusammenhang mit der Hauptdiagnose des Klienten berechnen. Für den Angehörigen III berechnet der Chi-Quadrat-Test mit einem p-Wert von 0,029 einen signifikanten Zusammenhang, welcher aber aufgrund der geringen Anzahl der Antworten (9) nicht verallgemeinerbar ist. Es zeigt sich also, dass es für alle Angehörigen gemeinsam und auch für alle Angehörigen getrennt betrachtet keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Grund der Ablehnung, sowohl vom Klienten, als auch vom Angehörigen und vom Profi, und der Hauptdiagnose des Klienten gibt. Die statistische Analyse der Daten zeigt, dass Hypothese 4 nicht bestätigt werden konnte. Trotz der besonderen Familienverhältnisse der Borderline-Patienten zeigt sich kein signifikanter Unterschied zu den Vergleichsgruppen F2 und F3. Besonders wichtig erscheint es hierbei, dass der angenommene Grund „Retraumatisierung“ nicht besonders in der Anzahl seiner Angabe hervorsticht. 8.5 Hypothese 5 Die psychische Erkrankung der Angehörigen spiegelt sich in der Qualität des Kontaktes zu den Klienten und den Therapeuten wieder. (komplette Auswertung siehe Anhang stat-up, S. 54 ff) Aufgrund der praktischen Erfahrungen wird vermutet, dass der Kontakt zu einem selbst psychischen Erkrankten aufgrund der eigenen Belastung des Angehörigen belastender sein 79 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? könnte. Ebenso wäre es möglich, dass aufgrund der Erkrankung des Angehörigen mehr Verständnis für den Klienten vorhanden ist und der Kontakt somit eher positiv ist. Vorab zeigt ein logistisches gemischtes Modell, dass es mit einem p-Wert von 0,000 eine signifkant höhrere Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Kontakt von Vincentro zum Angehörigen „hilfreich“ ist, wenn der Kontakt vom Klienten zum Angehörigen als „unterstützend“ und nicht als „belastend“ eingeschätzt wird. Betrachtet man lediglich den Zusammenhang zwischen den psychisch erkrankten Angehörigen und der Einschätzung des Kontaktes zum Klienten und zu Vincentro zeigt der ChiQuadrat-Test einen p-Wert von 0,127; d.h. es besteht keine Abhängigkeit. Hier ist zu beachten, dass nur 20 Angehörige einbezogen werden konnten. Abb. 8.6: Abhängigkeit zwischen der Einschätzung des Kontaktes der Angehörigen zum Klienten und des Kontaktes zu Vincentro bei nicht psychisch erkrankten Angehörigen (siehe Anhang stat-up, S. 58) 80 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Bei den nicht psychisch erkrankten Angehörigen zeigt der Chi-Quadrat-Test mit einem pWert <0,000 eine Abhängigkeit zwischen der Einschätzung des Kontaktes der Klienten zum Angehörigen und der Einschätzung des Kontaktes von Vincentro zum Angehörigen. Insgesamt lässt sich aus statistischer Sicht kein allgemeines Fazit ziehen, da die Berechnungen zu instabilen statistischen Auswertungen führen. Für die erkrankten Angehörigen ergibt sich im Chi-Quadrat-Test mit einem p-Wert von 0,127 keine Abhängigkeit, das logistische gemischte Modell jedoch ergibt mit einem p-Wert von 0,000 eine Abhängigkeit. Wie bereits erwähnt konnten hier lediglich 20 Personen in die Berechnung einbezogen werden. Da der p-Wert des Chi-Quadrat-Test mit 0,127 relativ niedrig ist, hätte bei einer größeren Stichprobe eventuell auch eine Abhängigkeit gezeigt werden können. Für die nicht erkrankten Angehörigen ergibt der Chi-Quadrat-Test mit einem p-Wert von 0,000 eine Abhängigkeit. Das logistische gemischte Modell jedoch lässt sich nicht berechnen, da zwar 69 Angaben einbezogen werden können, diese jedoch sehr ungleich in den Gruppen verteilt sind. Deshalb ist für diese Hypothese lediglich eine deskriptive Aussage möglich, wie sie bereits in den Punkten 6.5 und 6.6 dargestellt wurde. 9 9.1 Diskussion Methodische Aspekte Aufgrund der Stichprobe, welche nur aus Versicherten der Techniker Krankenkasse besteht, ist die externe Validität, wie bereits im Punkt 6.2.4.2 beschrieben, in dieser Untersuchung eingeschränkt. Auch, wie bereits im selben Punkt erläutert, trägt der relativ hochschwellige Zugang zur Integrierten Versorgung zu einer Selektion der Klienten bei. Aufgrund dieser Einschränkungen, was die externe Validität angeht, ist diese Untersuchung eher als eine PilotStudie zu sehen, aus deren Ergebnissen weitere Untersuchungen mit einer anderen Stichprobe folgen müssten, um ein verallgemeinerbares Ergebnis zu erhalten. Auch wurde, wie in Punkt 6.2.4 bereits erwähnt, eine mögliche Medikamenteneinnahme der Klienten nicht erhoben. Dieser Faktor wäre im Falle weitere Untersuchungen eventuell mit einzubeziehen, da es vorstellbar wäre, dass sich durch einen besseren psychopathologischen Zustand der Klienten auch die Beziehung zu den Angehörigen verändert. Ebenfalls ist zu betonen, dass in den Anamnesegesprächen mit den Klienten die psychische Erkrankung der Angehörigen nicht standardmäßig abgefragt wird und somit eventuell gar nicht davon berichtet wird. Die dadurch geringeren Angaben könnten Einfluss auf das Ergeb81 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? nis der Hypothese 5 haben, welche aufgrund geringer Anzahl nicht berechnet werden konnte. Die Reliabilität (siehe Punkt 6.2.5) ist in der Untersuchung eingeschränkt, was die Einschätzung der Qualität des Kontaktes zu den Angehörigen angeht, da sich diese auf die subjektive Einschätzung der Mitarbeiter stützt. Insgesamt ist die interne Validität als besser einzuschätzen, als die externe Validität oder die Reliabilität. Die Untersuchung beantwortet in ausreichendem Maße die Fragestellung der Arbeit, sie ist jedoch aufgrund oben aufgeführter Einschränkungen nicht verallgemeinerbar. 9.2 Stichprobe Die Stichprobe der F60.3-Störungen unterscheidet sich teilweise deutlich von denen der beiden Vergleichsgruppen F2 und F3. Die Klienten mit einer F60.3 sind signifikant häufiger jünger und auch häufiger weiblich (siehe Tabelle 7.1). Auffällig ist jedoch, dass genau für diese Gruppe die längste Erkrankungsdauer angegeben wird (siehe 7.4), d.h. die Klienten sind deutlich jünger jedoch trotzdem schon sehr viel länger erkrankt als die Klienten mit einer F2und F3-Störung. Die Klienten mit einer Borderline-Störung beziehen weniger häufig Gehalt als die Klienten in den Vergleichsgruppen, in dieser Gruppe werden häufiger Sozialleistungen bezogen (siehe Tabelle 7.2). Dier CGI liegt in der Gruppe F60.3 am häufigsten bei 5 „deutlich krank“ (25,5%) und 6 „schwer krank“ (21,3%), das Mittel jedoch lediglich bei 4,45. Auch statistisch konnte hier eine Abhängigkeit gefunden werden (siehe Punkt 7.2). Möglicherweise ist die Schwere der Erkrankung bei den Klienten mit einer Borderline-Störung der Grund dafür, dass sie häufiger Sozialleistungen beziehen, was hinsichtlich des Alters der Klienten doch mit Sorge zu betrachten ist. Ebenfalls in der Gruppe F60.3 häufiger vorzufinden sind häufigere Suizidversuche (siehe Tabelle 7.4). Dies ist auch zurückzuführen auf das von Bohus (2002) beschriebene häufige selbstverletzende Verhalten, welches in den anderen beiden Diagnosengruppen nicht so häufig vorkommt. Auch dieser Zusammenhang ist signifikant. Hinsichtlich der aktuellen Betreuungs- und Therapiesituation ist es mit Sicherheit am auffälligsten, dass die Klienten mit einer F60.3-Störung signifikant am häufigsten in Psychotherapie sind. Dies widerspricht hingegen der Annahme, wie sie in der Praxis oft angetroffen wird, wie schwierig es für Borderline-Klienten ist einen Psychotherapeuten zu finden. Als positiv anzu82 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? sehen ist die mit 89,4% doch sehr häufige Anbindung an fachpsychiatrische Behandlung (siehe Tabelle 7.5) Zu dem Vorhandensein von Angehörigen insgesamt lässt sich sagen, dass wie möglicherweise aufgrund der Schwere der Erkrankung oder der langen Erkrankungsdauer, anzunehmen gewesen wäre, bei den Klienten mit einer Borderline-Störung nicht weniger Angehörige vorzufinden. Deskriptiv sind es bei den F60.3-Störungen sogar ein wenig mehr Angehörige im Durchschnitt, dieses Ergebnis ist jedoch nicht statistisch signifikant. Bezüglich des persönlichen Verhältnisses der Angehörigen zu den Klienten (siehe Tabelle 7.7) lässt sich sagen, dass über alle Diagnosengruppen hinweg Mütter und Partner am häufigsten genannt wurden. Die Mütter sind jedoch besonders in der Gruppe der Borderline-Störungen deutlich überrepräsentiert. Auch sind in dieser Gruppe sehr viel häufiger Väter als Angehörige genannt, als in den beiden anderen Gruppen. Dies verdeutlicht meiner Ansicht nach nochmal wie wichtig die Einbeziehung der Angehörigen ist, da die Eltern scheinbar doch, neben den Partnern, trotz der Schwierigkeiten welche in Punkt 5 ausführlich beschrieben wurden, die engsten Angehörigen sind. Die sollte vor allem vor dem Hintergrund der schlechteren Bewertung des Kontaktes zu den Angehörigen bei den F60.3-Störungen gesehen werden. Laut Sansone et al (2009) sind die Angehörigen von Patienten mit einer Borderline-Störung signifikant häufiger von Depressionen und Substanzmissbrauch betroffen. Dies kann auch für diese Stichprobe teilweise bestätigt werden, da sich in der Gruppe F60.3 häufiger F1Diagnosen bei den Angehörigen zeigen (siehe Tabelle 7.11). Insgesamt zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der Hauptdiagnose des Klienten und dem Vorhandensein einer psychischen Erkrankung beim Angehörigen. Dieses Ergebnis bezieht sich jedoch nicht auf die einzelnen Diagnosen der Angehörigen, was durchaus interessant wäre nochmal zu untersuchen. 9.3 Hypothese 1: In Hypothese 1 wurde angenommen, dass die Hauptdiagnose sich in der Qualität des Kontaktes der Angehörigen zum Klienten widerspiegelt. Hier konnte nur gezeigt werden, dass ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe F2 und der Gruppe F60.3 besteht. Die Gruppe F3 unterscheidet sich nicht von der Gruppe F60.3. Der Kontakt der BorderlinePatienten zu ihren Angehörigen wird also signifikant schlechter beschrieben, als der schizo83 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? phrenen Patienten. Dies könnte auf die von Sansone und Sansone (2009) beschriebenen erhöhten Raten von Depressionen, Suchterkrankungen (auch in Punkt 7.4) und dissozialen Charakterzüge zurückzuführen sein. Ob die aufgeführten Eigenschaften der Angehörigen von Menschen mit einer Borderline-Störung die Gründe für den eher belastenden Kontakt sind, lässt sich nur vermuten, da dieser Zusammenhang nicht überprüft wurde. Möglicherweise spielt hier auch die Erkrankungsdauer der Klienten eine Rolle, da die Borderline-Patienten dieser Stichprobe häufig schon deutlich länger erkrankt sind, als die Patienten in den beiden Vergleichgsgruppen (siehe 7.2). Nicht erklären lässt sich jedoch der nicht vorhandene Unterschied zwischen den F60.3 und den F3-Störungen. Gerade weil die Angehörigenkontakte deutlich schlechter bewertet werden (bei den F2Störungen ist die Wahrscheinlichkeit eines positiv bewerteten Kontaktes um den Faktor 876 höher), erscheint die Einbeziehung umso wichtiger. Wie bereits beschrieben sind Stressreduktion und ein niedrigeres High-Expressed-Emotions-Level wichtig um die Rückfallraten zu senken. Auch die Tatsache, dass wie von Pitschel-Walz und Bäuml (2007b) beschrieben, viele Klienten nach einem stationären Aufenthalt wieder mit ihren Angehörigen zusammenleben unterstreicht besonders bei einer negativen Bewertung des Kontaktes von den BorderlinePatienten die Notwendigkeit der Einbeziehung der Angehörigen. Vor allem da diese Untersuchung gezeigt hat, dass 40,6% der Borderline-Patienten dieser Stichprobe in einer Partnerschaft leben oder verheiratet sind. Allgemein kann jedoch ein bestimmtes Grundlevel der Bewertung des Kontaktes der Klienten zu den Angehörigen (siehe Punkt 8, Hypothese 1) gesehen werden, d.h. wer den KeyAngehörigen eher positiv bewertet, tut dies auch beim Angehörigen II und Angehörigen III. Dies gilt auch umgekehrt. 9.4 Hypothese 2 Zur Bewertung der Qualität des direkten Kontaktes der Profis zu den Angehörigen konnte keine Literatur gefunden werden. In der Praxis stellt es sich jedoch teilweise so dar, dass die Angehörigen von Patienten mit einer Borderline-Störung als schwieriger bzw. belastender angesehen werden. Von besonderer Bedeutung ist es jedoch, dass zwischen der Einschätzung des Kontaktes des Klienten zum Angehörigen durch den Profi und auch bezüglich der Einschätzung des eigenen 84 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Kontaktes zum Angehörigen und der Hauptdiagnose kein signifikanter Zusammenhang besteht. Dies zeigt, dass die von Rentrop (2007) für die Psychoedukation geforderte Neutralität der Therapeuten gegeben ist. Dies ist mit Sicherheit eine wesentliche Grundvorraussetzung für eine gute Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Klienten mit einer BorderlineStörung unabhängig davon, ob diese im Rahmen der Psychoedukation stattfindet. Auch wird dies durch die Tatsache bestätigt, dass wenn Kontakt zu den Angehörigen besteht, dieser bei den F60.3-Störungen nicht schlechter bewertet wird, als bei den beiden anderen Gruppen. Diese beiden Ergebnisse sprechen für eine hohe Professionalität der Therapeuten, denn obgleich die Borderline-Patienten (Hypothese 1) ihre Angehörigen deutlich schlechter bewerten, haben die Therapeuten die notwendige fachliche Distanz um auch mit diesen Angehörigen gut zusammen zu arbeiten. 9.5 Hypothese 3 Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass in allen Diagnosengruppen die Angehörigen wenig kontaktiert wurden. Bei den F2-Störungen waren es lediglich 23%, bei den F3-Störungen 18,1% und bei den F60.3-Störungen 18,07%, wobei anzumerken ist, dass es keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Anzahl der Angehörigen in den verschiedenen Gruppen gibt. Grundsätzlich widerspricht diese Tatsache den Empfehlungen der meisten Therapiekonzepte. Schmid et al. (2005) beschreibt eine Reduktion der High-Expressed-Emotions, Rentrop (2007) die Reduktion von Stress und damit verbunden die Reduktion von stationären Aufenthalten. Dies wäre besonders in der Gruppe der Borderline-Patienten von Bedeutung, da die Untersuchung gezeigt hat, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Diagnose und der Anzahl der stationären Aufenthalte gibt und die hohe Anzahl der stationären Aufenthalte bei den F60.3-Störungen zunimmt. Dies wird bestätigt durch die Aussage von Rentrop (2007), dass zwar nur 10% aller psychiatrischen Patienten eine F60.3-Störung diagnostiziert bekommen, jedoch 20% aller stationär behandelten Patienten so diagnostiziert ist. Von Ihnen werden innerhalb eines Jahres 80% erneut stationär aufgenommen. Dies wird auch durch diese Untersuchung bestätigt (Siehe Punkt 7). Auch hier finden sich 11,3% der Klienten mit einer Borderline-Störung, diese zeigen jedoch die meisten Klinikaufenthalte insgesamt, was jedoch nur für die psychiatrischen Klinikaufenthalte statistisch signifikant ist. (siehe Tabelle 7.4) 85 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? Besonders wichtig erscheint die geringe Einbeziehung der Angehörigen im Rahmen der Integrierten Versorgung jedoch vor dem Hintergrund, dass dies, wie von Ruprecht (2010) beschrieben, ein grundlegender Ansatz des Konzeptes ist, welches im Sinne des Need-AdaptedTreatment formuliert ist. Aderhold und Greve (2010) beschreiben hier auch explizit die Notwendigkeit der Einbeziehung der Angehörigen und auch das Ziel den Dialog zwischen Klient und Angehörigem zu fördern. Von Sydow et al. (2007) beschreiben, dass es besonders für die Familientherapie kaum Kontraindikationen gibt, was dann auch den allgemeinen Einbezug der Angehörigen gilt. All diese Erkenntnisse, sowohl aus der Literatur wie auch aus der Untersuchung heraus, sprechen für eine vermehrte Einbeziehung der Angehörigen. Die Ergebnisse aus Hypothese 2 können keine Erklärung für die Nicht-Einbeziehung sein, da die Angehörigenkontakte, wenn vorhanden, überwiegend positiv bewertet werden (siehe Punkt 7.5). 9.6 Hypothese 4 Besonders interessant scheint es daher, die Gründe für die Nicht-Einbeziehung der Angehörigen näher zu betrachten. .Vorab ist zu sagen, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Hauptdiagnose und dem Grund für die Nicht-Einbeziehung der Angehörigen besteht. Deskriptiv lassen sich aber durchaus einige interessante Merkmale erkennen. Trotzdem, dass Bohus (2002) und Reich und Cierpka (2011) von häufiger sexueller Gewalterfahrung bei Borderline-Patienten sprechen, wird nur 4-mal die Angabe gemacht, dass einer der Angehörigen der „Täter“ (siehe Punkt 7.4) ist. Bei den Borderline-Störungen wurde die Diagnose F43.1 jedoch deutlich häufiger als Zweit- oder Drittdiagnose angegeben, als in den beiden anderen Vergleichsgruppen (siehe Punkt 7.2). Dies kann einerseits dafür sprechen, dass die Täter nicht mehr im Kontakt zu den Klienten stehen bzw. von diesen nicht mehr als Angehörige angebeben werden, oder aber es wird den Therapeuten nicht davon berichtet das die vorhandenen Angehörigen auch „Täter“ sind. Gegen letztere Erklärung spricht jedoch das Ergebnis, dass es wie in Hypothese 1 beschrieben, eher ein bestimmtes Level gibt was die Bewertung des Kontaktes zu den Angehörigen durch die Klienten gibt was über alle drei Angehörigen hinweg konstant bleibt. Es zeigt auch, passend zur geringen Angabe von Tätern als Angehörige, dass der Grund „Retraumatisierung“ über alle Diagnosengruppen nicht sehr häufig (2,26%) angegeben wurde (siehe Punkt 7.5). Bei der Borderline-Störung wurde dieser Grund mit 6,02% ein wenig häufiger angegeben. Dies spricht jedoch nicht unbedingt dafür, 86 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? die Angehörigen nicht mit einzubeziehen, sondern lediglich hier mit größerer Vorsicht heranzugehen als in den anderen Diagnosengruppen. Am häufigsten wurde der Grund (siehe Punkt 7.5) „Autonomiewunsch des Klienten“ (27,57%) genannt. Auch der Grund „Kein Nutzen“ wurde von Klientenseite mit 17,46% häufig genannt. Von den Profis wurde der Grund „Kein Nutzen“ mit 9,19% am häufigsten angegeben. Dies scheint jedoch aus unterschiedlichen Gründen keine stichhaltige Begründung für die Nicht-Einbeziehung. Die von Schmid et al (2003) beschriebenen Belastungen der Angehörigen (siehe Punkt 3.1), wie Ängste, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, die Angst vor einem Rückfall usw. sind von Seiten der Angehörigen zu nennen. Aber auch die Verbesserung der Emotionsregulation, die verbesserte Kommunikation wie sie im Family Skills Training (siehe Punkt 4.2) von Hoffmann et al. (1999) beschrieben wird und die von Rentrop (2007) genannte Stressreduktion (siehe Punkt 4.3) sind Gründe dafür, dass die Einbeziehung der Angehörigen durchaus von Nutzen ist. Laut Reich und Cierpka (2011) gibt es Hinweise darauf, dass eine ausgeprägte widersprüchliche elterliche Kommunikation in den Familien von Patienten mit einer Borderline-Störung gibt, welche möglicherweise durch die Einbeziehung der Angehörigen verbessert werden könnte. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Familienmitglieder welche an einer Borderline-Störung erkranken, diese Familiendynamik mit beeinflusst haben. Die Gründe „Noch nicht realisierbar“ oder „Noch verfrüht“ wurden mit gemeinsam 9,19% von den Profis doch oft angeben. Dies widerspricht jedoch dem von Hoffmann et al. (1999) beschriebenen DBT-Family Skills Training. Dieser beschreibt hier, dass die Einbeziehung der Angehörigen so früh wie möglich erfolgen soll. Dies kann auch die Rezidivrate der Klienten verringern. Auch wurden in diese Untersuchung nur Klienten einbezogen, welche sich vor dem 01.07.2012 in die Integrierte Versorgung eingeschrieben haben, sodass schon mehrere Monate Kontakt zum Klienten bestand. Deutlich wird hier, dass die Frage ob die Einbeziehung der Angehörigen einen Nutzen hat, wissenschaftlich positiv belegt ist, dies jedoch in der praktischen Arbeit häufig nicht so gesehen wird. Auch ist als Ergebnis mitzunehmen, dass mit den Klienten thematisiert werden sollte, was sie dazu bringt den Kontakt abzulehnen und hier die Ängste und Sorgen der Klienten ernst zu nehmen. Bei den Borderline-Patienten könnte natürlich hier die von Sansone und Sansone (2009) beschriebenen negativen Merkmale der Angehörigen der Grund für die Ablehnung des Kontaktes sein. Um hier durch eine Einbeziehung der Angehörigen die Kom87 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? munikation zu verbessern bedarf es großen Vertrauens der Klienten in die Profis, was durch eine längere Zusammenarbeit aufgebaut werden kann. Auf Seite der Angehörigen ist Motivation zur Zusammenarbeit, welche von Glick et al. (1995) als sehr wichtig für eine Zusammenarbeit beschrieben wurde, vorhanden. Insgesamt lehnten nur 3,14% der Angehörigen eine Zusammenarbeit ab. 9.7 Hypothese 5 Wie bereits bei der Hypothese 5 formuliert, lässt sich kein verallgemeinerbares Fazit bezüglich dem Zusammenhang der psychischen Erkrankung der Angehörigen und der Bewertung des Kontaktes der Klienten zu den Angehörigen sowohl aus deren, wie auch aus Therapeutensicht, ziehen. Bei den F2-Störungen sind die Angehörigen III häufiger erkrankt, bei der Gruppe der F60.3Störungen jedoch deutlich häufiger die Key-Angehörigen (siehe Punkt 7.4). Da die Angehörigen der Klienten mit einer Borderline-Störung negativer bewertet werden (siehe 7.5) und die Key-Angehörigen auch deutlich häufiger selbst erkrankt sind, wäre dies möglicherweise ein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. An dieser Stelle wäre auch zu beachten, dass laut Sansone und Sansone (2009) die Angehörigen der Patienten mit einer Borderline-Störung häufig selbst in invalidisierenden Verhältnissen aufgewachsen sind. Dies ist eine mögliche Erklärung für die höhere Anzahl an selbst erkrankten Key-Angehörigen. Um bezüglich dieser Frage ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, wäre es sinnvoll, diese nochmal mit einer grösseren Stichprobe auszuwerten. 10 Fazit Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die Vermutung, welche in den Hypothesen dargestellt wurde, dass die Angehörigen der F60.3-Klienten in allen Bereichen signifikant schlechter abschneiden, so pauschal nicht bestätigt werden kann. Trotz der schlechteren Bewertung der Klientenkontakte zu den Angehörigen besteht kein schwerwiegender Grund die Angehörigen der Borderline-Patienten nicht in die Behandlung mit einzubeziehen. Auch der „Generalverdacht“, dass diese Angehörigen per se ihre betroffenen Angehörigen traumatisiert haben, kann so nicht bestätigt werden. Es ist jedoch 88 Einbeziehung der Angehörigen in der Integrierten Versorgung – Gibt es diagnosenspezifische Unterschiede hinsichtlich Quantität und Qualität? aufgrund der beschriebenen besonderen familiären Problematik mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. Insgesamt ist durch die vorhandene Motivation der Angehörigen und durch die Neutralität der Profis eine gute Basis für eine profitable Zusammenarbeit vorhanden. Und besonders weil der Kontakt der F60.3-Klienten zu den Angehörigen signifikant schlechter bewertet wird, sollten diese mit einbezogen werden um diese Situation der Klienten und auch der Angehörigen selbst zu verbessern. Auch erscheint dies besonders wichtig, da die BorderlineStörung meist eine sehr lange Erkrankungsdauer aufweist (vgl. Rentrop, 2007). Auch das junge Alter und der vergleichsweise häufigere Sozialleistungsbezug, was auch durch die häufigen stationären Aufenthalte mitbegünstigt werden kann, weisen deutlich daraufhin die Angehörigen mit einzubeziehen, da dies meiner Ansicht nach deutlich zur Stabilisierung beitragen kann, wenn die Beziehung zu den Angehörigen verbessert wird. Dies wird auch durch die Literatur im Punkt 5 so bestätigt. Um verallgemeinerbare Aussagen zu den hier formulierten Hypothesen zu erhalten, wäre es sinnvoll die Untersuchung mit einer weniger selektiven Stichprobe durzuführen. Auch erscheint es interessant die Hypothesen mit der Erkrankungsschwere (CGI), der Erkrankungsdauer oder auch der möglichen Einnahme von Medikamenten in Beziehung zu setzen, um hier mögliche statistische Zusammenhänge zu erkennen. Auch wären weitere Untersuchungen bezüglich der Gründe der Profis für die NichtEinbeziehung der Angehörigen interessant, da der Kontakt zu den Angehörigen meist positiv bewertet wurde, trotzdem aber insgesamt nur wenig Kontakt besteht. Im Übrigen wird die Einbeziehung der Angehörigen bzw. des sozialen Netzes auch in den neu erschienenen S-3 Leitlinien Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen (DGPPN, 2013, S. 16 ff) in der Empfehlung 23 für die psychodukative Behandlung gefordert, was aber meiner Einschätzung nach auf die Behandlung generell übertragbar ist. In den Empfehlungen 4 bis 10 wird die gemeindenahe Versorgung gefordert, welche meiner Meinung nach auch die Einbeziehung der Angehörigen beinhaltet, sodass sich die Frage ob die Angehörigen mit einbezogen werden oder nicht hoffentlich in Zukunft nicht mehr stellen wird. 89