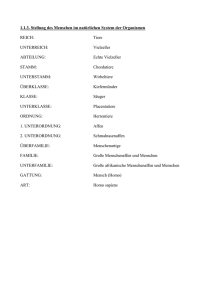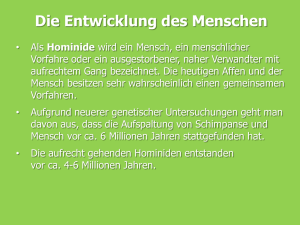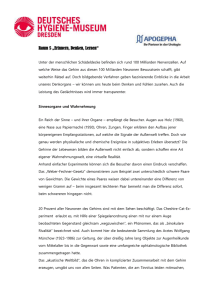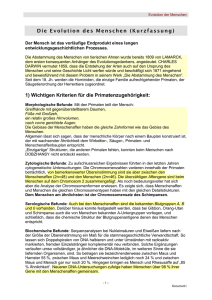Das Gehirn oder Sinn und Unsinn einer Grenze - E
Werbung

Das Gehirn oder Sinn und Unsinn einer Grenze Autor(en): Martin, Robert Objekttyp: Article Zeitschrift: Du : die Zeitschrift der Kultur Band (Jahr): 56 (1996) Heft 8: Am Anfang war die Kunst : die ersten Schritte des Menschen PDF erstellt am: 13.02.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-299490 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Das Gehirn oder Sinn und Unsinn einer Grenze Von Robert Martin Anthropologie ist ein Kind Diemodernen des Rationalismus, lange hat sie mit klaren Linien und dem Begriff «Fortschritt» operiert. Die Menschwerdung wurde arithmetisch, mit dem Zuwachs des Hirnvolumens, ausgedrückt. Langsam ent¬ wickeln sich nun auch die Denkmodelle zum Offenen hin. Sogar mehrfache, ver¬ schiedene Menschwerdungen sind jetzt denkbar. Kein Stammbaum, ein Stamm¬ busch. Frage: Wann erschien der Mensch zum ersten Mal in der Evolution der Orga¬ nismen? Fachleute neigen dazu, das Erst¬ erscheinen von Fossilien der Gattung Homo im Stammbaum mit dem Ursprung des Menschen gleichzusetzen. Man versucht immer wieder, bestim¬ mende biologische Merlanale zu definie¬ ren, die den Menschen von allen anderen Tieren trennen und deren Evolution zu seiner Sonderstellung geführt hat. Als Folge davon wird automatisch angenom¬ men, dass die Menschwerdung jene pro¬ gressive Evolution unserer besonderen Le¬ bensform nur einmal stattfinden konnte. Mindestens teilweise aus diesem letzten Grunde hat man mehrfach versucht, die fossilen Verwandten des Menschen (Hominiden genannt) in eine einzelne Reihe ohne Seitenzweige zu zwingen. Lange Zeit galt die einfache Ahnenreihe: Australo¬ pithecus africanus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens. Die Exemplare der ersten Homo-Axt können so als die ersten wirldichen Menschen in der Evolution be¬ trachtet werden. Einige Anthropologen, darunter vor allem Milford Wolpoff, Die Theorie, dass der Mensch und sämt¬ liche anderen Lebewesen einen einzigen Stammbaum haben, hat sich seit der Zeit von Darwin und Wallace allmählich durchgesetzt. Trotzdem bekunden auch Befürworter der Theorie Mühe, die volle Bedeutung der Evolutionstheorie für die Herkunft des modernen Menschen wahr¬ zunehmen. Die ldassische Prägung des mo¬ dernen Denkens hat unterschwellig vieles «undenkbar» gemacht. Sogar ausgewiesene Biologen reden beispielsweise häufig von «Unterschieden zwischen Menschen und Tieren». Es ist zwar etwas schwer zu fassen, dass die afrikanischen Menschenaffen (Go¬ rillas und Schimpansen) wirldich nahe mit wollen sogar das Grundprinzip gelten las¬ uns verwandt sind. Zahlreiche genetische sen, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt Untersuchungen haben aber übereinstim¬ nur eine Art der Hominiden existieren mend gezeigt, dass der Unterschied im kann. Die Ökologie nimmt allgemein an, Erbgut zwischen Menschen, Gorillas und dass aus Gründen der Konkurrenz zwei Schimpansen höchstens etwa zwei Prozent verschiedene Tierarten nicht gleichzeitig beträgt und dass die Trennung dieser drei dieselbe Nische besetzen können. Man Gattungen im Stammbaum demzufolge braucht nur die kulturelle Umwelt der Ho¬ bloss einige Millionen Jahre zurückliegen miniden als einheitliche «ökologische Ni¬ kann. Wenn man aber zwischen «Men¬ sche» zu definieren, um unausweichlich schen» und «Tieren» unterscheidet, rückt zum Schluss zu gelangen, dass zwei ver¬ man einen Schimpansen näher zu einem schiedene Hominidenarten nicht gleich¬ Einzeller als zu uns, nimmt man gewisser¬ zeitig existieren können. massen Abstand von unseren nächsten An Versuchen, irgendwo in der an¬ biologischen Verwandten. geblich geradlinigen Ahnenreihe der Ho¬ Es kann uns unheimlich vorkommen, miniden einen erkennbaren, deutlichen wenn wir einem Schimpansen oder einem Übergang zwischen «Tieren» und «Men¬ Gorilla im Zoo direkt in die Augen schen» zu definieren, mangelt es nicht. schauen. Wir können irgendeine Gemein¬ 'Manche Forscher haben zum Beispiel eine samkeit spüren, aber die Kluft zwischen bestimmte Gehimgrösse als «zerebralen uns und einem Menschenaffen scheint Rubikon», als Schwelle zur Menschwer¬ gewaltig zu sein. Der moderne Mensch dung bezeichnet. Eine Gehimgrösse von scheint einzigartig, und seine Sonderstel¬ etwa 750 Kubikzentimetern wurde nach lung in der Natur trotz der nahen Ver¬ Sir Arthur Keith vielfach als Schwellenwert wandtschaft mit den afrikanischen Men¬ für die Erkennung der Gattung Homo be¬ schenaffen gilt als selbstverständlich. zeichnet. Dieser Wert liegt höher als bei Dies prägt die Deutung biologischer den heute lebenden Menschenaffen und Tatsachen. So stellt man sich prinzipiell die niedriger als bei allen lebenden Menschen. - - - - 24 Biologisch gesehen ist die Festsetzung eines solchen Schwellenwerts natürlich Unsinn. Die Evolution jeder Linie im Stammbaum der Tiere ist ein kontinuier¬ licher Vorgang. Wenn wir irgendwo in der Ahnenreihe der Hominiden eine Schwelle zwischen «Tieren» und «Menschen» er¬ kennen wollen, müssen zwangsläufig auf dieser Schwelle die letzten «Tiere» die El¬ tern der ersten «Menschen» sein! Absurder noch: Da die Gehimgrösse einer Art im¬ mer eine ziemlich grosse Variationsbreite aufweist (zum Beispiel zwischen etwa 1000 und 2000 Kubikzentimetern beim moder¬ nen Menschen), mussten in einer frühen Population von Homo mit einer durch¬ schnittlichen Himgrösse von 750 Kubik¬ zentimetern die Hälfte der Individuen defmitionsgemäss «noch nicht menschlich» gewesen sein. Die Schwäche einer solchen Definition wird besonders Idar, wenn man eventuelle anatomische Unterschiede zwi¬ schen den Geschlechtem (Geschlechts¬ dimorphismus) berücksichtigt. Beim mo¬ dernen Menschen ist es eben so, dass das männliche Gehirn im Durchschnitt etwa zehn Prozent grösser als das weibliche ist. Wenn ein vergleichbarer Geschlechts¬ dimorphismus bei der ersten Art der Gattung Homo existierte, muss ein durch¬ schnittliches Weibchen dieser Art den «zerebralen Rubikon» von 750 Kubikzenti¬ metern erst rund 200 000 Jahre später als ein durchschnittliches Männchen über¬ quert haben! Der Mensch unterscheidet sich von den Schimpansen und Gorillas in vielen bio¬ logischen und kulturellen Merkmalen. Schon die rein biologischen Unterschiede sind gewaltig: Im Vergleich mit allen grossen Menschenaffen zeigt der heutige Mensch Sondermerkmale in drei Haupt¬ bereichen: im Kieferapparat, im Bewe¬ gungsapparat und im Gehirn. Der Kiefer¬ apparat des Menschen ist in seiner Gesamtform weitgehend umstrukturiert worden. Besonders auffallend ist die Re¬ duktion der Eckzähne, die gewissermassen zu zusätzlichen Schneidezähnen umfunk¬ tioniert wurden. Der Bewegungsapparat des Menschen ist im Dienste des einzigarti¬ gen aufrechten Gangs wortwörtlich von Kopf bis Fuss abgeändert worden. Ganz oben beginnt die senkrechte Wirbelsäule direkt unter dem Kopf, so dass das Hinter- hauptsloch am Schädel deutlich nach vorne gerückt ist. Die vielen anderen An¬ passungen im Skelett reichen ohne Unter¬ bruch bis zum Fuss, wo die Greiffähigkeit des Grosszehs im Dienste des aufrechten Gangs verloren gegangen ist. Schliesslich ist das menschliche Gehirn ungefähr dreimal grösser als das Hirn der moder¬ nen grossen Menschenaffen. Ein Durch¬ schnittsmensch besitzt etwa anderthalb Liter Himgewebe, gegenüber nur einem halben Liter des durchschnittlichen afrika¬ nischen Menschenaffen. Diese deutliche Vergrösserung unseres Gehirns wird häufig speziell betont, da die geistigen Fähigkei¬ ten des Menschen (zum Beispiel die Spra¬ che) zweifellos von Entwicklungen im Zentralnervensystem abhängen. Die Sondermerkmale des Menschen im Kieferapparat, im Bewegungsapparat und in der Gehimgrösse können alle durch die Fossilgeschichte zurückverfolgt wer¬ den, soweit Belegstücke vorhanden sind. Bis vor einigen Jahren schien der entspre¬ chende Stammbaum des Menschen ver¬ hältnismässig einfach zu sein. Die ersten Hominiden, die allgemein anerkannt wur¬ den, waren die Australopithecinen, von denen die ersten bekannten Spuren vor etwa 3,8 Millionen Jahren erschienen. In¬ teressanterweise waren die frühesten Hin¬ weise auf den aufrechten Gang nicht etwa Skeletteile sondern fossilisierte Fussspuren in Tansania. Diese Fussspuren und gewisse Fossilstücke wurden der Art Australopithe¬ cus afarensis zugerechnet, die vor allem durch das etwa 3,2 Millionen Jahre alte Skelett von «Lucy» aus Äthiopien berühmt wurde. Diese sogenannt grazile, leicht ge¬ baute Hominidenform ist der schon viel früher bekannt gewordenen Art Australo¬ pithecus africanus aus Südafrika weitge¬ hend ähnlich. Aber auch Überreste von sogenannt robusten Australopithecinen sowohl in Südafrika (Paranthropus robustus) wie auch in Ostafrika (Paranthropus boisei) liegen vor. Es ist üblich, alle späteren Hominiden von irgendwelchen Australo¬ pithecinen abzuleiten. Eine Auffassung geht dahin, dass Australopithecus afarensis zu Australopithecus africanus führte und dass die drei nacheinander folgenden Ar¬ ten des Homo anschliessend von Australo¬ pithecus africanus abstammten. Eine solche Reihenfolge fügt sich auch sehr gut zu den bekannten Durchschnittswerten für die Gehimgrösse: 400 Kubikzentimeter für Australopithecus afarensis, 440 für Austra¬ lopithecus africanus; 630 für Homo habilis; 1045 für Homo erectus und 1350 für den modernen Homo sapiens. Bezüglich der Australopithecinen ist in den sechziger Jahren ein heftiger Meinungsstreit ausgebrochen, weil einige Autoren schon für diese frühe Phase der Menschenevolution nur eine einzige Hominidenart ansetzten. Zu jenem Zeit¬ punkt, als der Australopithecus afarensis noch nicht bekannt und die Datierung einiger Fossilformen unldar war, wurden die grazilen und robusten Formen von ge¬ wissen Forschern als Weibchen und Männ¬ chen einer einzigen Art gedeutet. Erst später hat man durch bessere Datierungen erkennen können, dass die grazilen Aus¬ tralopithecinen allgemein rund eine bis zwei Millionen Jahre früher vorkamen als die robusten, was bei einem üblichen Geschlechtsunterschied selbstverständlich gewisse Schwierigkeiten verursacht hätte! Die jetzt anerkannten anatomischen Unterschiede zwischen den grazilen und robusten Australopithecinen sind sogar so ausgeprägt, dass die robusten Arten heute allgemein einer getrennten Gattung (Paranthropus) zugewiesen werden. Dieses Beispiel zeigt, dass die Anerkennung der Existenz von Seitenzweigen im Stamm¬ baum der Hominiden oft hart umkämpft wird und dass immer wieder Unterschiede zwischen Arten mit Geschlechtsunter¬ schieden innerhalb einer einzigen Art ver¬ wechselt werden. Dieser Streit wiederholt sich heute im Zusammenhang mit Australopithecus afa¬ rensis, da es Knochenreste von kleinen und grossen Individuen gibt. Viele Forscher möchten alle Fossilstücke aus den entspre¬ chenden Fundstellen in Äthiopien und Tansania der einzigen Art Australopithecus afarensis zuschreiben, und die Grössenunterschiede werden durch Geschlechts¬ dimorphismus wegerklärt. Andere For¬ scher sind aber überzeugt, dass mindestens zwei verschiedene Hominidenarten gleich¬ zeitig existierten, eine ldeine und eine grosse. Das Skelett von «Lucy» wurde vor¬ wiegend der ldeinen Körpergrösse wegen als weiblich identifiziert. Wenn aber beide Geschlechter von Australopithecus afaren¬ sis klein waren, ist es möglich, dass das «Lucy»-Skelett das eines Männchens war. Untersuchungen von Martin Häusler und Peter Schmid am Anthropologischen In¬ stitut in Zürich haben in der Tat darauf hingewiesen, dass das Becken von «Lucy» männliche Züge zeigt, die mit einem Geburtsvorgang schlecht zu vereinbaren wären. Es wäre vielleicht angebracht, das Skelett in «Lucius» umzutaufen! Im Falle der Australopithecinen ist es jedoch leichter, die Existenz von Seiten¬ zweigen wie Paranthropus-Aïten anzuneh¬ men, da es sich bei den Australopithecinen um verhältnismässig primitive Hominiden handelt. Bei Mitgliedern der Gattung Homo dagegen wird die Existenz von Seitenzweigen von manchen Autoren heute noch grundsätzlich abgelehnt. Viele Forscher wollen zum Beispiel die Nean¬ dertaler nicht als getrennte Art (Homo neanderthalensis) anerkennen, obwohl zu¬ nehmend bedeutende Unterschiede ge¬ genüber dem modernen Menschen (Homo 25 sapiens) zum Vorschein gekommen sind. Vor zwanzig Jahren deuteten die wenigen bekannten Fossilfünde darauf hin, dass Neandertaler vor dem modernen Men¬ schen lebten und dass der moderne Mensch erst vor 30000 Jahren die Bühne betreten hat. Viele haben demzufolge die Neandertaler als Bindeglied zwischen Homo erectus und Homo sapiens in eine einfache Stammlinie eingereiht. Jetzt weiss man aber, dass Neandertaler und moderne Menschen schon vor etwa 100000 Jahren im Nahen Osten gleichzeitig vorkamen und während etwa 70 000 Jahren gleichzei¬ tig (wenn auch nicht gleichzeitig am selben Ort) existierten. In Wirklichkeit sind die Hominiden nicht Mitglieder einer linearen Ahnen¬ reihe, und wir sind bestimmt nicht am Ende der Überraschungen. Vor gut zwei Jahren hat die Forschungsgruppe von Tim White in Äthiopien noch frühere, etwa 4,4 Millionen Jahre alte Skelettreste gefun¬ den, die zu den Australopithecinen ge¬ rechnet wurden. Die Entdecker haben auf¬ grund einiger Schädelfragmente eine neue Art, Australopithecus ramidus, definiert und als direkten Vorfahren von Australo¬ pithecus afarensis angesetzt. Viele Anthro¬ pologen hatten aber Mühe, einen Idaren Unterschied zwischen den Bruchstücken von Australopithecus ramidus und Schim¬ pansen zu erkennen. Kurz nach der Be¬ schreibung der Schädelfragmente wurde ein Teilskelett derselben Art ausgegraben, und die Entdecker haben, anscheinend we¬ gen gewisser unerwarteter Züge, überstürzt eine neue Gattung vorgeschlagen. Die neue Art wurde zu Ardipithecus ramidus umbenannt, obwohl sie von den Ent¬ deckern trotzdem weiterhin als direkter Vorfahre von Australopithecus afarensis ge¬ deutet wurde. Die Geschichte wurde vor einem Jahr noch komplizierter: Etwa vier Millionen Jahre alte Schädel- und Skelett¬ reste von deutlich erkennbaren Homi¬ niden aus zwei Fundstellen in Nordkenia wurden von Meave Leakey und ihren Kol¬ legen einer weiteren neuen Art (Australo¬ pithecus anamensis) zugerechnet. Die Ent¬ decker von Ardipithecus möchten auch mit diesem Fund immer noch nur eine einzige Evolutionslinie gelten lassen: Ardipithecus Australopithecus anamensis > Australopithecus afarensis. Der Witz dabei ist aber, dass die Skelettknochen von Australopithecus anamensis von Indivi¬ duen stammen, die etwa so gross waren wie moderne Europäer und einige besondere Merkmale aufweisen. Damit ist der klein¬ ramidus > wüchsige Australopithecus afarensis nicht ohne weiteres als Nachkomme von Au¬ stralopithecus anamensis zu deuten. Eine ähnliche Umstellung hat auch bei unseren Vorstellungen über die Evolution innerhalb der Gattung Homo stattgefun¬ den. Bis vor kurzem galten Vertreter der Art Homo erectus als die ersten Hominiden, die vor maximal einer Million Jahren aus¬ serhalb von Afrika vorkamen. Dieses Da¬ tum musste aber während der letzten Jahre bedeutend revidiert werden, da ein neuer Unterkiefer von Homo erectus aus Dmanisi in Georgien und eine Neudatierung der altbekannten Fundstelle dieser Art in Java (Indonesien) übereinstimmend zum Schluss führten, dass Homo erectus schon vor etwa 1,6 Millionen Jahren ausserhalb von Afrika vorkam. Vor einigen Monaten musste das Datum noch weiter zurück¬ gestellt werden, weil Schädelfragmente und primitive Steinwerkzeuge aus der neuen Fundstelle Longgupo in China die Existenz von Homo in Asien vor fast 2 Mil¬ lionen Jahren angedeutet haben. Es sieht sogar danach aus, dass die LonggupoHominiden primitiver als Homo erectus waren. Ob sie direkte Nachkommen von einer frühen Homo-Art in Afrika oder Mitglieder eines weiteren Seitenzweigs im Stammbusch der Hominiden waren, bleibt noch offen. Der Stammbaum des Menschen ist kein Baum, sondern ein Busch mit vielen Seitenzweigen, und der fliessende Über¬ gang zwischen «Tieren» und «Menschen» wird somit noch unklarer. Unsere Deutung der frühesten Hominiden, der grazilen Australopithecinen, zeigt auch sehr an¬ schaulich, wie schwer es sogar den Fach¬ leuten fallen kann, Übergänge und Seiten¬ zweige in der Tat zu akzeptieren. Man streitet sich immer noch darüber, ob die Australopithecinen den aufrechten Gang des modernen Menschen besassen. Es ist aber zunehmend Idar geworden, dass die Australopithecinen noch sehr viele Merk¬ male ihrer baumlebenden Vorfahren bei¬ behalten hatten und dass sie in vielen Hinsichten wirldich Bindeglieder zwischen Schimpansen und Menschen darstellen. Ihre Arme waren verhältnismässig lang, ihre Fingerknochen infolge einer ehema¬ ligen Anpassung noch für das Hangeln an Ästen gekrümmt, wie bei Menschenaffen. Der Bmstkorb hatte die Form eines nach oben gerichteten Trichters und war nicht fassförmig wie beim modernen Menschen. Die ersten Anpassungen des Skeletts für eine veränderte Gangform betrafen haupt¬ sächlich das Becken und die Beine. Ein neuer Fund von Fussknochen aus Süd¬ afrika, die man Australopithecus africanus zugerechnet hat, weist sogar darauf hin, dass noch ein Greiffuss vorhanden war! Trotz dieser Tatsachen sieht man bei fast allen Ganzkörper-Rekonstruktionen der grazilen Australopithecinen in verschie¬ denen Museen, dass auf diese Hominiden die Körperform eines modernen Men¬ schen projiziert wurde: kurze Arme, ein fassförmiger Brustkorb und Füsse ohne Greiffähigkeit. Diese Verzerrungen bei den Lebensbildern von grazilen Australopi¬ thecinen geht so weit, dass die Breite des rekonstruierten Kopfes einschliesslich Muskeln und Haut meistens Meiner ist als die Breite des blossen fossilen Schädels! Offensichtlich ist es allgemein schwer zu akzeptieren, dass Australopithecus eine echte Mischung von Menschenaffen- und Menschenmerkmalen besass. Ebenso stö¬ rend ist die Vorstellung, dass Australopithe¬ cus womöglich auch Sondermerlanale be¬ sass, die eine direkte Verbindung mit dem modernen Menschen ausschliessen könn¬ ten. Man kann halt nur Mensch oder Men¬ schenaffe sein; die Trennung in unserer geradlinigen Stammlinie muss erhalten bleiben! In vielen populärwissenschaftlichen Darstellungen hat man Szenarien entwor¬ fen, um die Evolution der Sondermerk¬ male des Menschen auf anschauliche Weise zu erklären. Dabei werden häufig viele Merkmale pauschal zusammengefasst, als ob sie gleichzeitig im Stamm¬ baum erschienen wären. Die Reduktion der Eckzähne bei den Hominiden wurde zum Beispiel häufig dadurch erklärt, dass die Entwicklung von Steinwerkzeugen als Waffen die ursprünglich offensive Funk¬ tion dieser Zähne überflüssig machte. Eine gewisse Reduktion der Eckzähne ist aber schon bei den frühsten bekannten Au¬ stralopithecinen erkennbar, während die ersten klar nachweisbaren Steinwerkzeuge erst vor etwa 2,5 Millionen Jahren (etwa 1,5 Millionen Jahre später) in der Fossil¬ geschichte erscheinen. Weniger offensicht¬ lich ist ein Denkfehler bei einer weitver¬ breiteten Deutung der Gehimgrösse im Zusammenhang mit der Entwicklung von Steinwerkzeugen. Die ersten Fossilreste, die zur Gattung Homo gerechnet werden, erscheinen etwa gleichzeitig mit den ersten Steinwerkzeugen vor etwa 2,5 Millionen Jahren. Da die Gehimgrösse bei einigen der frühesten Mitglieder der Gattung Homo erstmals den berühmten «zerebra¬ len Rubikon» überschreitet, ist eine Ver¬ bindung mit den Steinwerkzeugen an¬ scheinend naheliegend. Dabei wird aber vergessen, dass die Gehimgrösse bei allen Säugetieren sehr eng mit der Körpergrösse verknüpft ist. Schimpansen haben im Durchschnitt ein ldeineres Gehirn als Go¬ rillas (385 Kubikzentimeter gegen 495 Ku¬ bikzentimeter), bloss weil ihr durchschnitt¬ liches Körpergewicht fast um zwei Drittel kleiner ist. Die grazilen Australopitheci¬ nen, für die eine Gehimgrösse bekannt ist (Durchschnittswert: 440 Kubikzentime¬ ter), waren alle noch ldeiner als Schimpan¬ sen und wogen nicht mehr als 30 Kilo¬ gramm. Bereits bei den Australopithecinen war die Gehimgrösse relativ zur Körper¬ grösse aber weiter entwickelt als bei den modernen Menschenaffen. Das bedeutet, dass die Entwicklung eines relativ grossen Gehirns auch lange vor dem Auftauchen der ersten erkennbaren Steinwerkzeuge angefangen hatte. Die Entwicklung der verschiedenen Sondermerkmale des Men¬ schen zu verschiedenen Zeiten im Stamm¬ baum ist nur ein Beispiel des seit langem postulierten biologischen Phänomens der Mosaikevolution. Auch aus diesem Grund sollte man keine scharfe Trennung zwi¬ schen Menschen und Menschenaffen im Stammbaum der Tiere erwarten. Die ein¬ zelnen bestimmenden Merkmale des mo¬ dernen Menschen sind erst nach und nach (wenn auch nicht mit gleichmässiger Ge¬ schwindigkeit) im Laufe der Zeit entwickelt worden; die Grössenzunahme des Gehirns beweist dies besonders. Offensichtlich hat die fortlaufende Vergrösserung des Gehirns während der Evo¬ lution des Menschen mit den besonderen Leistungen im menschlichen Verhalten, mit unserer grossen «Intelligenz», einen di¬ rekten Zusammenhang. Deshalb wird im¬ mer wieder versucht, einen spezifischen Computergesteuerte Rekon¬ struktionen des Schädels und des Gehirns bei einem dreijährigen Neandertaler¬ kind (unten) und bei einem gleichaltrigen heutigen Kind (oben). Schon in die¬ sem frühen Stadium sieht man deutliche Unterschiede 4 zwischen den beiden Menschenformen, 26 das Gehirn des Neander¬ talerkinds ist etwas grösser. Bilder durch Marcia Ponce de Leon und Christoph Zollikofer im Rahmen eines Schweizerischen National¬ fonds-Projekts hergestellt. Selektionsdruck für diese markante Zu¬ nahme unserer Gehimgrösse zu identi¬ fizieren. Die Leitplanke der Evolutions¬ theorie ist eben die natürliche Selektion von spezifischen Eigenschaften, die über die Generationen hin eine Anpassung an die herrschenden Umweltbedingungen ge¬ währleistet. Die natürlich Auslese ist in der Tat keine Hypothese, sondern eine logi¬ sche Notwendigkeit. Wenn Individuen einer Art eine gewisse Variation in vererb¬ ten Merkmalen zeigen, wird es automa¬ tisch vorkommen, dass solche Merlanale, die zufällig mit einer grösseren Über¬ lebenswahrscheinlichkeit verbunden sind, über die Generationen immer häufiger werden. Demzufolge suchen Evolutions¬ biologen nach dem spezifischen Selek¬ tionsvorteil von einzelnen Merkmalen. Wie aber Stephen Gould ganz richtig ge¬ mahnt hat, kann diese Suche zu weit ge¬ trieben werden, indem man für jede bio¬ logische Eigenschaft eine «Erklärung» im Sinne einer direkten Anpassung an die Umwelt zu liefern versucht. Viele der Mu¬ tationen im Erbgut sind praktisch neutral und bringen weder Vorteile noch Nachteile mit sich. Dasselbe gilt auch für gewisse ana¬ tomische Merlanale, die wahrscheinlich keinen spezifischen Selektionsvorteil dar¬ stellen, sondern gewissermassen Neben¬ erscheinungen sind. Auf der Suche nach einem spezifischen Selektionsdruck bei der fortlaufenden Evolution des menschlichen Gehirns ha¬ ben verschiedene Autoren eine bunte Mi¬ schung von möglichen Erklärungen an¬ geboten. Bezeichnend dabei ist, dass die meisten jeweils einen spezifischen Vorteil der Evolution des Gehirns hervorgehoben haben. Im Grunde genommen hat jeder für sich versucht, die Frage zu beantwor¬ ten: «Wamm braucht der Mensch ein so grosses Gehirn?» Als mögliche Antworten wurden die Herstellung von Werkzeugen, komplexes Jagdverhalten, die Entwicklung einer Sprache, das Leben in komplexen Sozialsystemen und noch weitere Eigen¬ schaften des menschlichen Verhaltens vor¬ geschlagen. Es wurde sogar neulich von Geoffrey Miller postuliert, dass die zu¬ nehmende Vergrösserung des Gehirns bei Männern durch sexuelle Selektion voran¬ getrieben wurde. Die Frauen sollen beim Balzverhalten der Männer Zeichen der In¬ telligenz bevorzugt haben. Als man den Erfinder dieses genialen Vorschlags fragte, wamm auch Frauen ein grosses Gehirn ha¬ ben, hat er etwas lahm erwidert, dass man sicher auch eine ähnliche Erldamng für die Bevorzugung intelligenter Frauen durch Männer entwickeln könnte. Die Wahrheit ist, dass es einem sehr leicht fällt, beliebige Einzelerklärungen für die Selektion eines grossen Gehirns beim Menschen zu erfin¬ den. Um vieles schwieriger ist es, solche Hypothesen zu testen. Wenn ein direkter Zusammenhang zwischen bestimmten Verhaltensweisen des Menschen und der Gehimgrösse be¬ steht, bleiben sehr viele Fragen unbeant¬ wortet. Wamm haben Delphine mit einer vergleichbaren Körpergrösse eine dem Menschen ähnliche Gehimgrösse? Wamm findet man beim heutigen Menschen keine überzeugende Korrelation zwischen der Gehimgrösse und den Ergebnissen von Intelligenztests? Wenn ein grösseres Gehirn Vorteile im intelligenten Handeln bringt, sollten wir doch eine klare Korre¬ lation erwarten. Wamm vor allem ist die Gehimgrösse von Homo sapiens während der letzten 30 000 Jahre um zehn Prozent kleiner geworden? Gerade während der Zeit, da die kulturelle Entwicklung des Menschen immer schneller vorangegan¬ gen ist, ist das Organ unserer Intelligenz allmählich geschrumpft. Aus solchen Gründen ist es sicher angebracht, die Er¬ klärung für die Vergrösserung des Gehirns während der Evolution des Menschen an¬ derswo zu suchen. Wir können die Frage ganz anders stel¬ len: Wie kann man sich ein grosses Gehirn leisten? Man kann davon ausgehen, dass ein grösseres Gehirn (wie ein grösserer Computer an einer Universität) ohne spe¬ zifischen Selektionsdruck ganz allgemein Vorteile mit sich bringt. Demzufolge wäre es nur zu erwarten, dass jede Säugetierart das grösste Gehirn besitzt, das sie sich lei¬ sten kann. Ein Gehirn braucht nämlich sowohl in seiner Entwicklung wie auch für sein Funktionieren sehr viel Energie. Das Gehirn eines erwachsenen Menschen zum Beispiel macht nur zwei Prozent des Körpergewichts aus, verbraucht aber etwa zwanzig Prozent des gesamten Energieauf¬ wands des Körpers. Die Entwicklung des Gehirns hängt weitgehend von den Res¬ sourcen ab, die die Mutter während der Schwangerschaft und während der an¬ schliessenden Laktationszeit ihrem Kind weitergeben kann. Das Gehirn erreicht, im Gegensatz zu den meisten körperlichen Organen, sehr früh mehr oder weniger seine Endgrösse. Bei einem sechsjährigen menschlichen Kind ist das Gehirn schon fast so gross wie bei einem Erwachsenen. Aus diesem Grund kann die Selektion die Entwicklung eines grösseren Gehirns nicht direkt bevorzugt haben. Eine Forschungs¬ gruppe in den USA hat beispielsweise versucht, durch ein Selektionsprogramm Mäuse mit grösseren Gehirnen zu züch¬ ten. Im wesentlichen haben sie es nur fer¬ tiggebracht, grössere Mäuse zu züchten. Die allmähliche Vergrössemng des Gehirns im Laufe der Evolution können wir am be¬ sten dadurch erldären, dass unsere Vorfah¬ ren immer effizienter Nahrungsressourcen aus der Umwelt gewinnen konnten. Die langsam steigenden Energieressourcen ha¬ ben es den Müttern erlaubt, immer mehr in die Entwicklung der Gehirne ihrer Kin¬ der zu investieren. Diese alternative Anschauungsweise bezüglich der Evolution unserer Gehim¬ grösse ist auch für die Deutung des mo¬ dernen Menschen relevant. Hypothesen, die eine direkte Verbindung zwischen einem gewissen Selektionsdruck und der Gehimgrösse verlangen, führen auch zur Erwartung, dass es eine direkte Korrelation zwischen «Intelligenz» und Gehimgrösse beim modernen Menschen geben muss. Eine alternative Erldamng, die auf Zufuhr von Ressourcen von der Mutter zum Kind basiert, führt zu keiner solchen Erwartung. Die Idee, dass Intelligenz direkt von der Grösse des Gehirns abhängt, hat vor allem bei Diskussionen der Unterschiede zwi¬ schen den Geschlechtem und zwischen menschlichen Populationen («Rassen») eine wesentliche Rolle gespielt. Die Tat¬ sache, dass Frauen im Durchschnitt zehn Prozent weniger Gehirnmasse besitzen als Bildung einer Zwischen¬ form des Kopfes durch Verzerrung eines Gorilla¬ W kindgesichts mit menschli¬ chen Zügen. Computergesteuerte Bild¬ verarbeitung durch % Michel Hafner und Peter W. Simeon des Labors am 27 Multimedia- Institut für Informatik der Universität Zürich. Bildquelle: Foto eines Gorillakinds von Philip Coffey des Jersey Wildlife Preservation trust Männer, kann aufgrund des durchschnitt¬ lichen Unterschieds in der Körpergrösse ohne weiteres verstanden werden. Trotz¬ dem wird häufig vermutet, dass Männer von Natur aus intelligenter sind als Frauen, weil sie ein grösseres Gehirn besitzen. Wenn man aber die Ergebnisse von Intelli¬ genztests zusammenfasst, gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten für Frauen und Männer. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Streuung bei Männern grösser ist als bei Frauen. Es gibt einige Männer, die höhere als alle Frauen erreichen, aber es auch einige Männer, die schlechter gibt als jede Frau abschneiden. Obwohl die Gründe für diesen Unterschied noch un¬ geklärt sind, ist es klar, dass es nichts mit Gehimgrösse zu tun hat. Bei der Geburt besteht praktisch kein Unterschied in der Gehimgrösse zwischen den Geschlechtern. Nur mit sehr grossen Stichproben kann man statistisch nachwei¬ IQWerte sen, dass das Gehirn eines männlichen Kindes eine Spur grösser ist. Wir wissen aber, dass die Teilung der Nervenzellen (Neuronen) ungefähr in der Mitte der Schwangerschaft zu Ende geht. Es ist also zu erwarten, dass männliche und weibliche Neugeborene etwa die gleiche Anzahl von Neuronen im Gehirn besitzen. Ab einem Alter von sechs Jahren ist aber das Gehirn eines Knaben etwa zehn Prozent grösser als das Gehirn eines gleichaltrigen Mädchens. Woher kommt dieser Unterschied? Eine naheliegende Erklärung geht dahin, dass die Dichte der Nervenzellen im weiblichen Gehirn grösser ist als im männlichen. Neu¬ lich haben Forscher nachgewiesen, dass die Dichte der Neuronen in einem Teil der Hirnrinde bei Frauen tatsächlich höher ist. Der Unterschied in der Gehimgrösse zwi¬ schen erwachsenen Männern und Frauen könnte also gewissermassen bloss ein Aus¬ dmck einer unterschiedlichen «Verpakkung» der gleichen Anzahl von Neuronen sein. Dieses Beispiel zeigt besonders klar, w m %j warum wir keine direkte Korrelation zwi¬ schen Gehimgrösse und Intelligenz erwar¬ ten dürfen. Die besonderen Fähigkeiten des Menschen hängen nicht direkt von der absoluten Himgrösse ab; vielmehr sind sie Ausdmck von spezifischen Vernetzungen zwischen Neuronen. Auch in diesem Sinne können wir die fortlaufende Re¬ duktion der menschlichen Gehimgrösse während der letzten 30 000 Jahre verste¬ hen, nämlich als Änderung in der Ver¬ packung der Neuronen. Der französische Dichter Anatole France, dem im Jahre 1921 der Nobelpreis für Literatur ver¬ liehen wurde, hatte eine Gehimgrösse von nur 1000 Kubikzentimetern, dicht an der unteren Grenze für den modernen Men¬ vergrösserte Pharynx eine sehr wichtige Rolle bei der Gestaltung der Stimme. Umstritten ist aber die Behauptung von Lieberman, dass diese Vergrössemng des Rachens aus der Form der Schädelbasis er¬ kennbar ist. Er ist dadurch zum Schluss ge¬ schen. Der Stammbaum des Menschen ist ein dicht verzweigter Busch, und unsere Son¬ dermerlanale wurden schrittweise und mo¬ saikartig entwickelt. Es ist wahrscheinlich, dass viele Parallelentwicklungen stattgefun¬ Der Besitz einer artikulierten Sprache ist, ganz unabhängig von der Gehim¬ grösse, ein bestimmendes und sehr wesendiches Merkmal des Menschen. Des¬ halb haben viele Forscher den Versuch unternommen, die Evolution der Sprache anhand der fossilen Belegstücke zu rekon¬ struieren. Phillip Tobias hat zum Beispiel vermutet, dass Änderungen in der äusseren Form von Gehirnabgüssen darauf hinwei¬ sen, dass die Sprachzentren im Gehirn den Anfang einer entsprechenden Umorganisation schon bei Homo habilis aufweisen. Demnach wäre auch eine allmähliche Evo¬ lution der Sprache über die letzten zwei Millionen Jahre denkbar. Auf der anderen Seite haben Philip Lieberman und seine Kollegen postuliert, dass der spezifische Umbau des menschlichen Rachens zu einer Resonanzkammer, der für eine arti¬ kulierte Sprache notwendig war, erst sehr spät stattfand. Es ist unumstritten, ob der moderne Mensch sich von den grossen Menschenaffen dadurch unterscheidet, dass der Abstand zwischen der Mund¬ höhle und dem Kehlkopf (Larynx) wäh¬ rend der ersten zwei Lebensjahre allmäh¬ lich zunimmt, wodurch sich der Rachen (Pharynx) vergrössert. Bei uns spielt dieser kommen, dass eine artikulierte Sprache erstmalig bei Homo sapiens möglich wurde und dass sogar die Neandertaler diese Fähigkeit noch nicht besassen. Falls Lie¬ berman recht hat, besteht ein sehr bedeu¬ tender Unterschied zwischen uns und den Neandertalern. Falls er unrecht hat, wie viele Gegner seiner Hypothese meinen, ha¬ ben wir zur Zeit keine anderen Mittel, um den Urspmng der artikulierten Sprache festzulegen. den haben. Es gab sicherlich verschiedene Varianten des aufrechten Gangs, und nur eine führte zur modernen menschlichen Gangart. Das gleiche gilt für die Vergrösse¬ mng des Gehirns. Wir wissen, dass die Ne¬ andertaler im Durchschnitt grössere Ge¬ hirne besassen als der moderne Mensch. Es ist auch zunehmend Idar geworden, dass die Trennung zwischen uns und den Ne¬ andertalern weit zurückliegt. Wie weit sie zurückgeht, wissen wir nicht, aber es ist nicht auszuschliessen, dass die Vergrösse¬ mng des Gehirns bei Neandertalern und bei Homo sapiens weitgehend aufgetrenn¬ ten Wegen stattgefunden hat. Nach der Ge¬ himgrösse zu beurteilen, sind die Nean¬ dertaler «Menschen», aber die Möglichkeit besteht, dass Neandertaler und Homo sapi¬ ens diesen Status unabhängig voneinander erreichten. Dass die Neandertaler auch auf einem Seitenzweig des Stammbaums des Menschen sassen, ist sehr wahrscheinlich. Ist es aber sogar denkbar, dass die Evolu¬ tion des «Menschen» zweimal stattgefun¬ den hat? ¦ # r Vergleich zwischen zwei Rekonstruktionen des Eine neue Rekonstruktion Kopfes eines grazilen Schädel ausgeht, sieht Australopithecus. In der ersten Rekonstruktion viel weniger menschlich (links), die 29 aus einer in¬ (rechts), die direkt vom aus (Neurekonstruktion durch Margrit Peltier ternationalen Ausstellung vom Anthropologischen stammt, ist der Kopf nicht einmal so breit wie der ursprüngliche Schädel. Institut in Zürich).