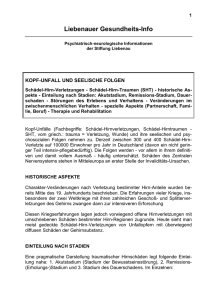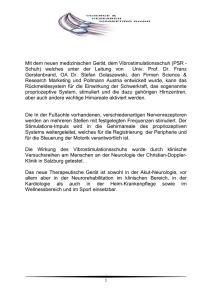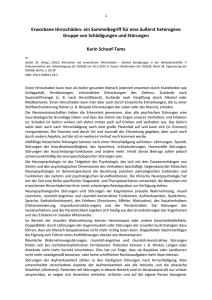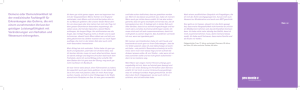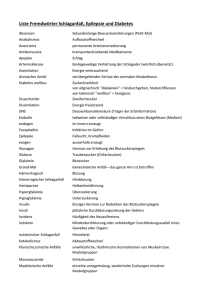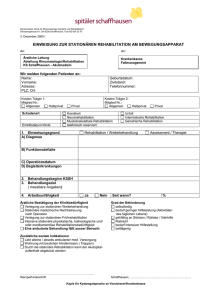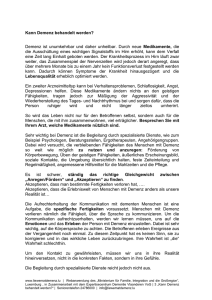Leseprobe zum Titel - content
Werbung

7 Vorwort der Herausgeber Erworbene Hirnschädigungen sind facettenreich, vielschichtig, häufig sehr komplex und führen oft zu bleibenden Beeinträchtigungen. Aktuellen Untersuchungen zufolge steigt nicht nur die Zahl der betroffenen pflegebedürftigen Patienten, sondern auch die Anzahl der indirekt betroffenen Personen, wie Partner, Familienmitglieder und Freunde. Ergebnisse der sich auch in Deutschland zunehmend etablierenden fachrichtungsübergreifenden Versorgungsforschung weisen darauf hin, dass trotz eines gleichen Inputs von rehabilitativen Maßnahmen starke Unterschiede hinsichtlich des Outcome zu verzeichnen sind. Damit rücken der so genannte „Throughput“ und das Phänomen der „Effectiveness Gaps“ in den Fokus der Rehabilitation und Versorgung. Ebenso vielfältig wie die Formen und Auswirkungen von erworbenen Hirnschädigungen sind die Handlungsstrategien zur Rehabilitation, die zunehmend auch nichtmedizinische Wissenschaftsgebiete, wie die Pädagogik – speziell die Rehabilitationspädagogik –, in die Behandlungs- und Versorgungsketten mit einbeziehen. Gibt es über die medizinische Versorgung hinaus spezielle Fördermaßnahmen für Heranwachsende mit einer erworbenen Hirnschädigung? Welche pädagogisch-therapeutischen Angebote benötigen Patienten, z.B. nach einem Unfall oder nach einem Schlaganfall? Wie müssen unterstützende ambulante bzw. stationäre Versorgungssysteme für eine erfolgreiche Rehabilitation strukturiert sein? Wie können pädagogische bzw. didaktische Zugänge gezielt für eine evidenzbasierte, partizipative Rehabilitation entwickelt und erfolgreich implementiert werden? Das sind interessante und zukunftsweisende Fragen, mit denen sich eine fachrichtungsübergreifende interdisziplinäre Rehabilitationspädagogik im System einer modernen Versorgungsforschung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erworbenen Hirnschädigungen auseinandersetzen muss. Dabei werden in den nächsten Jahren neue interdisziplinäre wissenschaftliche sowie praktische Zugänge mit kooperativen Handlungskompetenzen im Spannungsfeld von Rehabilitationspädagogik, Neurokognitionswissenschaften, Pflege und Medizin entstehen. Diese Sichtweise möchte das vorliegende Buch gezielt in den Mittelpunkt stellen und Impulse für eine fächerübergreifende Theorie- und Praxisentwick- 8 lung einer interdisziplinären Rehabilitationspädagogik geben. Es werden dabei grundlegende Aspekte des noch recht jungen Wissenschaftszweiges der Rehabilitationspädagogik in den Beiträgen aufgenommen und differenziert betrachtet. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen notwendigen theoretischen Bezügen, analytisch-diagnostischen Konzepten und Anregungen zum reflektierten beruflichen Handeln sind ein Kennzeichen dieser Veröffentlichung. Das Buch richtet sich sowohl an Studierende der Rehabilitationspädagogik als auch an die kooperierenden Berufsgruppen in den Bereichen Medizin, Psychologie, Therapie und Pflege. Oldenburg, im Juni 2012 Die Herausgeber 9 Einleitung Im Mittelpunkt dieses Buches stehen Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen, ihre Angehörige, Freunde sowie die Helfersysteme, die sie bei der (Wieder-) Erlangung der Teilhabe und Partizipation in der Gesellschaft unterstützen und begleiten. Obwohl eine Hirnschädigung nicht eigentlich „erworben“, sondern „erlitten“ wird, wurde in diesem Buch an dem etablierten medizinischen Fachbegriff der erworbenen Hirnschädigung festgehalten, wenn auch in einigen Texten immer wieder vereinzelt von „erlittener“ Hirnschädigung gesprochen wird. Um die Beeinträchtigung der Teilhabe für Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung abzuwenden, bedarf es zunehmend eines interdisziplinären Handelns. Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen stellen hinsichtlich der Rehabilitation vielseitige Herausforderungen an alle am Prozess beteiligten Professionen. Historisch betrachtet wurde erworbenen Hirnschädigungen zunächst wenig Bedeutung zugemessen, da die Überlebenswahrscheinlichkeit oft sehr gering war. Erst im Laufe des letzten Jahrhunderts haben erworbene Hirnschädigungen u.a. durch Kriege sowie Fortschritte in der Versorgung eine zunehmende Bedeutung für die Medizin, Pflege, Psychologie und aktuell auch für die Rehabilitationspädagogik gewonnen. Zunächst ging man davon aus, dass verlorengegangene Hirnfunktionen nicht mehr wiedererlangt werden können, da Nervenzellen keine Fähigkeiten zur Regenerierung aufweisen. Durch die medizinische Forschung ist jedoch deutlich geworden, dass mit entsprechender Behandlung und Förderung die fehlenden Fähigkeiten durch die Neuroplastizität des Gehirns wiederzuerlangen sind. Dieses Phänomen steht im Zentrum des Beitrags von Andreas Engelhardt zur medizinischen Versorgung von Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Zur Förderung der Neuroplastizität ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von unterschiedlichen Fachdisziplinen unerlässlich, es kommt dabei zunehmend zur Etablierung von neuen medizinischen sowie auch (pädagogisch-) therapeutischen Handlungsfeldern. Diesen Zusammenhängen widmet sich Andreas Zieger in seinem Beitrag zur Kooperation zwischen Medizin und Rehabilitationspädagogik. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit zwischen den beiden Fachgebieten, mit einem traditionell eher schwierigen Verhältnis zueinander, zugrunde legend, beschreibt er aus Sicht der Medizin die Rehabilitationspädagogik als eine Bereicherung für die Rehabilitation von Men- 10 schen mit einer erworbenen Hirnschädigung. Hieran schließt sich der Beitrag von Gisela Schulze an, der die Aufgaben der Rehabilitationspädagogik im Bereich der modernen Versorgungsforschung in Deutschland darlegt sowie am Beispiel von Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung analysiert. Eine Verortung der professionellen Pflege in diesem Aufgabengebiet führt Martina Hasseler durch. In ihrem Artikel werden die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege und Rehabilitationspädagogik beleuchtet. Dabei steht die ganzheitliche Förderung der Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung im Fokus. Die notwendigerweise enge Verzahnung zwischen den verschiedenen Fachgebieten, die eine abgestimmte, ganzheitliche Förderung überhaupt erst ermöglicht, setzt gut entwickelte Netzwerke und angemessene Kommunikationssysteme voraus. Vernetzung und Kooperation der Akteure aus unterschiedlichen Professionen werden in diesem Teil des Buches aufgegriffen, sodass die Beiträge zu aktuellen Forschungen einen psychologischen, soziologischen, sozial- oder sonderpädagogischen Akzent tragen. Für die rehabilitative Versorgung von Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen ist der Wandel von einem defizit- hin zu einem ressourcenorientierten Krankheitsfolgenverständnis von hoher Bedeutung. So geht Carmen Schmitz in ihrem Beitrag auf das für die Genesung wichtige Kohärenzgefühl bei einer erworbenen Hirnschädigung ein. Neben den Eigenschaften der Person haben aus Sicht der Rehabilitationspädagogik auch Umweltfaktoren einen maßgeblichen Einfluss auf die Genesung. Unter diesem Aspekt beleuchten die Beiträge von Jana Alber und Hilke Nienaber/Thorben Wist die Bedeutung von Partnerschaft sowie von persönlichen Netzwerken für die Teilhabe an der Gesellschaft. Die Berücksichtigung des Umfelds und des individuellen Kohärenzgefühls findet in der bisherigen Behandlungs- und Förderplanung noch wenig Beachtung. Mit der pädagogischen Modulation stellt Anna Esclusa Feliu ein Konzept aus Spanien vor, das die Ressourcen aus dem Umfeld zur rehabilitativen Versorgung von Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung nutzt. Im System der modernen Versorgung von Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung sind für die unterschiedlichen Zielgruppen der Betroffenen auch unterschiedliche Professionen beteiligt. In diesem System stellen Kinder und Jugendliche besondere Anforderungen an die Beteiligten. Holger Koppe stellt in seinem Beitrag dar, wie Angebote einer sozialpsychiatrischen Praxis die möglichen psychischen und seelischen Folgen für Kinder und Jugendliche mit einer Hirnschädigung in der Rehabilitation begrenzen. Menno Baumann zeigt in Abgrenzung hierzu auf, dass Gewalt und Misshandlung nicht nur zu seelischen Belastungen führen können, sondern auch als Ursache für erworbene Hirnschädigungen zu diskutieren sind. Eine Folge der erwor- 11 benen Hirnschädigungen sind Auswirkungen auf die motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Mit diesen Zusammenhängen beschäftigt sich Britta Gebhard in ihrem Beitrag zur Wirksamkeit von Fördermaßnahmen im Bereich der Motorik. Die Effektivität von Fördermaßen ist bei Kindern und Jugendlichen maßgeblich mit vom Verhalten der Eltern abhängig. Joachim Meyer-Holz analysiert in seinem Beitrag, welchen Einfluss Mütter auf den Therapieerfolg haben. In Hinblick auf Erwachsene mit erworbenen Hirnschädigungen sind spezifische Fragen nach modernen Versorgungs- und Förderungsmöglichkeiten von großer Bedeutung. Besonders die Personengruppe der Erwachsenen im Wachkoma wirft ethische sowie institutionelle Fragestellungen auf. Manfred Hülsken-Giesler thematisiert die damit verbundenen institutionellen Herausforderungen in der Versorgung von Wachkoma-Patienten aus pflegewissenschaftlicher Perspektive. Neben dem Aspekt der Pflege ist das Aufrechterhalten der Kommunikation von hoher Bedeutung. Andrea Erdélyi schildert, wie mit Techniken der unterstützten Kommunikation die Partizipation erhöht wird. Um eine ganzheitliche Versorgung von Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung zu etablieren, bedarf es ebenfalls der Versorgung und Förderung von Menschen aus deren Umfeld. Andrea Goll-Kopka schildert, wie eine systemische therapeutische Arbeit mit Angehörigen gestaltet werden kann. Um Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen einen Verbleib in ihrem bisherigen Lebensraum zu ermöglichen, müssen zeitgemäße Konzepte zur wohnortnahen Versorgung entwickelt werden. So zeigt Kerstin Bilda Wege auf, die eine adäquate Versorgung im bisherigen Lebensraum sicherstellen. Die im Buch vorhandenen Beiträge aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen stellen auf theoretischer sowie auch auf praktischer Ebene aktuelle Entwicklungen vor, welche für eine moderne, effektive und interdisziplinäre Versorgung von Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen sowie deren Angehörige unerlässlich sind. Die Darstellung der Geschlechterformen wurde von den Autoren individuell gelöst. Zum Zwecke einer besseren Lesbarkeit werden überwiegend die maskulinen Formen verwendet, die femininen sind jedoch stets mitzudenken. Der Sammelband richtet sich an Studierende der Sonder- und Rehabilitationspädagogik, der Pflegewissenschaften, der Medizin und Psychologie sowie an Lehrende in Universitäten und Hochschulen, an Therapeuten sowie an interessierte Familien und professionelle Unterstützer. 12 Die Herausgeber danken allen Autoren, die bei der Erstellung mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gebührt Thorben Wist, der uns bei der redaktionellen Bearbeitung des Werkes sehr unterstützt hat. 13 Theoretische Grundlagen Andreas Engelhardt 1 Medizinische Grundlagen/Einleitung zur Problematik „Erworbene Hirnschädigungen“ Zusammenfassung: Das Gehirn ist anatomisch der Teil des Zentralnervensystems, der innerhalb der knöchernen Schädelkapsel liegt. Funktionell ist es das zentrale Integrationsorgan für alle Reize, die aus der Umwelt über unsere Sinnesorgane in uns eindringen oder in unserem Organismus entstehen. Bewusstes Denken, Fühlen und Handeln sind an die intakte Funktion unseres Großhirns gebunden. Die meisten Hirnleistungen werden jedoch bereits in den unter der Ebene der Großhirnrinde (subkortikal) liegenden Strukturen der Stammganglien und des Hirnstamms verarbeitet. Nur ein verschwindend kleiner Teil geschieht bewusst und reflektiert. Gerade diese Fähigkeiten bedingen jedoch das Gefühl der eigenen menschlichen Identität und der biografischen Kontinuität: Wir sind uns sicher, dass wir heute derselbe sind wie gestern und es auch morgen sein werden. Das Gehirn als Beziehungsorgan (Fuchs 2012) verbindet unsere Innenwelt mit der Außenwelt, ist somit Voraussetzung für Kommunikation. Auch sie ist in wesentlichen Teilen unbewusst. Erworbene Hirnschädigungen bedeuten daher stets einen Bruch in der Kontinuität unserer Lebenslinie (Biographie) und der Beziehung zu unserer Umwelt (Kommunikation). Sie werden als besonders persönlichkeitsrelevant und ich-nah erlebt (Lucius-Hoene und Nerb 2010). 1.1 Einleitung Da Nervenzellen nach der Geburt ihre Teilungsfähigkeit bis auf wenige Ausnahmen verloren haben, kommt eine Defektheilung auf dem Wege einer Vermehrung von Nervenzellen nur begrenzt in Frage. Das heißt jedoch nicht, dass eine Wiederherstellung früherer Fähigkeiten nach einer erlittenen Schädigung nicht möglich ist. Sie beruht auf der Plastizität des Gehirns (Neuroplastizität), die Grundlage eines lebenslangen Lernprozesses auch bei Gesun- 14 den ist. Nach einer Hirnschädigung kommt es bis ins hohe Alter durch Neubildung von Verbindungen zwischen den Nervenzellen (Synapsen), vergleichbar durchaus mit den Lernvorgängen in der Kindheit, zu einer mehr oder weniger vollständigen Restitution der Hirnleistung Das Gehirn besitzt die Fähigkeit der neuronalen Plastizität bis ins hohe Alter. Wir verstehen hierunter die Anpassung von Struktur und Organisation an veränderte biologische Voraussetzungen und neue Anforderungen (Ende-Henningsen/ Henningsen 2010). Es ist zur ständigen Neubildung und Verknüpfung von Synapsen in der Lage. In der Akutphase steht bei einer Schädigung des Gehirns das therapeutische Bemühen um Schadensbegrenzung und Wiederherstellung überlebensfähiger Zellen im Vordergrund. In der oft Jahre anhaltenden Rehabilitationsphase sind Lernvorgänge notwendig. Neuroplastizität ist die biologische Grundlage und Voraussetzung für jede Form der Pädagogik und der gesamten Neurorehabilitation. Auf diese veränderten Bedingungen muss eine zeitgemäße Rehabilitationspädagogik eingehen. Ihre Hauptaufgabe ist nicht mehr die Förderung von Kindern mit Entwicklungsstörungen des Gehirns („Infantile Zerebralparese“) sondern die Anwendung von Methoden zum Wieder-Erlernen verlorengegangener Hirnfunktionen in jedem Lebensalter. Lebenslanges Lernen beim Gesunden und Rehabilitation nach Hirnschädigung geschehen analog: Auf biologischer Ebene wird beides ermöglicht durch Aussprossen von Nervenfortsätzen, Umorganisation innerhalb des Gehirns mit Einbeziehung bisher nicht genutzter „redundanter“ Areale („Unmasking“) sowie Neubildung von Synapsen (vgl. Ende-Henningsen/ Henningsen 2010). Tierexperimente weisen darauf hin, dass in begrenztem Umfang sogar eine Ausdifferenzierung neuer Nervenzellen aus neuronalen Stammzellen möglich ist (Kempermann 1997). Der bis dahin geltende Fatalismus, eine Regeneration des Zentralnervensystems sei aufgrund der fehlenden Teilungsfähigkeit der Nervenzellen nach der Geburt nicht möglich, ist spätestens seit diesen und zahlreichen nachfolgenden Beobachtungen nicht gerechtfertigt. 1.2 Medizinische Versorgung Als Folge der vielen Hirnverletzungen in den Weltkriegen und der Zunahme der Verkehrsunfälle in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wurde „erworbene“ häufig gleichgesetzt mit „traumatischer“ Hirnschädigung. Neurorehabilitation fand, wenn überhaupt, nach Hirnverletzung statt. Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Neuropsychologie wurden überwiegend in der Akutklinik durchgeführt. Die damals deutlich längeren Liegezeiten ermög- 15 lichten dies noch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Mittlerweile liegen die Liegezeiten in der Neurologie bei etwa 7 Tagen, sodass bei der überwiegenden Zahl der Hirnschädigungen, sei es durch Trauma oder Krankheit, in den neurologischen und neurochirurgischen Kliniken nach der Akutbehandlung („Phase A“ der Rehabilitation) die Weiterbehandlung in den Rehaphasen B bis D lediglich gebahnt werden kann. Die Ursachen der traumatischen Hirnschädigung haben sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt: SchädelHirn-Traumata im Straßenverkehr sind seltener geworden. Im Gegenzug haben häusliche Unfälle, insbesondere Sturzereignisse bei älteren Menschen zugenommen. So beobachten wir auch bei traumatischen Hirnschädigungen eine Verschiebung zu älteren Jahrgängen. Erst in den letzten Jahren wird Medizinern und Politikern langsam bewusst, dass mit der älter werdenden Bevölkerung nicht mehr Unfälle, sondern Schlaganfälle und Demenz die häufigsten Ursachen einer erworbenen Hirnschädigung sind und einer besonderen Versorgung bedürfen. Für die Behandlung dieser Erkrankungen notwendige Strukturen und Prozesse befinden sich erst im Aufbau. Beispielhaft seien hier die neurologischen Stroke-Units genannt. Auf diesen spezialisierten Stationen werden heute die meisten akuten Schlaganfälle behandelt. Hier kann neben der Akutversorgung eine qualitativ hochwertige Neurorehabilitation bereits in den ersten Tagen der Erkrankung eingeleitet werden. Die Überlegenheit dieses Behandlungskonzepts hinsichtlich des Therapieerfolgs („outcome“) wurde mehrfach nachgewiesen (Candelise et al. 2007). Eine besondere allgemeinmedizinische und pädagogische Aufgabe ist jedoch noch früher angesiedelt: die Prävention. Durch Behandlung wichtiger Risikofaktoren der Arteriosklerose, wie Hypertonie, Diabetes, Rauchen, Bewegungsmangel, Fehl- und Überernährung, wird das Risiko einer Durchblutungsstörung des Gehirns vermindert. Da dies auch Risikofaktoren der Demenz sind, können kognitive Defizite, wenn auch in bescheidenem Umfang, verzögert werden. Genetische Veranlagung und frühkindliche Erziehung spielen eine noch wesentlichere Rolle, sind jedoch naturgemäß später nicht zu beeinflussen: „In der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein“ (Paul Watzlawick, zitiert nach J. Wettig 2006) 1.3 Neurologische Diagnostik Der wichtigste Schritt vor einer exakten körperlichen Untersuchung ist die Erhebung der Krankheitsvorgeschichte (Anamnese). Sie erstreckt sich auf die aktuelle Entwicklung der Beschwerden, auf frühere Erkrankungen, familiäre 16 Vorbelastung und Sozialanamnese. Beruf, Familienstand, Hobbies und Neigungen, aber auch biographische Meilensteine sind wichtig und beeinflussen häufig bereits in den ersten Tagen der Erkrankung das weitere Vorgehen. Mehr als die Hälfte der Diagnosen können bereits nach sorgfältiger Anamnese gestellt werden. Auf die Wichtigkeit dieser Informationen (psychischer Befund, Sozial- und Familienanamnese) kann nicht häufig genug hingewiesen werden. Sie sind für die Weichenstellung in Richtung einer erfolgreichen Rehabilitation notwendig. Die körperliche neurologische Untersuchung schließt sich an. Hier lassen sich pathologische Zeichen (Symptome) nachweisen, die wir zu Syndromen zusammenfassen. Syndrome stellen wichtige Hinweise auf den Ort der Schädigung dar. Bildgebende Diagnostik (CT, MRT), Neurophysiologie (EEG, evozierte Potentiale, EMG) und Labordiagnostik (Blut, Liquor) vermitteln danach Erkenntnisse zur Ursache der Schädigung (Blutung, Infarkt, Entzündung u.a.). Bei bewusstseinsgetrübten Patienten ist diese allerdings häufig in der Akutphase nicht vom Betroffenen selbst zu erfahren, sondern von Angehörigen oder Begleitpersonen (Fremdanamnese). Bei epileptischen Anfällen ist die Schilderung des Anfallsablaufs in der Diagnostik wichtiger als das EEG! Die Krankheitssymptome sind nicht nur körperlich, sondern auch in ihren psychischen Voraussetzungen und Auswirkungen zu erfassen. Jeder Patient ist Teil eines sozialen Gefüges (Familie, Beruf) und durch Besonderheiten seines kulturellen Hintergrundes geprägt. Das Gehirn ist individueller Speicher der biographischen Erinnerungen und der Kulturleistungen. In Bezug auf die Umgebung und den „inneren Dialog“ ist es immer auch Kommunikationsorgan, nicht nur bei einer Sprachstörung. Verzweiflung und tiefe Depressionen sind nach erlittener Hirnschädigung bei den Patienten selbst und seinen Angehörigen häufig. Sie sind bei weitem nicht immer organisch bedingt. Diese Besonderheiten werden in einer modernen „kontextsensitiven“ Rehabilitation berücksichtigt (vgl. Frommelt/Grötzbach 2010), sollten jedoch bei jeder stationären und ambulanten neurologischen Behandlung hirngeschädigter Menschen im Auge behalten werden. 1.4 Lokalisation der Hirnschädigung Erworbene Hirnschädigungen können nur Teile des Gehirns betreffen (fokale Hirnschädigung), oder sie umfassen das gesamte Gehirn (diffuse Hirnschädigung). Beispiel einer fokalen Hirnschädigung ist eine Schädigung der linken Großhirnhälfte mit Sprachstörung (Aphasie) und Lähmung (Hemiparese) der 17 rechten Körperhälfte. Fokale Schäden im Hinterhauptslappen führen zu Gesichtsfeldeinschränkung nach der Gegenseite, Ausfälle im Scheitellappen zu halbseitigem Sensibilitätsverlust oder Handlungsstörung (Apraxie). Herdförmige Ausfälle im Temporallappen können Gedächtnisstörungen durch beidseitige Schädigung des Hippocampus verursachen. Im Bereich der rechten Hirnhälfte führen sie insbesondere nach Schlaganfällen zu einer Vernachlässigung (Neglect) der linken Körperhälfte. Diese Patienten verhalten sich so, als ob die betroffene Körperhälfte nicht zu ihnen gehöre. Bei anderen werden Gegenstände, Gesichter, Körperteile oder die eigene Erkrankung zwar wahrgenommen, aber nicht erkannt (Agnosie). Im Hirnstamm machen sich herdförmige Ausfälle oft durch Augenbewegungsstörungen (Doppelbilder, Nystagmus), Drehschwindel, Sprech- und Schluckstörung (Dysarthrie, Dysphagie) bemerkbar. Zusätzlich führt die Unterbrechung der auf- und absteigenden Leitungsbahnen zu Lähmungserscheinungen oder Sensibilitätsstörungen einer oder beider Körperhälften. Ataxie (unkoordinierte Bewegung) tritt besonders bei Kleinhirnschädigung auf, kann aber auch durch eingeschränkte Wahrnehmung der Gelenkstellung infolge einer Tiefensensibilitätsstörung hervorgerufen werden. Fokale Ausfälle können dem Neurologen bei der Untersuchung wichtige Hinweise auf die Lokalisation geben. Bei ungünstiger Lokalisation können auch umschriebene Läsionen zu schweren Ausfällen führen. Insbesondere im Hirnstamm können sie zu tiefer Bewusstlosigkeit und Lähmung aller Extremitäten (Tetraparese) sowie Atemstillstand führen. Ein Sonderfall einer fokalen Schädigung mit dramatischen Auswirkungen ist das „Locked-In-Syndrom“, bei dem infolge einer umschriebenen Hirnstammschädigung in der Brücke (Pons) Arme und Beine gelähmt sind, die Großhirnfunktion und ein Rest der Augenmotilität jedoch erhalten bleiben. Daher ist eine Kommunikation über Augen- oder Lidbewegung möglich. Eine diffuse Hirnschädigung (diffuse Enzephalopathie) betrifft das ganze Gehirn und erlaubt deshalb keine Rückschlüsse auf die Lokalisation. Zumeist handelt es sich um schwere Schädigungen, bei denen während der gesamten Akut- und Rehabilitationsphase nicht nur medizinische, sondern auch ethische Entscheidungen von großer Tragweite getroffen werden müssen (Oemichen 2007). Es handelt sich beispielsweise um Zustände nach Sauerstoffmangel (hypoxischer Hirnschaden), einer stoffwechselbedingten (metabolischen) Störung, wie beim diabetischen Koma, einer Unterzuckerung (Hypoglykämie), einer schweren Leber- und Nierenschädigung, einer Vergiftung, nach Entzündungen des Gehirns, schwerem Schädel-Hirn-Trauma oder Gefäßerkrankungen des Gehirns vor. Eine schwere Schädigung des Großhirns oder des Hirnstamms führt zur Einschränkung der Wachheit (Vigilanzstörung) und des Bewusstseins (Koma). Traditionell werden die Stadien der 18 Bewusstseinstrübung Somnolenz (Schläfrigkeit mit Erweckbarkeit auf Ansprache), Sopor (Erweckbarkeit auf Schmerzreize) und Koma (tiefe Bewusstlosigkeit ohne Erweckbarkeit) unterschieden. Die Augen sind in allen diesen Stadien geschlossen. Es kann sich allerdings im weiteren Verlauf ein Zustand des „Wachkomas“ (Coma vigile) entwickeln, in dem das Bewusstsein weiterhin fehlt, der Blick nicht fixiert, die Augen jedoch geöffnet sind. Auf Außenreize hin treten keine oder nur minimale Reaktionen auf. Wegen des Funktionsverlusts des „Hirnmantels“ (Pallium) wird dieser Zustand nach Gerstenbrand als apallisches Syndrom bezeichnet (ausführlich Beschreibung in Zieger und Schönle 2004). Zugleich kommt es dabei zu einer Verselbstständigung tiefer gelegener Abschnitte im Gehirn mit vegetativer Enthemmung, was zu der Bezeichnung „vegetative state“ geführt hat (Jennett und Plum 1972). Häufig führen Hirnschädigungen im Bereich der Großhirnrinde zu epileptischen Anfällen. Es gelingt dem Nervenzellverband dann nicht mehr, eine Erregung durch hemmende Mechanismen einzugrenzen. Bei verringerter Krampfschwelle kann sich synchrone elektrische Aktivität über das gesamte Gehirn ausbreiten und zu einem generalisierten epileptischen Anfall führen. Somit unterscheiden wir auch bei den epileptischen Anfällen herdförmige (fokale) und diffuse (generalisierte). Die Beobachtung der Vorboten des Anfalls (Aura) oder der Beginn der Krampferscheinungen in einer Extremität weisen hierbei auf einen fokalen Typ hin. 1.5 Epidemiologie der Hirnschädigung Der demographische Wandel in den westlichen Industrienationen durch Rückgang der Geburtenziffer und die steigende Lebenserwartung führt zu einer wachsenden Bedeutung der typischen Alterserkrankungen. So beträgt die Prävalenz der Demenz bei 70-74-Jährigen 3%, im Alter von über 90 Jahren bereits 30% (Ziegler und Doblhammer 2009). Die Hälfte aller Schlaganfälle ereignet sich in der Altersgruppe von über 75 Jahren. Die jährliche Inzidenz von Schlaganfällen ist mit 180 bis 250 pro 100.000 Einwohner mehr als doppelt so hoch wie für traumatische Hirnschäden. Zudem nehmen traumatische Hirnschäden seit 1982 kontinuierlich ab (Hirtz et al. 2007). Lediglich für die Altersgruppe unter 45 Jahre und hier besonders für Männer, ist das Trauma immer noch die häufigste Ursache einer Hirnschädigung (Jennett 1996). Der Schlaganfall ist heute die häufigste Ursache für eine Behinderung überhaupt. Dies erfordert neue Konzepte nicht nur in der Akutversorgung, sondern auch in der stationären und ambulanten Rehabilitation. 19 1.6 Medizinische Grundlagen Unter den zahlreichen Erkrankungen, die zu einer erworbenen Hirnschädigung führen können, werden in diesem Beitrag nur einige wenige wegen ihrer großen Bedeutung für die Neurorehabilitation ausgewählt: Schlaganfall, Demenz, Parkinson-Syndrom, Schädel-Hirn-Trauma, Multiple Sklerose und Epilepsie. Dieser kurze Überblick kann auch nicht annähernd ein neurologisches Lehrbuch ersetzen. Interessierte Leser seien zur weiteren Vertiefung auf die aktuellen Lehrbücher der Neurologie von Berlit (2011) und der Neurorehabilitation von Frommelt und Lösslein (2010) verwiesen. Hilfreich sind auch die aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (http://www.dgn.org/-leitlinien-online.html). Schlaganfälle sind nicht nur die häufigste Ursache einer erworbenen Hirnschädigung, sondern auch die Hauptursache für eine bleibende Behinderung überhaupt (Johnston et al. 2009). Sie sind zu 80% durch eine Durchblutungsminderung (Ischämie) des Gehirns bedingt. Wir bezeichnen dies als Hirninfarkt. Etwa 20% der Schlaganfälle entstehen durch intrazerebrale Blutungen und seltenere Ursachen (Subarachnoidalblutung, Sinusthrombose, Vaskulitis). Unter den Hirninfarkten werden arteriosklerotische unterschieden von embolischen, die zumeist auf eine Herzrhythmusstörung (Vorhofflimmern bei absoluter Arrhythmie) zurückzuführen sind. Die medikamentöse prophylaktische Behandlung ist hier völlig unterschiedlich: Bei arteriosklerotisch bedingten Hirninfarkten werden Thrombozytenaggregationshemmer (ASS oder Clopidogrel) zur Prophylaxe weiterer ischämischer Ereignisse eingesetzt, bei kardioembolischen Hirninfarkten Marcumar. Eine exakte neurologische und kardiologische Ursachenabklärung ist auch nach einer Durchblutungsstörung des Gehirns notwendig, die sich innerhalb von 24 Stunden komplett zurückbildet (TIA: transitorische ischämische Attacke). Da in den ersten Stunden nach einem Hirninfarkt eine Auflösung des Gefäßverschlusses (Thrombolyse) häufig noch möglich ist, stellt der akute Schlaganfall einen typischen Notfall dar. Innerhalb einer gut strukturierten Versorgungskette wird der Patient in die nächstgelegen Stroke-Unit gebracht, die über eine mögliche Lyse entscheidet und die vitale Versorgung (Atmung, Blutdruck, Blutzuckerüberwachung, Fiebersenkung, Ernährung) übernimmt. Bereits in der Akutphase, oft schon am ersten Tag, erfolgen neurorehabilitative Maßnahmen wie Physio- und Ergotherapie, bei Sprach- und Schluckstörungen auch Logopädie und in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst die Einleitung einer anschließenden Rehabilitation. Neuropsychologen können frühzeitig bei den häufig bestehenden kognitiven Defiziten (beispielsweise 20 Aufmerksamkeits- und Vigilanzstörung, Neglect, Agnosie) eine neuropsychologische Testung und Übungsbehandlung einleiten. Eine psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung von Depressionen ist nicht zu vernachlässigen, da die Prognose nicht nur durch schlechte Blutzuckerwerte und Fieber, sondern auch durch Depression beeinträchtigt wird. Unter neurologischer Leitung stehende Stroke-Units bilden in Deutschland die Eckpfeiler der Schlaganfallversorgung (Ritter et al. 2012). Zu ihrem Konzept gehört jedoch unbedingt die Kooperation der verschiedenen Berufsgruppen und Fachdisziplinen. So ist eine kardiologische Abklärung bei möglichen kardioembolischen Schlaganfällen notwendig. In einigen Fällen kann auch frühzeitig eine gefäßchirurgische Maßnahme zur Beseitigung einer Gefäßenge (Stenose) durchgeführt werden. Eine neuroradiologische Intervention kann einen Gefäßverschluss darstellen und in besonders gelagerten Fällen auch durch lokale Lyse (Thrombolyse) oder mechanisch (Thrombektomie) diesen Gefäßverschluss beseitigen. Bei extremer Schwellungsneigung des Gehirns ist gelegentlich eine neurochirurgische Intervention in Form eines Heraussägens der knöchernen Schädeldecke notwendig (Kraniektomie). Andernfalls könnte das anschwellende Gehirn den Hirnstamm einklemmen und durch Ausfall der dort lokalisierten lebenswichtigen Zentren für Atmung und Kreislaufregulation zum zentralen Tod des Patienten führen. Intrazerebrale Blutungen (ICB) sind in aller Regel durch einen erhöhten Blutdruck bedingt, seltener durch Gabe von Marcumar oder durch eine Fehlbildung der Blutgefäße (Angiom, Kavernom). Wenn die Akutphase bei intrazerebralen Blutungen überlebt wird, tritt oft eine erstaunlich rasche Rückbildung der Ausfälle ein, da das Blut nach einigen Wochen vollständig resorbiert wird. Da Patienten mit Blutungen im Durchschnitt etwa zehn Jahre jünger als Patienten mit Hirninfarkten sind und oft noch im Beruf stehen, sind hier die Anforderungen an eine konsequente und früh einsetzende Rehabilitation sehr wichtig. Selten sind Blutungen unter der weichen Hirnhaut (Subarachnoidalblutungen, SAB), die in jedem Alter auftreten können und nicht durch erhöhten Blutdruck sondern durch das Platzen einer kleinen Gefäßaussackung an einer Hirnarterie (Aneurysma) hervorgerufen werden. Heftigste plötzliche Kopfschmerzen und eventuell rasch einsetzende Bewusstlosigkeit sind die Folge. Durch eine reflektorische Engstellung des Gefäßes (Spasmus) kann es zu Hirninfarkten kommen. Da Subarachnoidalblutungen vor allem bei Wiederholung in hohem Prozentsatz tödlich sind, sollte eine Ausschaltung des Aneurysmas durch neurochirurgisches Clipping oder durch neuroradiologische Intervention mit Einbringung kleiner Metallspiralen über einen Katheter (Coiling) durchgeführt werden. 21 Seltene, jedoch insbesondere in jüngeren Jahrgängen auftretende Ursachen eines Schlaganfalls sind Gefäßentzündungen (Vaskulitis) oder eine Einblutung in die Gefäßwand (Dissektion) und dadurch verursachte Arterienverschlüsse. Letztere sind manchmal durch Unfälle (Gurtverletzung am Hals) oder durch Manipulation an der Halswirbelsäule verursacht. Bei der Sinusthrombose ist der venöse Abfluss des Blutes aus dem Gehirn gestört. Sie kann, wie andere Venenthrombosen auch, während der Schwangerschaft und im Wochenbett auftreten. Klinisch sind typisch heftige Kopfschmerzen, epileptische Anfälle und Ausfälle im Bereich beider Körperseiten. Der Rückstau des Blutes führt zu Einblutungen ins Gehirn mit schweren neurologischen Ausfällen oder Todesfolge. Durch die heute übliche frühzeitige Behandlung mit Heparin können diese dramatischen Verläufe zumeist verhindert werden. Demenz ist ein sehr heterogenes Syndrom, bei dem bis dahin vorhandene kognitive Funktionen (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Denken, räumliche Orientierung, Urteilsvermögen) und Hirnleistungen wie Sprache (Aphasie), Rechnen (Akalkulie), Erkennen (Agnosie) und Handlungsabläufe (Apraxie) gestört sind. Hierdurch werden Alltagskompetenz und Berufsausübung zunehmend beeinträchtigt. Die Störungen müssen über mindestens sechs Monate anhalten. Eine Bewusstseinsstörung oder eine Einschränkung der Sinnesfunktion liegt nicht vor oder steht zumindest nicht im Vordergrund. Depression und Verhaltensstörungen sind häufig, sie erklären jedoch nicht die kognitiven Beeinträchtigungen, sondern sind als Folge der selbst wahrgenommenen Defizite oder der gestörten Kommunikation mit der Umwelt zu erklären. Die Abgrenzung einer Demenz gegenüber einer „Pseudodemenz“ bei Depression kann gerade in Frühstadien schwierig sein. Am häufigsten wird eine Demenz verursacht durch die Alzheimer-Krankheit. Als primär degenerative Hirnkrankheit ist ihre Ursache letztlich nicht geklärt. Etwa 60% der Demenz-Erkrankten leiden am Alzheimer-Typ (Ferry et al. 2005). In der Hirnrinde finden sich neuropathologische Veränderungen: senile Plaques und Neurofibrillen. Die Plaques bestehen zum größten Teil aus Beta-Amyloid-Peptid, das mit Hilfe von Sekretasen aus Amyloid-PrecursorProtein (APP) entsteht. Die Neurofibrillen-Bündel in den Nervenzellen werden aus hyperphosphoryliertem Tau-Protein gebildet. Demenzen mit diesen histologischen Merkmalen bezeichnet man daher auch als Taupathien. Durch Verlust von Nervenzellen in der Hirnrinde entsteht ein Schwund von Hirnsubstanz (Hirnatrophie) mit der Folge eines zunehmenden Verlusts der Hirnleistung. Sie ist das klassische Beispiel für eine Demenz vom kortikalen Typ. 22 Die Alzheimer-Demenz (AD) ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters, unter 55 Jahren ist sie sehr selten. Etwa 20% der über 65-Jährigen sind von ihr betroffen. Sie endet letal nach einer Überlebenszeit von fünf bis acht Jahren. Zu Beginn steht regelhaft eine zunehmende Vergesslichkeit für neue Informationen (Neugedächtnis), später ist auch das Altgedächtnis betroffen. Gerade bei vorbestehender hoher Intelligenz können die Defizite noch lange durch Floskeln und eingeübte gewandte Umgangsformen ausgeglichen werden („gute Fassade“). In Spätstadien ist das nicht mehr möglich. Depressionen sind gerade in frühen Stadien häufig, da dann die Ausfälle von den Betroffenen noch bemerkt werden; die Abgrenzung zu kognitiven Störungen bei einer primären schweren Depression („Pseudodemenz“) ist für die weitere Behandlung wichtig. Frühzeitig ist das räumliche Orientierungsvermögen gestört. So kann die Uhrzeit nicht mehr an der Stellung der Zeiger festgestellt werden („Uhrentest“). Wortfindungsstörungen sowie eine Apraxie beim Ankleiden und Essen sind in frühen bis mittleren Stadien typisch. An körperlichen Symptomen fällt zu Beginn lediglich eine Riechstörung auf. In Spätstadien sind die Patienten schließlich vollständig auf fremde Hilfe angewiesen, wobei gewöhnliche Gegenstände und vertraute Gesichter nicht mehr erkannt werden (visuelle Agnosie, Prosopagnosie). Selbst nahe Angehörige erscheinen wie Fremde. Psychiatrische Begleitsymptome wie Unruhe, Weglauftendenz, Angst und Wahn sind häufig und belasten die Angehörigen in hohem Maße. Nach der Behandlung der Schlaganfälle sind die Demenzen die in Zukunft größte Herausforderung der Neurofächer. Neben Neurologen, Psychiatern und Neuroradiologen sind hier auch Rehapädagogen gefordert. Das Scheitern dementer Patienten an den Erfordernissen des Alltags und die kaum zu ertragende Belastung der Angehörigen sind das Hauptproblem. Eine wirklich durchgreifende medikamentöse Behandlung ist nicht in Sicht. Die bisher angewandten Antidementiva vermögen allenfalls eine vorübergehende Verlangsamung des intellektuellen Abbaus zu ermöglichen (zur evidenzbasierten Diagnostik und Therapie der Demenzen siehe die Leitlinien der DGPPN und DGN 2010). Trotz der vor allem bei Kostenträgern vorherrschenden Einstellung, dass Rehabilitation bei chronisch-progredienten degenerativen Prozessen sinnlos sei, ist es eine wichtige und segensreiche Aufgabe der Neurorehabilitation, Hilfen im Alltag, Training noch vorhandener kognitiver Leistungen und Schulung der pflegenden Angehörigen durchzuführen. Die Betreuung dementer Patienten ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, die nur durch Kooperation von Hausärzten, Neurologen, Psychiatern, Psychologen, Pädagogen, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden 23 und dem Pflegedienst ansatzweise bewältigt werden kann. Kaum eine andere Erkrankung belastet Angehörige so stark. Sie müssen daher einerseits frühzeitig in die Versorgungskonzepte eingebunden, andererseits aber auch langfristig entlastet werden. Besonders die Kommunikation mit Demenzkranken, die sich häufig in Chiffren ausdrücken, muss in weiten Bereichen verstanden und gelernt werden. Damit ist viel Entwicklungsarbeit verbunden. Die Neurorehabilitation bei Demenzen ist ein wichtiger Gegenstand der Versorgungsforschung. Sie wird erst in Ansätzen sichtbar; nur 10% der Psychotherapeuten beschäftigen sich überhaupt mit Menschen, die älter als 65 Jahre sind (Voigt-Radloff und Hüll 2012)! Ambulante Diagnostik und Rehabilitation sollen nach Möglichkeit bevorzugt werden. Schon im Rahmen des physiologischen Alterns werden kognitive Verluste und besonders das schlechter werdende Gedächtnis schmerzhaft erlebt. Durch lebenslanges Lernen, kognitive, soziale und körperliche Aktivität kann die Neuroplastizität gefördert und eine gewisse Verzögerung der Defizite herbeigeführt werden (Janzarik 2012). Die Einrichtung von „Gedächtnissprechstunden“ mit pädagogischen Ansätzen (Gedächtnistagebuch, Orientierungstraining, Kommunikationshilfen) kann insbesondere in Frühstadien der Demenz Hilfen bieten. Stationäre Behandlungen bei dementen Patienten sind dagegen zumeist ungünstig, da jede Umgebungsänderung bei Demenz zu Unruhe, Angst und Verzweiflung führt. Zur differentialdiagnostischen Abklärung und Behandlung von Komplikationen sind sie allerdings häufig unumgänglich. Die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ wird in erster Linie klinisch gestellt. Das Kardinalsymptom der zunehmenden Gedächtnisstörung zusammen mit Orientierungsstörungen oder weiteren kognitiven Störungen lenkt den Verdacht auf die Erkrankung, wobei entscheidend ist, ob wirklich eine alltagsrelevante Beeinträchtigung besteht. Diese findet sich nämlich nicht bei der sog. physiologischen „Alters-Vergesslichkeit“, die zumeist nicht einmal von den Angehörigen bemerkt wird und der sog. leichten kognitiven Beeinträchtigung (mild cognitive impairment, MCI). Die Rate der Patienten mit Progression in eine Alzheimer Patient beträgt etwa 10% jährlich (Eschweiler et al. 2010). Patienten, die bei sich selbst Gedächtnisstörungen wahrnehmen, sind in hohem Maße beunruhigt. Leider ist eine spezifische frühzeitige Diagnostik durch einfache Laboruntersuchungen bis heute nicht möglich und wegen noch fehlender Behandlungsmöglichkeit auch nicht unbedingt wünschenswert. Bei allen Demenzen können neuropsychologische Testbatterien (DemTect, MMST, CERAD) das Vorhandensein und den ungefähren Schweregrad einer Demenz beschreiben. Zur orientierenden Abschätzung dient der „Uhrentest“, der eine ausführliche neuropsychologische Leistungstestung jedoch nicht ersetzt. 24 Durch Bildgebung (CCT, MRT, SPECT, PET) und Labordiagnostik werden vor allem andere Ursachen einer Demenz ausgeschlossen. Die Demenz mit Lewy-Körperchen ist die zweithäufigste degenerative Demenzform. Neben einem Parkinson-Syndrom fallen hier klinisch frühzeitig auftretende visuelle Halluzinationen und eine Neuroleptika-Überempfindlichkeit auf. Eine sehr viel seltenere neurodegenerative Demenzformen ist die frontotemporale Lobärdegeneration (FTLD, Morbus Pick), bei der es durch Frontalhirnabbau frühzeitig zu einer Enthemmung, Verflachung und einem Zerfall der Fassade der Persönlichkeit kommt. Noch seltener sind andere „fokale Demenzen“, bei denen umschriebene Hirnteile von der Neurodegeneration betroffen, z.B. das Sprachzentrum bei der primär progressiven Aphasie (PPA) oder das Sehzentrum im Okzipitallappen bei der posterioren kortikalen Atrophie (PCA). In etwa 20% führen vaskuläre Ursachen zu einer Demenz, wobei auch Mischformen mit AD vorkommen. Diese Demenzform zeigt häufig subkortikale, durch jahrelangen erhöhten Blutdruck bedingte Veränderungen im Bereich der Stammganglien (Status lacunaris) oder des Marklagers (vaskuläre Leukenzephalopathie). Schon früh erkannte man eine Arteriosklerose der kleineren Gefäße (zerebrale Mikroangiopathie) als Ursache und bezeichnet sie deshalb als subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie (SAE), nach ihrem Erstbeschreiber auch als M. Binswanger. Bedeutsam sind Demenzen, die durch andere, zum Teil behandelbare Erkrankungen verursacht werden. Sie müssen im Rahmen einer umfangreichen neurologischen Abklärung ausgeschlossen werden. Wichtig ist die Differentialdiagnose eines Normaldruckhydrozehalus (Hydrocephalus aresorptivus) mit der klinischen Symptom-Trias Demenz, Gangstörung und Blasenstörung sowie einer in der CCT sichtbaren Erweiterung der inneren Liquorräume. Hier ist eine Behandlung durch Liquorentnahme (Lumbalpunktion) oder eine Umleitung des Nervenwassers in die Blutbahn (Shunt) möglich. Behandelbar ist die Demenz auch, wenn sie durch Vitamin B12-Mangel, eine Hormonstörung wie Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) oder Erkrankungen der Nebenschilddrüse verursacht wird. Stoffwechselerkrankungen der Leber und Niere (hepatische und renale Enzephalopathie) können sich nach erfolgreicher Transplantation bessern. Auch Entzündungen des Gehirns im Rahmen einer Multiplen Sklerose oder erregerbedingt, wie bei HIV oder Lues, können zu einer Demenz führen, die Möglichkeiten einer Behandlung und Rehabilitation bietet. Tatsächlich sind manche Demenzen also durchaus behandelbar und rückbildungsfähig. Diese gilt es durch umfangreiche Diagnostik zu erkennen. Bei Demenz durch die rasch tödlich verlaufende Creutzfeldt-JacobErkrankung ist hingegen weder eine ursächliche Therapie noch eine sinnvolle Rehabilitation möglich. Gerade hier ist allerdings eine intensive Gesprächs- 25 führung und psychologische Betreuung der aufs höchste beunruhigten und verunsicherten Angehörigen notwendig. Die eigentliche Parkinsonsche Krankheit wird auch als idiopathisches Parkinson-Syndrom oder Paralysis agitans bezeichnet (zusammenfassende Beschreibung der Diagnostik und Therapie bei Ceballos-Baumann et al. 2011). Es handelt sich um eine neurodegenerative Erkrankung, bei der es zu einem fortschreitenden Verlust der melaninhaltigen schwarzen Nervenzellen in der Substantia nigra des Mittelhirns kommt. Hierdurch fehlt in den Stammganglien der Transmitter Dopamin. In letzter Zeit wurde jedoch erkannt, dass zahlreiche Orte im Gehirn von der Nervendegenration und einer Ansammlung von Lewy-Körperchen betroffen sind, was die vielfältigen nicht-motorischen Symptome der Erkrankung erklärt. Die Prävalenz beträgt etwa 160:100.000 Einwohner. Männer sind etwas häufiger als Frauen betroffen. Überwiegend tritt die Erkrankung sporadisch auf. In etwa 10% ist sie erblich. Raucher sind etwas seltener betroffen als Nichtraucher. Erst bei einem Verlust von mehr als 60% der Neurone treten erste Ausfallsymptome auf. Die Stadien werden nach Hoehn und Yahr mit 0-5 bezeichnet, wobei diese von fehlenden klinischen Zeichen bis zur Bettlägerigkeit bzw. ständige Rollstuhlbindung reichen. Die Erkrankung, von der etwa 1-2% der über 60Jährigen betroffen sind, mit einer deutlichen Zunahme der Prävalenz in den nächsten Jahrzehnten ist zu rechnen (Dorsey et al. 2007). Mit großen individuellen Schwankungen schreitet die Erkrankung über einen Zeitraum von 10–20 Jahren voran bis der Tod durch Sekundärkomplikationen (zumeist Pneumonie) bei höchstgradiger Bewegungsverarmung mit Schluck- und Atemstörung eintritt. Die klassische Trias des Parkinson-Syndroms umfasst Akinese, Rigor und Tremor. In der Regel wird sie noch ergänzt durch Standunsicherheit (posturale Instabilität). Die Bewegungsverlangsamung (Akinese, Bradykinese) ist zumeist das wesentliche beeinträchtigende Symptom. Es führt zu dem typischen kleinschrittigen, schlurfenden Gang und fehlender Mitbewegung der Arme. Vor allem automatisierte Bewegungsroutinen sind gestört. (Ebersbach in Lösslein 2010). Die Mimik ist verarmt (Hypomimie) mit seltener werdendem Lidschlag, das Gesicht erscheint maskenhaft. Die Schrift wird immer kleiner (Mikrographie) und zitteriger. Die Sprache ist leise (Hypophonie), wobei Wörter oder Silben häufig rasch wiederholt werden (Palilalie). Das Schlucken ist so stark verlangsamt, dass Nahrungsmittel und Tabletten häufig über lange Zeit im Mund gespeichert werden. Der Speichelfluss ist vermehrt (Sialorrhoe). Der erhöhte Muskeltonus mit Starre der Muskulatur (Rigor) führt bereits frühzeitig zu erhöhter Belastung der Gelenke. Deshalb sind nicht 26 selten Schulterschmerzen erster Anlass für einen Arztbesuch. Auch im weiteren Verlauf sind Schmerzen des Bewegungsapparats häufig. Das Zittern, das der Erkrankung den Namen „Paralysis agitans“ (Schüttellähmung) gegeben hat, ist ein niedrigfrequenter Ruhetremor, zumeist als einseitig betonter Antagonistentremor (Geldzähltremor, Pillendrehtremor). Eine Lähmung (Paralyse oder Parese) liegt jedoch nicht vor. Die Posturale Instabilität führt vor allem in späteren Stadien häufig zu Stürzen, da die Patienten eine begonnene Bewegung nicht abbremsen können. Manchmal kommt es auch zu plötzlichem „Einfrieren“ der Bewegung („freezing“). Bei einigen Patienten ist nicht nur der Kopf, sondern der gesamte Rumpf rechtwinkelig nach vorne gebeugt (Kamptokormie), seltener ist eine extreme Seitneigung des Rumpfes („PisaSyndrom“). Neben diesen motorischen gibt es eine große Zahl nicht-motorischer Symptome, über die fast alle Patienten berichten. So tritt ein Verlust des Riechvermögens (Anosmie) häufig schon lange vor der motorischen Beeinträchtigung auf. Depressionen und Ängste sind in allen Stadien der Erkrankung häufig und beeinträchtigen die Patienten oft stärker als die motorischen Symptome. Dies gilt ebenso für Psychosen mit Halluzinationen und Impulskontrollstörungen (Hypersexualität, Glücksspiel, stereotype Verhaltensstörung), bei denen immer besonders an Nebenwirkungen der dopaminergen Medikation gedacht werden muss. Die meisten Patienten leiden an Schlafstörungen wie nächtlicher Schlaflosigkeit, vermehrter Tagesmüdigkeit oder Erschöpfung (Fatigue). In Traumphasen können Parasomnien mit Bewegungen und Ausagieren der Träume stattfinden (REM behaviour disorder, RBD, Schenk-Syndrom). Autonome Funktionsstörungen (Orthostatische Hypotonie, Obstipation, Blasen-Mastdarmstörung, Libidoverlust, Erektionsstörung, vaginale Trockenheit, Anorgasmie) treten bei mehr als der Hälfte der Patienten auf. Falls sie das klinische Bild beherrschen, ist allerdings eine Multisystematrophie eher anzunehmen als ein idiopathisches Parkinson-Syndrom. Auch handelt es sich häufig um Nebenwirkungen der Medikation. Charakteristisch sind die Hautveränderungen mit Seborrhoe („Salbengesicht“). Kognitive Störungen sind sehr häufig. Sie äußern sich zunächst in allgemeiner Verlangsamung der Denkabläufe (Bradyphrenie). Demenz entsteht im Verlauf der Parkinson-Erkrankung bei fast der Hälfte der Patienten. Im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz handelt es sich bei der Parkinson-Demenz um eine typische „subkortikale“ Demenz, bei der die Exekutivfunktionen, wie mentale Umstellungsfähigkeit („set shifting“), Aufmerksamkeit und Handlungsplanung besonders beeinträchtigt sind. Ausgeprägte Gedächtnisstörungen sind hingegen selten. 27 Eine kausale Therapie ist bis heute nicht möglich. Durch symptomatische Behandlung mit L-DOPA oder dopaminergen Medikamenten gelingt jedoch insbesondere in der Anfangszeit der Erkrankung eine erhebliche Reduktion der motorischen Ausfälle. In Spätstadien kommen auch Medikamentenpumpen oder die tiefe Hirnstimulation bei geeigneten Patienten zur Anwendung. Ein großes Problem sind die Wirkungsfluktuationen mit raschem Wechsel von überbeweglichen und unbeweglichen Phasen („on-off-Phänomen“). Die Hyperkinesen kommen ebenso wie die Halluzinationen durch ein relatives Überwiegen von Dopamin in Relation zu der nur noch geringen Neuronenzahl in der Substantia nigra zustande. Schwerste Hyperkinesen und schmerzhafte Dystonien der Extremitäten sind die Folge. Von Anfang an ist regelmäßige Bewegung beim Parkinson-Syndrom ebenso wichtig wie die Medikamenteneinnahme. Bewegungstherapie in Form von Physiotherapie, auch unterstützt durch von außen oder innerlich gegebene Kommandos, Musik und Tanz, ist in jeder Phase notwendig. Vorübergehende Bettlägerigkeit durch interkurrente Erkrankungen oder Operationen führt bereits nach wenigen Tagen zu einem raschen Abbau noch erhaltener motorischer Funktionen. Ungünstig wirkt sich hierbei die bei den meisten Parkinson-Patienten vorhandene Antriebshemmung aus. Ergänzt wird die Behandlung durch Ergotherapie, Logopädie und Neuropsychologie. Das idiopathische Parkinson-Syndrom ist unter den Formen am häufigsten. Es beginnt häufig auf einer Körperseite und kann überwiegend mit Tremor (Tremordominanztyp) oder Akinese (Akinetischer Typ) einhergehen. Atypische Formen durch Neurodegenration zusätzlicher Systeme im Gehirn sind durchwegs sehr selten und sprechen nur gering oder gar nicht auf dopaminerge Medikamente an. So kann eine besonders deutliche Koordinationsstörung (Ataxie) auf eine Multisystematrophie (MSA) vom zerebellären Typ (MSAC, olivo-ponto-zerebelläre Atrophie, OPCA) hinweisen, schwere frühzeitige Akinese, die kaum oder gar nicht auf L-DOPA-Medikation anspricht, ist kennzeichnend für den Parkinson-Typ der MSA-P. Ausgeprägte orthostatische Hypotension und Blasenstörung kennzeichnen die Multisystematrophie vom Typ Shy-Drager. Die Prognose der MSA ist mit einer Überlebenszeit von fünf bis zehn Jahren schlechter als beim idiopathischen ParkinsonSyndrom. Stehen Demenz und Halluzinationen bereits zu Beginn der Erkrankung im Vordergrund und nicht die motorischen Symptome, ist an eine Lewy-Körperchen-Demenz zu denken. Weitere atypische ParkinsonSyndrome sind die Kortikobasale Degeneration mit sehr starker asymmetrischer Akinese, Apraxie und dem typischen „alien-limb-Syndrom“, bei welchem eigene Körperteile und ihre Bewegungen als fremd empfunden werden. Eine mit einer Prävalenz von 1,5:100.000 nicht so seltene Neurodegeneration 28 ist die Progressive supranukleäre Paralyse (PSP, Steele-RichardsonOlszewski-Syndrom). Auffällig sind eine vertikale, später auch horizontale Blickparese mit weit geöffneten Augen, dadurch seltsam erstauntem Gesichtsausdruck („astonished face“) und frühzeitig auftretender posturaler Instabilität mit Sturzneigung. Auch bei atypischen Parkinson-Syndromen sind eine regelmäßige Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie sinnvoll. Die geschätzte Inzidenz aller Schweregrade des Schädel-Hirn-Traumas beträgt 332 pro 100.000 Einwohner jährlich. Davon sind jedoch nur etwa 10% schwere oder mittelschwere Fälle und nur 3% werden länger als drei Wochen stationär behandelt (Rickels 2010). Andererseits ist das SHT die häufigste Todesursache von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis zum Alter von 45 Jahren (Jennett 1996). Die meisten Betroffenen werden von Allgemeinmedizinern, Neurologen und Chirurgen behandelt, nur 10% von Neurochirurgen. Die häufigste Ursache für ein SHT ist ein Sturz, nur noch 27% sind durch Verkehrsunfälle bedingt. Eine rasche Beurteilung der weiteren Behandlungspfade ist auch für Rettungssanitäter möglich durch die Glasgow-Coma–Scale (GCS), die Augenöffnen, beste verbale und beste motorische Reaktion beurteilt. Sie reicht von minimal drei bis maximal 15 Punkten. Bedeutsam ist sie auch für die Langzeitprognose, denn Kohortenstudien zeigen, dass Patienten mit schwerem SHT (GCS 8) eine Letalität von 30% aufweisen. Nur 25% von ihnen erlangen eine langzeitige funktionelle Unabhängigkeit (Jijang 2002). Gerade bei diesen schwerstbetroffenen Patienten ist eine frühzeitige und konsequente Rehabilitation entscheidend für die gesamte weitere Lebensführung. Das leichteste Trauma im Bereich des Kopfes, das ganz ohne Bewusstlosigkeit oder Zeichen einer Funktionsstörung des Gehirns einhergeht, ist die Schädelprellung. Die zu Beginn bestehenden Kopfschmerzen klingen dabei folgenlos nach Tagen bis wenigen Wochen ab, eine Behandlung ist nicht erforderlich. Bei Bewusstlosigkeit ohne andere neurologische Ausfälle bezeichnen wir dies als Commotio cerebri. Hierbei besteht stets eine Amnesie für das Unfallereignis, eine gewisse Zeit davor (retrograde Amnesie) und danach (anterograde Amnesie). Die Dauer der Bewusstlosigkeit und der Amnesie ist ein gewisses Maß für die Schwere der Hirnschädigung. So wird bei einer Bewusstlosigkeit von fünf bis 60 Minuten von einem leichten SHT, bei bis zu 24 Stunden Bewusstlosigkeit von einem mittelschweren SHT und über 24 Stunden von einem schweren SHT gesprochen (Greenberg 2010). Auch die Commotio cerebri heilt folgenlos aus und bedarf keiner spezifischen Behandlung. Die Patienten sollten früh mobilisiert werden. Allenfalls bis zu vier Wochen können Kopfschmerzen oder vegetative Störungen (unsystema- 29 tischer Schwindel) anhalten. Treten außer Bewusstlosigkeit auch neurologische Ausfälle oder epileptische Anfälle auf, kann dies ein Zeichen für eine Hirnsubstanzschädigung oder Contusio cerebri sein. Auch eine länger als zwei Stunden anhaltende Bewusstlosigkeit spricht in der Regel für eine substanzielle Hirnschädigung im Sinne einer Contusio cerebri. Die Abgrenzung ist wichtig, da eine Contusio cerebri dauerhafte neurologische Ausfälle und noch nach Jahren Folgeschäden verursachen kann. Für die Dringlichkeit einer neurochirurgischen Operation ist häufig maßgeblich, ob eine Schädelfraktur oder eine Verletzung der harten Hirnhaut (Dura mater) vorliegt. Die Duraverletzung ist das Kriterium für ein offenes Schädel-Hirn-Trauma. Dieses muss in der Regel operativ versorgt werden, da die Prognose wegen der Gefahr einer Meningitis bedeutend schlechter ist als bei einer gedeckten Schädel-Hirnverletzung. Auch Blutungen zwischen Hirnhaut und Schädeldecke (epidurales Hämatom) oder unter die harte Hirnhaut (Subduralhämatom) bedürfen der operativen Entlastung, falls sie eine raumfordernde Größe erreichen. Epidurale Hämatome sind dabei besonders gefürchtet, da sie aus Zerreißung von Arterien entstehen und sich bereits in den ersten Stunden nach dem Unfall entwickeln können. Subdurale Hämatome entstehen langsamer, da sie venöser Natur sind. Selbst nach mehreren Monaten können sie noch klinisch manifest werden (chronisches Subduralhämatom). Epidurales und subdurales Hämatom wurden früher als Compressio cerebri zusammengefasst. Typisch ist bei ihnen, dass es nach kurzer oder sogar fehlender anfänglicher Bewusstlosigkeit zu einer Phase der Aufhellung („luzides Intervall“) kommt und danach wieder zu tiefer Bewusstlosigkeit. Die Pupille ist auf der Seite der Blutung erweitert (Mydriasis). Der Begriff „Raumforderung“ hat nicht nur im Bereich der Neurotraumatologie, sondern auch bei Tumoren, Schlaganfällen und Entzündungen des Gehirns eine für das therapeutische Handeln und die Prognose zentrale Bedeutung. Da das Gehirn zusammen mit Liquor und Blut vom knöchernen Schädel umgeben ist, hat keine zusätzliche Masse im Schädelinneren Platz. Das Gehirn weicht deshalb im Falle einer Raumforderung nach unten in Richtung Hinterhauptsloch aus. Dort klemmt es sich selbst ein, indem es auf die lebenswichtigen Zentren und Bahnen im Hirnstamm drückt. Die Symptome dieser oberen und unteren Einklemmung sind Mydriasis, Streckkrämpfe, Bewusstlosigkeit, schließlich Atemstillstand und Tod. Das Gehirn reagiert auf Druck stets mit einer Schwellung durch Wasseransammlung (Ödem). Der erhöhte Hirndruck durch das Hirnödem infolge Contusio oder Compressio cerebri ist häufig Ursache für eine anhaltende Bewusstlosigkeit. Bei der intensivmedizinischen Überwachung nach schwerem SHT mit tiefer Bewusst- 30 losigkeit wird häufig der intrakranielle Druck kontinuierlich mittels einer Drucksonde gemessen. Wenige Tage nach dem Trauma hat er sein Maximum erreicht, falls nicht weitere Komplikationen, wie erneute Blutungen oder Infektionen, zu einer länger anhaltenden Hirndruckerhöhung und Bewusstlosigkeit führen. Die Hirndrucktherapie erfolgt durch Oberkörperhochlagerung, Infusion von hypertonen Lösungen (Mannitol), Senkung der Körpertemperatur (Hypothermie), Beatmung, evtl. Sedierung mit Barbiturat oder operative Entfernung eines großen Knochendeckels aus der Schädeldecke (Kraniektomie). Der Knochendeckel wird zumeist unter der Bauchdecke aufbewahrt und nach Möglichkeit später, in der Regel erst nach der Neurorehabilitation, wieder eingesetzt. Eine wichtige pathophysiologische Besonderheit beim SHT ist die Relativbewegung des Gehirns innerhalb der Schädelkapsel bei äußerer Gewalteinwirkung. Dies hat häufig zur Folge, dass die oberhalb der Nase durch die Schädelbasis tretenden feinen Riechfäden (Fila olfactoria) abreißen und der Patient deshalb an einem Verlust des Riechvermögens für aromatische Substanzen (Anosmie) leidet. Schwerwiegender sind die durch Druck und Sogwirkung entstehenden Rindenprellungsherde am Gehirn selbst, wobei die Stelle des Anschlags („Coup“) meist kleiner ist als die gegenüberliegende Stelle („Contre-Coup“). Bei schwerem Schädelhirntrauma mit langdauernder Bewusstlosigkeit ist an ein „diffuses axonales Trauma“ zu denken, bei welchem es durch Schwerkräfte zu Läsionen der Nervenfasern im Bereich des Balkens, der inneren Kapsel und des Hirnstamm kommt. In der Kernspintomographie (MRT) des Gehirns können sie sichtbar gemacht werden. Die Prognose ist ungünstig. Infolge ihres Verlaufs an der Schädelbasis werden die dort verlaufenden Hirnnerven häufig geschädigt. Besonders anfällig hierfür sind neben den bereits genannten Fila olfactoria die Augenbewegungsnerven (N. oculomotorius, N. trochlearis und N. abducens). Die Patienten klagen dann über die entstehenden Doppelbilder oder Muskelverspannung infolge ständiger Zwangshaltung des Kopfes, um die Doppelbilder auszugleichen (Okulärer Schiefhals). Eine Schädigung des Hör- und Gleichgewichtsnervens (N. vestibulo-cochlearis) und des motorischen Gesichtsnervens (N. fazialis) entsteht häufig bei einer Schädelbasisfraktur des Felsenbeins. Hörminderung und Gleichgewichtsstörung mit Fallneigung auf die betroffene Seite sowie die typische Gesichtslähmung mit fehlendem Lidschluss und „schiefem“ Mund sind die Folge. Traumatische Schäden der Hirnnerven können sich nach einigen Monaten spontan zurückbilden. 31 Eine folgenschwere Komplikation nach einem SHT ist eine Liquorfistel, die durch ein Leck in der Dura nach Fraktur der vorderen Schädelbasis entsteht. Aus der Nase tropft Liquor, der mittels Glukoseteststreifen leicht als solcher erkannt werden kann. Manchmal verschließt sich der Defekt spontan, ansonsten muss er operativ verschlossen werden, da es sonst zu einer lebensgefährlichen eitrigen Meningitis durch aufsteigende Keime kommen kann. Als weitere Komplikation nach SHT sind auch epileptische Anfälle zu werten, die nur selten in den ersten Stunden nach dem Trauma (Frühanfälle), häufig erst Monate und Jahre danach auftreten. Für viele Patienten bleibt die posttraumatische Epilepsie hinsichtlich der Berufstätigkeit und allgemeiner Lebensführung die wichtigste Traumafolge. Durch das bestehende Fahrverbot sind sie in ihrer Mobilität und Berufsausübung eingeschränkt. Ursache der Anfallsentstehung ist eine Verletzung und Narbenbildung im Bereich der Hirnrinde. Somit kann eine posttraumatische Epilepsie auch im Nachhinein als Hinweis auf eine kontusionelle Hirnschädigung gewertet werden. Sie entsteht nicht nach Schädelprellung oder Commotio cerebri. Für die Phase der Rehabilitation und die berufliche und soziale Wiedereingliederung sind die psychopathologischen Folgen nach einer Hirnverletzung oft noch entscheidender als Lähmungserscheinungen oder epileptische Anfälle. Zum einen finden sich nach traumatischer Hirnschädigung organisch bedingte psychische Veränderungen der Persönlichkeit, der Aufmerksamkeit, des Antriebs, der Denkvorgänge und der Stimmungslage, die häufig unter dem Begriff des „hirnorganischen Psychosyndroms“ (HOPS) oder der „organischen Wesensänderung“ zusammengefasst werden. Gerade bei Verletzungen des Stirnhirns (Frontallappen) sind Wesensänderungen mit Reizbarkeit, Kontrollverlust und Antriebshemmung oder -steigerung häufig. Sie können eine soziale und berufliche Integration erheblich erschweren oder sogar unmöglich machen und sollten daher durch neuropsychologische Diagnostik und Therapie frühzeitig erkannt und nach Möglichkeit behandelt werden. Psychische Folgen des SHT müssen jedoch nicht durch eine organische Dauerschädigung des Gehirns bedingt sein. Bewusstlosigkeit und Amnesie führen regelhaft zu einer erheblichen angstvollen Verunsicherung in der Wahrnehmung des Selbst und der Umgebung. Daher sind psychische Reaktionen und psychosomatische Störungen (anhaltende Kopfschmerzen, unsystematischer Schwindel, Depressionen) auch bei leichteren SHT häufig. Auch bei den schwersten Traumafolgen, wie anhaltender Bewusstlosigkeit oder einem sich daraus entwickelndem apallischen Syndrom, wird nach Untersuchungsergebnissen der Psychotraumatologie von einigen Autoren psychoreaktiven Mechanismen eine Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung dieses 32 Zustands zuerkannt (Zieger und Schönle 2004). Leider wird bei vielen Patienten nach einem SHT der weitere Lebensweg bestimmt durch einen dauerhaften Kampf wegen vermeintlich oder wirklich erlittenen Unrechts und um eine versicherungsrechtliche Entschädigung. Auch diese Fehlentwicklung soll durch frühzeitige neuropsychologische Behandlung bzw. sinnvolle Sozial- und Rechtsberatung vermieden werden. Rehabilitation und sozialmedizinische Begutachtung sind zeitlich und inhaltlich aufeinander abzustimmen. Noch bestehende Entschädigungswünsche und ungeklärte Rentenansprüche erschweren rehabilitative Maßnahmen erheblich oder machen sie sogar unmöglich. Die Multiple Sklerose (MS) wird auch Encephalomyelitis disseminata (E.d.) genannt. Es handelt sich um die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems (Gehirn und Rückenmark). In Deutschland sind etwa 130.000 Menschen an MS erkrankt (Faiss und Wiethölter 2011). Die jährliche Zahl der Neuerkrankungen (Inzidenz) beträgt ca. fünf auf 100.000 Einwohner Zumeist sind 20-45-Jährige betroffen, Frauen etwa dreimal häufiger als Männer. Bei Kindern und alten Menschen ist MS sehr selten. Ursächlich ist wahrscheinlich eine fehlerhafte Reaktion des eigenen Immunsystems (Autoimmunerkrankung), wobei der Grund für diese Fehlreaktion nicht bekannt ist. Die autoimmune Reaktion richtet sich gegen die Markscheiden (Myelin) im Zentralnervensystem, die durch die Entzündung geschädigt werden (Demyelinisierung). Viele Befunde sprechen allerdings dafür, dass frühzeitig auch die Axone in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies ist von Bedeutung, da eine Regeneration bei Demyelinisierung recht gut, bei axonaler Schädigung jedoch kaum möglich ist. In den letzten Jahren wird die einseitige Sicht der MS als einer rein entzündlichen Erkrankung revidiert durch die Bedeutung parallel ablaufender neurodegenerativer Prozesse. In den ersten Krankheitsjahren verläuft die MS zu 80% schubförmig. Disseminierte Entzündungsherde treten im Bereich des Zentralnervensystems auf, bevorzugt in der Nähe der Seitenventrikel, des Balkens, des Hirnstamms und im Kleinhirn. Häufig ist gerade zu Beginn der Erkrankung der Sehnerv von der Entzündung betroffen (Opticusneuritis, Retrobulbärneuritis). Die neurologischen Symptome sind von der Lokalisation der Entzündungsherde abhängig und sehr individuell: Häufig sind Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen mit fleck- oder querschnittsförmiger Verteilung, Doppelbilder, Lähmungen mit Spastik, Blasen- und Potenzstörungen sowie Stand- und Gangunsicherheit. Die Sprache ist oft unartikuliert (dysarthrisch), verwaschen-lallend oder skandierend. Schmerzen (z.B. Trigeminusneuralgie) sind nicht selten. 33 Für die Neurorehabilitation besonders wichtig sind kognitive Beeinträchtigungen, insbesondere Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen, die bei mehr als der Hälfte der Hälfte der Patienten nachgewiesen werden können (Hildebrandt und Schwendemann 2004, Calabrese und Penner 2007). Mit progredienter axonaler Schädigung und Hirnatrophie nehmen sie noch zu. Von den meisten Patienten wird eine ungewohnte Müdigkeit („fatigue“Syndrom) als besonders beeinträchtigend bemerkt. Auch Depressionen, seien sie reaktiv oder organisch bedingt, sind häufig. Seltener sind insbesondere in Spätstadien auftretende euphorische Gemütszustände. Die Schwere der Beeinträchtigung wird zumeist mit der Expanded Disability Status Scale (EDSS) angegeben. Sie reicht von 0 (normal) bis 10 (Tod infolge MS) und ist überwiegend auf die Gehbehinderung ausgerichtet. Für viele Behinderungen, wie beispielsweise kognitive Störungen, Schmerzen, Sehstörungen oder Depressionen, ist sie ungeeignet. Daher wird zusätzlich die Anwendung der Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) empfohlen (Vaney und Roth 2010). Die Ausfälle bilden sich nach einer Schubdauer von wenigen Wochen zurück, wobei mit zunehmender Krankheitsdauer immer mehr Reste von neurologischen Ausfällen verbleiben. Nach Jahrzehnten geht der schubförmigremittierende Verlauf häufig über in eine sekundär-chronische Progredienz. Selten sind von Anfang an stetig fortschreitende Verläufe ohne Schübe (primär-progredienter Verlauf). In mehr als 10% ist die MS gutartig mit seltenen Schüben, kaum merklichen Ausfällen und auch nach Jahrzehnten fehlender Behinderung. Selten sind maligne Verläufe, die in wenigen Monaten zum Tod führen (Marburg-Variante). Eine besondere Form ist die Neuromyelitis optica (Devic-Syndrom) mit ausschließlichem Befall von Sehnerv und Rückenmark. Die Therapie der MS hat sich in den letzten 20 Jahren durch die Einführung immunmodulatorischer Medikamente grundlegend verändert. Mit selbst durchführbaren Injektionen von Beta-Interferon oder Glatiramerazetat gelingt es, die Schubhäufigkeit um ein Drittel zu reduzieren (Basistherapie). Falls dennoch weitere Schübe in hoher Frequenz auftreten, kommt eine Eskalationstherapie mit Fingolimod oder Natalizumab in Frage. In extrem schweren Fällen werden auch Immunsuppressiva aus der Krebstherapie, wie Cyclophosphamid, angewandt. Die Schübe selbst können verkürzt werden durch Cortison (Prednisolon), das zumeist als intravenöse Stoßtherapie über drei bis fünf Tage verabreicht wird mit anschließendem Ausschleichen über einige Wochen. Eine Cortisongabe direkt in den Liquor (intrathekale Therapie) ist 34 in besonderen Fällen möglich. Insgesamt haben die modernen Therapieschemata eine erheblich Verbesserung der Schubfrequenz und des Behinderungsgrades erbracht, eine Heilung der MS ist allerdings bis heute nicht möglich. Im Rahmen der Rehabilitation spielt die symptomatische medikamentöse Behandlung eine sehr wichtige Rolle. Spastik, Blasenstörung, Schmerzen, Depressionen und Anfälle können günstig beeinflusst und dadurch die stets notwendige Physiotherapie oft erst ermöglicht werden. Ambulant und stationär durchgeführte Neurorehabilitation kann die Lebensqualität der Betroffenen und ihre Teilhabe am Alltagsleben verbessern. Allerdings müssen deren Wünsche, Möglichkeiten und Lebensumstände im Sinne der kontextsensitiven Neurorehabilitation stets berücksichtigt werden. Hierzu ist es erforderlich, „sie im wörtlichen und übertragenen Sinn dort abzuholen, wo sie sich im wirklichen Leben befinden“ (Frommelt und Grötzbach 2010). Epilepsien gehören zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. Etwa 4% aller Menschen erleiden einen einmaligen epileptischen Anfall, zumeist ausgelöst durch Fieber (Fieberkrämpfe) oder Schlafentzug. Von Epilepsie wird jedoch nur bei mehrfachen Anfällen gesprochen oder, wenn neben einem Anfall zumindest eine durch EEG oder MRT nachgewiesene Prädisposition für weitere Anfälle besteht. Von der Erkrankung sind etwa 0,5-1% der Bevölkerung betroffen, die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen (Inzidenz) liegt zwischen 20 und 70/100.000 Einwohner (Tettenborn et al. 2011). Sie ist stark altersabhängig mit einem Gipfel in der frühen Kindheit und einem weiteren im Alter. Gerade die erstmals im Alter auftretenden Anfälle, die überwiegend vaskulär bedingt sind, haben erheblich zugenommen. Das Erscheinungsbild epileptischer Anfälle (Anfallssemiologie) ist sehr vielfältig. Für die Einordnung ist die Anfallsbeobachtung essentiell, da häufig weder in der Bildgebung noch im EEG pathologische oder gar spezifische Veränderungen auftreten. Oft ist der Neurologe hierbei auf Angaben des Patienten oder anwesender Personen angewiesen. Besonders schwierig kann eine Unterscheidung organischer und psychogener (dissoziativer) Anfälle sein, zumal beide Formen bei ein und demselben Patienten auftreten können. Eigene Angaben des Patienten sind vor allem dann verwertbar, wenn herdförmig Anfälle ohne Bewusstseinstrübung (einfach-fokale Anfälle) auftreten oder vor dem eigentlichen Anfall ein „Vorgefühl“ (Aura) auftritt. Hierbei ist ein unbestimmtes Gefühl in der Magengegend (epigastrische Aura) am häufigsten, aber auch visuelle, olfaktorische, akustische oder affektive Eindrücke und Gefühle können vom Herannahen eines Anfalls künden und zum Teil bereits Hinweise auf die anatomische Lokalisation des epileptogenen Fokus geben. Eine Bewusstseinstrübung tritt nicht selten auch bei fokalen Anfällen 35 auf (komplex-fokale Anfälle, ältere Bezeichnungen: Temporallappenepilepsie, psychomotorische Anfälle). Dennoch kann der Patient dabei Bewegungen oder komplexe Handlungen ausführen („Dämmerzustand“). Ein komplex-fokaler Anfallsstatus kann Tage oder Wochen lang anhalten („nichtkonvulsiver Status“). Für diese Zeit besteht eine Erinnerungslücke (retrograde Amnesie). Nur sekundenlange, jedoch mit hoher Frequenz auftretende Bewusstseinstrübungen, meist verbunden mit einer Blickbewegung nach oben, sind typisch für Absenzen des Kindes- und Jugendalters (Pyknolepsie). Bei der juvenilen myoklonischen Epilepsie des Jugendalters (Janz-Syndrom) treten zumeist morgens nach dem Aufwachen Anfälle mit heftigen schleudernden Bewegungen auf, die so kurz sind, dass eine Bewusstseinstrübung nicht bemerkt wird. Der große generalisierte tonisch-klonische Anfall (Grand Mal) kann primär auftreten oder sich sekundär aus einem fokalen Anfall entwickeln. Mit oder ohne Aura kommt es, manchmal nach einem Initialschrei, zu Bewusstseinsverlust und Hinstürzen. Die Atmung setzt aus, der Patient wird „blau“ (zyanotisch). Die gesamte Muskulatur verkrampft sich tonisch, wobei es sehr häufig zu einem Zungenbiss kommt. In der sich anschließenden klonischen Phase bewegen sich die Extremitäten und das Gesicht rhythmisch, sodass blutiger, schaumiger Speichel aus dem Mund tritt. Einnässen oder Einkoten sind die Regel. Nach Beendigung der Krampfphase kann sich ein langer Terminalschlaf anschließen oder auch ein Erregungszustand mit motorischer Unruhe und Selbst- oder Fremdgefährdung (postparoxysmaler Dämmerzustand). Für den gesamten Ablauf besteht eine Amnesie. Mehrere Anfälle hintereinander werden als Serie bezeichnet. Erlangt der Patient zwischen den Anfällen das Bewusstsein nicht, spricht man von einem Grand-Mal-Status. Ätiologisch wird die Epilepsie in drei große Gruppen eingeteilt: idiopathisch, symptomatisch und kryptogen. - Die idiopathische Epilepsie manifestiert sich im Kindesalter häufig mit Absencen (Pyknolepsie), später überwiegend als Aufwach-Grand-Mal. Das EEG zeigt ein typisches Muster (3/sec-Spike-Wave-Komplexe). Häufig besteht eine Fotosensibilität, die durch EEG-Ableitung mit Flickerlicht nachgewiesen werden kann. Die genetisch bedingte Disposition zu dieser Anfallsform ist hoch. - Symptomatische Epilepsien können nach jeder Art von Hirnschädigung auftreten. In jüngeren Jahren sind es häufig perinatale Hirnschädigungen („Residualepilepsie“), Schädel-Hirn-Traumata oder Entzündungen, später chronischer Alkoholabusus, Tumore, Gefäßfehlbildungen (Angiome, Kavernome) und vor allem Schlaganfälle (vaskuläre Epilepsie). Symp- 36 tomatische Anfälle werden insbesondere vermutet, wenn fokale Anfälle beobachtet werden – mit oder ohne sekundäre Generalisierung. - Bei vielen Patienten kann ein Defekt im Gehirn als Ursache der Epilepsie nicht nachgewiesen werden. Diese leiden an einer kryptogenen Epilepsie. Zur medikamentösen Behandlung der Anfälle stehen heute mehr als 25 verschiedene antikonvulsive Substanzen zur Verfügung mit unterschiedlicher Indikation, Wirkungsweise und Verträglichkeit. Damit können Anfallsfreiheit oder eine deutliche Reduktion der Anfallsfrequenz in 50-80% erreicht werden. Der guten Wirksamkeit stehen allerdings häufig erhebliche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten gegenüber. Die Behandlung wird zumeist nach dem zweiten Anfall begonnen und bis zu einer Anfallsfreiheit von mindestens zwei Jahren, häufig auch lebenslang, fortgesetzt. In einem Teil der refraktären Fälle lässt sich mit aufwändigen diagnostischen Maßnahmen ein epileptogener Fokus nachweisen, der einer epilepsiechirurgischen Therapie zugänglich ist. Zumeist handelt es sich hierbei um Patienten mit komplex-fokalen Anfällen, die ihren Ursprung im medialen Temporallappen (Hippokampus, Amygdala) nehmen. Die psychischen, biographischen und sozialen Auswirkungen eines geglückten epilepsiechirurgischen Eingriffs oder einer erfolgreichen medikamentösen Einstellung sind erheblich. Anfallsfreiheit oder -reduktion zu erreichen, ist das Hauptziel der Behandlung. In vielen Fällen ist damit eine geglückte Teilhabe möglich. Die Entlassung aus der krankheitsbedingten Abhängigkeit kann allerdings für einige Kranke (und ihre Familien!) zunächst eine Überforderung bedeuten („burden of normality“, Wilson 2004). Die Epilepsie unterscheidet sich durch wichtige Eigenschaften von anderen chronischen Erkrankungen des Gehirns. Anfälle sind nicht vorhersehbar, treffen den Patienten wie ein Blitz und führen zu Gefährdung seiner körperlichen und seelischen Integrität und Autonomie. Angst vor neuen Anfällen ist daher ein ständiger Begleiter. Die Gefahr der Selbst- und Fremdgefährdung führt zu zahlreichen Einschränkungen in der Lebensführung, von denen das zeitlich begrenzte oder dauerhafte Fahrverbot in unserer mobilen Gesellschaft für viele besonders einschneidend ist. Der Ausschluss von Arbeiten an Maschinen, auf Leitern und Gerüsten führt häufig zur Berufsaufgabe und kann einen sozialen Rückzug einleiten. Neben dieser durch Gefährdung begründeten Ausgrenzung erleben viele Patienten eine tatsächliche oder vorweggenommene Stigmatisierung (Specht und Thorbecke 2010). Gerade bei einem Grand-Mal reagiert die Umgebung mit Angst, Schrecken und Überaktivität. Diese kann eine zusätzliche Gefährdung bedeuten. So sollte im Anfall keinesfalls ein Gummikeil oder ähnliches in den Mund geschoben werden. Der 37 Versuch, die Extremitäten festzuhalten, kann zu Knochenbrüchen führen. Andererseits sollten Gegenstände aus dem Weg geräumt und der Patient genauestens beobachtet werden (Blick- und Kopfwendung, Beginn der Konvulsionen mit welcher Extremität etc.). Die Verständigung des Notarztes ist in der Regel nicht notwendig. Eine stationäre Notfallbehandlung ist nur beim Anfallsstatus oder bei Komplikationen erforderlich. Obwohl Epilepsie in ihrer Entstehung eine körperlich begründete Erkrankung ist, besteht eine hohe Komorbidität mit psychischen Erkrankungen. Depressionen sind sehr häufig und beeinträchtigen die Lebensqualität mehr als die Anfallsfrequenz (Boylan et al. 2004). Kognitive Störungen insbesondere im Bereich der Gedächtnisfunktion können auch in anfallsfreien Intervallen zu Beeinträchtigungen führen. Selten sind Psychosen nach Anfallsfreiheit (Alternativpsychose). Viele psychische Störungen sind auch Folge der Langzeitmedikation mit zentral wirkenden Pharmaka. Besonders die älteren Medikamente wie Barbiturate führten regelmäßig zu schweren psychischen Nebenwirkungen. So nimmt man heute an, dass ein nach langem Anfallsleiden auftretendes Psychosyndrom mit typisch „haftender“ (enechetischer) Wesensänderung multifaktoriell, teilweise medikamentenbedingt und nicht spezifisch für die Epilepsie ist (Huber 2005). Eine Demenz auf dem Boden der Epilepsie ist selten. Ein besseres Verständnis der vielfältigen Problematik „Erworbene Hirnschädigung“ und Epilepsie bei Betroffenen, Angehörigen und Pflegeberufen sowie Lehrern zu fördern, ist eine dankbare Aufgabe für die Rehabilitationspädagogik. Literatur Berlit, P. (Hrsg.) (2011). Klinische Neurologie. 3. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer Boylan, L.S./Flint, L.A./Labovitz, D.L./Jackson, S.C./Starner, K./Devinsky, O. (2004). Depression but not seizure frequency predicts quality of life in treatment-resistant epilepsy. Neurology, 62, 258-261 Calabrese, P./Penner, I.K. (2007). Neuropsychologische Störungen bei MS. In: Calabrese, P. (Hrsg.): Multiple Sklerose und Kognition. Stuttgart, Thieme, 2-8 Candelise, L./Gattinoni, M./Bersano, A./Micieli G./Sterzi, R./Morabito, A. on the behalf of the PROSIT Study Group (2007). Stroke-unit care for acute stroke patients: an observational follow-up study. In: Lancet 369, 299-305. Ceballos-Baumann, A.O./Schwarz, M./Wessel, K./Weiland, T. (2011). Bewegungsstörungen. In: Berlit, P. (Hrsg.): Klinische Neurologie. 3. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer, 955-1054 Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)/Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) (Hrsg.) (2010). Diagnose- und Behandlungsleitlinie Demenz. [interdisziplinäre S3-Praxisleitlinien]. Berlin-Heidelberg: Springer 38 Dorsey E.R./ Constantinescu R./ Thompson J.P. et al. (2007). Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030. In: Neurology, 68, 384386 Ebersbach, G./Wissel, J. (2010). Parkinsonkrankheit und Dystonie. In: Frommelt, P./ Lösslein, H. (Hrsg.), NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg: Springer, 711-738 Ende-Henningsen, H../Henningsen, H. (2010). Neurobiologische Grundlagen der Plastizität des Nervensystems, In: Frommelt, P.; Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. BerlinHeidelberg, 67-79 Eschweiler, G.W./ Leyhe, T/ Klöppel, S/ Hüll, M. (2010). Neue Entwicklungen in der Demenzdiagnostik. In: Dtsch. Ärztebl., 107, H.39, 677-683 Faiss, J.H./Wiethölter, H. (2011). Multiple Sklerose. In: Berlit, P. (Hrsg.): Klinische Neurologie. 3. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer, 1219-1257 Ferri, C.P./ Prince, M./ Brayne, C. (2005). Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. In: Lancet. 366, 2112-2117 Fuchs, T. (2012). Das Gehirn - ein Beziehungsorgan: Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. 4. Auflage, Stuttgart: Kohlhammer Frommelt P. (2010). Rehabilitation von Personen mit einem Schlaganfall. In: Frommelt, P./Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg, 634-672 Frommelt, P./Grötzbach, H. (2010). Kontextsensitive Neurorehabilitation: Einführung in die klinische Neurorehabilitation. In: Frommelt, P.; Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg, 4-22 Frommelt, P./Lösslein, H. (Hrsg.) (2010). NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg: Springer Gerstenbrand, F. (1967). Das traumatische apallische Syndrom. Wien: Springer Greenberg, M.S. (2010). Handbook of Neurosurgery. Stuttgart: Thieme Heuschmann, P.U./Busse, O./Wagner, M./Endres, M./Villringer, A../Röther, J./KolominskyRabas, P.L./Berger, K. für das Kompetenznetz Schlaganfall, die Deutsche Schlaganfall Gesellschaft sowie die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe (2010). Schlaganfallhäufigkeit und Versorgung von Schlaganfallpatienten in Deutschland. In: Akt. Neurol., 37, 333-340 Hildebrandt, H./Schwendemann, G. (2004). Kognitive Beeinträchtigungen bei Multipler Sklerose. In: Zieger, A./ Schönle, P.W. (Hrsg.) (2004): Neurorehabilitation bei diffuser Hirnschädigung. Rehabilitationswissenschaftliche Reihe Band IV. Bad Honnef: Hippocampus Verlag, 197-242 Hirtz, D./Thurman, D.J./Gwinn-Hardy, K./Mohamed, M./Chaudhuri, A.R./Zalutsky, R. (2007). How common are the "common" neurologic disorders? In: Neurology, 68, 326-337. Huber, G. (2005). Psychiatrie. Lehrbuch für Studium und Weiterbildung, 7. Auflage, Stuttgart: Schattauer Janzarik, W. (2012). Psychische Verluste des hohen Alters, kognitive Reserve, strukturelle Resistenz. In: Nervenarzt, 83, 31-32 Jiang, J.Y./Gao, G.Y./Li, W.P./Yu, M.K./Zhu, C. (2002). Early indicators of prognosis in 846 cases of severe traumatic brain injury. In: J. Neurotrauma., 19, 869-874 Johnston, S.C./Mendis, S./Mathers, C.D. (2009). Global variation in stroke burden and mortality: estimates from monitoring, surveillance, and modelling. In: Lancet Neurol., 8, 345-354 Jennett, B. (1996). Epidemiology of head injury. In: J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 60, 362369 Jennett, B./Plum, F. (1972). Persistent vegetative state after brain damage. A syndrome in search of a name. In: Lancet, 1, 743-747 Kempermann, G./Kuhn, HG./Gage, FH (1997). More hippocampal neurons in adult mice living in an enriched environment. In: Nature, 386, 493-495 Lucius-Hoene, G./Nerb, N. (2010). Hirnschädigung, Identität und Biographie, In: Frommelt, P./Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg, 93-106 39 Oehmichen F. (2007). Schwere erworbene Hirnschädigungen. Wege zur Behandlungsentscheidung. München-Wien-New York: W. Zuckschwerdt Rickels, E. (2010). Neurotraumatologie. In: Frommelt, P./ Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg: Springer, 616-632 Ritter M.A./ Dittrich R./ Busse O./ Nabavi D.G./ Ringelstein, E.B. (2012). Zukünftige Versorgungskonzepte des Schlaganfalls In: Akt. Neurol., 39, H.01, 27-32 Specht, U./ Thorbecke, R. (2010). Epilepsien. In: Frommelt, P./ Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg: Springer, 739-754 Tettenborn, B./ Bredel-Geissler, A.E./ Krämer, G. (2011). Die Epilepsien. In: Berlit, P. (Hrsg.): Klinische Neurologie. 3. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer, 837-898 Vaney, C./ Roth, R. (2010). Rehabilitation bei Multipler Sklerose. In: In: Frommelt, P./Lösslein, H. (Hrsg.): NeuroRehabilitation. Berlin-Heidelberg: Springer, 674-94 Voigt-Radloff, S./ Hüll, M. (2012). Neue Ansätze zur Versorgung von Demenzpatienten. In: Günster, C/ Klose, J./ Schmacke, N. (Hrsg.), Versorgungsreport 2012. Schwerpunkt: Gesundheit im Alter. Stuttgart: Schattauer Wilson, S./ Bladina,P./ Salinga, M. (2001). The “burden of normality”: concepts of adjustment after surgery for seizures. In: J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 70, 649-656 Wettig, J. (2006): Kindheit bestimmt das Leben. In: Dtsch. Ärztebl., 103, H. 36, A 2298-2301 Zieger, A./Schönle, P.W. (Hrsg.) (2004). Neurorehabilitation bei diffuser Hirnschädigung. Rehabilitationswissenschaftliche Reihe Band IV. Bad Honnef: Hippocampus Verlag Ziegler, U./G. Doblhammer (2009). Prävalenz und Inzidenz von Demenz in Deutschland: Eine Studie auf Basis von Daten der gesetzlichen Krankenversicherungen von 2002. In: Das Gesundheitswesen, 71, 281-290