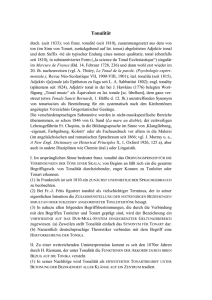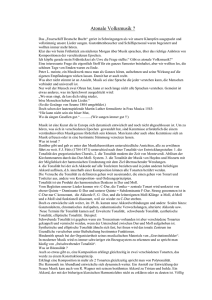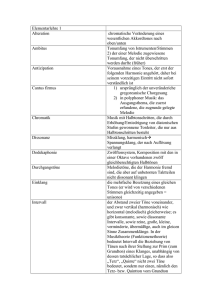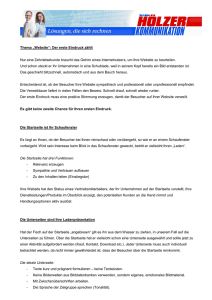Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse
Werbung

Klangzentren und Tonalität Über die Bedeutung der Zentralklänge in der Musik des 19. Jahrhunderts Dieter Kleinrath Betreuer: Univ. Prof. Dr. phil. Christian Utz Juni 2010 Masterarbeit der Studienrichtung Musiktheorie (V 066 702) am Institut für Komposition, Musiktheorie, Musikgeschichte und Dirigieren Kunstuniversität Graz meinen Eltern ABSTRACT „Tonalität“ ist ein vielschichtiger und mehrdeutiger Terminus, der in der Musikgeschichte mehrere Veränderungen erfahren hat. Als wesentliche Bedingung der europäischen Dur-Moll-Tonalität wird meist ein Zentralklang – die Tonika – angegeben, auf den sich die übrigen Harmonien beziehen. Die Tonika erfüllt dabei die Funktion der formalen Gliederung und sorgt als harmonischer Ruhepunkt für das Gefühl der Abgeschlossenheit eines Werkes. 1927 führt Hermann Erpf den Begriff „Klangzentrum“ ein, um damit eine Kompositionstechnik atontaler Musik zu bezeichnen, in der ein Klang als zentraler Bezugspunkt eine vergleichbare Funktion erfüllt wie die Tonika dur-moll-tonaler Musik. Die vorliegende Arbeit untersucht zunächst den Begriff „Tonalität“ in seiner historischen Entwicklung und stellt anschließend Erpfs Begriff des Klangzentrums der dur-moll-tonalen Tonika gegenüber. Die vordergründigen Fragestellungen sind dabei, ob sich dur-moll-tonale Musik tatsächlich aus Sicht eines einzelnen Zentralklangs beschreiben lässt und in wie weit Erpfs „Technik des Klangzentrums“ als Weiterdenken dur-moll-tonaler Prinzipien angesehen werden kann. Abschließend werden die Klangzentren dur-moll-tonaler Musik unter anderem an den Beispielen Richard Wagners (Tristan-Vorspiel, Parsifal-Vorspiel 3. Akt) und Arnold Schönbergs (Verklärte Nacht op. 4, Kammersymphonie op. 9) diskutiert. * „Tonality“ is an ambiguous term that changed its meaning multiple times throughout the course of music history. Most of the time the main characteristic for European major-minor tonality is said to be the unifying sound of the tonic, that serves as the point of reference for the other sounds. The function of the tonic is to produce formal structure and closure by providing a resting point for the harmonic progressions. In 1927 Hermann Erpf defined the term „Klangzentrum“ (central sound) to analyze atonal music that exposes a central sound which serves the same function as the tonic in majorminor tonality. This article examines the historic development of the term „tonality” and compares Erpf’s „Klangzentrum“ with the tonic of major-minor tonality. The questions to be answered are, if it is actually possible to describe major-minor-tonality with a single unifying sound and, if Erpf’s „Klangzentrum“ may be considered a continuation of tonal principles in 20th century music. Finally I will discuss the central sounds of major-minor tonality by examples of Richard Wagner (preludes to Tristan and Parsifal 3rd act) and Arnold Schoenberg (Verklärte Nacht op. 4, chamber symphony op. 9). INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG 1 I. ÜBER DEN BEGRIFF „TONALITÄT“ 6 1.1 Begriffsbildung im frühen 19. Jahrhundert 6 1.2 François-Joseph Fétis 8 1.3 Tonalität und Tonart im deutschsprachigen Raum 16 1.4 Hauptmann – Helmholtz – Oettingen 27 1.5 Riemann und Schenker 33 1.6 Die Auflösung der Tonalität und Arnold Schönberg 38 1.7 Der Tonalitätsbegriff im 20. Jahrhundert 44 1.8 Der Begriff des „Klangzentrums“ bei Erpf und Lissa 55 1.9 Schlussfolgerungen 68 II. ANALYTISCHE KONSEQUENZEN 75 2.1 Klangzentren der Dur-Moll-Tonalität 75 2.2 Richard Wagner: Einleitung zu Tristan und Isolde 89 2.3 Richard Wagner: Parsifal, Vorspiel zum dritten Akt 100 2.4 Arnold Schonbergs Frühwerk 116 SCHLUSSWORT 124 QUELLENVERZEICHNIS 128 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 135 ANHANG 137 a) Weiterführende Literatur 137 b) Sonstiges 139 DANKSAGUNG Mein besonderer Dank gilt Univ. Professor Dr. Christian Utz für seine wunderbare und selbstlose Betreuung während des Studiums und während der Erstellung der vorliegenden Arbeit. Ohne seine fachliche Präzision und Kompetenz sowie seine ausgewogene Kritik, wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Weiters bedanke ich mich bei Univ. Professor Clemens Gadenstätter für sein künstlerisch-kreatives Feedback während der Studienzeit und die unkonventionelle Sichtweise auf musikalischer Probleme, die er mir beigebracht hat. Schließlich gilt mein Dank auch dem gesamten Institut für Komposition, Musiktheorie, Musikgeschichte und Dirigieren für die fortwährende Unterstützung und das angenehm freundschaftliche Klima während des Studiums, das mir immer gerne in Erinnerung bleiben wird. ii „Die Wege der Harmonie sind verschlungen; führen kreuz und quer; nähern sich einem Ausgangspunkt und entfernen sich von ihm immer wieder; führen irre, indem sie einem anderen Punkt eine augenblickliche Bedeutung verleihen, die sie ihm bald darauf wieder nehmen; erzeugen Höhepunkte, die sie zu übertreffen wissen; rufen Wellenberge hervor, die verebben, ohne dass die Welle zum Stillstand kommt.“1 1 Arnold Schönberg, Der musikalische Gedanke und die Kunst, Logik und Technik seiner Darstellung [1934], http://www.schoenberg.at (1.6.2010), S. 203. iii EINLEITUNG Der Begriff Tonalität gehört seit seinem Aufkommen zu Beginn des 19. Jahrhunderts2 wohl zu den am häufigsten verwendeten und zugleich ambivalentesten Termini der Musiktheorie. Carl Dahlhaus schreibt diesbezüglich: „Der Terminus Tonalität ist vieldeutig, und [...] es [dürfte] vergeblich sein, eine Norm des Wortgebrauchs festsetzen zu wollen.“3 Das Verständnis von Tonalität hat im Laufe der Musikgeschichte viele Wandlungen erfahren. Unterschiedliche Autoren hoben dabei jeweils unterschiedliche Aspekte tonaler Musik hervor und es entwickelte sich so eine Begriffsvielfalt, die in ihrer ganzen Komplexität heute kaum überschaubar ist. Insbesondere sind dabei zwei Definitionsbereiche zu unterscheiden:4 (1) die skalenbezogene Definition von Tonalität als die Beziehungen zwischen den Tönen einer Skala; (2) die akkordbezogene Definition von Tonalität als die Beziehungen der Harmonien auf einen Zentralklang, die Tonika. Diese beiden Definitionen stehen sich jedoch keineswegs diametral gegenüber, sondern sie ergänzen und bedingen sich gegenseitig. So ist auch bei den meisten skalenbezogenen Definitionen durchaus die I. Stufe als ein Zentralton gegeben. Brian Hyer stellt fest, dass jede Theorie, die sich mit dem Begriff Tonalität auseinander setzt, der einen oder anderen Tradition zugewiesen oder als ein Hybrid beider Auffassungen angesehen werden kann. Die beiden musiktheoretischen Hauptströmungen innerhalb dieser Traditionen sind laut Hyer die Stufentheorie von Gottfried Weber und Heinrich Schenker (skalenbezogen) auf der einen Seite sowie Hugo Riemanns Funktionstheorie (akkordbezogen) auf der anderen Seite.5 François-Joseph Fétis verstand unter „tonalité“ 1844 noch primär die „Zusammenstellung der notwendigen Beziehungen simultan oder sukzessiv angeordneter Tonleiter2 3 4 5 Nach heutiger Kenntnis findet sich der erste Beleg für den Begriff bei A. É. Choron in seiner 1810 erschienenen Sommaire de l’histoire de la musique. Vgl. Michael Beiche, Tonalität, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stuttgart: Steiner 1999, S. 2. Carl Dahlhaus, Tonalität, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Kassel: Bärenreiter 1989, S. 623. Vgl. ebda.; Brian Hyer Tonality, in: Grove Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com (1.6.2010). Hyer, Tonality. 1 töne“6 und fasst dabei die für eine Tonalität unabdingbaren Skalen und Tonsysteme7 „nicht als natürliche Gegebenheit auf, sondern begründet sie anthropologisch als auf geschichtlichen und ethnischen Voraussetzungen beruhend.“8 Fétis unterscheidet dem entsprechend noch zwischen unterschiedlichen „types de tonalités“, von denen die „tonalité moderne“ – die harmonische Tonalität des 17. bis 19. Jahrhunderts9 – eine Möglichkeit sei.10 Dabei hebt Fétis die Bedeutung der Dominante und ihrer Auflösung in die I. Stufe als konstitutive Momente der „tonalité moderne“ besonders hervor und trägt so entschieden zu der mehrdeutigen Verwendung des Begriffs bei. Fast alle weiteren Auseinandersetzungen mit dem Begriff beziehen sich später in der einen oder anderen Weise auf Fétis’ Tonalitätsbegriff. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts wird der Begriff vorwiegend auf die europäische Dur-Moll-Tonalität angewendet11 und erfährt dabei unterschiedliche Erweiterungen. Die Skala als Grundbedingung von Tonalität wird dabei auf die diatonischen Dur- und Moll-Skalen eingeschränkt und die I. Stufe der Tonleiter gewinnt als zentraler Bezugston oder -akkord eine zunehmende Bedeutung. Insbesondere im romanischen und angelsächsischen Sprachbereich wird der Begriff zuweilen auch als Synonym für den Begriff Tonart verwendet.12 Eine weitreichende Uminterpretation erfährt der Begriff Tonalität seit den 1870er Jahren durch Hugo Riemann, der darunter die „Bezogenheit [der Akkorde] auf einen Hauptklang, die Tonika“ versteht.13 Nachdem für Riemann die Bedeutung der Akkorde in deren Funktionen ausgedrückt wird, ist für ihn Tonalität der „Inbegriff der Akkordfunktionen“.14 Zudem war Riemann im Gegensatz zu Fétis davon überzeugt, „daß die ‚types de tonalités‘ auf ein einziges ‚natürliches System‘ [...] reduzierbar seien.“15 Diese Riemanns Tonalitätsbegriff anhaftende Naturbezogenheit führte in der Musikwissenschaft zu kontroversen Diskussionen und wurde laut Carl Dahlhaus „von Historikern 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Beiche, Tonalität, S. 3f. Vgl. ebda., S. 5 Gerhard Luchterhandt, „Viele ungenutzte Möglichkeiten“. Die Ambivalenz der Tonalität in Werk und Lehre Arnold Schönbergs, Mainz: Schott 2008, S. 72; Vgl. Carl Dahlhaus, Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel: Bärenreiter 1988, S. 1 0. Vgl. Dahlhaus, Untersuchungen, S. 10. Vgl. Beiche, Tonalität, S. 5. Vgl. ebda., S. 6. Vgl. ebda., S. 7f. Hugo Riemann, Tonalität, in: Hugo Riemann Musik-Lexikon. Sachteil [Leipzig: Bibliographisches Institut, 1882], Mainz 1967, S. 923f. Dahlhaus, Untersuchungen, S. 9. Ebda., S. 7. 2 und Ethnologen, die den Systemzwang scheuten, als empirisch unbegründbares Dogma verworfen.“16 Im 20. Jahrhundert setzten sich auch einige Komponisten in ihren Lehrwerken mit dem Begriff Tonalität auseinander, wie beispielsweise Arnold Schönberg in seiner Harmonielehre (1911) und Paul Hindemith in seiner Unterweisung im Tonsatz (1939). Schönberg verwendet den Begriff dabei in einer ambivalenten Weise, die leicht zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen führen kann. Während der Begriff Tonalität bis dahin hauptsächlich unter systematischen und historischen Gesichtspunkten verstanden wurde, wird er von Schönberg auch als eine „formale Möglichkeit“17 beschrieben, von der ein Komponist Gebrauch machen kann oder auch nicht.18 Tonalität wird damit gewissermaßen auf eine Kompositionstechnik, einen handwerklichen Kniff, reduziert. Damit stellt sich Schönberg entschieden gegen naturalistische und evolutionistische Theorien, die davon ausgehen, dass Tonalität das natürliche Ergebnis einer historischen Entwicklung sei. Bei der Bewertung von Schönbergs Tonalitätsbegriff muss allerdings berücksichtigt werden, dass Schönberg wenig daran lag, den Begriff aus Sicht der Musiktheorie zu differenzieren. Vielmehr nutzte er ihn vorrangig, um seine eigene Musik zu legitimieren und seinen Schülern einen künstlerisch freien Zugang zur Kompositionstechnik zu ermöglichen. Dabei verwendet Schönberg in seinen Analysen dur-moll-tonaler Musik gerne Begriffe wie „schwebende Tonalität“, „erweiterte Tonalität“ oder „aufgelöste Tonalität“ und trug damit entschieden zu der Vorstellung bei, die Tonalität hätte sich mit der Musik der Wiener Schule „aufgelöst“. Damit hat Schönberg (bewusst oder unbewusst) auch eine Polarisierung der Musik nach 1910 heraufbeschworen. Komponisten, die nach wie vor dur-moll-tonale Musik schrieben, wurden in weiterer Folge oft als konventionell und regressiv abgestempelt. Nachfolgende Musiktheoretiker hatten es unter diesen Voraussetzungen schwer den Tonalitätsbegriff neutral und werturteilsfrei weiterzudenken. Dies mag einer der Gründe dafür gewesen sein, weshalb Hermann Erpf 1927 den Begriff „Klangzentrum“ einführte, um damit einen „funktionslosen Satztypus“ zu beschreiben: 16 17 18 Ebda. S. 17. Arnold Schönberg, Harmonielehre [1911], Wien: Universal Edition 2001, S. 27. Vgl. ebda. 3 Die Technik des Klangzentrums hat als wesentliches Merkmal einen [...] Klang, der im Zusammenhang nach kurzen Zwischenstrecken immer wieder auftritt. Dadurch gewinnt dieser Klang [...] in einem gewissen primitiven Sinn den Charakter eines klanglichen Zentrums [...]. Die Zwischenpartien heben sich kontrastierend ab, dem dominantischen Heraustreten aus der Tonika vergleichbar, so daß ein gewisser Wechsel Tonika-Nichttonika-Tonika zustande kommt [...]. 19 Des inhärenten Widerspruchs, die Eigenschaften eines „funktionslosen Satztypus“ mit den Begriffen der dur-moll-tonalen Funktionstheorie zu beschreiben, war sich Erpf wahrscheinlich bewusst. Er entschloss sich aber, offenbar in Ermangelung einer besseren Alternative, diesen Kompromiss einzugehen. Interessanterweise geht Erpfs Definition der „Technik des Klangzentrums“ jedoch durchaus konform mit Riemanns Definition von Tonalität als die Beziehung von Funktionen auf eine Tonika. So gesehen handelt es sich dabei um eine Form der Tonalität, deren Zentralklang anstelle eines Durbeziehungsweise Moll-Dreiklangs auch andere Formen annehmen kann. * Die vorliegende Arbeit vertritt die These, dass eine ausschließlich monozentrische Sichtweise dur-moll-tonaler Musik, welche Tonalität auf einen einzigen Zentralklang – die Tonika – reduziert, aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar ist. An der Entwicklung der Harmonik im 19. Jahrhundert lässt sich verfolgen, dass weitere Zentralklänge immer mehr an Bedeutung gewannen und oft gleichberechtigt nebeneinander eingesetzt wurden. In hochromantischer Musik wird dabei insbesondere die Dominante, meist in Form von verminderten Septakkorden oder übermäßigen Dreiklängen, häufig als eigenständiger Zentralklang behandelt und dient auch in größeren Abschnitten als zentraler Bezugspunkt der restlichen Harmonien. Auch die der Tonalität zugrunde liegenden Skalen haben sich in diesem Prozess gewandelt. So nehmen beispielsweise die oktatonische Skala oder die Ganztonskala in vielen Werken des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle ein. Manchmal scheint es sogar der Fall zu sein, dass nicht ein oder mehrere Akkorde oder Töne die Zentralklänge eines Werkes darstellen, sondern die Skala selbst die Rolle des Klangzentrums übernimmt und damit den Gesamtklang entschieden beeinflusst. Erpfs „Technik des Klangzentrums“, die in 19 Hermann Erpf: Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neueren Musik, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1927, S. 122. 4 mehreren Werken des 20. Jahrhunderts nachgewiesen werden kann, stellt also in vieler Hinsicht ein Weiterdenken dur-moll-tonaler Prinzipien dar. Es wäre falsch generell zu behaupten, dass sich die Dur-Moll-Tonalität mit der Wiener Schule „aufgelöst“ hätte. Vielmehr ist es notwendig zu untersuchen, welche Prinzipien in post-tonaler Musik tatsächlich nicht mehr vorhanden sind und welche lediglich, den neuen musikalischen Gegebenheiten entsprechend, angepasst wurden. Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit wird sich mit der Geschichte des Begriffs Tonalität im Allgemeinen und der Dur-Moll-Tonalität im Speziellen auseinander setzen. Dabei werde ich versuchen die unterschiedlichen Fragestellungen, die diesen Begriff heute begleiten, einander gegenüberzustellen; insbesondere werde ich dabei zwischen historischen, systematischen, kompositionstechnischen und hörpsychologischen Ansätzen unterscheiden. Schließlich werde ich mich in diesem Kapitel auch genauer der Technik des Klangzentrums widmen, wie sie von Hermann Erpf und Zofja Lissa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben wurde. Darauf aufbauend werde ich untersuchen, ob zwischen einem Klangzentrum im Sinne Erpfs und einer Tonika im Sinne der Dur-Moll-Tonalität ein prinzipieller Unterschied besteht bzw. inwiefern die „Technik des Klangzentrums“ mit dem Begriff Tonalität vereinbar ist. Das zweite Kapitel wird schließlich die analytischen Konsequenzen aus den vorangegangenen Überlegungen ziehen. Der Schwerpunkt der Analysen liegt auf dur-molltonalen Werken, die in ihrer Harmonik mehrere Klangzentren entwerfen und in denen ursprünglich dissonante Klänge, wie der verminderte Septakkord, als zentrale Ruhepunkte Verwendung finden. Dabei wird eine auf Klangzentren basierende Analyse traditionellen Methoden der harmonischen Analyse gegenübergestellt und die Vor- und Nachteile beider Methoden werden gegeneinander abgewogen. 5 KAPITEL I ÜBER DEN BEGRIFF „TONALITÄT“ 1.1 Begriffsbildung im frühen 19. Jahrhundert Der Begriff Tonalität geht auf den von französischen Musiktheoretikern seit Beginn des 19. Jahrhunderts verwendeten Ausdruck „tonalité“ zurück. Der erste Beleg dafür findet sich nach heutiger Kenntnis bei Alexandre-Étienne Choron in seinem Sommaire de l’histoire de la musique20 (1810). Unter tonalité versteht Choron „die Tonleitersysteme, von denen es entsprechend den verschiedenen Völkern und ihrer Musik eine sehr große Anzahl gebe und deren Töne immer einen konstanten Bezug zu einem Grundton hätten.“21 Choron unterscheidet zwischen der „griechischen Tonalität“, aus der die Kirchentonarten hervorgegangen seien und der „modernen Tonalität“, die sich in weiterer Folge aus den Kirchentonarten entwickelt hätte. Das bestimmende Merkmal für die „moderne Tonalität“ war für Choron der Dominantseptakkord („harmonie tonale“), dessen Ursprung er auf Claudio Monteverdi gegen Ende des 16. Jahrhunderts zurückführte.22 In dieser ersten überlieferten Beschreibung von Tonalität sind bereits fast alle Merkmale enthalten, die sich wie ein roter Faden durch dessen Begriffsgeschichte ziehen. Zunächst erkennt man einen engen Zusammenhang zwischen den Termini Tonalität und Tonleiter bzw. Tonart. Zudem werden die Töne der verwendeten Tonleiter auf einen Grundton bezogen, bei dem sich Choron wohl auf Jean-Philippe Rameaus „centre harmonique“ bezieht, dessen Theorien auf französische Musiktheoretiker um 1800 einen großen Einfluss hatten. Auch ist für Choron bereits ein Akkord – die „harmonie tonale“ – ein kennzeichnendes Element der „modernen Tonalität“, allerdings ist auffällig, dass Choron nicht die Tonika als den wesentlichen Klang angibt, sondern die Dominante. Alle nachfolgenden Definitionen des Begriffs Tonalität werden sich in der einen oder anderen Weise mit diesen grundlegenden Aspekten des Tonalitätsbegriffs 20 21 22 Alexandre-Étienne Choron, Sommaire de l’histoire de la musique, in: Alexandre-Étienne Choron / François Joseph Fayolle, Dictionnaire historique des musiciens Bd. 1, Paris 1810, S. XI-XCII. Beiche, Tonalität, S. 2. Vgl. ebda. 6 auseinander setzen. Eine weitere Besonderheit, die Chorons Begriffsdefinition auszeichnet, ist, dass er bereits zwei weitere wichtige Aspekte erkennen lässt, die Untersuchungen zur Tonalität in weiterer Folge immer wieder begleiten. Einerseits impliziert er einen ethnologischen Ansatz, indem er die Tonleitersysteme verschiedener Völker in seine Definition mit einfließen lässt, andererseits verfolgt er einen historischen Ansatz23, indem er versucht die Entstehung der „modernen Tonalität“ als eine Entwicklung von der „griechischen Tonalität“ über die Kirchentonarten zu Monteverdis „Dominantseptakkord“ zu verstehen. Der erste Lexikonartikel Tonalité erscheint 1821 im Dictionnaire de musique moderne von Castil-Blaze. Dort wird der Geltungsbereich des Begriffs auf das Dur-Moll-System eingeschränkt und Tonalität als „Eigenart der musikalischen Tonart, die im Gebrauch ihrer wesentlichen Töne“24 besteht, beschrieben. Als „wesentliche Töne“ werden dabei die I., IV. und V. Stufe genannt. Auch Philippe de Geslin begrenzt 1826 tonalité auf das Dur-Moll-System. „Für ihn bedeutet tonalité das Bestreben, immer ‚den Gesang‘ vorzugsweise auf ‚ein und demselben Ton eines Tonsystems‘ zu beenden, und zwar auf der Tonika einer Tonart.“25 Weitere Aspekte werden 1830 von Daniel Jelensperger formuliert.26 Er versteht unter Tonalität den „‚Eindruck der Tonart‘; bei einer vollständigen Modulation werde eben die Tonalität der vorangehenden Tonart gänzlich ausgelöscht, weil man in die neue Tonart kadenziere.“27 Jelenspergers Ansatz die beiden Begriffe Modulation und Kadenz in einen direkten Zusammenhang mit der Dur-MollTonalität zu bringen, ist dabei besonders auffällig und wurde später von mehreren Musiktheoretikern aufgegriffen. Als neues Motiv innerhalb der Begriffsgeschichte lässt sich durch Jelenspergers Beschreibung von Tonalität als „Eindruck der Tonart“ bereits erstmals ein hörpsychologischer Aspekt ausmachen. Darauf deutet auch seine Übertragung des Begriffs auf konsonante und dissonante Akkorde hin: „In diesem Zusammenhang sei mit Tonalität der Eindruck gemeint, den ein Akkord hervorrufe und der es ermögliche, ihn auf diese oder jene Tonleiter zu beziehen.“28 23 24 25 26 27 28 Volker Helbing meint sogar, dass „Choron ihn [den Begriff Tonalität] ausschließlich [verwendet], um (historische) Differenzen innerhalb der europäischen Musik zu benennen.“ Volker Helbing, Tonalität in der französischen Musiktheorie zwischen Rameau und Fétis, in: Musiktheorie (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Bd. 2), Laaber: Laaber 2005, S. 171-202, hier S. 171. François H. J. Castil-Blaze, Dictionnaire de musique moderne, zit. nach: Beiche, Tonalität, S. 3. Beiche, Tonalität, S. 3. Vgl. ebda. Ebda. Ebda. 7 1.2 François-Joseph Fétis François-Joseph Fétis gilt in der musikwissenschaftlichen Literatur als der Musiktheoretiker, der den Begriff Tonalität wesentlich geprägt hat. In seiner 1844 erschienenen Traité complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie29 behandelt er Tonalität sowohl aus systematischer Sicht als auch in seiner historischen Entwicklung. Dabei unterscheidet er zwischen der „tonalité moderne“, die der europäischen DurMoll-Tonalität entspricht sowie der „tonalité ancienne“, die von den Kirchentonarten der Renaissancemusik ausgebildet wurde. Fétis argumentiert wie Choron, dass die Auflösung des Dominantseptakkords in die I. Stufe das wesentliche Element der „tonalité moderne“ sei. Aus historischer Sicht unterscheidet er daneben zwischen den Epochen („ordre“) „unitonique“, „transitonique“, „pluritonique“ und „omnitonique“. Dabei bezeichnet „ordre unitonique“ die Renaissancemusik der „tonalité ancienne“, „transitonique“ die Übergangszeit von der „tonalité ancienne“ zur „tonalité moderne“ und „pluritonique“ bezeichnet die Musik seiner Zeit, in der die „tonalité moderne“ bereits voll ausgebildet ist. Unter der Epoche „ordre omnitonique“ versteht Fétis schließlich die Musik der Zukunft, die laut seinen Angaben in den Werken mancher Zeitgenossen bereits begonnen hat. Fétis war von besonderer Bedeutung für die weitere Verbreitung des Begriffs Tonalität, einerseits durch seine Lehrtätigkeit als Kompositionsprofessor am Pariser Konservatorium, andererseits durch seine zahlreichen Schriften, die unter nachfolgenden Musiktheoretikern weite Verbreitung und Akzeptanz fanden. Insbesondere sorgte auch die von Fétis herausgegebene Zeitschrift Revue musicale für diese Verbreitung, die in deutschsprachigen Publikationen der Zeit häufig zitiert wurde.30 Eine weitere Leistung Fétis’ war es, das musiktheoretische Wissen seiner Zeit zu sammeln und vorhandene Theorien zusammenzuführen und zu erweitern.31 Er baute auf den Theorien von Jean-Philippe 29 30 31 François-Joseph Fétis, Traité complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie, Paris: Schlesinger 1844. Vgl. diesbezüglich die Fußnoten 59 und 61. Fétis’ eigenständiger Beitrag zu der Begriffsdefinition ist allerdings nicht unumstritten. So weist Bryan Simms darauf hin, dass Fétis einen Großteil seiner Erkenntnisse und Thesen wohl fälschlicherweise unter eigenem Namen veröffentlicht hat (vgl. Bryan Simms, Choron, Fetis, and the Theory of Tonality, in: Journal of Music Theory (Bd. 19,1), 1975, S. 112-138, hier S. 115). Allerdings sollte man dies auch nicht überbewerten, da zu Fétis Zeit nicht im selben Maße zwischen Quelle und Plagiat unterschieden wurde, wie dies heute üblich ist. Fétis hat vermutlich durchaus noch innerhalb der ethi- 8 Rameau, Georg Andreas Sorge, Johann Philipp Kirnberger, Charles Simon Catel, Alexandre-Étienne Choron und anderen Musiktheoretikern auf32, und prägte so in seinem Traité einen Tonalitätsbegriff, der vielen weiteren Musiktheoretikern als Grundlage diente. Tonalität bildet sich laut Fétis „aus der Kollektion der notwendigen, sukzessiven oder simultanen Beziehungen der Tonleiter“33, also aus Beziehungen zwischen den Harmonien und Melodien eines Musikstücks in Bezug auf eine zugrunde liegende Skala. Der Ursprung dieser Beziehungen ist dabei für Fétis weder ein akustisches oder mathematisches Phänomen, noch liegt es in der Physiologie des menschlichen Gehörs begründet; statt dessen meinte Fétis, dass die Gesetze tonaler Beziehungen „metaphysischer“ Natur und damit unergründlich seien. Unterschiedliche Kulturen stellen laut Fétis aufgrund ihrer Gefühle, Gedanken und auch aufgrund des Intellekts34 verschiedene Beziehungen her und entwickeln dem entsprechend unterschiedliche Typen von Tonalität („types de tonalités“).35 Der Mensch erhalte diese Ordnung [der Tonalität] und die sich daraus ergebenden melodischen und harmonischen Phänomene als Konsequenz seiner Bildung und Erziehung, und diese Tatsache bestehe durch sich selbst und unabhängig von jedem fremden Einfluss.36 Carl Dahlhaus, der sich in seinen Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität ausgiebig dem Tonalitätsbegriff widmete, interpretierte den Begriff „Metaphysik“ bei Fétis als analog zum heutigen Bereich der „Anthropologie“37 und es ist wahrscheinlich, dass sich Fétis mit der Verwendung des Begriffs hauptsächlich von anderen gängigen Erklärungsversuchen seiner Zeit abgrenzen wollte (wie beispielsweise die auf Rameau zurückgehende Naturklangtheorie). Die Feststellung, dass Fétis jegliche physikalischen und physiologischen Ursachen ausschließt muss man, um Missverständ- 32 33 34 35 36 37 schen und moralischen Grundsätze seiner Zeit gehandelt, wenn er auf anderen Theorien aufbaute ohne explizit darauf hinzuweisen. Vgl. ebda. S. 133-134. Fétis: Traité complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie, zit. nach: Beiche, Tonalität, S. 5. Hyer, Tonality: „Fétis asserted that ‚primitive’ (non-Western) societies were limited to simpler scales because of their simpler brain structures, while the more complex psychological organizations of Indo-Europeans permitted them to realize, over historical time, the full musical potential of tonalité; his theories were similar in their biological determinism to the racial theories of Gobineau.“ Vgl. zu diesem Abschnitt auch: Beiche, Tonalität, S. 4-5; Simms, Choron, Fetis, S. 124f; Dahlhaus, Untersuchungen, S. 11-14; Dahlhaus, Tonalität, S. 623f; Hyer, Tonality. Fétis, zit. nach: Beiche, Tonalität, S. 5. Dahlhaus, Untersuchungen, S. 10. 9 nissen vorzubeugen, noch etwas genauer differenzieren. Laut Dahlhaus geht es Fétis dabei nicht darum, die Herleitung der Konsonanzgrade aus der Natur zu leugnen. Dahlhaus argumentiert, gegen ein rein auf physikalischen Ursachen basierendes System, „würde Fétis einwenden: Daß die Quint und die große Terz ‚direkt verständliche‘ Intervalle sind, sei zwar von der Natur gegeben; die Entscheidung aber sie einem System zugrundezulegen, sei ‚metaphysisch‘.“38 Damit hätte Fétis bereits recht genau die heute öfters vertretene Meinung widergespiegelt, dass unsere Hörphysiologie gemeinsam mit unserem Gedächtnis und unserer Erfahrung in einem stätigen Wechselspiel mit dem ästhetischen und künstlerischen Entscheidungsprozess steht. Brian Hyer widerspricht in seinem Artikel Tonality im Grove Music Online der von Dahlhaus vorgelegten Interpretation des Begriffs „Metaphysik“ und der damit verbundenen Implikationen: He [Fétis] believed that tonality was a metaphysical principle, a fact not of the inner structure or formal properties of music but of human consciousness, which imposes a certain cognitive organization – a certain set of dynamic tendencies – on the musical material. As a metaphysical principle, then, tonality does not itself evolve, but rather remains invariant and universal, true for all people and for all time. He thus regarded what he felt to be the undeniable historical progress of Western music as a series of discrete advances toward completion, the ever more perfect realization of a musical absolute.39 Gegen Hyers Meinung, Fétis sähe Tonalität als ein unveränderbares Prinzip „für alle Menschen und zu jeder Zeit“ an, spricht allerdings Fétis Vorstellung, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Tonalitäten ausbilden und seine Unterscheidung zwischen „tonalité ancienne“ und „tonalité moderne“ in der europäischen Musikgeschichte. Also ließe sich diese Aussage, wenn überhaupt, nur auf den speziellen Fall der europäischen Dur-Moll-Tonalität („tonalité moderne“) anwenden. In diesem Zusammenhang war Fétis scheinbar davon überzeugt, dass die „tonalité moderne“ vor einer ernsten Bewährungsprobe stand, keineswegs aber, dass dies das Aufkommen einer neuen Tonalität ausschließen würde: 38 39 Ebda., S. 15. Hyer, Tonality. 10 Fétis sees the omnitonic order as the ultimate stage in deriving more and more expression from major/minor tonality. [...] He sees the era as a degradation of music, allowing too great a resource for unbridled emotion and passion, and one that could itself be superseded only by a new tonality.40 Auch die Bedeutung der Harmonik für Fétis’ Tonalitätsbegriff wird in der Literatur unterschiedlich bewertet. So schreibt Brian Hyer: While both Choron and Fétis drew on the same basic theoretical resources, there are subtle but crucial differences between their accounts of tonalité. In contrast to Choron, who emphasizes relations between harmonies, Fétis places more stress on the order and position of pitches within a scale. This difference in emphasis corresponds to the two main historical traditions of theoretical conceptualization about tonal music: the function theories of Rameau and Riemann on the one hand and the scale-degree theories of Gottfried Weber and Schenker on the other.41 Der Behauptung, dass Fétis im Gegensatz zu Choron der skalaren Ordnung der Tonhöhen mehr Bedeutung beigemessen hätte als der Harmonik, widerspricht dagegen folgende Aussage von Bryan Simms: Shirlaw credits Fetis with the statement that scales created harmony. Fetis, in fact, says just the opposite. The fundamental relationship which generated modern tonality, he says, is the harmonic nature of the tritone. This and other appellative intervals dictated the intervallic structure of the major scale in the sense that the interval from degree seven to the tonic would be a semitone (the „natural“ resolution of the upper term of an augmented fourth), the interval from degree four to seven would be an augmented fourth, and so on, until our modern tonality (the major scale) was established in an invariant intervallic order regardless of the pitch level of the tonic. This is what Fetis means when he says that modern tonality possesses an inherent harmonic principle, since it was the harmonic nature of the augmented fourth and its proper resolution which shaped the scale in the first place.42 Folgende Aussage von Michael Beiche legt nahe, dass Fétis eine sehr ähnliche Auffassung über die Bedeutung des Dominantseptakkords hatte wie Choron (s.o.): Die notwendige Auflösung der „harmonie dissonante“ (des Dominantseptakkords als Streben, Anziehung und Bewegung) in die „harmonie consonnante“ (den Dreiklang mit dem Charakter 40 41 42 Simms, Choron, Fetis, S. 132. Hyer, Tonality. Simms, Choron, Fetis, S. 124f. 11 von Ruhe und Schlußbildung) sowie die Stellung ihrer Töne innerhalb der Tonleiter lege die Gesetze der Aufeinanderfolge aller Tonleitertöne fest, wodurch wiederum die unter dem Namen Tonalität gefaßten notwendigen Beziehungen der Töne festgelegt würden.43 Für die Vermutung Fétis habe mit seinen harmonischen Überlegungen an Choron angeknüpft spricht auch, dass sich Fétis bei der Entstehung der „tonalité moderne“ – der Dur-Moll-Tonalität – ebenso wie Choron auf Monteverdis „Entdeckung“ der Dominantseptakkordauflösung beruft.44 Fétis sieht im Zusammenhang mit Akkorden nur Sekunden und Septimen als Dissonanzen an, die übermäßige Quart beziehungsweise die tief alterierte Quint seinen dagegen konsonant:45 It is remarkable that these intervals [augmented fourth and diminished fifth] characterize modern tonality by the energetic tendencies of their two constituent notes, the leading tone summoning after it the tonic and the fourth degree followed in general by the third. Now this phenomenon, eminently tonal, cannot involve a state of dissonance. In fact, the augmented fourth and diminished fifth are used as consonances in several harmonic progressions. The augmented fourth and diminished fifth are hence consonances, but consonances of a special kind that I call by the name „appellative consonances“.46 Diese Überlegungen hat Fétis vermutlich von Choron und Catel übernommen.47 Der „Entdecker“ der Dominantauflösung war für Fétis Monteverdi, der zum ersten Mal unvorbereitete Septimen in die Musik einführte und den Dominantseptakkord häufig in die Tonika auflöste (vgl. Abbildung 1). Fétis ging davon aus, dass Dominantseptakkorde zuvor nur in Sextakkorde aufgelöst wurden: V7 → V6 (vgl. Abbildung 2).48 43 44 45 46 47 48 Beiche, Tonalität, S. 5. Vgl. Simms, Choron, Fetis, S. 126f . Vgl. ebda., S. 120-122. Fétis, Traité complet de la théorie, S. 8-9, zit. nach: Simms, Choron, Fetis, S. 122. Simms, Choron, Fetis, S. 122. Ebda., S. 127. 12 Abbildung 1: Auflösung Dominante → Tonika.49 Abbildung 2: Auflösung V7 → V6.50 Die unterschiedlichen Bewertungen von Fétis Tonalitätsauffassung sind ein Beleg dafür, dass sich der Begriff schon in den ersten Jahren seines Aufkommens keineswegs auf eine einzige Bedeutung einschränken lässt. Bei Fétis waren sowohl der skalenbezogene als auch der akkordbezogene Tonalitätsbegriff bereits implizit angelegt und es wäre willkürlich ihn auf die eine oder andere Bedeutung reduzieren zu wollen. Die Entwicklung der Tonalität innerhalb der europäischen Musikgeschichte unterteilt Fétis wie gesagt in die vier historischen Epochen „unitonique“, „transitonique“, „pluritonique“ und „omnitonique“, wobei er die Vorstellung der ersten beiden offensichtlich von Choron übernahm. Die „ancienne tonalité unitonique“ bezeichnet dabei die Musik der Renaissance bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Der Begriff „unitonique“ bezieht sich darauf, dass es laut Fétis in der „tonalité ancienne“, der die Modi der Kirchentonarten zugrunde lagen, nicht möglich war in dem Sinn zu modulieren, wie es sich in der Dur-Moll-Harmonik etabliert hatte. Dies änderte sich erst mit der oben beschriebenen Auflösung des Dominantseptakkordes in die Tonika bei Monteverdi. Choron schrieb über diese Entwicklung:51 The most important step [in this transition] had not yet been made [during the era of Palestrina]. A master of the Lombardian school (Cl. Monteverdi), who flourished around 1590, created the harmony of the dominant; he was the first who dared to use the dominant seventh and even ninth overtly and without preparation; the first who dared to use as consonant the diminished fifth, considered until then as dissonant. And tonal harmony was known.52 Fétis sah die Zeit der „ordre transitonique“ als eine Übergangszeit zwischen der „tonalité ancienne“ und der „tonalité moderne“ an, also als eine Entwicklung von den 49 50 51 52 Ebda., S. 131. Ebda. Vgl. ebda., S. 126-130; Beiche, Tonalität, S. 5. Choron, zit. nach: Simms, Choron, Fetis, S. 122. 13 Kirchentonarten zur Dur- und Molltonart.53 Der weitere Übergang zum „ordre pluritonique“ beinhaltete keine Änderung der Tonalität, sondern einen freieren Umgang mit Modulationen. Laut Fétis begann man einzelne Noten enharmonisch zu verwechseln, um so Beziehungen zu neuen Tonarten herstellen zu können. In diesem Zusammenhang verweist Fétis insbesonders auf die zunehmende Bedeutung des verminderten Septakkords für die Modulation, wodurch es etwa möglich wurde, die zuvor nicht aufeinander beziehbaren Tonarten a-Moll und fis-Moll zu verbinden (vgl. Abbildung 3).54 Abbildung 3: Auflösung eines verminderten Septakkords nach Fétis. 55 Der in die Zukunft weisende „ordre omnitonique“ zeichnet sich schließlich dadurch aus, dass mehrere Töne eines Modulationsakkords gleichzeitig enharmonisch verwechselt werden und es so möglich ist, von einem Akkord aus potenziell in jede beliebige Tonart zu modulieren. Erste Anzeichen dieser Entwicklung finden sich laut Fétis bereits bei den Komponisten Beethoven, Rossini, Meyerbeer und Cherubini.56 In einem 1844 publizierten Artikel schrieb Fétis über die frühen Kompositionen des 21-jährigen Franz Liszt, dass dessen neue Harmonik seinem 1832 postulierten “ordre omnitonique“ entspräche.57 Zusammenfassend lässt sich über Fétis Tonalitätsauffassung sagen, dass er die – den Begriff Tonalität betreffend – wichtigsten Ideen, Motive und Überlegungen seiner Zeit reflektiert und weitergedacht hat. Wie Choron verfolgt er einen historischen Ansatz, den 53 54 55 56 57 Gewissermaßen war die „tonalité moderne“ bei Fétis ein Überbegriff für die Epochen „transitonique“, „pluritonique“ und „omnitonique“. Alle diese Epochen verwenden die „tonalité moderne“, allerdings ist die „odre transitonique“ noch in einem Übergangsstadium begriffen. Vgl. Simms, Choron, Fetis, S. 130-132. Ebda., S. 131. Vgl. ebda., S. 132. Vgl. Klára Móricz, The Ambivalent Connection between Theory and Practice in the Relationship of F. Liszt & F.-J. Fétis, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Bd. 35,4), 19931994, S. 399-420, hier S. 414. 14 er versucht auf die Musik seiner Zeit auszuweiten. Auch eine kognitive Dimension wird von Fétis impliziert, allerdings ist für ihn die Wahrnehmung nicht der Grund für das Entstehen von Tonalität, sondern ein Element, das mit dem bewussten Entscheidungsprozess des Komponisten in stetiger Wechselwirkung steht. In der Auffassung, dass Monteverdi in einer selbstständigen Handlung – das heißt nicht zwingend als Resultat einer „natürlichen“ Entwicklung – die Auflösung der Dominante in die Tonika „gefunden“ hätte, wird ein weiteres Motiv deutlich, das besonders in der Musiktheorie des 20. Jahrhunderts an Bedeutung gewinnt: die Vorstellung, dass Tonalität bewusst durch den Komponisten „gesetzt“ und verändert werden kann und somit in gewissem Sinne auch eine Kompositionstechnik darstellt. Dem entsprechend werden nach dieser Auffassung die, eine bestimmte Tonalität auszeichnenden, Beziehungen zwischen den Tönen und Harmonien einer Tonleiter nicht von physikalischen oder physiologischen Phänomenen gelenkt, sondern variieren abhängig von den kulturellen und soziologischen Gegebenheiten der Zeit. Insofern verwendet Fétis den Begriff Tonalität auch, um zwischen der harmonischen Syntax unterschiedlicher Epochen und unterschiedlicher Kulturen unterscheiden zu können. Die charakteristischen Merkmale der Dur-MollTonalität, die aus der soziokulturellen Entwicklung der europäischen Kunstmusik hervorging, sind die Auflösung der Dominante in die Tonika und die Möglichkeit der enharmonischen Modulation. Diese Merkmale wurden von Fétis nur im besonderen Zusammenhang mit der europäischen Kunstmusik definiert und können sich von Tonalität zu Tonalität unterscheiden. Indem Fétis eine arithmetische Erklärung explizit als Beschreibung für Tonalität ausschloss58, wird ein weiteres für den Tonalitätsbegriff des 20. Jahrhundert bedeutendes Motiv offen gelegt. So wurden auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder Versuche unternommen dur-moll-tonale Musik mit der Hilfe mathematischer Modelle zu erklären (vgl. S. 46). 58 Angeblich hat Fétis sechs Jahre seiner Zeit damit verbracht selbst nach einer mathematischen Begründung für die Dur-Moll-Tonalität zu suchen, bevor er diese Möglichkeit schließlich verworfen hat. Vgl. dazu: Rosalie Schellhous, Fetis’s „Tonality“ as a Metaphysical Principle: Hypothesis for a New Science, in: Music Theory Spectrum (Bd. 13,2), 1991, S. 219-240, hier S. 222. 15 1.3 Tonalität und Tonart im deutschsprachigen Raum Die Verbreitung des Begriffs Tonalität im deutschsprachigen Raum begann um 1830.59 1834 erschien in der Neuen Zeitschrift für Musik eine Rezension der Revue musicale mit beigefügter Übersetzung von Fétis’ Aufsatz Vergleich des jetzigen Zustands der Musik mit dem vergangener Epochen.60 In einer Fußnote des Artikels heißt es: „Für tonalité dürfte ein bezeichnender Ausdruck im Deutschen schwer zu finden sein. Der Zusammenhang wird dem Leser den Begriff leicht geben können.“61 Wie der Titel des Aufsatzes bereits vermuten lässt, behandelt Fétis darin nicht die systematischen Aspekte des Begriffs, sondern die historische Entwicklung der „tonalité moderne“: Die Tonalität, Basis aller Musik, hat seit drei Jahrhunderten mehrere Veränderungen erlitten; [...] Nachdem die Tonalität von der eintönigen Form zur mehrtönigen überging, ist sie nach und nach zur alltönigen gekommen, wo sich jedwede gegebene Note, mittelst der Enharmonie, auflösen läßt.62 Aus der Sicht deutscher Musiktheoretiker waren die systematischen Aspekte, die den Begriff bei Fétis begleiteten – also die harmonische bzw. tonale Syntax (die Beziehungen zwischen Harmonien oder Tönen einer Tonleiter) und die Möglichkeit der enharmonischen Verwechslung – keinesfalls neue Erkenntnisse. Diese musikalischen Eigenschaften wurden in der deutschsprachigen Literatur der Zeit meist unter dem Begriff Tonart zusammengefasst. Georg Joseph Vogler schreibt beispielsweise 1802: „Tonart ist das, was die Tonleitung bestimmt, weil diese immer auf den Karakter der Tonart einen unverkennbaren Bezug haben muß.“63 Unter Tonleitung versteht Vogler 59 60 61 62 63 Der erste Beleg in der deutschen Literatur scheint eine beiläufige Verwendung des Begriffs in einem Artikel der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1830 zu sein. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine kritische Reaktion auf Fétis’ Äußerungen bezüglich Mozarts bekanntem Streichquartett in C-Dur KV 465 („Dissonanzenquartett“). Vgl. A. C. Leduc, Ueber den Ausatz des Herrn Fétis (in dessen Revue musicale Tome V. Nr. 26. 1829), eine Stelle Mozart’s betreffend, in: Allgemeine Musikalische Zeitung (Bd. 32,8), Februar 1830, S. 117-132, hier S. 124. Eine weitere Verwendung lässt sich 1833 in der Übersetzung D. Jelenspergers L’harmonie au commencement du 19me siecle nachweisen (vgl. Beiche, Tonalität, S. 6). Vgl. Beiche, Tonalität, S. 6. Journalschau (Fortsetzung). VI. Revue musicale, in: Neue Leipziger Zeitschrift für Musik (Bd. 1,58) Oktober 1834, S. 230-232, hier S. 232. Ebda. Georg Joseph Vogler, Handbuch zur Harmonielehre und für den Generalbaß, nach den Grundsätzen der Mannheimer Tonschule, Prag 1802, S. 8. 16 das Resultat von einem allmälig und harmonisch wirkenden Eindruck der Lehre von Schlußfällen64 und Mehrdeutigkeit65 auf das Ohr. Die Tonleitung gibt Aufschluß über die Sukzession der Harmonien, und wie das Gefühl davon affizirt, d. i: bald überrascht, bald getäuscht wird.66 Vogler verbindet mit dem Begriff Tonart somit die „Sukzession der Harmonien“ und deren Wahrnehmung, unter besonderer Berücksichtigung der Kadenz und der Mehrdeutigkeit von Akkorden. Die Ähnlichkeit dieser Auffassung mit Fétis Definition der „tonalité moderne“ mittels der Auflösung eines Dominantseptakkords in eine Tonika und der Möglichkeit enharmonischer Modulationen ist auffällig. Vogler gibt außerdem noch an, dass sich die Tonleitung auf den Hauptton – die I. Stufe der Tonart – bezieht: Da der Begriff Klang allgemeiner ist, als Ton, so nenne ich den vornehmsten Ton jeder Harmonie, der aber nicht immer zum Grunde (im Baß) liegt, Hauptklang, den Ton, der im Baß liegt, Grundton, und den ersten unter den 7 Hauptklängen jeder Tonart, worauf die Tonleitung sich bezieht, Hauptton. In ähnlicher Weise beschreibt auch 1775 Johann Georg Sulzer die Bedeutung des Dreiklangs auf der ersten Stufe. Sulzer verwendet die Begriffe Hauptklang und Tonika zwar noch nicht im direkten Zusammenhang mit dem Begriff Tonart (insofern ist „Tonart“ bei Sulzer eher vergleichbar mit dem Begriff Tonleiter),67 bei der Begriffsbeschreibung von „Tonica“ schreibt er allerdings: Mit diesem Worte [Tonica] wird der Grundton der diatonischen Tonleiter angedeutet, der in jedem Satz eines Stücks der Hauptton ist, in welchem der Gesang und die Harmonie fortgehen, und den Satz schließen. Die Tonica ist daher von dem eigentlichen Hauptton darin unterschieden, daß sie mit jeder Ausweichung ihren Platz verändert, da dieser hingegen durchs ganze Stück derselbe bleibt. Doch wird sie auch in der Bedeutung des Haupttones genommen, wenn man sagt, der erste Theil eines Stücks habe in der Dominante geschlossen. Der fünfte Ton der Tonica ist die Dominante.68 64 65 66 67 68 Vogler verwendet den Begriff „Schlußfall statt Kadenz, worunter man auch die willkührlichen Schnörkel zu Ende der Bravour-Arie versteht.“ (Ebda., S. 6). „Die Lehre der Mehrdeutigkeit bestimmt [...] alle möglichen Fälle, wo entweder dieselbigen Harmonien dem Gehöre wie verschiedene, oder verschiedene dem Gehöre wie dieselben vorkommen.“ (Ebda.). Ebda. S. 8-9. Vgl. Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln. 2. Teil, Leipzig: M. G. Weidmanns Erben und Reich 1775, S. 779. Ebda., S. 783. 17 Vergleichbares schreibt Gottfried Weber 1830 bei der Definition des Begriffes Tonart in seinem Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst: Wenn unser Gehör eine Folge von Tönen und Harmonieen vernimmt, so strebt es, seiner Natur gemäss, unter diesem Manchfaltigen einen inneren Zusammenhang, eine Beziehung auf einen gemeinsamen Mittelpunct, zu finden. [...] Das Gehör verlangt überall, einen Ton als Haupt- und Centralton, eine Harmonie als Hauptharmonie zu empfinden [...]. Insofern nun solchergestalt ein Ton als Haupt- und Centralton, eine Harmonie als CentralHarmonie erscheint [...], so nennt man solche Harmonie tonische Harmonie, und den Grundton dieser Harmonie Tonica [...]. Man [...] nennt solche Herrschaft einer Hauptharmonie über die übrigen: Tonart.69 Als erläuterndes Beispiel für den „etwas abstract ausgedrückten Satz“70 dieses Zitats bringt Weber eine schlichte Kadenz in C-Dur (vgl. Abbildung 4): „Beim Anhören des nachstehenden Satzes fühlt jedes Ohr den Ton c als Centralton [...] und den C-Dreiklang als die Hauptharmonie des Satzes.“71 Abbildung 4: C-Dur Kadenz Gottfried Webers.72 Während Fétis nur implizit die Tonika als einen Zentralklang der Dur-Moll-Tonalität angibt, indem er die Auflösung des Dominantseptakkordes in den Dreiklang auf der I. Stufe als grundlegendes Element der „tonalité moderne“ bezeichnet, verweist Weber bei seiner Definition von Tonart explizit auf diesen Zusammenhang. Umgekehrt impliziert Weber die Auflösung des Dominantseptakkordes als entscheidendes Moment der Tonika, indem er zeigt, dass diese nur durch die Kadenz als solche wahrgenommen wird. 69 70 71 72 Gottfried Weber, Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, Bd. 2, Paris: B. Schott’s Söhne 1830, S. 1-2. Ebda., S. 1. Ebda., S. 2. Ebda. 18 Auffällig an Webers Definition ist auch sein besonderes Hervorheben der Begriffe „Haupt- und Centralton“ sowie des Begriffs „Central-Harmonie“.73 Er legte dabei offensichtlich großen Wert darauf, im Zusammenhang mit diesen Begriffen nicht missverstanden zu werden. In den Lehrbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts wurden Begriffe wie Hauptton, Tonika oder auch Hauptklang nicht immer einheitlich verwendet und teilweise als Synonyme für den Basston eines Dreiklanges in Grundstellung – den „basse fondamentale“ – betrachtet. Vogler versteht beispielsweise in der oben zitierten Stelle unter dem Begriff Hauptton zwar dasselbe wie Weber. Den Bass eines Akkordes bezeichnet Vogler jedoch als „Grundton“. Dagegen bezeichnet er das, was Weber hier als „Grundton“ ansieht, nämlich den Basston eines Dreiklanges in Grundstellung,74 als „Hauptklang“ (vgl. oben). Dem gegenüber unterscheidet Sulzer explizit zwischen Hauptton und Tonika: Die Tonika verändere „mit jeder Ausweichung ihren Platz“, während der Hauptton „durchs ganze Stück derselbe bleibt“ (vgl. oben). Weber weist auch darauf hin, dass die Terz und Quint eines grundständigen Dreiklanges gelegentlich als „Mediante“ und „Dominante“ bezeichnet werden, er von diesen Ausdrücken in dem Zusammenhang jedoch absehe, um insbesonders den Begriff „Dominante“ auf den Dreiklang der V. Stufe anwenden zu können.75 Nachdem in der deutschen Musiktheorie der systematische Anteil von Fétis’ Tonalitätsbegriff bereits mit dem Begriff Tonart belegt war, sollte es nicht überraschen, wenn diese Begriffe bis heute häufig synonym verwendet wurden (insbesondere auch im romanischen und angelsächsischen Sprachgebrauch76). Auch das in dieser Zeit zunehmende „Ersetzen“ des bestimmenden Merkmals bei Fétis – die Auflösung der Dominante – durch den Begriff Tonika erklärt sich aus diesem Zusammenhang. Gerade in den Jahren 1830 bis 1860 fällt zudem auf, dass der Begriff im deutschsprachigen Raum häufig im Zusammenhang mit der von Fétis beschriebenen historischen Entwicklung von der alten zur neuen Tonalität erwähnt wird. Insofern wurde der Teil aus Fétis Tonalitätsbegriff extrahiert, der aus Sicht der deutschsprachigen Musiktheorie etwas Besonderes darstellte, nämlich das Bewerten der dur-moll-tonalen Entwicklungs73 74 75 76 Als Synonyme für den Begriff „tonische Harmonie“ führt Weber noch folgende an: „tonischer Accord“, „Haupt- oder Principal-Akkord“; als Synonyme für den Begriff „Tonica“: „tonische Note“, „erste Note“, „erste Stufe“, „Prime“, „Finalnote“, „Finalsaite“, „Principalnote“, „Hauptton“, „Hauptnote“ (vgl. ebda.). Vgl. ebda., S. 213. Vgl. ebda., S. 199-200. Vgl. Beiche, Tonalität, S. 7. 19 geschichte mittels der harmonischen Syntax.77 Auf den besonderen Schwerpunkt der Musikgeschichte in Fétis’ Werk weist auch die oben erwähnte Rezension der Neuen Zeitschrift für Musik hin, wenn auch das Fehlen von „Poesie“ in seinen Schriften bemängelt wird: [...] da er [Fétis] tiefe und sehr mannichfache Kenntnis in allen Theilen der Geschichte der Musik besitzt, so herrscht das Geschichtliche auf eine auffallende Weise vor, indem es alles andere in den Hintergrund zurückdrängt. Die Poesie hat hierbei nichts zu thun, und läßt Hrn. Fétis mit seinen Jahreszahlen oft allein dastehen.78 Als musikhistorischer Ausdruck zur Unterscheidung unterschiedlicher Epochen wird der Begriff Tonalität in den 1840er Jahren häufig rezipiert. Bei der deutschen Übersetzung von Félicité Robert de Lamennais’ Grundriss einer Philosophie (1841), der sich dabei wohl direkt auf Fétis bezieht, heißt es: Monteverde brachte, vielleicht ohne es zu wissen, diese große Revolution zu Stande. In Folge der Kühnheit seines Talents allein, schuf er, indem er das Verhältniß der Übergangsnote mit der vierten Stufe angab, die natürlichen Dissonanzen der Harmonie und sofort die Modulation; an die Stelle der Tonalität des Kirchengesanges, die sich mit diesen Abänderungen nicht vertrug, setzte er eine andere Tonalität [...], kurz er war der Erfinder einer neuen Musik.79 Carl Georg August Vivigens von Winterfeld macht in einer Biographie des Komponisten Adam Gumpelzhaimer darauf aufmerksam, dass sich bei diesem auch bereits die neue Tonalität anbahne. In diesem Artikel verweist er auch ausdrücklich auf Fétis:80 Einen wirklichen Leitton konnte deshalb die ältere Tonkunst nicht besitzen, und die Tonalität unserer Tage war damals unmöglich. [...] Was die Tonlehre so bestimmt untersagt hatte, wurde aber durch einen glücklichen Instinct Monteverde’s gewagt; er schuf dadurch die natürlichen 77 78 79 80 Bryan Simms schreibt über die Bedeutung von Fétis’ historischer Darstellung: „His vision of an omnitonic order in music was a remarkable innovation to historic and theoretic concepts of the nineteenth century. Many of his contemporary critics viewed the course of music of their own time vaguely as a process of increasing complexity; others, such as Choron and Castil-Blaze, saw contemporary music as some sort of interaction of the various national ‚schools’. It was to Fetis’s credit, then, that he rightly saw the history of nineteenth-century music as essentially a matter of changing harmonic styles and techniques.“ (Simms, Choron, Fetis, S. 132). Journalschau (Fortsetzung). VI. Revue musicale, S. 230. Félicité Robert de Lamennais, Grundriss einer Philosophie Bd. 3, Paris/Leipzig: Jules Renouard 1841, S. 284. Vgl. Carl Georg August Vivigens von Winterfeld, Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniss zur Kunst des Tonsatzes Bd. 1, Leipzig: Breitkopf und Härtel 1843, S. 498. 20 Mißklänge der Harmonie, denn er erkannte den in der diatonischen Leiter enthaltenen Tritonus als rechten Hebel für die Ausweichung, und erfand dadurch die Tonalität, das chromatische Geschlecht. Ein Mann nur vor ihm, Adam Gumpelzhaimer, bahnte diese Erfindung an, aber niemand hat seiner gedacht.81 Zu den ersten musiktheoretischen Schriften im deutschsprachigen Raum, die den Ausdruck Tonalität verwenden, zählt Siegfried Wilhelm Dehns Theoretisch-praktische Harmonielehre (1840).82 Allerdings ist für Dehn der Ausdruck Tonalität offenbar noch nicht von großer musiktheoretischer Bedeutung, so gibt er weder eine Definition des Begriffs, noch erwähnt er ihn im Stichwortverzeichnis des Buches.83 Einmal verwendet Dehn den Begriff recht beiläufig im Zusammenhang mit den Verwandtschaftsverhältnissen der Tonarten, ein andermal – und hier eindringlicher – benutzt Dehn den Begriff im Zusammenhang mit der Geschichte der Dur-Moll-Harmonik: Bis zu den Zeiten Monteverde’s (vergl. pag. 289) herrschte die Tonalität der sogenannten Kirchentonarten [...]. Erst mit Einführung der neuen Tonalität wurde das Feld selbstständiger neuer Harmonieen erweitert, und hiermit entstand denn auch die Nothwendigkeit einer selbstständigen Harmonielehre [...].84 Auf der angegebenen Seite 289 schreibt Dehn: Die regelmässige Behandlung der Dissonanzen, d. h. ihr Eintreten mittelst vorher liegender Consonanz, ihre stufenweise Auflösung, u. s. w., gehörte früher zu den wesentlichen Bedingungen der sogenannten strengen oder gebundenen Schreibart [...]. Bis zu der Zeit des Claudio Monteverde [...] herrschte diese Schreibart fast allgemein [...]. Zu den bedeutendsten Neuerungen jener Zeit nun gehören Monteverde’s Versuche in einer freieren Behandlung der Dissonanzen; er war der Erste, welcher in mehreren Stimmen zu gleicher Zeit Vorhalte anbrachte [...].85 Auch wenn Dehn nicht ausdrücklich Fétis als Quelle angibt, so ist der Zusammenhang, in dem der Begriff Tonalität hier verwendet wird, doch von auffälliger Ähnlichkeit zu den oben angegebenen Zitaten von Lamennais und Winterfeld. Alle drei beziehen sich 81 82 83 84 85 Ebda., S. 499. Vgl. Beiche, Tonalität, S. 7. Vgl. Siegfried Wilhelm Dehn, Theoretisch-praktische Harmonielehre mit angefügten Generalbassbeispielen, Berlin: Wilhelm Thome 1840, S. 311-315. Ebda., S. 306-307. Ebda., S. 289. 21 dabei auf Monteverdi als den Urheber der neuen Tonalität und dessen besondere Behandlung der Dissonanzen beziehungsweise deren Auflösung. Die weitere Stelle in der Dehn den Begriff Tonalität verwendet ist im Zusammenhang mit den Verwandtschaftsverhältnissen der Tonarten. Er spricht dabei von der unveränderten „Tonalität der Tonart C-Dur“: Weiter als bis zum vollkommenen Grunddreiklang von D moll kann, mit Rücksicht auf unveränderte Tonalität der Tonart C Dur, diese Kette von Dreiklängen nicht geführt werden; denn nach dem Dreiklange d, f, a, würde b, d, f, folgen, der einen der Tonart C Dur fremden Ton, nemlich b, mit sich führt.86 Die Dreiklangskette, von der Dehn hier spricht, ist die alterierende Terzenreihe C-Dur, a-Moll, F-Dur, d-Moll. Das Verändern der „Tonalität der Tonart“ durch ein Weiterführen dieser Reihe mit B-Dur ist hier nichts anderes als das Verändern der Tonart selbst. In so fern bahnt sich hier bereits die spätere Vermischung der beiden Termini Tonart und Tonalität an. Unter Tonart versteht Dehn den „Inbegriff von acht Tönen [der Dur- bzw. Moll-Tonleiter], deren jeder einzelne zu einem bestimmten Ton, Haupt- oder Grundton, in einem einmal als Norm angenommenen Verhältnisse der Entfernung steht.“87 Dehn verwendet die Bezeichnungen Hauptton und Grundton synonym mir dem Intervall der „Prim“, von der I. Stufe der Tonart aus gerechnet. Als „Nebenbenennung“ für diesen Ton gibt er die Bezeichnung „Tonica“ an. Das von der Tonika aus gerechnete Intervall der großen Terz bezeichnet Dehn des Weiteren als „Mediante“, das Intervall der Quint als „Dominante“ und das Intervall der Septime als „Leitton“.88 Diese besondere Verbindung des Tonartbegriffs mit den Intervallen im Bezug auf die I. Stufe ist ein herausragendes Merkmal in Dehns theoretischen Überlegungen. Davon ausgehend deutet Dehn die Tonartverwandtschaften anhand der Konsonanzen und Dissonanzen der Tonart. Als konsonante Intervalle lässt Dehn in diesem Zusammenhang nur die große und kleine Terz, die reine Quint, die große und kleine Sext und die reine Oktav gelten. Die Intervalle Sekund, Quart und Septim seien dagegen dissonant.89 Laut Dehn sind nun 86 87 88 89 Ebda., S. 234. Ebda., S. 58. Vgl. ebda., S. 78. Vgl. ebda., S. 82. 22 jene Tonarten miteinander verwandt, deren Grunddreiklänge sich aus Konsonanzen einer anderen Tonart zusammensetzen: In jeder Tonart giebt es zwei vollkommene Dreiklänge, d. h. solche, die nur aus Consonanzen der Tonart bestehen. [...] In C Dur sind diese beiden Dreiklänge c, e, g und a, c, e; in C moll: c, es, g, und as, c, es; in A moll a, c, e und f, a, c; u. s. w. Beiläufig kann hier auch noch erwähnt werden, dass der Dominantenakkord jeder Tonart sich in einen dieser beiden vollkommenen Dreiklänge auflöst, wenn die Auflösung überhaupt eine regelmässige ist [...]. Mit Rücksicht auf das Wesen der Consonanzen und Dissonanzen einer Tonart, [...] kann hier nun auch der Grundsatz aufgestellt werden, dass diejenigen Tonarten am nächsten mit einander verwandt sind, deren vollkommene Grunddreiklänge (oder Dreiklänge auf dem - Grundton der Tonart) in einer und derselben Tonart als vollkommene Dreiklänge vorkommen.90 Dem entsprechend bildet Dehn die oben beschriebene Verwandtschaftsreihe C-Dur, a-Moll, F-Dur, d-Moll und in umgekehrter Richtung C-Dur, e-Moll und G-Dur (vgl. Abbildung 5). Abbildung 5: Verwandtschaftsreihe der Tonarten nach Siegfried Wilhelm Dehn.91 90 91 Ebda., S. 233. Ebda., S. 234. 23 Als Übersicht der Verwandtschaftsbeziehungen aller Tonarten gibt Dehn folgendes Schema an (vgl. Abbildung 6). Abbildung 6: Schema der Tonartverwandtschaften nach Siegfried Wilhelm Dehn92 Mit dieser außerordentlichen Einschätzung der Verwandtschaftsverhältnisse über einen alterierenden Terzenzirkel93 widerspricht Dehn den gängigen Meinungen der meisten Zeitgenossen, welche die Tonartverhältnisse meist über den Quintenzirkel oder – wie im Falle von Gottfried Weber – aus einer Mischung von Quintenzirkel und verwandten Molltonarten deuten.94 Für Weber, der den Quintenzirkel als ersten Verwandtschaftsgrad ansieht, sind entsprechend nicht a-Moll und e-Moll die nächst verwandten Tonarten von C-Dur, sondern F-Dur und G-Dur.95 Auch Weber kommt zu einem vergleichbaren, jedoch nicht identischen, Schema der Verwandtschaftsgrade (vgl. Abbildung 7).96 Einer der wichtigsten Unterschiede der beiden Auffassungen ist, dass in Webers Darstellung die Tonarten A-Dur und Es-Dur dem Verwandschaftsgrad nach C-Dur sehr 92 93 94 95 96 Ebda., S. 235. Der alterierende Terzenzirkel beinhaltet auch die Verwandtschaftsverhältnisse des Quintenzirkels bzw. Quartenzirkels, worauf Siegfried Wilhelm Dehn bei seinen weiteren Ausführungen auch eingeht (vgl. Dehn, Theoretisch-praktische Harmonielehre, S. 235f). Moritz Hauptmann verwendet in seinen Theorien vergleichbare Terzenzirkel, allerdings ergibt sich dieser aus anderem Zusammenhang (vgl. Abbildung 9). Bei Hugo Riemann gewinnt die Terzverwandtschaft durch die Funktionen der Parallelund Wechselklänge eine große Bedeutung und im späten 20. Jahrhundert werden die Verwandtschaftsverhältnisse des Terzenzirkels auch von der sogenannten Transformation-Theory und der musiktheoretischen Neo-Riemann-Bewegungen wieder aufgegriffen (vgl. S. Fehler! Textmarke nicht definiert.). Vgl. Weber, Versuch einer geordneten Theorie, S. 69-86. Vgl. ebda. S. 70f. Für ein komplettes Schema der Verwandtschaftsverhältnisse nach Gottfried Weber, siehe Anhang b, Abbildung 77. 24 viel näher liegen, als in Dehns Schema. Auf eine Inkonsequenz in diesem Zusammenhang deutet Weber selbst hin: Nach der […] Darstellung [Abbildung 7] sind die eben genannten vier Tonarten [D, A, Es und B] mit C im zweiten Grade, also sämtlich gleich nahe, verwandt; dennoch ist diese Verwandtschaft, genauer betrachtet, nicht ganz gleich innig. Man fühlt es schon, ohne genaue Betrachtung, dass Es und A dem C im Grunde doch noch fremder sind als D, B, e, d, f und g.97 Auf der anderen Seite trägt Weber der Verwandtschaft zwischen C-Dur und c-Moll Rechnung, welche in Dehns Darstellung dem Verwandtschaftsverhältnis zu Es-Dur untergeordnet ist. Abbildung 7: Schema der Tonartverwandtschaften nach Gottfried Weber98 Ebenso unvermittelt wie Siegfried Wilhelm Dehn verwendet Arrey von Dommer in seinem 1862 erschienenen Elemente der Musik den Begriff Tonalität. Auch Dommer gibt keinerlei Definition des Begriffs Tonalität an und hält ihn nicht für wichtig genug ihn in sein Stichwortverzeichnis als Hauptbegriff aufzunehmen.99 Allerdings erscheint der Begriff im Stichwortverzeichnis eigenartigerweise als Unterbegriff von „Periode“ („- deren Tonalität“).100 Die dort verwiesene Stelle ist auch die wichtigste Stelle im Buch, die sich dem Begriff widmet: Kehren wir jedoch für’s Erste zur einfachen achttaktigen Periode zurück und betrachten sie in Betreff ihrer Tonalität und Cadenzen. Die Tonalität kann verschieden sein. Eine Periode kann: 1. 97 98 99 100 vollständig tonisch gehalten sein, auf der Tonika beginnen, bleiben und schliessen; Vgl. Weber, Versuch einer geordneten Theorie, S. 81. Ebda., S. 81. Vgl. Arrey von Dommer, Elemente der Musik, Leipzig: T. O. Weigel 1862, S. 368. Vgl. ebda., S. 366. 25 2. auf der Tonika beginnen und schliessen, aber durchgehend in andere leitereigene Töne modulieren; 3. auf der Tonika beginnen, aber in einen anderen Ton hinein moduliren und in diesem schließen; 4. weder auf der Tonika beginnen, noch in einem bestimmten Ton verharren, sondern beständig aus einem in den anderen modulieren, wie die sogenannten Modulationsperioden, welche inmitten aller grösseren Sätze vorkommen.101 Bei Dommers Beschreibung der möglichen harmonischen Schwerpunkte einer Periode, also deren Ausweichungen beziehungsweise Modulationen, lässt sich eine wichtige Bedeutungsänderung in Bezug auf den Begriff „Tonika“ feststellen.102 Während bei Sulzer die Tonika noch „mit jeder Ausweichung ihren Platz verändert“103 (vgl. S. 17), verwendet Dommer den Begriff Tonika bereits, um damit einen übergeordneten Bezugspunkt zu bezeichnen, der unabhängig von den Modulationen innerhalb eines Satzes gleich bleibt. Im Zusammenhang mit der Fugenkomposition schreibt Dommer: Führer und Gefährte stehen also im Verhältniss der Tonika und Dominant. [...] Vor allem ist zu beachten, dass Einheit der Tonalität zwischen Gefährten und Führer aufrecht erhalten werde, der Gefährte also von der Haupttonart nicht zu weit sich entferne, nicht einmal die Dominanttonart gleich beim Eintritt als eine durchaus selbstständige Tonart hinstelle, sondern als eine vom Hauptton abhängige.104 Diese Aussage legt nahe, dass Dommer zwischen den Begriffen Tonalität und Tonart in ähnlicher Weise unterscheidet wie zwischen der Tonika und einer vorübergehenden Hauptstufe innerhalb einer Ausweichung. Tonalität wäre dann für Dommer ein allgemeinerer Begriff als Tonart und bezieht sich immer auf die Tonart der Tonika – die „Haupttonart“. Während sich innerhalb einer Periode die Tonart durch Ausweichung oder Modulation verändern kann, bleibt die Tonalität gemeinsam mit der Tonika bestehen. Diese wichtige Einsicht – die Möglichkeit Tonalität als übergeordneten Tonartbegriff anzusehen – wurde später auch von Hugo Riemann wieder aufgegriffen (vgl. S. 35). 101 102 103 104 Ebda., S. 156. Vgl. auch Beiche, Tonalität, S. 7. Sulzer, Allgemeine Theorie, S. 783. Dommer, Elemente der Musik, S. 196. 26 1.4 Hauptmann – Helmholtz – Oettingen Moritz Hauptmann vertrat in seinem Buch Die Natur der Harmonik und der Metrik (1853) bereits ähnliche Ansichten wie Arrey von Dommer, allerdings ohne dabei direkt auf den Begriff Tonalität zu verweisen. Hauptmann war der Naturklangtheorie verbunden und führte in seinem Buch eine eigene Schreibweise ein, die zwischen Terzen und Quinten unterscheidet, um damit den Unterschied zwischen vier reinen Quinten und einer reinen Terz hervorzuheben. Aus Sicht eines Dur-Dreiklangs bezeichnet Hauptmann Terzen mit Kleinbuchstaben, Grundton oder Quint dagegen mit Großbuchstaben (z.B. „e–G–C“ als erste Umkehrung von C-Dur).105 Für ihn gab es drei unveränderliche, „direkt verständliche“ Intervalle: die Oktav, die Quint und die Terz. Die Oktav repräsentiert für Hauptmann „Identität“ und „Gleichheit“, die Quint „Zweiheit“ und „inneren Gegensatz“ und die Terz sieht er als „Gleichsetzung des Entgegengesetzten: der Zweiheit als Einheit“ an.106 Wenn die Oktave Ausdruck ist für Einheit, so spricht die Quint die Zweiheit oder Trennung aus, die Terz Einheit der Zweiheit oder Verbindung. Die Terz ist die Verbindung der Oktave und Quint.107 In Hauptmanns Vorstellung von These, Antithese und Synthese spiegelt sich die Philosophie der Hegelschen Dialektik wider. Diese dialektische Denkweise durchdringt Hauptmanns Theorien auf allen musikalischen Ebenen: den Akkorden, den Akkordfortschreitungen, der Form und auch der Rhythmik und Metrik.108 So verbinden sich die drei Momente Oktave, Terz und Quint im Dreiklang wiederum zum „gegliederten Ganzen“, zur „Einheit“. Als Gegensatz stehen dem Dreiklang der Tonika die Antithesen Dominante und Subdominante gegenüber, die in der Tonart als „Dreiklang höherer Ordnung“ wiederum mit der Tonika vereint werden.109 Abbildung 8 zeigt ein Schema Hauptmanns, welches die dialektischen Beziehungen der Tonart darstellt. Die römischen Ziffern entsprechen dabei den Momenten Antithese (I–II) und Synthese (III). 105 106 107 108 109 Vgl. Moritz Hauptmann, Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik, Leipzig: Breitkopf u. Härtel 1853, S. 11. Vgl. ebda., S. 21f. Ebda., S. 22. Vgl. ebda., S. 23. Vgl. ebda., S. 27. 27 Abbildung 8: Hauptmanns dialektischer Tonartbegriff.110 Hauptmann vertritt also wie Weber die Vorstellung eines Tonartbegriffs, der durch die Kadenz – die Beziehungen zwischen Subdominante, Dominante und Tonika – definiert wird. Allerdings nimmt die Tonika eine besonders zentrale Rolle als verbindendes Element der Antithesen Dominante und Subdominante ein. Folgende Aussage legt sogar nahe, dass die Begriffe Tonika und Tonart aus Hauptmanns Sicht im Grunde austauschbar sind, da das Vorhandensein einer Tonika automatisch eine Tonart entstehen lässt: Die Tonart entstand, wenn der gegebene Dreiklang, nachdem er durch den Unter- und OberDominant-Accord, mit sich selbst in Gegensatz gekommen war, diesen Gegensatz als Einheit in sich zusammenfasste und damit Tonica wurde.111 Auch die Beziehungen zwischen Tonarten deutet Hauptmann in weiterer Konsequenz gemäß den Regeln der Hegelschen Dialektik. Der „tonischen Tonart“, als „Mitte eines Tonartensystems“, treten als Antithesen die Tonarten der Dominante und der Subdominante entgegen.112 Abbildung 9 zeigt diese Tonartbeziehungen; die dargestellte alterierende Terzfolge (B–d–F–a–C usw.) erinnert zwar an das Schema der Tonartverwandtschaften von Siegfried Wilhelm Dehn (Abbildung 6), sollte jedoch nicht mit diesem verwechselt werden, da die Kleinbuchstaben sich hier nicht auf einen Moll-Dreiklang beziehen, sondern lediglich die Terz eines Dur-Dreiklangs bezeichnen. 110 111 112 Ebda., S. 26. Ebda., S. 30. Ebda., S. 30f. 28 Abbildung 9: Dialektische Tonartbeziehungen Hauptmanns.113 Größere Popularität erlangte der Begriff Tonalität im deutschsprachigen Raum erst in den 1860er Jahren. Auslöser dafür war Hermann von Helmholtz’ 1863 publiziertes Buch Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Diese Veröffentlichung hatte nicht nur weit reichende Auswirkungen auf die Musiktheorie selbst, sondern auch auf benachbarte Disziplinen. Für die rasche Verbreitung des Begriffs Tonalität in den folgenden Jahren sorgten unter anderem mehrere naturwissenschaftliche Fachzeitschriften, die sich mit Helmholtz’ Theorien auseinander setzten. So finden sich beispielsweise im Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern im Jahre 1862114 (1863) oder in Aus der Natur. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet d. Naturwissenschaft115 (1863) Rezensionen von Helmholtz’ Buch und auch in den folgenden Jahren waren seine Theorien ein sehr häufig diskutiertes Gesprächsthema in der wissenschaftlichen Literatur. Helmholtz schlug damit zum ersten Mal eine Brücke zwischen der bis dahin weitgehend isoliert voneinander agierenden Musiktheorie und den Naturwissenschaften, insbesondere der Akustik und der Psychologie. Gemeinsam mit den beiden von Carl Stumpf 1883/1890 veröffentlichten Bänden Tonpsychologie116 hat Helmholtz damit auch die Grundsteine für die neue Wissenschaft der Musikpsychologie gelegt. Wie selbstverständlich der Begriff Tonalität zu jener Zeit plötzlich geworden war, illustriert ein Artikel aus dem Jahre 1864, in dem der Autor den Begriff Tonalität als Übersetzung des lateinischen „tonus“ einführt.117 113 114 115 116 117 Ebda., S. 31. Gabriel Gustav Valentin, Bericht über die Leistungen in der Psychologie, in: Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern im Jahre 1862 (Bd. 1 Psychologische Wissenschaften), Würzburg: Stahle’sche Buch und Kunsthandlung 1863, S. 103-, 197, hier S. 159f. Wissenschaftliche Begründung der Musik, in: Aus der Natur. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet d. Naturwissenschaft (Bd. 25 oder neue Folge Bd. 13), Leipzig: Gerhardt & Reisland 1863, S. 481-487. Carl Stumpf, Tonpsychologie [1883/1890] (2 Bde.), Leipzig: Hirzel 1965. „Die Tonalität ist eine gewisse Beschaffenheit der Melodie“ – „Tonus est certa qualitas melodiae“ (August Wilhelm Ambros, Die ersten Zeiten der neuen christlichen Welt und Kunst [Bd. 2 Geschichte der Musik], Breslau, F. E. C. Leuckard 1864, S. 54). 29 Die neu gewonnene Nähe zu den Naturwissenschaften und die damit verbundene Aussicht die Musiktheorie wissenschaftlich zu fundieren wurde von vielen Musiktheoretikern der Zeit bereitwillig aufgenommen. . Es entstand aus diesem Streben – ganz im Sinne der wissenschaftlichen Aufbruchsstimmung des 19. Jahrhunderts – die zunehmende Forderung nach wissenschaftlichen Arbeitsmethoden in der Musiktheorie. Diese Tendenz zur wissenschaftlichen Methode hat in vielen Bereichen des Fachs bis heute angehalten und wurde gerade in den letzten Jahrzehnten z.B. durch die Kognitionswissenschaft oder die transformational theory wieder belebt. Ernst Kurth war 1931 der Ansicht „die Musiktheorie sei für die Musikpsychologie ungefähr das, was das Experiment für die Tonpsychologie sei.“118 Auch Thesen und Termini anderer Disziplinen wurden bereitwillig in den musiktheoretischen Sprachgebrauch übernommen. So verwendet Kurth beispielsweise die Begriffe „kinetische Energie“ im Zusammenhang mit melodischen Linien und „potentielle Energie“ im Zusammenhang mit Akkorden; diese Energien können laut Kurth ineinander umgewandelt werden.119 Kurth war auch der Ansicht, „daß Töne eine Tendenz haben gegen den Naturklang hin zu ‚gravitieren‘.“120 Im Gegensatz zu vorangegangenen Musiktheoretikern verwendet Helmholtz den Begriff Tonalität nicht mehr willkürlich, sondern setzt ihn gezielt und systematisch ein. Die in diesem Zusammenhang meist zitierte Stelle lautet: Die moderne Musik hat hauptsächlich das Princip der Tonalität streng und consequent entwickelt, wonach alle Töne eines Tonstücks durch die Verwandtschaft mit einem Hauptton, der Tonica, zusammengeschlossen werden.121 Dabei bezieht sich Helmholtz bewusst auf den Tonalitätsbegriff von Fétis, schränkt diesen allerdings auf dessen systematischen Aspekt ein und verwirft damit die bis dahin 118 119 120 121 Ludwig Holtmeier, Die Erfindung der romantischen Harmonik, in: Zwischen Komposition und Hermeneutik: Festschrift für Hartmut Fladt, Würzburg: Königshausen & Neumann 2005, S. 115; Vgl. Ernst Kurth, Musikpsychologie, Hildesheim/New York: Georg Olms 1969, S. 72. Vgl. Andreas Moraitis, Zur Theorie der musikalischen Analyse, Frankfurt a. M./ Wien: Lang 1994, S. 229-231. Helga de la Motte-Haber, Kräfte im musikalischen Raum. Musikalische Energetik und das Werk von Ernst Kurth, in: Musiktheorie (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Bd. 2), Laaber: Laaber 2005, S. 284-310, hier S. 292. Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage Für die Theorie der Musik, Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn 1863, S. 8. 30 wichtige musikgeschichtliche Bedeutung von Tonalität als Bezeichnung einer durch harmonische Beziehungen geprägten Epoche. Wir können die Herrschaft der Tonica als des bindenden Mittelgliedes für sämtliche Töne des Satzes mit Fétis als das Princip der Tonalität bezeichnen. Dieser gelehrte Musiker hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass in den Melodien verschiedener Nationen die Tonalität in sehr verschiedenem Grade und verschiedener Weise entwickelt sei.122 Auffällig ist bei dieser Interpretation von Fétis Tonalitätsbegriff, dass die Töne sich laut Helmholtz nicht auf eine Skala beziehen, sondern nunmehr einzig und allein auf den Hauptton, die Tonika. Auch wird von Helmholtz hervorgehoben, dass scheinbar unterschiedliche Nationen nicht unterschiedliche Tonalitäten hervorbringen, sondern dass „die Tonalität in sehr verschiedenem Grade und verschiedener Weise entwickelt sei“. Damit hat Helmholtz den Begriff Tonalität endgültig auf eine ganz bestimmte Ausprägung musikalischer Syntax in der europäischen Kunstmusik reduziert und ihm jene Bedeutung gegeben, in der er auch heute noch zumeist verwendet wird. Inspiriert durch Helmholtz’ Veröffentlichung, begann der Physiker Arthur von Oettingen sich kurz darauf dem Thema Musiktheorie zuzuwenden. Oettingen veröffentlichte 1866 sein Buch Harmoniesystem in dualer Entwickelung – Studien zur Theorie der Musik123, das in der wissenschaftlichen Literatur zunächst ähnlich bereitwillig rezipiert wurde wie Helmholtz’ Lehre von den Tonempfindungen. Oettingens Theorie baut auf Moritz Hauptmanns dialektischer Interpretation musikalischer Strukturen und Zusammenhänge auf. Dabei denkt Oettingen streng dualistisch und stellt der Obertonreihe eine theoretische „Untertonreihe“ gegenüber, aus der er den Moll-Dreiklang sowie die Molltonart ableitet. Unter einer Untertonreihe versteht Oettingen „all diejenigen Töne, die einen gegebenen Ton als Oberton enthalten.“124 Oettingen bezeichnet den Grundton eines Dur-Dreiklanges als den „tonischen Grundton“. Diesem stellt er den „phonischen Oberton“ entgegen, den tiefsten Partialton, den alle Akkordtöne gemeinsam haben.125 Der tonische Grundton von C-Dur ist der Ton C, der phonische Oberton ist dagegen der Ton H; der tonische Grundton von c-Moll der Ton As, der 122 123 124 125 Ebda., S. 395. Arthur von Oettingen, Harmoniesystem in dualer Entwickelung -Studien zur Theorie der Musik, Dorpat/Leipzig: Gläser 1866. Ebda., S. 31. Vgl. ebda., S. 32. 31 phonische Oberton ist dagegen der Ton G.126 Oettingen bezeichnet in weiterer Folge Dur-Dreiklänge als tonische Klänge und benennt sie nach dem tonischen Grundton (CDur = „C+“); Moll-Dreiklänge bezeichnet Oettingen als phonische Klänge und benennt sie nach dem phonischen Oberton (c-Moll = „g°“).127 In entsprechender Weise stellt Oettingen dem Begriff Tonalität auch den Begriff Phonalität gegenüber: Als dualen Gegensatz gegen das Prinzip der Tonalität stelle ich das der Phonalität auf. – Unter Phonalität aber verstehe ich das […] Prinzip, dem zufolge die gesammte Masse der Töne aus einer phonischen Klangvertretung entspringt.128 Oettingen veröffentlichte auch ein Tonnetz, das in der Horizontalen Quinten und in der Vertikalen große Terzen enthält (Abbildung 10). Dieses Tonnetz hatte besonderen Einfluss auf die Neo-Riemann-Theorie des späten 20. Jahrhunderts. Abbildung 10: Oettingens Tonnetz.129 126 127 128 129 Vgl. ebda., S. 33. Vgl. ebda., S. 45. Ebda., S. 64. Ebda., S. 15. 32 1.5 Riemann und Schenker Die Thesen von Hauptmann, Helmholtz und Oettingen wurden schließlich in den 1880er Jahren von Hugo Riemann aufgegriffen und erweitert.130 Riemann war von der Naturgegebenheit der Dur-Moll-Tonalität im Sinne der Naturklangtheorie fest überzeugt und postulierte – gemäß den Theorien Oettingens – eine Untertonreihe als dualistischen Gegensatz zur Obertonreihe.131 Von Hauptmann übernahm Riemann die Vorstellung, dass Terz und Quint die einzigen direkt verständlichen Intervalle seien.132 Die große Leistung Riemanns war es, die harmonischen Theorien des 19. Jahrhunderts in einem geschlossenen musiktheoretischen System – der Funktionstheorie – zusammenzufassen. Damit machte Riemann, insbesondere im deutschsprachigen Raum, den Tonalitätsbegriff einem größeren musiktheoretisch interessierten Publikum zugänglich. Zum ersten Mal verwendet Riemann den Begriff Tonalität in dem 1872 noch unter dem Pseudonym Hugibert Ries veröffentlichen Aufsatz Ueber Tonalität133 und wendet den Begriff damals noch ausschließlich auf Tonbeziehungen an. Drei wesentliche Aspekte für Riemanns Tonalitätsauffassung sind in diesem Aufsatz aber bereits deutlich erkennbar: (1) Tonalität entsteht erst durch eine Folge von mehreren Tönen. (2) Tonalität hängt wesentlich von unserer Wahrnehmung134 und unserem Gedächtnis ab.135 (3) Jede Aufeinanderfolge von Tönen bezieht sich auf einen Zentralton, ein Zentrum: Aristoxanes sagt: beim Anhören von Musik ist unsere Geistesthätigkeit eine doppelte, Wahrnehmung und Gedächtnis. Wahrnehmung nämlich des eben Ertönenden und Gedächtnis des Vorausgegangenen. In diesen Worten liegt das Geheimnis der Tonalität. Der Zweite Ton folgt nicht als ein anderer, dem ersten fremder, nicht am Hören des einzelnen Tones erfreuen wir uns 130 131 132 133 134 135 Riemann bezeichnete Rameau, Hauptmann, Helmholtz und Oettingen als die vier „großen Harmoniker“ der Musikgeschichte (vgl. Hugo Riemann, Musikalische Logik [als Dissertation: Ueber das musikalische Hören, Leipzig 1874], Leipzig: C. F. Kahnt 1875, S. 4-6). Vgl. ebda., S. 12f, 25. Vgl. Dahlhaus, Untersuchungen, S. 10. Vgl. Beiche, Tonalität, S. 9. Der Begriff Wahrnehmung darf in diesem Zusammenhang nicht mit der akustischen Realität verwechselt werden. Riemann selbst hat die Tonika, unabhängig von der akustischen Realität, auch als „etwas Vorgestelltes, Imaginäres“ gedacht. Es handelt sich bei der Tonika gewissermaßen um eine psychische „Realität“ (vgl. auch Hans-Ulrich Fuß, Funktion, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft [Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6], Laaber: Laaber 2010, S. 127-129, hier S. 128). Vgl. auch Riemann, Musikalische Logik, S. 64: „Tonalität ist […] Festhalten eines Tones im Gedächtniss als Hauptton (Tonus).“ 33 […], sondern der zweite wird uns verständlich in seinem Verhältnis zum ersten, wir hören […] den ersten Ton auch dann noch im Gedächtnis, wenn der zweite erklingt.136 [… Wir suchen] in dem Zusammenklange wie in der Aufeinanderfolge vieler Töne einen Anhalt […], einen Ausgangs- oder Endpunkt – ein Zentrum, um das sich alles in enger Beziehung gruppiert.137 1877 erweitert Riemann diese These auf Akkorde und Akkordverbindungen. Jeder Ton steht von da an als Vertreter für einen Akkord: Es verlangt aber eine Folge von Akkorden sowohl wie einer Folge einzelner Töne mit Akkordbedeutung (im Sinne der Klangvertretung138) eine innere Einheit, eine Bezogenheit auf ein Centrum […]. Die Bezogenheit eines Harmoniegefüges auf einen Zentralklang nennt man (seit Fétis) Tonalität.139 1882 definiert Riemann Tonalität schließlich – vergleichbar mit Helmholtz – nicht mehr über die Beziehung zwischen Tönen, sondern über die „Bezogenheit [der Akkorde] auf einen Hauptklang, die Tonika.“140 Auf diese Definition wird heute meist Bezug genommen, wenn im engeren Sinn von Tonalität gesprochen und damit eigentlich die europäische Dur-Moll-Tonalität gemeint wird (zumindest im deutschsprachigen Sprachgebrauch, der nachhaltig von Riemann geprägt wurde). Tonalität wird von Riemann nun als moderner Tonartbegriff aufgefasst, der nicht mehr an eine Tonleiter gebunden ist, sondern auch leiterfremde Töne umfasst.141 In diesem Zusammenhang ist jedoch nicht zu vernachlässigen, dass die Tonika zwar einen zentralen Bezugsklang darstellt, jedoch selbst erst über die beiden Funktionen der Subdominante und Dominante definiert ist. Ein Akkord kann erst im harmonischen Verlauf eine Funktion im Sinne Riemanns einnehmen und ist somit – diesmal im mathematischen Sinn – eine Funktion der vorangegangenen und nachfolgenden Klänge. Auch der Begriff „funk- 136 137 138 139 140 141 Hugo Riemann, Ueber Tonalität [Neue Zeitschrift für Musik 1872, Bd. 45-46], in: Präludien und Studien. Gesammelte Aufsätze zur Aesthetik, Theorie und Geschichte der Musik Bd. 3, Heilbronn: Schmidt (o. J.), S. 24. Ebda., S. 25. Ein Begriff, den Riemann von Helmholtz bzw. Oettingen übernahm. Vgl. auch: Julia Kursell, Konsonanz / Dissonanz, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 227-230, hier S. 228. Hugo Riemann, Musikalische Syntaxis. Grundriß einer harmonischen Satzbildungslehre, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1877, S. 13f. Riemann, Tonalität, S. 923f., zit. nach: Beiche, Tonalität, S. 9. Vgl. ebda. 34 tionale Tonalität“ hat sich in Riemanns Nachfolge häufig als Synonym für die DurMoll-Tonalität durchgesetzt. Die Tonika ist bei Riemann als Zentralklang keine abstrakte Stufe, sondern sie bezeichnet eine Funktion: Die I. Stufe ist je nach Zusammenhang auf unterschiedliche Weise zu deuten (z.B. als Zwischendominante zur Subdominante oder als Subdominante der Dominante). Der Zentralklang wechselt somit auf mikroformaler Ebene durch Modulationen seinen Platz. Der Tonalitätsbegriff bezieht sich bei Riemann auf die Tonika der „Haupttonart“, auf den sich, im Sinne eines übergeordneten Zentralklangs, die „Nebentonarten“ beziehen. Damit sieht Riemann Tonalität gewissermaßen als eine übergeordnete Tonart an: Während die Tonalität das Ganze Stück hindurch gleich bleibt, ändert sich durch Modulationen streckenweise die Tonart und ein anderer Zentralklang gewinnt dadurch als neue Tonika an Bedeutung.142 Dennoch sei „jede Nebentonart auch dann noch von der Haupttonart aus zu verstehen in ganz ähnlichem Sinne, wie im engsten Kreise der leitereigenen Harmonik die Dominanten der Tonika gegenüberstehen“.143 Beiche kommt zu dem Schluss, dass „in H. Riemanns Nachfolge […] Tonalität als erweiterter Tonartbegriff unter Betonung der Bezogenheit aller Klänge auf ein Zentrum tradiert“ wird.144 In seinen Ideen zu einer „Lehre von den Tonvorstellungen“ stellte Riemann ein Tonnetz dar, das mit Oettingens Tonnetz (vgl. Abbildung 10) vergleichbar ist. Dieses Tonnetz zeigt sowohl die Beziehungen von Tonhöhen und Akkorden als auch jene zwischen Tonalitäten bzw. Tonarten. Eine Gruppe von drei Tönen innerhalb eines nach oben gerichteten Dreiecks stellt beispielsweise einen Dur-Dreiklang dar, während man in der Horizontalen den Quintenzirkel ablesen kann.145 142 143 144 145 Vgl. ebda., S. 10; Hugo Riemann, Handbuch der Harmonielehre [1887], Leipzig, Breitkopf & Härtel 5 1912, S. 215. Riemann, Handbuch der Harmonielehre, S. 215. Beiche, Tonalität, S. 10. Vgl. auch Brian Hyer, Reimag(in)ing Riemann, in: Journal of Music Theory (Bd. 39,1), 1995, S. 101138, hier S. 101f. 35 Abbildung 11: Riemanns Tonnetz.146 Einen etwas anderen Zugang zur Dur-Moll-Tonalität stellt Heinrich Schenkers Schichtenlehre dar, deren Grundzüge er zum ersten Mal in seiner Harmonielehre147 1906 veröffentlichte. Schenker reduziert in seinen Analysen während mehrerer Arbeitsschritte den harmonischen und melodischen Gehalt eines Werkes auf den „Ursatz“, der laut Schenker als „Hintergrund“ die eigentliche Grundlage und Struktur der Werke bildet.148 Schenker wendet seine Theorien vornehmlich auf das so genannte „Geniewerk“ der Musik zwischen etwa 1700 bis 1850 an. Er baut dabei insbesondere auf die Lehre vom freien Satz nach Johann Joseph Fux und auf die Generalbasslehre nach Carl Philipp Emanuel Bach auf. 149 Der „Ursatz“, den Schenker aus der Naturklangtheorie ableitet150, wird in verschiedenen Varianten angegeben (Abbildung 12). Die Oberstimme bezeichnet er dabei als „Urlinie“, die Unterstimme bildet als „Brechung“ (auch „Bassbrechung“) immer eine Folge der Stufen I–V–I. Urlinie und Brechung sieht Schenker als eine „Bewegung zu einem Ziele hin“.151 Die strukturelle Melodieanalyse wird bei Schenker immer in „Zügen“ gedacht. Der „Ursatz“ kann dabei immer nur aus Terzzug (Abbildung 12 links), 146 147 148 149 150 151 Hugo Riemann, Ideen zu einer ‚Lehre von den Tonvorstellungen’, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 21–22 (1914/15), Leipzig 1916, S. 1–26. hier S. 20. Heinrich Schenker, Harmonielehre [1906] (Neue musikalische Theorien und Phantasien Bd. 1), Wien: Universal Edition (o.J.). Vgl. Andreas Moraitis, Zur Theorie der musikalischen Analyse, S. 208. Vgl. Heinrich Schenker, Der freie Satz (Neue musikalische Theorien und Phantasien Bd. 3), Wien: Universal Edition 1935, S. 1f. Vgl. ebda., S. 30-36. Ebda., S. 16f. 36 Quintzug (Abbildung 12 Mitte) oder Oktavzug (Abbildung 12 rechts) bestehen. Zwischen dem „Vordergrund“ – der den eigentlichen Notentext bezeichnet – und dem „Hintergrund“ ist laut Schenker auch noch ein „Mittelgrund“ vorhanden, der als strukturelle Schicht zwischen Hinter- und Vordergrund vermittelt. Den Begriff „Tonalität“ wendet Schenker nur auf den Vordergrund an und versteht darunter im Prinzip alles, was das musikalische Kunstwerk seiner Ansicht nach ausmacht: Nenne ich den Inhalt der […] Urlinie Diatonie […], so zeigt der Vordergrund die Tonalität als Summe aller Erscheinungen von den niedersten bis zu den umfassendsten, bis zu den scheinbaren Tonarten und Formen.152 Abbildung 12: Schenkers Ursatz-Varianten; Terzzug (links), Quintzug (Mitte), Oktavzug (rechts).153 Die Zentrierung der Melodik und Harmonik zugunsten eines Zentralklangs ist bei Schenker in besonderer Weise ausgeprägt. Über die Bewegung der Oberstimme schreibt Schenker: „Das Ziel, der Weg ist das Erste, in zweiter Reihe erst kommt der Inhalt.“154 Zusätzlich zu dem „Ziel“ der Linienführung beziehen sich alle musikalischen Ereignisse auf einen einzelnen Grundton: Innerhalb der Oktave ergab sich […] eine Gesamtbezogenheit des Satzes nur auf den einen Grundton, den Grundton des Klanges. Die so für die Oberstimme, die Urlinie erzielte Tonfolge stellt die Diatonie vor […]. Die gleiche Bezogenheit auf einen Grundton herrscht auch im Vordergrund: ist doch alle Vordergrund-Diminution, einschließlich der scheinbaren Tonarten aus den Stimmführungsverwandlungen, zuletzt eben aus der Diatonie im Hintergrund erflossen.155 Schenkers Begriff der „Tonart“ ist vergleichbar mit Riemanns hierarchischem Tonalitätsbegriff, in dem Tonalität als übergeordnete Tonart gedacht wird: 152 153 154 155 Ebda., S. 17. Heinrich Schenker, Der freie Satz. Anhang: Figurentafeln (Neue musikalische Theorien und Phantasien Bd. 3), Wien: Universal Edition 1956, S. 1f. Heinrich Schenker, Der freie Satz, S. 18. Ebda., S. 31f. 37 Wohl der verhängnisvollste Fehler der üblichen Theorie ist es aber, immer schon Tonarten anzunehmen, wenn sie in Ermangelung von Hinter- und Mittelgrund-Erkenntnissen keine andere Lösung findet. […] Nichts ist so kennzeichnend für die Theorie und die Analyse, wie eben der schreiende Ueberfluß an Tonarten, den sie mit sich führen. Der Begriff Tonart als einer höheren in die Vordergrund-Tonalität eingeordneten Einheit ist ihr noch völlig fremd, sie bringt es fertig, schon einen einzigen unauskomponierten Klang als eine Tonart zu bezeichnen.156 1.6 Die Auflösung der Tonalität und Arnold Schönberg Als Riemann 1893 in seiner Vereinfachten Harmonielehre157 zum ersten Mal die vollständigen Funktionsbezeichnungen veröffentlichte, war sein Vorhaben eine alles umfassende Theorie der dur-moll-tonalen Harmonik zu entwickeln bereits zum Scheitern verurteilt. Der „Prozess“, den man im allgemeinen musikalischen Sprachgebrauch häufig als „Auflösung der Tonalität“158 bezeichnet, war bereits nicht mehr umkehrbar und seine Auswirkungen manifestierten sich in den Werken der zeitgenössischen Komponisten. Bereits 1859 hatte Richard Wagner die Komposition an seinem Tristan beendet und in der Folge der Uraufführung im Jahr 1865 bei nachfolgenden Generationen von Musiktheoretikern und Komponisten einen Diskurs ausgelöst, der bis heute nachklingt. Kaum ein anderes musikalisches Element wurde so häufig zitiert und analysiert wie der berühmte Tristan-Akkord, der sich vehement jeglicher tonaler Analyse entzog und so zum Sinnbild für die „Auflösung der Tonalität“ hochstilisiert wurde. Walter Gieseler schreibt über dessen Bedeutung: „Der Tristan-Akkord ist noch nicht die neue harmonische Welt, aber er kündigt sie an.“159 In seinem Parsifal, der am 26.7.1882 uraufgeführt wurde, zog Richard Wagner schließlich die Konsequenzen aus der Harmonik des Tristan. Im Vorspiel des dritten Akts tritt anstelle der dur-moll-tonalen Tonika der verminderte Septakkord in das Zentrum des kompositorischen Interesses und übernimmt als Zentralklang auch weitgehend deren Funktion. Ähnliche Wege beschreitet zur selben Zeit auch Franz Liszt in seinen späten Klavierwerken. Die mit übermäßigen Dreiklängen und verminderten Septakkorden angereicherte Harmonik setzt die 156 157 158 159 Ebda., S. 26. Hugo Riemann, Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorde [1893], London: Augener 1899. Vgl. Amon, Lexikon der Harmonielehre, S. 278 u. Walter Gieseler, Harmonik in der Musik des 20. Jahrhunderts. Tendenzen - Modelle, Celle: Moeck 1996, S. 7. Gieseler, Harmonik, S. 7. 38 Dur-Moll-Tonalität über weite Strecken außer Kraft und weist auf neue und ungenutzte Möglichkeiten tonaler Beziehungen hin.160 Programmatisch wirkt in diesem Zusammenhang der Titel von Liszts Klavierstück Bagatelle ohne Tonart aus dem Jahre 1885. Auch wenn Richard Wagner selbst die späten Werke seines Schwiegervaters zum Teil als Senilitätserscheinung161 abgetan hat, sind sie doch Zeugnis der neuen Aufbruchstimmung, die sich damals ausgebreitet hatte. Arnold Schönberg war zu dieser Zeit gerade zehn Jahre alt und komponierte bereits seine ersten Jugendkompositionen, noch weitgehend unbeeinflusst von den harmonischen Neuerungen der Zeitgenossen. Dies änderte sich jedoch rasch, nachdem er 1894 Alexander von Zemlinsky kennen gelernt hatte, der ihn mit den Kompositionen Richard Wagners und Franz Liszts vertraut machte. Als ich ihn kennenlernte war ich ausschließlich Brahmsianer. Er liebte Brahms und Wagner gleichermaßen, wodurch ich bald darauf ebenfalls ein glühender Anhänger beider wurde. Kein Wunder, daß die Musik dieser Zeit deutlich die Einflüsse dieser beiden Meister zeigte, mit einem gelegentlichen Zusatz von Liszt, Bruckner und vielleicht auch Hugo Wolf.162 Über Schönbergs Auffassung von Tonalität wurde bereits viel spekuliert. So schreibt zum Beispiel Lukas Haselböck, dass „Schönberg [...] als einzige Voraussetzung für ‚Tonalität‘ das Vorhandensein sinnvoller Tonbeziehungen genannt hat.“163 Dieter Rexroth ist derselben Auffassung und führt aus, dass „Schönberg [...] unter ‚tonal‘ ganz allgemein eine Beziehung [versteht].“164 Auf der anderen Seite weist Martin Eybl darauf hin, dass Schönberg den Begriff „Tonalität“ durchaus in unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht hat: Demgegenüber bezeichnen einige Autoren des frühen 20. Jahrhunderts (Guido Adler, Arnold Schönberg) mit Tonalität die Beziehungen zwischen Tönen im Allgemeinen. Das Fehlen eines 160 161 162 163 164 Vgl. Dieter Kleinrath, Kompositionstechniken im Klavierwerk Franz Liszts. Eine Gegenüberstellung kompositorischer Verfahren im Früh- und Spätwerk unter besonderer Berücksichtigung des Klavierstücks Funérailles, Kunstuniversität Graz 2007, S. 10-19. Cosima Wagner, Die Tagebücher (Bd. 2), München: Piper 1976, S. 1059. (29. November 1882). Arnold Schönberg, Rückblick, 1949, S. 434. Lukas Haselböck, Zwölftonmusik und Tonalität. Zur Vieldeutigkeit dodekaphoner Harmonik, Laaber: Laaber 2005, S. 17. Dieter Rexroth: Arnold Schönberg als Theoretiker der tonalen Harmonik, Bonn 1971, S. 386. 39 harmonischen Zentrums nennt Schönberg „aufgehobene Tonalität“, verwendet den Begriff Tonalität somit doppeldeutig.165 Grund für die allgemeine Verwirrung um Schönbergs Tonalitätsauffassung ist folgende viel zitierte Fußnote seiner Harmonielehre: Nur so kann es gelten: Alles was aus einer Tonreihe hervorgeht, sei es durch das Mittel der direkten Beziehung auf einen einzigen Grundton oder durch komplizierte Bindungen zusammengefasst, bildet die Tonalität. [...] Ein Stück wird stets mindestens insoweit tonal sein müssen, als von Ton zu Ton eine Beziehung bestehen muß, vermöge welcher die Töne, nebenoder übereinander gesetzt, eine als solche auffaßbare Folge ergeben. [...] Zudem ist die Frage gar nicht untersucht, ob das, wie diese neuen Klänge sich schließen, nicht eben die Tonalität der Zwölftonreihe ist. Wahrscheinlich sogar ist es so [...]166 Zu diesem Zitat ist allerdings anzumerken, dass Schönberg diese Aussage machte um den Begriff „Atonalität“ zu widerlegen und sich und seine Musik davon abzugrenzen. Aus diesem Grund hat er hier den Tonalitätsbegriff wohl etwas weiter gefasst als gewöhnlich. Dennoch ist erkennbar, dass Schönberg durchaus offen war für eine erweiterte Auslegung des Tonalitätsbegriffs. So vergleicht er die „neuen Klänge“ seiner Musik anschließend mit dem Suchen nach dem Grundton zur Zeit der Kirchentonarten: „Hier [in der neuen Musik] fühlt man ihn [den Grundton] noch nicht einmal, aber darum ist er doch wahrscheinlich vorhanden.“167 Rückblickend präzisiert Schönberg 1949 seine Aussage nochmals: In meiner Harmonielehre (1911) habe ich behauptet, daß die Zukunft bestimmt zeigen wird, daß eine Zentralkraft, vergleichbar der Anziehungskraft einer Tonika, auch hier noch wirksam ist. Zieht man in Betracht, daß z. B. die Gesetze von Bachs oder Beethovens satzbildenden Bedingungen oder die von Wagners Harmonik noch immer nicht in wahrhaft wissenschaftlicher Weise erforscht sind, so darf man sich nicht wundern, daß hinsichtlich der sogenannten „Atonalität“ noch kein solcher Versuch gemacht wurde.168 Zitate dieser Art sind in Schönbergs Schriften jedoch eher die Ausnahme als die Regel. Meist verwendet er den Begriff Tonalität dagegen im „traditionellen“ Sinne bzw. gemäß 165 166 167 168 Martin Eybl, Tonalität, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 485-488, hier S. 485. Schönberg. Harmonielehre, S. 486. Ebda. Arnold Schönberg, Rückblick [1949], http://www.schoenberg.at, S. 437. 40 der üblichen Bedeutung seiner Zeit; auch eine Nähe zur Naturklangtheorie ist dabei in Schönbergs Denkweise erkennbar. So deutet er beispielsweise im HarmonielehreKapitel Die Durtonart und die leitereigenen Akkorde die C-Dur-Skala anhand der Obertonreihe169 und in seinem Aufsatz Problems of harmony findet sich folgender Abschnitt: Let us first examine the concept of tonality. This coincides to a certain extent with that of key, in so far as it refers not merely to the relation of tones with one another, but much more to the particular way in which all tones relate to a fundamental tone, especially the fundamental tone of the scale, whereby tonality is always comprehended in the sense of a particular scale. Thus, for example, we speak of a C-major tonality, etc.170 Für Schönberg lagen also offenbar die Begriffe Tonalität und Tonart sehr nahe bei einander. Er hebt auch die Bedeutung der Skala für seine Tonalitätsauffassung hervor, allerdings fällt auf, dass auch für ihn nicht nur die Beziehungen der Töne untereinander, sondern auch die Beziehung der Töne auf einen Fundamentalton (ein Begriff den ebenfalls Rameau prägte) von Bedeutung seien. Im weiteren Verlauf des oben zitierten Textes deutet Schönberg Beziehungen zwischen aufeinander folgenden Tönen mit Hilfe der Obertonreihe und bezeichnet Akkordfolgen, die in mehr als einer Tonart interpretiert werden können, als „Gefahr“ für die Tonalität.171 Ein weiterer Aspekt, den Schönberg im Zusammenhang mit Tonalität immer wieder hervorgehoben hat, ist die Bedeutung von Tonalität als eine vom Komponisten bewusst eingesetzte Möglichkeit unter vielen.172 In diesem Zusammenhang steht Schönberg dem Tonalitätsbegriff von Fétis nahe, der (sofern man Dahlhaus’ Interpretation folgt) zwar die Naturklangtheorie nicht a priori ausschloss, die Entscheidung sie einem System zugrunde zu legen, jedoch in die Verantwortung des Komponisten gelegt hat (vgl. S. 10). In der Harmonielehre schreibt Schönberg: 169 170 171 172 Vgl. Schönberg, Harmonielehre, S. 20-22. Arnold Schönberg, Problems of Harmony [1934], http://www.schoenberg.at (1.6.2010), S. 169 Vgl. ebda., S. 169-173 Vgl. Constantin Grun, Arnold Schönberg und Richard Wagner: Schriften (Spuren einer außergewöhnlichen Beziehung Bd. 2), Göttingen: V&R 2006, S. 724-726. 41 Die Tonalität ist eine sich aus dem Wesen des Tonmaterials ergebende formale Möglichkeit, durch eine gewisse Einheitlichkeit eine gewisse Geschlossenheit zu erzielen. […] Ich werde […] mich […] hier darauf beschränken, bloß […] anzuführen: […] daß ich sie [die Tonalität] nicht halte, wofür sie scheinbar alle Musiktheoretiker vor mir gehalten haben: für ein ewiges Gesetz, ein Naturgesetz der Musik, obwohl dieses Gesetz den einfachsten Bedingungen des naturgegebenen Vorbilds, des Tons und des Grundakkords, entspricht […].173 Schönbergs Tonalitätsbegriff ist vielseitig, jedoch nicht unbedingt widersprüchlich. Die traditionelle Vorstellung von Tonalität benutzt er meist in seiner Rolle als Kompositionslehrer und Pädagoge. In diesem Zusammenhang verwendet er den Begriff Tonalität im Sinne einer historischen Epoche, die sich dadurch auszeichnete, dass Komponisten aus freiem Willen den naturgegebenen Eigenschaften des Tones folgten und ihn, zum Erzielen formaler Geschlossenheit, als einen Zentralklang annahmen. Den erweiterten Tonartbegriff vertritt Schönberg dagegen in Diskussionen bezüglich der „neuen Musik“, die er selbst entscheidend mitgestaltet hat. In diesem Sinne ist sein Tonalitätsbegriff ein kaum greifbarer ideeller Gedanke, der im Prinzip auf jede tonhöhenbezogene Musik angewendet werden könnte. Zur „Auflösung der Tonalität“ trug Schönberg nicht nur in seiner Funktion als innovativer Komponist bei, auch sein Sprachgebrauch in Bezug auf den Tonalitätsbegriff förderte entschieden diese Vorstellung. Während Helmholtz noch meinte „die moderne Musik hat hauptsächlich das Princip der Tonalität streng und consequent entwickelt“ (vgl. S. 30), wird, spätestens seit Schönberg, der Tonalitätsbegriff in Bezug auf die musikalische Syntax der Spätromantik zunehmend in Frage gestellt. Im Zusammenhang mit seinen Frühwerken, wie z.B. dem 1899 komponierten Streichsextett Verklärte Nacht op. 4, sprach er von „Stellen einer unbestimmbaren Tonalität, die zweifellos als Hinweis auf die Zukunft gelten können“174. Als Beispiel gibt Schönberg die Takte 138-139 aus dem Streichsextett an (Abbildung 13), in denen kein eindeutiger Grundton- bzw. Tonartbezug mehr erkennbar ist. Wie später noch zu sehen sein wird (vgl. S. 117), ist die Harmonik dieses Abschnitts eng verwandt mit der Harmonik der Einleitung zum dritten Akt von Richard Wagners Parsifal. 173 174 Schönberg, Harmonielehre, S. 27. Schönberg, Rückblick, S. 437. 42 Abbildung 13: Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, T. 137-140. Ein Kapitel seines Buchs Die formbildenden Tendenzen der Harmonie widmete Schönberg der „erweiterten Tonalität“175 und in seiner Harmonielehre verwendet er Begriffe wie „schwebende Tonalität“ und „aufgehobene Tonalität“176. Unter schwebender Tonalität verstand Schönberg Musik, deren Harmonik sich nicht auf einen einzelnen Zentralklang beschränkt, sondern stets zwischen zwei oder mehreren oft gleichberechtigten Zentren hin und her schwankt, gleichsam zwischen diesen Klangwelten schwebt. Schwebende Tonalität erkennt Schönberg bereits im letztem Satz von Ludwig v. Beethovens e-Moll-Quartett op. 59/2 sowie im Finale von Robert Schumanns Klavierquintett.177 175 176 177 Arnold Schönberg, Die formbildenden Tendenzen der Harmonie [Structural Functions of Harmony, 1948], Mainz: B. Schott’s Söhne 1954, S. 74-110. Schönberg. Harmonielehre, S. 509. Ebda., S. 460. 43 1.7 Der Tonalitätsbegriff im 20. Jahrhundert Zum Ende des 19. Jahrhundert hatte sich die Bedeutung des Tonalitätsbegriffs im deutschsprachigen Raum zunehmend gefestigt und wurde von Helmholtz und Riemann auf die musikalische Syntax der europäischen Kunstmusik reduziert. Das wesentliche Merkmal der Definition ist von nun an der Zentralklang – die Tonika – auf den sich alle anderen Töne und Akkorde beziehen. Die besondere Bedeutung des Zentralklanges führte dazu, dass einige Autoren Metaphern für den Begriff der Tonika einführten, wie zum Beispiel „Konzentrationston“, „Gravitationszentrum“, „Kraftzentrum“ oder „Brennpunkt“ („focal point“). Zugleich wird Tonalität nun immer häufiger mit hörpsychologischen Aspekten in Verbindung gebracht wie beispielsweise von Jacques Chailley, der Tonalität als eine „musikalische Wahrnehmungsart“ bezeichnet.178 Seit den 1920er Jahren gewinnt „Tonalität“ auch als erweiterter Tonartbegriff, wie er von Riemann beschrieben wurde, zunehmend an Bedeutung. So schreibt Hermann Grabner in der Allgemeinen Musiklehre 1924: „Die Beziehungen der einzelnen Tonarten eines Stückes zur Haupttonart heißt Tonalität.“179 Während die Musiktheorie um 1900 gerade noch dabei war den Begriff Tonalität aufzuarbeiten und „die tonale Musik“ zu systematisieren, begannen Komponisten wie Franz Liszt, Arnold Schönberg oder Alexander Skrjabin die Tonalität in Frage zu stellen und sich neuen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zuzuwenden und lösten mit dem darauf folgenden Stilpluralismus des 20. Jahrhunderts in gewisser Weise auch einen analogen Systempluralismus in der Musiktheorie aus. Musiktheoretiker waren im 20. Jahrhundert zunehmend gezwungen ihre Theorien den neuen Gegebenheiten der zeitgenössischen Kompositionspraxis anzupassen und es scheint, als hätte man sich zumeist damit abgefunden gehabt, dass Tonalität, mit ihren reichhaltigen Facetten, eine historische Erscheinung war, die im 20. Jahrhundert nur mehr in Popularmusik oder verwandten Genres eine Gültigkeit besäße. Bestenfalls wird bei Diskussionen um die Musik des 20. Jahrhunderts vorsichtig der Begriff „post-tonal“ angewendet, um damit auszudrücken, dass tonale Elemente auch in späteren Werken der Kunstmusik noch teilweise aufgegriffen wurden oder weiterwirken. Diese Entwicklung wurde insbeson178 179 Vgl. Beiche, Tonalität, S. 10-11. Hermann Grabner, zit. nach Beiche, Tonalität, S. 11. 44 dere auch durch die zunehmende Abneigung zeitgenössischer Komponisten gegenüber dem Begriff Tonalität nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gefördert. Die Polarisierung während der Nachkriegszeit in Komponisten, die tonale Elemente in ihren Kompositionen nutzten, und solche, die sich ihnen verweigerten, war nicht zuletzt auch von der Rhetorik Schönbergs im Zusammenhang mit Tonalität und neuer Musik geprägt. Ein weiterer Grund für die zunehmende Abneigung gegen Tonalität und der damit oft verbundenen Naturklangtheorie könnte damit zusammenhängen, dass eine von der Naturklangtheorie abgeleitete europäische Dur-Moll-Tonalität leicht die Züge von nationalistischem und rassenspezifischem Gedankengut annehmen konnte. So fand man zum Beispiel in der Bibliothek Adolf Hitlers ein Exemplar des Buches Der Naturklang als Wurzel aller Harmonien: eine aesthetische Musiktheorie in zwei Teilen von Josef Achtélik.180 In diesem Werk versucht Achtélik, unter anderem aufbauend auf den Thesen Riemanns181, die Naturklangtheorie als einzig wahre Grundlage jedweder Musik darzustellen: Für uns, die wir alle Klangmöglichkeiten eines Naturklanges als Tonalität empfinden und damit nur der Weisung der Natur folgen, für uns ist auch die jetzige Epoche nur ein Entwicklungsübergang [...]182 Die Musik der Zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg lehnt Achtélik dagegen kategorisch ab: Schönberg und der kleine Kreis um ihn, zum großen Teil asiatischer Abstammung, erhoben die Dissonanz zum einzigen musikalischen Zusammenklang. [...] So kommt es denn, dass man diese Musik weder verstehen noch empfinden kann, daß man sie weder schön noch erhebend, weder wohltuhend noch begeisternd finden kann. Die Musik ist zum nichtssagenden, weil alles auf einmal sagenwollenden Tongeräusch erniedrigt worden. [...] Daß Gehörreizungen durch diese Klangballungen hervorgerufen werden, wird niemand bestreiten; aber Musik ist das nicht mehr. [...] impotente Versuche degenerierter Nerven nennen es die meisten.183 180 181 182 183 Vgl. Library of Congress: Third Reich Collection. Vgl. Josef Achtélik, Der Naturklang als Wurzel aller Harmonien: eine aesthetische Musiktheorie (Band 2), Frankfurt: C.F. Kahnt 1922, S. 101ff. Ebda., S. 145. Ebda. 45 In den 1960er Jahren griff Carl Dahlhaus in seiner Habilitationsschrift Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität den Tonalitätsbegriff erneut auf. Dahlhaus versuchte darin weniger die bestehenden systematischen Aspekte im Zusammenhang mit dem Begriff zu erweitern, als vielmehr „die Entstehung der harmonischen Tonalität in der Mehrstimmigkeit des 16. und 17. Jahrhunderts“ zu untersuchen.184 Ausgangspunkt dieser Untersuchungen war dabei Fétis’ historischer Tonalitätsbegriff und dessen Einteilung der Musikgeschichte in unterschiedliche Epochen, basierend auf der jeweiligen harmonischen Syntax. Dahlhaus stellt fest, dass „Tonalität außer einer systematischen auch eine historische Kategorie ist. Die Tonalität des 16. und die des 19. Jahrhunderts sind Stufen einer zusammengehörigen Entwicklung.“185 Den Begriff „harmonische Tonalität“ verwendet Dahlhaus dabei „synonym mit Riemanns ‚Tonalität‘ und Fétis’ ‚tonalité moderne‘“186. Der harmonischen Tonalität stellt Dahlhaus den Begriff der „melodischen Tonalität“ gegenüber, „die der harmonischen – durch Akkorde fundierten – des 17. Jahrhunderts vorausging“. Die rasante Entwicklung von Computertechnologien und der damit verbundene Aufschwung der Naturwissenschaften seit den 1950er Jahren wirkte sich auch nachhaltig auf die Musiktheorie aus. Schlüsselwörter wie „Berechenbarkeit“ („computability“) und „Interdisziplinarität“ sind seither in allen Wissenschaftsbereichen an der Tagesordnung und werden oft sogar als ein „Qualitätsmerkmal“ neuer Theorien angesehen. Vor allem in den USA werden Forschungsgelder oft nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit einer Software-Implementierung und der damit verbundenen wirtschaftlichen Aussichten vergeben. Auch die Mathematik hatte in der Folge großen Einfluss auf musiktheoretische Untersuchungen. Die von Milton Babbit 1946 und 1961 entwickelte pitch class set theory187 wurde von Allen Forte seit den 1960er Jahren als Analysewerkzeug für harmonische Zusammenhänge weiterentwickelt. Forte nutzt Erkenntnisse der mathematischen Mengenlehre und wendet diese auf Tonmengen (pitch sets) an. Eine Gruppe von Tönen, wie ein Akkord oder auch eine melodische Linie, wird von Forte in einer mathema184 185 186 187 Dahlhaus, Untersuchungen, S. 18. Ebda. Ebda. Vgl. Stephan Lewandowski, Pitch Class Set, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 380-382, hier S. 381. 46 tischen Menge zusammengefasst und in ihre „Grundform“ (prime form) gebracht, die anschließend gemäß ihrer Intervallstruktur zur Bezeichnung der Tonmenge dient. Ein Dreiklang (sowohl Dur als auch Moll) lautet in der prime form beispielsweise „037“ (von Forte auch als „3-11“ bezeichnet). Die Zahlen beziehen sich dabei auf die – von der Ziffer Null aus gerechneten – Intervalle der kleinen Terz (3) und der reinen Quint (7). Damit erzeugte Forte einerseits einen Quasi-Standard für die Abbildung von Tonmengen in Computern mittels der Zahlen null bis elf, andererseits verzichtet die set theory auch auf enharmonische Verwechslungen und stellt damit eine allgemeine Terminologie für die abstrakte Kommunikation von Klängen zur Verfügung.188 Die pitch class Analyse ermöglichte insbesondere neue Einblicke in die Klangorganisation post-tonaler Musik, Forte wendet sie jedoch gelegentlich auch auf Analysen spättonaler Musik, wie z.B. Werke von Franz Liszt, an.189 Auch statistische Methoden wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer häufiger für die musikalische Analyse herangezogen. Der Komponist Raymond Wilding-White geht 1961 sogar so weit in einem Artikel „Tonikalität“190 als ein (mathematisches) Verfahren anzusehen: „it is a measure of bias and represents the relative importance given to each of the subsets contained in a given set.“191 Die Tonika einer Tonalität wäre damit der „relativ bedeutendste“ Akkord oder Ton innerhalb einer Menge von Akkorden oder Tönen. Seit den letzten 15 Jahren gewann mit der Neo-Riemann-Theorie auch eine Neuinterpretationen der Funktionstheorie Riemanns zunehmend an Bedeutung. Die NeoRiemann-Theorie verbindet zeitgenössische Strömungen wie set theory und Berechenbarkeitstheorie mit musiktheoretischen Erkenntnissen des 19. Jahrhunderts und steht dabei auch der Kognitionswissenschaft sowie der Sprachwissenschaft – namentlich Noam Chomskys Transformationstheorie192 – nahe. 188 189 190 191 192 Vgl. Allen Forte, A Theory of Set-Complexes for Music, in: Journal of Music Theory (Bd. 8,2), 1964, S. 136-139, 141, 140, 142-183. Vgl. Allen Forte, Liszt’s Experimental Idiom and Music of the Early Twentieth Century, in: 19thCentury Music (Bd. 10,3), 1987, S. 209-228. Der Begriff „Tonikalität“ geht auf Rudolph Reti zurück und hebt die Bedeutung des Grund- oder Zentraltons der Dur-Moll-Tonalität hervor (vgl. Dahlhaus, Tonalität, S. 623). Raymond Wilding-White, Tonality and Scale Theory, in: Journal of Music Theory (Bd. 5,2), 1961, S. 275-286, hier S. 280. Vgl. Noam Chomsky, Syntactic Structures [1957], Berlin, New York: Mouton de Gruyter 2002. 47 Riemanns Anspruch einer allumfassenden Theorie dur-moll-tonaler Harmonik wurde im 20. Jahrhundert immer wieder stark kritisiert. Harmonische Neuerungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die nach Schönberg eine „schwebende“ oder „aufgelöste“ Tonalität darstellen, lassen sich mit der Riemannschen Funktionstheorie kaum oder nur unzulänglich beschreiben. Die zunehmende Chromatisierung romantischer Musik sowie die Verwendung „vagierender“193 Akkorde führte dazu, dass harmonische Folgen nicht mehr nur aus Sicht einer einzelnen Tonika gedacht werden können, sondern vielmehr in kurzen Abschnitten den Zentralklang wechseln. Außerdem wurden die traditionellen Harmoniefortschreitung im Quintenzirkel immer mehr mit mediantischen Harmoniefolgen im Terzenzirkel angereichert. Die Vorstellung eines einzelnen – die gesamte Harmonik bestimmenden – Zentralklangs scheint in Bezug auf einen großen Teil spätromantischer Musik demnach nicht mehr haltbar zu sein. Die NeoRiemann-Theorie ist ein Versuch dieser Problematik Rechnung zu tragen, indem sie Akkorde nicht mehr auf einen Zentralklang bezieht, sondern statt dessen die direkten Beziehungen zwischen aufeinander folgenden Klängen untersucht: I propose to position triadic harmonies in relation to neither a diatonic system nor a tonal center, but rather to other triadic harmonies on the basis of the number of pitch-classes that they share, and more generally on the efficiency of the voice leading between them.194 Die Ursprünge der Neo-Riemann-Theorie gehen auf David Lewin zurück. In seinem 1982 erschienenen Artikel A Formal Theory of Generalized Functions195 definiert Lewin mathematische „Transformationen“ („transformations“) die sich auf „Riemann- 193 194 195 Ein Terminus den ebenfalls Schönberg prägte. Unter „vagierenden“ Akkorden versteht Schönberg Akkorde, die in unterschiedlichen Tonarten unterschiedliche Funktionen ausüben (wie z.B. der übermäßige Dreiklang, der verminderte Septakkord oder der halbverminderte Septakkord) und somit nicht auf eine einzelne Tonart bezogen werden können (Vgl. Schönberg, Harmonielehre, S. 310ff). Allerdings ist diese Verallgemeinerung durchaus problematisch da zweifelsfrei jeder Mehrklang – auch der Dur-Dreiklang – in unterschiedlichen Tonarten gedeutet und somit als „vagierender“ Akkord gedacht werden kann. Insofern macht einen „vagierenden Akkord“ weniger der Akkordtyp aus, sondern viel mehr die Art und Weise, in der er verwendet wird. Werner Breig schreibt diesbezüglich: „Die zur Kategorie der vagierenden Akkorde gehörenden Klänge können zwar so behandelt werden, daß ihr Tonartbezug eindeutig bleibt; zu ihrer eigentlichen Wirksamkeit als ‚vagierende‘ Akkorde gelangen sie jedoch dann, wenn ihr gehäuftes Auftreten zur schwebenden und aufgehobenen Tonalität führt.“ (Werner Breig, Vagierender Akkord, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stuttgart: Steiner 1999, S. 1). Ebda., S. 214. David Lewin, A Formal Theory of Generalized Tonal Functions. Journal of Music Theory (Bd. 26,1), 1982, S. 32-60. 48 Systeme“ anwenden lassen.196 Eine Transformation ist dabei gewissermaßen eine Funktion, die als Input einen Klang akzeptiert und diesen Klang nach bestimmten Regeln verändert, um so zu einem neuen Klang zu gelangen. In Generalized Musical Intervals and Transformations197 (1987) verfeinert Lewin seine Theorie und untersucht Transformationen im Zusammenhang mit konsonanten Dreiklängen. Lewin unterscheidet zwischen zwei Klassen von Transformationen: der Umkehrung („inversion“) und der Verschiebung („shift“). Eine Verschiebung bewirkt, dass ein Dreiklang auf einer alterierenden Terzenskala (Abbildung 14), vergleichbar mit der Skala in Abbildung 9 von Hauptmann, eine bestimmte Anzahl von Stellen nach links („left shift“) oder rechts („right shift“) verschoben wird.198 b – Db – f – Ab – c – Eb – g – B – d – F – a – C – e – G – h – D – f# – A – c# – E – g# – H – d Abbildung 14: Alternierende Terzenskala. Eine einfache Verschiebung nach links bezeichnet Lewin als MED, da der Zielakkord zum Ausgangsakkord in einer mediantischen Beziehung steht (z.B. C-Dur → a-Moll), eine doppelte Verschiebung nach links bezeichnet er entsprechend als DOM, da es sich um eine dominantische Beziehung handelt (z.B. C-Dur → F-Dur).199 Als UmkehrungsTransformationen definiert Lewin REL, the operation that takes any Klang into its relative major/minor. […] We can also define PAR, the operation that takes any Klang into its parallel major/minor. […] We can define Riemann’s „leading tone exchange“ as an operation LT.200 Akkordfolgen, welche diesen Transformationen entsprechen stellt Lewin in Form von zweidimensionalen gerichteten Graphen dar.201 Abbildung 15 zeigt zwei Transformations-Graphen der ersten Takte des langsamen Satzes von Ludwig v. 196 197 198 199 200 201 Lewin definierte seine Theorie mit Berücksichtigung möglicher Berechenbarkeit mathematisch. Die Transformationen sind demnach nicht auf Dur- und Moll-Dreiklänge beschränkt, sondern können abhängig vom zugrunde liegenden „Riemann System“ auch auf andere Dreiklänge angewendet werden (vgl. Lewin, A Formal Theory, S. 26). David Lewin, Generalized Musical Intervals and Transformations [1987], Oxford/New York: Oxford University 2007. Vgl. Richard Cohn, Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective, in: Journal of Music Theory (Bd. 42,2), 1998, S. 167-180, hier S. 170. Vgl. ebda., S. 170f. Lewin, Generalized Musical Intervals and Transformations, S. 178. Vgl. Cohn, Introduction to Neo-Riemannian Theory, S. 171. 49 Beethovens Sonate op. 57 „Appassionata“. Die Pfeile zeigen dabei nicht den harmonischen Verlauf an, sondern die Richtung der Transformation. 1993 wendet Lewin seine Theorie in Analysen auf Luigi Dallapiccolas Simbolo, Karlheinz Stockhausens Klavierstück Nr. 3 (1952), Anton Weberns op. 10/4 aus Fünf Stücke für Orchester (1911) sowie Claude Debussys Feux d'artifice (1910-1912) an.202 Abbildung 15: Zwei Transformations-Graphen der ersten Takte des langsamen Satzes von Beethovens Sonate op. 57 „Appassionata“.203 Lewins Theorie wurde von Brian Hyer aufgegriffen und weiterentwickelt. Hyer verzichtet auf die redundante MED-Transformation, da diese im Prinzip der PARTransformation entspricht und reinterpretiert die DOM-Transformation als Transposition. Die Verschiebungs-Transformationen werden von da an in der Neo-RiemannTheorie meist fallen gelassen. Eine besondere Leistung Hyers war es die Beziehungen zwischen den einzelnen Transformationen in einem Graphen darzustellen (Abbildung 16). Er bezieht sich dabei direkt auf die Tabellen von Tonartverwandtschaften bzw. Tonnetze, wie sie von Musiktheoretikern des 19. Jahrhunderts (z.B. Weber und Oettingen, vgl. Abbildung 7 u. Abbildung 10) entworfen wurden. Die drei Koordinaten des Graphen repräsentieren dabei die drei Intervalle des diatonischen Dreiklangs (reine Quint auf der Horizontalen, große und kleine Terz auf den beiden Diagonalen); jedes Dreieck des Graphen entspricht einem Dreiklang. 202 Vgl. David Lewin, Musical Form and Transformation. Four Analytic Essays [1993], Oxford: Oxford University 2007. 203 Vgl. Lewin, Generalized Musical Intervals and Transformations, S. 178. 50 Abbildung 16: Beziehungen der unterschiedlichen Transformationen nach Hyer.204 Richard Cohn untersuchte 1996 die verschiedenen Umkehrungs-Transformationen und interessierte sich dabei insbesondere für die Stimmfortschreitungen, die bei derartigen Transformationen entstehen. Bei jeder Umkehrungs-Transformation bleiben zwei Akkordtöne liegen, währen ein Akkordton in einem kleinen oder großen Sekundschritt verändert wird. Diese Akkordzusammenhänge stellte Cohn als „maximally smooth cycles“ auf einem Kreis-Diagramm dar, auf dem sich jeder Akkord durch die chromatische Veränderung von einem Ton in den nächsten verwandelt, bis zum Schluss der Ausgangsakkord wieder erreicht wurde (Abbildung 17). Diese Akkordfortschreitung basiert auf einem Großterzzirkel, einer Fortschreitung, die in spätromantischer Musik oft eine bedeutende Rolle einnahm.205 Eine eindeutige Zentrierung auf eine Tonika im funktionstheoretischen Sinne ist innerhalb des abstrakten Zirkels unmöglich, da jeder Akkord im Verhältnis zu den anderen prinzipiell die gleiche Bedeutung hat. 204 205 Cohn, Introduction to Neo-Riemannian Theory, S. 172. Vgl. Richard Cohn, Maximally Smooth Cycles, Hexatonic Systems, and the Analysis of Late-Romantic Triadic Progressions, in: Music Analysis (Bd. 15,1), 1996, S. 9-40, hier S. 9-17; Cohn, Introduction to Neo-Riemannian Theory, S. 174f. 51 Abbildung 17: Cohns „maximally smooth cycles“.206 Die Ergebnisse seiner Untersuchungen wandte Cohn unter anderem auf Franz Schuberts Klaviertrio in Es-Dur op. 100 (D. 929) an. Die Take 586-598 der Coda dieses Werkes enthalten den in Abbildung 18 dargestellten harmonischen Verlauf, der genau den „maximally smooth cycles“ entspricht.207 Abbildung 18: Schubert, Klaviertrio in Es-Dur op. 100; harmonischer Verlauf der Takte 586-598. 206 207 Ebda., S. 17. Vgl. zu Cohns Schubert-Analyse: Cohn, As Wonderful as Star Clusters: Instruments for Gazing at Tonality in Schubert, in: 19th-Century Music (Bd. 22,3), 1999, S. 213-232, hier S. 215. 52 In weiterer Folge wurde die Neo-Riemann-Theorie von vielen Autoren aufgegriffen und erweitert, um damit weitere Akkordverbindungen zu untersuchen. David Kopp beschäftigte sich in seinem Buch Chromatic transformations in nineteenth-century music beispielsweise mit mediantischen Beziehungen zwischen Dreiklängen.208 Jack Douthett und Peter Steinbach erweiterten in Korrespondenz mit Richard Cohn die „maximally smooth cycles“ auf übermäßige Dreiklänge und Septakkorde.209 Abbildung 19 zeigt eine dreidimensionale Darstellung der vier Zyklen, von denen jeweils zwei über einen gemeinsamen übermäßigen Dreiklang chromatisch verbunden sind. Abbildung 20 zeigt eine vergleichbare Darstellung für Dominantseptakkorde und halbverminderte Septakkorde, die über den verminderten Septakkord chromatisch verbunden sind. Abbildung 19: „Dancing Cubes“; Darstellung der chromatischen Beziehungen zwischen übermäßigen Dreiklängen und Dur- bzw. Molldreiklängen.210 208 209 210 David Kopp, Chromatic transformations in nineteenth-century music (Cambridge studies in music theory and analysis 17), Cambridge: Cambridge University Press 2002. Jack Douthett / Peter Steinbach, Parsimonious Graphs: A Study in Parsimony, Contextual Transformations, and Modes of Limited Transposition, in: Journal of Music Theory (Bd. 42,2), 1998, S. 241263. Ebda., S. 254. 53 Abbildung 20: „Power Towers“; Darstellung der chromatischen Beziehungen zwischen verminderten Septakkorden mit dem Dominantseptakkord und dem halbverminderten Septakkord. Die Vorteile der Neo-Riemann-Theorien im Vergleich zu Riemanns Funktionstheorie lassen sich an einem einfachen Beispiel aufzeigen. Abbildung 21 zeigt eine schlichte Akkordfolge in C-Dur inklusive einer möglichen funktionstheoretischen Interpretation (zu diesem Beispiel ist anzumerken, dass es keinerlei Anspruch auf künstlerischen Wert erhebt, sondern lediglich der Anschaulichkeit dient). Abbildung 22 zeigt dieselbe Akkordfolge, diesmal im Sinne der Neo-Riemann-Theorie mittels Transformationen gedeutet. Anhand des dort dargestellten gerichteten Graphen kann man, im Gegensatz zur Riemannschen Funktionsanalyse, leicht erkennen, dass die Akkordfolge einem gleich bleibendem Schema folgt. Die Transformationen PAR und LT wechseln sich kontinuierlich ab, bis hin zum B-Dur-Dreiklang in Takt 5. Die Verbindung zwischen BDur und G-Dur kann man wiederum als eine LT-Transformation gefolgt von einer REL-Transformation ansehen, bevor schließlich mit einer DOM-Transformation zum C-Dur-Dreiklang zurückgekehrt wird. Abbildung 21: Akkordfolge in C-Dur funktionstheoretisch gedeutet. 54 A- LT F+ PAR PAR C+ D- DOM LT G PAR+REL REL [G-] B+ PAR Abbildung 22: Akkordfolge in C-Dur im Sinne der Neo-Riemann-Theorie gedeutet. 1.8 Der Begriff des „Klangzentrums“ bei Erpf und Lissa Hermann Erpf prägte 1927 in seinem Buch Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neueren Musik den Terminus „Klangzentrum“, der zahlreiche Analyseansätze posttonaler Musik beeinflusste. Er definierte die Technik des Klangzentrums wie folgt: Die Technik des Klangzentrums hat als wesentliches Merkmal einen nach Intervallzusammenhang, Lage im Tonraum und Farbe bestimmten Klang, der im Zusammenhang nach kurzen Zwischenstrecken immer wieder auftritt. Dadurch gewinnt dieser Klang, der meist ein dissonanter Vielklang von besonderem Klangreiz ist, in einem gewissen primitiven Sinn den Charakter eines klanglichen Zentrums, von dem die Entwicklung ausgeht, und in das sie wieder zurückstrebt. Die Zwischenpartien heben sich kontrastierend ab, dem dominantischen Heraustreten aus der Tonika vergleichbar, so daß ein gewisser Wechsel Tonika-Nichttonika-Tonika zustande kommt, in dem dieses Gebilde noch in einer letzten Beziehung auf die Funktionsharmonik zurückweist.211 Erpf beschreibt die Technik des Klangzentrums als einen „funktionslosen Satztypen“, wobei er sich mit dem Begriff „Funktion“ hier auf Riemanns Funktionstheorie im Sinne der Dur-Moll-Tonalität bezieht. Als weitere funktionslose Satztypen gibt er die 211 Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik, S. 122. 55 „Technik der ostinaten Unterlage“212 und die „Zwölf-Töne-Musik“ an.213 Es scheint offensichtlich, dass Erpf diese Techniken nur deshalb unter einem Satztypus zusammengefasst hat, da sie seiner Meinung nach eines gemeinsam haben: die resultierende Harmonik ist aus Sicht der Dur-Moll-Tonalität nicht oder nur schwer erklärbar; selbst wenn man einen einzelnen Klang aus Sicht der Dur-Moll-Tonalität deuten könnte, würde er im musikalischen Zusammenhang keine Funktion im Sinne Riemanns einnehmen. Aus dieser Sicht ist es überraschend, dass Erpf die Technik des Klangzentrums trotzdem mit den Begriffen der Riemannschen Funktionstheorie als einen „gewissen Wechsel Tonika-Nichttonika-Tonika“ beschreibt und damit impliziert, dass das Klangzentrum dieser Technik dieselbe musikalische Funktion besäße wie der Zentralklang der Dur-Moll-Tonalität, die Tonika. Auch die Ähnlichkeit des Begriffs mit den oben erwähnten Synonymen für die Tonika – „Konzentrationston“, „Gravitationszentrum“, „Kraftzentrum“ und „Brennpunkt“ – ist sehr auffällig. Erpfs Definition der Klangzentren-Technik erweckt den Anschein, als hätte sich die Dur-Moll-Tonalität in manchen Werken der Atonalität nicht zur Gänze „aufgelöst“ gehabt; statt dessen könnte das definierende Moment – der Zentralklang – im Zuge der harmonischen Neuerungen lediglich neue Formen angenommen haben. Durch den Vergleich mit einer Tonika macht Erpf gleichzeitig auch eine Aussage über die hörpsychologischen Eigenschaften des Klangzentrums. Das Klangzentrum müsste in diesem Sinne ein Klang sein, der im musikalischen Zusammenhang keiner Auflösung mehr bedarf, obwohl es sich dabei laut Erpf meist um einen dissonanten Vielklang handelt. Auch alle akkordfremden Töne beziehen sich entsprechend auf dieses Klangzentrum und sind aus dessen Sicht zu deuten. Erpf spricht in diesem Zusammenhang von „Nebennoten“ und „Vorhalten“.214 Auch die restliche Harmonik bezieht sich laut Erpf direkt auf das Klangzentrum, wie an dem Vergleich von kontrastierenden Zwischenpartien mit „dem dominantischen Heraustreten aus der Tonika“ deutlich wird. 212 213 214 Unter der „Technik der ostinaten Unterlage“ versteht Erpf mehrstimmige ostinierende Figuren im Bass, die eigenständige harmonische Folgen ausbilden. Die Melodiestimmen bewegen sich zum Teil unabhängig von der Harmonik der ostinaten Unterlage und sind insofern – im Sinne der Dur-MollTonalität – nicht funktional zu deuten (vgl. ebda., S. 122f, 194-198). Vgl. ebda. Vgl. z.B. Erpfs Analyse von Schönbergs Klavierstück op. 19/6 (ebda., S. 198). 56 Als Beispiel für die Technik des Klangzentrums, diskutiert Erpf Schönbergs Klavierstück op. 19/6 (1911).215 In diesem Werk kann der in Abbildung 23 dargestellte Akkord als Zentralklang interpretiert werden. Seine sehr stabile Klangwirkung erhält der Akkord unter anderem durch seine weite Lage und die Quartenschichtung der Außenstimmen (g–c1–f1 sowie fis2–h2). Dur-moll-tonale Bezüge werden durch den gedrängten Tonvorrat (G–A–H–C–F–Fis) sowie durch die interne Intervallstruktur (2 große Nonen: g–a1, a1–h2; eine kleine None: f1–fis2; zwei Tritoni: c1–fis2, f1–h2) weitgehend ausgeschlossen. Abbildung 23: Zentralklang aus Schönberg, Klavierstück op. 19/6. In dem nur neun Takte dauernden Werk klingt dieser Klang in den ersten drei Takten sowie im letzten Takt (Abbildung 24). Der Klang in Takt 5-6 könnte als eine Variation des Klanges in einer Transposition des Tonvorrats nach C gedeutet werden (C–D–E–F– B–[H]). Zugleich stellt Takt fünf, durch das typische Aussetzen eines Dominantseptakkords auf E im zweiten System, auch recht eindeutige dur-moll-tonale Beziehungen her. Dies könnte der Grund für die beiden eigentlich akkordfremden Töne Gis und Fis sein, die den Klang hier von einem vorwiegend aus Quarten zusammengesetzten Klang in einen vorwiegend ganztönigen Klang verwandeln (C–D–E–[F]–Fis–Gis–B). Als Verbindung dieser beiden Klänge erweitert Schönberg auf der zweiten Viertel von Takt Fünf die untere Quartenstruktur des Klangzentrums kurzzeitig zu einem viertönigen Quartenklang (g–c1–f1–b1). Die Takte sieben und acht lassen sich nur schwer aus Sicht des Klangzentrums deuten und bilden einen Kontrast. Auffällig ist, dass die Melodie in Takt sieben die letzten beiden Töne Cis und Es der chromatischen Skala einführt und damit den Tonvorrat vom achten Takt vorbereitet. Der erste Klang in Takt acht hat als strukturbildendes Element wiederum den dreistimmigen Quartenklang im unteren System. Dieses Klangelement wandert damit von den Unterstimmen (T. 1-5) in die Oberstimmen (T. 5-6) und wieder zurück (T. 8 sowie T. 9). So ist der Zentralklang nicht nur ein harmonischer Ruhepunkt, von dem die Bewegung ausgeht und in die sie wieder 215 Vgl. Ebda. 57 zurückkehrt, sondern dient auch als strukturbildendes Vorbild für die restlichen Klänge des Werkes. Abbildung 24: Schönberg, Klavierstück op. 19/6. Anton Weberns erstes Lied der 5 Lieder nach Gedichten von Stefan George op. 4 (Abbildung 25) ist ein weiteres Beispiel für die Technik des Klangzentrums. Die Akkordstruktur des Klangzentrums im ersten Takt dient auch hier den übrigen Harmonien als Vorbild. Besonders auffallend sind in diesem Zusammenhang die Quartenstrukturen (inclusive übermäßiger Quart) aus denen sich die Klänge meist aufbauen. In Takt 5 sowie zum Schluss des Werkes kehrt die Harmonik wieder zum Klangzentrum zurück.216 216 Weitere Werke Weberns, in denen die Technik des Klangzentrums angewendet wurde sind laut Rudolf Stephan unter anderem die Lieder op. 3/4 und op. 4/4. Albern Bergs Fünf Orchesterlieder 58 Abbildung 25: Anton Webern, 5 Lieder nach Gedichten von Stefan George op. 4/1, Takte 1-5. Eine etwas andere Variante der Klangzentren-Technik findet sich in Schönbergs Orchesterstück Farben op. 16/3. Neben der Bezeichnung „Farben“ gab Schönberg dem 1909 komponierten Stück unter anderem auch die Namen „Akkordfärbungen“ und „Der wechselnde Akkord“, welche die zugrunde liegende Kompositionstechnik hervorheben.217 Das Klangzentrum des Anfangsakkords wird im Verlauf des Stückes sukzessive in kleinen Schritten verändert und variiert. Abbildung 26 zeigt den harmonischen Verlauf über die ersten neun Takte. Die Stimmen folgen dabei einer einfachen Logik: Jede wird einmal um einen Halbton erhöht und anschließen – aus Sicht des Zentralklangs – um einen Halbton erniedrigt. In Takt neun ergibt sich so wiederum der ursprüngliche Zentralklang um einen Halbton nach unten transponiert. In seiner ursprünglichen Transposition wird das Klangzentrum in Takt 30 und zum Schluss des Werkes (T. 43-44) wieder erreicht, außerdem erscheinen noch weitere Transpositionen während 217 nach Ansichtskarten von Peter Altenberg op. 4 bezeichnet Stephan als Schlüsselwerk dieser Technik (vgl. Rudolf Stephan, Neue Musik. Versuch einer kritischen Einführung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1958, S. 36-39). Vgl. Charles Burkhart, Schoenberg’s Farben: An Analysis of Op. 16, No. 3, in: Perspectives of New Music (Bd. 12/1), 1973-1974, S. 141-172, hier S. 141f. 59 des Stücks.218 Damit durchläuft das Klangzentrum dieses Werks gewissermaßen eine kontinuierliche Klangtransformation219, die zum Schluss wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt. Neben der Zentrierung auf einen Zentralklang ist in Farben demnach auch ein harmonischer Prozess vorhanden, der den „maximally smooth cycles“ von Richard Cohn (vgl. S. 51) sehr ähnlich ist. Im Sinne der Transformationstheorie könnte man auch argumentieren, dass der Klang in den ersten neun Takten der Reihe nach alle denkbaren Umkehrungs-Transformationen erfährt, die jeden Ton um eine kleine Sekunde nach oben bzw. nach unten transformieren. Eine sehr ähnliche Transformationstechnik konnte auch in manchen Klavierwerken Franz Liszts, wie beispielsweise R.W. Venezia (1883) nachgewiesen werden. Dort verwandelt sich der Zentralklang des übermäßigen Dreiklangs auf Cis in den ersten 24 Takten über b-Moll, D-Übermäßig und h-Moll in einen übermäßigen Dreiklang auf Dis.220 Abbildung 26: Harmonischer Verlauf der Takte 1-9 von Schönbergs Orchesterstück Farben op. 16/3. Zofja Lissa übernimmt in den 1930er Jahren Erpfs Begriff des Klangzentrums und wendet ihn auf die Musik Alexander Skrjabins an.221 Insbesondere verwendet sie den Terminus um Skrjabins bekannten Prometheus-Akkord (Abbildung 27; auch „mystischer Akkord“ oder „synthetischer Akkord“) zu deuten, der in vielen Werken Skrjabins zweiter Schaffensperiode den Ausgangspunkt aller harmonischen und melodischen Ereignisse bildet: 218 219 220 221 Vgl. ebda. S. 143. Christian Utz und Dieter Kleinrath wenden diesen Begriff auch auf Klangereignisse neuerer Musik an wie z.B. Iannis Xenakis’ Metastasis für Orchester (1953), in dem sich in den ersten 34 Takten ein einzelner Ton (G) durch Glissandieren in den geteilten Streichern in einen Cluster verwandelt. Das sukzessive Verändern eines Klangzentrums kann durchaus als eine Vorform metamorphosenartiger Klangprozesse angesehen werden, die in der Musik des 20. Jahrhunderts immer wieder eine zentrale Rolle eingenommen haben (vgl. Christian Utz, Dieter Kleinrath, Klangorganisation. Zur Systematik und Analyse einer Morphologie und Syntax post-tonaler Kunstmusik, in: Musiktheorie und Improvisation. Bericht des IX. Kongresses der Gesellschaft für Musiktheorie, Mainz: Schott, in Vorbereitung. Vgl. Kleinrath, Kompositionstechniken, S. 42-45. Zofja Lissa, Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik, in: Acta Musicologica (Bd. 7/1), 1935, S. 15-21. 60 Auch die Melodik des Stückes [arbeitet] ständig und ausschließlich mit dem durch das Klangzentrum repräsentierten Tonmaterial. Das Klangzentrum bildet also die allgemeine Basis der Komposition, denn alle konstruktiven Elemente, sowohl der Harmonik, wie auch der Melodik lassen sich von ihm ableiten, auf ihn zurückführen. Ihr Tonmaterial und ihre Form ergibt sich aus den Bestandtönen und der Form des Klangzentrums.222 Abbildung 27: Skrjabins Prometheus-Akkord auf A. Skrjabins Klangzentrum vereint Skala und Harmonik zu einem geschlossenen Ganzen. Dieses Verfahren erkennt man schon an den ersten Takten (Abbildung 28) des Prometheus und sie wird das ganze Stück hindurch beibehalten. Harmonische Vielfalt erreicht Skrjabin weniger durch das Ändern des Grundakkords, sondern hauptsächlich durch Umkehrungen und Transpositionen desselben sowie durch Herausfiltern oder Hervorheben von Farbschattierungen anhand der Instrumentation beziehungsweise durch das Weglassen einzelner Akkordtöne. Die wenigen Ausnahmen, in denen akkordfremde Töne im Prometheus erklingen (wie beispielsweise das B der Melodie, T. 12), sind durchwegs als Nebennoten beziehungsweise Akkordfarben anzusehen. Diese Tendenz – Skala und Harmonik aneinander anzugleichen – kann man auch schon in den späten Klavierwerken Liszts beobachten, in denen zum Beispiel die so genannte „Zigeunerleiter“ und die Ganztonleiter eine wesentliche Rolle einnehmen.223 Schönberg wendet in seiner ersten Kammersymphonie op. 9 ähnliche Techniken auch auf den Quartenakkord an, der in letzter Konsequenz der chromatischen Skala zugrunde liegt. Abbildung 28: Prometheus, Takte 1-10; harmonische Reduktion.224 222 223 224 Ebda., S. 18. Vgl. Kleinrath, Kompositionstechniken, S. 19-38. Vgl. Gottfried Eberle, Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins, München/Salzburg: Katzbichler, S. 50. 61 Abbildung 29a zeigt die nach C transponierte Skala des Prometheus-Akkords. Skrjabins Aufzeichnungen legen jedoch nahe, dass die ursprüngliche Skala die in Abbildung 29b dargestellte mixolydische Skala mit erhöhter Quart war. Er notierte in einer Skizze den zusätzlichen Ton G dieser Skala, der zwar im Prometheus eine unbedeutende Rolle einnimmt, jedoch im zur selben Zeit entstandenen Poème op. 59 sowie in späteren Werken von Bedeutung ist.225 Zsolt Gárdonyi bezeichnet diese Skala, gemeinsam mit anderen Theoretikern der Bartók-Forschung, auch als „akustische Skala“226 und die von ihr ausgehende Tonalität als „akustische Tonalität“. Dabei weist Gárdonyi auf Béla Bartóks häufige Verwendung dieser Skala hin wie beispielsweise in der Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug oder in Melodie mit Begleitung im zweiten Heft des Mikrokosmos.227 Abbildung 29: a) Die Skala des Prometheus-Akkords, b) die mixolydische Skala mit erhöhter Quart. In der erwähnten Skizze bildet Skrjabin auf jedem Ton der Skala siebenstimmige Akkorde in Quarten- und Terzenschichtung (Abbildung 30). Das Auflisten dieser Klänge zeigt, wie sehr die dur-moll-tonalen Bezüge in Skrjabins Denkweise noch vorhanden waren. Zofja Lissa weist auch darauf hin, dass die Wurzeln des PrometheusAkkords in der Dominante der Dur-Moll-Tonalität liegen.228 So gesehen könnte der Prometheus-Akkord auf C beispielsweise als eine Alteration der Dominanten C7, Fis7 oder D7 angesehen werden, von denen er jeweils Grundton, Terz und kleine Sept enthält (Abbildung 31). Von diesen drei Klängen wird vor allem die Variante auf C (ein Domi225 226 227 228 Vgl. ebda., S. 63f. Die Bezeichnung „akustische Skala“ lehnt sich an die Teiltonreihe an, aus der die Skala einen Ausschnitt vom 8. bis zum 14. Teilton bildet. Vgl. Zsolt Gárdonyi, Akustische Tonalität und Distanzharmonik im Tonsatzunterricht, in: Harmonik im 20. Jahrhundert, Wien: Wiener Universitätsverlag 1993, S.46-61, hier S. 46f; sowie Zsolt Gárdonyi, Paralipomena zum Thema Liszt und Skrjabin, in: Virtuosität und Avandgarde, Untersuchungen zum Klavierwerk Franz Liszts, Mainz 1988, S. 11-14. Der Prometheus-Akkord kann aus einem übermäßigen Terzquartakkord mit hinzugefügter None und Sexte abgeleitet werden. Die Dominante mit Sext-Vorlhalt bezeichnet Lissa auch als „ChopinAkkord“ und weist damit auf eine wichtige Inspirationsquelle Skrjabins hin (vgl. Jörg-Peter Mittmann, Musikalische Selbstauslegung - eine sichere Quelle histori-scher Musiktheorie?, in: Musiktheorie als interdisziplinäres Fach (musik.theorien der gegenwart 4), Saarbrücken: Pfau 2010, in Bearbeitung). Vgl. auch Eberle, Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins, S. 49 sowie Zofja Lissa, Zur Genesis des Prometheischen Akkords bei Skrjabin, in: Musik des Ostens: Sammelbände für historische und vergleichende Forschung (Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa) (Bd. 2), 1963. 62 nantseptakkord mit hinzugefügter Sext, None und übermäßiger Quarte) – die Grundstellung des Prometheus-Akkords – auch in der Jazzmusik des 20. Jahrhunderts häufig als tonikaler Klang eingesetzt. Abbildung 30: Akkorde in Quarten- (a) und Terzschichtung (b) über der mixolydischen Skala mit erhöhter Quart. Abbildung 31: Dur-moll-tonale Deutung des Prometheus-Akkords. Lissa weist in ihrem Artikel ausdrücklich darauf hin, dass der Begriff „Klangzentrum“ bei Erpf eine andere Bedeutung hätte als bei ihr.229 Aus Sicht der Erweiterung des Begriffs auf die Kompositionstechniken Skrjabins – Erpf hat Skrjabin in seinem Buch selbst nicht behandelt – trifft dies sicherlich zu, dennoch haben die beiden Definitionen viele Gemeinsamkeiten. Der wesentliche Unterschied zu Erpfs Auffassung des Klangzentrums ist, dass Lissa, entsprechend der Kompositionstechnik Skrjabins, Klangzentrum und Skala als eine gemeinsame Einheit auffasst. Dies allein widerspricht Erpfs Begriff noch nicht, jedoch geht Lissa in ihrer Argumentation so weit, dass sie behauptet, die Dodekaphonie bilde in diesem Sinne ihr eigenes Klangzentrum aus und könne 229 Lissa, Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik, S. 18. 63 deshalb – dem „natürlichen Evolutionsgesetz“230 folgend – als Weiterentwicklung und Konsequenz der Klangzentren-Technik Skrjabins bewertet werden:231 Die Grundgestalt bildet [in der Dodekaphonie] die Basis für die Konstruktion der ganzen Komposition, sowohl ihrer melodischen Motive und Themen, als auch ihrer Zusammenklänge. Sie ist […] ihr Beziehungszentrum analog dem Tonika-Akkord in der tonalen Harmonik.232 […] Beide Systeme [die Klangzentrenharmonik Skrjabins und die Dodekaphonie] haben also als gemeinsame Eigenschaft das Vorhandensein eines bestimmten Zentrums, welches das ganze Tonmaterial umfaßt und seine eigene spezifische Struktur besitzt.233 Lissa stellt dabei die Klangzentren der Dodekaphonie und der Klangzentren-Technik Skrjabins der dur-moll-tonalen Tonika gegenüber. Als Unterschiede zwischen der tonalen Harmonik und diesen beiden Techniken führt sie die folgenden an: a) die tonale Harmonik stützt sich auf die Tonika, als Beziehungszentrum, welches in seiner Struktur (der Terzenaufbau) für alle tonalen Kompositionen gleich blieb und welches nur einen Teil des Tonmaterials zum Ausdruck brachte; die Klangzentrum- und Zwölftontechnik nehmen aber als Beziehungszentrum eine bestimmte Form, eine vertikale oder horizontale Gestaltung des ganzen Tonmaterials an […]; b) […] Die tonale Harmonik scheidet einzelne Komplexe von Tonartelementen aus […]. Die beiden Systeme jedoch, […] beziehen alle Teilstrukturen der musikalischen Konstruktion auf das Zentrum als Urform.234 Die Vorstellung, dass die Klangzentrenharmonik Skrjabins eine Vorform der Zwölftontechnik sei, wurde von mehreren Autoren in weiterer Folge aufgegriffen. Elmar Budde schrieb 1971, dass „die Technik des Klangzentrums […] allgemein als Vorform der Zwölftontechnik beschrieben“235 wird und bezieht sich dabei direkt auf Lissa. Allerdings wurde diese Sichtweise auch kritisiert; Gottfried Eberle meint, dass Lissa „die Unterschiede [zwischen Skrjabins Klangzentrenharmonik und der Dodekaphonie] […] zwar zum Teil durchaus sieht, aber unterbewertet, vielleicht aus der Genugtuung heraus, eine Vorform der Dodekaphonie entdeckt zu haben.“236 230 231 232 233 234 235 236 Ebda., S. 16. Vgl. ebda., S. 15-20. Ebda., S. 17. Ebda., S. 20. Ebda., S. 20f. Elmar Budde, Anton Weberns Lieder op. 3. Untersuchungen zur frühen Atonalität bei Webern, Wiesbaden: Steiner 1971, S. 68. Eberle, Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins, S. 52. 64 Lissas Argumentation hätte Erpf wahrscheinlich widersprochen, da er Zwölftontechnik und Klangzentren-Technik zwar unter dem Kapitel der funktionslosen Satztypen zusammengefasst hat, jedoch keineswegs eine direkte Beziehung zwischen diesen beiden Techniken herstellte. Auf einen anderen vermeintlichen Unterschied der Begriffsdefinitionen von Erpf und Lissa geht Gottfried Eberle in seinen Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins 1978 ausführlich ein: Erpfs „Klangzentrum“ oder – um gleich die gemeinte Sache anzusprechen – der Quartenakkord in Schönbergs Klavierstück [op. 19/6], tritt immer wieder „nach kurzen Zwischenstrecken“ auf, die sich „kontrastierend abheben“. Skrjabins „Klangzentrum“ jedoch werden keine kontrastierenden Zwischenpartien gegenübergestellt, es bestimmt in seinen 12 Transpositionsstufen das Werk ganz ausschließlich. Es ist nicht ein „klangliches Zentrum, von dem die Entwicklung ausgeht und in das sie wieder zurückstrebt“, sondern es repräsentiert das Ganze, das im Grunde keine harmonische Fortentwicklung kennt […].237 Eberle scheint jedoch Erpfs Begriff des Klangzentrums zu verkennen. Erpf gibt zu keinem Zeitpunkt das Vorhandensein kontrastierender Zwischenstrecken als notwendige Bedingung für die Technik des Klangzentrums an. Im Gegenteil verwendet er den Begriff Klangzentrum auch im Zusammenhang mit der „Technik der ostinaten Unterlage“ wie folgt: Schrumpft die Klangfolge der ostinaten Unterlage auf einen einzigen – etwa figurierten – Klang zusammen, so geht sie in ein Klangzentrum über; dehnt sich der Klang des Klangzentrums zu einer Klangfolge aus, so kann er, bei Wiederholung in regelmäßigen Abständen, zu einer ostinaten Unterlage werden.238 Als Beispiel für eine Mischform aus ostinater Unterlage und Klangzentrum nennt Erpf Igor Strawinkys Trois pièces pour quatuor à cordes. Über die Takte 1-15 dieses Werkes schreibt Erpf: Der ganze Komplex, der übrigens den ganzen Satzablauf beherrscht, setzt sich also aus mehreren unregelmäßig verbundenen ostinaten Bewegungen zusammen, die zugleich die Figuration eines 237 238 Ebda., S. 49. Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik, S. 198. 65 festgehaltenen Klangzentrums bilden. […] Der Klang verzichtet ebenfalls auf Entwicklung von beziehungsmäßiger Struktur, beharrt vielmehr auf einem Punkt.239 Daraus geht zweifelsfrei hervor, dass Erpf auch statische Klangzentren in seiner Definition mit einschließt. Das Klangzentrum einer Komposition definiert sich nicht über möglicherweise vorhandene kontrastierende Zwischenstrecken; umgekehrt werden diese jedoch durch das Vorhandensein eines Klangzentrums ermöglicht. Im Allgemeinen lag Erpf wohl wenig daran, mit seinen Begriffen eine exakte Systematik zu beschreiben. Vielmehr versucht er die Zusammenhänge von unterschiedlichen Kompositionstechniken und Satzmodellen anhand konkreter Beispiele, die aus seiner Sicht ähnlichen Prinzipien folgen, aufzuzeigen, weshalb er wohl auch die Technik des Klangzentrums mit dem Begriff der dur-moll-tonalen Tonika in Beziehung gebracht hat. Erpf weist sogar ausdrücklich darauf hin, „daß die [Satz-]Typen in reiner, deutlicher Form selten auf längeren Strecken herrschen. Sie wechseln vielmehr häufig untereinander, durchdringen sich gegenseitig und sind fast immer durchsetzt von Resten funktioneller Beziehung.“240 So gesehen schließen sich die Klangzentrenbegriffe bei Erpf und Lissa keineswegs gänzlich aus. Jedenfalls beziehen sich beide auf vergleichbare Kompositionstechniken, die in den Denkmustern der Komponisten um 1900 fest verankert waren und auf ähnliche Wurzeln hindeuten. Auch Eberles Behauptung im erwähnten Zitat, dass Skrjabins Klangzentrum „nicht ein ‚klangliches Zentrum [ist], von dem die Entwicklung ausgeht und in das sie wieder zurückstrebt‘“ ist sehr fragwürdig. Er bezieht sich dabei direkt auf folgende Aussage Lissas:241 Die zwölf möglichen Transpositionen des Grundakkordes bilden nichts an sich Selbstständiges, das sich dem Klangzentrum in seiner ursprünglichen Gestalt entgegenstellen würde, es sind bloß Schattierungen seiner Tonhöhe.242 Wie soll diese Aussage verstanden werden? Ist damit gesagt, dass die Transposition des Prometheus-Akkords auf eine andere Stufe der chromatischen Skala keinerlei klangliche Auswirkung hat, die unterschiedlichen Stufen also alle in derselben tautologischen 239 240 241 242 Ebda., 201f. Ebda., S. 202. Vgl. Eberle, Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins, S. 65. Lissa, Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik, S. 19. 66 Beziehung zum Klangzentrum stehen? Wohl kaum, denn dann wäre eine Transposition des Prometheus-Akkords an sich schon überflüssig und würde der Musik keinerlei zusätzlichen Gehalt hinzufügen, eine Behauptung, der Skrjabin wohl vehement widersprochen hätte. Auch die einzelnen Umkehrungen des Klangzentrums sind in ihrem Klangcharakter sehr unterschiedlich und werden oft weniger als Umkehrungen eines einzigen Klanges wahrgenommen, sondern vielmehr als Klänge mit durchaus eigenständigen Klangqualitäten. Fest steht jedenfalls, dass Skrjabin nicht nur zwischen den unterschiedlichen Transpositionen des Prometheus-Akkords unterschieden hat, sondern auch zwischen den einzelnen Umkehrungen des Akkordes. So legt er beispielsweise Wert darauf, dass seine Stücke meist mit der Grundform des Klangzentrums beginnen und enden. Skrjabin bezeichnete anfangs Werke sogar noch nach dem Grundton des zugrunde liegenden Klangzentrums im Sinne einer Tonart.243 Außerdem folgte Skrjabin Modulationsschemen die vorgaben wie die Transpositionen der Klangzentren aufeinander folgen.244 Der Wechsel von einer Transposition zur anderen ist dabei keineswegs willkürlich, sondern folgt ästhetischen und formalen Prinzipien, wie beispielsweise der Anzahl der gemeinsamen Töne zwischen zwei aufeinander folgenden Klängen.245 In Skrjabins Klangzentrenharmonik ist also – zumindest aus kompositionstechnischer Sicht – ganz offensichtlich eine vom Klangzentrum ausgehende und wieder zurückkehrende Akkordbewegung vorhanden. 243 244 245 Vgl. Eberle, Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins, S. 61f. Vgl. ebda. S. 64. Vgl. ebda. S. 66. 67 1.9 Schlussfolgerungen Die Bedeutung des Begriffs Tonalität war im Laufe der Musikgeschichte einem ständigen Wandel unterzogen und es hat fast den Anschein, als ob man sich aus der Vielfalt der möglichen Bedeutungen jeweils jener bedienen könne, die der gerade gestellten Frage die treffende Antwort liefert. Selbst bei einzelnen Autoren, wie im Falle Schönbergs, ist die Verwendung des Begriffs nicht unbedingt eindeutig. In Anbetracht der unterschiedlichen Fragestellungen, die heute in der Musiktheorie verfolgt werden und des unterschiedlichen Erkenntnisgewinnes, der daraus resultiert, scheint es wichtiger denn je einen exakten Tonalitätsbegriff zu verwenden, der klar einschränkt, worüber man gerade spricht. Aussagen etwa über „die Tonalität der Zwölftonmusik“ sind bestenfalls mehrdeutig und können kaum falsifiziert werden, wenn der Begriff Tonalität nicht zuvor in einen eindeutigen Zusammenhang gebracht wurde. Wenn man den Begriff Tonalität zum Beispiel als die Beziehungen zwischen den Tönen einer Skala versteht, ist etwa die Dodekaphonie, die „Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“, durchaus als ein tonaler Typ im Sinne Fétis’ zu verstehen.246 Unter diesem Gesichtspunkt wäre auch die Aussage, dass sich die Tonalität mit dem Beginn der Atonalität aufgelöst hat ebenso irreführend, wie der Begriff „Atonalität“ selbst. Dass der unreflektierte Begriffsgebrauch zu Missverständnissen und einer dem Begriff unangemessenen Beliebigkeit führt, ist absehbar. Vielleicht wäre es der Sache heute sogar dienlicher, wenn man versuchte, Tonalität über das zu definieren, was sie, ihren zahlreichen Bedeutungsfacetten nach, nicht ist. Dann müsste es heißen: Tonalität ist die Antithese eines imaginären Begriffs (ich verwende hier bewusst nicht die Bezeichnung „Atonalität“), der sich auf Musik bezieht, bei der keinerlei Beziehungen zwischen den verwendeten Tönen besteht, weder im vertikalen Zusammenklang, noch im horizontalen Aufeinanderfolgen. Insbesondere ist diese Musik auch dadurch gekennzeichnet, dass keinerlei tonaler oder harmonischer Bezugspunkt als Zentralklang eine besondere Rolle einnimmt. Spätestens hier muss man allerdings fragen, was es überhaupt bedeutet, wenn sich Töne oder Akkorde „aufeinander beziehen“. So einfach diese Frage im ersten Moment auch scheint, so schwierig ist es, sie im konkreten Fall zu beantworten. Betrachtet man zum 246 Vgl. Dahlhaus, Tonalität, S. 624. 68 Beispiel die Dur-Moll-Tonalität im Sinne der Naturklangtheorie, so sind zumindest zwei Typen von Tonbeziehungen relevant. Einerseits die Beziehung der Töne untereinander aufgrund des Konsonanzprinzips, andererseits die Beziehung der Töne auf einen gemeinsamen Grundton oder -akkord, die Tonika. Wenn man den Tonalitätsbegriff dagegen weiter fasst, ist die Voraussetzung ausreichend, dass die Töne des verwendeten Tonsystems in irgendeiner beliebigen Beziehung zu einander stehen. Unter diesem Gesichtspunkt ließe sich der Begriff wie gesagt durchaus auch auf Zwölftonmusik anwenden. Aber was ist das Kriterium dafür, dass sich die Töne einer Komposition auf einander beziehen? Nehmen wir einmal an, der Komponist selbst wäre dafür verantwortlich, den Tönen innerhalb seiner Komposition einen Bezugsrahmen zu geben. Dann wäre eine rein aleatorische Komposition eindeutig als Musik zu bezeichnen, die im Rezipienten kein „Tonalitätsgefühl“ hervorruft, da die sich ergebenden Klänge als Zufallsprodukt des Kompositionsprozesses zu bewerten wären. Eine solche Aussage geht allerdings davon aus, dass die Kompositionstechnik des Komponisten direkten Einfluss auf die Wahrnehmung des Hörers hat, was selbstverständlich mehr als zweifelhaft ist. Ebenso wenig kann vorausgesetzt werden, dass im Umkehrschluss eine Komposition, in der die Akkorde während des Kompositionsprozesses eindeutig auf einander bezogen wurden, beim Hörer auch tatsächlich den Eindruck einer Bezogenheit der Klänge auslöst. Hier zeigt sich, dass wir den Begriff Tonalität kaum bewerten können, ohne dabei auch auf die subjektive Wahrnehmung und musikalische Sozialisierung des Rezipienten Rücksicht zu nehmen. Andererseits bestehen natürlich immer Tonbeziehungen sobald Töne in einem Musikstück vorhanden sind, unabhängig davon, ob wir diese Bezüge auch wahrnehmen oder, ob ein Komponist diese Bezüge als solche gedacht hat. Jeder Ton steht zu jedem anderen immer in einem bestimmten Verhältnis. Ein einzelner ausgehaltener Sinuston definiert sich sogar über eben dieses Verhältnis, da er in jedem Moment dem vorangegangenen gleicht. Im selben Ausmaß definiert sich „ein anderer Ton“ durch seine Beziehung zu dem Ton, von dem er sich unterscheidet. Hierin offenbart sich die Problematik einer Tonalitätsdefinition als die einfache Bezogenheit der Töne oder Akkorde, basierend auf einer zugrunde liegenden Skala. Streng genommen ließe sich der Begriff Tonalität dann auf jede Tonbeziehung anwenden – sogar auf den Sinuston selbst – und würde zu einem beliebigen, tautologischen Begriff verkommen. Dahlhaus stellt treffend fest: 69 Ob die Zentrierung der Ton- oder Akkordbeziehungen um einen Grundton oder -akkord als essentielles oder als akzidentelles Merkmal der Tonalität gelten soll, ist ungewiß oder scheint es zu sein. Der Verzicht auf das definierende Merkmal „Zentrierung“ läßt „Tonalität“ zu einer generellen Bezeichnung für Tonbeziehungen verblassen; „Tonalität“ und „Tonsystem“ werden synonyme Ausdrücke, sofern man nicht „Tonalität“ als „Prinzip“ und „Tonsystem“ als „Erscheinungsform“ begreift. Doch ist es […] überflüssig, den Sachverhalt, den der Ausdruck „Tonsystem“ meint, durch einen zweiten Terminus zu bezeichnen.247 In diesem Zusammenhang ist auch Zofja Lissas Gleichsetzung von Klangzentrum und Skala und die damit verbundene Deutung von Dodekaphonie als Weiterentwicklung der Klangzentren-Technik kritisch zu bewerten. Jede beliebige Ansammlung von Tonhöhen kann irgendeiner Skala oder – im Falle der Dodekaphonie – einer Reihe zugrunde gelegt werden, womit sich der Begriff „Klangzentrum“ auf jede beliebige Musik anwenden ließe: Wird der Tonalitätsbegriff an Umfang weiter, so muß er nach den Regeln der formalen Logik an Inhalt ärmer werden. […] Ein Begriff der alle Akkorde und Akkordverbindungen umfaßt, die denkbar sind, ist inhaltslos. […] An dem Eingeständnis, daß der „Zentralklang“ eines Satzes nicht als realer Akkord248 in ihm vorkommen müsse, sondern konstruiert werden könne, wird die Schwäche der Konstruktion offenbar; denn man braucht, um den gemeinsamen Ursprung aller Akkorde eines Satzes zu finden, nur die kleinste Zahl der Töne, von denen mindestens einer in jedem Akkord enthalten ist, zu einem hypothetischen „Zentralklang“ zusammenzusetzen. Das Prinzip ist also, da es für alle Musik gilt und über keine etwas besagt, leer allgemein.249 Damit ist aber nicht gesagt, dass sich Skala und Klangzentrum gegenseitig ausschließen. Jede Menge von Tönen kann im vertikalen Zusammenklang als Klangzentrum dienen und zugleich in der horizontalen Aufeinanderfolge als Skala oder Reihe Verwendung finden. Jedoch umgekehrt davon auszugehen, dass jede Skala oder Reihe auch ein Klangzentrum wäre, ist ein logischer Fehlschluss. Allerdings hat die einem Werk zugrunde liegende Skala oft einen erheblichen Einfluss auf den sich ergebenden Gesamtklang. Wenn eine Skala im Sinne einer modalen Kompositionstechnik als 247 248 249 Dahlhaus, Untersuchungen, S. 17. Dahlhaus’ Aussage, dass ein Klangzentrum als „realer Akkord“ in einem Musikstück vorkommen muss ist allerdings schwer nachvollziehbar. Gerade die dur-moll-tonale Musik lebt schließlich von einem Klangzentrum – der Tonika – das keineswegs immer vorhanden sein muss, jedoch trotzdem wahrgenommen oder zumindest gedacht werden kann. Carl Dahlhaus, Der Tonalitätsbegriff in der neuen Musik, in: Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur Musik mit einer Einleitung von Hans Oesch, Schott: Mainz 1978, S. 111-117, hier S. 113. 70 zentraler Bezugspunkt verwendet wird, dann mag es in manchen Fällen durchaus sinnvoll sein, sie als ein Klangzentrum zu behandeln. Die Sinnhaftigkeit eine Skala als Klangzentrum anzusehen ergibt sich jedoch allein aus ihrer Einzigartigkeit im Verhältnis zu anderen Skalen oder Klängen, welche ihr wiederum als Klangzentren gegenübergestellt werden können. Wenn die Skala dagegen für sich alleine steht, dann wäre sie als Klangzentrum bedeutungslos, da wir keinen Erkenntnisgewinn aus dieser Information ableiten könnten. Die Grundreihe einer dodekaphonen Komposition muss an sich noch nichts über den Gesamtklang der Stelle aussagen, in der ihre Ableitungen verwendet werden. Vielmehr ergibt sich der Gesamtklang aus der bewussten Kombination unterschiedlicher Reihenformen und ändert sich demnach im Verlauf des Werkes ständig. Dass diese Kombination von Reihenformen auch Zentralklänge ausbildet, ist zwar möglich, kann aber nicht im Allgemeinen beantwortet, sondern muss im konkreten Fall erneut hinterfragt werden; insbesondere erzeugen gleiche Reihenformen nicht unbedingt dieselben Klangzentren. Auch wurde noch nicht geklärt, aus wessen Sicht ein Ton oder Akkord die Rolle eines Zentralklangs nun einnehmen muss, damit Tonalität vorhanden ist: Ist es der Komponist, der einem Klang eine besondere Bedeutung zukommen lässt, oder ist es der Hörer, der einen Klang als besonders bedeutend wahrnimmt? Oder ist es gar der Musiktheoretiker, der einer Komposition das Vorhandensein eines bestimmten Zentralklangs unterstellt oder neue Klangzentren aufdeckt, die weder dem Komponisten noch dem Hörer bekannt waren? Es dürfte schwierig sein diese Fragen endgültig zu beantworten, da jede dieser Positionen gleichermaßen ihre Berechtigung hat. Dahlhaus stellt fest, „daß Tonalität eine historische Kategorie ist, die das Moment der Zeit enthält. Auf einer späteren Entwicklungsstufe können Phänomene als tonal gelten, die man auf einer früheren vom Begriff der Tonalität ausschließen müßte“250. Zusätzlich ist Tonalität jedoch auch eine kompositionstechnische sowie eine hörpsychologische Kategorie, aus deren Sicht sich der Begriff substanziell unterscheiden kann. Die endgültige Bedeutung von Tonalität kann sich demnach immer nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus erschließen. Ob die von Erpf und Lissa auf post- bzw. atonale Werke angewandte Technik des Klangzentrums, als eine Konsequenz oder ein Weiterwirken dur-molltonaler Prinzipien angesehen werden kann, hängt insofern auch von dem jeweiligen 250 Ebda. 71 Untersuchungsgegenstand ab. Dass aus kompositionstechnischer Sicht Klangzentren auch in der Musik des 20. Jahrhunderts immer wieder verwendet wurden, steht außer Frage; ob diese Klänge jedoch auch aus hörpsychologischer Sicht die Rolle eines Zentralklangs einnehmen, müsste anhand konkreter Beispiele untersucht und bewiesen werden. Die vorherigen Überlegungen legen nahe, dass irgendeine Form der „Zentrierung“ für einen sinnvollen Tonalitätsbegriff unerlässlich ist. Diese Feststellung scheint Richard Cohns Beobachtungen im Zusammenhang mit den „maximally smooth cycles“ in Franz Schuberts Klaviertrio in Es- Dur op. 100 (vgl. S. 52) im ersten Moment zu widersprechen. Bei genauerer Betrachtung der Takte 586-618 wird jedoch schnell deutlich, dass auch diese Harmoniefolge (vgl. Abbildung 18) durchaus Zentrierung auf unterschiedlichen musikalischen Ebenen aufweist. Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei der fraglichen Stelle um die Coda eines Klaviertrios in Es-Dur handelt und die Tonika EsDur schon allein aufgrund unserer konditionierten Erwartungshaltung (durch die vorangegangenen mehr als 500 Takte sowie unseres „Extra-Opus-Wissens“ über tonale Musik) eine besondere Rolle einnimmt. Dem entsprechend beginnt der „maximally smooth cycle“ auch mit Es-Dur und schließt wieder darin, wobei Es-Dur in den Takten 615-622 durch das dreimalige Wiederholen einer Kadenz (T. 614-615) als Zentralklang hervorgehoben wird. Weiters muss festgehalten werden, dass die chromatische Stimmführung der Harmonik in diesen Takten zwar eine wichtige Rolle einnimmt, für den musikalischen Gestus und die formale Struktur jedoch eine andere Kompositionstechnik weit wichtiger ist: Die Takte 597-615 bestehen aus zwei realen Sequenzen der Takte 587-569 (Abbildung 32), die jeweils von einem Dur-Dreiklang ausgehend, in einen Dur-Dreiklang um eine große Terz tiefer modulieren. Diese Sequenzen exponieren den Ausgangsakkord und den Zielakkord der Modulation in besonderer Weise und sind auch für unsere Wahrnehmung von wesentlicher Bedeutung. Der großformale Verlauf dieser Harmoniefolge erzeugt durch die Sequenzen also wiederum eine Zentrierung, und zwar auf die Tonarten Es-Dur (T. 586-587), Ces/(H)-Dur (T. 587), G-Dur (T. 606) und schließlich wieder Es-Dur (T. 615). Auch in den mikroformalen harmonischen Beziehungen werden die Dreiklänge des „maximally smooth cycles“ in ihrer Bedeutung nicht einfach gleichgeschaltet. Beispielsweise tritt der Zielakkord der in Takt 597 abgeschlossenen ersten Modulation – Ces-Dur – bereits in Takt 591 als übermäßiger Quintsextakkord in es-Moll auf, der die Kadenz in den darauf folgenden zwei Takten 72 einleitet; damit bringt Schubert Ces/(H)-Dur auch in einen funktionalen Kontext aus Sicht von es-Moll. Schließlich ist auch noch anzumerken, dass die „maximally smooth cycles“, wie sie von Cohn beschrieben wurden, selbst schon eine Form der „Zentrierung“ darstellen: Schubert hätte zum Erzeugen chromatischer Stimmführung andere Akkorde wie beispielsweise den übermäßigen Dreiklang verwenden können, entschied sich hier jedoch bewusst für die traditionellen Akkordtypen der Tonika – Dur und Moll. Abbildung 32: Schubert, Klaviertrio in Es- Dur op. 100, T. 586-598.251 Ich will Richard Cohns verdienstvolle Forschung im Zusammenhang mit der Bedeutung chromatischer Stimmführung während der Kunstmusik des 19. Jahrhunderts hier keinesfalls schmälern. Natürlich treffen Cohns Beobachtungen hinsichtlich der „maximally smooth cycles“ zu und auch weitere Kompositionen zeugen von ihrer besonderen Bedeutung für die damalige Kompositionstechnik (wie auch am Beispiel Liszts und Schönbergs gezeigt wurde, vgl. S. 60). Wenn man die Vorstellung eines möglichen Zentralklangs jedoch gänzlich fallen lässt, läuft man leicht Gefahr harmonische Zusammenhänge unangemessen zu verallgemeinern. In ihrer abstrakten Form bilden die „maximally smooth cycles“ keine Klangzentren aus, da ein Kreis bekanntlich keinen Anfang und kein Ende hat. Musik dreht sich jedoch nicht im Kreis, sondern bewegt sich linear fort. Deshalb wird jede konkrete harmonische Folge zumindest zwei Klänge an 251 Cohn, As Wonderful as Star Clusters, S. 215. 73 exponierter Stelle enthalten und damit „zentrieren“: den Anfangsklang und den Zielklang. Nachdem unsere musikalische Wahrnehmung unter anderem von unserem Gedächtnis abhängt, muss der mögliche Einfluss dieser Klänge auf die Wahrnehmung der restlichen Harmonien bei unseren Überlegungen mit berücksichtigt werden. Anstatt ein unzulängliches Theoriemodell – die absolute Zentrierung auf einen Zentralklang, die Tonika – durch ein anderes unzulängliches Theoriemodell – die absolute Dezentrierung zugunsten einer Analyse konkreter Akkordbeziehungen – zu ersetzt, sollte ein Mittelweg gefunden werden, der sowohl unmittelbare Akkord- und Tonbeziehungen, als auch die Beziehungen zu Zentralklängen mit einschließt. 74 KAPITEL II ANALYTISCHE KONSEQUENZEN Die vorangegangenen Untersuchungen haben ergeben, dass eine Zentrierung auf einen Ton oder Akkord für den Tonalitätsbegriff notwendig ist und dass Kompositionstechniken atonaler bzw. post-tonaler Musik möglicherweise als ein Weiterdenken dieses ursprünglich dur-moll-tonalen Prinzips gelten können. Es liegt nahe nun den Untersuchungsgegenstand – das Klangzentrum – näher zu betrachten und die Klangzentren der Dur-Moll-Tonalität mit den Klangzentren späterer Werke zu vergleichen. Im folgenden Kapitel werden unterschiedliche Formen der harmonischen Zentrierung dur-molltonaler Musik untersucht. Die vordergründigen Fragen, die es dabei zu beantworten gilt, sind: (1) Zeichnet sich die Dur-Moll-Tonalität tatsächlich dadurch aus, dass ein einzelner Zentralklang immer den zentralen Bezugspunkt darstellt? (2) Ist der Akkordtyp des Zentralklangs zwangsläufig ein Dur- oder Moll-Dreiklang oder kann er auch andere Formen annehmen? 2.1 Klangzentren der Dur-Moll-Tonalität Der Zentralklang der Dur-Moll-Tonalität ist den meisten Definitionen nach die Tonika. Dieser Denkweise folgend beziehen sich alle Töne und Akkorde auf die I. Stufe der Tonleiter. Am deutlichsten kommt diese Überlegung in den Theorien von Riemann und Schenker zum Tragen. Riemann bezieht in seiner Funktionstheorie alle Akkorde direkt auf die Tonika, selbst dann, wenn diese Tonika gar nicht im analysierten Abschnitt in Erscheinung tritt. Dabei nimmt die Tonika entweder die Form eines Dur-Dreiklangs (Symbol: T) oder eines Moll-Dreiklangs (Symbol: t) ein. Schenker blendet in seinen Analysen dagegen die mikroformalen harmonischen Beziehungen, die in der Funktionstheorie im Vordergrund stehen, bewusst aus und reduziert ganze Abschnitte oder gar Werke auf die Bewegung von einer Tonika hin zur nächsten. Es wird heute meist davon ausgegangen, dass die bezeichnete Tonika nicht nur einen abstrakten Bezugspunkt einnimmt, sondern der Hörer sie auch tatsächlich in entsprechender Weise wahrnimmt. Aus analytischer Sicht legt man sich mit der Wahl der 75 Tonika als Dur- oder Moll-Dreiklang also nicht nur in Bezug auf die musikalische Struktur fest, sondern man macht gleichzeitig auch eine Aussage über die hörpsychologischen Erwartungen des Rezipienten. Dabei erfüllt die Tonika vor allem zwei relevante musikalische Funktionen: (1) Sie bezeichnet einen harmonischen Ruhepunkt; die Fortschreitung zur Tonika im Rahmen einer Kadenz wird als Auflösung wahrgenommen und führt zu einer Entspannung des harmonischen Verlaufs. (2) Sie dient der formalen Gliederung. Das Erreichen der Tonika erzeugt ein Gefühl der Abgeschlossenheit und ermöglicht damit das Anschließen eines neuen musikalischen Gedankens oder aber das Beenden des Stückes. Einem ausschließlich monozentrischen Tonalitätsbegriff stünde die dualistische Vorstellung gegenüber, dass sich Tonalität nicht nur über die Tonika, sondern auch über die Dominante definiert. Selbst Riemann und Schenker, die beide der Tonika eine tragende Rolle zukommen ließen, kamen nicht ohne das Miteinbeziehen der Dominante oder der Subdominante aus. Die Tonika definiert sich allein über das Vorhandensein von harmonischen Beziehungen zu anderen Tönen oder Akkorden. Schon Choron und Fétis räumten in ihren Definitionen des Tonalitätsbegriffs der Dominante tendenziell einen größeren Stellenwert ein als der Tonika und auch bei den Theorien von Vogler und Weber wird die Kadenz – und damit das Wechselspiel zwischen Tonika und Dominante – als wesentliches Merkmal einer Tonart angegeben (vgl. S. 16-18). Ernst Krenek schrieb 1937 über die Bedeutung der Dominant-Tonika-Beziehung: Was die Atonalität wesentlich von der Tonalität unterscheidet, ist die Dominantwirkung, die diese besitzt, die jener fehlt; Die Konstituierung unserer Tonalität wird bewirkt durch die Orientierung eines ganzen großen musikalischen Verlaufs, eines Werkes, nach einer einzigen Dominant-Tonika-Beziehung, eben jener, die die „Haupttonart“ des Werkes repräsentiert.252 Aus dieser Sicht erscheint es sinnvoller das Klangzentrum der Dur-Moll-Tonalität als ein Konglomerat von Dominante und Tonika aufzufassen, die Vorstellung eines einzigen Klangzentrums also zu verwerfen und die Dominante als Klangzentrum der Tonika gegenüberzustellen. Dass die Dominante über weite Strecken ein eigenständiges Zentrum ausbildet, kann schon im Barock beobachtet werden. Betrachtet man bei252 Ernst Krenek, Über neue Musik [Wien 1937], zit. nach: Beiche Tonalität, S. 11. 76 spielsweise den harmonischen Verlauf von Johann Sebastian Bachs bekanntem Präludium in C-Dur BWV 846, welches wohl als ein Paradebeispiel tonaler Musik angesehen werden kann, so wird dort der Dominante ebenso viel Platz eingeräumt wie der Tonika. Einerseits übernimmt die Dominante die Rolle einer temporären Tonika in den Takten 5-13, andererseits wird der Dominantseptakkord in den Takten 24-31 über einem Dominant-Orgelpunkt auskomponiert. Auch die aus harmonischer Sicht ungewöhnlichste Stelle des Präludiums exponiert die Dominante: In den Takten 22-23 (Abbildung 33) umspielen zwei verminderte Septakkorde (Fis- und As-Vermindert) den Grundton der Dominante (Fis–As–G) und leiten so den Dominant-Orgelpunkt der folgenden Takte ein. Abbildung 33: J. S. Bach, Präludium in C-Dur BWV 846, T. 22-24. Wie die Tonika erfüllt auch die Dominante zwei primäre musikalische Funktionen: (1) Sie erzeugt harmonische Spannung, die in der Auflösung zur Tonika als Lösung empfunden wird. (2) Sie dient ebenfalls der formalen Gliederung. Ausgedehnte Orgelpunkte oder Auftaktakkorde kündigen beispielsweise oft die Rückkehr zum Thema bzw. zur „Haupttonart“ an. Auch in den meisten dualistischen Interpretationen ist jedoch eine eindeutige Hierarchisierung der Klangzentren zugunsten der Tonika vorhanden. Besonders deutlich tritt diese Hierarchie in den dialektischen Theorien Moritz Hauptmanns zutage. Dominante und Subdominante treten dort als Antithese dem Zentralklang der Tonika gegenüber und erfüllen erst in der Synthese mit der Tonika ihre endgültige Bestimmung. Diese Hierarchisierung entspricht auch in vielen Werken des 18. und 19. Jahrhunderts der musikalischen Realität, sowohl auf mikroformaler, als auch auf makroformaler Ebene. Nicht zuletzt prägt das abstrakte Schema der Sonatensatzform, eben diese Hierarchisierung deutlich aus. Dem gegenüber zeigt die Entwicklung der Harmonik des 20. Jahrhundert jedoch eine deutliche Tendenz, dass diese Hierarchisierung mehr und mehr aufgebrochen wurde und damit andere Klänge neben der Tonika an Bedeutung gewannen. 77 Zunächst ist festzustellen, dass die Rolle der Tonika in der Dur-Moll-Tonalität zugunsten der Dominante mehr und mehr zurückgedrängt wurde. Einerseits wurden die Durchführungen, die sich meist in weiten Strecken hauptsächlich dominantischen und weiterführenden Techniken widmen, immer länger und komplexer, andererseits wurde dem dominantischen „Auftaktakkord“, der die Rückführung von der Durchführung zur Reprise einleitet, in den Sonatensätzen immer mehr Bedeutung beigemessen. Weiters nehmen auch dissonante Akkorde, die im Sinne der Dur-Moll-Tonalität eigentlich als Dominanten bewertet werden müssten, in der Hochromantik häufig die Funktion eines spannungsfreien Akkords ein. Georg Andreas Sorge klassifizierte im Vorgemach der musicalischen Composition253 bereits 1745 den übermäßigen Dreiklang als einen konsonanten Dreiklang unter den „scharfen musikalischen Gewürzen“254. Carl Friedrich Weitzmann sah in seiner Schrift Der Übermäßige Dreiklang255 den übermäßigen Dreiklang als einen der vier natürlichen Dreiklänge Dur, Moll, vermindert und übermäßig an.256 Weitzmann veröffentlicht auch ein Tonnetz, das alle 12 Töne als Kreuzprodukt von verminderten Septakkorden und übermäßigen Dreiklängen darstellt (Abbildung 34).257 Abbildung 34: Weitzmanns Zwölftonmatrix.258 253 254 255 256 257 258 Georg Andreas Sorge, Vorgemach der musicalischen Composition, Lobenstein 1745. Georg Andreas Sorge, zit. nach: Larry Todd, Franz Liszt, Carl Friedrich Weitzmann, and the Augmented Triad, in: The second practice of nineteenth-century tonality, Lincoln: University of Nebraska Press 1996, S. 153-177, hier S. 154. Carl Friedrich Weitzmann, Der Übermäßige Dreiklang, Berlin 1853. Vgl. Todd, Franz Liszt, Carl Friedrich Weitzmann, S. 157. Vgl. Kleinrath, Kompositionstechniken, S. 14. Weitzmann. Der übermäßige Dreiklang, Bsp. aus: Richard Cohn, Weitzmann’s Regions, My Cycles, and Douthett’s Dancing Cubes, in: Music Theory Spectrum (Bd. 22,1), 2000, S. 89-103, hier S. 91. 78 Erste Anzeichen dieser Entwicklung, die letztendlich in der endgültigen Emanzipation der Dissonanz im 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt fand, kann man bereits in den Durchführungen mancher klassischer Sonatensatzformen erkennen. So verselbständigen sich die ausgedehnten Orgelpunkte der Rückführung gelegentlich in einer Weise, dass sie weniger eine dominantische Wirkung entfalten, sondern vielmehr als Ruhepunkte und statische Klangzentren wirken. Ein ausgedehnter Orgelpunkt auf der Dominante findet sich beispielsweise in Beethovens Sonate op. 28 (T. 219-256). In den ersten acht Takten des Auftaktakkords (T. 219-226) wird die Dominante traditionell mit QuartsextVorhalten auskomponiert. In den Takten 228-256 (Abbildung 35) wird sie dagegen als konsonanter Akkord ohne die kleine Sept eingesetzt, was dazu führt, dass ihre eigentliche Funktion, die Spannung vor der Auflösung in die Tonika (T. 257), fast verloren geht. Abbildung 35: Beethoven, Sonate op. 28 „Pastorale“, T. 240-261. Beethovens Sonate op. 13 (T. 167-187, Abbildung 36) weist dagegen einen eigentlich dissonanten Dominantseptakkord als Auftaktakkord auf. Durch die chromatischen Umspielungen der Akkordtöne (T. 167-170 und T. 175-178) sowie die Harmonik der Takte 171-174 bzw. 179-186, wirkt die Dominante hier jedoch wie ein harmonischer Ruhepunkt, der keiner zwingenden Auflösung mehr bedarf. 79 Zu diesen Beispielen ist anzumerken, dass aus hörpsychologischer Sicht natürlich nach wie vor die Tonika als unterschwelliges Klangzentrum mitschwingt, die Hierarchisierung also keinesfalls aufgehoben ist. Dies liegt jedoch hauptsächlich an unserer Erwartungshaltung in Bezug auf den formalen Ablauf der Sonatensatzform und weniger an der Spannung des Auftaktakkords selbst, ist also direkt von unserer musikalischen Sozialisierung bedingt. Gerade diese Erwartungshaltung wird aber in der Hochromantik immer häufiger enttäuscht, sodass es spätestens seit der Musik Wagners und Liszts kaum Veranlassung mehr gibt eine bestimmte – oder überhaupt eine – Auflösung eines Klanges zu erwarten. Abbildung 36: Beethoven, Sonate op. 13 „Pathétique“, T. 173-189. Die Dominante wurde in Rückführungen auch unabhängig von Orgelpunkten als eigenständiger Bezugspunkt der Harmoniefolgen eingesetzt. So schreibt Schönberg in den Grundlagen der musikalischen Komposition: In komplizierteren Kompositionen wird die liquidierende Passage über dem Orgelpunkt auf der Dominante durch eine Reihe von Segmenten ersetzt, die Schlußsätzen ähnlich sind, außer daß sie 80 sich, statt der Tonika, wiederholt dem Auftaktakkord nähern. Sie können innere Modulation enthalten oder „schweifende“ Harmonie, die aber auf verschiedenem Wege immer wieder zum Auftaktakkord zurückkehrt.259 Als Beispiele solcher Auftaktakkorde nennt Schönberg Beethovens 3. und 5. Symphonie.260 In solchen zum Teil sehr ausgedehnten Passagen der Rückführung wird der Schwerpunkt des tonalen Klangzentrums von der Tonika zur Dominante hin verlagert, allerdings natürlich mit der damit verbundenen Erwartung, dass die Tonika in der Reprise auch tatsächlich wiederkehrt. Auf der anderen Seite findet man in Sonatensätzen auch häufig das Ausweiten der Coda und damit meist der Tonika-Region. Diese Praxis könnte durchaus als eine direkte Reaktion auf die zunehmende Bedeutung der Dominante interpretiert werden. So ist beispielsweise die Coda in Beethovens 3. Symphonie auf 135 Takte ausgeweitet und erzeugt damit einen formalen Ausgleich in Bezug auf die ausgedehnte Rückführung. Es sprechen noch weitere Argumente dafür, dass die Dur-Moll-Tonalität im 19. Jahrhundert nicht aus Sicht eines einzigen Klangzentrums gedeutet werden sollte. Neben der zunehmenden Bedeutung der Dominante werden auch andere Regionen immer häufiger als zentrale Bezugspunkte eingesetzt. In diesem Zusammenhang wäre zunächst die Ambivalenz zwischen Dur und Moll zu nennen, die von Komponisten seit jeher ausgenutzt wurde, um zwischen diesen beiden Klangcharakteren zu wechseln. Es gibt wohl kaum ein größeres Werk in der Literatur, das nicht sowohl Dur als auch Moll in längeren Abschnitten ausgiebig behandelt. Hier wäre einerseits die diatonische Beziehung zwischen einer Durtonart mit der parallelen Molltonart zu nennen. Siegfried Wilhelm Dehn bezeichnete 1840 die Verwandtschaft zwischen I. und VI. Stufe, gemeinsam mit der Verwandtschaft zwischen I. und III. Stufe, als den größtmöglichen Verwandschaftsgrad. Er begründete dies mit der großen Anzahl konsonanter Intervalle in diesen Klängen in Bezug auf die Dur-Tonleiter (vgl. S. 22). Als weitere wichtige Verwandtschaftsbeziehung ist die chromatische Beziehung zwischen einer Durtonart und der Molltonart auf derselben Stufe zu nennen. Diese Art der Verwandtschaft wurde in Gottfried Webers 1817 veröffentlichtem Tonnetz als Verwandtschaft ersten Grades gekennzeichnet und damit sogar als wichtiger charakterisiert als die Verwandtschaft 259 260 Schönberg, Die formbildenden Tendenzen der Harmonie, S. 113. Ebda. 81 zwischen Dur und paralleler Molltonart (vgl. Abbildung 7). Bella Brover-Lubovsky argumentiert, dass diese Doppeldeutigkeit zwischen Dur und Moll auf derselben Stufe bereits bei venezianischen Komponisten des frühen 17. Jahrhunderts eine häufig wiederkehrende Grundkonstellation in der tonalen Anlage von Werken darstellt (z.B. bei Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello und Tomaso Albinoni).261 Insbesondere im 19. Jahrhundert wurden diese (und weitere) Verwandtschaften zwischen Dur und Moll teilweise an ihre äußersten Grenzen getrieben, sodass es in manchen Harmoniefolgen kaum möglich ist, ein eindeutiges Klangzentrum auszumachen. Vielmehr scheint die Musik dann zwischen zwei Welten zu schweben und einmal der Dur-Tonika, ein anderes Mal der Moll-Tonika den Vorzug zu geben. Zusätzlich zu den ambivalenten Klangzentren der I. Stufe in Dur und Moll sowie der VI. Stufe in Moll kommen im 19. Jahrhundert noch weitere Klangzentren hinzu, welche die alleinige Vorherrschaft der Tonika zunehmend in Frage stellen. Diese Entwicklung wurde insbesondere durch die häufige Verwendung von mehrdeutigen Akkorden wie dem verminderten Septakkord und dem übermäßigen Dreiklang hervorgerufen. Eine große Anzahl von vorwiegend mediantischen Akkordbeziehungen konnten so als neue Klangzentren der Tonika gegenübergestellt werden. Dies führte direkt zu jenen harmonischen Verläufen, die Schönberg später als „schwebende Tonalität“ bezeichnete. Eine eindeutige Angabe der Tonika als einzigen Bezugsklang ist in solchen Harmoniefolgen weder aus Sicht der Analyse, noch aus Sicht des Hörers möglich bzw. sinnvoll. Es hat fast den Anschein als hätten die soziokulturellen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, die mit der Französischen Revolution die Vorherrschaft des Adels über den Bürger beendeten, auch eine analoge Revolution im hierarchischen System der DurMoll-Tonalität hervorgerufen. Bereits in den Einleitungen zu Beethovens Streichquartetten wird ein eindeutiger Tonikabezug oft bewusst hinausgezögert. Im Streichquartett op. 59/3 werden beispielsweise mehrere Klangzentren angedeutet (G-Dur, a-Moll und Es-Dur), die Tonika C-Dur wird jedoch erst in Takt 43 eindeutig bestätigt (Abbildung 37). Es ist zwar möglich die Harmonik dieser Einleitung funktionstheoretisch in Bezug auf die Tonika zu deuten, dies würde aber wohl kaum der tatsächlichen Wahrnehmung und Erwartungshaltung 261 Bella Brover-Lubovsky, Venetian Clouds and Newtonian Optics, in: Musiktheorie als interdisziplinäres Fach (musik.theorien der gegenwart 4), Saarbrücken: Pfau 2010, in Bearbeitung. 82 des Hörers entsprechen. Selbst wenn man versucht, die ersten neun Takte aus Sicht der Dominante G-Dur zu deuten, wird man nicht der tatsächlichen Wahrnehmungssituation in Takt 11 gerecht, in der sich die vermeintliche Dominante ohne Grundton mit tiefalterierter None (T. 8-10) plötzlich in einen B-Dur-Septakkord verwandelt, der nach Es-Dur weiterleitet. Außerdem deuten die ersten 5 Takte der Einleitung eher auf die Tonart aMoll hin als auf G-Dur und den verminderten Septakkord auf Fis im ersten Takt hört man im Nachhinein eher als einen Vorhalt zum nachfolgenden F7 (das zum übermäßigen Quintsextakkord umgedeutet wird) und nicht als Dominante zu G. Auch den verminderten Septakkord auf H in den Takten 26-28 stellt Beethoven in ein harmonisches Umfeld, das nicht an C-Dur erinnert. Erst mit Beginn des Hauptthemas in T. 30 wird zum ersten Mal C-Dur als Tonart angedeutet und schließlich in T. 43 bestätigt. Doch auch vor dieser Bestätigung zögert Beethoven in Takt 41 C-Dur nochmals hinaus, indem er zunächst einen Dominantseptakkord auf C setzt. Diese Einleitung scheint sich Deutungsversuchen aus Sicht eines einzigen Zentralklangs vehement zu widersetzen. Vielmehr hat es den Anschein als kreise die Harmonik – ganz im Sinne von Schönbergs schwebender Tonalität – kontinuierlich um mehrere Zentralklänge ohne sich dabei eindeutig festzulegen. Dieses Wechselspiel verschiedener Klangzentren ist nicht nur für die Analyse von Bedeutung, auch unsere Wahrnehmung vermag hier kaum einen einzelnen Bezugspunkt festzumachen. 83 Abbildung 37: Beethoven, Streichquartett Nr. 9 op. 59/3, T. 1-44. Ein weiteres Beispiel Beethovens, in dem ein eindeutiger Zentralklang über weite Strecken außer Kraft gesetzt wird, ist die Variation Nr. 20 aus den „Diabelli“ Variationen op. 120 (Abbildung 38). Die Variation beginnt zunächst sehr vorsichtig C-Dur als Tonika zu etablieren. Aus Sicht dieser Tonika handelt es sich bei dem verminderten Septakkord am Ende von Takt 8 um eine Dominante mit tiefalterierter None im Bass. Derselbe Akkordtyp verwandelt sich jedoch plötzlich in der zweiten Hälfte des nächsten Takts in eine „vagierende“ Klangfolge. Durch die Verbindung eines g-MollSeptakkords mit einem Quintsextakkord auf Gis (T. 10-11) und die Verbindung eines verminderten Septakkords auf Ais mit einem C-Dur-Dreiklang (T. 12-13) verschwindet 84 in den Takten 10-13 jeglicher dur-moll-tonale Bezug. Mehr noch, man hat hier fast das Gefühl, als ob der verminderte Septakkord selbst für einen kurzen Augenblick die Rolle eines Klangzentrums eingenommen hat. Der G-Moll-Septakkord in Takt 10 wirkt dabei als ein Spannungsakkord, der sich in einen E-Dur-Septakkord (Gis im Bass) auflöst, das verbindende Element ist jedoch der verminderte Septakkord auf As des vorangegangenen Taktes, der als unterschwelliges Klangzentrum den Gesamtklang beeinflusst. In Takt 14 bereitet Beethoven diesem Spuk zunächst ein Ende, indem er – dem Thema der Variation entsprechend – die Phrase in die Dominantregion auflöst. Abbildung 38: Beethoven Variation Nr. 20 aus Variationen op. 120. Auch der weitere harmonische Verlauf dieser Variation ist sehr auffällig. In den Takten 13-19 wird deutlich, dass die Harmonik einem bestimmten Auflösungsschema folgt: Auf die schwere Taktzeit wird ein dissonanter Akkord gesetzt, der sich in einen weniger dissonanten Akkord auf der leichten Taktzeit auflöst. Die Takte 21-24 setzen dieses Schema fort, allerdings steht nun auf der leichten Taktzeit ein verminderter Septakkord auf E bzw. B und G. Dies bestärkt die vorherige Vermutung, dass der verminderte Septakkord hier als ein Zentralklang behandelt wird. Alle Töne der Takte 21-24 ent- 85 stammen der mit dem verminderten Septakkord eng verwandten Ganzton-HalbtonSkala auf E. Wie zuvor der g-Moll-Septakkord, werden in diesen Takten die Dominantseptakkorde auf C und Es (enharmonisch umgedeutet) in den verminderten Septakkord aufgelöst. Dies wird auch durch die Notation der Vorzeichen in Takt 24 (Dis – E in der Oberstimme) deutlich. Auch im weiteren Verlauf der Variation bleibt ein eindeutiger Tonartbezug aus, bis sich die Harmonik schließlich im letzten Takt nach C-Dur auflöst. Mit der tragenden Rolle des verminderten Septakkordes nimmt Beethoven in dieser Variation viele harmonische Neuerungen der Hochromantik vorweg, wie später nach am Beispiel von Richard Wagners Parsifal zu sehen sein wird. Besonders auffällig ist die Ambivalenz des Klangzentrums insbesondere auch in den späten Klavierstücken von Franz Liszt. Bereits in Funérailles (1849) hatte Liszt die beiden Klangzentren f-Moll und E-Dur fast gleichberechtigt nebeneinander verwendet und dabei die gemeinsame Terz der beiden Akkorde als Bindeglied genutzt.262 Bei La lugubre gondola I (1882) stellt Liszt anstelle der Tonika sogar eine bitonale Mischung zwischen E-Dur und f-Moll. Das erste Intervall der Melodiestimme von La lugubre gondola I deutet f-Moll an, bei den Takten 6-10 handelt es sich jedoch um einen Ausschnitt aus der E-Dur-Tonleiter. Zusammengehalten wird die Melodie durch einen übermäßigen Dreiklang auf E, der mit den beiden Akkorden E-Dur und f-Moll jeweils zwei gemeinsame Töne enthält (Abbildung 39).263 In Unstern! sinistre, disastro (nach 1881), in der Liszt verwandte Techniken anwendet, geht er sogar so weit, dass die Töne von E-Dur und f-Moll zu einem einzigen Klanggemisch vereint werden.264 262 263 264 Vgl. Kleinrath, Kompositionstechniken, S. 46-67. Ebda., S. 21f. Ebda., S. 30. 86 Abbildung 39: Liszt, La lugubre gondola I, Takte 1-22. In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass es in der Musik des 19. Jahrhunderts oft schwierig ist einen eindeutigen Zentralklang festzumachen und auch der Akkordtyp des Zentralklangs ist nicht klar definierbar. So nehmen in der romantischen Literatur anstelle der traditionellen Dreiklänge Dur und Moll auch dissonante Klänge – wie der Dominantseptakkord, der verminderte Septakkord oder der übermäßige Dreiklang – den Platz eines zentralen Bezugspunkts ein. Nun stellt sich die Frage, ob diese dissonanten Klangzentren nur aus systematisch-analytischer bzw. aus kompositionstechnischer Sicht eine Bedeutung haben, oder ob auch unsere Wahrnehmung diese Klänge als zentrale Ruhepunkte akzeptieren kann. Gerade bei Orgelpunkten über einer Dominante oder in Rückführungen einer Sonatensatzform scheint es ganz offensichtlich, dass man als Hörer weiterhin das Bedürfnis nach der Auflösung der Dominante in die Tonika hat und diese Erwartung wird in den allermeisten Fällen auch erfüllt. So gesehen nimmt die Dominante dann zwar eine zentrale Rolle ein, die Tonika schwingt jedoch als unterschwelliger Zentralklang weiterhin mit. Dem gegenüber gibt es jedoch Beispiele, wie 87 einige der späten Klavierwerke Liszts, die darauf hindeuten, dass auch dissonante Klänge durchaus als Klangzentren wahrgenommen werden, die kein zwingendes Auflösungsbedürfnis mehr hervorrufen. Auch die zeitgenössische Musik des 20. Jahrhunderts hat mit der Emanzipation der Dissonanz und des Geräuschs eindrucksvoll bewiesen, dass ein Auflösungsbedürfnis dissonanter Klänge immer nur vom jeweiligen harmonischen bzw. stilistischen Kontext abhängt. Kreneks Aussage, dass der wesentliche Unterschied zwischen Atonalität und Tonalität „die Dominantwirkung [ist], die diese besitzt, die jener fehlt“ (vgl. S. 76) deutet genau auf diesen Zusammenhang hin. In anderen musikalischen Strömungen des 20. Jahrhunderts wiederum, die primär im durmoll-tonalen Kontext verstanden werden – wie beispielsweise dem Blues oder dem Jazz – ist die Tonika sogar meistens ein dissonanter Klang, den unsere Wahrnehmung durchaus als Ruhepunkt zu akzeptieren scheint. 88 2.2 Richard Wagner: Einleitung zu Tristan und Isolde Das Loslösen von der Tonika als harmonisches Klangzentrum fand seinen ersten Höhepunkt in der viel diskutierten Einleitung (bzw. dem „Vorspiel“) zu Richard Wagners Tristan und Isolde. Der so genannte „Tristan-Akkord“ – der dem Tonvorrat eines „halbverminderten Septakkords“265 entspricht – wurde im Laufe der Musikgeschichte unterschiedlichsten Deutungen unterzogen, nicht zuletzt mit dem Wunsch ihn einem vorgegebenen Theoriemodell gefügsam zu machen. Ich werde mich in der vorliegenden Analyse weniger dem Wesen des Tristan-Akkords widmen, sondern vielmehr den unterschiedlichen Klangzentren, die in der Tristan-Einleitung eine Rolle spielen. Abbildung 40: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 1-11. Es ist durchaus möglich in den ersten vier Takten des Tristan (Abbildung 40) a-Moll als zugrunde liegenden Zentralklang anzunehmen, was der am häufigsten anzutreffenden harmonischen Deutung entspricht.266 Die ersten drei Töne könnten dann als eine Um265 266 Ich werde in der vorliegenden Analyse darauf verzichten den Akkordtyp des Tristan-Akkords gemäß einer der vielen Deutungsmöglichkeiten als z.B. „Unterseptimenakkord“ (Martin Vogel, Der TristanAkkord und die Krise der modernen Harmonielehre, Düsseldorf: Gesellschaft zur Förderung der systematischen Musikwissenschaft 1962, S. 140) oder „Doppelleittonklang“ (Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik, S. 51 u. S. 162) , zu bezeichnen. Jegliche Akkordbezeichnungen sind in weiterer Folge als eine Bezeichnung des abstrakten Tonvorrats im Sinne eines pitch sets zu verstehen und werden jeweils nach dem Grundton der Terzenschichtung oder, bei äquidistanten Klängen, nach dem Basston benannt; enharmonische Verwechslungen werden für die Benennung des Tonvorrates ignoriert. Der Autor geht davon aus, dass der Leser anhand des Notentextes versteht um welche konkreten Klänge es sich während der Diskussion handelt. Vgl. unter anderem: Vogel, Der Tristan-Akkord, S. 140; Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik, S. 51 u. S. 162; Ernst Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“, Berlin: Max Hessels 1920, S. 44. Für weiterer Interpretationen des Tristan-Akkords vgl. auch Diether 89 spielung von a-Moll ohne Terz angesehen werden und die erste Phrase würde in Takt 3 auf der Dominante von a-Moll – E7 – schließen. Gegen diese Interpretation spricht allerdings, dass in a-Moll während des gesamten Vorspiels kein einziges Mal kadenziert wird. A-Dur kommt in der Einleitung zwar vor, jedoch erst in Takt 24 und dort nur für die kurze Dauer einer punktierten Viertel innerhalb eines harmonischen Kontexts, der eher E-Dur vermuten lässt. Der Hörer wird zu diesem Zeitpunkt den A-Dur-Dreiklang wohl kaum mehr mit dem E-Dur-Septakkord aus Takt 4 (bzw. T. 16) in Verbindung bringen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass der geschulte Hörer, der die romantische Musik vor dem Tristan gut kennt, nach den ersten vier Takten zunächst einmal von der Tonika a-Moll ausgeht. Dies ändert sich jedoch schlagartig in den Takten 5-7, mit der leicht veränderten realen Sequenz der ersten drei Takte um eine kleine Terz höher. Würde man der vorherigen Argumentation weiter folgen, dann müsste man Takt 7 als Dominante nach C hören. Auf C-Dur würde die Nähe zur vorangegangenen Tonart aMoll hindeuten, c-Moll könnte dagegen wegen des Tons Gis/As der Takte 5-6 nahe liegen. In den Takten 8-11 wird die erste Phrase ein drittes Mal (diesmal stärker abgeändert) variiert. Takt 10 könnte man aus Sicht von C-Dur als einen Vorhalt zu einem übermäßigen Dreiklang auf C deuten (Abbildung 41), der in Takt 11 zu einem Dominantseptakkord auf H weitergeführt wird. Damit wäre die Tonika der Takte 10-11 EDur oder e-Moll. A5+)R -: -: -: -: - -)* - - E§ Abbildung 41: Tristan-Vorspiel, T. 10, gedeutet als Tonika mit übermäßiger Quint. Der einzige Zentralklang, der aus Sicht der Funktionstheorie in diesen ersten Takten wenigstens annähernd bestätigt wurde, ist C-Dur. Dafür spricht einerseits die Nähe zum anfänglichen a-Moll, andererseits die Quasi-Auflösung in einen übermäßigen Dreiklang de la Motte, Harmonielehre [1976], München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Bärenreiter 91995, S. 225-228. 90 auf C in Takt 10. C-Dur wird als Zentralklang in den folgenden Takten (T. 17-20) sogar bestätigt und in ganz traditionellen harmonischen Wendungen vier Takte lang ausgekostet. Außerdem wird zum Schluss der Einleitung die Anfangsphrase mit einem Orgelpunkt auf G in die Tonart c-Moll umgedeutet (Abbildung 42, T. 100-106), auf deren Dominante das Tristan-Vorspiel schließlich endet. Abbildung 42: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 100-111. Unsere Wahrnehmung scheint dieser Interpretation jedoch nicht exakt zu folgen. Zwar ist es denkbar den 3. Takt als Dominante in a-Moll zu hören, ob man jedoch tatsächlich in den folgenden Takten mit jedem neuen Dominantseptakkord einen Wechsel des Zentrums nach C und schließlich nach E wahrnimmt, obwohl weder a-Moll noch C-Dur eindeutig bestätigt wurde, ist zu bezweifeln. Spätestens nach dem 7. Takt hat sich unsere Wahrnehmung darauf eingestellt, dass ihre Erwartung bislang nicht erfüllt wurde. Außerdem nehmen die Dominantseptakkorde E7, G7 und H7 in diesem harmonischen Umfeld einen sehr stabilen Platz ein, der gar keiner zwingenden Auflösung bedarf. Dieser Effekt entsteht dadurch, dass die Dominantseptakkorde hier, im Verhältnis zu dem Tristan-Akkord, die „konsonanteren“ Klänge darstellen. Diese in sich ruhende Dominantwirkung wird auch noch durch die Auflösung der übermäßigen Quart (Ais) in die Quint (H) des Zielakkords verstärkt. Dies ist durchaus vergleichbar mit der Auflösung des G-Moll-Septakkords in den Quintsextakkord auf Gis in Beethovens „Diabelli“-Variation Nr. 20 (vgl. Abbildung 38). Ernst Kurth schreibt über die besagte Stelle der Tristan-Einleitung: 91 Ein weiteres technisches Merkmal tritt schon bei dieser ersten Akkordverbindung des „Tristan“ hervor; nämlich die eigentümliche Erscheinung, daß (mit dem zweiten Akkord) ein Septakkord nach der vorangehenden Alterationsdissonanz als Auflösungsform eintritt, und zwar auch der Wirkung nach als eine Auflösung, die sich hier einem konsonanten Klangeindruck nähert.267 Die Dominantseptakkorde nehmen hier demnach auf mikroformaler Ebene die Rolle von Klangzentren ein. Betrachtet man den formalen Ablauf der ersten 16 Takte unter diesem Gesichtspunkt, so sieht man, dass sich neben den Klangzentren C-Dur und aMoll auch ein weiteres Klangzentrum auf E etabliert. Die Akkordfolge der Dominantseptakkorde – E7, G7, H7, E7 – kann dann als eine Art „Kadenz“ bezogen auf das Klangzentrum E gedeutet werden. Bevor ich auf die Harmonik dieser ersten 16 Takte in Bezug auf das Klangzentrum E genauer eingehe, möchte ich nochmals einen kurzen Exkurs zu Franz Liszt machen. Wie angedeutet finden sich in Liszts Spätwerk häufig Stellen, die sich auf die beiden Klangzentren der I. Stufe (E-Dur) und der tiefalterierten II. Stufe (f-Moll) beziehen268 (vgl. S. 86). Als Bindeglied zwischen diesen beiden Klangzentren verwendet Liszt meist den übermäßigen Dreiklang auf E (Abbildung 43a) sowie den verminderten Dreiklang auf F (Abbildung 43b). Eine weitere Variante zur Verbindung von E-Dur und f-Moll, die Liszt vorwiegend im Klavierstück Funérailles einsetzt, ist das Umdeuten der Dominante von f-Moll zu einem übermäßigen Dreiklang auf C, der wiederum dem übermäßigen Dreiklang auf E entspricht (Abbildung 43c). In diesem Zusammenhang verwendet Liszt auch eine direkte Verbindung zwischen dem Dominantseptakkord auf C und dem Dur-Dreiklang auf E, die man aus Sicht von f-Moll als einen erweiterten Trugschluss auffassen könnte (Abbildung 43d).269 267 268 269 Kurth, Romantische Harmonik, S. 47. Kurth führt diese ruhende Wirkung des Dominantseptakkords auf seine Terzenschichtung zurück: „das Ohr [fasst] die Rückkehr des musikalischen Gewebes in einen auf Terzlagerung zurückzuführenden Akkord als Einrenkung in ein von der Natur vorgezeichnetes System und als Ruhepunkt im musikalischen Kräftespiel [auf …].“ (Vgl. Ernst Kurth, Die Voraussetzungen der Theoretischen Harmonik, Bern: Max Drechsel 1913). Nachdem beide Klangzentren oft in gleichem Maße betont werden könnte man umgekehrt auch von der I. Stufe f-Moll und der erhöhten VII. Stufe E-Dur sprechen. Die Problematik der exakten Bezeichnung spiegelt gewissermaßen unsere mangelhafte Symbolschrift für multiple Klangzentren wider, da sowohl Stufentheorie als auch Funktionstheorie von einem einzigen Klangzentrum ausgehen. Im Zusammenhang mit mehreren Klangzentren wäre es vielleicht ratsam die übliche Stufenbezeichnung fallen zu lassen und statt dessen nur Akkordbezeichnungen wie z.B. „E/Fm“ zu verwenden. In der Jazztheorie gibt es beispielsweise für polytonale Akkorde verschiedene Bezeichnungsmöglichkeiten, bei der insbesondere die Bezeichnung mittels eines schrägen oder horizontalen Balkens zwischen den beiden Akkorden sinnvoll erscheint. Vgl. dazu auch Kleinrath, Kompositionstechniken, S. 60ff. 92 Abbildung 43: Harmonische Zusammenhänge zwischen E-Dur und f-Moll. Besonders deutlich treten diese Beziehungen in den Takten 21-25 von Liszts oben erwähntem Klavierstück Unstern! zum Vorschein (Abbildung 44). In Takt 22 würde der Hörer hier – mit dem hinzugefügten F im Bass – als Zentralklang wahrscheinlich f-Moll annehmen, in den Takten 23-25 kommt es jedoch zu einer Umspielung eines übermäßigen Dreiklangs auf E. Strukturell gesehen vereint diese Stelle sowohl die Charakteristik von E-Übermäßig als auch von F-Vermindert. Abbildung 44: Liszt, Unstern!, Takte 21-25. Die Beziehung der beiden Zentralklänge auf C und E in der Einleitung zu Wagners Tristan sind den Beziehungen zwischen E-Dur und f-Moll bei Liszt nicht unähnlich. So ist die Tonart C-Dur als Dominante zu f-Moll in dem oben vorgestellten Schema sogar implizit vorhanden (vgl. Abbildung 43d). Die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen C-Dur und E-Dur sind zum Vergleich in Abbildung 45 dargestellt. E-Dur hat mit C-Dur einen gemeinsamen Ton E, der jeweils der Grundton bzw. die Terz der Akkorde ist. Direkt sind die beiden Akkorde über den übermäßigen Dreiklang auf C bzw. E verbunden, mit dem beide Klänge jeweils zwei gemeinsame Töne teilen. Indirekt besteht auch noch eine Verbindung über F-Vermindert, das aus Sicht von C-Dur als Dominantseptnonenakkord ohne Grundton und Quinte gedeutet werden kann. 93 Abbildung 45: Harmonische Zusammenhänge zwischen C-Dur und E-Dur. Unter diesen Gesichtspunkten kann der Tristan-Akkord in Takt 2 wenigsten auf drei verschiedene Weisen gedeutet werden: aus Sicht der Klangzentren a-Moll bzw. C-Dur und aus Sicht des Klangzentrums E-Dur. Im ersten Fall könnte man den Tristan-Akkord als Vorhalt zu einem übermäßigen Terzquartakkord deuten, also doppeldominantisch zu a-Moll (Abbildung 46 links) oder dominantisch zu C-Dur. Die Deutung in a-Moll könnte man als die traditionelle funktionstheoretische Erklärung des Tristan-Akkords ansehen.270 Dem zufolge müsste man den Melodieschritt Gis–A als eine Bewegung von der Sext zur Sept hören – das entspricht aber kaum der tatsächlichen Wahrnehmungssituation. Aus Sicht des Klangzentrums E-Dur ergibt sich dagegen ein etwas anderes Bild. Der halbverminderte Septakkord auf F hat wie der verminderte Dreiklang auf F (vgl. Abbildung 45) zwei gemeinsame Töne mit E-Dur (Gis und H), eine umständliche Deutung aus Sicht der Dominante ist also gar nicht unbedingt notwendig. Statt dessen könnte man den halbverminderten Septakkord auf F bereits als einen direkten Vorhalt zur Tonika E-Dur deuten (Abbildung 46 rechts).271 Die Melodielinie Gis–A–Ais–H wäre dann einfach ein Durchgang von der Terz zur Quint des Zentralklanges E-Dur und die kleine Sept könnte als zusätzliche Farbe des Zielklanges bewertet werden. F& : / 5ö D7 Y7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 2ö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Abbildung 46: Tristan-Akkord aus Sicht von a-Moll (links) und aus Sicht von E-Dur (rechts). 270 271 Vgl. Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik, S. 162. Erpf bezeichnet diese Beziehung als Doppelleittonklang da die Prim durch zwei Leittöne erreicht wird (vgl. Ebda., S. 51 u. S. 162.). 94 Jedoch entspricht auch diese Interpretation nicht in jeder Hinsicht unserer Wahrnehmung der ersten Takte des Tristan. Vielmehr scheint es eher so zu sein, dass wir eine Kombination beider genannten Varianten hören und sich insofern auch alle Akkorde – a-Moll, C-Dur und E-Dur – neben einander als Klangzentren etablieren. Die oben erwähnte Beziehung zwischen C-Dur und E-Dur über den verminderten Dreiklang auf F (vgl. Abbildung 45) ist es auch, die zum Schluss des Vorspiels die Interpretation der Anfangstakte in c-Moll ermöglicht (vgl. Abbildung 42). Für die weiteren Takte ergibt sich, unter Bezug auf die beiden Zentralklänge C-Dur und E-Dur folgendes Bild: Der Tristan-Akkord in Takt 6 (As-Halbvermindert) dient als Bindeglied zwischen dem in Takt 3 erreichten Zentralklang E7 und der Dominante G7 des zweiten Zentralklangs C, in den sich die zweite Phrase in Takt 7 auflöst (Abbildung 47 links). Der halbverminderte Septakkord auf As fügt dem Zentralklang E7 dabei lediglich die große None hinzu (Abbildung 47 rechts) und hat mit dem nachfolgenden G7 wiederum die Terz und die Quint gemeinsam. Der erreichte Dominantseptakkord auf G kann auf formaler Ebene als ein vorübergehender Zentralklang zwischen den Klängen E7 und H7 angesehen werden. A(E-Dur) 3ö Y2(E-Dur) D(C-Dur) Abbildung 47: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 5-8 (links); Verbindung zwischen E7 und dem halbverminderten Septakkord auf Gis. Der halbverminderte Sekundakkord in Takt 10 stellt entsprechend der Interpretation in Abbildung 41 einen Vorhalt zu einem übermäßigen Dreiklang auf C dar. Dieser Dreiklang steht zu den Zentralklängen C-Dur und E-Dur im selben Verhältnis und enthält von beiden Klängen den Grundton sowie die Terz (vgl. Abbildung 45). Die Verbindung zur nachfolgenden Dominante von E könnte man dem entsprechend wiederum aus Sicht beider Zentralklänge deuten. In Takt 16 wird H7 schließlich in den Zentralklang E7 aufgelöst, der aber sofort zur Subdominante von C-Dur (T. 17) weitergeführt wird. 95 Das darauf folgende prägnante Thema (Abbildung 48, T. 17-22, „Motiv der Blickbegegnung“), das vom Klangzentrum C-Dur in die Region der Subdominantparallele dMoll moduliert (T. 22), ist für den weiteren harmonischen Verlauf des Vorspiels von wesentlicher Bedeutung. Zunächst bestätigen diese Takte den Zentralklang C-Dur, in den darauf folgenden Takten 23-29 wird jedoch als Ausgleich sofort wieder E-Dur in das Zentrum gerückt (bzw. in T. 28f die Dominante zu E-Dur). Auch der Zentralklang a-Moll gewinnt durch die Ausweichung zur Subdominante d-Moll (T. 22) wieder implizit an Bedeutung. Abbildung 48: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 17-29. Nach zwei Takten Überleitung (T. 30f) erklingt dieses Thema ein zweites Mal in C-Dur, allerdings in einer Variation und mit leicht veränderter Harmonisierung (Abbildung 49, T. 33-36). Interessant ist, dass Wagner nun auch den Zentralklang C-Dur ganz offen als Dominantseptakkord ohne Auflösung einsetzt. Zunächst in Takt 35 als Vorbereitung des anschließenden g-Moll-Dreiklangs und schließlich auch in Takt 37f als Abschluss der Phrase. Takt 41f endet abermals auf der Dominante des zweiten Zentralklang E-Dur, der in Takt 46 auch bestätigt wird. 96 Abbildung 49: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 32-42. In den Takten 55-63 tritt das Thema schließlich zweimal hintereinander auf, wobei mit den beiden neuen Themenvarianten wiederum die beiden Klangzentren C-Dur und EDur einander gegenübergestellt werden (Abbildung 50). In den Takten 55-58 steht das Thema zunächst in E-Dur und ist dabei um einen halben Takt verschoben. In Takt 58 moduliert das Thema jedoch nicht wie gewohnt zur Subdominantparallele fis-Moll, sondern endet mit einem Trugschluss auf einem D-Dur-Dreiklang in erster Umkehrung. Dieser leitet als Doppeldominante in die zweite Themenvariante über, die nun in C-Dur erscheint (59-62). In Takt 62 wird das Thema dann ein weiteres Mal nach E-Dur weitergeführt und in dieser Tonart endet der Abschnitt schließlich. Es folgt ein ausgedehnter Orgelpunkt über dem Klangzentrum E7 in den Takten 63-70, der mit der Akkordfolge E7–G7–H7–E7 der Einleitung beendet wird (T. 70-73). 97 Abbildung 50: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 55-63. Eine weitere sehr interessant Stelle in Bezug auf das Klangzentrum sind die Takte 7883. Hier wird zunächst in den Takten 78f ein halbverminderter Septakkord auf C umspielt, der in Takt 79 über den Dominantseptakkord B7 zu einem halbverminderten Septakkord auf F weitergeleitet wird. Man könnte hier im ersten Moment vermuten, dass das Klangzentrum es-Moll ist, dies wird jedoch zu keinem Zeitpunkt bestätigt. Statt dessen scheint es in den folgenden 4 Takten fast, als würde der halbverminderte Septakkord, der enharmonisch umgedeutet dem Tristan-Akkord aus Takt 2 entspricht, für kurze Zeit selbst zu einem eigenständigen Klangzentrum werden (Abbildung 51). Besonders auffällig ist dabei auch, dass in Takt 80 ein E-Dur-Dreiklang enharmonisch umgedeutet und nun auf den halbverminderten Septakkord auf F bezogen wird (Ces– As–E, 6. Achtel). Dies suggeriert, dass Wagner den hohen Verwandtschatftsgrad dieser beiden Akkorde bewusst ausgenutzt hat, um unterschiedlichste harmonische Beziehungen zu erzeugen. In Takt 83 wird der Tristan-Akkord wieder in seine ursprüngliche Gestalt umgedeutet und löst sich dem Beginn entsprechend in den Dominantseptakkord E7 auf (T. 84). Damit erfüllen die Takte 80-83 gewissermaßen auch die Funktion eines Auftaktakkords zu dem Zentralklang E7. 98 Abbildung 51: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 80-84. Am Beispiel der Tristan-Einleitung konnte gezeigt werden, dass die Annahme mehrerer Klangzentren in romantischer Musik aus analytischer Sicht durchaus eine Berechtigung hat. Ob Wagner tatsächlich sowohl E-Dur als auch C-Dur als Zentralklänge konzipiert bzw. komponiert hat, ist eine Frage, die sich nur schwer beantworten lässt – es gibt in der Tristan-Einleitung jedoch auf mikro- und makroformaler Ebene mehrere Anzeichen die darauf hindeuten. Durch die besondere Behandlung des Dominantseptakkords sowie des halbverminderten Septakkords ist diese Einleitung auch ein Beispiel dafür, dass ursprünglich dissonante Klänge in der Spätromantik zunehmend als eigenständige und stabile Klangzentren eingesetzt wurden. In der Entwicklung der europäischen Musikgeschichte kann dies als Vorläufer für komplexere Klangzentren angesehen werden, wie sie später zum Beispiel von Skrjabin, Bartók oder Schönberg eingesetzt wurden. 99 2.3 Richard Wagner: Parsifal, Vorspiel zum dritten Akt Im Vorspiel zum dritten Akt des Parsifal führt Wagner die Techniken des TristanVorspiels weiter. Diesmal steht jedoch nicht ein Dominantseptakkord als Zentralklang im Vordergrund, sondern ein verminderter Septakkord. Der verminderte Septakkord hat hier als Klangzentrum auch eine tonsymbolische Bedeutung. Das Vorspiel stellt Parsifals Irrfahrt dar und es gibt wohl keinen Klang, der innerhalb der Dur-Moll-Harmonik eine harmonische Irrfahrt besser ausdrücken könnte, als der verminderte Septakkord; von dem aus in praktisch alle Tonarten moduliert werden kann, der dabei jedoch keine Tonart in besonderer Weise hervorhebt. In den ersten vier Takten des Vorspiels (Abbildung 52) könnte man – den Vorzeichen entsprechend – als Klangzentrum zunächst b-Moll vermuten. Dafür spricht, dass die ersten drei Töne (B–F–Des) eine Zerlegung eines b-Moll-Dreiklangs sind und dass ein b-Moll-Dreiklang in erster Umkehrung die letzte Viertel im zweiten Takt bildet. Auch der dritte Takt ließe sich aus Sicht von b-Moll sehr gut deuten. Der es-Moll-Sextakkord ohne Quint auf der dritten Viertel dieses Taktes wäre dann eine Subdominante, die auf der vierten Viertel in die Dominante F7 mit Quartvorhalt mündet. Diese offensichtlichen Bezüge zu b-Moll werden jedoch immer wieder durch verminderte Septakkorde eingetrübt. Im zweiten Takt auf der zweiten Viertel sowie zu Beginn des dritten Takts klingt jeweils ein verminderter Septakkord auf G, der sich aus Sicht von b-Moll nur schwer erklären lässt. Auf der zweiten Viertel des vierten Taktes klingt ein verminderter Septakkord auf Ges, der sich in b-Moll immerhin als Dominante ohne Grundton deuten ließe. Allerdings wäre dann die Weiterführung dieses Klangs in den verminderten Septakkord auf D (T. 4, 4. Viertel) sehr ungewöhnlich. 100 Abbildung 52: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4. Abbildung 53 zeigt eine harmonische Reduktion dieser Takte mit hinzugefügten Akkordsymbolen, in denen die verminderten Septakkorde hervorgehoben wurden. Die harmonischen Beziehungen, die Wagner in diesen vier Takten vorstellt, sind bis auf wenige Ausnahmen für den gesamten weiteren Verlauf des Vorspiels grundlegend und kehren in den unterschiedlichsten Varianten wieder. Abbildung 53: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4; harmonische Reduktion. Bevor ich mich der Analyse dieses Vorspiels im Detail widme, diskutiere ich zunächst einige harmonische Eigenschaften des verminderten Septakkords, die für die weitere Harmonik des Vorspiels wesentlich sind. Die wohl grundlegendste Eigenschaft des verminderten Septakkords ist, dass er wie der übermäßige Dreiklang ein äquidistanter Akkord ist, der die Oktave in vier gleiche Teile teilt. Dem entsprechend gibt es – bezogen auf den Tonvorrat – nur drei unterschiedliche verminderte Septakkorde. Daraus ergibt sich, dass jeder verminderte Septakkord zu den beiden anderen jeweils im Abstand einer kleinen Sekund steht. Wenn man den verminderten Septakkord als Klangzentrum annimmt, dann können also streng genommen nur drei dieser Klangzentren mit unterschiedlichem Tonvorrat während eines Werks verwendet werden (sofern man von 101 einer gleichstufigen zwölftönigen Stimmung ausgeht). Die „Modulation“ von einem verminderten Septakkord in einen anderen kann also einfach durch eine harmonische Rückung des Zentralklangs um eine kleine Sekund geschehen. Diese Akkordketten aus verminderten Septakkorden sind seit dem Barock üblich und wurden auch von Franz Liszt gerne eingesetzt, wie beispielsweise im Klavierstück La lugubre gondola II.272 Dabei ist die traditionelle Variante das Verschieben eines verminderten Septakkords um eine kleine Sekund nach unten (aus funktionstheoretischer Sicht eine Dominantbeziehung273), aber auch das Verschieben um eine kleine Sekund nach oben ist durchaus üblich (vgl. z.B. J. S. Bachs Chromatische Fantasie und Fuge BWV 903, T. 34; Abbildung 58 weiter unten). Genau diese Art der harmonischen Rückung findet sich im Prinzip auch in den Takten 3-4 des hier behandelten Parsifal-Vorspiels, allerdings wird die harmonische Folge G°–Ges°–F° (D im Bass) durch die umgebenden Harmonien überdeckt. In diesen beiden Takten erklingt damit also auch der gesamte Tonvorrat der Zwölftonleiter. Eine weitere Eigenschaft des verminderten Septakkords die sich aus den bisherigen Eigenschaften ergibt ist, dass jeder Ton der restlichen Zwölftonskala als eine direkte Nebennote des verminderten Septakkords angesehen werden kann. Der verminderte Septakkord ist tatsächlich der einzige Akkord, bei dem jeder akkordfremde Ton der Zwölftonskala von einem Akkordton genau eine kleine Sekunde entfernt ist. Abbildung 54 zeigt die verschiedenen Stufen des verminderten Septakkords auf C und verdeutlicht damit auch diesen Zusammenhang: Jede akkordfremde Stufe kann chromatisch in einen Akkordton weitergeleitet werden. Ich werde im Folgenden Stufenbezeichnungen bezogen auf den verminderten Septakkord gemäß Abbildung 54 benennen. Dabei bezeichnen die Stufen I, III, V und VII die Akkordtöne des verminderten Septakkords und die Stufen II, IV, VI und VIII die akkordfremden Töne. Akkordfremde Töne werden immer mit einem Vorzeichen (Kreuz und B) versehen um ihre chromatische Nähe zu einem der Akkordtöne zu kennzeichnen. 272 273 Vgl. Kleinrath, Kompositionstechniken, S. 11f. Der verminderte Septakkord entspricht dann einer Dominante ohne Grundton mit tiefalterierter None und Sept im Bass. Die Sept löst sich dabei um eine kleine Sekund nach unten in die Terz des nächsten Akkords auf, bei dem es sich wiederum um eine Dominante ohne Grundton und tiefalterierter None handelt, diesmal jedoch mit der Terz als Basston. 102 Abbildung 54: Die Stufen des verminderten Septakkords. Die oktatonischen Skalen, die mit dem verminderten Septakkord in einer engen Beziehung stehen, können auch als Durchgänge dieses Akkords angesehen werden. Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 55 dargestellt. Dabei entspricht Abbildung 55a der Ganzton-Halbton-Skala und Abbildung 55b der Halbton-Ganzton-Skala auf C. Abbildung 55: Oktatonische Skalen als Durchgänge eines verminderten Septakkords. Wenn der verminderte Septakkord das harmonische Klangzentrum darstellt, dann können seine Nebennoten nicht nur als Durchgänge angesehen werden, sondern auch als Vorhalte. Wiederum ist dabei jede Nebennote chromatischer Vorhalt eines Akkordtons. Abbildung 56 zeigt die möglichen chromatischen Vorhalte zu einem verminderten Septakkord auf C. Die Akkordtypen, die auf den Vorhaltstönen entstehen, sind dabei halbverminderte Septakkorde (Abbildung 56a) und Dominantseptakkorde (Abbildung 56b), die in Kleinterzbeziehungen sowie im Tritonusabstand zu einander stehen. Die Grundtöne dieser Septakkorde ergeben damit wiederum den Tonvorrat eines verminderten Septakkords (im Falle der Dominantseptakkorde H–D–F–A). 103 Abbildung 56: Chromatische Vorhalte zum verminderten Septakkord. Die Auflösung des halbverminderten Septakkords im vierten Takt von Abbildung 56a (CØ7 _ Cº7) entspricht im Wesentlichen der ersten Auflösung des Tristan-Akkords im Tristan-Vorspiel, mit dem Unterschied, dass sich der halbverminderte Septakkord dort in einen Dominantseptakkord auflöst, der Basston also ebenfalls chromatisch nach unten weitergeführt wird (FØ7 _ E7). Abbildung 57 verdeutlicht diesen Zusammenhang: die Stimmführung der Tristan-Auflösung wurde dort in zwei separate Schritte aufgeteilt, die über den verminderten Septakkord verbunden sind. Auch J. S. Bach verwendet bereits vergleichbare Durchgänge und Vorhalte zum verminderten Septakkord. Abbildung 58 zeigt die Takte 32-35 aus Bachs Chromatische Fantasie und Fuge in dMoll BWV 903. Der Dominantseptakkord auf D (Terz im Bass) in Takt 32 (3. Viertel) entspricht dabei der Beziehung des zweiten Takts von Abbildung 56b und kann als Durchgangsakkord des verminderten Septakkords auf Fis gedeutet werden. Der anschließende Dominantseptakkord auf H (Terz im Bass) entspricht dem ersten Takt von Abbildung 56b und löst sich diesmal in einen verminderten Septakkord auf Dis auf. Die in Abbildung 56 dargestellten Akkordbeziehungen entsprechen auch den „Tower Powers“ von Jack Douthett und Peter Steinbach (vgl. Abbildung 20). Abbildung 57: Tristan-Auflösung über den verminderten Septakkord. 104 Abbildung 58: J. S. Bach, Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll BWV 903, T. 32-35. Eine weitere Möglichkeit diese Vorhalte zu harmonisieren besteht darin, dass die Vorhalte nicht als Septakkorde gesetzt werden, sondern als Dreiklänge. Dabei wird der Vorhaltston verdoppelt und um eine große Sekund in umgekehrter Richtung zum eigentlichen Vorhaltston aufgelöst. Abbildung 59 zeigt einige Möglichkeiten wie diese doppelten Vorhalte ausgesetzt werden können. Die Dreiklänge, die durch den doppelten Vorhalt gebildet werden, sind Moll- (Abbildung 59a) und Durdreiklänge (Abbildung 59b). Abbildung 59: Doppelte chromatische Vorhalte zum verminderten Septakkord. Durch diese recht einfache Systematik erhält man 16 Akkorde, die man direkt auf das Klangzentrum eines verminderten Septakkords beziehen kann. Dabei haben die Dreiklänge jeweils zwei, die Septakkorde drei gemeinsame Töne mit dem Klangzentrum. Erweitert man dies auf die restlichen verminderten Septakkorde, dann lassen sich alle Dur- und Molldreiklänge sowie alle halbverminderten Septakkorde und Dominantseptakkorde auf eines der drei Klangzentren beziehen. Dies liegt in der Struktur des verminderten Septakkords begründet: Jeder beliebige Mehrklang lässt sich chromatisch in die Akkordtöne eines verminderten Septakkords weiterführen. 105 In der folgenden Analyse werde ich untersuchen, wie sich diese Akkordbeziehungen auf die Harmonik des Vorspiels zum 3. Akt des Parsifal auswirken. Gezeigt wurde bereits, dass die Tonart b-Moll in den ersten vier Takten immer wieder durch verminderte Septakkorde in Frage gestellt wird. Wenn wir die genannten Akkordbeziehungen auf den verminderten Septakkord auf G anwenden, dann ergibt sich folgendes Harmonieschema (Abbildung 60). Abbildung 60: Harmonische Beziehungen des verminderten Septakkords auf G. Die Beziehungen zu b-Moll, Ges-Dur, G-Halbvermindert und dem Dominantseptakkord auf Ges sind in dieser Abbildung hervorgehoben, um ihre besondere Bedeutung für das Parsifal-Vorspiel (3. Akt) anzudeuten. Die Harmoniefolge der ersten drei Takte (b-Moll – Ges-Dur – Ges7 – G° – b-Moll – G°; vgl. Abbildung 53) des Vorspiels lässt sich diesem Schema folgend als eine gerichtete Folge ansehen, die das Klangzentrum G° vorbereitet. Abbildung 61 zeigt die harmonischen Beziehungen der ersten vier Takte bezogen auf den verminderten Septakkord. Dabei werden mit den Zahlen die Stufen des verminderten Septakkords (vgl. Abbildung 54) in ähnlicher Weise bezeichnet, wie dies in Riemanns Funktionstheorie bezogen auf die Tonika geschieht. Aus dieser Sicht stellen die ersten beiden Takte einen Vorhalt zum verminderten Septakkord dar, der sich auf der zweiten Viertel des zweiten Taktes auflöst. Besonders interessant ist die zweite Hälfte des dritten Taktes. Dieser kann sowohl aus Sicht von G° als auch aus Sicht des nachfolgenden Ges° gedeutet werden und wird somit als harmonisches Bindeglied zwischen G° und Ges° genutzt. Die melodische Linie der Oberstimme (b–c1–es1–des1) ist – bezogen auf G° – eine Umspielung der Quint, bereitet jedoch das Klangzentrum Ges° bereits vor: Der zugrunde liegende es-Moll-Sextakkord ohne Quint auf der dritten 106 Viertel dieses Taktes nimmt aus Sicht von Ges° die gleiche Funktion ein wie der bMoll-Dreiklang in G°. Die Auflösung des F7 nach Ges° im vierten Takt (#8–1) entspricht der Auflösung von Ges7 nach G° im zweiten Takt. Den verminderten Septakkord auf D habe ich, dem Tonvorrat entsprechend, in einen verminderten Septakkord auf F umgedeutet, um so den harmonischen Verlauf in kleinen Sekunden deutlicher darzustellen (Gº – Gbº – Fº). Auch im weiteren Verlauf der Analyse werde ich versuchen verminderte Septakkorde nicht nur gemäß ihrem tatsächlichen Grundton zu deuten, sondern auch gemäß ihrer strukturellen und formalen Funktion. Abbildung 61: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4; bezogen auf den verminderten Septakkord. Abbildung 62 zeigt den harmonischen Prozess der ersten vier Takte in Form eines gerichteten Graphen. Die Bezeichnungen „+1“ und „-1“ beziehen sich dabei auf den verminderten Septakkord innerhalb desselben Rechtecks und stehen für die chromatische Erhöhung eines Akkordtons („+1“; z.B. b-Moll und G-Halbvermindert aus Sicht von G-Vermindert) bzw. die chromatische Erniedrigung eines Akkordtons (z.B. GesDur oder Ges7 aus Sicht von G-Vermindert). Die Pfeile markieren jene Zustandsänderungen der Akkorde, die in den jeweiligen Takten vorhanden sind. Man erkennt am Graphen deutlich, wie die Umspielung des verminderten Septakkords – und damit auch die dur-moll-tonalen Beziehungen – mit jedem neuen verminderten Septakkord weniger werden, bis in der zweiten Hälfte des vierten Takts nur noch die Auflösung von DHalbvermindert in D-Vermindert überbleibt. Außerdem sieht man, dass die harmonischen Beziehungen in Bezug auf G° am konsequentesten auskomponiert wurden. 107 Start -1 +1 -1 +1 Gbº Gº T. 1-3 T. 3-4 Fº +1 T. 4 Abbildung 62: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4; Graph-Darstellung des harmonischen Prozesses. In ähnlicher Weise wie während des Tristan-Vorspiels werden in diesen ersten Takten des Parsifal-Vorspiels (3. Akt) mehrere Klangzentren etabliert, die nicht nur analytische Konsequenzen fordern, sondern auch unsere Wahrnehmung des Werks nachhaltig beeinflussen. Interessanterweise nimmt jedoch das Klangzentrum b-Moll im weiteren Verlauf des Vorspiels eine relativ unbedeutende Rolle ein. Während der Dominantseptakkord im Tristan-Vorspiel noch der Tonika in mancher Beziehung untergeordnet war, komponiert Wagner den verminderten Septakkord nun mit all seinen Konsequenzen als eigenständiges Klangzentrum. Fast jede Harmoniefolge des Parsifal-Vorspiels lässt sich direkt auf die harmonischen Beziehungen in Abbildung 60 zurückführen und mündet in einen verminderten Septakkord, der ohne jedwede Auflösung als tonaler Bezugspunkt dient. In den Takten 5-12 (Abbildung 63) stehen die verminderten Septakkorde auf D und E/G im Zentrum. Dabei werden die Takte 5-6 in den Takten 7-8 um einen Ganzton höher sequenziert (T. 7) bzw. um einen Halbton höher imitiert (T. 8). Die Dreiklänge gis-Moll und E-Dur in Takt 5 stehen im selben Verhältnis zu F° wie zuvor b-Moll und Ges-Dur zu G°. Dieser Zusammenhang tritt auch in der Sequenz in Takt 8 in Erscheinung, in dem wiederum b-Moll und Ges-Dur (enharmonisch umgedeutet) klingen. Der C-DurDreiklang im fünften Takt leitet die „Tonart“ E°/G° ein und führt damit wieder zum Zentralklang der ersten Takte zurück. Der Dominantseptakkord auf Fis im sechsten Takt 108 ist, vergleichbar mit dem Ges7 in Takt 2, ein Vorhaltsakkord zu E°/G°. Die Auflösung des halbverminderten Septakkords in Takt 7 (b8–7) entspricht dabei der Auflösung in Takt 4 (3. Viertel) und kann wie gesagt als Variante der Tristan-Auflösung angesehen werden. Dieselbe Auflösung wird auch in Takt 10 wieder verwendet und hat im weiteren Verlauf des Vorspiels eine wesentliche motivische Bedeutung. In Takt 12 löst sich die Phrase schließlich erneut nach G° auf, sodass G° als die „Haupttonart“ des Vorspiels vermutet werden kann. Abbildung 64 zeigt wiederum einen gerichteten Graphen dieses Prozesses, bei dem die besondere Bedeutung von G-Vermindert deutlich sichtbar wird. Abbildung 63: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 5-12; harmonische Reduktion. 109 +1 Dº Gº -1 T. 12 T. 8-11 D-Dur Start -1 Dº -1 Gº +1 T. 5 +1 T. 5-8 Abbildung 64: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 5-12; Graph-Darstellung des harmonischen Prozesses. Aus formaler Sicht hat das Parsifal-Vorspiel damit in den Takten 1-12 in gewissem Sinne eine „Kadenz“ über dem verminderten Septakkord auf G durchlaufen, in der auch kurzzeitig in die beiden „Nebentonarten“ Ges° und F° ausgewichen wurde. Takt 12, der in Takt 13 wiederholt wird („Ritt-Motive“ Kundrys; erstmals Beginn des I. Akts), scheint G° als Klangzentrum (Abbildung 65) zu bestätigen. Die Harmonik dieses Taktes wird im weiteren Verlauf des Stückes noch öfters aufgegriffen und lässt die bisher genannten harmonischen Zusammenhänge besonders deutlich erkennen. Der halbverminderte Septakkord auf E sowie der Es-Dur-Dreiklang stehen dabei zu G° im selben Verhältnis wie der Ges-Dur-Dreiklang und der halbverminderte Septakkord auf G (vgl. Abbildung 60). Die Takte 12-13 werden in den Takten 14-15 um einen Halbton höher auf As° sequenziert und in Takt 16 nochmals auf A° und B° (diesmal in einer diminuierten Variante). Takt 17 führt schließlich über den verminderten Septakkord auf As/F wieder zurück zu G° (Abbildung 66). Somit bilden die Takte 12-18 eine weitere „Kadenz“ in G°, diesmal werden die „Nebentonarten“ jedoch in aufsteigenden Sekundenschritten erreicht: G° – As° – A° – B°/G° – As° – G°. 110 Abbildung 65: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 12; harmonische Reduktion. Abbildung 66: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 13-18 (Klavierauszug). In Takt 18 werden deutlich Bezüge zum Klangzentrum e-Moll hergestellt, das wie bMoll in Takt 1 als Nebenklang zu G° aufgefasst werden kann und zu b-Moll im Tritonusverhältnis steht. Auch das Motiv des ersten Taktes wird hier erneut aufgenommen und verarbeitet. Die halbverminderten Septakkorde auf Cis (1. und 2. Viertel) und G (3. Viertel) sind wiederum als Nebenklänge in Bezug auf G° zu deuten. 111 Die Takte 19-21 verarbeiten nochmals die Harmonik aus Takt 12 und leiten in Takt 21 über G° in das „Gralsmotiv“ (Abbildung 67, T. 21-22) über, das zum ersten Mal im Vorspiel scheinbar eindeutige dur-moll-tonale Harmonik in das Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Doch auch die in der ursprünglichen Fassung reine Diatonik des Gralsmotivs ist hier in verminderte Septakkorden eingebettet. So löst sich die Phrase zum Ende von Takt 21 nicht wie erwartet nach Es-Dur auf, sondern wird in einen verminderten Septakkord auf E weitergeführt (T. 22, 1. Viertel). In Takt 23 wird die Sequenzierung des Motivs eine große Sept höher (D-Dur) erneut in einen verminderten Septakkord, dieses Mal auf H, „aufgelöst“. Die hörpsychologische Wirkung des Gralsmotivs im Kontext des verminderten Klangzentrums ist erstaunlich und wirkt hier fast wie ein Besucher eines fremden Sterns. Dies zeigt wie gefestigt die harmonischen Bezüge um den verminderten Septakkord an dieser Stelle bereits sind und dass sich die daraus resultierende musikalische Syntax offensichtlich auch im (Unter-) Bewusstsein des Hörers etabliert hat. Abbildung 67: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 21-24 (Klavierauszug). In den folgenden Takten (Abbildung 68, T. 22-37) wird hauptsächlich das Klangzentrum H° bzw. später As° auskomponiert. Auf großformaler Ebene erfüllt dieser durchführungsartige Abschnitt eine ähnliche Funktion wie ein Auftaktakkord in durmoll-tonaler Musik. Die bisherigen harmonischen Bezüge und Motive werden – hier bezogen auf H° – weiter entwickelt und variiert. Besonders auffällig ist an diesen 112 Takten, dass die Bedeutung des „Nonvorhalts“ zum verminderten Septakkord nun in besonderer Weise akzentuiert wird (in der Abbildung durch vertikale Pfeile markiert). Diese Vorhalte entsprechen dem Vorhalt des halbverminderten Septakkords auf H in Takt 23 (bzw. T. 4, T. 7 und T. 10), mit dem Unterschied, dass der Vorhaltston nun im Akkord bereits enthalten ist. Die Sequenz des „Torenspruch-Motivs“ der Takte 24-27 in den Takten 28-31 führt dazu, dass in den Takten 23-33 „Nonvorhalte“ die strukturelle Basis bilden, welche den Auflösungen der halbverminderten Septakkorde HØ (T. 23), FØ (T. 29) und AbØ (T.30-33) entsprechen. Erst in Takt 34 löst sich diese harmonische Folge schließlich in einen verminderten Septakkord auf As auf. Aus dieser Sicht könnte man diesen Abschnitt als einen ausgedehnten Vorhalt zum verminderten Septakkord ansehen. Dies entspricht der Deutung, dass Wagner hier einen durchführungsartigen Abschnitt im Sinne eines Auftaktakkords komponiert hat, allerdings mit dem Unterschied, dass der Auftaktakkord sich zunächst nach As° und nicht nach G° – dem eigentlichen Klangzentrum des Vorspiels – auflöst (G° erscheint erst wieder in Takt 37). Zudem ist die Ähnlichkeit dieses Abschnitts zu den Takten 79-84 des Tristan-Vorspiels auffällig: Dort wurde der halbverminderte Septakkord als ein Auftaktakkord zum Zentralklang E7 auskomponiert (vgl. Abbildung 51). Die beiden Septakkorde G7 und B7 in Takt 24 und Takt 28 stellen in Bezug auf H° wiederum jene Nebenklänge dar, die im Parsifal-Vorspiel schon zuvor mehrfach Verwendung fanden (vgl. z.B. T. 3, 6 und 9); der Klang Ces–Es–B in Takt 34 ist in entsprechender Weise aus Sicht von As° zu deuten. In Takt 35, kurz vor dem Erreichen des Zentralklangs G°, wird wiederum mit einer Auflösung eines halbverminderten Septakkords (EbØ) nach Bes/A° ausgewichen. Die Takte 35-37 wirken daher wie eine kleine Abschlusskadenz des Abschnitts (T. 24-37) auf As°. An der Notation des FesDur-Dreiklangs in Takt 34 (As-Fes-Ces) erkennt man dabei recht deutlich, dass dieser Klang aus Sicht von As° zu interpretieren ist. 113 Abbildung 68: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 23-37; harmonische Reduktion. Nach der Rückkehr zum Klangzentrum G° in Takt 37 folgt eine „diatonische“ Sequenz in kleinen Terzen, die diesen Zentralklang nochmals als „Haupttonart“ bestätigt (Abbildung 69, T. 39-43). Wagner setzt die harmonischen Beziehungen zwischen dem Dominantseptakkord und dem Moll-Dreiklang zum verminderten Septakkord hier in besonders plakativer Weise aus. Durch die chromatische Gegenbewegung der Stimmen („Motiv der verdorrten Blumen“; Ende von Akt II) lösen sich die Dominantseptakkorde Es7 (T. 39), C7 (T. 41) und A7 (T. 43) über die Molldreiklänge g-Moll, e-Moll und cisMoll alle in den Tonvorrat des verminderten Septakkords auf G auf. Damit hat Wagner im Parsifal-Vorspiel (3. Akt) alle in Abbildung 56 und Abbildung 59 vorgestellten Möglichkeiten der Auflösung zum verminderten Septakkord zumindest einmal verwendet. Das Vorspiel endet schließlich in Takt 45 mit einem halbverminderten Septakkord auf Es. Im anschließenden Teil „Von dorther kam das Stöhnen“ löst Wagner diesen halbverminderten Septakkord – im Sinne des Tristan-Akkords – nach D-Dur auf und schließlich nach d-Moll. 114 Abbildung 69: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 38-48; harmonische Reduktion. Wagner hat im Parsifal-Vorspiel zum dritten Akt die Konsequenzen aus dem TristanVorspiel gezogen und den Zentralklang der Tonika fast vollständig durch einen (ursprünglich) dissonanten Akkordtyp – den verminderten Septakkord – ersetzt. Anders jedoch als in manchen Spätwerken Liszts schafft es Wagner im Pasifal-Vorspiel (3. Akt) durch den geschickten Einsatz von bekannten Akkordtypen – dem Dur- und MollDreiklang, dem Dominantseptakkord und dem halbverminderten Septakkord – weiterhin das Gefühl dur-moll-tonaler Bezüge zu einem gewissen Grad aufrecht zu erhalten. Dennoch etabliert sich das Klangzentrum des verminderten Septakkords in einer Weise, dass Reste der Dur-Moll-Tonalität (wie z.B. das Gralsmotiv in T. 21-22) hier wie Fremdkörper gegenüber der inhärenten musikalischen Syntax erscheinen. 115 2.4 Arnold Schonbergs Frühwerk Arnold Schönberg war einer jener Komponisten, die in ihrer Musik die Dur-MollTonalität an ihre Grenzen trieben und sich in letzter Konsequenz von ihr loslösten.274 Als Schönberg sich 1894 mit den Kompositionen Richard Wagners und Franz Liszts vertraut machte, hatte sich die harmonische Syntax der Dur-Moll-Tonalität bereits zusehends von der Zentrierung auf einen einzelnen Zentralklang entfernt. Der hohe Grad chromatischer Stimmführung, die überschäumende Alterationstechnik sowie der Einsatz von symmetrischen Akkorden und äquidistanten Harmoniefolgen führten dazu, dass die Tonika nicht mehr im selben Maße die wichtige Funktion der formalen Gliederung ausüben konnte wie zuvor. Diese Entwicklung wurde auch durch die zunehmende Emanzipation der Dissonanz verstärkt. Dissonante Vielklänge, die nun auch als harmonische Ruhepunkte Verwendung fanden, stellten die Funktion der Tonika immer mehr in Frage.275 Schönberg war sich der Problematik bewusst und es hat den Anschein, dass er in seinen frühen Werken gezielt versuchte dieser Tendenz entgegenzuwirken. Die Tonika wurde von ihm in Form von Dur- und Moll-Dreiklängen in besonderer Weise akzentuiert, um so im formalen Verlauf „durch eine gewisse Einheitlichkeit eine gewisse Geschlossenheit zu erzielen“ 276. Hans Redlich schrieb über Schönbergs Tonalität: Vergleicht man die Werke seiner ersten Periode mit gleichzeitig entstandenen Werken etwa von Strauß, Reger oder Pfitzner, so fällt vor allem bei Schönberg das starke Gravitieren zum Fundamentalton, die ausgesprochene Tonalitätsfarbe […] auf […]. […] Das Klangspiel in Es zu Anfang der Gurrelieder, das hartnäckige Zurückstreben zum d-Moll des Anfangs im d-Moll Quartett, das eigensinnige lydische E-Dur der Kammersymphonie welches das Werk wie eine Eisenklammer in allen Teilen zusammenhält – wo gibt es bei einem anderen Meister ähnliche Stellen, ja Werke von solcher tonaler Eindeutigkeit, von solcher Überbetonung der fundamentalen Grundstimmung? 277 274 275 276 277 Dazu ist allerdings anzumerken, dass Schönberg in einigen seiner späten Werke, wie beispielsweise der zweiten Kammersymphonie op. 38 wieder zur Tonalität zurückkehrte und dabei einige Techniken der Zwölftonkomposition auch auf tonale Musik anwandte. Vgl. auch Catherine Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies: the crystallization and redescovery of a style, Aldershot: Ashgate 2000, S. 1. Schönberg, Harmonielehre, S. 27. Hans Friedrich Redlich, Schönbergs Tonalität, in: Anrnold Schönberg und seine Orchesterwerke, Wien: Universal Edition 1927, S. 22-24, hier S. 22f. 116 Doch konnte das gezielte Zentrieren auf den Zentralklang der Tonika den Tendenzen der neuen musikalischen Syntax offensichtlich nicht mehr länger entgegenwirken. Über sein zweites Streichquartett op. 10 (1907–1908), das als Wendepunkt den Übergang zur Atonalität kennzeichnet, schreibt Schönberg: Schon im ersten und zweiten Satz kommen Stellen vor, in denen die unabhängige Bewegung der einzelnen Stimmen keine Rücksicht darauf nimmt, ob deren Zusammentreffen in „anerkannten“ Harmonien erfolgt. Dabei ist hier […] eine Tonart an allen Kreuzwegen der formalen Konstruktion deutlich ausgedrückt. Doch konnte die überwältigende Vielheit dissonanter Klänge nicht länger durch gelegentliche Anbringung von solchen tonalen Akkorden ausbalanciert werden, die man gewöhnlich zum Ausdruck einer Tonart verwendet.278 Im Streichsextett Verklärte Nacht op. 4 (1899) finden sich erste Anzeichen dafür, dass es Schönberg immer schwerer fiel, die Tonika als Zentralklang zu festigen. Catherine Dale kommt zu dem Schluss, dass: […] as in [the first chamber symphony] op. 9, Schoenberg was uncertain about the amount of dominant preparation necessary in order to create closure in his tonally expanded style. […] Moreover, the evasion of the dominant and, in particular, its substitution by whole-tone and quartal harmonies […] are anticipated in op. 4 […].279 Die Harmonik des Streichsextetts ist gekennzeichnet durch Passagen dur-moll-tonaler Dezentrierung zugunsten dissonanter Klänge sowie der anschließenden Rückkehr zur Tonika als formalen Bezugspunkt. Die Takte 138-139, die Schönberg selbst als eine Stelle unbestimmbarer Tonalität bezeichnete (vgl. S. 42),280 weisen beispielsweise Gemeinsamkeiten mit der Zentrierung auf einen verminderten Septakkord auf, die bereits in der Harmonik des Parsifal-Vorspiels zum dritten Akt besprochen wurde (vgl. S. 101-106). Abbildung 70 zeigt, dass die Harmonik hier aus Sicht der verminderten Septakkorde D° und F° als Nebennoten bzw. Vorhalte gedeutet werden kann (die Zahlen beziehen sich dabei wie zuvor bei den Parsifal-Analysen auf die Stufen des verminderten Septakkords; vgl. dazu Seite 102 sowie Abbildung 54). Insofern ist tatsächlich die Dur-Moll-Tonalität dieser Takte unbestimmbar, da das Klangzentrum nicht einen Dur- oder Moll-Dreiklang, sondern einen verminderten Septakkord darstellt. 278 279 280 Schönberg, Rückblick, S. 437. Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 6. Schönberg, Rückblick, S. 437. 117 Abbildung 70: Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, T. 137-140; Klavier-Reduktion. Auch der formale Zusammenhang wird in der Verklärten Nacht nicht mehr ausschließlich über die Tonika hergestellt. Statt dessen verwendet Schönberg einen Dominantseptnonenakkord mit der None im Bass, um die formale Gliederung hervorzuheben. Theodor W. Adorno schrieb: Dieser wechselnder Auflösungen fähige Akkord erscheint in der „Verklärten Nacht“ wiederholt, und zwar an entscheidenden Einschnitten der Form, absichtsvoll anorganisch. Er bewirkt Zäsuren im Idiom. Ähnlich verfährt dann Schönberg in der Ersten Kammersymphonie mit dem berühmt gewordenen, ebenfalls in der traditionellen Harmonielehre nicht verzeichneten Quartenakkord. Er wird zur Leitharmonie und markiert alle wichtigen Einschnitte und Verklammerungen der großen Form.281 Schönberg sah bekanntlich symmetrische Klänge wie den übermäßigen Dreiklang den Quartenakkord oder den sechsstimmigen Ganztonakkord, als Alterationen der Dominante an. In seiner Harmonielehre löste er diese Klänge konsequent in andere Klänge auf bzw. führte sie in andere Klänge weiter. Abbildung 71 zeigt die Auflösung des 281 Theodor W. Adorno, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren, in: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften Bd. 16 (Musikalische Schriften I-III), Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1978, S. 649-664, hier S. 655. 118 Ganztonakkords (links) und des Quartenakkords (rechts); es fällt dabei auf, dass Schönberg den Quartenakkord hier nicht in Toniken, sondern in Dominanten auflöst. Abbildung 71: Auflösung des Ganztonakkords (links) und des Quartenakkords (rechts) nach Schönberg.282 Dennoch sah Schönberg die symmetrischen Akkorde durchaus auch als eigenständige Klänge an.283 Dies wird z.B. an seiner „Auflösung“ eines Quartenakkords in einen Ganztonakkord besonders deutlich. Abbildung 72 zeigt, wie ein Quartenakkord durch die chromatische Stimmenbewegung von drei Stimmen zunächst in einen Ganztonakkord geführt wird und anschließend durch das Weiterführen der übrigen drei Stimmen ein Quartenakkord um eine kleine Sekund tiefer entsteht. Dieses Beispiel weist erneut auf die große Bedeutung der chromatischen Stimmführung für die spättonale Harmonik hin (vgl. auch Schönbergs Orchesterstück Farben op. 16/3; S. 59f). Abbildung 72: Weiterführen eines Quartenakkords in einen Ganztonakkord nach Schönberg.284 Der Dualismus zwischen Tonika und Dominante war in Schönbergs Musik besonders stark ausgeprägt. Schönberg ersetzte die Dominante sukzessive mit symmetrischen Klängen, die als „vagierende“ Akkorde in praktisch jede beliebige Tonart weitergeführt werden können. Dies führt zu einer Dezentrierung der dur-moll-tonalen Tonika in Passagen der Dominante einerseits und zu einer überbetonten Zentrierung der Tonika im Rahmen von Schlusskadenzen andererseits. In der symphonischen Dichtung für 282 283 284 Schönberg, Harmonielehre, S. 469 u. 485. Vgl. Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 12. Schönberg, Harmonielehre, S. 485. 119 Orchester Pelleas und Melisande op. 5 (1902–1903) wurden Ganzton- und Quartenakkorde von Schönberg zum ersten Mal konsequent eingesetzt.285 In seiner Harmonielehre stellt er eine Passage aus Pelleas und Melisande als Beispiel für Ganztonharmonik vor.286 Durch die chromatische Gegenbewegung der Stimmen eines übermäßigen Dreiklangs entsteht auf jeder zweiten Viertel ein Ganztonakkord. Diese Technik ist in gewissem Sinne das Gegenteil von Richard Cohns „maximally smooth cycles“, da keiner der Akkorde einen gemeinsamen Akkordton besitzt. Es handelt sich also um einen „maximally rough cycle“, der auf jeder Viertel den gesamten Tonvorrat einer der beiden Ganztonskalen erklingen lässt. Die Ganztonskala bestimmt den Gesamtklang diese Stelle in einer Weise, dass sie selbst die Funktion eines Klangzentrums einnimmt. Abbildung 73: Schönberg, Pelleas und Melisande op. 5, 3 Takte vor Ziffer 32.287 Schönbergs erste Schaffensperiode kulminierte in der Kammersymphonie op. 9. Es ist bekannt, dass Quarten- und Ganztonakkorde in diesem Werk eine wesentliche Rolle einnehmen und dabei den dur-moll-tonalen Kontext immer wieder in Frage stellen. In der Kammersymphonie folgt Schönberg mit einer Sonatensatzform288 einem klaren durmoll-tonalen Formschema und setzt diesem formale Abschnitte gegenüber, deren Klangzentren auf Quarten- und Ganzton-Harmonik basieren. Dieses Prinzip stellt Schönberg bereits in den einleitenden Takten (Abbildung 74) der Kammersymphonie vor und es bestimmt von da an die gesamte harmonische Syntax. Zuerst wird in den Takten 1-2 ein Quartenakkord gesetzt, der in Takt 3 in einen unvollständigen Ganztonakkord weitergeführt wird. In Takt 4 löst sich dieser in einen F-Dur-Dreiklang auf (aus Sicht von E-Dur die Tonart des neapolitanischen Sextakkords). 285 286 287 288 Vgl. Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 8. Vgl. Schönberg, Harmonielehre, S. 470. Ebda. Vgl. Claus-Steffen Mahnkopf, Gestalt und Stil. Schönbergs Kammersymphonie und ihr Umfeld, Kassel: Bärenreiter 1994, S. 35-46. 120 Abbildung 74: Schönberg, Kammersymphonie op. 9, T. 1-4; Klavierauszug. Anthony Payne schrieb, dass the fact that many such paragraphs end in tonal cadence should not lead us to overemphasize the structural importance of tonality. The absence of key-feeling prior to these terminal points sometimes lends them an arbitrary air, and in theory their punctuating function could be replaced by one of the many referential features, harmonic, melodic or rhythmic.289 Catherine Dale weist in weiterer Folge darauf hin, dass diese weiterweisenden Merkmale („referential features“), bei denen es sich unter anderem um Quarten- und Ganztonakkorde handelt, in Kadenzen nicht nur die Dominante, sondern gelegentlich auch die Tonika ersetzen. Die harmonischen Fortschreitungen basieren dabei auf dem Prinzip der stufenweisen Stimmführung.290 Das Quartenmotiv der Takte 4-6 stellt eine Horizontalisierung des Quartenakkords dar und wird in Takt 6-7 wieder der Ganztonharmonik gegenübergestellt. Takt 8 leitet die Kadenzierung in E-Dur (T. 9-10) über einen verminderten Septakkord auf A ein, der hier als Dominante mit Sept im Bass zu deuten ist. Der Kontrast zwischen der dur-molltonalen Dezentrierung der Takte 5-9 und der anschließenden Betonung der Tonika im Rahmen der Kadenz (T. 9-10) ist hier sehr deutlich ausgeprägt und wird auch im weiteren Verlauf der Kammersymphonie immer wieder thematisiert. 289 290 Anthony Payne, zit. nach Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 21. Vgl. Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 21f. 121 Abbildung 75: Schönberg, Kammersymphonie op. 9, T. 5-10; Klavierauszug. In weiterer Folge wird der Quartenakkord sowie das Quartenmotiv – vergleichbar mit dem Dominantseptnonenakkord der Verklärten Nacht – an Schlüsselpositionen eingesetzt, um die formale Gliederung der Sonatensatzform zu markieren (z.B. Anfang und Ende der Durchführung [T. 278-280 u. T. 376-377] sowie Beginn der Coda [T. 573581]).291 Damit unterstützt das Klangzentrum des Quartenakkords auch die formbildende Funktion der dur-moll-tonalen Tonika. In der dritten Hälfte der Durchführung erfahren die Klangzentren des Quartenakkords und des übermäßigen Dreiklangs ihren Höhepunkt. Ab der vierten Viertel von Takt 334 dient eine Ganztonskala auf C als Klangzentrum, auf das die durchgeführten Themen bezogen werden. Der Höhepunkt dieser Stelle beginnt ab Takt 354: Durch gegenläufige übermäßige Dreiklänge klingt auf jeder Viertel ein anderer Ganztonakkord. In diese Ganztonharmonik wird zugleich auch das Quartenmotiv eingebettet, womit hier gewissermaßen eine Kombination der beiden Klangzentren wirksam ist. Zum Schluss bleibt nur noch die Quartenharmonik übrig, die ab Takt 364 in Form ausgehaltener Quartenakkorde diesen Abschnitt beendet (Abbildung 76). 291 Vgl. Mahnkopf, Gestalt und Stil, S. 70f; Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 24f. 122 Abbildung 76: Schönberg, Kammersymphonie op. 9, T. 364-368; Klavierauszug.292 In Schönbergs erster Schaffensperiode prallen die Gegensätze zwischen der dur-molltonalen Tonika und symmetrischen Klangzentren wie dem Ganzton- und dem Quartenakkord direkt aufeinander. Schönberg zog daraus die Konsequenz, die Tonika als Klangzentrum fallen zu lassen und entschloss sich während der atonalen Phase andere Klänge als harmonische Bezugspunkte zu verwenden. Dennoch sind die Kompositionstechniken, die Schönberg später anwandte, durchaus mit den Techniken seiner ersten Schaffensperiode vergleichbar. So setzt Schönberg auch weiterhin Klangzentren ein, die als formbildende Ruhepunkte dienen, wie z.B. im Klavierstück op. 19/6 oder im Orchesterstück Farben op. 16/3. Chromatische und stufenweise Stimmführungstechniken werden dabei häufig mit der Technik des Klangzentrums kombiniert und führen zu Klangprozessen, die das Klangzentrum transformieren und auch die formale Struktur der Werke mit beeinflussen. 292 Dale, Schoenbergs Chamber Symphonies, S. 25. 123 SCHLUSSWORT Tonalität – oder vielmehr jene Eigenschaft, die wir mit diesem Begriff assoziieren – ist ein komplexer und vielschichtiger Gedankenkomplex, der sich auf allen musikalischen Parametern entfaltet. Die Vorstellung eine „allgemein gültige Norm des Begriffs Tonalität festsetzten zu wollen“ wäre utopisch. Viele Aspekte, die den Tonalitätsbegriff begleiten, wie z.B. die Bedeutung metrischer und rhythmischer Strukturen, die Instrumentationstechnik oder auch die Interpretation, mussten in der vorliegenden Arbeit weitgehend unberücksichtigt blieben, zeugen jedoch von dem Beziehungsreichtum, der den Begriff begleiten kann. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass bestimmte Konstanten für einen sinnhaften Tonalitätsbegriff notwendig sind, da der Begriff sonst zu einer Beliebigkeit tendieren würde, die seiner Bedeutung nicht gerecht wird. Ohne eine differenzierte Zentrierung auf ein oder mehrere Klangzentren, welche den Klängen eine relative Bedeutsamkeit und einzigartige Funktion im harmonischen Verlauf zugesteht, wird nicht nur der Begriff Tonalität bedeutungslos, sondern auch der Begriff des Klangzentrums selbst. Ein Klangzentrum kann für sich alleine nicht existieren; der Begriff „Zentrum“ beinhaltet zwangsläufig, dass andere Klänge vorhanden sein müssen die im Verhältnis zu diesem eine „geringere“ – oder vielmehr andere Bedeutung einnehmen. Es versteht sich von selbst, dass die Klänge dabei unterschiedliche Funktionen einnehmen und ihre relative Bedeutung deshalb immer abhängig vom konkreten musikalischen Kontext neu hinterfragt werden muss. Streng genommen existiert zu keinem Zeitpunkt ein einzelner Zentralklang, auf den sich alle anderen Klänge beziehen. Stattdessen bestehen mehrere potenzielle Zentralklänge, deren relative Bedeutung ständig von anderen Klängen in Frage gestellt wird. Abhängig von der harmonischen Syntax entscheidet sich immer wieder aufs Neue, welche Klänge wir als zentral wahrnehmen bzw. welche Bedeutung wir ihnen beimessen. Auch die Stimmführung der Akkordverbindungen darf in diesem Zusammenhang nicht vernachlässigt werden. Stimmführung und Zentrierung gehen in der Dur-Moll-Tonalität Hand in Hand und bedingen sich gegenseitig: Die zunehmende chromatische Stimmführung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte zu Zusammenklängen, welche die dur-moll-tonale Syntax streckenweise außer Kraft setzte. Umgekehrt führte die zunehmende Zentrierung auf symmetrische Akkorde sowie auf Harmoniefolgen in großen und kleinen Terzen zu 124 einer vorwiegend chromatischen Stimmführung wie beispielsweise den „maximally smooth cycles“ Richard Cohns. Unter diesen Gesichtspunkten ist es notwendig, das Wesen des Zentralklangs dur-molltonaler Musik neu zu bewerten. Der Zentralklang ist ein Klang, der sich durch seine direkten Beziehungen zu anderen Klängen, seine formbildende Wirkung oder allgemein seine harmonische Funktion in besonderer Weise auszeichnet. Dabei ist festzuhalten, dass der Akkordtyp des Zentralklangs sich nicht alleine auf Dur- und Molldreiklänge einschränken lässt, sondern auch andere Formen annehmen kann. Wir können zwischen örtlichen Klangzentren, die sich durch die unmittelbare Stimmführung der Akkordfolgen ergeben, und übergeordneten Klangzentren, die als entfernte Bezugspunkte eine Bedeutung einnehmen, unterscheiden. Allerdings können, abhängig vom Untersuchungsgegenstand, durchaus unterschiedliche Klangbeziehungen und Klangzentren in einem Werk wirksam sein. Wenn wir die Kompositionstechnik untersuchen, wäre es denkbar auch ein „ideelles“ Klangzentrum anzunehmen: zum Beispiel einen Klang, der als kompositorischer Ausgangspunkt alle weiteren Klänge generiert, jedoch selbst gar nicht zum Einsatz kommt. Ob dieser Klang auch als Klangzentrum wahrgenommen wird, ist in diesem Zusammenhang aus kompositionstechnischer Sicht irrelevant. Aus hörpsychologischer Sicht sind dagegen nur jene Klangzentren von Interesse, die auch tatsächlich als solche wahrgenommen werden; „wahrgenommen“ im eigentlichen Sinn des Wortes: nämlich etwas als wahr bzw. real annehmen. Auch in diesem Fall muss das Klangzentrum nicht unbedingt als reales akustisches Ereignis existieren, sondern lediglich in der Vorstellung des Rezipienten. Nachdem ein Klang als Singularität kein Klangzentrum darstellt, sondern erst durch das Vorhandensein anderer Akkorde als solches erkannt wird, ist zu keinem Zeitpunkt nur ein einzelnes Klangzentrum von Bedeutung. Eine Tonika muss zumindest durch das Vorhandensein der Dominante bestätigt werden, womit automatisch auch die Dominante als potenzielles Klangzentrum an Bedeutung gewinnt. So entsteht eine Hierarchie von Klängen, die abhängig von der harmonischen Syntax unterschiedliche Klangzentren in unterschiedlicher Weise akzentuiert. Diese Hierarchie kann im einfachsten Fall eine Form annehmen, wie sie zum Beispiel von Moritz Hauptmann postuliert wurde: die Tonika steht im Zentrum, während die Dominant- und Subdominantregionen lediglich als untergeordnete Klangzentren die Tonikaregion bestätigen. Chromatische Stimm125 führung sowie „vagierende“ und äquidistante Akkorde führen jedoch zwangsläufig zu einer harmonischen Syntax, die diese Hierarchie aufbricht und anderen Klangzentren eine größere Bedeutung zukommen lässt. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass mehrere Klangzentren eine annähernd gleiche Bedeutung erlangen. Im Spezialfall könnte dies theoretisch soweit führen, dass alle Klänge die gleiche Bedeutung haben und eine Zentrierung der Harmonik – und damit ihre harmonische Gestalt – nicht mehr gegeben ist; der Begriff des Klangzentrums würde in diesem Fall bedeutungslos werden. Ob jedoch eine Harmonik, in der jeder Klang dieselbe Bedeutung bzw. Funktion hat, auch praktisch umgesetzt werden kann, ist zu bezweifeln. So gesehen existiert die Dur-Moll-Tonalität nicht. Statt dessen gibt es selbst in einzelnen Werken eine Vielzahl unterschiedlicher Tonalitäten, die sich aus der relativen Bedeutung der vorhandenen Klangbeziehungen ergeben. Diese Klangbeziehungen entstehen dabei sowohl in der direkten Aufeinanderfolge der einzelnen Klänge als auch in ihrer Bezogenheit auf ein oder mehrere Klangzentren. Es ist jedoch möglich bestimmte Tendenzen in der harmonischen Hierarchie aufzudecken, um so Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zugrunde liegenden Tonalitäten zu kommunizieren. Die Frage in wie weit der Begriff des Klangzentrums in der Musik des 20. Jahrhunderts als ein Weiterdenken dur-moll-tonaler Prinzipien gelten kann ist nicht nur eine Frage der Terminologie, sondern auch unseres historischen Selbstverständnisses und unserer Wahrnehmung. Es gilt zu beantworten, welche musikalischen Parameter tatsächlich mit der Dur-Moll-Tonalität „verloren“ gegangen sind und welche Parameter lediglich eine Entwicklung durchgemacht haben. Schließlich gilt es zu beantworten ob wir komplexe Klangzentren der neuen Musik wie dissonante Vielklänge in ähnlicher Weise als Ruhepunkte akzeptieren können wie die Tonika der Dur-Moll-Tonalität. Dass auch in atonaler und post-tonaler Musik Klangzentren als formbildende Kompositionstechniken Verwendung fanden, wurde an den Beispielen von Schönberg und Skrjabin gezeigt. Ob diese Klänge jedoch auch hörpsychologisch mit der Wirkung einer Tonika verglichen werden können, bleibt vorerst offen. Sicher scheint allerdings bereits zu sein, dass die Antwort auf diese Frage nicht ausschließlich von unserer Hörphysiologie abhängt, sondern auch von unserem Gedächtnis, unserer musikalischen Erfahrung und unserem sozialen Umfeld. Ob Zwölftonmusik eine Tonalität ausbildet, kann im Allgemeinen nicht beantwortet, sondern müsste am konkreten Beispiel immer neu hinterfragt werden. 126 Es ist durchaus möglich, gemäß „den Regeln“ der Dodekaphonie zu komponieren und dabei den Eindruck spätromantischer Dur-Moll-Tonalität zu erzeugen. Ebenso ist es aber auch möglich, eine zwölftönige Passage so zu konzipieren, dass sie den Anschein höchstmöglicher Bezuglosigkeit – und damit Bedeutungslosigkeit – der entstandenen Klänge erweckt. Richard Cohn schrieb 1999 in Bezug auf ein Zitat – „Schubert’s tonality is as wonderful as star clusters“293 – von Donald Francis Tovey: The traditional metaphorical source for tonal relations is the solar system, where positions are determined relative to a central unifying element. A star cluster evokes a network of elements and relations, none of which hold prior privileged status. These two contrasting images of cosmic organization provide a lens through which to compare two conceptions of tonal organization in Schubert’s music.294 Sternenhaufen und Sonnensysteme entstehen – um bei dieser Analogie zu bleiben – aufgrund desselben Prinzips: der Gravitation. Die Schönheit eines Sternenhaufens ergibt sich aus seiner internen Struktur; die Sterne des Haufens tragen dabei, abhängig von ihrer Masse, in unterschiedlichem Maße zu seiner einzigartigen Gestalt bei. Gerade die Zentrierung – das Ausformen von differenzierten Strukturen – macht das Wesen eines Sternenhaufens aus. Ohne die Gravitation würde er sich in eine homogene und charakterlose Masse von Molekülen auflösen. 293 294 Donald Francis Toveys, zit. nach: Richard Cohn, As Wonderful as Star Clusters: Instruments for Gazing at Tonality in Schubert, in: 19th-Century Music (1999/22,3), S. 213-232, hier S. 213. Cohn, As Wonderful as Star Clusters, S. 213. 127 QUELLENVERZEICHNIS ACHTÉLIK, Josef: Der Naturklang als Wurzel aller Harmonien: eine aesthetische Musiktheorie (Bd. 2), Frankfurt: C. F. Kahnt 1922. ADORNO, Theodor Wiesengrund: Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren, in: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften Bd. 16 (Musikalische Schriften I-III), Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1978, S. 649-664. AMBROS, August Wilhelm: Die ersten Zeiten der neuen christlichen Welt und Kunst (Geschichte der Musik Bd. 2), Breslau, F. E. C. Leuckard 1864. AMON, Reinhard: Lexikon der Harmonielehre, Wien/München: Doblinger 2005. BEICHE, Michael: Tonalität, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stuttgart: Steiner 1999. BREIG, Werner: Vagierender Akkord, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stuttgart: Steiner 1999. BROVER-LUBOVSKY, Bella: Venetian Clouds and Newtonian Optics, in: Musiktheorie als interdisziplinäres Fach (musik.theorien der gegenwart 4), Saarbrücken: Pfau 2010, in Bearbeitung. BUDDE, Elmar: Anton Weberns Lieder op. 3. Untersuchungen zur frühen Atonalität bei Webern, Wiesbaden: Steiner 1971. BURKHART, Charles: Schoenberg’s Farben: An Analysis of Op. 16, No. 3, in: Perspectives of New Music (Bd. 12/1), 1973-1974, S. 141-172. COHN, Richard: ― As Wonderful as Star Clusters: Instruments for Gazing at Tonality in Schubert, in: 19th-Century Music (Bd. 22,3), 1999, S. 213-232. ― Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective, in: Journal of Music Theory (Bd. 42,2), 1998, S.167-180. ― Maximally Smooth Cycles, Hexatonic Systems, and the Analysis of Late-Romantic Triadic Progressions, in: Music Analysis (Bd. 15,1), 1996, S. 9-40. ― Weitzmann’s Regions, My Cycles, and Douthett’s Dancing Cubes, in: Music Theory Spectrum (Bd. 22,1), 2000, S. 89-103. CHOMSKY, Noam: Syntactic Structures [1957], Berlin, New York: Mouton de Gruyter 2002. 128 CHORON, Alexandre-Étienne: Sommaire de l’histoire de la musique, in: AlexandreÉtienne Choron / François Joseph Fayolle, Dictionnaire historique des musiciens Bd. 1, Paris 1810. DAHLHAUS Carl: ― Der Tonalitätsbegriff in der neuen Musik, in: Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur Musik mit einer Einleitung von Hans Oesch, Schott: Mainz 1978, S. 111-117. ― Tonalität, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Kassel: Bärenreiter 1989. ― Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel: Bärenreiter 1988. DALE, Catherine: Schoenbergs Chamber Symphonies: the crystallization and redescovery of a style, Aldershot: Ashgate 2000. DE LAMENNAIS, Félicité Robert: Grundriss einer Philosophie Bd. 3, Paris/Leipzig: Jules Renouard 1841. DE LA MOTTE, Diether: Harmonielehre [1976], München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Bärenreiter 91995. DE LA MOTTE-HABER, Helga: Kräfte im musikalischen Raum. Musikalische Energetik und das Werk von Ernst Kurth, in: Musiktheorie (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Bd. 2), Laaber: Laaber 2005, S. 284-310. DEHN, Siegfried Wilhelm: Theoretisch-praktische Harmonielehre mit angefügten Generalbassbeispielen, Berlin: Wilhelm Thome 1840. DOMMER, Arrey von: Elemente der Musik, Leipzig: T. O. Weigel 1862. DOUTHETT, Jack, STEINBACH, Peter: Parsimonious Graphs: A Study in Parsimony, Contextual Transformations, and Modes of Limited Transposition, in: Journal of Music Theory (Bd. 42,2), 1998, S. 241-263. EBERLE, Gottfried: Studien zur Harmonik Alexander Skrjabins, München/Salzburg: Katzbichler 1978. ERPF Hermann: Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neueren Musik, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1927. EYBL, Martin: Tonalität, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 485-488. FÉTIS, François-Joseph: Traité complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie, Paris: Schlesinger 1844. 129 FORTE, Allen: ― A Theory of Set-Complexes for Music, in: Journal of Music Theory (Bd. 8,2), 1964, S. 136-139, 141, 140, 142-183. ― Liszt’s Experimental Idiom and Music of the Early Twentieth Century, in: 19thCentury Music (Bd. 10,3), 1987, S. 209-228. FUSS, Hans-Ulrich: Funktion, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 127-129. GÁRDONYI, Zsolt: ― Akustische Tonalität und Distanzharmonik im Tonsatzunterricht, in: Harmonik im 20. Jahrhundert, Wien: Wiener Universitätsverlag 1993, S.46-61. ― Paralipomena zum Thema Liszt und Skrjabin. in: Virtuosität und Avandgarde, Untersuchungen zum Klavierwerk Franz Liszts, Mainz 1988, S. 9-31. GIESELER Walter: Harmonik in der Musik des 20. Jahrhunderts. Tendenzen - Modelle, Celle: Moeck 1996. GRUN, Constantin: Arnold Schönberg und Richard Wagner: Schriften (Spuren einer außergewöhnlichen Beziehung Bd. 2), Göttingen: V&R 2006. HASELBÖCK, Lukas: Zwölftonmusik und Tonalität. Zur Vieldeutigkeit dodekaphoner Harmonik, Laaber: Laaber 2005. HAUPTMANN, Moritz: Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik, Leipzig: Breitkopf u. Härtel 1853. HELBING, Volker: Tonalität in der französischen Musiktheorie zwischen Rameau und Fétis, in: Musiktheorie (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Bd. 2), Laaber: Laaber 2005, S. 171-202. HELMHOLTZ, Hermann von: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage Für die Theorie der Musik, Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn 1863. HOLTMEIER, Ludwig: Die Erfindung der romantischen Harmonik, in: Zwischen Komposition und Hermeneutik: Festschrift für Hartmut Fladt, Würzburg: Königshausen & Neumann 2005. HYER, Brian: ― Tonality, in: Grove Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com (1.6.2010). ― Reimag(in)ing Riemann, in: Journal of Music Theory (Bd. 39,1), 1995, S. 101-138. 130 Journalschau (Fortsetzung). VI. Revue musicale, in: Neue Leipziger Zeitschrift für Musik (Bd. 1,58) Oktober 1834, S. 230-232. KLEINRATH Dieter, Kompositionstechniken im Klavierwerk Franz Liszts. Eine Gegenüberstellung kompositorischer Verfahren im Früh- und Spätwerk unter besonderer Berücksichtigung des Klavierstücks Funérailles, Kunstuniversität Graz 2007. KOPP, David: Chromatic transformations in nineteenth-century music (Cambridge studies in music theory and analysis 17), Cambridge: Cambridge University Press 2002. KURSELL, Julia: Konsonanz / Dissonanz, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 227-230. KURTH, Ernst: ― Die Voraussetzungen der Theoretischen Harmonik, Bern: Max Drechsel 1913. ― Musikpsychologie, Hildesheim/New York: Georg Olms 1969. ― Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“, Berlin: Max Hessels 1920. LEDUC, A. C.: Ueber den Ausatz des Herrn Fétis (in dessen Revue musicale Tome V. Nr. 26. 1829), eine Stelle Mozart’s betreffend, in: Allgemeine Musikalische Zeitung (Bd. 32,8), Februar 1830, S. 117-132. LEWANDOWSKI, Stephan: Pitch Class Set, in: Lexikon der systematischen Musikwissenschaft (Handbuch der systematischen Musikwissenschaft Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 380-382. LEWIN, David: ― A Formal Theory of Generalized Tonal Functions. Journal of Music Theory (Bd. 26,1), 1982, S. 32-60. ― Generalized Musical Intervals and Transformations [1987], Oxford/New York: Oxford University 2007. ― Musical Form and Transformation. Four Analytic Essays [1993], Oxford: Oxford University 2007. LISSA, Zofja: ― Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik, in: Acta Musicologica (Bd. 7/1), 1935, S. 15-21. 131 ― Zur Genesis des Prometheischen Akkords bei Skrjabin, in: Musik des Ostens: Sammelbände für historische und vergleichende Forschung (Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa) (Bd. 2), 1963. LUCHTERHANDT, Gerhard: „Viele ungenutzte Möglichkeiten“. Die Ambivalenz der Tonalität in Werk und Lehre Arnold Schönbergs, Mainz: Schott 2008. MAHNKOPF, Claus-Steffen: Gestalt und Stil. Schönbergs Kammersymphonie und ihr Umfeld, Kassel: Bärenreiter 1994. MITTMANN, Jörg-Peter: Musikalische Selbstauslegung - eine sichere Quelle historischer Musiktheorie?, in: Musiktheorie als interdisziplinäres Fach (musik.theorien der gegenwart 4), Saarbrücken: Pfau 2010, in Bearbeitung. MORAITIS Andreas, Zur Theorie der musikalischen Analyse, Frankfurt a. M./ Wien: Lang 1994. MÓRICZ Klára: The Ambivalent Connection between Theory and Practice in the Relationship of F. Liszt & F.-J. Fétis, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Bd. 35,4), 1993-1994, S. 399-420. OETTINGEN, Arthur von: Harmoniesystem in dualer Entwickelung -Studien zur Theorie der Musik, Dorpat/Leipzig: Gläser 1866. REDLICH, Hans Friedrich: Schönbergs Tonalität, in: Anrnold Schönberg und seine Orchesterwerke, Wien: Universal Edition 1927, S. 22-24. REXROTH, Dieter: Arnold Schönberg als Theoretiker der tonalen Harmonik, Bonn 1971. RIEMANN, Hugo: ― Handbuch der Harmonielehre [1887], Leipzig, Breitkopf & Härtel 51912. ― Ideen zu einer „Lehre von den Tonvorstellungen“, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 21–22 (1914/15), Leipzig 1916, S. 1–26. ― Musikalische Logik [als Dissertation: Ueber das musikalische Hören, Leipzig 1874], Leipzig: C. F. Kahnt 1875. ― Tonalität, in: Musik-Lexikon. Sachteil [Leipzig: Bibliographisches Institut, 1882], Mainz 1967. ― Musikalische Syntaxis. Grundriß einer harmonischen Satzbildungslehre, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1877. ― Ueber Tonalität [Neue Zeitschrift für Musik 1872, Bd. 45-46], in: Präludien und Studien. Gesammelte Aufsätze zur Aesthetik, Theorie und Geschichte der Musik Bd. 3, Heilbronn: Schmidt (o. J.). 132 ― Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorde [1893], London: Augener 1899. SCHELLHOUS Rosalie, Fetis’s „Tonality“ as a Metaphysical Principle: Hypothesis for a New Science, in: Music Theory Spectrum (Bd. 13,2), 1991, S. 219-240. SCHENKER Heinrich: ― Der freie Satz (Neue musikalische Theorien und Phantasien Bd. 3), Wien: Universal Edition 1935. ― Der freie Satz. Anhang: Figurentafeln (Neue musikalische Theorien und Phantasien Bd. 3), Wien: Universal Edition 1956, S. 1f. ― Harmonielehre [1906] (Neue musikalische Theorien und Phantasien Bd. 1), Wien: Universal Edition (o.J.). SCHÖNBERG, Arnold: ― Der musikalische Gedanke und die Kunst, Logik und Technik seiner Darstellung [1934], http://www.schoenberg.at (1.6.2010). ― Die formbildenden Tendenzen der Harmonie [Structural Functions of Harmony, 1948], Mainz: B. Schott’s Söhne 1954. ― Harmonielehre [1911], Wien: Universal Edition 2001. ― Problems of Harmony [1934], http://www.schoenberg.at (1.6.2010). ― Rückblick [1949], http://www.schoenberg.at (1.6.2010). SIMMS, Bryan: Choron, Fetis, and the Theory of Tonality, in: Journal of Music Theory (Bd. 19,1), 1975, S. 112-138. SORGE, Georg Andreas: Vorgemach der musicalischen Composition, Lobenstein 1745. STEPHAN, Rudolf: Neue Musik. Versuch einer kritischen Einführung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1958. SULZER, Johann Georg: Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln. 2. Teil, Leipzig: M. G. Weidmanns Erben und Reich 1775. TODD, Larry: Franz Liszt, Carl Friedrich Weitzmann, and the Augmented Triad, in: The second practice of nineteenth-century tonality, Lincoln: University of Nebraska Press 1996, S. 153-177. VIVIGENS VON WINTERFELD, Carl Georg August: Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniss zur Kunst des Tonsatzes Bd. 1, Leipzig: Breitkopf und Härtel 1843. 133 UTZ, Christian, KLEINRATH, Dieter: Klangorganisation. Zur Systematik und Analyse einer Morphologie und Syntax post-tonaler Kunstmusik, in: Musiktheorie und Improvisation. Bericht des IX. Kongresses der Gesellschaft für Musiktheorie, Mainz: Schott, in Vorbereitung. VALENTIN, Gabriel Gustav: Bericht über die Leistungen in der Psychologie, in: Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern im Jahre 1862 (Bd.1 Psychologische Wissenschaften), Würzburg: Stahle’sche Buch und Kunsthandlung 1863, S. 103-, 197. VOGEL, Martin: Der Tristan-Akkord und die Krise der modernen Harmonielehre, Düsseldorf: Gesellschaft zur Förderung der systematischen Musikwissenschaft 1962. VOGLER, Georg Joseph: Handbuch zur Harmonielehre und für den Generalbaß, nach den Grundsätzen der Mannheimer Tonschule, Prag 1802. WEBER, Gottfried: Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst Bd. 2, Paris: B. Schott’s Söhne 1830. WAGNER Cosima, Die Tagebücher (Bd. 2), München: Piper 1976. WEITZMANN, Carl Friedrich: Der Übermäßige Dreiklang, Berlin 1853. WILDING-WHITE, Raymond: Tonality and Scale Theory, in: Journal of Music Theory (Bd. 5,2), 1961, S. 275-286. Wissenschaftliche Begründung der Musik, in: Aus der Natur. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet d. Naturwissenschaft (Bd. 25 oder neue Folge Bd. 13), Leipzig: Gerhardt & Reisland 1863, S. 481-487. 134 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Abbildung 2: Abbildung 3: Abbildung 4: Abbildung 5: Abbildung 6: Abbildung 7: Abbildung 8: Abbildung 9: Abbildung 10: Abbildung 11: Abbildung 12: Abbildung 13: Abbildung 14: Abbildung 15: Abbildung 16: Abbildung 17: Abbildung 18: Abbildung 19: Abbildung 20: Abbildung 21: Abbildung 22: Abbildung 23: Abbildung 24: Abbildung 25: Abbildung 26: Abbildung 27: Abbildung 28: Abbildung 29: Abbildung 30: Abbildung 31: Abbildung 32: Abbildung 33: Abbildung 34: Abbildung 35: Abbildung 36: Abbildung 37: Abbildung 38: Abbildung 39: Abbildung 40: Abbildung 41: Abbildung 42: Abbildung 43: Abbildung 44: Auflösung Dominante → Tonika. ........................................................ 13 Auflösung V7 → V6.............................................................................. 13 Auflösung eines verminderten Septakkords nach Fétis. ...................... 14 C-Dur Kadenz Gottfried Webers.......................................................... 18 Verwandtschaftsreihe der Tonarten nach Siegfried Wilhelm Dehn..... 23 Schema der Tonartverwandtschaften nach Siegfried Wilhelm Dehn... 24 Schema der Tonartverwandtschaften nach Gottfried Weber................ 25 Hauptmanns dialektischer Tonartbegriff. ............................................. 28 Dialektische Tonartbeziehungen Hauptmanns. .................................... 29 Oettingens Tonnetz............................................................................... 32 Riemanns Tonnetz. ............................................................................... 36 Schenkers Ursatz-Varianten; Terzzug, Quintzug, Oktavzug................ 37 Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, T. 137-140..................................... 43 Alternierende Terzenskala.................................................................... 49 Transformations-Graphen; Beethovens Sonate op. 57.......................... 50 Beziehungen der unterschiedlichen Transformationen nach Hyer....... 51 Cohns „maximally smooth cycles“....................................................... 52 Schubert, Klaviertrio in Es-Dur op. 100; T. 586-598........................... 52 „Dancing Cubes“. ................................................................................. 53 „Power Towers“. .................................................................................. 54 Akkordfolge in C-Dur funktionstheoretisch gedeutet. ......................... 54 Akkordfolge in C-Dur im Sinne der Neo-Riemann-Theorie gedeutet. 55 Zentralklang aus Schönberg, Klavierstück op. 19/6............................. 57 Schönberg, Klavierstück op. 19/6. ....................................................... 58 Webern, 5 Lieder op. 4/1, Takte 1-5..................................................... 59 Schönbergs Orchesterstück Farben op. 16/3; T. 1-9............................ 60 Skrjabins Prometheus-Akkord auf A. .................................................. 61 Prometheus, Takte 1-10; harmonische Reduktion. .............................. 61 a) Die Skala des Prometheus-Akkords, b) die mixolydische Skala mit erhöhter Quart...................................... 62 Akkorde in Quarten- und Terzschichtung über der mixolydischen Skala mit erhöhter Quart........................................................................63 Dur-moll-tonale Deutung des Prometheus-Akkords............................ 63 Schubert, Klaviertrio in Es- Dur op. 100, T. 586-598. ......................... 73 J. S. Bach, Präludium in C-Dur BWV 846, T. 22-24. .......................... 77 Weitzmanns Zwölftonmatrix................................................................ 78 Beethoven, Sonate op. 28 „Pastorale“, T. 240-261. ............................. 79 Beethoven, Sonate op. 13 „Pathétique“, T. 173-189. ........................... 80 Beethoven, Streichquartett Nr. 9 op. 59/3, T. 1-44. ............................. 84 Beethoven Variation Nr. 20 aus Variationen op. 120........................... 85 Liszt, La lugubre gondola I, Takte 1-22............................................... 87 Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 1-11. ...................................................... 89 Tristan-Vorspiel, T. 10, gedeutet als Tonika mit übermäßiger Quint. . 90 Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 100-111. ................................................ 91 Harmonische Zusammenhänge zwischen E-Dur und f-Moll. .............. 93 Liszt, Unstern!, Takte 21-25. ............................................................... 93 135 Abbildung 45: Harmonische Zusammenhänge zwischen C-Dur und E-Dur. .............. 94 Abbildung 46: Tristan-Akkord aus Sicht von a-Moll und aus Sicht von E-Dur. ......... 94 Abbildung 47: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 5-8; Verbindung zwischen E7 und dem halbverminderten Septakkord auf Gis. ......................................... 95 Abbildung 48: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 17-29. .................................................... 96 Abbildung 49: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 32-42. .................................................... 97 Abbildung 50: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 55-63. .................................................... 98 Abbildung 51: Wagner, Tristan-Vorspiel, T. 80-84. .................................................... 99 Abbildung 52: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4. ................................. 101 Abbildung 53: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4; harm. Reduktion. .... 101 Abbildung 54: Die Stufen des verminderten Septakkords.......................................... 103 Abbildung 55: Oktatonische Skalen als Durchgänge eines verm. Septakkords. ........ 103 Abbildung 56: Chromatische Vorhalte zum verminderten Septakkord...................... 104 Abbildung 57: Tristan-Auflösung über den verminderten Septakkord. ..................... 104 Abbildung 58: J. S. Bach, Chrom. Fantasie und Fuge BWV 903, T. 32-35............... 105 Abbildung 59: Doppelte chromatische Vorhalte zum verminderten Septakkord....... 105 Abbildung 60: Harmonische Beziehungen des verminderten Septakkords auf G...... 106 Abbildung 61: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4; bezogen auf den verminderten Septakkord.................................................................... 107 Abbildung 62: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 1-4; Graph-Darstellung des harmonischen Prozesses............................................................... 108 Abbildung 63: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 5-12; harm. Reduktion. .. 109 Abbildung 64: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 5-12; Graph-Darstellung. 110 Abbildung 65: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 12; harm. Reduktion....... 111 Abbildung 66: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 13-18 (Klavierauszug). .. 111 Abbildung 67: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 21-24 (Klavierauszug). .. 112 Abbildung 68: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 23-37; harm. Reduktion. 114 Abbildung 69: Wagner, Parsifal, Vorspiel zum 3. Akt, T. 38-48; harm. Reduktion. 115 Abbildung 70: Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, T. 137-140; Klavier-Reduktion... 118 Abbildung 71: Auflösung des Ganztonakkords und des Quartenakkords.................. 119 Abbildung 72: Weiterführen eines Quartenakkords in einen Ganztonakkord............ 119 Abbildung 73: Schönberg, Pelleas und Melisande op. 5, 3 Takte vor Ziffer 32........ 120 Abbildung 74: Schönberg, Kammersymphonie op. 9, T. 1-4; Klavierauszug. ........... 121 Abbildung 75: Schönberg, Kammersymphonie op. 9, T. 5-10; Klavierauszug. ......... 122 Abbildung 76: Schönberg, Kammersymphonie op. 9, T. 364-368; Klavierauszug. ... 123 Abbildung 77: Tabelle der Tonverwandtschaften nach Gottfried Weber................... 139 136 ANHANG a) Weiterführende Literatur BAKER, James M.: Scriabin's Implicit Tonality, in: Music Theory Spectrum (Bd. 2), 1980, S. 1-18. BAUER, Hans-Joachim: Wagners „Parsifal“. Kriterien der Kompositionstechnik, München-Salzburg: Emil Katzbichler 1977. BRINER, Andres: A New Comment on Tonality, in: Journal of Music Theory (Bd. 5,1), 1961, S. 109-112. BROWN, Matthew, DEMPSTER, Douglas, HEADLAM, Dave: The #IV(bV) Hypothesis: Testing the Limits of Schenker's Theory of Tonality, in: Music Theory Spectrum (Bd. 19, 2), 1997, S. 155-183. CHERLIN, Michael: Schoenberg and Das Unheimliche: Spectres of Tonality, in: The Journal of Musicology (Bd. 11, 3), 1993, S. 357-373. CLAMPITT, David: Alternative Interpretations of Some Measures from "Parsifal", in: Journal of Music Theory (Bd. 42,2), 1998, S. 321-334. COLLIN, Mason: Versuch einer Analyse. Tonalität, Symmetrie und latentes Reihendenken in Bartóks viertem Streichquartett (1957), in: Zur Musikalischen Analyse, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1974, S. 241-260. DAHLHAUS Carl: ― Tonalität – Struktur und Prozeß, in: Carl Dahlhaus, Gesammelte Schriften in 10 Bänden Bd. 2 (Allgemeine Theorie der Musik II), Laaber: Laaber 2001, S. 393-401. ― Tristan-Harmonik und Tonalität, in: Carl Dahlhaus, Gesammelte Schriften in 10 Bänden Bd. 2 (19. Jahrhundert IV. Richard Wagner – Texte zum Musiktheater), Laaber: Laaber 2004, S. 435-442. ― Über den Begriff der tonalen Funktion, in: Carl Dahlhaus, Gesammelte Schriften in 10 Bänden Bd. 2 (Allgemeine Theorie der Musik II), Laaber: Laaber 2001, S. 187196. FORKEL, Johann Nikolaus: Musikalisch-kritische Bibliothek Bd. 3, Gotha: Carl Wilhelm Ettinger 1779. GERLACH, Reinhard: Mystik und Klangmagie in Anton von Weberns hybrider Tonalität. Eine Jugendkrise im Spiegel von Musik und Dichtung der Jahrhundertwende, in: Archiv für Musikwissenschaft (Bd. 33,1), 1976, S. 1-27. 137 HINRICHSEN, Hans-Joachim: "Eines der dankbarsten Mittel zur Erzielung musikalischer Formwirkung". Zur Funktion der Tonalität im Frühwerk Arnold Schönbergs, in: Archiv für Musikwissenschaft (Bd. 57,4), 2000, S. 340-361. KUPKOVIC, Ladislav: The Role of Tonality in Contemporary and 'Up-to-Date' Composition, in: Tempo, New Series (Bd. 135), 1980, S. 15-19. LORENZ, Alfred: Der musikalische Aufbau von Richard Wagners „Parsifal“, Tutzing: Hans Schneider 1966. LOWINSKY, Edward E.: Tonality and Atonality, in: Music & Letters (Bd. 43,3), 1962, S. 295-298. MARK, Christopher: Contextually Transformed Tonality in Britten, in: Music Analysis (Bd. 4,3), 1985, S. 265-287. MARX, Adolf Bernhard: Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch Bd. 4 [1847], neu bearbeitet von Hugo Riemann, Leipzig: Breitkopf und Härtel 51888. MCCRELESS, Patrick: Ernst Kurth and the Analysis of the Chromatic Music of the Late Nineteenth Century, Music Theory Spectrum (Bd. 5), 1983, S. 56-75. NEMECEK, Robert: Untersuchungen zum frühen Klavierschaffen von Piere Boulez, Kassel: Gustav Bosse 1998. PERSCHMANN, Wolfgang: Richard Wagner Parsifal. Schwanenschluß - Wissenskuß glühende Befreiung, Graz: Richard-Wagner-Gesellschaft 1991. RIEMANN, Hugo: ― Elementar-Schulbuch der Harmonielehre, Leipzig: Max Hesses 1923. ― Geschichte der Musiktheorie im IX. - XIX. Jahrhundert, Hildesheim: Georg Olms 1964. SCHMITT, Theo: Zur Entstehung der harmonischen Tonalität, in: Archiv für Musikwissenschaft (Bd. 41,1), 1984, S. 27-34. SCHÖNBERG, Arnold: Stil und Gedanke, Frankfurt a. M. : Fischer Taschenbuch 1992. STUMPF, Carl, Tonpsychologie [1883] (2 Bände), Leipzig: Hirzel 1965. TOVEY, Donald F.: Tonality, in: Music & Letters, (Bd. 9,4), 1928, S. 341-363. VON DER NÜLL, Edwin: Moderne Harmonik, Leipzig: Fr. Kistner 1932. WHITE, Harry: The Holy Commandments of Tonality, in: The Journal of Musicology (Bd. 9,2), 1991, S. 254-268. WIENPAHL, Robert W.: English Theorists and Evolving Tonality, in: Music & Letters (Bd. 36,4), 1955, S. 377-393. 138 b) Sonstiges Abbildung 77: Tabelle der Tonverwandtschaften nach Gottfried Weber.295 295 Weber, Versuch einer geordneten Theorie, S. 86 139