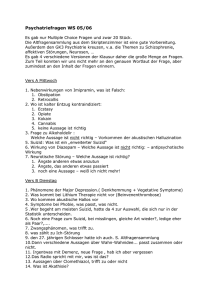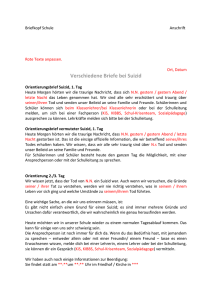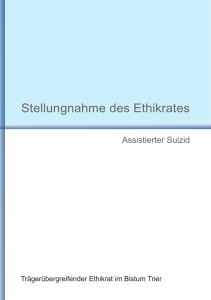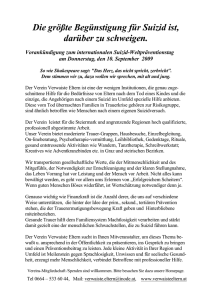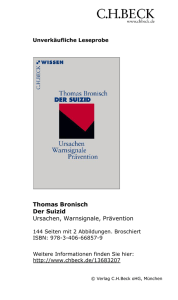Mein Wille geschehe? Zur gegenwärtigen Debatte um
Werbung
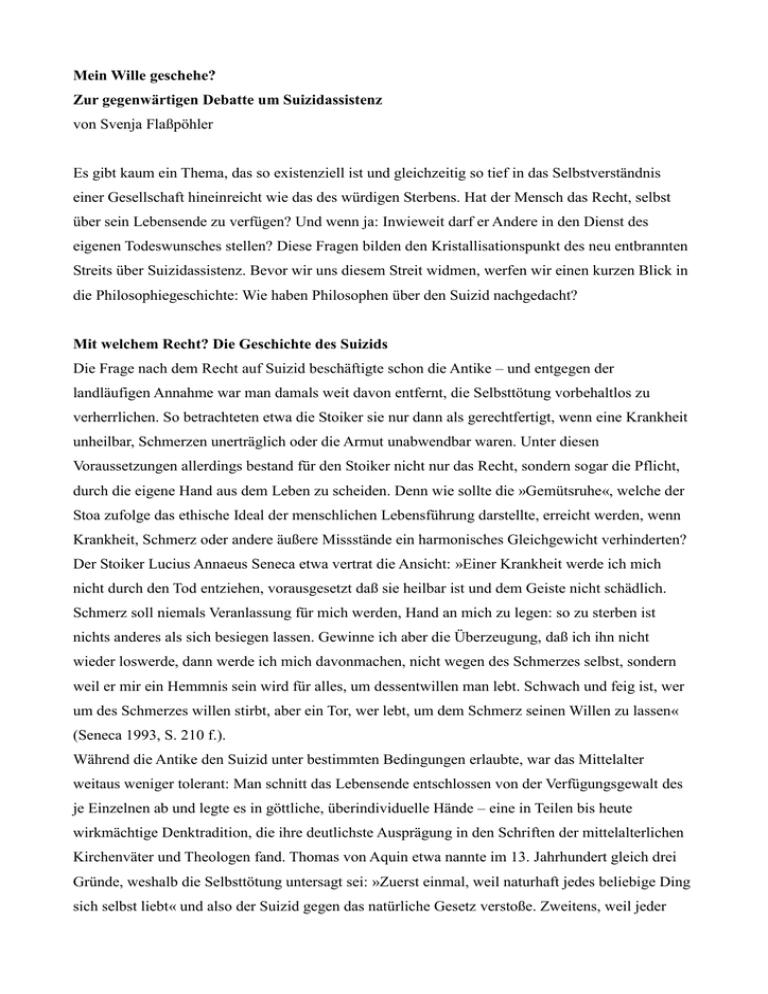
Mein Wille geschehe? Zur gegenwärtigen Debatte um Suizidassistenz von Svenja Flaßpöhler Es gibt kaum ein Thema, das so existenziell ist und gleichzeitig so tief in das Selbstverständnis einer Gesellschaft hineinreicht wie das des würdigen Sterbens. Hat der Mensch das Recht, selbst über sein Lebensende zu verfügen? Und wenn ja: Inwieweit darf er Andere in den Dienst des eigenen Todeswunsches stellen? Diese Fragen bilden den Kristallisationspunkt des neu entbrannten Streits über Suizidassistenz. Bevor wir uns diesem Streit widmen, werfen wir einen kurzen Blick in die Philosophiegeschichte: Wie haben Philosophen über den Suizid nachgedacht? Mit welchem Recht? Die Geschichte des Suizids Die Frage nach dem Recht auf Suizid beschäftigte schon die Antike – und entgegen der landläufigen Annahme war man damals weit davon entfernt, die Selbsttötung vorbehaltlos zu verherrlichen. So betrachteten etwa die Stoiker sie nur dann als gerechtfertigt, wenn eine Krankheit unheilbar, Schmerzen unerträglich oder die Armut unabwendbar waren. Unter diesen Voraussetzungen allerdings bestand für den Stoiker nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, durch die eigene Hand aus dem Leben zu scheiden. Denn wie sollte die »Gemütsruhe«, welche der Stoa zufolge das ethische Ideal der menschlichen Lebensführung darstellte, erreicht werden, wenn Krankheit, Schmerz oder andere äußere Missstände ein harmonisches Gleichgewicht verhinderten? Der Stoiker Lucius Annaeus Seneca etwa vertrat die Ansicht: »Einer Krankheit werde ich mich nicht durch den Tod entziehen, vorausgesetzt daß sie heilbar ist und dem Geiste nicht schädlich. Schmerz soll niemals Veranlassung für mich werden, Hand an mich zu legen: so zu sterben ist nichts anderes als sich besiegen lassen. Gewinne ich aber die Überzeugung, daß ich ihn nicht wieder loswerde, dann werde ich mich davonmachen, nicht wegen des Schmerzes selbst, sondern weil er mir ein Hemmnis sein wird für alles, um dessentwillen man lebt. Schwach und feig ist, wer um des Schmerzes willen stirbt, aber ein Tor, wer lebt, um dem Schmerz seinen Willen zu lassen« (Seneca 1993, S. 210 f.). Während die Antike den Suizid unter bestimmten Bedingungen erlaubte, war das Mittelalter weitaus weniger tolerant: Man schnitt das Lebensende entschlossen von der Verfügungsgewalt des je Einzelnen ab und legte es in göttliche, überindividuelle Hände – eine in Teilen bis heute wirkmächtige Denktradition, die ihre deutlichste Ausprägung in den Schriften der mittelalterlichen Kirchenväter und Theologen fand. Thomas von Aquin etwa nannte im 13. Jahrhundert gleich drei Gründe, weshalb die Selbsttötung untersagt sei: »Zuerst einmal, weil naturhaft jedes beliebige Ding sich selbst liebt« und also der Suizid gegen das natürliche Gesetz verstoße. Zweitens, weil jeder Mensch ein ›Teil der Gemeinschaft‹ ist, ihr gehört und ihr verpflichtet ist. Drittens schließlich ist das Leben ein Geschenk Gottes:»Darum sündigt gegen Gott, wer sich selbst des Lebens beraubt« (Thomas von Aquino 1954, S. 305 f.). Im Mittelalter glaubte man, dass ein Mensch, der sich selbst tötet, im Bannkreis des Teufels stehe, weshalb es üblich war, den Leichnam einem exorzistischen, abschreckenden Ritus zu unterziehen. Wer die Verdammung des Suizids allein Theologen zuschreibt, irrt allerdings: Auch der Aufklärer und Pflichtethiker Immanuel Kant hielt »die Selbstentleibung« für ein »Verbrechen«. Der Mensch ist ein Zweck an sich und untersteht qua Vernunft dem Kategorischen Imperativ, der ihm gebietet, nur nach der Maxime zu handeln, die zugleich ein allgemeines Gesetz werden kann. Dies ist aber beim Suizid ganz offensichtlich nicht der Fall. So heißt es in der Metaphysik der Sitten: »Das Subject der Sittlichkeit in seiner eigenen Person zernichten, ist ebenso viel, als die Sittlichkeit selbst ihrer Existenz nach [...] aus der Welt zu vertilgen« (Kant 1968, S. 423). Eine ganz andere Ansicht vertrat wiederum Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert. Für Nietzsche ist der Suizid ein »Sieg der Vernunft«, wenn ein Mensch altersbedingt die »Abnahme seiner Kräfte« spürt. Warum auf sein Ende warten, wenn man es zu gegebener Zeit selbst herbeiführen kann? Welchen Sinn hat es, auszuharren, wenn es nichts mehr gibt, um dessentwillen es sich zu leben lohnt? Für ärztlich verordnete Lebensverlängerungsmaßnahmen hat der Philosoph nur Verachtung übrig: »Die Sucht dagegen, sich mit ängstlicher Beratung von Ärzten und peinlichster Lebensart von Tag zu Tage fortzufristen, ohne Kraft, dem eigentlichen Lebensziel noch näher zu kommen, ist viel weniger achtbar« (Nietzsche 1988: S. 85). Einer der prominentesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, die über den Suizid nachdachten, war der französische Existenzialist Albert Camus. »Der Selbstmord ist das einzige wirklich ernsthafte Problem«, so Camus in Der Mythos des Sisyphos. Die Welt ist absurd, »verharrt in Schweigen«, birgt keinerlei Sinn; warum also die Herausforderungen des Lebens annehmen? Trotzdem ist der Suizid für Camus keine Lösung, denn gerade die Absurdität vermag, wenn der Mensch sie akzeptiert, ihm größtes Glück zu schenken. Als Beleg dient dem Philosophen Sisyphos, der den Felsbrocken immer wieder den Berg heraufrollt und gerade darin Erfüllung findet: »Jedes Gran dieses Steins, jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet für ihn die ganze Welt« (Camus 1958, S. 13). Als Beispiel für eine zeitgenössische Sicht auf den Suizid sei der hochumstrittene Philosoph Peter Singer genannt. Der Utilitarist bildet den ethischen Gegenpol zu Kant. Der Mensch ist für Singer kein Zweck an sich. Er allein hat das Recht zu entscheiden, ob er leben will oder streben. Ja, mehr noch: Für Singer hat ein Lebewesen (ob Mensch oder Tier) überhaupt nur ein Lebensrecht, wenn es über Selbstbewusstsein, Autonomie, Rationalität verfügt. Weder Säuglinge und Embryonen noch geistig Schwerstbehinderte besitzen diese Eigenschaften. Im utilitaristischen Sinne gut ist eine Handlung, wenn sie dem größtmöglichen Glück der größtmöglichen Zahl von Betroffenen dient. Menschen auf ihren Wunsch hin den Tod zu ermöglichen (zumal wenn sie hohe Kosten erzeugen oder dauerhaft Leid empfinden), kann danach, so schlussfolgert Singer, ethisch geboten sein. Die gegenwärtige Debatte um Suizidassistenz Durch die gegenwärtige Debatte um Suizidassistenz ist die alte moralphilosophische Frage nach dem Recht auf Suizid in einer kaum noch zu überbietenden Dringlichkeit wieder auf den Plan getreten. Bestimmt wird diese Debatte zur Zeit durch zwei extreme Positionen. Während die einen dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen absolute Priorität einräumen und einen umfassenden Anspruch auf eine Suizidbegleitung fordern, ist das erklärte Ziel der anderen, diese Sterbehilfepraxis gesetzlich ein für alle Mal zu verbieten. Ein Wortführer der radikalen Befürworter ist der ehemalige MDR-Intendant Udo Reiter. »Es geht um Menschen, die nicht todkrank sind, aber in freier Entscheidung zu dem Entschluss kommen, nicht mehr weiterleben zu wollen, sei es, weil sie [...] den Verlust ihrer Persönlichkeit im Altwerden nicht erleben wollen, sei es, weil sie einfach genug haben und, wie es im ersten Buch Moses heißt, ›lebenssatt‹ sind«, so der querschnittsgelähmte Publizist Reiter in seinem Anfang des Jahres veröffentlichten Plädoyer. »Diese Menschen werden in unserer Gesellschaft alleingelassen. Sie müssen sich ihr Ende quasi in Handarbeit selbst organisieren. Das kann nicht so bleiben« (Reiter 2014). Dieser liberalen Haltung widerspricht Gesundheitsminister Hermann Gröhe energisch: So forderte der CDU-Politiker kurz nach Erscheinen des Reiter-Texts ein Gesetz, das nicht nur – wie ein Entwurf der alten Regierung aus dem Jahr 2013 vorsah –, die gewerbsmäßige, sondern auch die geschäftsmäßige Suizidassistenz unter Strafe stellt. Verboten werden soll die Beihilfe in jeder organisierten Form; ob nun von gewinnorientierten Vereinen ausgeübt (gewerbsmäßig) oder von Ärzten praktiziert (geschäftsmäßig). Denn, so Gröhe: »Wer [...] die Selbsttötung propagiert, als Ausdruck der Freiheit des Menschen geradezu verklärt, der versündigt sich an der Wertschätzung des menschlichen Lebens in allen seinen Phasen« (zitiert in Mayntz, 2014). Begriffliche Unschärfen Die Leidenschaftlichkeit, mit der diese seit Jahren schwelende, so drängende Debatte nun endlich geführt wird, ist begrüßenswert. Doch fallen durch die hohe Emotionalität, mit der gerade wir Deutschen über Fragen der Euthanasie (griech: schöner Tod) diskutieren, wichtige, ja wesentliche Differenzierungen unter den Tisch. So ist auffällig und bezeichnend, dass beide Lager ebenso wie die Mehrheit berichtender Journalistinnen und Journalisten die Suizidassistenz notorisch als »aktive Sterbehilfe« und damit als eine Tötung auf Verlangen bezeichnen. Selbst Reiter spricht in seinem die jüngere Debatte prägenden Text an einer Stelle plötzlich von »aktiver Sterbehilfe«; ein Fehler, der Sterbehilfegegnern und -gegnerinnen oft nicht unabsichtlich unterläuft, um das nationalsozialistische Trauma heraufzubeschwören und die Suizidbeihilfe von vornherein zu kriminalisieren. Um die Debatte ernsthaft und sachbezogen führen zu können, ist jedoch eine saubere Unterscheidung der beiden Sterbehilfeformen dringend vonnöten: Zwar hat auch die qua Injektion durchgeführte aktive Sterbehilfe definitionsgemäß nichts mit der Ermordung von Kindern und Behinderten im Dritten Reich zu tun; immerhin handelt es sich um eine Tötung auf Verlangen. Dennoch birgt diese Hilfe - die hierzulande genauso verboten ist wie in der Schweiz - die Gefahr des Missbrauchs insofern, als Menschen, die sie in Anspruch nehmen, nicht immer bei Bewusstsein sind. Sollten sie ihren Willen nicht zweifelsfrei in einer Patientenverfügung niedergelegt haben, bleibt ein gewisser Spielraum, den »mutmaßlichen Willen« zu ermitteln. Bei der Suizidassistenz hingegen ist von vornherein ausgeschlossen, dass ein Arzt einen Patienten ohne dessen erklärtes Einverständnis tötet. Um eine Beihilfe zur Selbsttötung nämlich handelt es sich, wenn der Sterbewillige selbst die entscheidende, zum Tode führende Handlung vornimmt und die Beihilfe sich auf die Ermöglichung oder Erleichterung dieser Handlung beschränkt. Die Missbrauchsgefahr ist im Fall der Suizidassistenz demnach ungleich geringer: Der Sterbewillige muss den Akt eigenhändig und bei voller Urteilsfähigkeit ausführen. Hierfür wird eine tödliche Dosis NatriumPentobarbital bereitgestellt, das der Sterbewillige selbst zum Mund führen muss; fehlt hierfür die Kraft, besteht auch die Möglichkeit, eine Infusion durch das Betätigen eines Hahns in den eigenen Körper gelangen zu lassen. Der blinde Fleck der Befürworter/innen Doch nicht nur die begrifflichen Unschärfen, auch die Extremität der Positionen zeugt von einem Unwillen, gar einer Angst, sich mit dem Thema Suizidassistenz wirklich auseinanderzusetzen.Tatsächlich sind bei genauerem Hinsehen beide Sichtweisen, sowohl die der Befürworter/innen, wie auch die der Gegner/innen, unhaltbar. Beginnen wir mit den Befürwortern, die einem Sterbewilligen ein Recht auf Beihilfe auch dann zuzubilligen wollen, wenn er nicht todkrank, sondern lediglich ›genug‹ hat. Das hieße in letzter Konsequenz: Ein altersschwacher Mensch, der unter Niereninsuffizienz oder Parkinson leidet, hat genauso einen Anspruch auf Beihilfe wie ein von Liebeskummer und Weltschmerz geschüttelter Jugendlicher oder ein Depressiver, der gerade eine Episode durchlebt. Weniger überspitzt formuliert: Wo genau wollte man die Grenze ziehen, wenn letztlich nur der Betroffene selbst entscheiden kann, wann er ›lebenssatt‹ ist? Wie könnte bei einem solch subjektiven Kriterium, das sich jeder objektiven Überprüfbarkeit entzieht, noch eine Assistenz abgelehnt werden? »Wer bestimmt«, so der Publizist Fritz J. Raddatz, ebenfalls ein radikaler Befürworter der Suizidassistenz, »was jemand wann auf welche Weise darf? Der Staat? Ich spreche dem Staat rundweg jegliches Recht dazu ab« (Raddatz 2012). An dieser Stelle tritt das fundamentale Problem zutage, über das in den flammenden Plädoyers mit keinem Wort gesprochen wird: Dass nämlich bei einer Beihilfe zur Selbsttötung nicht einfach ein Mensch für sich entscheidet, dass sein Leben nicht mehr lebenswert ist, sondern er sich explizit an andere wendet. Diese Angesprochenen müssen moralisch vor sich selbst und der Gesellschaft rechtfertigen können, einem Menschen bei der Beendigung seines Lebens geholfen zu haben. Hier kommt eine weitere wichtige Unterscheidung zum Tragen: So hat ein Patient und eine Patientin hierzulande nämlich durchaus ein absolutes Selbstbestimmungsrecht, wenn es um die Frage geht, welche ärztlichen Maßnahmen er am eigenen Körper vornehmen lassen will und welche nicht. Für den Fall, dass jemand schriftlich in seiner Patientenverfügung fixiert, dass er etwa im Falle einer Demenz oder eines schweren Unfalls nicht medizinisch behandelt werden möchte, müssen sich Mediziner/innen sich an diese Vorgabe halten – und zwar auch dann, wenn in der konkreten Situation noch die Möglichkeit auf eine Heilung bestünde. Die Nichtanwendung eines Medikaments, das Abschalten eines Gerätes, das Unterlassen eines Heilungsversuchs ist aber etwas fundamental anderes, als ein tödliches Mittel bereitzustellen. Im ersten Fall wird der Natur freien Lauf gelassen und die Verfügungsgewalt des je einzelnen über seinen eigenen Körper gewahrt. Im letzten Fall hingegen verhilft ein Mensch einem anderen zum Suizid - und die Verantwortung für diese Hilfe ist letztlich gerade nicht in allen Fällen tragbar. Um ein Beispiel zu nennen: In der Schweiz dürfen seit 2004 auch psychisch Kranke Sterbehilfe in Anspruch nehmen, wenn ihr Sterbewunsch »autonom«, »dauerhaft« und »wohlerwogen« ist. Die Gefahr jedoch, dass eine Organisation gerade durch ihre ›Hilfe‹ das (womöglich aus sozialer Kälte resultierenden) Minderwertsempfinden eines Kranken bestätigt, lässt sich im Fall einer Depression kaum ausschließen: »Es hätte mich nie geben sollen«, so schrieb eine psychisch kranke Frau im Frühjahr 2005 an die Organisation Exit. Und: »Meine eigene Familie wusste ja nichts Richtiges anzufangen mit mir« (vgl. Flaßpöhler 2013: S. 51 ff.). Ein paar Monate später verhalf ihr Exit zur Selbsttötung. Kann ein Suizidbeihelfer, kann eine Suizidbeihelferin sein bzw. ihr Handeln wirklich mit dem Argument rechtfertigen, dass er bzw. sie einem lebensmüden Menschen lediglich seinen Wunsch erfüllt? Wer diese Meinung ernsthaft vertritt, negiert und leugnet das innerste Funktionsgesetz menschlichen Zusammenlebens: Auch in einer Zeit, in der die Selbstbestimmung des Individuums zu den höchsten Werten zählt, beruht das Funktionieren einer jeden Gesellschaft darauf, dass Menschen einander im Leben halten, sich wechselseitig vom Leben überzeugen, solange noch Möglichkeiten weiterzuleben vorhanden sind. Bei psychisch kranken Menschen ist diese Möglichkeit nie zweifelsfrei auszuschließen - das hat jüngst der Fall »Dianne« in den Niederlanden gezeigt. Die 35-jährige Frau wurde auf eigenen Wunsch durch aktive Sterbehilfe getötet; einer ihrer Hausärzte hat nun geklagt, da seiner Meinung nach noch Heilungschancen bestanden hätten. Wer aufgibt, sich selbst und anderen gute Gründe zu liefern, am Leben zu bleiben und Todeswünsche vorschnell, mitunter regelrecht sklavisch erfüllt, untergräbt das Gelingen von Sozietät überhaupt: Ohne den Lebenswillen des einzelnen würde jede Gesellschaft in sich zusammenbrechen. Dieser Wille – darauf haben Philosophen der Moderne eindrücklich hingewiesen - ist aber weder gottgegeben, noch allein auf das wollende Subjekt beziehbar. Vielmehr beruht er gerade in einer säkularisierten, aufgeklärten Gesellschaft insbesondere auf einem gelungenen Miteinander. »Wir kommen aus ohne Gott«, so schreibt Jean Améry in Hand an sich legen. »Wir kommen nicht aus ohne den Anderen« (Améry 1992, S. 45). Auch wenn der Mensch am Beginn der Moderne an die Stelle Gottes getreten ist, heißt das folglich nicht, dass er diese Position als Einzelner besetzt. Nur weil wir uns darauf verlassen können, dass die anderen uns im Leben halten wollen und auch selbst am Leben hängen, gehen wir Beziehungen ein, lieben wir, arbeiten wir, ja, trauen wir uns morgens überhaupt auf die Straße. Wer nicht am Leben hängt, wer es zu opfern bereit ist, zerschneidet das Band, wird unter Umständen sogar zu einer Gefahr für die Gesellschaft, wie sich besonders extrem an Amokläufern und Selbstmordattentätern zeigt. Unhaltbarer Paternalismus Damit ist allerdings nicht gesagt, dass Leben unter allen Umständen erhaltenswert wäre; noch soll der Suizid als ›teuflisch‹ oder ›böse‹ verdammt werden. Genauso wenig, wie der Lebenswille rein natürlich ist, gibt es eine wie auch immer geartete Pflicht zu leben. Wer hätte das Recht, diese unbedingt auszusprechen? Wie wäre ihre Verbindlichkeit einzuklagen? Damit kommen wir zur Kritik der anderen Seite, der radikalen Suizidassistenzgegner, zu denen auch die Bundesärztekammer und ihr Präsident Frank Montgomery gehört. Um ihre ablehnende Haltung zu begründen, beruft sich die Kammer gebetsmühlenartig auf den Hippokratischen Eid: »Auch werde ich niemandem ein tödliches Gift geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde.« Entsprechend sieht die Musterberufsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland ein standesrechtliches Verbot der Suizidassistenz vor: »Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen […]. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.« Was aber legitimiert diesen über 2000 Jahre alten Eid in Zeiten hochgerüsteter Medizin und fortgeschrittener Diagnostik? Nehmen wir den Fall des Schriftstellers Wolfgang Herrndorf: Herrndorf wusste, dass er an einem unheilbaren Hirntumor leidet, er wusste, dass er an diesem Tumor binnen weniger Jahre sterben würde. Die Qualen, die ihm dieses Wissen bereiteten, kann ein gesunder Mensch schwerlich nachvollziehen. Sein Nachdenken über Suizid hat Herrndorf in seinem jüngst als Buch erschienenen Blog eindrücklich geschildert (Herrndorf 2013). Im August vergangenen Jahres nahm sich Herrndorf durch einen Kopfschuss das Leben – Freunde geleiteten den schon stark geschwächten Autor auf dem Weg zu Tat. Ein eigens durchgeführter Suizid bleibt allerdings mit einem hohen Risiko des Misslingens verbunden. Viele Selbstmordversuche enden mit schwersten Behinderungen. Ein assistierter Suizid hingegen birgt diese Gefahr nicht: Natrium-Pentobarbital lässt Sterbewillige schmerzlos und garantiert entschlafen. Zudem ist durch das vergleichsweise ›sanfte‹ Sterben die Möglichkeit gegeben, Angehörige teilhaben zu lassen, sich von ihnen zu verabschieden. Ein begleiteter Suizid zumal, wenn er zuhause, in der gewohnten Umgebung geschieht - vermag einem Menschen jene Würde zurückzugeben, die seine Krankheit ihm genommen haben mag. Ein Arzt hingegen, der mit Verweis auf den Hippokratischen Eid todkranken Patienten den erlösenden Tod verweigert, erniedrigt sie unter Umständen zusätzlich. Vor diesem Hintergrund muss auch das von Sterbehilfegegnern vielbeschworene »Dammbruchargument« einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Ein Satz nach dem Strickmuster: »Wenn wir die Suizidassistenz nicht unter Strafe stellen, dann gerät die Gesellschaft auf eine schiefe Ebene« ist kein Argument, sondern zunächst eine Befürchtung. Anders gesagt: Die von Lebensschützern oft verwendete »Wenn-Dann«-Konstruktion ist keine logische, sondern eine spekulative. Gewiss, die Befürchtungen sind nicht gänzlich ohne Gehalt: Der Pflegenotstand in deutschen Krankenhäusern und Altenheimen ist genauso unabweisbar gegeben wie die zunehmende Prekarisierung der Bevölkerung und ein immer strengerer Leistungsimperativ, der ›ineffiziente‹ Mitbürger auf besorgniserregende Weise entwertet. Wenn diese Entwicklung flankiert wird von einer romantisierten Thanatos-Ethik à la Reiter, sollten alle Alarmglocken läuten. Bei einer Legalisierung der Suizidassistenz aber schlittern wir keineswegs zwangsläufig auf den Abgrund zu; vielmehr wäre es gerade Aufgabe einer umsichtigen Gesetzgebung, die Gefahr des Abrutschens zu vermeiden. Lösungsvorschlag Aus der Kritik an beiden Positionen folgt: Die Last der Verantwortung für eine Suizidassistenz ist gesellschaftlich (nur) zu tragen, wenn die Situation eines Kranken zweifelsfrei keine Lebensmöglichkeiten mehr offen lässt. Nur für Menschen, deren Krankheit in kurzer Zeit unumkehrbar zum Tode führt, ist der Freitod wirklich der letzte Ausweg. Das eine Legitimation der Freitodhilfe in derart klar umgrenzten Fällen durchaus nicht zu einer gesellschaftlichen Schieflage führt, zeigt das Beispiel des US-Staates Oregon: Zentrale Bedingung für einen begleiteten Suizid ist dort, dass der Kranke nur noch sechs Monate zu leben hat. Zwei Ärzte müssen ein entsprechendes Attest ausstellen und die Urteilsfähigkeit des Kranken bestätigen. Überdies hat der Patient seinen Sterbewunsch in einem Abstand von vierzehn Tagen zweimal mündlich und anschließend noch einmal schriftlich zu bekunden. Seit der Einführung des Sterbehilfegesetzes im Jahr 1997 bis zum Jahr 2013 haben insgesamt 752 Menschen eine Beihilfe in Anspruch genommen. 2013 waren es 71; 122 hatten sich das Rezept ausstellen lassen. Dass 51 Menschen dieses letztlich nicht einlösten, ist bezeichnend: Den Betroffenen genügt offensichtlich oft die schlichte Möglichkeit, in einer als unaushaltbar empfundenen Situation gehen zu können. Auch die Angst, bei einer Legalisierung würden sich vornehmlich sozial schwache Menschen begleiten lassen, wird durch das Beispiel Oregon entkräftet: Vor allem die Gebildeten, Begüterten und gut Versicherten ersuchen um eine Beihilfe. Bleibt zu fragen, wer in Deutschland Freitodbegleitungen durchführen dürfte. Private Organisationen, so legen Erfahrungen in der Schweiz nahe, mögen strukturell nicht geeignet sein, eine seriöse Form der Suizidassistenz zu gewährleisten: Zu undurchsichtig ist die Motivation der ehrenamtlichen Freitodbegleiter/innen, zu fragwürdig die Tatsache, dass diese etwa bei der Organisation Exit 500 Franken Spesenpauschale pro ›Fall‹ erhalten, zu lax die Überprüfung der Anträge. Überlegenswert wäre daher, die Suizidassistenz allein Ärzten zu überlassen. Erstens, weil Ärzte qua standesrechtlicher Kontrolle zu größerer Sorgfalt bei der Prüfung etwaiger Fälle gezwungen sind; zweitens, weil niemand die Leiden todkranker Menschen besser kennt und einschätzen kann. Bislang verschließt sich die Bundesärztekammer solchen Überlegungen. Aber: Zu leben ist nicht an sich wertvoll und wünschenswert. Darauf haben Philosophen und Philosophinnen seit jeher und völlig zu Recht hingewiesen. Sich dieser unbequemen Wahrheit zu öffnen, ist gerade in Zeiten des medizinischen Fortschritts eine ärztliche, eine humane Pflicht. Literatur Aquino, Thomas von (1954): Summe der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart. Dritter Band. Stuttgart: Kröner. Améry, Jean (1992): Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart: Klett-Cotta. Camus, Albert (1958): Der Mythos des Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Düsseldorf: Karl Rauch Verlag. Flaßpöhler, Svenja (2013): Mein Tod gehört mir. Über selbstbestimmtes Sterben. München: Pantheon. Herrndorf, Wolfgang (2013): Arbeit und Struktur. Hamburg: Rowohlt. Kant, Immanuel (1968): Die Metaphysik der Sitten. Berlin/New York: Walter de Gruyter. Mayntz, G. (2014): Hermann Gröhe gegen Geschäft mit Sterbehilfe. http://www.rponline.de/politik/deutschland/berlin/hermann-groehe-gegen-geschaeft-mit-sterbehilfe-aid1.3925436 - 19.04.2014. Raddatz, Fritz J. (2012): Mein Tod gehört mir. In: die Welt. 4.4.2012. http://www.welt.de/print/die_welt/article106154103/Mein-Tod-gehoert-mir.html Reiter, Udo (2014): Mein Tod gehört mir. In: Süddeutsche Zeitung. (http://www.sueddeutsche.de/leben/selbstbestimmtes-sterben-mein-tod-gehoert-mir-1.1856111 4.1.2014) Seneca (1993): Briefe an Lucilius. In: Philosophische Schriften. Übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Otto Apelt. Band 3. Hamburg: Meiner.