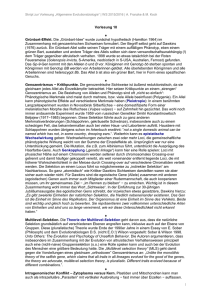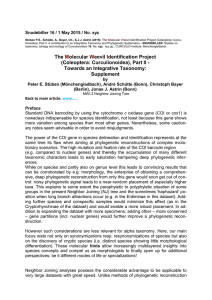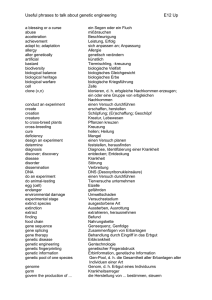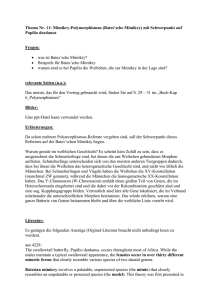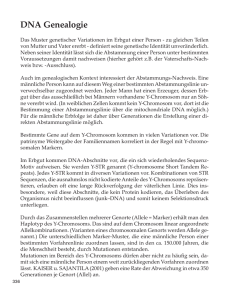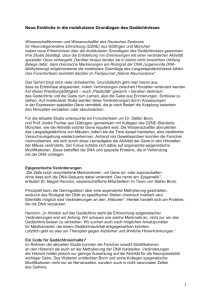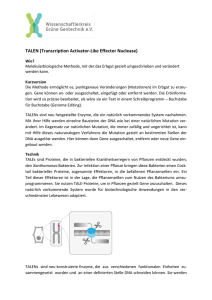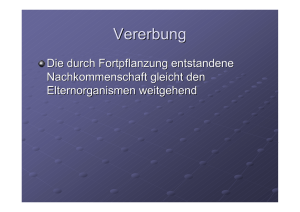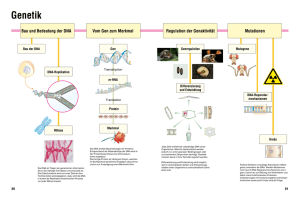Skript zur Vorlesung
Werbung
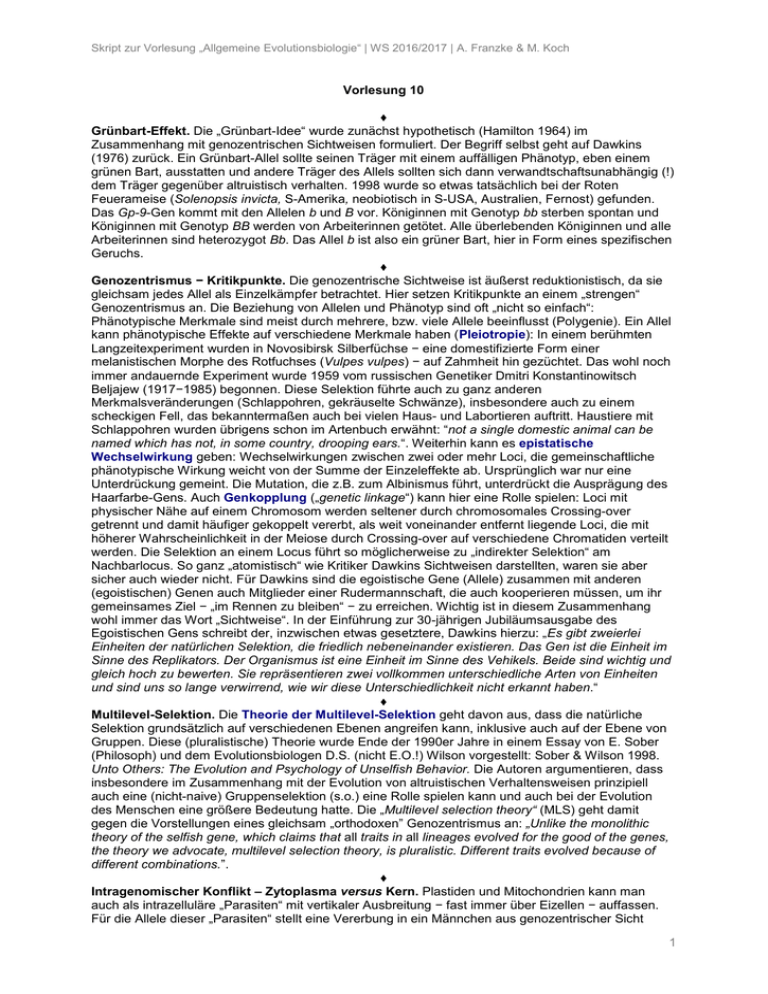
Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2016/2017 | A. Franzke & M. Koch Vorlesung 10 ♦ Grünbart-Effekt. Die „Grünbart-Idee“ wurde zunächst hypothetisch (Hamilton 1964) im Zusammenhang mit genozentrischen Sichtweisen formuliert. Der Begriff selbst geht auf Dawkins (1976) zurück. Ein Grünbart-Allel sollte seinen Träger mit einem auffälligen Phänotyp, eben einem grünen Bart, ausstatten und andere Träger des Allels sollten sich dann verwandtschaftsunabhängig (!) dem Träger gegenüber altruistisch verhalten. 1998 wurde so etwas tatsächlich bei der Roten Feuerameise (Solenopsis invicta, S-Amerika, neobiotisch in S-USA, Australien, Fernost) gefunden. Das Gp-9-Gen kommt mit den Allelen b und B vor. Königinnen mit Genotyp bb sterben spontan und Königinnen mit Genotyp BB werden von Arbeiterinnen getötet. Alle überlebenden Königinnen und alle Arbeiterinnen sind heterozygot Bb. Das Allel b ist also ein grüner Bart, hier in Form eines spezifischen Geruchs. ♦ Genozentrismus − Kritikpunkte. Die genozentrische Sichtweise ist äußerst reduktionistisch, da sie gleichsam jedes Allel als Einzelkämpfer betrachtet. Hier setzen Kritikpunkte an einem „strengen“ Genozentrismus an. Die Beziehung von Allelen und Phänotyp sind oft „nicht so einfach“: Phänotypische Merkmale sind meist durch mehrere, bzw. viele Allele beeinflusst (Polygenie). Ein Allel kann phänotypische Effekte auf verschiedene Merkmale haben (Pleiotropie): In einem berühmten Langzeitexperiment wurden in Novosibirsk Silberfüchse − eine domestifizierte Form einer melanistischen Morphe des Rotfuchses (Vulpes vulpes) − auf Zahmheit hin gezüchtet. Das wohl noch immer andauernde Experiment wurde 1959 vom russischen Genetiker Dmitri Konstantinowitsch Beljajew (1917−1985) begonnen. Diese Selektion führte auch zu ganz anderen Merkmalsveränderungen (Schlappohren, gekräuselte Schwänze), insbesondere auch zu einem scheckigen Fell, das bekanntermaßen auch bei vielen Haus- und Labortieren auftritt. Haustiere mit Schlappohren wurden übrigens schon im Artenbuch erwähnt: “not a single domestic animal can be named which has not, in some country, drooping ears.“. Weiterhin kann es epistatische Wechselwirkung geben: Wechselwirkungen zwischen zwei oder mehr Loci, die gemeinschaftliche phänotypische Wirkung weicht von der Summe der Einzeleffekte ab. Ursprünglich war nur eine Unterdrückung gemeint. Die Mutation, die z.B. zum Albinismus führt, unterdrückt die Ausprägung des Haarfarbe-Gens. Auch Genkopplung („genetic linkage“) kann hier eine Rolle spielen: Loci mit physischer Nähe auf einem Chromosom werden seltener durch chromosomales Crossing-over getrennt und damit häufiger gekoppelt vererbt, als weit voneinander entfernt liegende Loci, die mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Meiose durch Crossing-over auf verschiedene Chromatiden verteilt werden. Die Selektion an einem Locus führt so möglicherweise zu „indirekter Selektion“ am Nachbarlocus. So ganz „atomistisch“ wie Kritiker Dawkins Sichtweisen darstellten, waren sie aber sicher auch wieder nicht. Für Dawkins sind die egoistische Gene (Allele) zusammen mit anderen (egoistischen) Genen auch Mitglieder einer Rudermannschaft, die auch kooperieren müssen, um ihr gemeinsames Ziel − „im Rennen zu bleiben“ − zu erreichen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang wohl immer das Wort „Sichtweise“. In der Einführung zur 30-jährigen Jubiläumsausgabe des Egoistischen Gens schreibt der, inzwischen etwas gesetztere, Dawkins hierzu: „Es gibt zweierlei Einheiten der natürlichen Selektion, die friedlich nebeneinander existieren. Das Gen ist die Einheit im Sinne des Replikators. Der Organismus ist eine Einheit im Sinne des Vehikels. Beide sind wichtig und gleich hoch zu bewerten. Sie repräsentieren zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Einheiten und sind uns so lange verwirrend, wie wir diese Unterschiedlichkeit nicht erkannt haben.“ ♦ Multilevel-Selektion. Die Theorie der Multilevel-Selektion geht davon aus, dass die natürliche Selektion grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen angreifen kann, inklusive auch auf der Ebene von Gruppen. Diese (pluralistische) Theorie wurde Ende der 1990er Jahre in einem Essay von E. Sober (Philosoph) und dem Evolutionsbiologen D.S. (nicht E.O.!) Wilson vorgestellt: Sober & Wilson 1998. Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior. Die Autoren argumentieren, dass insbesondere im Zusammenhang mit der Evolution von altruistischen Verhaltensweisen prinzipiell auch eine (nicht-naive) Gruppenselektion (s.o.) eine Rolle spielen kann und auch bei der Evolution des Menschen eine größere Bedeutung hatte. Die „Multilevel selection theory“ (MLS) geht damit gegen die Vorstellungen eines gleichsam „orthodoxen” Genozentrismus an: „Unlike the monolithic theory of the selfish gene, which claims that all traits in all lineages evolved for the good of the genes, the theory we advocate, multilevel selection theory, is pluralistic. Different traits evolved because of different combinations.”. ♦ Intragenomischer Konflikt – Zytoplasma versus Kern. Plastiden und Mitochondrien kann man auch als intrazelluläre „Parasiten“ mit vertikaler Ausbreitung − fast immer über Eizellen − auffassen. Für die Allele dieser „Parasiten“ stellt eine Vererbung in ein Männchen aus genozentrischer Sicht 1 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2016/2017 | A. Franzke & M. Koch somit eigentlich eine Sackgasse dar, da sie von dort nicht in eine nächste Generation gelangen können. Bei einigen Blütenpflanzen kommen mitochondriale „male killer genes“ (S-Allele) vor, die zu männlich sterilen Blüten führen, die sich durch diese „Männervermeidung“ egoistisch verhalten (cytoplasmatisch-kerngenetische Pollensterilität, „cytoplasmatic male sterility“, CMS). ♦ Intragenomischer Konflikt − Meiotischer Drive. Durch einen meiotischen Drive („segregation distortion“) können homologe Chromosomen bzw. Allele − im Gegensatz zur „normal“ ablaufenden Meiose − in den Gameten überrepräsentiert sein. Es gibt verschiedene Mechanismen, die einen meiotischen Drive bewirken (meist chromosomaler Drive bei der Eizellbildung und ein genischer Drive bei der Spermienbildung). Der genische Drive beruht auf einer Entwicklungsstörung derjenigen Gameten, welche das betreffende Gen nicht besitzen. Ein gut untersuchtes Beispiel ist das sd-System („segregation distorter“) in Drosophila: Das sd-Gen kommt in zwei Allelen vor („aggressiv“ und „nichtaggressiv“), die einen eng gekoppelten Rsp-Locus („responder“) kontrollieren, der die SpermienBildung steuert und ebenfalls zwei Allele hat („anfällig“ und „resistent“). Das aggressive distorter-Allel produziert ein Protein, das an den anfälligen responder-Locus binden kann und somit verhindert, dass sich ein Spermium mit solch einer „Vergiftung“ entwickeln kann. Bei den Homozygoten sd-„nicht aggressiv“ passiert natürlich weiter nichts; ebenso bei den Homozygoten „resistent“. Bei den Heterozygoten sd-„aggressiv“ und „nicht-aggressiv“ gelangt das agressive Allel aber in alle Spermien, die überhaupt gebildet werden und sollte so in seiner Frequenz steigen. Solche Gene (Allele) werden als ultraegoistisch oder auch als Renegaten (Abtrünnige) bezeichnet. ♦ Intragenomischer Konflikt − Geschlechtschromosomen. Die Gene, die bei Säugetieren auf dem Y-Chromosom liegen, sind gleichsam in der väterlichen Linie gefangen. Wenn man auch hier von egoistischen Genen ausgeht, könnte es hier eigentlich ein sogenanntes „Blaubart-Allel“ geben, das dafür sorgt, dass der Träger (fast) alle seine Töchter tötet und an seine Söhne verfüttert. (Blaubart ist eine frauenmordende Märchengestalt.) Aus neodarwinistischer Sicht würde der Allelträger so natürlich die Hälfte seiner Fitness einbüßen, aus Sicht eines egoistischen Gens sollte sich solch ein Allel allerdings stark in der Population durchsetzen, auch weil die Söhne ja (fast) keine Konkurrenz durch Töchter (mehr) haben. (Bisher „zum Glück“ ein rein hypothetisches Modell: Smith & Price 1973.) Das Verhältnis der Geschlechtschromosomen beträgt bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis 3X zu 1Y. Egoistische Gene sollten sich eigentlich also „ungern“ auf dem unterzähligen Y-Chromosom aufhalten. In der Tat verließen und verlassen Gene das Y-Chromosom, dessen vornehmste Aufgabe es ist, das SRY-Gen („sex determining region Y gene“) zu tragen. Beim Menschen trägt das YChromosom insgesamt etwa nur etwa 20 Gene. Die Hypothese ist, dass das Y-Chromosom weiter schrumpft und SRY schließlich ein neues Autosom besetzt und das Ganze von vorne losgeht. Verhältnisse beim Medakafisch (Oryzias latipes, Japan) stützen diese Hypothese: Hier sind X- und YChromosom beide gleich groß und das Y-Chromosom wohl also „brandneu“. ♦ Egoistische DNA. Der Begriff „egoistische DNA“ darf nicht mit dem Begriff der „egoistischen Gene“ verwechselt werden. Das Konzept der egoistischen DNA beschreibt bzw. „erklärt“ den Befund, dass es DNA-Sequenzen gibt, die ihre Kopienzahl im Genom steigern und offensichtlich keinen Einfluss auf Fitness haben. Orgel & Crick 1980: Selfish DNA: the ultimate parasite. Nature 284, 604–607 („The spread of selfish DNA sequences within the genome can be compared to the spread of a not-tooharmful parasite within its host”). Diese Idee bezog sich vor allem auf funktionslose nicht-kodierende DNA, wobei die Einschätzung, dass wirklich absolut keine Funktion vorliegt natürlich erst mal problematisch ist. Transposons (mit replikativer Transposition) und B-Chromosomen (überzählige Chromosomen) gelten als egoistische DNA. Dahinterstehende molekulare Mechanismen auf Genomebene werden zusammenfassend als „molecular drive“ bezeichnet. Dover 1982. Molecular drive: A cohesive mode of species evolution. Nature 299, 111–117. Die großen Mengen repetitiver DNA in Genomen (z.B. Mini- bzw. Mikrosatelliten) sind aber wohl vielleicht doch nicht so funktionslos, wie früher z.T. vermutet wurde. Grechko 2011. Repeated DNA sequences as an engine of biological diversification. Molecular Biology 45, 704−727: “There is a growing evidence that the usage of methaphoric designations of protein-noncoding sequences as "egoistic, junk or parasitic" are senseless and useless.” Repetitive Elemente haben unter anderem wohl eine Bedeutung bei epigenetischen Regulationen (s.u.). ♦ Wie Darwinisten denken – Stern von Madagaskar. Weil der Stern von Madagaskar (Angraecum sesquipedale, Orchidaceae, Epi- bzw. Lithophyt, O-Küste Madagaskar, „sesquipedale“ bedeutet „anderthalb Fuß“) gerade im Botanischen Garten blüht, wurde die Pflanze mitgebracht und dann auch dieser „Klassiker“ der (Ko)Evolutionsbiologie vorgestellt: Darwin stellt 1862 in einem Orchideenbuch die These auf, dass Angraecum sesquipedale mit seinem bis zu 40 cm langen, im unteren Teil mit Nektar gefülltem Blütensporn durch einen – bis dahin unbekannten – Schmetterling 2 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2016/2017 | A. Franzke & M. Koch mit entsprechend langem Rüssel bestäubt wird. Er wird daraufhin „natürlich“ von zeitgenössischen Entomologen verspottet. 1903 wurde dann tatsächlich ein solcher Schwärmer Xanthopan morganii praedicta – „praedictus“ bedeutet „der Vorausgesagte“ – beschrieben. Allerdings wurde erst 1997 auch ein Blütenbesuch dieses Schwärmers durch Photos dokumentiert. Durch den anthropogen bedingten Rückgang des Wirtsbaums der Xanthopan-Raupe in den letzten Jahrzehnten ist der Stern von Madagaskar stark bedroht. Messungen an einem Standort ergaben, dass hier im Jahr 1934 aus 75% der Blüten, Früchte hervorgingen, aktuell nur noch aus etwa 1%. ♦ Ana- & Kladogenese. Anagenese (Artumwandlung) ist die Evolution eines Merkmals innerhalb einer Abstammungslinie, z.B. einer Art, bzw. die Entwicklung eines Taxons ohne Aufspaltung. Kladogenese ist die Verzweigung von Abstammungslinien. Diese Begriffe wurden 1947 durch den deutschen Zoologen Bernhard Rensch (1900−1990) geprägt; ein (weiterer) Architekt der synthetischen Evolutionstheorie. (Rensch und andere frühere Autoren verwendeten den Begriff Anagenese allerdings wertend im Sinne einer „Höherentwicklung“.) In einem Stammbaum stellt jeder Knoten ein Artbildungsereignis dar, also die Aufspaltung einer Stammart in zwei Schwesterarten (Arten, die unmittelbar auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen). Speziation (Artbildung) ist also gleichsam die Brücke zwischen Mikro- und Makroevolution, die letztendlich zu taxonomischer Vielfalt führt. Ein Taxon (griech. (An)ordnung/Ausrichtung; Pl.: Taxa) ist eine benannte Einheit, welcher Individuen oder Arten zugeordnet werden. Oberhalb der Artebene spricht man von höheren Taxa (Gattungen, Familien, etc.). Der Begriff „Taxon“ wurde übrigens 1926 durch den gebürtigen Ostfriesen Adolf Meyer-Abich (1893−1971, Philosoph, Naturwissenschaftshistoriker) geprägt und schließlich 1950 auf dem Botanischen Kongress in Stockholm für den Internationalen Code der Botanischen Nomenklatur (ICBN) eingeführt. In einem weiteren Sinne wurde/wird in der (deutschsprachigen) Botanik der Begriff „Sippe“ z.T. synonym für „Taxon“, zumeist für Einheiten unterhalb der Artebene, verwendet. Im eigentlichen Sinne ist eine Sippe eine konkrete (reale) Population, die − wenn ihr eine („virtuelle“) taxonomische Rangstufe zugewiesen wird − zum Taxon wird: Taxon = Sippe + Rangstufe. ♦ On the Origin of Species. Das Artenbuch behandelt „nicht wirklich“ die „origin of species“ im Sinne von Artentstehung (Speziation) bzw. Kladogenese, sondern vor allem den Mechanismus der natürlichen Selektion, der zu Anagenese (Artumwandlung) führen kann. Häufig wurde/wird darüber hinaus betont, dass das Artenbuch auch keine Artdefinition enthielte. Insbesondere für Ernst Mayr (s.u.) hatte Darwin nicht wirklich verstanden, was Arten seien bzw. wie Speziation funktioniere und Darwin wurde sogar gleichsam ein „Arten-Nihilismus“ unterstellt. Im Artenbuch gibt es aber (natürlich) schon einige Passagen, in denen sich Darwin mit dem Artbegriff auseinandersetzt, die aber naturgemäß nicht einfach in Einklang zu bringen sind: Einerseits „glaubte“ Darwin an die Existenz von Arten, die man (generell) anhand von (morphologischen) Variationslücken voneinander abgrenzen kann. Andererseits hatten Arten für Darwin aber keine besonderen ‘‘essences“ und waren für ihn nicht „fundamentally’’ verschieden von Varietäten einer Art, zwischen denen oft eine kontinuierliche Variation vorliegt. Hier zwei Zitate dazu: “the only distinction between species and wellmarked varieties is, that the latter are known, or believed, to be connected at the present day by intermediate forms, whereas species were formerly thus connected “ und „To sum up, I believe that species come to be tolerably well-defined objects, and do not at any one period present an inextricable chaos of varying and intermediate links …”. Diese wissenschaftshistorische Arbeit liefert Einzelheiten zu Darwins Artkonzept und dessen Rezeption: Mallet 2010. Why was Darwin’s view of species rejected by twentieth century biologists? Biology & Philosophy, 25: 497–527. ♦ Artbegriff. Der Begriff „Art“ hat folgende Bedeutungsebenen: Zunächst kann „Art“ (Spezies) erst mal, rein technisch, eine Bezeichnung für eine (bestimmte) taxonomische Rangstufe sein (Kategorie). Mit „Art“ kann auch eine reale Population gemeint sein, die diesen Rang zugesprochen bekommt (Taxon). Davon zu unterscheiden ist der Artbegriff im Sinne einer Definition, was eine Art denn wohl sei (Artkonzept). Definitionen sind grundsätzlich immer „nur“ Definitionen, zunächst also weder „falsch“ noch „richtig“. Konventionelle Definitionen können allerdings natürlich „falsch“ verwendet werden und Definitionen können grundsätzlich mehr oder weniger nützlich bzw. angemessen sein. Artdefinitionen im Sinne von Artkonzepten gibt es eine ganze Reihe. Diese Arbeit listet z.B. 22 Konzepte (mit Synonymen): Mayden 1997. A hierarchy of species concepts: the denouement in the saga of the species problem. In Species: the Units of Biodiversity. Chapman & Hall, 381−424. Nur für einen Eindruck, die hier erwähnten „species concepts“ und ihre Abkürzungen: 1. Agamospecies (ASC), 2. Biological (BSC) 3. Cohesion (CSC), 4. Cladistic (CISC), 5. Composite (CpSC), 6. Ecological (EcSC), 7. Evolutionary Significant Unit (ESU), 8. Evolutionary (ESC), 9. Genealogical Concordance (GCC), 10. Genetic (GSC), 11. Genotypic Cluster Definition (GCD), 12. Hennigian (HSC), 13. Internodal (ISC), Morphological (MSC), 15. Non-dimensional (NDSC), 16. Phenetic (PhSC), 17. Phylogenetic (PSC), 3 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2016/2017 | A. Franzke & M. Koch 18. Polythetic (PtSC), 19. Recognition (RSC), 20. Reproductive Competition (RCC), 21. Successional (SSC), 22. Taxonomic (TSC). ♦ Artdefinitionen bzw. -konzepte. Ganz generell können Artkonzepte folgendes leisten: 1.) Organismen klassifizierbar machen, 2.) diskreten Organismengruppen entsprechen, 3.) Bezug auf Entstehungsmodus nehmen oder 4.) auf ihre evolutionäre Geschichte und/oder 5.) sind möglichst umfassend (alle „Lebensformen“). Kein Artkonzept „bedient alles“ (s.u.), sondern verschiedene Definitionen sind letztlich, je nach Kontext, mehr oder weniger nützlich. ♦ Morphologische & taxonomische Arten. Artkonzepte früher Taxonomen, wie z.B. Linné, für den Arten ja (im Prinzip) „gottgegeben unveränderlich“ waren (s.o.), hatten ihre Wurzeln in Vorstellungen Platons bzw. Aristoteles, die (reale) Individuen einer Art als Erscheinungsformen einer Idee („eidos“) ansahen. Variationen wurden hier als Abweichungen vom Ideal betrachtet. Solche Artkonzepte wurden von Ernst Mayr (s.u.) als typologisch bzw. essenzialistisch bezeichnet. Hierher gehören der morphologische Artbegriff mit der Morphospezies (auch „classical species“) als kleinste Gruppe, die konsistent verschieden und durch einfache Mittel unterscheidbar sind und die (wesensverwandte) taxonomische Art, zu der diejenigen Individuen gehören, die von einem kompetenten Taxonomen auf der Basis von morphologischen (oder anderen) Merkmalen dieser Art zugeordnet werden. Generelle Vorteile solcher typologischer Konzepte: „Einfach“ anwendbar, können auch bei „asexuellen Arten“ und Fossilien angewandt werden. Generelle Probleme: Arten bzw. Populationen evolvieren, Objektivierbarkeit der verwendeten Merkmale, Unterscheidung kryptischer Arten (s.u.), Umgang mit evtl. vorhandenen Polymorphismen, Sexualdimorphismen, unterschiedlichen Ontogeniestadien und phänotypischer Plastizität. ♦ Phylogenetische Art. Das phylogenetische Artkonzept („phylogenetic species concept, PSC“) gibt es in mindestens 3 Varianten, die in den 1980er und -90er Jahren von Systematikern formuliert wurden und phylogenetische (stammesgeschichtliche) gemeinsame Abstammung aller Individuen einer Art betonen. Gemeinsam ist den Varianten, dass es hier darum geht, die kleinste biologische Einheit (die Art) zu finden, die diagnostizierbar und/oder insbesondere monophyletisch ist, also auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Cracraft (1983): „A species is the smallest diagnosable cluster of individual organisms within which there is a parental pattern of ancestry and descent.“ Arten werden hier letztlich durch in allen Populationen (fixierte) diagnostische Merkmale voneinander abgegrenzt. Dazu werden phylogenetische Methoden, wie Stammbaumrekonstruktionen (s.u.) angewendet und das phylogenetische Artkonzept ist somit ein praktischer Ansatz des sehr allgemeinen evolutionären Artkonzepts, bei der eine Art eine Linie ist, die unabhängig von anderen Linien evolviert. Vorteile: Spiegelt „wahre“ Phylogenie wider, Anwendbarkeit auch bei asexuellen Arten und Fossilien. Probleme/Grenzen: Vorabdefinitionen der operationalen Einheiten (meist) mit typologischen Artkonzepten, Monophylie ist (markerbedingt) nicht immer erkennbar, retikulate (netzartige) Evolution durch Hybridartbildung (s.u.). ♦ Biologische Art. Das biologische Artkonzept („biological species concept, BSC“) wurde von Ernst Mayr ausgearbeitet und unter diesem Namen stark propagiert und war bzw. ist sehr prägend für den Artbegriff vieler Biologen und Laien. In jüngerer Zeit nimmt diese „Vormachtstellung“ allerdings wohl eher ab, weil in der Folge eben auch eine Reihe von Alternativen formuliert wurden und dieses Konzept auch deutliche Grenzen hat (s.u.). In seinem epochalen Buch „Systematics and the Origin of Species” von 1942, das als eines der vier bedeutendsten Werke der modernen Synthese gilt, definiert er (auf Seite 120) eine Art folgendermaßen: „Species are groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups“. Dieses Konzept betont also die Eigenschaft einer reproduktiven Isolation und nicht die Typologie bzw. Monophylie oder die oder die Bildung einer ökologischen Nische (ökologisches Artkonzept). Später (1982), definierte Mayr etwas beschreibender: „A species is a reproductive community of populations (reproductively isolated from others) that occupies a specific niche in nature.“ Für Mayr stellte sein Konzept einen Durchbruch der Evolutionsbiologie dar, da nun – im Gegensatz zu Darwins Ansichten (s.o.) – das wesentliche Merkmal von Arten, nämlich die reproduktive Isolation erkannt sei und dass Arten somit auch reale (!) biologische Einheiten darstellen und nicht, wie er Darwin unterstellte (s.o.), nur willkürlich durch Menschen festgelegte Einheiten eines kontinuierlichen Diversifizierungsprozesses. Darwin behandelte übrigens das Phänomen der reproduktiven Isolation in Form von Hybridsterilität auch schon im Artenbuch; für ihn stellte diese jedoch ein Nebenprodukt der Evolution und kein Schlüsselmerkmal einer Art dar, wohl auch weil solche reproduktiven Isolationen variieren können. Das biologische Artkonzept geht aber auch nicht (!) davon aus, dass alle biologischen Arten immer 100%ig reproduktiv isoliert sind und eine reproduktive Isolation muss auch nicht unbedingt Bastardsterblichkeit oder sterilität beinhalten. Vorteile des Konzepts: Variationen innerhalb und zwischen Populationen werden 4 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2016/2017 | A. Franzke & M. Koch integriert, es greift bei Zwillingsarten („sibling species“), also morphologisch sehr ähnlichen biologische Arten bzw. bei Kryptospezies („cryptic species“) morphologisch ununterscheidbaren Biospezies. Probleme/Grenzen: Nicht anwendbar auf fossile und asexuelle Arten (Mayr: „Bakterien haben keine Arten“) und strenggenommen eigentlich auch nicht auf allopatrische Populationen, also geographisch getrennte Populationen, weil die sich eben nicht treffen und es somit nicht zum sogenannten Sympatrietest kommt, bei dem sich eben zeigt, ob sich die beiden Population „vermischen“ oder nicht. Mayr hat insbesondere bewirkt, dass die Evolutionsbiologie sich im Rahmen der modernen Synthese (und danach) mit Artkonzepten und vor allem mit Artbildungsprozessen (s.u.) intensiv auseinandergesetzt hat (und weiterhin auseinandersetzt). ♦ Biologische Art − Isolationsmechanismen. Es gibt eine Reihe von Isolationsmechanismen, die eine reproduktive Isolation zwischen (biologischen) Arten bewirken. Der „Futuyma“ bevorzugt hierfür allerdings den Begriff „Barriere“ („isolating barriers“ oder „barriers to gene flow“) statt „Mechanismus“, weil sich der Begriff „isolating mechanisms“ im engeren Sinne auf Konzepte des „reinforcement“ bezieht (s.u.). – Progame, präzygotische Isolationsmechanismen verhindern den Gametenaustausch: Ökologische Isolation (z.B. Fortpflanzung zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Habitaten), ethologische Isolation (z.B. unterschiedliches Paarungsverhalten), Bestäuberisolation (Anpassungen an unterschiedliche Bestäuber bzw. Bestäubungsvorgänge). – Postgame, präzygotische Isolationsmechanismen: Mechanische oder Verhaltensisolation bei einer Paarung, gametische Isolation (Inkompatibilität zwischen artverschiedenen Gameten oder arteigene Spermien- bzw. Pollenschlauchprioritäten). – Postzygotische Barrieren: Hybrid ökologisch nicht lebensfähig („fehlende“ Nische), Verhaltenssterilität (Hybrid hat kein bzw. wenig erfolgreiches Paarungsverhalten), insbesondere Bastardsterblichkeit (gestörte Ontogenese) und Bastardsterilität (gestörte Meiose führt zu aneuploiden Gameten). ♦ Aufgaben ♦ Was ist denn eigentlich für Sie eine Art? ♦ Erläutern Sie folgende Aussage: Allopatrische Populationen mit fixierten Merkmalen sind nach dem phylogenetischen Artkonzept verschiedene Arten, nach dem biologischen Artkonzept möglicherweise geographische Varianten einer Art. ♦ 5