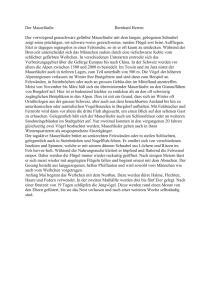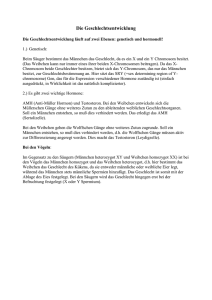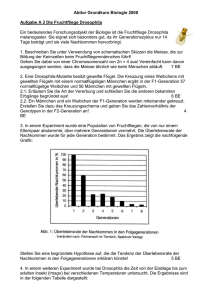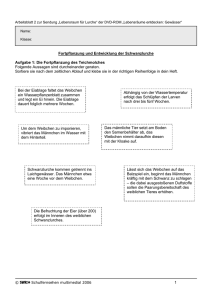Pressedienst Forschung Aktuell 6/2007
Werbung

Pressedienst Forschung Aktuell 6/2007 Tübingen, 25. Juni 2007 Zoologie Zwitter können, weil sie weibliche und männliche Geschlechtsfunktionen besitzen, besonders flexibel auf wechselnde Paarungschancen mit ihren Artgenossen reagieren. Dennoch hat sich Zwittrigkeit bei höher organisierten Tieren nicht durchgesetzt. Prof. Nico Michiels hat festgestellt, dass sie zu einer ungezügelten Entwicklung der männlichen Funktion führt. Die Getrenntgeschlechtlichkeit fördert hingegen die Kooperation zwischen den Geschlechtern. „Zwitter spielen gerne Männchen“ Tierarten mit zweigeschlechtlichen Individuen geraten oft in eine Sackgasse der Evolution Die sexuelle Fortpflanzung scheint viele Vorteile mit sich zu bringen. Sonst, so könnte man vermuten, hätte sie sich bei den höher organisierten Lebewesen nicht so stark durchgesetzt. Für viele Tiere scheint es dabei kein Vorteil zu sein, die männliche und die weibliche Geschlechtsfunktion in einem Individuum zu vereinen. Zwitter, auch Hermaphroditen genannt, finden sich zwar vielfach an der Basis des Tierreichs zum Beispiel bei Schwämmen, Korallen, vielen Arten von Würmern und Schnecken. Doch insgesamt sind nur 15 Prozent der mehrzelligen Tierarten Zwitter. Die Vertreter besonders vieler erfolgreicher artenreicher Zweige des Tierreichs wie Insekten, Spinnen und Wirbel- bis hin zu Säugetieren wie dem Menschen sind hingegen getrenntgeschlechtlich. Prof. Nico Michiels vom Zoologischen Institut der Universität Tübingen erforscht, warum der Hermaphroditismus sich nicht stärker durchgesetzt hat, obwohl Zwitter sich generell schneller an wechselnde Paarungschancen in einer Population anpassen können. Der Zoologe kommt zu dem Ergebnis, dass das Dasein als Zwitter in eine evolutionäre Sackgasse führt, weil sich die Tiere mit ihrer männlichen Seite zu stark verausgaben. „Bei getrennten Geschlechtern hat das Männchen nur beschränkte Chancen, die Fortpflanzung zu kontrollieren, das kann nur das Weibchen, das die Eizellen hat“, erklärt Michiels, „das Männchen kann nur bessere Kopulationsorgane entwickeln, um näher an das Weibchen und die Eier heranzukommen.“ Ein Männchen wolle seine Befruchtungserfolge gegenüber anderen Männchen erhöhen. Auch wenn die Männchen untereinander kämpfen, werden die Weibchen davon jedoch nicht berührt. „Bei Zwittern ist das anders. Es gibt zwar auch dort einen Kampf um die Eier. Doch da Männchen und Weibchen ein Individuum sind, muss es beide Möglichkeiten optimieren.“ Wenn ein Zwitter auf einen anderen trifft, haben beide Interesse, die Eier des jeweils anderen zu befruchten. Auf den ersten Blick erwartet EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN Presse- und Öffentlichkeitsarbeit · Michael Seifert Wilhelmstr. 5 · 72074 Tübingen Tel. 0 70 71 · 29 · 7 67 89 · Fax 0 70 71 · 29 · 55 66 [email protected] Verantwortlich für diese Ausgabe: Janna Eberhardt Tel. 0 70 71 · 29 · 7 78 53 – [email protected] Wir bitten um Zusendung von Belegexemplaren! -2- man dabei kein Problem: Schließlich könnten die beiden Tiere einfach ihre Spermien austauschen. „Zwitter spielen gerne Männchen. Zumindest bei einer hohen Populationsdichte ist die Konkurrenz unter ihnen groß, ebenso das Angebot an Spermien“, sagt der Zoologe. Der weibliche Teil des Zwitters werde dadurch förmlich von Spermien überschwemmt. Dort ließen sich häufig Sonderentwicklungen beobachten wie zum Beispiel ein Spermienmagen – um der Spermienmenge Herr zu werden, werden sie einfach wie Nahrung verdaut. Die Konkurrenz unter den Männchen ergibt einen starken Druck, die Spermien noch besser unterzubringen. „Das führt zu Eskalationen bei Egel, Regenwurm, Meeres- und Landschnecken sowie Plattwürmern. Brutalste Mechanismen haben sich da entwickelt, bei denen die Spermiengeber die Spermien einfach irgendwie im Partner platzieren“, sagt Michiels. Zum Teil werden mit den Spermien auch Substanzen übertragen, die den zwittrigen Geschlechtspartner verweiblichen sollen. Bei diesen Entwicklungen hat der Wissenschaftler mit seinen Mitarbeitern wahre Exzesse beobachtet: In Australien gibt es eine nur fünf Millimeter große, gelb-rote Meeresschnecke (Siphopteron quadrispinosum), die einen Riesenpenis mit zwei Ästen besitzt. Der Nebenast funktioniert wie eine Injektionsnadel, mit dem die Schnecken gegenseitig versuchen, einem Geschlechtspartner eine narkotisierende Flüssigkeit in die Leibeshöhle zu spritzen. „Durch den Penis-Hauptast werden dann die Spermien übertragen. Das erinnert stark an eine Vergewaltigung“, sagt Michiels. Seine Arbeitsgruppe untersucht auch die Spermienübertragung bei Regenwürmern, bei denen während der Kopulation bis zu 40 spezielle Borsten ein Drüsensekret in den Geschlechtspartner pumpen, das dessen Gewebe teilweise auflöst und dadurch erhebliche Schäden anrichtet. Dies scheint die Aufnahme von physiologisch aktiven Substanzen im Sekret zu fördern, und führt zur Verweiblichung des Partners. „Der Spermiengeber erhöht damit seine Befruchtungschancen“, sagt Michiels, der die Vorgänge bei Regenwürmern in Versuchen mit und ohne Einsatz der speziellen Kopulationsborsten verglichen hat. Die kalifornischen Bananenschnecken der Gattung Ariolimax beißen bei der Paarung sogar dem Partner oder sich selbst den Penis ab, sie können dann nur noch Weibchen sein. „Bei einem weiteren Beispiel haben wir zunächst unseren eigenen Beobachtungen nicht getraut“, berichtet der Forscher. Eine Art sehr bunter, fünf bis sechs Zentimeter langer Plattwürmer namens Pseudobiceros bedfordi, die auf Korallen lebt, hat zwei Penisse, mit denen es zum regelrechten „Penisfechten“ komme. „Die Plattwürmer sehen aus wie Ritter mit Capes, die ihre Schwerter ziehen. Allerdings stechen die Tiere die Penisse nicht in den Partner ein, sondern drücken die Spermienflüssigkeit auf dessen Haut aus wie zwei Tuben Zahnpasta“, sagt Michiels. Die Penisse tragen die Plattwürmer auf der Bauchseite und versuchen, den Partner am Rücken zu bearbeiten. An dieser Stelle löst das Ejakulat das Gewebe auf, was es den schraubenförmigen Spermien erlaubt, zu den Eiern zu gelangen. Dabei entsteht aber ein Riesenloch. „Es kann passieren, dass der Plattwurm von der Mitte an verstümmelt ist – und dies war kein Beobachtungsfehler. Tatsächlich haben 70 bis 80 Prozent der Freilandtiere solche Narben und regenerieren nur langsam und unvollständig ein neues Hinterteil.“ Bei Zwittern, bei denen die Befruchtung im Körper stattfindet, seien Taktiken, durch die möglichst viele Eier befruchtet werden, zumindest kurzfristig sinnvoll. Man habe also gewonnen, wenn man den Partner in die weibliche Rolle gedrängt hat. „Diese Strategie setzt sich bei Zwittern immer durch“, hat Michiels festgestellt. Bei getrenntgeschlechtlichen Arten gebe es hingegen kein Interesse, den Partner zu schädigen. Die männliche Konkurrenz spiele sich hier unter Männchen ab, meistens würden die Weibchen geschützt. „Vielmehr muss der Mann balzen, tanzen und sich bemühen. Es setzt die Männchen unter Druck, zu Gentlemen zu werden“, sagt der Forscher. Die Kommunikation zwischen den Geschlechtern werde dabei zum konstruktiven Wettlauf – im Gegensatz zu den Verhältnissen bei Zwittern. „Bei Zwittern wollen alle Männchen sein. Computermodelle zeigen aber, dass dies -3- das System sehr labil macht und den Wechsel zur Getrenntgeschlechtlichkeit immer wahrscheinlicher.“ Das passiert aber selten. Weshalb? Michiels hat dazu zwei Arbeitshypothesen. „Theoretisch könnten getrenntgeschlechtliche Tiere das zwittrige System kippen. Doch ein Zwitter wird oft darauf bestehen, dass der Partner auch Zwitter ist“, meint der Forscher. Nur so könne er prüfen, wie gut der Partner ist. Produziert der Partner zum Beispiel kaum oder keine Spermien, deute das auf schwere Schädigungen oder eine kürzlich vorausgegangene Kopulation hin – das macht den Partner auch als Weibchen uninteressant. Eingeschlechtliche Tiere könnten sich unter diesen Bedingungen nicht verbreiten. In seiner zweiten Arbeitshypothese stellt Michiels fest, dass Zwitter in vielen Fällen sehr komplexe männliche und weibliche Genitalsysteme entwickelt haben. „Man kann dann nicht von diesen komplexen zu ganz einfachen Organen springen. Es kann keine Einzelmutationen geben, die das eine Genitalsystem ausschalten.“ So steckten die Zwitter evolutiv in einer Sackgasse. „Sie können sich nur in spezialisierten ökologischen Nischen halten. Es sind häufig sesshafte, im Wasser lebende Organismen, die ihre Spermien frei ins Wasser abgeben. Es ist ein Zufall, dass sie noch da sind. Wahrscheinlich würden sie unter nur wenig geänderten Bedingungen schnell von anderen Tiergruppen verdrängt“, lautet das Urteil des Zoologen. (7597 Zeichen) Nähere Informationen: Prof. Nico K. Michiels Zoologisches Institut Auf der Morgenstelle 28 72076 Tübingen Tel. 0 70 71/2 97 46 49 Fax 0 70 71/29 5634 E-Mail nico.michiels [at] uni-tuebingen.de Der Pressedienst im Internet: http://www.uni-tuebingen.de/uni/qvo/pd/pd.html