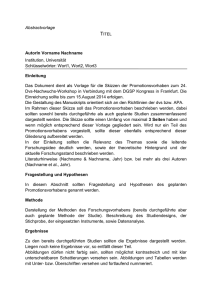Heft als PDF downloaden - Rubin - Ruhr
Werbung

Editorial NEUROrubin 2003 Neurowissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum Die offene Fakultät Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann (links), Allgemeine Neurobiologie, Fakultät für Biologie, Prof. Dr. Onur Güntürkün (rechts), Biopsychologie, Fakultät für Psychologie 4 F rancis Crick, der den Nobelpreis für die Mitentdeckung der genetischen Struktur bekam und heute über die neuralen Grundlagen von Bewusstsein forscht, bemerkte einmal, dass sich die biologische Evolution und die Entwicklung von Wissenschaft in einem Punkt fundamental unterscheiden: Während in der Evolution hybride Individuen, die aus der Mischung zweier Arten stammen, in der Regel unfruchtbar sind, gelten hybride Wissenschaften, die sich an den Rändern klassischer Disziplinen entwickeln, als besonders erfolgreich. In dieser Hinsicht sind die Neurowissenschaften eine Hybriddisziplin par excellence. Das Gehirn ist zu kompliziert, um mit den Forschungstraditionen und Methoden einer einzigen akademischen Disziplin erfolgreich verstanden zu werden. Daher waren und sind nur Kooperationen erfolgversprechend, die die Grenzen der eigenen Fakultät überschreiten. So entwickelte sich langsam aber sicher ein neuer hybrider Forschungszweig, bei dem die Hirn- und Verhaltensforschung an Tieren aus der Biologie stammte, die Aufklärung der molekularen Prozesse aus der Biochemie kam, die klinische Komponente aus der Medizin geliefert wurde, die Psychologen die verhaltensexperimentelle Forschung kognitiver Prozesse beisteuerten, während Mathematiker, Physiker und Ingenieure die Modellierung und Erforschung der künstlichen Intelligenz einbrachten. „Das Gehirn ist zu kompliziert, um mit den Forschungstraditionen und Methoden einer einzigen akademischen Disziplin erfolgreich verstanden zu werden.“ An der Ruhr-Universität Bochum war es der Sonderforschungsbereich „Bionach“ (Biologische Nachrichtenverarbeitung, 1972 – 1986), der das Fundament für eine interdisziplinäre neurowissenschaftliche Struktur legte, die den ganzen Campus sowie die Kliniken umfasste. Nach dem Ende von Bionach wurde die Forschergruppe Editorial NEUROrubin 2003 NEUROVISION gegründet (1990– 1996), die dann 1996 im gleichnamigen Sonderforschungsbereich aufging. Jeder dieser Forschungsverbünde intensivierte die Kooperationen sowohl innerhalb der Fakultäten als auch zwischen den Disziplinen. Es wurde nicht nur gemeinsam geforscht, sondern auch gemeinsam ausgebildet. Das Graduiertenkolleg KOGNET (Kognition, Gehirn und Netzwerke, 1991 – 2000) schuf zum ersten Mal eine Plattform für eine interdisziplinäre neurowissenschaftliche Doktorandenausbildung. Im Jahre 2000 folgte das Graduiertenkolleg „Entwicklung und Plastizität des Nervensystems“ und im Jahre 2001 wurde schließlich die „International Graduate School for Neuroscience“ (IGSN) gegründet. Die IGSN markiert mit der Etablierung einer ‚offenen’ Fakultät für Neurowissenschaften mit eigenem Promotionsrecht zum ‚PhD of Neuroscience’ sowie einem strikt interdisziplinären Ausbildungs kanon den vorläufigen Endpunkt der Entwicklung einer vier Fakultäten (Biologie, Chemie, Medizin, Psychologie) sowie das Institut für Neuroinformatik umfassenden Forschungs- und Lehreinrichtung, die insgesamt 30 wissenschaftliche Einheiten umspannt. „Jeder dieser Forschungsverbünde intensivierte die Kooperationen sowohl innerhalb der Fakultäten als auch zwischen den Disziplinen. Es wurde nicht nur gemeinsam geforscht, sondern auch gemeinsam ausgebildet.“ Dieser Verbund hat eine eigene Mentalität geschaffen, die durch den „Campus der kurzen Wege“ noch verstärkt wurde. An der Ruhr-Universität ist es selbstverständlich, dass Psychologen die Impulsströme einzelner Nervenzellen ableiten, Biochemiker Raumkognition bei genetisch veränderten Mäusen studieren, Biologen Roboter bauen und Mediziner sich für die Entwicklung des Vogelgehirns interessieren. Gemeinsame Lehre, gemeinsame Forschung, gemeinsame Publikationen sind zum interdisziplinären Alltag geworden. Ein durchaus erfolgreicher Alltag: Nach der Analyse des Instituts für Essential Science Indicators (ESI) gehören die Publikationen der Bochumer Neurowissenschaften seit 2001 zu den Top 1% der weltweit am meisten zitierten neurowissenschaftlichen Arbeiten. „Hinter all diesen wissenschaftlichen und organisatorischen Entwicklungen gibt es ein zutiefst menschliches Element, dass uns alle eint: die Faszination für das Gehirn.“ Hinter all diesen wissenschaftlichen und organisatorischen Entwicklungen gibt es ein zutiefst menschliches Element, dass uns alle eint: Die Faszination für das Gehirn, dieses mit Abstand komplexeste Organ, welches uns Menschen zu Menschen macht. Das vorliegende Heft will Sie an dieser Faszination teilhaben lassen. Die Themen stellen nur einen kleinen Ausschnitt der Fragestellungen dar, an denen in Bochum geforscht wird. Im Beitrag von Schöner wird z. B. beschrieben, wie kompliziert es ist, einen Roboter so zu konstruieren, dass er gezielt Gegenstände greifen kann. Kruse, Oreja und Hoffmann untersuchen ebenfalls das Greifen, doch aus einer anderen Perspektive: Sie erläutern die zellulären Prozesse im Cortex von Affen, während diese mit ihrer Hand eine Computermaus bedienen, um mit dem Cursor bewegte Gegenstände auf dem Monitor zu jagen. Der Beitrag von Andrich und Epplen schließlich beschreibt den Verlust der Fähigkeit, gezielte Greifbewegungen durchführen zu können, wenn Patienten am tödlich verlaufenden Veitstanz erkranken. Während in von der Malsburgs Beitrag von künstlichen Hirnnetzen berichtet wird, die mühelos Gesichter aus allen Perspektiven erkennen können, berichten Kress und Daum von hirnverletzten Patienten, die selektiv die Fähigkeit verloren haben, selbst die Gesichter ihrer engsten Freunde und Verwandten wiederzuerkennen, ob- wohl ihre verbliebene visuelle Wahrnehmung intakt ist. So ergeben sich immer wieder neue Perspektiven auf korrespondierende Fragestellungen und Probleme. In anderen Beiträgen geht es um die neuralen Grundlagen der Geruchswahrnehmung, die Selbstreparatur des Gehirns, kognitive Geschlechtsunterschiede, elektrische Synapsen, transgene Tiermodelle für neurodegenerative Erkrankungen und schließlich um die sagenhafte Fähigkeit des Gehirns, mit wenigen Ausgangsinformationen Milliarden von Nervenzellen im Laufe der Entwicklung richtig zu „verdrahten“. Diese kleine Auswahl an Themen, die von Bochumer Neurowissenschaftlern bearbeitet werden, belegt den vorläufigen Endpunkt einer interdisziplinären Entwicklung, in der Wissenschaftler aus verschiedenen Fakultäten und Traditionen an dieser Universität zu einer gemeinsamen und neuen Forschungsrichtung zusammengefunden haben. Wenn Francis Crick mit seiner Bemerkung über den Erfolg hybrider Wissenschaften Recht behält, sollte die Entwicklung der interdisziplinären neurowissenschaftlichen Forschung an der Ruhr-Universität Bochum auch in Zukunft ähnlich rasant und erfolgreich verlaufen wie bisher. 5 Biopsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 „Der kleine Unterschied“ im menschlichen Gehirn O. Güntürkün M. Hausmann M. Tegenthoff E inige kognitive Geschlechtsunterschiede sind wissenschaftlich belegt. Zum Beispiel sind Frauen bei verbalen Fähigkeiten überlegen, bei denen es auf das schnelle Nennen von Zielwörtern ankommt. Männern dagegen fallen manche Aufgaben leichter, die besonders das räumliche Vorstellungsvermögen fordern (Info, S. 7). Geschlechtsspezifische Unterschiede des Sprachvermögens und der visuellen Raumkognition sind also kein bösartiges Vorurteil, sondern wissenschaftliche Tatsache. Sie könnten das Ergebnis unterschiedlicher Erziehungsstile und/ oder biologischer Faktoren sein. Für Letzteres spricht, dass sich weibliche und männliche Gehirne in ungefähr einem Dutzend anatomischer Merkmale unterscheiden. Auf biologische Faktoren deuten auch spezielle Testergebnisse hin, in denen Geschlechtsunterschiede nicht nur in verschiedenen Nationen, son- Prof. Dr. Onur Güntürkün, Dr. Markus Hausmann, Biopsychologie, Institut für Kognitive Neurowissenschaft, Fakultät für Psychologie, PD Dr. Martin Tegenthoff, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, Neurologische Klinik, Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannsheil 5 Können Männer wirklich nicht zuhören, und sind Frauen tatsächlich unfähig einzuparken? Vorurteile dieser Art sind weit verbreitet und in den meisten Fällen falsch. Doch manchmal findet sich ein wahrer Kern, den Forscher jetzt in funktionellen Unterschieden zwischen beiden Hirnhälften entdecken. Interessant ist, dass dieser „kleine Unterschied“ zumindest einmal pro Monat aufgehoben wird. dern auch über die letzten 30 – 40 Jahre hinweg recht konstant nachgewiesen werden (s. Info), obwohl sich die Erziehungsstile in diesen Ländern und Zeitspannen extrem unterscheiden. Zudem erhöhen sich bei Männern, die nach einer Geschlechtsumwandlung zu Frauen werden, unter Einnahme weiblicher Sexualhormone die Sprachkompetenzen auf Kosten der Raumkognitionen. Genau die umgekehrte Entwicklung machen Frauen durch, die zu Männern werden. Es spricht viel dafür, dass die ko- Abb. 1 gnitiven Unterschiede zwischen Männern und Frauen zumindest zum Teil durch unterschiedliche hormonelle Faktoren entstehen können, die dann wahrscheinlich geschlechtsspezifische Hirnmechanismen nach sich ziehen. Doch müssten dann nicht auch die hormonellen Schwankungen während des weiblichen Monatszyklus Veränderungen von kognitiven Leistungen erzeugen? Wir sind dieser Frage nachgegangen und haben weiblichen Testpersonen, die keine Hormonpräparate wie z.B. die Pille einnehmen, zweimal Naturwissenschaften Biopsychologie NEUROrubin 2003 während ihres Zyklus Aufgaben (z.B. Rotations-Test, Info 1) gestellt, bei denen Frauen meist schlechter abschneiden als Männer. Ein Testzeitpunkt lag während der Menstruation (2. Tag), wenn alle Sexualhormone auf dem Tiefpunkt sind. Die zweite Aufgabe stellten wir in der Lutealphase (22. Tag), in der der Hormonspiegel an Östradiol und Progesteron sehr hoch ist. Die Ergebnisse waren eindeutig (Abb. 2): Wenn die weiblichen Sexualhormone ihren Tiefpunkt erreichten (2. Tag), war die Leistung der Frauen beim mentalen Rotations-Test ähnlich gut wie die der Männer. Stiegen aber die Hormone zum 22. Tag an, dann sank die Leistung dramatisch ab. Die untersuchten Frauen waren demnach in ihren visuell-räumlichen Fähigkeit nicht prinzipiell schlechter als die Männer – es kam nur drauf an, wann man sie testete! D ie individuellen Leistungsunterschiede bei Männern und Frauen sind zwar größer als zwischen beiden Geschlechtern, trotzdem kommt es bei bestimmten Aufgaben zu recht konstanten Unterschieden zwischen Männern und Frauen. So fallen Frauen beim „Wortflüssigkeitstest“ in einer Minute mehr Wörter ein, die z.B. mit einem „A“ oder einem „M“ beginnen als Männern (s. Abb. rechts). Dagegen schneiden Männer im Durchschnitt im „Mentalen Rotations-Test“ besser ab, bei dem Vergleichsfiguren gefunden werden sollen, die mit der Zielfigur identisch sind. (Abb. unten, Lösung: 1 und 3) Mentaler Rotationstest Auf den Zeitpunkt kommt es an ! Da Sexualhormone vielfältige Einflüsse auf Hirnfunktionen haben, ist es nicht einfach, herauszufinden, welche dieser Funktionen bei unseren Versuchspersonen verändert wurden. Ein „aussichtsreicher Kandidat“ sind die sog. cerebralen Asymmetrien - die Funktionsunterschiede zwischen der linken und der rechten Hirnhälfte. Die linke Hirnseite zeigt bei Menschen eine Überlegenheit verbaler Fähigkeiten, während die rechte eine Dominanz für visuell-räumliche Funktionen besitzt. Diese funktionellen LinksRechts-Unterschiede sind bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Könnte es sein, dass Frauen und Männer sich kognitiv unterscheiden, weil die Asymmetrien ihrer Gehirne unterschiedlich sind? Doch dann müssten sich mit der Kognition auch die Hirnasymmetrien während des Monatszyklus verändern. Wir untersuchen die Asymmetrien beim Menschen mit einem speziellen Experiment („Visuelle Halbfeldtechnik“), das es ermöglicht, quasi nur Wortflüssigkeitstest INFO einer Hirnhälfte Bilder zu zeigen (Abb. 3a): Wenn eine Versuchsperson ein Kreuz in der Monitormitte betrachtet, wird die Figur links vom Fixationskreuz nur von ihrer rechten Hirnhälfte gesehen. Sobald die Versuchsperson nach links blickt und die Figur zentral ansieht, nehmen natürlich beide Hirnhälften diesen Stimulus wahr. Für eine solche Blickbewegung brauchen Menschen ca. 200 Millisekunden. Verschwindet die seitliche Figur aber nach Abb. 2: Rotationstest: Unter vier seitlichen Vergleichsfiguren sind die herauszufinden, die zwar verdreht, aber sonst identisch mit der zentralen Form sind. Frauen, die während ihrer Menstruation (2. Tag) und in der Lutealphase (22. Tag) getestet werden, erreichten in der Lutealphase schlechtere Leistungen bei der mentalen Rotationsaufgabe. 6 Biopsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 3: „Visuelles Halbfeldexperiment“: Zunächst prägt sich die Testperson ein Muster in der Monitormitte ein. Darauf folgt das Fixationskreuz und dann für 180 Millisekunden seitlich ein Vergleichsmuster (Bild b und c). Die Testperson entscheidet so schnell wie möglich per Tastendruck, ob es sich um das gleiche (G) oder um ein ungleiches (U) Muster handelt. nur 180 Millisekunden vom Monitor, während die Versuchsperson noch auf das zentrale Fixationskreuz blickt, dann wird dieser lateralisierte Reiz nur von der rechten, d.h. contralateralen Hemisphäre wahrgenommen. Was von links kommt: schnell erkannt beiden Hirnhälften während der Lutealphase seitengleich. Die cerebralen Asymmetrien für visuell-räumliche Aufgaben hatten sich tatsächlich während des Menstruationszyklus radikal verändert! Eine Reduktion der weiblichen Sexualhormone führt also sowohl zu einer Leistungssteigerung bei der mentalen Rotation als auch zu einer asymmetrischen Hirnorganisation. Auch bei Frauen nach der Menopause fanden wir Links-Rechts-Unterschiede für visuell-räumliche Reize, die denen von Männern wie auch von Frauen während der Menstruation entsprachen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich die Asymmetrie vor allem mit der Fluktuation des Hormons Progesteron veränderte. Progesteron steigt zum 22. Tag des Monatszyklus an und fällt dann wieder ab. Im Gehirn erhöht Progesteron die Effektivität der Rezepto- Im nächsten Schritt vergleichen die Testpersonen verschiedene Figuren (s. Abb. 3 b u. c): Zunächst prägen sie sich eine zentral dargebotene abstrakte Figur einige Sekunden lang ein, sodass beide Hirnhälften diesen Reiz speichern. Dann erscheint anstelle der zentralen Figur kurz das Fixationskreuz. Anschließend wird seitlich links oder rechts für 180 Millisekunden die gleiche (Abb. 3b) oder eine andere Figur (Abb. 3c) eingeblendet, während der Blick auf das Kreuz gerichtet bleibt. Die Testperson entscheidet nun so schnell wie möglich per Tastendruck, ob es sich um die gleiche (G) oder eine ungleiche Figur (U) handelt. In der Regel folgt die Antwort schneller und korAbb. 4: rekter, wenn die zweite Figur Ergebnisse des „Visuellen auf dem Monitor links erHalbfeldexperiments“: scheint, da die rechte HemiDie höchsten Treffersphäre bei visuell-räumlichen quoten erreichen Männer Aufgaben überlegen ist. Diesowie Frauen während der ses Ergebnis bestätigten unRegel mit der rechten sere männlichen VersuchsperGehirnhälfte. Bei Frauen sonen sowie Frauen während in der Lutealphase ist die der Menstruation (Abb. 4). Leistung der beiden HirnDagegen war bei den selben hälften identisch. Frauen die Leistung ihrer 7 ren für den hemmenden Botenstoff GABA und reduziert gleichzeitig die Aufnahme und Umsetzung des aktivierenden Botenstoffs Glutamat. Insgesamt sollte Progesteron somit auf viele Hirnprozesse dämpfend wirken. Dabei könnte Progesteron die cerebralen Asymmetrien vor allem durch die Modulation des Informationsaustausches zwischen den beiden Hirnhemisphären über die große Faserverbindung (Corpus callosum) verändern. Das Corpus callosum besteht aus über 200 Millionen Fasern und verbindet beide Hirnhälften miteinander. Die Nervenzellen, die das Corpus callosum bilden, verwenden fast ausschließlich Glutamat. Während der Lutealphase könnte das Progesteron somit die Effizienz dieser interhemisphärischen Verbindung und damit zugleich die cerebralen Asymmetrien verringern. Wenn diese Überlegungen stimmen, müsste während des Biopsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 bei der ein unterschwelliger TMS-Reiz wenige Millisekunden vor einem überschwelligen Testreiz gegeben wird, lässt sich die Erregbarkeit der Zielregionen im Gehirn untersuchen. Diese Methode stützt sich auf die Existenz von Zellverbänden innerhalb der Hirnrinde, die über ihre Synapsen einen hemmenden (inhibitorischen) Einfluss auf die nachgeschalteten Areale haben, während andere Neuronenverbände in der Nachbarschaft die nachgeschalteten Funktionsbereiche des Gehirns eher erregen (exzitieren). Beträgt der zeitliche Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Reiz nur 1 bis 4 Millisekunden, werden hauptsächlich die inhibitorischen GABA-Zellverbände aktiviert. Bei einem größeren zeitlichen Abstand von 8 bis 20 Millisekunden sind es dagegen die exzitatorischen Neu- Sexualhormone dämpfen Aktivität von Nervenzellen Abb. 5: Transkranielle Magnetstimulation (TMS): Der Versuchsleiter hält die TMS-Spule über die Zielregion der Hirnoberfläche die für einen kurzen Augenblick elektrisch erregt werden soll. Menstruationszyklus die gesamte Erregbarkeit innerhalb der Hirnrinde schwanken. Doch wie kann man das nachweisen? Mit Hilfe der transkraniellen Magnetstimulation (TMS) lässt sich die Erregbarkeit des menschlichen Gehirns schonend untersuchen. Diese neurophysiologische Methode wird seit mehr als zehn Jahren in der klinischen Neurologie als Diagnoseverfahren eingesetzt (Abb. 5). Das technische Grundprinzip besteht darin, dass sich durch einen starken Stromfluss innerhalb einer Rundspule ein Magnetfeld aufbaut, das ungehindert und schmerzfrei die Schädeldecke durchdringt und durch elektromagnetische Induktion innerhalb der Hirnsubstanz einen elektrischen Strom erzeugt und somit einzelne Gehirnzellen erregt. Durch eine spezielle Reiztechnik, ronenverbände, die Glutamat als Botenstoff einsetzen. Die standardisierte zeitliche Abfolge einer solchen Doppelreizmethode erlaubt eine differenzierte Aussage bezüglich der aktuellen hemmenden und erregenden Zellaktivität in einer bestimmten Hirnregion. Mit einer vergleichbaren TMSTechnik untersuchen wir die Signalübertragung zwischen den beiden Hemisphären über das Corpus callosum. Diese TMS-Doppelreiz-Methode wurde nun bei Frauen in unterschiedlichen Phasen des Menstruationszyklus eingesetzt. Die Aktivität der hemmenden und erregenden Neuronenverbände zeigte dabei in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Zyklusphasen deutliche Schwankungen. So verringerte sich die Aktivität der erregenden Zellverbände bei hoher Konzentration der Sexualhormone Östradiol und Progesteron in der Lutealphase deutlich, während die hemmenden Zellverbände gleichzeitig aktiviert wurden. Hieraus resultierte insgesamt eine verminderte Aktivierbarkeit bestimmter Hirnregionen. Dies ist genau der Effekt, den wir für Progesteron durch die Reduktion der Glutamat- und die Erhöhung der GABA-Übertragungseffizienz erwartet hatten. Gleichzeitig war eine Veränderung des Informationsaustausches zwischen den beiden Hemisphären über das Corpus callosum nachweisbar: In der Lutealphase verringerte sich die Signalvermittlung, was den Test-Ergebnissen der Visuellen Halbfeldtechnik entspricht. Damit konnten wir unsere Hypothese einer im Verlauf des Menstruationszyklus wechselnden Erregbarkeit der Hirnrinde und einer Modulation der interhemisphärischen Interaktion bestätigen. Die mit sehr unterschiedlichen Verfahren gewonnenen Untersuchungsergebnisse belegen eindrucksvoll eine im Verlauf des weiblichen Zyklus vorhandene hormonvermittelte wechselnde Asymmetrie der Hirnfunktion. Diese Schwankungen schlagen sich in tagtäglichen Funktionen nieder. Unsere Forschungsergebnisse zeigen nicht nur, dass sich „der kleine Unterschied“ im Gehirn des Menschen objektiv begründen lässt, sondern dass dieser Unterschied hormonabhängig schwankt. „The little difference“ Men and women differ in some cognitive functions. Although these differences are small, they reliably demonstrate sex-dependent differences in the functional organisation of the brain. Hemispheric asymmetries are indeed differently organised with female subjects having less pronounced left-right differences. However, these reduced asymmetries in women are not stable over time, but differ between menstrual cycle phases due to hormone fluctuations. As also shown by Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), especially progesterone seems to influence cortical excitability and interhemispheric crosstalk, thereby altering brain asymmetries. AbstracT 8 Neuropsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Wenn Gesichter bedeutungslos sind Th. Kress I. Daum Abb. 1 Jedes Erkennen ist ein Wiedererkennen. Blicken wir in das Gesicht eines Menschen, dann greift unser Gehirn blitzschnell auf einen „Gesichtsspeicher“ zurück. Bei einigen Menschen scheint dieser Zugriff versperrt. Gesichter bleiben ihnen fremd – selbst das eigene – obgleich sie Häuser, Gegenstände oder Bilder mühelos wiedererkennen. Noch nicht lange weiß man um diese seltene Funktionsstörung des Gehirns, die Neuropsychologen jetzt im EEG nachweisen konnten. D as Erkennen von Gesichtern gehört zu den bemerkenswertesten menschlichen Fähigkeiten: Scheinbar mühelos erkennen wir Menschen, die wir lange Zeit nicht gesehen haben; selbst in einer großen Menge unbekannter Personen finden wir ein bekanntes Gesicht ohne Probleme wieder. Die Entscheidung, ob wir unser Gegenüber kennen oder nicht, fällt in weniger als einer halben Sekunde. Diese Dipl.-Psych. Thomas Kress, Prof. Dr. Irene Daum, Neuropsychologie, Fakultät für Psychologie 9 Spezialisierung auf das schnelle Erkennen von Menschen zeigt sich von Geburt an. Lässt man Neugeborenen die Wahl, bevorzugen sie bereits wenige Stunden nach der Geburt das Gesicht ihrer Mutter gegenüber dem einer fremden Frau. Ebenso früh beginnen sie, die Gesichtsausdrücke von Erwachsenen zu imitieren und schauen von zwei Gesichtern dasjenige länger an, welches auch Erwachsene als attraktiver einschätzen. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Fähigkeit, andere Menschen am Gesicht zu erkennen, vererbt wird. Möglicherweise hatte derjenige, der Freund von Feind beson- ders schnell und zuverlässig unterscheiden konnte, einen Vorteil in der Evolution. Aber das Erkennen von Gesichtern funktioniert nicht immer reibungslos. Joachim Bodamer beschrieb 1947 Patienten, die nach einer Kopfverletzung nicht mehr in der Lage waren, medizinisches Personal im Krankenhaus und zum Teil sogar ihre Verwandten am Gesicht zu erkennen. Bodamer nannte dieses Defizit „Prosopagnosie“: Nichterkennen von Gesichtern (gr.: Prosopon/Gesicht, Agnosia/Unfähigkeit des Erkennens). Die Betroffenen selbst bezeichnen sich lieber als „gesichts- Neuropsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 blind“, weil damit das Problem sofort erklärt ist. Immer wieder wurden Menschen beschrieben, die nach einem Schlaganfall oder einer Kopfverletzung Bekannte oder sogar ihr eigenes Spiegelbild nicht erkannten. Relativ neu hingegen sind Berichte von Menschen, die von Geburt an keine Gesichter erkennen können. Oft merken die Betroffenen gar Betroffene wissen oft nicht, dass sie gesichtsblind sind nicht, dass ihnen etwas fehlt, und es gibt vermutlich Unterschiede in dem, was sie sehen: Einige Patienten beschreiben das Gesicht als blanke, helle, fast weiße Fläche (s. Abb. 1), andere empfinden es wie das eines Strichmännchens. Sie sehen zwar Augen, Nase und Mund – und doch scheint sich daraus kein Sinn zu ergeben. Die Informationen, die sie aus einem Ge- Blickwinkel und die Unterscheidung sehr ähnlich aussehender Gegenstände bei ihnen mühelos funktionieren. In anderen geistigen Leistungen zeigen sich ebenfalls keine Einschränkungen – Gesichtsblinde haben ganz normale Berufe und gehen ihrem Leben fast unbeeinträchtigt nach. Allerdings kommt es immer wieder zu peinlichen Situationen: z. B. wenn Betroffene unvermittelt auf eine Person treffen, die sie überschwänglich begrüßt und offensichtlich zu erkennen gibt, dass sie sich über die Begegnung freut, der Gesichtsblinde aber keine Ahnung hat, wer da vor ihm steht. Eine Patientin berichtet, dass sich der fremde Mann, der vor ihrer Tür stand, als ihr eigener Vater entpuppte, sobald er anfing zu sprechen. Vergleich erfolgreich, wird das gesehene Gesicht als ein bekanntes identifiziert. In einem weiteren Schritt werden nun Informationen zu diesem Gesicht aus den Gedächtnisspeichern gesucht. Dabei greift das Gehirn auf zahlreiche Informationen über die Person zu, wie ihr Beruf, ihr Name, woher sie bekannt ist und wann man sie zuletzt gesehen hat. Diese Leistungen sind eng an den Temporallappen geknüpft, eine Struktur an der Seite des Gehirns, die neben dem Hören vor allem Gedächtnisleistungen erbringt (s. Abb. 2, rechts). Auch das Erkennen von Objekten lässt sich als ein Gedächtnisprozess beschreiben, denn der Sinn einer gesehenen Struktur erschließt sich erst durch die Verbindung mit den Erfahrungen, b a (Präparation und Foto: Prof. Dr. K. Morgenroth, Pathologie) sicht entnehmen können, reichen für ein Wiedererkennen nicht aus. Erst wenn weitere hinzukommen, wie z. B. die Stimme oder der Gang, können sie die Person identifizieren. Trotzdem haben die Betroffenen oft keine Schwierigkeiten, das Geschlecht einer Person oder deren Stimmung aus dem Gesicht abzulesen. Tests zeigen auch, dass das Erkennen von Objekten selbst aus ungewöhnlichem Abb. 2: Linke Hirnhälfte, außen (B): Im seitlichen Temporallappen sind neben dem Hören vor allem Gedächtnisleistungen lokalisiert – darunter vermutlich auch die Region, in der Objekte gespeichert werden. Rechte Hirnhälfte, innen (A): Die rot angefärbten Strukturen (Gyrus fusiformis) sind am Erkennen von Gesichtern beteiligt. Das Erkennen von Gesichtern ist für das Gehirn eine komplexe Aufgabe: Aus dem gesehenen Bild einer Person muss ein Muster geformt werden, das sich mit bereits gespeicherten Informationen vergleichen lässt. Verläuft dieser die im Gedächtnis gespeichert sind. Der Vergleichsprozess erweist sich dabei als extrem leistungsfähig und flexibel. Gegenstände werden auch dann erkannt und richtig eingeordnet, wenn sie im Aussehen beträchtlich variieren. 10 Neuropsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Auch Veränderungen des Blickwinkels, aus dem wir etwas betrachten, oder der Beleuchtungsverhältnisse beeinträchtigen das Erkennen nur begrenzt. Für Gesichter gilt Ähnliches: Wir können Menschen wiedererkennen, deren Gesicht sich durch das Alter verändert hat, und auch Veränderungen der äußeren Form eines Gesichtes, z.B. durch eine neue Frisur oder eine Brille, stellen uns nicht vor unlösbare Probleme. Dennoch unterscheiden sich die Gesichtserkennung und das Erkennen von Objekten. Während bei Objekten die Analyse von Ekken und Kanten für die Identifikation wesentlich ist, spielen bei Gesichtern ganzheitliche Aspekte die größere Rolle. So tragen auch Proportionen des Gesichtes zum Erkennen bei, z. B. in welchem Verhältnis der Augenabstand zur Nasenlänge steht. Dementsprechend erscheint es plausibel, dass Informationen aus Gesichtern an anderen Stellen im Gehirn als Informationen über Objekte verarbeitet werden . Studien mit bildgebenden Verfahren, z.B. der funktionellen Kernspintomog- Abb. 4: Gehirn im Test: Die Patientin betrachtet auf dem Monitor Bilder von bekannten und unbekannten Personen sowie von unbelebten Objekten. Dabei zeichnet das Elektroenzephalogramm (EEG) über Elektroden am Kopf der Testpersonen Veränderungen der elektrischen Aktvität im Gehirn auf. 11 aufklären kann, welche Teile des Gehirns bei einer bestimmten Aufgabe aktiv sind, geben elektrophysiologische Verfahren Abb. 3: genaueren Aufschluss über den Einige Beroffene sehen zeitlichen Ablauf von Gehirndas Gesicht als blanke, prozessen. Die Nervenzellen im helle Fläche (s. Abb. 1), Gehirn übermitteln ihre Inforanderen geht es vielmationen mit elektrischen Imleicht wie uns, wenn wir pulsen. Beim Elektroenzephadas linke Bild betrachten logramm (EEG) zeichnen Elekund den „irgendwie betroden, die außen am Kopf ankannten“ Mann nicht ergebracht werden, Veränderunkennen? (Zusammengen der elektrischen Aktivität schnitt: Michael Schuim Gehirn auf. Moderne EEGmacher und eine Verstärker erreichen eine Aufunbekannte Person) lösung von unter einer Millisekunde und ermöglichen es so, grafie, erlauben hier einen genaueren sehr schnelle Veränderungen im Gehirn Einblick: Während ein Proband eine zu registrieren. Um festzustellen, wie bestimmte Aufgabe löst, z.B. „Mensich die Verarbeitung von Gesichtern schen am Gesicht zu erkennen“, wird im Gehirn von der Verarbeitung andeder Blutfluss im Gehirn gemessen. rer Dinge unterscheidet, vergleicht Stärkere Durchblutung weist auf man die Gehirntätigkeit bei der Behöhere Aktivität eines Hirnareals hin. trachtung von Bildern von Gesichtern Dabei erwies sich vor allem eine Strukund anderen Gegenständen, z.B. Häutur an der Innenseite des Temporallapsern (s. Abb. 4). pens als relevant für die GesichtererAbb. 5 (rechts) zeigt den Unterkennung: Der sog. Gyrus fusiformis (s. schied in der elektrischen Hirnaktivität Abb. 2, links) scheint immer dann bevon Personen ohne Gesichtsblindheit, sonders aktiv zu sein, wenn Menschen die Gesichter und Häuser betrachten. Bilder von Gesichtern betrachten. DesDabei fällt auf, dass es nach 170 halb vermuten wir, dass hier das ZenMillisekunden, also 1/6 Sekunde, einen trum der Gesichtererkennung liegt. Unterschied auf der rechten Seite des Während die Kernspintomografie Gehirns gibt (s. Abb. 5, Pfeil). Diese Neuropsychologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 5: Das EEG zeigt, dass Menschen, die Gesichter wiedererkennen können, unterschiedlich auf Gesichter und Gegenstände reagieren (rechts, s. Pfeil). Bei der 35jährigen ProsopagnosiePatientin verlaufen die EEG-Kurven von Objekten und Gesichtern sehr ähnlich (links, s. Pfeil). Die topografische Darstellung der EEG-Kurve (unten) zeigt, dass sich bei Menschen, die Gesichter erkennen können, die Verarbeitung von Gesichtern und Häusern vor allem über dem rechten hinteren Teil des Gehirns unterscheidet. die Frisur oder die Art, sich zu kleiden. Man kann diese alternativen Möglichkeiten zur Erkennung von Personen gezielt schulen und dadurch erheblich verbessern. Und doch: Nichts ist so unverwechselbar wie ein Gesicht. Schwankung ist zwar sehr gering – sie bewegt sich im Bereich von wenigen Millionstel Volt – lässt sich aber bei fast jedem Menschen nachweisen. Sie reflektiert die Aktivität eines bestimmten Teils des Gehirns, der auf Gesichter stärker reagiert als auf andere visuelle Reize. Bereits nach 170 Millisekunden führt unser Gehirn also eine spezielle Verarbeitung für Gesichter aus. Kontrollpersonen: Gesichter bevorzugt verarbeitet Wie aber gestalten sich diese Reaktionen bei Menschen, die andere Personen nicht an ihrem Gesicht erkennen können? Abb. 5 (links) zeigt die Verarbeitung derselben Reize bei einer 35jährigen Frau, die seit Geburt an Gesichtsblindheit leidet. Blickt sie auf ein Gesicht, dann ist der Anstieg der Kurve in den negativen Bereich und damit die Hirnaktivität deutlich geringer als bei den Kontrollpersonen. Ihr Gehirn reagiert auf Gesichter und Häuser ähnlich. Doch weitere Informatio- nen über das Gesicht sind nicht zugänglich. Wahrscheinlich scheitert bereits die Übersetzung eines gesehenen Gesichtes in einen Code, den das Gehirn nutzt, um es mit den gespeicherten Gesichtern zu vergleichen. Gesichtsblindheit lässt sich also auf eine beeinträchtigte Verarbeitung im Gehirn zurückführen. Hoffnung auf Heilung ist noch nicht in Sicht, denn die Medizin ist weit davon entfernt, ein ausgefallenes oder beeinträchtigtes Zentrum im Gehirn zu „ersetzen“. Was kann man den Betroffenen raten? Es kann helfen, Teile des Gehirns zu trainieren, die andere Erkennungsmerkmale eines Menschen verarbeiten. Damit lässt sich die fehlende Fähigkeit der Gesichtererkennung kompensieren. Gesichtsblinde achten z. B. sehr viel mehr auf die Stimme und nutzen sie, um ihr Gegenüber zu erkennen. Auch die genaue Analyse von Bewegungen hilft, Bekannte zu identifizieren. So ist etwa der Gang einer Person charakteristisch, und mit einiger Übung lässt er sich nutzen, um Menschen auseinander zu halten. Charakteristisch ist oft auch Developmental Prosopagnosia Prosopagnosia is a deficit in recognizing familiar individuals on the basis of facial information. It can occur in the absence of any established neurological disease. Cases of developmental prosopagnosia provide valuable information on the organization of highly specialized functions in the human brain. We could demonstrate that patients suffering from developmental prosopagnosia show abnormalities in brain function when processing pictures of faces. It is suggested that prosopagnosia is the result of malfunction of a module in the human brain specialized for the recognition of faces. ABSTRACT 12 Zellphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Von der Nase bis ins Gehirn: Düfte nehmen Gestalt an H. Hatt Gerüche wecken Assoziationen und Emotionen, beeinflussen unser Leben mehr als wir glauben. Und doch ist der Geruchssinn erst wenig erforscht. Wissenschaftler spüren ihm nach von der Nase bis ins Gehirn und entdecken jetzt, was biochemisch passiert, wenn wir uns an einen Duft gewöhnen und wie Düfte Gestalt annehmen. Abb. 1 G erüche deuten an, versprechen, wecken Aufmerksamkeit und Phantasie, nähren Ängste und Hoffnungen: Sie sind das Salz in der atmosphärischen Suppe. Wir halten zwar Sehen und Hören für wichtigere Sinnesfunktionen, da sie eher zu bewussten kognitiven Wahrnehmungsprozessen beitragen – aber im Augenblick höchsten Genusses schließen wir die Augen und schmecken den Geruch, riechen den Geschmack. Bevor Geist und Schönheit eines Menschen uns faszinieren können, muss dieser erst einmal unsere Nase betören. Prof. Dr. Dr. Dr. Hanns Hatt, Zellphysiologie, Fakultät für Biologie 13 Noch steckt die Geruchsforschung allerdings in den Kinderschuhen. Die Wissenschaft beschäftigt sich erst seit ein paar Jahren mit den molekularen Prozessen, durch die wir z.B. zwischen dem Duft einer Rose und einer vollen Windel unterscheiden können, oder warum wir uns an Düfte so gewöhnen, dass wir sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmen. Folgen wir der Geruchsspur ins Mikroskopische: Alle duftenden Gegenstände geben flüchtige Moleküle in die Luft ab. Fast alle natürlich vorkommenden Gerüche sind komplizierte Gemische aus Hunderten verschiedener Moleküle. Trotzdem genügen meist einige sog. Leitsubstanzen, um einen bestimmten Geruch zu charakterisieren. So lässt sich mit Amylacetat Bananen- duft imitieren, Geraniol erzeugt einen rosenähnlichen Eindruck und Skatol den von Fäkalien. Allerdings bemerken unsere Nase und unser Gehirn sehr schnell, dass noch etwas fehlt: Das macht den Unterschied aus zwischen einem Nahrungsmittel mit künstlichen Aromastoffen und einem aus den natürlichen Produkten. Im obersten Bereich der menschlichen Nase finden wir das sog. Riechepithel, das aus den eigentlichen Riechzellen, den Stützzellen und den Basalzellen besteht. Die Basalzellen sind adulte Stammzellen, die unser ganzes Leben lang im Vierwochentakt die 30 Millionen Riechzellen erneuern. Die Riechzellen tragen am Ende ca. 20 feine, in den Nasenschleim ragende Sinneshärchen (Cilien, s. Abb. 3). De- Zellphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 ren Zellmembran enthält alle molekularen Komponenten, die dafür sorgen, dass wir mehr als 10.000 verschiedene Düfte selbst in geringsten Konzentrationen wahrnehmen und unterscheiden können. Die Umsetzung des chemischen Duftreizes in ein elektrisches Zellsignal erfolgt über einen kaskadenartigen biochemischen Verstärkungsmechanismus: Jeder Duftstoff muss zuerst ein spezifisches Rezeptoreiweiß auf der Oberfläche der Sinneshärchen finden und daran andocken (s. Abb. 5). Der Rezeptor benutzt dann sog. G-Proteine als Vermittler, um ein Enzym (Adenylatzyklase) zu aktivieren. Die- Abb. 2 (oben): links - Verteilung der Gene für den Riechsrezeptor auf den menschlichen Chromosomen (rote Bereiche). Nur auf den Chromosomen 20 und Y gibt es keine Riechrezeptorgene. Sie wurden für ein Genclusters auf Chromosom 17 am Lehrstuhl vollständig isoliert. rechts - Menschlicher Chromosomensatz, ungeordnet. ses Enzym kann große Mengen zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) als zweiten Botenstoff herstellen. Diese cAMP-Moleküle verändern nun direkt in der Zellmembran die Struktur von Kanalproteinen, so dass eine offene Röhre entsteht, durch die positiv geladene Teilchen (Kationen) aus dem Nasenschleim in die Zelle einströmen und das negative Membranpotenzial (in Ruhe etwa –70 mV) verschieben. Ab einer gewissen Schwelle (ca. –50 mV) werden diese Rezeptorpotentiale in sog. Aktionspotentiale umgesetzt, die entlang des Nervenfortsatzes der Riechzelle bis ins Gehirn geleitet werden. All diese molekularen Komponenten kennt die Wissenschaft seit etwa zehn Jahren. 1991 gelang ein Durchbruch in der Riechforschung: In den USA fanden Forscher im Rattengenom eine riesige Genfamilie mit über 1000 Mitgliedern, die nahezu exklusiv in den Sinneshärchen von Riechzellen exprimiert werden. 1999 gelang es uns erstmals, ein Mitglied dieser Rezeptorfamilie auch aus dem menschlichen Genom zu Abb. 3: Blick auf das Köpfchen einer menschlichen Riechzelle mit ihren Cilien. sitzen zwar noch die Geninformation unserer tierischen Vorfahren, aber nur noch 347 dieser Gene sind benutzbar. Sie liegen über fast alle unsere Chromosomen verteilt, außer auf Chromosom 20 und Y (Abb. 2). Meist sind sie in sog. Genclustern angeordnet, von denen die größten bis zu 80 Rezeptorgene enthalten. Trotz ihrer reduzierten Zahl stellen sie mit einem Anteil von ca. einem Prozent am menschlichen Gesamtgenom immer noch die größte Genfamilie überhaupt dar. Dies spricht für die Bedeutung des Geruchssinns für den Menschen und gegen seine Einordnung als „niederen Sinn“. Abb. 4 (rechts): Bei primitiven Wirbeltieren wie dem Schleimaal dienen mehr als 90 Prozent des Gehirns der Analyse von chemischen Reizen. Seine Riechrezeptoren sind den menschlichen bereits sehr ähnlich. klonieren und zu identifizieren. Schnell stellte sich heraus, dass die Zahl der aktiven Mitglieder dieser Superfamilie beim Menschen dramatisch abgenommen hat: In der verhältnismäßig kurzen Evolutionszeitspanne von wenigen 100 Millionen Jahren haben wir im Vergleich zu Primaten und höheren Säugern zwei Drittel aller Gene für Geruchsrezeptoren (olfaktorische Rezeptoren) „stillgelegt“ und in Pseudogene umgewandelt. Wir be- 14 Zellphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 profil dreier weiterer Rezeptoren detailliert charakterisieren. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass ein Rezeptorprotein in der Lage ist, sehr spezifisch nur eine bestimmte chemische Teilstruktur (funktioAbb. 5: nale oder detera - Molekulare minante Gruppe) eiStruktur eines nes Moleküls zu ermenschlichen Riech- kennen und so nur rezeptorproteins. auf Duftstoffe zu reaDie 320 Aminosäugieren, die genau dieren lange Kette se Struktur besitzen. durchquert siebenIn höheren Konzenmal die Zellmemtrationen können jebran. doch auch Moleküle b - Dreidimensiona- mit ähnlicher Strukles Modell der tur den Rezeptor akRezeptorstruktur. tivieren. Das funktioniert allerdings nur, solange die determinante Gruppe Die Aminosäureketten (ca. 320 gleich ist – jede kleine Veränderung Aminosäuren) der Rezeptorproteine daran führt in der Regel zu einem vollsind sich in ihrer Sequenz sehr ähnlich ständigen Wirkverlust. (homolog) und durchspannen siebenFür uns Menschen bedeutet dies, mal die Zellmembran (s. Abb. 5). Die dass wir ca. 350 unterschiedliche cheBereiche drei bis sechs zeigen die mische Strukturen identifigrößte Vielfalt. Dort vermuten wir die zieren und unterscheiden Bindungstasche, also den Bereich der können. Da aber kleine Wechselwirkung zwischen Duftmolekül strukturelle Änderungen an und Rezeptorprotein. In Computervielen Molekülbereichen modellen des Rezeptorproteins gelang die Rezeptorreaktion nur es uns, Aminosäuren zu identifizieren, graduell verändern, ist die die in der Bindungstasche lokalisiert Gesamtzahl der riechbaren sind (s. Abb. 6). Inzwischen haben wir chemischen Moleküle viel alle Riechrezeptorgene eines Genhöher. Hinzu kommt, dass clusters auf Chromosom 17 des Mendie meisten natürlichen schen (insgesamt 18 Gene) isoliert, Düfte Mischungen verschiesequenziert und kloniert. Sieben davon dener Komponenten sind, so sind Pseudogene. Die elf funktionsfädass man insgesamt fast unhigen Rezeptoren schleusten wir in endlich viele Gerüche erNieren-Tumorzelllinien ein und chakennen kann. Interessanterrakterisierten ihre Funktion. Dabei geweise wählt jede Riechsinlang es uns vor drei Jahren erstmals, neszelle nur ein einziges einen Rezeptor hinsichtlich seiner Speder 347 Gene aus und stellt zifität für einen bestimmten Duft das entsprechende Rezep(Ligandenspezifität) zu identifizieren: torprotein her – ein bisher den Rezeptor 17-40, der spezifisch ist unerforschter faszinierender für Helional, einen der Meeresbrise Mechanismus. Bei ca. 20 ähnlichen Duft. Millionen Riechzellen und Inzwischen konnten wir das Duft- 15 rund 350 unterschiedlichen Rezeptoren sind von jedem Riechsinneszelltyp rund 50.000 Zellen in der Schleimhaut verteilt. Die Muster dieser Verteilung sind sehr spezifisch und genetisch festgelegt bei jedem Menschen gleich. Sie treten auch symmetrisch in beiden Nasenhöhlen auf. Symmetrie der Riechzellen-Muster in beiden Nasenhöhlen Folgen wir der Geruchsspur vom Rezeptor weiter in die Riechsinneszelle hinein, so endet die biochemische Reaktionskaskade in der Herstellung großer Mengen des zweiten Botenstoffes cAMP, der direkt Ionenkanäle in der Membran öffnet (Abb. 7). Diese Kanäle weisen einige funktional sehr wichtige Anpassungen auf. So konnten wir vor längerem schon zeigen, dass die Kalziumionen aus dem Nasenschleim, die der Kanal in die Riechsinneszelle leitet, zwei völlig unterschiedliche Funktionen haben: Sie können als positive Ladung das Membranpotential verändern und somit zur Zellerregung beitragen. Bei steigender Abb. 6: Molecular modelling des menschlichen Riechrezeptors 17-4 mit der Bindetasche für den Duft Bourgeonal (s. Kasten) Zellphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 7: Molekulare Prozesse der Verarbeitung von Duftreizen in einer Riechzelle. Hemmende Mechanismen blockieren Ionenkanäle, die für Reizaufnahme und -weiterleitung wichtig sind. Konzentration können sie aber auch den cAMP-Kanal von innen her blokkieren: Je intensiver und länger man einen Duft riecht, also diese cAMP-aktivierten Kanäle offen hält, desto höher steigt die Kalziumkonzentration in der Zelle, bis der Kanal sich irgendwann selbst abschaltet (Feedback-Mechanismus). Das ist die erste Erklärung für die Verarbeitung von Gerüchen auf molekularer Ebene. Erst im letzten Jahr konnten wir darüber hinaus zeigen, dass cAMP nicht nur direkt Ionenkanäle öffnen kann, sondern auch ein Kanal zu - Duftleitung unterbrochen Enzym (Proteinkinase A) aktiviert, das durch Phosphorylierung von Natriumund Kalzium-Kanalproteinen diese Ionenkanäle abschalten kann (s. Abb. 7, unten). Da diese Kanäle für den sog. Aktionspotentialstrom verantwortlich sind, der eine Dufterregung aus der Nase ins Gehirn leitet, wird der Duft nicht länger gerochen – wir haben uns an ihn gewöhnt. Obwohl molekularbiologische Arbeiten davon ausgehen, dass jede Riechsinneszelle nur einen einzigen Typ von Riechrezeptor auf der Oberfläche ausbildet, konnten wir jüngst erstmals zeigen, dass eine Riechzelle un- terschiedlich auf verschiedene Düfte reagieren kann: Ein und dieselbe Zelle kann durch einen Duft erregt, durch einen anderen jedoch daran gehindert werden. Im Experiment verlor z. B. eine auf Maiglöckchenduft (Bourgeonal) spezialisierte Riechzelle die Fähigkeit diesen Duft zu riechen, wenn sie zuvor einen hemmenden Duft wahrgenommen hatte. „Hemmende“ Düfte aktivieren auf bisher unbekannte Weise eine andere biochemische Kaskade in der Zelle, an deren Ende nicht die Erhöhung der Konzentration von cAMP sondern PIP 3 steht. PIP 3 wird durch PI 3 Kinase aus PIP 2 gebildet. Diese Substanz kann die Öffnung der cAMP-aktivierten Ionenkanäle verhindern. Hemmung in diesem System bedeutet also keine direkte Beeinflussung des Membranpotenzials einer Zelle, sondern dass die Zelle nicht erregt werden kann, da die Kanäle blockiert sind. Unsere aktuellen Forschungsdaten geben erstmals Hinweise, dass man Hemmstoffe für Riechrezeptoren entwickeln kann, die den Rezeptor direkt blockieren und damit, ähnlich wie in der Pharmakologie, als konkurrierende Antagonisten wirken können. Diese Ergebnisse zeigen, dass Riechzellen und die Informationsverarbeitung im Riechsystem sehr viel komplexer sind als bisher angenommen, und dass bereits eine Signalverarbei- tung auf peripherer Ebene im Riechepithel stattfindet. Dies wirft ein völlig neues Licht auf das Potenzial der möglichen Dufterkennungen und –unterscheidungen, zeigt aber auch, dass es vieler raffinierter zellulärer Prozesse bedarf, um dieses wichtige Sinnesorgan zu Höchstleistungen zu befähigen. Die meisten natürlichen Düfte wie Blumenduft und Parfums bestehen aus Human olfactory system The human olfactory system detects odorants at low concentrations with remarkably precise discrimination. Our knowledge about the molecular components of the transduction cascade has increased considerably. Recently, we were able to functionally express and characterize the first human olfactory receptor protein. We demonstrated additionally that odorant-induced activation of the biochemical cascade initiates modulatory activities which lead to activation of PKA and/or phosphoinositides, affecting not only the transduction current but also the input/ output relationship of olfactory cells. ABSTRACT 16 Zellphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Hunderten einzelner chemischer Duftkomponenten. Wie können wir also eine duftende Rose von einer Orange unterscheiden? Beim Einatmen dieser komplexen Mischung werden von den ca. 350 verschiedenen Typen von Riechsinneszellen nur die aktiviert, die Rezeptoren für einen der vorhandenen Düfte tragen. Neuroanatomische und immunhistochemische Daten haben gezeigt, dass alle Sinneszellen mit den gleichen Rezeptorproteinen ihre Nervenfortsätze von überall in der Nase in ein- und dieselbe kugelförmige Zellansammlung (Glomerulus) in unserem Riechhirn (bulbus olfactorius) senden. Alle rund 50.000 Nervenfortsätze der „Vanillin-Sinneszellen“ enden z. B. in der „Vanillekugel“. Welche Markierungsstoffe diese Wegfindungsprozesse 17 Abb. 8: Duftgestalt: Modell der Aktivierung der Glomeruli nach Reizung mit Rosen- bzw. Orangenduft. ermöglichen, ist bisher unbekannt. Riecht man nun eine Mischung aus mehreren chemischen Komponenten, so werden entsprechend mehrere Sinneszellenrezeptortypen aktiviert und damit auch die dazugehörigen Glomeruli. Es entsteht ein reproduzierbares, aber komplexes Aktivierungsmuster von Glomeruli (s. Abb. 8), das im Umkehrschluss zeigt, welche Duftmischung wir gerochen haben. Das Rosenduft-Aktivierungsmuster unterscheidet sich eindeutig vom Orangenduftmuster. Wenn einzelne chemische Komponenten in beiden Duftmischungen vorkommen, können die Muster aktivierter Glomeruli überlappen. In der Psychologie könnte man dies mit dem Begriff Duftgestalt bzw. Gestalterkennung beschreiben. Haben wir einmal einen Duft gelernt, so können wir ihn auch wieder erkennen, wenn ihm ein Teil der Information fehlt. Das macht man sich z. B. bei den stark reduzierten künstlichen Rosenoder Orangendüften zu nutze. Neuroinformatik/Physiologie Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 Leistungssteigerung und Plastizität bis ins hohe Alter Das erwachsene Gehirn ist unveränderbar - das galt jahrzehntelang als Postulat. Doch längst besteht kein Zweifel mehr daran, dass Leistungssteigerung und Selbstreparatur des Gehirns bis ins hohe Alter möglich sind. Neurowissenschaftler zeigen am Beispiel des Laufverhaltens und bei Verletzungen der Sehrinde wie gut sich dieses Potenzial erschließen lässt. Abb. 1 N ach dem Konzept der „gebrauchsabhängigen Plastizität“ befindet sich auch das erwachsene Gehirn in einem Zustand permanenter Veränderung: Schon ein geringfügiger Wechsel der Lebensumstände, der zu einem anderen alltäglichen Verhalten führt, kann plastische Reorganisationsprozesse in Gang setzen. Welchen Einfluss haben diese Mechanismen auf Verletzungen des Gehirns oder auch auf natürliche Alterungsprozesse des Menschen? Altern ist zentraler Bestandteil jeglichen Lebens. Viele Theorien versuchen das Altern zu erklären, allerdings ohne wirklich Einsicht in die Hintergründe zu geben. Neben der Bedeutung für das Individuum selbst hat das Altern auch eine gesellschaftliche Dimension: Mit dem Geburtenrückgang PD Dr. Hubert Dinse, Institut für Neuroinformatik der RUB, Prof. Dr. Ulf T. Eysel, Institut für Physiologie, Medizinische Fakultät und der zunehmenden Lebenserwartung der Menschen in den modernen Industrieländern hat sich die „Alterspyramide“ umgekehrt. Die Konsequenzen sind heute noch nicht absehbar. Im Zuge dieser Entwicklung wird die sog. Alltagskompetenz alter Menschen immer wichtiger. Sie charakterisiert die sensomotorischen Fähigkeiten, die notwendig sind, um alltägliche Arbeiten zu verrichten. Doch sind altersbedingte Veränderungen degenerativen Ursprungs und damit weitgehend irreversibel, oder handelt es sich um plastische Veränderungen im Sinne einer kompensatorischen Anpassung an die Anforderungen des täglichen Lebens? Ratten stellen ein optimales Untersuchungsmodell für diese Fragestellung dar, da sie mit zwei bis drei Jahren schon „in hohem Alter“ sind. Als einen Aspekt der Alltagskompetenz wählten wir für unsere Untersuchungen das Laufverhalten der Ratten aus. Wie die Pfotenabdrücke zeigen (Abb. 2), sind Ratten im Alter - wie Menschen H. Dinse U. T. Eysel Abb. 2: Pfotenabdrücke: Wie der schlurfende Gang alter Ratten zeigt, fällt es ihnen schwer, die Hinterbeine zu heben. 17 Neuroinformatik/Physiologie Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 3: Jeder Nervenzelle ist ein rezeptives Feld (RF) auf der Pfote der Ratte zugeordnet, damit repräsentiert eine Nervenzelle nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten Außenwelt. Die kortikale Karte berechnet sich aus der gegenseitigen Lagebeziehung der Nervenzellen und den dazu gehörenden RFs auf der Pfote. auch - im Laufen stark eingeschränkt. Sie schlurfen und humpeln mit den Hinterbeinen, während die Vorderextremitäten weitgehend unbeeinträchtigt bleiben. Doch führt dieses Laufverhalten auch zu Veränderungen im Gehirn? Bei der Klärung dieser Frage kam uns die Art der Gehirnorganisation zugute, die die Körperoberfläche wie eine Landkarte kartiert: Benachbarte Punkte auf der Haut korrespondieren mit nebeneinander liegenden Bereichen des Gehirns (s. Abb. 3). Reizt man zum Beispiel zwei Punkte auf der Handfläche, so werden auch im Gehirn nah beieinander liegende Stellen aktiviert. Liegen die Reizpunkte weit voneinander entfernt, so ist auch der Abstand der aktivierten Gehirnbereiche größer. Das in der Hirnrinde des Menschen entstehende Bild, die sog. kortikale Karte der gesamten Körperoberfläche, wird deshalb auch als Homunculus („Menschlein“) bezeichnet. Abb. 4 zeigt eine kortikale Karte, die anhand von elektrophysiologischen Messungen der Nervenzellaktivität in den Hirnregionen erstellt wurde, die die Extremitäten repräsentieren: Im Bereich der Hinterextremitäten sind dramatische Aktivitätsstörungen zu erkennen. Diese Ergebnisse konnten wir auch mit einer neuen Methodik, der „optischen Registrierung“, bestätigen (s. Abb. 4). Dabei messen wir die Veränderungen des Blutflusses in bestimmten Bereichen des Gehirns nach Reizung der Haut. Es konnte experi- 18 mentell nachgewiesen werden, dass Nervenzellaktivität mit einer Änderung des Blutflusses verbunden ist. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die kortikalen Karten altersbedingt verändern. Sie verlieren ihren Ordnungsgrad und schrumpfen, was auf einen veränderten Tastsinn und damit auf eine veränderte Wahrnehmungsfähigkeit im betroffenen Körperteil schließen lässt. Die Veränderungen bleiben auf die kortikalen Karten der Abb. 4: Die kortikalen Karten der Vorderpfoten (VP) unterscheiden sich bei jungen und alten Ratten nicht. Ausdehnung und Aktivierungsstärke sind vergleichbar. Dagegen ist die Verarbeitung des Tastsinns im Bereich der Hinterpfoten (HP) bei alten Ratten stark eingeschränkt, wie die kortikalen Karten zeigen. Hinterextremitäten beschränkt, obwohl diese nur wenige Millimeter von denen der Vorderextremitäten entfernt liegen. Wir vermuten deshalb, dass das altersbedingt veränderte Laufverhalten nicht auf degenerative Veränderungen im Sinne eines „Zusammenbruchs von Gehirnfunktionen“ zurückzuführen ist. In diesem Fall müssten die kortikalen Karten beider Extremitäten betroffen sein. Wir erklären diese Ergebnisse im Sinne der „gebrauchsabhängigen Plastizität“. Bis etwa 1980 ging man davon aus, dass plastische Anpassungsprozesse des Gehirns auf die sog. „kritische Entwicklungsphase“ eines Individuums beschränkt bleiben. Das erwachsene Hirn hielt man dagegen für weitgehend unveränderlich, Lernprozesse bezögen sich lediglich auf Veränderungen der Synapsen und damit auf mikroskopische Vorgänge. Heute besteht kein Zweifel mehr daran, dass auch im erwachsenen Gehirn weitreichende Reorganisationsprozesse in makroskopischer Größenordnung im Mil- Neuroinformatik/Physiologie Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 limeter- oder sogar Zentimeterbereich stattfinden. Man nimmt an, dass die synaptische Plastizität mikroskopische Veränderungen auslöst, die dann zu den makroskopischen Veränderungen führen, die sich wiederum in der kortikalen Karte widerspiegeln. Unsere Hypothese lautet daher, dass die beobachteten Altersveränderungen kein Ausdruck des Absterbens und Untergangs von Nervenzellen sind, sondern dass es sich dabei um aktive Adaptationsprozesse handelt. So können z.B. äußere Faktoren wie altersbedingter Muskelschwund oder Gelenkschmerzen dazu führen, dass bestimmte Körperteile weniger „benutzt“ werden. Über Mechanismen der gebrauchsabhängigen Plastizität führt dies wiederum zu Veränderungen der senso-motorischen Karten im Gehirn. Für die zentrale Rolle des Cortex beim Auftreten von Altersveränderungen spricht auch, dass die peripheren Nerven der Hinterextremitäten alter Ratten unbeeinflusst bleiben. Wodurch lässt sich diese Hypothese stützen? Zumindest gibt es Hinweise dafür, dass ein erhöhter oder verringerter Gebrauch von Körperfunktionen zu kortikaler Reorganisationen führen kann: So benutzen Musiker Hände und Finger wesentlich häufiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die er- Gipsverband schränkt Bewegung und damit kortikale Karte ein höhte sensomotorische Fähigkeit von Geigen- und Klavierspielern ist auch tatsächlich mit einer spezifischen Vergrößerung ihrer kortikalen Karten verbunden. Dagegen haben Patienten, die für mehrere Wochen einen Gipsverband tragen und damit in ihren Bewegungen eingeschränkt sind, spezifisch verkleinerte kortikale Karten. Auch bei unse- Abb. 5: Balkenlauftest: Die alte Ratte (Mitte, rechts) schafft es im Vergleich zum jungen Tier (oben) nicht, den Balken zu überqueren. Ihre kortikale (motorische) Karte ist in Ausdehnung und Emfpindlichkeit stark reduziert (Mitte, links) . Wenige Monate nach Aufenthalt im „enriched environmemt“ hat die motorische Karte wieder die Ausdehnung bei jungen Tieren erreicht, nicht aber deren Empfindlichkeit (Farbcode). Die „enriched-Ratte“ (unten) hat neue Verarbeitungsstrategien entwickelt. ren Ratten führen geringfügige Einschränkungen des Laufverhaltens zu schnellen Änderungen der kortikalen Karten. Dass diese Prozesse reversibel sind und sich je nach „Lebensumständen“ und verändertem Verhalten modifizieren und beeinflussen lassen, spricht dafür, dass es sich dabei um aktive Plastizitätsprozesse handelt. Wir haben deshalb den Einfluss einer „anregenden Umgebung“ (enriched environment) auf die Alterungsprozesse anhand der kortikalen Karten, der Antworteigenschaften kortikaler Nervenzellen sowie verschiedener Verhaltensparameter für die Laufeigenschaften von Ratten überprüft. Im „enriched environment“ können die Tiere Gänge und Höhlen bauen, erhalten ihr Futter an jeweils anderen Orten und werden so zu einem aktiven Explorationsverhalten und zum Klettern motiviert, was ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit und ihre Fitness stärkt. Sie blieben im Durchschnitt ein halbes Jahr in dieser Umgebung und hatten dann mit fast drei Jahren ein für Ratten hohes Alter erreicht. Die Haltung im „enriched environment“ zeigte einen sehr positiven Einfluss auf das Laufverhalten der Ratten: Auf den ersten Blick liefen die Tiere fast so gut wie junge Ratten (s. Abb. 5 u. 6). Erst bei näherem Hinschauen, entdeckten wir, dass sie dafür aber neue Laufstrategien entwickelt hatten, mit denen sie die typischen Altersbeeinträchtigungen, wie Unsicherheit, Verlangsamung oder Muskelabbau, weitgehend ausgleichen konnten. So hielten die alten Ratten z. B. durch viele kleine Schritte die Beine mehr am Boden und erreichten damit eine bessere Standsicherheit. Die „enriched-Ratten“ entwickeln eine neue Form der Alltagskompetenz, die sich wesentlich von der alter, aber auch von jungen Ratten unterscheidet. Der Zerfall der 19 Neuroinformatik/Physiologie Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 6: Fotosequenz des Balkenlauftests: Alle jungen Ratten erreichten das Häuschen am Ende des Balken (oben), aber keine der alten Ratten (Mitte). Nach Haltung im „enriched environment“ kommen auch 80 Prozent der alten Ratten langsam am Ende des Balkens an (unten). kortikalen Karten der Hinterextremitäten wurde durch das „enriched environment“ ebenfalls verhindert - auch hier fanden wir dafür andere neuronale Strategien als bei jungen Ratten. Weit über die Funktionsbeeinträchtigung bei normalen Alterungsvorgängen hinaus gehen Blutmangelzustände, Blutungen oder mechanische Verletzungen des Gehirns. Mit dem Untergang größerer Zellverbände fallen ganze Funktionsbereiche aus. Da keine Re- generation eintritt, steht das Funktionssystem Gehirn damit vor einer ganz neuen Aufgabe: Zellen, die Jahre oder Jahrzehnte eine bestimmte Funktion inne hatten, müssen neue Aufgaben übernehmen, wenn das Gesamtsystem überleben soll. Ähnlich dem Altern, stellen auch Schädigungen des Gehirns, insbesondere der Schlaganfall und die nachfolgende Rehabilitation, ein bedeutendes medizinisches und ökonomisches Problem dar. Abb. 7: Die Sehrinde einer Katze von oben (a) und schematisch im Querschnitt (b). Die Läsion ist grün markiert (Kreis in a, Fläche in b) Die rezeptiven Felder zeigen vor der Schädigung (weiß) die normale relativ kleine Fläche. Nach 76 Tagen überdekken die stark vergrößerten rezeptiven Felder an denselben Orten (mattgrün) auch zuvor „blinde“ Nachbarbereiche des Gesichtsfeldes. 20 Unser experimentelles Modell geht von winzigen Läsionen in der Sehrinde von Katzen und Ratten (Abb. 8) aus, die zu Gesichtsfeldausfällen führen. Die Folge sind kleine blinde Bereiche, die sich anhand von Mikroelektrodenableitungen demonstrieren lassen. Zellen in der Umgebung dieser Läsionen antworten auf Lichtreize (s. Abb. 7). Die Bereiche der Läsionen selbst aber bleiben unerregt - als wäre ein kleines Loch in ein Bild gestanzt worden (Abb. 7c, Lücke zwischen den weißen Feldern). In einer weiteren Untersuchung 76 Tage später stellten wir fest, dass sich die Gesichtsfeldbereiche (rezeptive Felder) vergrößert hatten (Abb. 7c, mattgrüne Felder), die von einzelnen Zellen am Rand der Läsion „gesehen“ werden. Sie überdecken wieder den gesamten Bereich des Gesichtsfeldes der zuvor blinde Bereich war verschwunden und kleine Objekte, die sich hier befinden, konnten wieder wahrgenommen werden. Die Zellen am Läsionsrand hatten die Funktion ihrer ausgefallenen Nachbarzellen übernommen. Wir haben festgestellt, dass sich die rezeptiven Felder bei vermehrter und gezielter Benutzung schon bei kurzer Übungszeit (ca. 1 Stunde) innerhalb von 48 Stunden nach Eintreten einer Läsion vergrößern. Werden sie nicht trainiert, sondern z.B. in völliger Dunkelheit gehalten, dann bleibt die Umprogrammierung der Zellen aus. Diese Umprogrammierung von Zellfunktionen lässt sich am besten Neuroinformatik/Physiologie Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 durch die sog. Langzeitpotenzierung (LTP), eine Form zellulären Lernens, erklären. Dabei führt die wiederholte und hochfrequente Nutzung von Zellkontakten zu deren dauerhafter Verstärkung. Wir lösen die LTP durch eine spezielle Stimulation aus (Theta-BurstStimulation, TBS), bei der innerhalb einer Minute drei Salven von je 20 hochfrequent wiederholten erregenden Antwortpotenzialen an der Synapse ausgelöst werden (Abb. 9a). In Hirnschnitten von Ratten mit kleinen Laserläsionen konnten wir zeigen, dass bei Zellen des Läsionsrandes eine hochsignifikant verstärkte Langzeitpotenzierung auftritt (Abb. 9b). Während im gesunden, erwachsenen Abb. 9: Noch lange nach wiederholter hochfrequenter elektrischer Erregung der Synapse ist das übertragene Signal (gelbe Spur) größer als vor dem Lernreiz (blaue Spur). Der Lerneffekt ist in der Umgebung der Schädigung am größten (rote Messpunkte, unten). Gehirn weniger als die Hälfte der Zellen eine schwache LTP zeigt (Amplitudensteigerung auf 137% der Ausgangsamplitude), fanden wir am Läsionsrand bereits in der ersten Woche nach der Verletzung bei zwei Dritteln aller Zellen eine deutlich stärkere Langzeitpotenzierung (Amplitudensteigerung auf 190%). Diese verstärkte Plastizität des Gehirns geht mit einem erhöhten Calciumspiegel in den Zellen um die Läsion einher. Die veränderte synaptische Plastizität unmittelbar nach Eintreten der Verletzung deutet auf ein erhöhtes Potenzial des Gehirns hin, sich umprogrammieren zu können. Dieses Phänomen scheint der frühkindlichen Plastizität des Gehirns vergleichbar und hat offenbar auch ähnliche molekulare Ursachen. Es stellt eine interessante biologische Anpassung der Hirnrinde dar, durch Selbstreparatur und Umprogrammierung überleben zu können. Bereits heute sind Trainingsprogramme erfolgreich, die das Zeitfenster der verstärkten Plastizität nach der Schädigung nutzen. Wie unsere Ergebnisse zeigen, sind plastische Anpassungsprozesse des Gehirns ebenso Teil des Alterns, wie auch Grundlage von Reparaturstrategien nach einer Hirnschädigung. Daraus ergeben sich erhebliche Konsequenzen für mögliche Therapien: Während sich immer deutlicher zeigt, dass das menschliche Gehirn das Potenzial besitzt, Alterungs- Abb. 8: Die kleinen lokalen Schädigungen in der Hirnrinde von Katze (a) und Ratte (b) sind frei von Nervenzellen. vorgänge durch Training, Fitness und Lernen nicht nur zu stoppen, sondern auch umzukehren, lassen sich Hirnfunktionen selbst bei Verletzungen und Zelluntergang durch frühzeitiges Training wieder zurückgewinnen. In beiden Fällen deuten erste Untersuchungen am Menschen darauf hin, dass sich die im Tierversuch gewonnenen Daten auf klinisch-medizinische Anwendungen übertragen lassen könnten. The Role of neural plasticity in aging and repair We describe new approaches that utilize the framework of use-dependent plasticity for the understanding of agerelated changes and repair processes. Age related changes in sensorimotor cortex of old rats carry signs of usedependent plastic changes as a result of reduced use. Consequently, housing old rats under enriched environmental conditions ameliorates and delays both cortical alterations and sensorimotor performance. After cortical lesions, surrounding cells show a temorarily increased synaptic plasticity similar to that found in juvenile brains. Reprogramming on the network level and functional recovery are facilitated. The use-dependent nature of neuronal plasticity in aging and repair can be utilized for use-dependent improvement. abstract 21 Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 Vom Nervensystem abgeguckt: Künstliche Bewegung – so natürlich wie möglich Der „Griff in die Kiste“ – das autonome Ergreifen eines Gegenstandes aus einem ungeordneten Haufen – ist bis heute technisch ungelöst. Menschen dagegen können zur Not eine Schraube auch ohne Sichtkontakt in eine Schraubenmutter „pfriemeln“. Neuroinformatiker versuchen, Roboter nach dem Vorbild des Gehirns so zu programmieren, dass sie lernen, sich geschickter zu bewegen. G. Schöner L eben ist Bewegung. Fragt man, was Tiere als biologische Wesen auszeichnet, so erhält man oft die Antwort: „Dass sie sich bewegen“. Wir Menschen sind Meister der Bewegung. Unser manuelles Geschick ist sogar konkurrenzlos im Tierreich. Doch sich geschickt zu bewegen, ist schwierig, wie das Beispiel zeigt: Wir bauen und programmieren Computer, die uns im Schachspiel schlagen und uns in komplexen Planungen weit übertreffen. Doch das Bewegungsgeschick eines dreijährigen Kindes bleibt für den Roboter unerreicht. Was ist so schwierig an der Bewegung? Sicher nicht sie zu erzeugen – das können Autos oder Flugzeuge sehr effizient und kraftvoll. Es ist auch Prof. Dr. Gregor Schöner, Institut für Neuroinformatik 23 Abb. 1: Roboter Arnold nicht unbedingt die Präzision der Bewegung – moderne Industrieroboter erreichen und übertreffen den Menschen im präzisen Positionieren von Werkzeugen. Eine zentrale Herausforderung ist es, zielgerichtete Handlungen in natürlichen, teilweise unbekannten Umwelten flexibel zu erzeugen. Industrieroboter brauchen detaillierte und präzise Informationen über die Lage und mögliche Greifkonfigurationen von Objekten. Dagegen können Menschen einen noch nie zuvor gesehen Gegenstand ergreifen und manipulieren. Dies gelingt uns auch noch, wenn der Gegenstand halb verdeckt auf einem unaufgeräumten Schreibtisch im Halbdunkel liegt. Wie erreichen wir diese Flexibilität? Unser Bewegungsapparat hat reichlich Bewegungsmöglichkeiten (Freiheitsgrade), mehr als genug, um die meisten Bewegungsaufgaben mechanisch realisieren zu können. Ein Ziel mit einer Laserpistole zu treffen, erfordert z. B. nur, zwei Kenngrößen richtig einzustellen: Hält man die Pistole in beliebiger Position, so muss sie maximal um zwei Achsen gedreht werden, damit sie auf das Ziel zeigt. Die dritte Drehung um die Längsachse der Pistole beeinflusst den Schießerfolg nicht. Um die beiden Winkel korrekt einzustellen, stehen uns im Oberarm sieben Gelenkwinkel zur Verfügung. Wenn wir das Schulterblatt und den Oberkörper mitbewegen dürfen, sind es noch mehr. Die vielen Freiheitsgrade nutzen Men- Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 schen auch: Schießen wir wiederholt auf ein Ziel, dann ist die genaue Gelenkwinkelkonfiguration von Durchgang zu Durchgang nicht identisch, sondern sie schwankt. Schon in den dreißiger Jahren konstatierte Nikolai Bernstein, der russische Pionier der Bewegungsforschung, dass Meisterschützen von Schuss zu Schuss genau so viele Schwankungen in ihrem Bewegungsapparat zulassen wie Anfänger. Beide stellen also nicht jedesmal wieder die gleiche Stellung her. Wie erzeugen dann aber Meisterschützen ihre höhere Zielgenauigkeit? In einer experimentellen Arbeit mit John Scholz und Mark Latash konnten wir nachweisen, dass sie dazu die vielen Freiheitsgrade gezielt koordinieren. Nur die Schwankungen von Gelenkwinkelkonfigurationen werden erlaubt, die die beiden relevanten Zielwinkel unverändert lassen. Schwankungen, die sie verändern, werden dagegen minimiert. Von Schuss zu Schuss nehmen die Meisterschützen damit für diese Gelenkwinkelkombinationen fast die gleichen Positionen ein. Bei einer anderen Bewegungsaufgabe, z. B. mit der Fingerspitze auf ein Ziel im körpernahen Raum zu zeigen, passt sich diese Struktur den Gelenkwinkelschwankungen an. Jetzt findet man verstärkt solche Schwankungen, die die räumliche Position der Fingerspitze unverändert lassen. Bei jeder Wiederholung des Versuchs werden die Gelenkwinkelkombinationen sehr präzise reproduziert, die diese räumliche Position der Fingerspitze verändern könnten. Damit treten im Gegensatz zum Schießen wenig Schwankungen auf. Von Schuss zu Schuss variiert die räumliche Position von Hand und Pistole wie auch die Gelenkwinkelkombinationen, die diese Position beeinflussen, erheblich (s. Abb. 2 ). In der Technik macht man sich ein analoges Regelungsprinzip zu Nutze, um zusätzliche Randbedingungen bei Abb. 2 : Welche Bewegungen koordiniert ein Schütze, wenn er das Ziel sicher treffen will? Dargestellt sind die räumlichen Koordinaten von vier ausgewählten Markierungen auf dem Arm des Schützen. Die Grafik unten zeichnet die Bewegung des Schützen nach. Die farbigen Linien der Laserpistole kennzeichnen vier Versuche. Der Schütze trifft stets das Ziel - auch wenn sich die Pistole beim Feuern an verschiedenen Positionen (s. Kreis) befindet. zielgerichteten Bewegungen zu erfüllen. Am interaktiven Manipulatorarm CORA des Instituts für Neuroinformatik kann der Benutzer (s. Abb. 4) z. B. den Ellenbogen des Roboterarms wegschieben, ohne dadurch die räumliche Position des Werkzeugs an der Spitze des Roboterarms zu ändern. Der Roboter gleicht die Ellenbogenbewegung aktiv aus und stabilisiert das Werkzeug. Dies erhöht die Flexibilität des Roboters, indem er sich so konfigurieren lässt, dass er den Benutzer wenig stört. Wie jedoch kommen Bewegungsziele und Aufgabenstellungen in das Nervensystem hinein, so dass sie dort Bewegungsregelung strukturieren können? Meist richten wir Bewegungen auf visuell erfasste Bewegungsziele, etwa wenn wir eine Tasse vor uns auf einem Tisch ergreifen. Wir können diese Information aber problemlos durch Information aus anderen Systemen ersetzen, wenn wir z. B. aus dem Gedächtnis nach der verdeckten Tasse greifen, wenn wir in Richtung auf eine Schallquelle zeigen oder wenn wir uns an einer Oberfläche entlang zum verborge- nen Bewegungsziel tasten. Aus der Neurophysiologie wissen wir, dass diese verschiedenen Informationen letztlich zu einem abstrakten Bewegungsplan integriert werden. Dieser Plan hängt im Detail nicht mehr von den sensorischen Quellen ab, er ist aber auch noch nicht mit den Details der Bewegungsregelung ausgestattet. Im Motor- und Prämotorareal der Hirnrinde findet man zum Beispiel zahlreiche Neurone, die durch ihre Aktivität die Richtung im äußeren Raum einer zielgerichteten Bewegung repräsentieren. Das ist ein Parameter, der die Bewegung ganzheitlich beschreibt, nicht auf der Ebene der genauen Gelenkwinkelkonfigurationen, Eine Nervenzelle repräsentiert viele Bewegungsrichtungen die durchlaufen werden sollen. Da jedes Neuron an einer Vielzahl von Bewegungsrichtungen beteiligt ist, sind bei jeder einzelnen Bewegung zahlreiche Neuronen aktiv – man spricht von einer Populationskodierung (s. Abb. 3). Mathematisch kann man diese Form der Repräsentation der Bewegungsaufgabe mit dem Begriff des neuronalen Feldes erfassen. Wie das elektrische Feld in der Physik jedem Raumpunkt eine Größe zuordnet, aus der die Kraft auf eine elektrische Ladung abgeleitet werden kann, so ordnet das neuronale Feld jeder möglichen Bewegung eine Größe – die Aktivierung – 24 Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 zu. Aus der Aktivierung kann abgeleitet werden, mit welcher Abb. 3: Wahrscheinlichkeit die BeweEine zielgerichtete Bewegung ausgeführt wird. gung hier die ArmbeweWird eine zielgerichtete gung eines Affen - wird Bewegung vorbereitet, so entneuronal erfasst (Grafik wickelt sich das neuronale oben) und modellhaft nachFeld in der Zeit von einem gebildet (Grafik unten): Die vorstrukturierten Zustand aus, Bewegungsrichtung ergibt der Vorabwissen über die Besich anhand der Populawegungsaufgabe reflektiert tionsverteilung aus ca. hun(z.B. bekannte mögliche Bedert aktiven Neuronen im wegungsziele) hin zu einem motorischen Kortex. Der Zustand, der durch einen Berg Affe bewegt seine Hand von von Aktivität die gewünschte einer zentralen Plattform zu Bewegung repräsentiert (s. einem von sechs ZielpunkAbb. 3). Diese zeitliche Entten. Eine Sekunde nach der wicklung wird durch sensori„Vorabinformationen“ über sche, oft visuelle Information ein bzw. zwei mögliche Ziele angetrieben. gibt das Bewegungsignal Sensorische Information aldie genaue Information über leine legt Bewegungsziele aber das Ziel zu dem die Hand noch nicht eindeutig fest. Im bewegt werden soll. Schon Alltag gibt es meist viele die„Vorabinformation“ mögliche Bewegungsziele, zwistrukturiert die neuronale schen denen eine EntscheiPopulation (s. Aktivierungsdung gefällt werden muss. verteilung). Aus der neuroWerden diese Entscheidungen nalen Aktivierung ergibt willkürlich gefällt? Nicht imsich, welche Bewegungen mer! Im Labor kann man dies das Tier vorbereitet. Mit am besten an den sprunghaften dem Bewegungssignal (sakkadischen) Augenbewegunwächst ein lokalisiertes Magen nachweisen, mit denen wir ximum der Aktivierung geunsere Blickrichtung ändern nau über dem angezeigten (s. Abb. 5). Präsentiert man eiBewegungsziel an – die Bener Testperson einen grün wegung wird ausgelöst. Das leuchtenden Punkt in der Peridynamische neuronale Feldpherie des Gesichtsfeldes, so modell (unten) bildet die kann sie diesen Leuchtpunkt Zeitverläufe der neuronalen leicht ins Zentrum des GeAktivierung nach. sichtsfeldes bringen, indem sie eine sakkadische Augenbewegung macht. Befindet sich aber gleichzeitig ein grüner verhindern, dass sie in etwa der Hälfte und ein roter Leuchtpunkt in der Perider Fälle die „falsche“ Entscheidung pherie des Gesichtsfeldes, so trifft die treffen. Sie findet auf einer Ebene statt, Versuchsperson eine Entscheidung, welauf der die Anweisung zur Farbkodiechen der beiden Punkte sie ins Zentrum rung noch nicht verarbeitet ist. bringt. Unter geeigneten Bedingungen In den neuronalen Feldern lässt findet diese Entscheidung auf recht sich die Fähigkeit, aus möglichen niedriger Ebene statt: Gibt man die Bewegungszielen eines auszuwählen, Anweisung, stets den grünen Punkt ins durch Wechselwirkung erklären: VerZentrum des Gesichtsfeldes zu bringen, schiedene aktivierte Bewegungen beso können die Testpersonen doch nicht 25 Neuronale Daten Modell einflussen sich gegenseitig so, dass sie in Konkurrenz zu einander stehen. Nur eine Bewegung kann „gewinnen“. Welche das ist, kann von der Attraktivität der Bewegungsziele, von der vorangegangenen Bewegung oder auch vom Zufall abhängen. Wenn Babies Bewegungen planen, kann man den Prozess der Entscheidungsfällung unmittelbar beob- Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 achten. Dabei hilft ein in den 50er Jahren von Jean Piaget beschriebener und seitdem empiAbb. 4: risch gut abgesicherter Effekt: Roboter Cora lässt Versteckt man ein Spielzeug in sich bedienerfreundlich einer abgedeckten Mulde, so konfigurieren. So kann können Babies im Alter von 6 bis z.B. der Ellenbogen des 11 Monaten danach greifen, auch Roboterarms weggewenn das Spielzeug bei Beweschoben werden, ohne gungsbeginn unter einem Deckel dass sich die räumliche versteckt ist. Sie greifen „aus Position des Werkzeugs dem Gedächtnis“. Bringt man ein an der Spitze des RoboBaby drei oder viermal dazu, terarms verändert. nach dem Spielzeug links in einer Mulde zu greifen, und legt es beim nächsten Mal in eine ähnliche Mulde zur Rechten, dann greift es erneut zur linken Mulde! Es kann die „Angewohnheit“, zur linken Mulde zu greifen, nicht unterdrücken, wenn der visuelle Stimulus rechts zu schwach ist (Spielzeug ist verdeckt). Im Entscheidungsprozess ist die gegenseitige Unterdrückung zu schwach. Eine Vielzahl konvergierender Beobachtungen führen zu der Vorstellung, dass im Laufe des Entwicklungsprozesses die anfangs sehr starke Abhängigkeit der Bewegung vom direkten sensorischen Eingang langsam zugunsten interner Prozesse abgebaut wird. Mit Hilfe neu- Bewegung zwischen äußeren und inneren Prozessen ronaler Felder – getrieben durch sensorische Information und durch Wechselwirkungen – versuchen wir Bewegungsplanung im Nervensystem zu verstehen. Nach diesem Prinzip versuchen wir unsere Roboter autonom handeln zu lassen. Bei CORA heißt das, dass visuelle Information, die vom Roboter mit dem eigenen Kamerasystem gewonnen wird, mit haptischer Information, mit Information aus Kraftsensoren und Gelenkwinkelsensoren und sogar mit Information aus einem Spracherkennungssystem kombiniert wird, um daraus einen zeitlich kontinuierlichen Bewegungsplan zu generieren und auch regelnd auszuführen. Die Fähigkeiten unseres „Serviceroboters“ sind noch sehr bescheiden, die Prinzipien bilden aber vielleicht die Basis für ein wesentliches Stück technischen Fortschritts – gewonnen durch Abgucken vom Nervensystem. Dank: Die Arbeiten wurden gefördert durch die DFG und das BMBF in Deutschland, NIH und NSF in den USA, GIS „Cognitique“ in Frankreich, EU in Portugal. Literatur: Bastian, A., Riehle, A., Erlhagen, W., Schöner, G.: Prior inform ation preshapes the population representation of movement direction in motor cortex. Neuroreports 9:315-319 (1998) Erlhagen, W., Bastian, A., Jancke, D., Riehle, A., Schöner, G.: T he distribution of neuronal population activation (DPA) as a tool to study interaction and integration in cortical representations. Journal of Neuroscience Methods 94: 53-66 (1999) Scholz, J.P., Schöner, G., Latash, M.L., Identifying the control structure of multijoint coordination during pistol shooting. Experimental Brain Research 135: 382-404 (2000) Abb. 5: Versuchsschema zum Entscheidungsfällen bei sprunghaften (sakkadischen) Augenbewegungen. Trotz der Anweisung stets den grünen Punkt ins Zentrum des Gesichtsfeldes zu bringen, können die Testpersonen nicht verhindern, dass sie in etwa der Hälfte der Fälle die „falsche“ Entscheidung treffen. Movement generation in organisms and robots Organisms are particularly good at generating movement, the human race distinguishing itself by being particularly flexible and dexterous. We investigate how nervous systems couple the many available degrees of freedom to achieve particlar movement tasks. Movement generation is based on broad distribrutions of neural activation evolving continuously in time driven by sensory information and neural interaction. Theoretical models of this evolution are used at the Institute for Neuroinformatics to enable robots to autonomously reach, grasp, and interact with a human operator. abstract 26 Naturwissenschaften Neurobiologie NEUROrubin 2003 Sehen und Bewegen: Ein Feuerwerk der Nervenzellen Neugierig verfolgt der Rhesusaffe über eine Computermaus mit dem roten Punkt den Zielkreis auf dem Monitor. Ein wahres Feuerwerk der Nervenzellen sorgt für die so einfach erscheinende Auge-Hand-Koordination. W. Kruse C. Oreja-Guevara K.-P. Hoffmann B ewegung sehen ist eine grundlegende Fähigkeit unseres Gehirns. Sie erlaubt Mensch und Tier, bewegte Objekte in einer Szene zu entdecken, Beute zu verfolgen und sich in der Welt zu bewegen. Selbst auf einer unruhig gemusterten Fläche und im schwachen Licht der Dämmerung sehen wir eine Fliege – wenn sie sich bewegt. Bewegte Objekte rufen eine erhöhte Aufmerksamkeit hervor. Zudem führt die Bewegung innerhalb einer visuellen Szene unwillkürlich zu einer Mitbewegung beim Betrachter: Er folgt dem Weg der Fliege mit den Augen und gegebenenfalls auch mit dem Kopf. Indem sich die Blickrichtung mitbewegt, bleibt das Objekt im Zentrum des Ge- Dr. Wolfgang Kruse, Dr. Celia OrejaGuevara, Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann, Allgemeine Neurobiologie, Fakultät für Biologie 27 sichtsfeldes (Fovea). In diesem zentralen Bereich der Netzhaut (Retina) ist die visuelle Auflösung am höchsten. Bei der Steuerung von glatten Augenfolgebewegungen (s. Info, S. 29) sind zwei Aspekte besonders wichtig: Die Bewegung des Objektes – seine Richtung und Geschwindigkeit – muss möglichst genau erfasst werden und die Augenmuskeln müssen beim Ansteuern des Objektes auf dessen Bewegung abgestimmt und kontinuierlich korrigiert werden. Für solche Anforderungen hat das Gehirn höher entwickelter Affen und des Menschen (Primaten) eine komplexe Aufgabenteilung entwickelt. So gibt es z.B. in der Großhirnrinde von Rhesusaffen eine Vielzahl räumlich getrennter Areale, denen spezielle funktionelle Eigenschaften zugeordnet werden können. Bei Primaten sind Areale bekannt, die spezifisch z. B. auf farbige Reizmuster oder auf Gesichter reagieren. Andere Areale antworten sehr selektiv auf bewegte Stimuli, wie etwa das sog. mediotemporale Areal (Area MT) am Scheitellappen ( Parietalkortex, s. Abb. 2). In Area MT haben Neurone meist eine „Vorzugsrichtung“, auf die sie besonders kräftig antworten, wenn sich ein Objekt und damit zugleich dessen Abbild auf der Retina in diese Richtung bewegt. Weicht die Objektbewegung von der Vorzugsrichtung ab, wird die Antwort der jeweiligen Neurone schwächer. Aufgrund der großen Anzahl von Neuronen und der gleichmäßigen Verteilung der Vorzugsrichtungen im gesamten Areal findet sich immer eine Vielzahl Neurone, die auf eine Bewegungsrichtung maximal antwortet. Die Kodierung der Bewegung des visuellen Reizes erfolgt quasi durch ein Feuerwerk zahlreicher Neuronen – man spricht von einer Populationsantwort. Aktivität weiterleiten: auf sehen folgt bewegen Blickt z.B. ein Rhesusaffe auf einen Bildschirm, auf dem sich ein heller Punkt bewegt, dann entstehen neuronale Aktivitätsmuster im Areal Area MT seines Gehirns. Diese Aktivität kann eine entsprechende Augenfolgebewegung steuern, wenn sie aus Area MT zu Strukturen im Mittelhirn projiziert wird, die direkten Einfluss auf die Augenbewegungen haben. Die neuronale Kontrolle der Augenmuskeln in Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Populationsvektoren in Motorkortex (Aktivität von 353 Zellen) und visuellem Areal MT (Aktivität von 252 Zellen). Die Vektoren der Motorpopulation sagen die Richtung der Handbewegung voraus (nach oben). Der visuelle Populationsvektor gibt die Richtung der Zielbewegung wieder (nach oben). Abb. 2: Kernspintomografische Aufnahme der Großhirnrinde eines Rhesusaffen mit den für das Sehen und die Bewegung wichtigen Bereichen Area MT und Primärem Motorkortex. Augenbewegungen: Schnell oder glatt? Die Bewegung unserer Augen erfolgt häufiger als jede andere Bewegung des Körpers. Wir führen etwa drei Augenbewegungen pro Sekunde aus. Meist ändern wir sprunghaft die Blickrichtung, um damit ein Objekt aus dem visuellen Umfeld ins Zentrum des Gesichtsfeldes zu bringen. Diese sog. Sakkaden laufen mit hoher Geschwindigkeit ab und können von uns auch bewusst gesteuert werden. Andere Augenbewegungen führen wir nur bei einem visuellen Reiz aus: Wenn wir z.B. ein sich bewegendes Objekt kontinuierlich mit den Augen verfolgen, spicht man von „glatten“ Augenfolgebewegungen. Zu dieser auf die Geschwindigkeit des Objektes genau abgestimmten Bewegung der Augen kommt es nur, solange sich das Objekt auch in unserem Gesichtsfeld bewegt. info diesen Mittelhirnstrukturen ist unabdingbar für glatte Augenbewegungen. Aufbauend auf den Erkenntnissen über die neuronale Kontrolle der Augenbewegungen rückten in den letzten Jahren zunehmend auch die Bewegungen der Hand in den Mittelpunkt unserer Arbeiten. So können wir der Bewegung der Fliege über die Wand mit unserer Hand sehr präzise folgen, um die Fliege zu fangen oder zu verjagen. Diese Leichtigkeit deutet auf die hohe Entwicklung unseres Gehirns für solche Aufgaben hin. Offensichtlich muss die Kontrolle der Hand und des Armes direkt auf die visuelle Information zurückgreifen können. Bei der Steuerung von Bewegungen der Hand nimmt der primäre Motorkortex eine zen- trale Stellung ein. Dieses Gebiet, das vor der Zentralfurche (Sulcus centralis) an der hinteren Kante des Frontallappens liegt (Abb. 2), sendet Signale direkt zum Rückenmark und kann daher für die Gliedmaßenmotorik als „Ausgangsstation“ im Großhirn angesehen werden. Ähnlich wie die Neurone im visuellen Bewegungsareal MT besitzen auch die Nervenzellen im Motorkortex eindeutige Vorzugsrichtungen, die sich hier auf die Bewegung der Hand beziehen: Ein einzelnes Neuron generiert Aktionspotenziale mit maximaler Rate, wenn z. B. eine Bewegung der Hand nach rechts erfolgen soll. Auch in diesem Hirnareal wird wegen der relativen Unschärfe, mit der einzelne Neurone bei einer Bewegung der Hand die Richtung kodieren, immer eine Vielzahl Vor jeder Handbewegung sind eine Vielzahl Zellen aktiv zahl von Neuronen aktiv. Es wird angenommen, dass die hohe Präzision, mit der zielgerichtete Bewegungen der Hand ausgeführt werden können, auf der simultanen Aktivität einer größeren Neuronenpopulation beruht. Jeder zielgerichteten Handbewegung geht nicht nur die Aktivität einiger weniger Zellen voraus, sondern wiederum ein wahres Feuerwerk der kortikalen Zellen, die die jeweilige Richtung bevorzugen. 28 Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Modelle der kortikalen Steuerung von Handbewegungen gehen auch von einer Populationskodierung aus, die der tatsächlichen Bewegung zeitlich vorausgeht. Hirnzellen haben Vorzugsrichtung Die Ähnlichkeit der Richtungskodierung im primären Motorkortex und im visuellen Bewegungsareal MT macht es besonders interessant, die Aktivität in beiden Arealen direkt zu vergleichen: Wir wählten dafür ein Verhaltensexperiment mit Rhesusaffen, bei dem beide Areale funktionell von Bedeutung sind. Diese Tiere sind aufgrund ihrer Neugier und ihres manuellen Geschicks in der Lage, auch relativ Abb. 4: Einfluss von Ziel- und Handbewegung auf die motorische und visuelle Populationsaktivität. Die visuellen Daten (B) hängen vor allem von der Bewegung des Ziels ab und werden nur wenig von der Handbewegung beeinflusst. Im Unterschied dazu zeigt der motorische Vektor (A) eine Abhängigkeit von der Bewegung der Hand und des Ziels (Krümmung der Ergebnisfläche entlang beider Achsen). 29 komplexe Aufgaben zu erlernen. Wir trainierten die Affen, eine „Computermaus“ mit der Hand zu bedienen und damit den Cursor auf dem Bildschirm zu einem bestimmten Zielpunkt zu bewegen. Eine weitere Aufgabe bestand darin, einen auf dem Bildschirm bewegten Zielpunkt möglichst genau mit dem Cursor zu verfolgen. Auf diese Weise führten die Tiere zeitlich und räumlich definierte Bewegungsmuster aus, die sich an einem bewegten Stimulus orientierten. Die in Area MT und im primären Motorkortex aufgezeichnete Aktivität vieler Neurone fassten wir dann zu einer gemeinsamen Antwort zusammen. Wir nutzten dabei aus, dass der Mehrzahl der Zellen beider Areale eine eindeutige Vorzugsrichtungen zugewiesen werden kann. Damit ist die Berechnung eines „Populationsvektors“ möglich, der die Aktivität vieler Neurone als ein gemeinsames Richtungssignal wiedergibt. Dieses gemittelte Richtungssignal ist in Abb. 3 in seinem Zeitverlauf dargestellt: Man erkennt, mit welcher Präzision in beiden Arealen die Bewegungsrichtung von Hand und Ziel kodiert wird, sofern die Aktivität von mehreren hundert Zellen gemeinsam interpretiert wird. Offensichtlich sind beide Gebiete der Hirnrinde während dieser Aufgabe gleichzeitig aktiv. Durch weitere Analyseschritte wird der Zeitversatz zwischen der Aktivität beider Gebiete erkennbar, genauer bestimmt und schließlich der Einfluss von Hand- und Reizbewegung auf die Aktivität in beiden Arealen vergleichbar. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die neuronale Aktivität im Motorkortex sowohl durch die Bewegung der Hand als auch durch die Bewegung des Ziels beeinflusst wird (Abb. 4). Dagegen bleibt Area MT unabhängig von der Handbewegung des Tieres und bestätigt damit seine Rolle als vornehmlich visuelles Areal. Es unterscheidet sich von anderen Arealen im Parietallappen, die als multimodale Integeationsareale angesehen werden und für die bereits ein Einfluss von Handbewegungen auf die sensorische Verarbeitung beschrieben wurde. Gerade bei der im Tierexperiment untersuchten Folgebewegung der Hand scheint die Aktivität in Area MT unabdingbar für die visuell gesteuerten Folgebewegungen zu sein. Wir haben diese Ergebnisse beim Menschen mit Hilfe der funktionellen Kernspintomografie überprüft, da wir auch hier eine gemeinsame Aktivierung von Area MT und primärem Motorkortex erwarten. Die Messungen im Kernspintomographen bieten den Vorteil, dass die Aktivitäts- Naturwissenschaften Neurobiologie NEUROrubin 2003 Abb. 5: Experiment im Kernspintomografen: Testpersonen steuerm während der Kernspinmessung mit einem modifizierten Joystick (A) einen „feedbackcursor“ auf einem Bildschirm (B) und verfolgen damit ein bewegtes Ziel. änderungen im gesamten Gehirn gleichzeitig bestimmt werden können. Das funktionelle Kernspinsignal weist indirekt – basierend auf Veränderungen im Sauerstoffgehalt des Blutes – auf die neuronale Aktivität bei der Verhaltensaufgabe hin. Mit einem für das starke Magnetfeld eines klinischen Kernspintomographen modifizierten Joystick (s. Abb. 5) konnten die Versuchspersonen einen Cursor steuern und damit ebenfalls einem bewegten Zielpunkt folgen. Zu- sätzlich mussten sie eine zuvor von ihnen ausgeführte Cursorbewegung passiv betrachten. Mit diesen „replay“-Bedingungen war es möglich, identische visuelle Eindrücke zu erzeugen, die sich allein darin unterscheiden, ob die Versuchsperson die Bewegung des Cursors aktiv steuert oder nur passiv betrachtet. Die Unterschiede im Kernspinsignal (Abb. 6) weisen auf die besondere Bedeutung von Area MT für die visuelle Information zur aktiven Steuerung von Handbewegungen hin. igkeit, während die Kernspinmessung am Menschen einen vorerst nur groben Blick auf das Ganze erlaubt. Wir rechnen aber damit, dass durch die Fusion beider Methoden unser Wissen über die Hirnfunktionen zunehmen wird und sich neurologische Störungen, wie sie nach Hirnverletzungen oder bei der Parkinson-Erkrankung vorliegen, zukünftig besser diagnostizieren und langfristig auch behandeln lassen werden. Motion processing during visually guided actions Abb. 6: Die funktionellen Kernspin-Aufnahmen zeigen die Gebiete erhöhter Aktivität bei der in Abb. 5 beschriebenen Verhaltensaufgabe. Der Frontalschnitt (links) zeigt deutliche Aktivität im primären Motorkortex (M1). Im weiter hinten gelegenen Frontalschnitt (rechts) ist eine Aktivitätszunahme im Parietalkortex (PK) und in Area MT sichtbar. Die Forschung in den Neurowissenschaften stößt zunehmend in Bereiche vor, die interdisziplinäre Ansätze erfordern, um aktuelle Fragen umfassend beantworten zu können. Dies zeigt auch die Übereinstimmung unserer Ergebnisse aus der tierexperimentellen Elektrophysiologie und den funktionellen Kernspinmessungen. Dabei liefert die Elektrophysiologie die höhere räumliche und zeitliche Genau- Processing of movement in our world is an essential capability of our visual system - and is fundamental for visually guided actions. In humans and non-human primates, cortical area MT is devoted to the processing of moving stimuli. To elucidate the interplay of visual area MT and motor cortex, we designed a behavioural task where stimuli on a computer screen had to be pursued by means of a manually controlled feedback cursor. Population analysis of the cell activity in the monkey as well as results from fMRI with human subjects underline the importance of area MT for the motion processing needed during visually guided action. abstract 30 Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 Neuronales Modell des Objektsehens: Schnelle Links für scharfe Bilder Chr. von der Malsburg Abb. 1 O Mit jedem Augenschlag und jeder Bewegung unseres Gegenübers verändert sich blitzschnell das Bild, das wir sehen. Auf einen Schirm an die Wand projiziert, würde uns dieses bewegte Netzhautbild nur schwindelig machen. Doch unser „inneres Auge“ scheint auf eine andere „Leinwand“ zu blicken. bjekte mit den Augen zu erfassen, ist uns so natürlich, dass uns kaum klar wird, wie komplex dieser Vorgang ist. Das Bild, das von einem Objekt auf unserem Augenhintergrund entworfen wird, variiert mit jeder Augenbewegung und jeder Lageveränderung (Abb 1). Und doch sehen wir ein stabiles Bild des betrachteten Objektes – aufgebaut aus aktueller visueller Information und dem Gedächtnis. Wie macht das unser Sehsystem? Wir haben ein Modell für diesen Vorgang entworfen und über viele Jahre verfeinert: “Dynamic Link Matching“ (DLM). Dieses Objekterkennungsmodell (Info, S. 33) ist von vorn- Prof. Dr. Christoph von der Malsburg, Institut für Neuroinformatik 31 herein darauf angelegt, in natürlichen, nicht manipulierten und vereinfachten Umgebungen zu funktionieren und kann inzwischen als sehr erfolgreich angesehen werden. Seine Stärken hat es vor allem bei der Gesichtserkennung unter Beweis gestellt und dort mehrfach die internationale Konkurrenz geschlagen. Seit einigen Jahren wird DLM industriell eingesetzt, insbesondere für die Gesichtserkennung in der ursprünglich als An-Institut der RuhrUniversität gegründeten Firma ZN. “Dynamic Link Matching“ ist als biologisches Modell konzipiert und orientiert sich soweit wie möglich an den Neurowissenschaften. Doch mitunter ergeben sich gerade dann neue, interessante Sichtweisen, wenn sich dieser Rahmen als zu eng erweist. Das Modell besteht aus einer „Bilddomäne“, einer “Modelldomäne“ und einem System von „dynamischen Links“. Die Bilddomäne entspricht der primären visuellen Hirnrinde im hinteren Bereich des Gehirns, in der sich das schnell variable Bild des Augenhintergrunds widerspiegelt. Die Modelldomäne befindet sich vermutlich im Schläfenlappen oder seitlichen Scheitellappen des Gehirns. Dort baut sich das hypothetische stabile Bild auf. Die dynamischen Links werden von einem System neuronaler Fasern gebildet, die auf schneller Zeitebene schalten. Wie wir aus der Neurophysiologie wissen, ist eine Hirnrindenzelle im Bildbereich durch die periphere Sehbahn mit einem kleinen Bereich (dem ,,rezeptiven Feld“) der Netzhaut ver- Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 bunden und empfängt von dort Signale. Sie ,,schaut“ so quasi wie durch ein größeres oder kleineres Schlüsselloch auf die Umwelt. Durch dieses – ihr spezielles – Guckloch hält jede Zelle nach einem bestimmten Merkmal Ausschau. Das tut sie, indem sie ein ent- pfindlichkeitsverteilungen der Zellen bekannt sind, lässt sich aus den Signalen eines solchen Merkmalspaketes ein kleiner Teil des Bildes rekonstruieren. Das gesamte Bild eines Objektes wird durch ein Feld von Merkmalspaketen in der Bilddomäne dargestellt. durch Augenbewegung zentrieren, so gibt es in der Modelldomäne ein ähnliches ,,Fenster“, in dem jeweils ein Objektfeld aktiviert werden kann (s. Info 2). Wenn ein Objektbild irgendwo im Bereich des schärfsten Sehens des Au- tuellen visuellen Daten der Bilddomäne und aus im Gedächtnis gespeicherten Daten der Modelldomäne das von uns wahrgenommene stabile Bild des betrachteten Objektes auf. Zwischen den Domänen und dem Fenster werden durch einen schnellen Organisationsprozess geordnete Punkt-zuPunkt-Verbindungen aufgebaut (dynamische Links, s. Doppelpfeile). Mit jeder Augenbewegung und jeder Aufmerksamkeitsverschiebung geschieht dies neu: durchgezogene und gestrichelte Linien stellen zwei verschiedene „Augenblicke“ dar. Die Links zwischen der Bilddomäne und dem Modellfenster handhaben alle Änderungen in Position, Orientierung und Größe des vom Auge entworfenen Bildes. Die Links zur Modelldomäne und innerhalb dieser regeln modellabhängige Veränderungen wie Objektform, Pose und Beleuchtung. Das Modell Die Bilddomäne besteht aus der primären visuellen Hirnrinde und der peripheren Sehbahn*, durch die ein Sinnesreiz aus der Umgebung in das Gehirn gelangt. Die Modelldomäne entspricht Bereichen des Schläfenoder Scheitellappens des Gehirns und enthält eine große Zahl von Objektmodellen. Zwischen beiden Domänen vermittelt das Modellfenster („inneres Auge“). Hier baut das System aus ak- * Im Bild symbolisiert die Linse die gesamte Sehbahn (Auge, optischer Nerv etc.). info sprechendes Empfindlichkeitsprofil mit dem aktuellen Bild vergleicht und dann je nach Ähnlichkeit stärker oder schwächer antwortet (Info 2). Alle Zellen, deren rezeptive Felder an derselben Stelle der Netzhaut zentriert sind, werden durch einen „dynamischen Bindungsmechanismus“ zu einem Paket zusammengefasst, so wie sich Atome zu Molekülen verbinden. Wenn die Em- Auch die Modelldomäne besteht aus Merkmalspaketen, die ein eigenes Feld für jedes gespeicherte Objekt bilden. Dabei können einzelne Pakete oder ganze Teilfelder auch für verschiedene Objekte wiederverwendet werden. So wie im Augenhintergrund das zentrale Gebiet eine herausragende Rolle spielt, indem wir dort das Bild des gerade interessierenden Objektes ges (Fovea) auftaucht, ist es die Aufgabe der dynamischen Links, in einem raschen Prozess – buchstäblich im Augenblick – ein glattes Feld von Punktzu-Punkt-Verbindungen zwischen der Bild- und der Modelldomäne aufzubauen. Dabei müssen korrespondierende Punkte in Bild und Modell miteinander verbunden werden (s. Info 2). Sobald eine solche Abbildung installiert ist, 32 Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 wird die augenblickliche Gesamtähnlichkeit zwischen allen Paaren von Merkmalspaketen in den verbundenen Bild- und Modellpunkten ausgewertet. Die Ähnlichkeit verbessert sich, indem die Abbildung kontinuierlich in Position, Größe und Orientierung angepasst wird. Gleichzeitig wird auch das im Modellfenster dargestellte Objektmodell auf Ähnlichkeit optimiert. In unserem Gehirn ist dieser Vorgang äußerst schnell, wir erkennen grobe Objektklassen wie „Auto“, „Haus“ oder „Gorilla“ in weniger als einer Zehntelsekunde. Wahrscheinlich wird in unserem Gehirn ein schnelles Index-System ver- wendet, das die Objektklassen kategorisiert und ein entsprechendes Bild in das Modellfenster projiziert. Dieses Bild wird dann auf größte Ähnlichkeit mit dem projizierten Bildbereich optimiert und kann allen Objektbewegungen kontinuierlich nachgeführt werden. Das aus aktuellen Bild- und gespeicherten Modelldaten konstruierte Bild im Modellfenster vermittelt uns den stabilen, von Augenbewegungen unbeeinflussten Eindruck von den Objekten. Unser „inneres Auge“ blickt auf das stabile Bild im Modellfenster. Im Rechner haben wir einen Prozess der Objekterkennung in dieser Art realisiert und hauptsächlich auf das Problem der Gesichtserkennung angewendet – mit großem Erfolg, soweit es 33 um den Vergleich von statischen Bildern im Bild- und Modellbereich geht (Abb. 2). Wir wollen nun die Fähigkeit des natürlichen Sehsystems nachbilden, visuelle Erfahrung direkt aus der natürlichen Umwelt aufzunehmen. Sobald das gelingt, wird unser System selbständig aus Bildern lernen und aus vielen Tausenden von Einzelbildern ein plastisches Modell des menschlichen Gesichts aufbauen. Es wird sich nach Gesichtsform, Pose, Ausdruck und Beleuchtung an beliebige Eingangsbilder anpassen und diese damit genau wiedergeben und erkennen können. Wir hoffen, dieses Ziel in ein oder zwei Jahren zu erreichen. Obwohl unser Modell der Objekterkennung weiter verbessert wird, ergibt sich daraus für die Neurowissenschaften schon heute eine Fülle von Konsequenzen und experimentellen Voraussagen. Der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist die im Rechner experimentell nachgewiesene Fähigkeit des Modells, ganz verschiedene Objekte zu erkennen. Nicht viele Konzepte lassen sich so experimentell bestätigen. Seit entsprechende Rechner-Kapazitäten zur Verfügung stehen, sind Rechnerexperimente eine scharfe Waffe gegen oberflächlich überzeugende, aber funktionell nicht „lebensfähige“ Ideen. Wenn wir das Modell für den biologischen Prozess der Objekterkennung ernst nehmen, dann ergeben sich dar- aus eine ganze Reihe von experimentellen Voraussagen. Dies betrifft zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad von Erkennungsaufgaben: Nach Experimenten, bei denen Testpersonen Gesichter auf Fotos wiedererkennen sollten, konnte unser amerikanischer Kollege Irv Biederman zeigen, dass das von uns entwickelte System diese menschliche Fähigkeit richtig wiedergibt. Ohne jede Anpassung des Modells an die experimentelle Situation kann es den Schwierigkeitsgrad bei der Erkennung von Gesichtern durch Menschen auch bei wechselnder Pose oder verändertem Gesichtsausdruck richtig wiedergeben. Dies ist noch mit keinem anderen Mo- Abb. 2: Vom Bild zur Bilddomäne: Jede Zelle der Sehrinde (Bilddomäne, links) gleicht den Bildauschnitt ihres rezeptiven Feldes mit ihrem Empfindlichkeitsprofil (Merkmalstyp) ab. In der folgenden Spalte sind zwei Merkmalstypen dargestellt. Sie unterscheiden sich nach Größe und Orientierung. Rechts davon schließen sich die Antworten ganzer Felder von Zellen des jeweils links gezeigten Typs an. Die dritte Spalte zeigt die Antworten sog. komplexer Zellen, die das Signal glätten. Ihre Aktivität stellt Bereiche im Bild dar, in denen jeweils eine Kantenorientierung auf einer bestimmten Auflösungsstufe vorherrscht. Die Bilddomäne ist quasi ein Stapel vieler solcher Felder eines Zelltyps. dell gelungen und stützt seine direkte biologische Relevanz. Nur wenn es um das Erkennen von vertrauten Gesichtern geht, bleibt das Modell in der gegenwärtigen Form deutlich hinter den menschlichen Fähigkeiten zurück, weil unser visuelles System vertraute Personen in allen Variationen von Gesichtsform- und Ausdruck, Pose oder Beleuchtung kennt. Wir hoffen, diese Defizite durch Lernen beseitigen zu können, indem auch das künstliche System viele Bilder Neuroinformatik Ingenieurwissenschaften NEUROrubin 2003 „sammelt“. Schließlich erreicht selbst der Mensch erst weit nach seinem zehnten Lebensjahr die Kompetenz eines Erwachsenen, Objekte zu erkennen. Objekte auch dann zu erkennen, wenn sich ein Bild ständig verändert, ist ein zentraler Vorgang in unserem Verhältnis zur Umwelt. Es ist ein Beispiel für die fundamentale Fähigkeit unseres Gehirns, die strukturelle Verwandtschaft zwischen mentalen Objekten zu erkennen: selbst bis hin zu Analogien zwischen zwei Geschichten. Dies alles ist nicht denkbar ohne einen dynamischen Bindungsmechanismus zur Konstruktion strukturierter Objekte (Modelldomäne) und ohne dynami- als zwei Jahrzehnten vorgeschlagen. Erst mit großer zeitlicher Verzögerung setzte eine weltweite Kontroverse ein. Inzwischen stützen experimentelle Daten aus einer Reihe von Labors die Existenz und funktionelle Bedeutung dieses Mechanismus. Dynamische Links lassen sich im Gehirn einfach realisieren, indem Synapsen durch Signalkorrelationen schnell und reversibel zwischen einem leitenden und einem nichtleitenden Zustand schalten (Abb. 3). Experimentell überprüft wurde das bis heute nicht, obgleich dies möglich wäre. Doch die Hinweise in der Literatur mehren sich, dass sich Hirnzustände vermutlich nicht allein Abb. 4.: Gesichtserkennung Für das Gesicht oben hat das System das Modell unten der Modelldomäne gefunden. Die Gitterpunkte (s. oben) sind mit den entsprechenden Gitterpunkten (s. unten) durch dynamische Links verbunden. sche Links zur Darstellung struktureller Beziehungen zwischen Bild und Modell. Das neuronale Standardmodell beschreibt dagegen ein starres Verbindungsmuster, hier können sich Neuronen nicht situationsabhängig gruppieren und verbinden. Unser Modell macht hier weitreichende experimentelle Voraussagen. Dass der grundsätzliche dynamische Bindungsmechanismus unseres Gehirns darin bestehen könnte, dass Neuronen Signale miteinander synchronisieren, haben wir bereits vor mehr über die Zellaktivität erfassen lassen: Zum Beispiel verändern Synapsen ihr Gewicht ständig und sehr schnell. Der enorme funktionelle Vorteil unseres Modells liegt in seiner Fähigkeit zur Innovation, zur Erzeugung von Bindungen und Links, wo immer sie die Situation erfordert. Der Nachteil ist ihr großer Zeitbedarf, da Signalkorrelationen in der Zeit erzeugt und ausgewertet werden müssen. Wir vermuten daher, dass das Gehirn Bindungen und Links, die einmal als wichtig erkannt wurden, durch geeignete Verschaltungen der Neuronen so realisiert, dass sie sehr viel schneller aktiviert werden können. Unabhängig von der Art der neuronalen Realisierung eröffnet die Hypothese dynamischer Bindungen und Links eine völlig neue, weitreichende Perspektive auf das Gehirn und seine Darstellung der Wirklichkeit. Abb. 3: Signalkorrelation durch schnell schaltende Synapsen: Die Signale dreier Zellen sind schematisch dargestellt, jeder senkrechte Strich entspricht einem Nervenimpuls. Die Zellen a und b sind zeitlich miteinander korreliert, d.h., sie feuern mit großer Wahrscheinlichkeit gleichzeitig – ein Ausdruck dafür, dass sie miteinander ,,verbunden“ sind. Nach der Hypothese schneller synaptischer Plastizität wird diese synaptische Verbindung in einigen tausendstel Sekunden verstärkt (Pluszeichen). Die Zellen b und c sind zeitlich nicht korreliert – ihre synaptische Verbindung ist momentan abgeschaltet (Minuszeichen). Nach der Hypothese werden auf diese Weise dynamische Links im Gehirn realisiert. A neuronal model of object vision Apparently effortlessly, our visual system creates stable perception from rapidly varying retinal images. We have developed a computer model for comparing those images with memorized ones, which is also commercially successful as a face recognition device. It is based on „Dynamic Link Matching“, a dynamical binding mechanism, which can assemble the activities of single neurons into structured groups using temporal synchronisation. Some physiological basis for such a mechanism has been demonstrated experimentally but the implications are still controversial. abstract 34 Neuroanatomie Medizin NEUROrubin 2003 „Aschenputtel“ unter den Zellkontakten: Elektrische Synapse Abb. 1 R. Dermietzel C. Meier G. Zoidl D as weitverbreitete Verständnis des Übertragungsmechanismus von elektrischen Impulsen in Nervenzellen schließt chemische Botenstoffe ein, die an bestimmten Kontakten (Synapsen) abgegeben werden. Diese sog. Neurotransmitter vermitteln das Signal an nachgeschaltete Nervenzellen weiter. Heute weiß man, dass zahlreiche solcher Botenstoffe existieren und für fundamentale Prozesse der Signalverarbeitung im Nervensystem verantwortlich sind. Eine ganze Reihe von Erkrankungen des zentralen Nervensystems beruhen auf dem Verlust eines bestimmten Botenstoffes, z. B. des Dopamins bei der Parkinson-Erkrankung. Die meisten Neuropharmaka wie Beruhigungsmittel und Antidepressiva greifen in den Stoffwechsel der Neurotransmitter ein, indem sie Veränderun- Prof. Dr. Rolf Dermietzel, Dr. Carola Meier, Dr. Georg Zoidl, Institut für Anatomie, Neuroanatomie und Molekulare Hirnforschung, Medizinische Fakultät 35 gen des Erregungszustandes in ganz bestimmten Hirnregionen dämpfen oder stimulieren. Die Möglichkeit in den Haushalt der Botenstoffe einzugreifen und über Störungen ihres Stoffwechsels neurologische und psychiatrische Erkrankungen erklären zu können, hat chemische Synapsen zu einem Schwerpunkt neurowissenschaftlicher Forschung werden lassen. Erst in jüngster Zeit wird deutlich, dass alternativ zu den chemischen Synapsen Membrankontakte im Nervensystem existieren, die keine Botenstoffe benutzen, und an denen elektrische Impulse direkt übertragen werden: Der grundlegende physikalische Vorgang der Signalvermittlung zwischen Neuronen – die Änderung der Spannung an der Nervenzellmembran und der daraus resultierende Stromfluss an den Synapsen – kommt hier ohne die Helfershelfer Neurotransmitter aus (s. Abb. 1 u. 2). Erst in den letzten Jahren hat sich die elektrische Synapse als ebenbürtiger Partner der chemischen Synapse erwiesen. Sie ist für bestimmte elementare Verarbeitungsmechanismen im zentralen Nervensystem sogar von erheblicher Bedeutung. Ein wesentlicher Vorteil elektrischer Synapsen, auch Gap Junctions genannt, ist die hohe Geschwindigkeit ihrer direkten Erregungsübertragungen. Viel zu lange unterschätzt rücken sie jetzt in den Blickpunkt der Forscher: Elektrische Synapsen leiten Signale blitzschnell durch die Nervenbahn und spielen damit eine wichtige Rolle bei einigen natürlichen und krankhaften Prozessen im Gehirn. Abb. 2: Elektrische Synapsen (grüne Plaques) in den Zellwänden verbinden Zellen miteinander. Die vereinfachte Darstellung berücksichtigt Strukturen des Zellkerns und des Zytoskeletts. Abb 1 (oben): Ansammlung von Einzelkanälen (grün) in einem sog. Gap JunctionPlaque. Medizin Neuroanatomie NEUROrubin 2003 Dagegen führen bei der chemischen Synapse (s. Abb. 3) Signalabgabe, Diffusion durch den Spalt, der die beiden Nervenzellen trennt, sowie die Reaktionen an der Membran der nachfolgenden Nervenzelle, die den Impuls weiterleitet, zu einer Verzögerung von bis zu 0,5 Millisekunden. Das entspricht der Dauer eines Wimpernschlages und ist für die Dimensionen der Physik und Physiologie eine erhebliche Zeitspanne. Elektrische Synapsen, die den Strom direkt von Zelle zu Zelle weiterleiten, wurden zuerst bei Nervenzellen von Fischen gefunden, wo sie z.B. Fluchtreflexe vermitteln. Sie setzen außerordentlich schnelle Verhaltensmuster in Gang, die für das Überleben Zahl Strukturen, die den elektrischen Synapsen entsprechen. Sie verbinden das Gliagewebe wie ein Netzwerk zu einem funktionellen Synzytium (Abb. 4). Herzmuskelzellen sind ebenfalls durch solche Kontakte miteinander gekoppelt. Sie leiten elektrische Impulse weiter, die zur Kontraktion der Muskulatur führen. Eine Blockade dieser Strukturen würde sofort zum Herzstillstand führen. Elektrische Synapsen Abb. 3: Die chemischen Synapse: Die in der Präsynapse ausgeschütteten Neurotransmitter (blau) werden in den synaptischen Spalt abgegeben und auf der postsynaptischen Seite (grün) aufgenommen. wichtig sind. Der Aufbau der elektrischen Synapsen unterscheidet sich erheblich von dem der chemischen Synapsen. Die elektrische Synapse besteht aus kleinen durch Eiweißmoleküle gebildeten Kanälen (s. Abb. 1 u. 2). Diese Kanäle verbinden die beiden aneinander grenzenden Zellen, indem sie die Zellmembranen durchdringen und den Zwischenzellraum überbrücken. Damit wird ein direkter Stromfluss zwischen Nervenzellen möglich. Auch zwischen den Stützzellen (Gliazellen) befinden sich in großer bzw. Gap Junctions lassen sich nachweisen und exakt lokalisieren, seitdem man die Eiweiße, aus denen die Kanäle aufgebaut sind, identifizieren und dagegen Antikörper produzieren konnte (s. Abb. 5). Wir sind mehr als zwanzig Jahre auch der Frage nachgegangen, wie groß die Zahl elektrischer Synapsen im Gehirn von Wirbeltieren ist, und an welchen Stellen sie anzutreffen sind. Erstaunlicherweise sind sie im Gehirn von Nagern, die man als Labortiere nutzt, viel häufiger vorhanden, als ur- Abb. 4: Kultur von Gliazellen. Die zahlreichen Gap Junctions zwischen den Zellen sind rot gefärbt. Die Kerne sind mit einem Kernfarbstoff blau dargestellt. sprünglich vermutet. Sie treten an Neuronen zwar nicht so zahlreich auf wie die chemischen Synapsen, sind dafür aber in bestimmten Nervenzellansammlungen mit spezifischen Funktionen konzentriert. Man trifft sie hauptsächlich dort an, wo eine schnelle Erregungsleitung benötigt wird, weil die Aktivität von Nervenzellgruppen synchronisiert werden soll. So gibt es in der Hirnrinde ein System von Nervenzellen, das seine Aktivität offenbar über elektrische Synapsen synchronisieren kann, und das diesen Rhythmus an übergeordnete neuronale Netzwerke weiterleitet. Seit langem ist bekannt, dass sich von der Hirnrinde rhythmische Aktivitäten ableiten lassen, die man als Oszillationen bezeichnet. Für die Entstehung dieser in ihrer Frequenz zum Teil variierenden Oszillationen werden unterschiedliche Mechanismen verantwortlich gemacht. Neueste Untersuchungen zeigen jedoch, dass offenbar für das Entstehen von Oszillationen in der Hirnrinde elektrische Synapsen mitverantwortlich sind. Sie synchronisieren jene Nervenzellen miteinander, die einen hemmenden Einfluss auf übergeordnete Neuronen ausüben. In diesen übergeordneten aus sog. Pyramidenzellen bestehenden 36 Neuroanatomie Medizin NEUROrubin 2003 Netzwerken vermutet man die Speicherorte für Erinnerungen sowie Regionen, in denen Wahrnehmungen verarbeitet und motorische Funktionen initiiert werden. Die hemmenden Nervenzellen können offenbar eintreffende Erregungen filtern, sie aufgrund ihrer Kopplung durch elektrische Synapsen in schnelle rhythmische Entladungen umwandeln und diese Rhythmen über größere Distanzen an die übergeordneten Neurone weiterleiten. Dies ist vergleichbar einem Harmonium, das über die rhythmische Bedienung von Blasebälgen unterschiedliche Abb. 5: Gliazellen mit einer grün gefärbten elektrischen Synapse (Gap Junction). Zu erkennen sind außerdem Zellkerne (blau) und Strukturen des Zellskeletts (rot) der Gliazellen. (Immunfluoreszenz nach Markierung mit einem spezifischen Antikörper) Pfeifen ansteuert, die in ihrem Zusammenspiel einen Akkord und aus der Reihung von Akkorden Musik entstehen lassen. Die rhythmische Zufuhr von Luft ermöglicht es, über die gesamte Tastatur die spezifischen Pfeifen- Komplexer Sinneseindruck formt sich wie eine Melodie töne zu bedienen. Wenn man das Bild des Harmoniums auf das Gehirn überträgt, so können über die schnelle Ausbreitung von rhythmischen Erregungen durch elektrische Synapsen fast gleichzeitig über die gesamte Tastatur des Gehirns Regionen mit unterschiedlichen Funktionen (Akkorden) angesteuert werden. Daraus formt sich dann wie eine Melodie oder ein ganzes sympho- 37 Elektrische Synapsen: Gezielt blockieren – Hirnschäden begrenzen Elektrische Synapsen (Gap Junctions) treten im zentralen Nervensystem zwischen Nervenzellen und zwischen den ihnen funktionell zugeordneten Gliazellen auf und bilden jeweils ein funktionelles Netzwerk. Sie können elektrische Impulse zwischen Nervenzellen sehr schnell ohne Botenstoffe weiterleiten. Ihre Struktur ist auf den ersten Blick sehr einfach: Zwei Halbkanäle, die aus sechs Proteinen, den Connexinen, aufgebaut sind, paaren sich spiegelbildlich miteinander und verbinden so zwei aneinander grenzende Zellen. Durch diese Kanäle tauschen die Zellen Ionen und Stoffwechselprodukte aus. Doch die simple molekulare Architektur entpuppt sich als ein raffiniertes System von Membrankanälen, das den chemischen Synapsen in seiner Leistung nicht nachsteht. Wir konnten zeigen, dass die im Hirngewebe auftretenden elektrischen Synapsen aus unterschiedlichen Proteinen einer Proteinklasse (Isoformen) der Connexine bestehen (s. Abb. 7). Daraus ergeben sich für einzelne Nervenzellgruppen sowie Gliazellen ganz bestimmte Muster ihrer Kanalproteine. Den Gap Junction-Kanälen lassen sich je nach Connexintyp verschiedene Funktionen zuordnen: Die Kanäle sind selektiv bezüglich der Ladung und der Größe der sie passierenden Substanzen. Auch der pH-Wert im Gewebe und das elektrische Potential über den Zellmembranen wirken sich unterschiedlich auf die Kinetik des Öffnens und Schließens der Kanäle aus. Von über 20 Gap Junction-Proteinen haben wir allein zehn im zentralen Nervensystem gefunden. Diese molekulare Variabilität deutet darauf hin, dass Gap Junctions viele verschiedene Funktionen erfüllen. Kanal blockiert: Ein die elektrische Synapse hemmendes Peptid schützt bei Schlaganfall. Grün markiert (links) sind sterbende Neurone in einer spezifischen Hirnregion von Mäusen 45 min nach dem Sauerstoffmangel. Das Peptid schützt die Nervenzellen (rechts): Nur noch wenige Zellen sind grün markiert. Vor fast fünfzehn Jahren haben wir beobachtet, dass unterschiedliche Kanalproteine während der Gehirnentwicklung auftreten und schon damals deren Einfluss auf Differenzierungsprozesse vermutet. Mit modernen Genanalyseverfahren (DNA-Microarray Technologie) konnten wir dies nun bestätigen. Gap Junctions scheinen auch krankhafte Prozesse im zentralen Nervensystem massiv zu beeinflussen. Dies gilt nicht nur für Änderungen der neuronalen Erregbarkeit wie die Epilepsie, sondern auch für durch entzündliche Prozesse oder Hirninfarkt zerstörtes Nervengewebe. Elektrische Synapsen beeinflussen hier offenbar massiv das Ausmaß der Schädigung in glialen Zellen. Wir versuchen nun, Gap Junctions im Nervensystem spezifisch zu blockieren, um durch ein zeitweises Ausschalten dieser Kontakte die Infarktgröße bei Schlaganfall zu reduzieren. In jüngsten Untersuchungen ist es uns gelungen, mit bestimmten blockierenden Substanzen Nervengewebe zu schützen (s. Abb. im Info) und den neuronalen Zelltod nach einem Infarkt einzuschränken. info Medizin Neuroanatomie NEUROrubin 2003 tischer Anfälle oder bei der Größenausdehnung eines Schlaganfalles beteiligt sind. Da epileptische Anfälle immer durch ein hohes Maß an synchroner Aktivität von Nervenzellen gekennzeichnet sind, deren Entladungen sich über weite Hirnareale ausbreiten, ist es naheliegend, dass die schnell leitenden elektrischen Synapsen hierbei eine Rolle spielen. Wir entwickeln und prüfen zur Zeit Substanzen, die eine Weiterleitung von elektrischen Impulsen an diesen Synapsen hemmen. Derartige Substanzen könnten einen neuen Ansatz bei der Behandlung von Epilepsien bieten. Neuer Therapieansatz für Epilepsie Abb. 6: Nach den Bausteinen der elektrischen Synapsen, den Connexinen, suchen: Mit Hilfe der Lasermikrodissektion werden dünne Gewebeschnitte aus dem Hippocampus ausgeschnitten. Abb. 7: Lokalisierung eines Connexins (grün) im Hippokampus der Ratte. Zur Orientierung wurde eine Pyramidenzelle rot angefärbt. (Immunzytochemische Darstellung). nisches Werk ein komplexer Sinneseindruck. Über solche Mechanismen erklären sich komplizierte Wahrnehmungsbilder, die unser Gehirn aus vielen gleichzeitig eintreffenden Detailinformationen zu einem Bild von der Welt verschmilzt. Elektrische Synapsen scheinen bei diesem Vorgang der sog. Koinzidenz-Detektion (Gleichzeitigkeit der Registrierung) eine wichtige Rolle zu spielen. Das Auftreten von synchronen über elektrische Synapsen vermittelten Aktivitäten im Gehirn kann aber auch Krankheitsursachen haben. So wird zum Beispiel heftig diskutiert, ob elektrische Synapsen am Entstehen epilep- Auch bei der Entstehung von größeren Hirndefekten nach einem Schlaganfall scheinen elektrische Synapsen eine wichtige Rolle zu spielen (s. Info, S. 38). Vermutlich sorgen die Gap Junctions zwischen den Gliazellen dafür, dass das innere Milieu des Gehirns Elektrical synapses: the neglected cell-structures The role of electrical synapses (Gap Junction) in the central nervous system has been neglected for several decades since their first description in the middle of the 20 th century. Composed of the extended family of Gap Junction forming proteins (connexins), they show a remarkable speed of signal transmission, a high molecular diversity and various ways of regulation. Most recent findings suggest a prominent role of electrical synapses in essential functions of the intact and diseased brain. Uncovering these functions may guide to new therapeutic approaches in the treatment of the diseased brain, for example epilepsy. 38 Neuroanatomie Medizin NEUROrubin 2003 konstant gehalten wird. Offenbar werden gelöste Substanzen über die Kontakte zwischen den Gliazellen innerhalb des glialen Netzwerkes verteilt. Bei massivem Stress, wie durch einen Schlaganfall ausgelöst, können sich schädliche Stoffwechselprodukte in den Zellen anhäufen. Werden diese Substanzen dann aber über die Gap Junctions weitergeleitet, können sie auch primär nicht vom Infarkt betroffene Zellgruppen schädigen. Der Vorgang wird als “Bystander-Effekt” (engl.: Beistand) bezeichnet. Im Falle des Hirninfarktes vermittelt dieser „Beistand“ jedoch Zelltod induzierende Faktoren, die letztlich das Infarktareal vergrößern. Auch hier wäre es von Vorteil, die funktionelle Kopplung der glialen Zellen über Gap Junctions zu verringern (s. Info). Welche Sub- 39 stanzen freigesetzt werden und wie diese bei einem solchen „negativen Beistand“ weiter geleitet werden, ist bislang noch nicht aufgeklärt. Ihre Auswirkungen können aber beim Hirninfarkt wie auch bei mechanischen Hirnverletzungen dramatisch sein. Blickt man auf die Entwicklung dieses Forschungszweiges der modernen Neurowissenschaften zurück, so stellt man fest, die elektrische Synapse ist im Bewusstsein der Hirnforscher endlich aus dem Schatten der chemischen Synapse hervorgetreten. Sie wird nicht nur unser Verständnis von der Funktionsweise des Gehirns bereichern, sondern hält auch neue Therapieansätze für eine Reihe von Erkrankungen des Nervensystems bereit. Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Räume der Begegnung: Wo Nervenbahnen entstehen, wachsen und sich verändern A. Faissner Wie der Schlussstein eines Gewölbes bildet ein sechsarmiges Molekül den Dreh- und Angelpunkt im extrazellulären Raum zwischen den Nervenzellen. Mit „stop- and goSignalen“ beschleunigt es das Wachstum, baut Barrieren oder steuert Wanderungsprozesse. Ließe sich der molekulare Alleskönner medizinisch nutzen, dann könnten durchtrennte Nervenzellen wieder wachsen oder Stammzellen gezielt entwickelt werden. D as Nervensystem der Säuger be steht aus einer unvorstellbar großen Zahl von Nervenzellen (Neuronen), die über vielfältige Verbindungen miteinander verknüpft und in eine strukturierte Umgebung von Stützzellen (Gliazellen) eingebettet sind. Beim Menschen rechnet man mit 10 12-13 Neuronen, 10 15-16 Synapsen (Verschaltungen) und 10 13-14 Gliazellen. Damit überstei- Prof. Dr. Andreas Faissner, Zellmorphologie und molekulare Neurobiologie, Fakultät für Biologie gen die Zellen des Nervensystems die auf 30 000 bis 40 000 geschätzte Zahl humaner Gene um das zehn Milliardenfache. Wie wird ein solches System höchster Komplexität durch eine vergleichsweise beschränkte Zahl von Genen gesteuert, so dass es entstehen, sich selbst organisieren, stabilisieren und sich während der Lebenszeit eines Organismus verändern kann? Diese Frage auf der Ebene der Einzelzelle und der neuronalen Netze zu klären, ist heute das zentrale Thema der Entwicklungsneurobiologie. Ausgangspunkt für die Entstehung des Nervensystems ist eine Vielzahl undifferenzierter neuraler Vorläuferzellen, die sich in genau festgelegten Entwicklungsphasen bilden und zu neuroanatomischen Subsystemen ordnen. Zwei Grundprinzipien ermöglichen diese bemerkenswerte Leistung, die heute zahlreiche wissenschaftliche Projekte weltweit durchdringen und miteinander verzahnen: Integration durch Interaktion. Die Wechselwirkungen gehen von Signalen während der frühen Embryonalentwicklung aus, die die Vorläuferzellen für bestimmte Entwick- 39 Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 2: Die sternförmigen Astrozyten sind im Gewebeschnitt angefärbt. lungsbahnen programmieren. Wenn Nerven- und Stützzellen ihre Plätze eingenommen und ihre jeweiligen Merkmale ausgebildet haben, steuern spezielle Moleküle das weitere Geschehen: Sie ermöglichen erst, dass sich Nervenzellen erkennen oder in der jeweiligen Umgebung zurecht finden können. Besonders kritisch sind diese Moleküle bei der Ausbildung von Nervenzellververbindungen - den sog. Axonen (Abb. 3). Darin unterscheidet sich das Nervensystem von jedem anderen Gewebe des Körpers. Nervenzellen werden in dichter Packung von Gliazellen umgeben. Diese sternförmigen Gebilde, sog. Astrocyten (s. Abb. 2), übertreffen die Zahl der Neuronen um das zehnfache und übernehmen wichtige Funktionen im Zentralnervensystem. Sie kontrollieren z.B. die extrazelluläre Konzentration von Salzen oder den gerichteten Transport von Stoffen aus den Blutgefäßen des Nervensystems zur Nervenzelle. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des Zentralnervensystems (ZNS): So bilden sie Leitschienen, auf denen Nervenzellen wie kleine Züge in ihre Zielgebiete ziehen. Sie lenken die beweglichen, aktiv wandernden Wachstumskegel der Axone (s. Abb. 4) an den vorgesehenen Platz, indem sie das Richtungswachstum unterstützen oder vorübergehend durch Gewebebarrieren blockieren (Abb. 5). Vermutlich tragen Astrocyten auf diese Weise dazu bei, dass sich Muster und Strukturen im ZNS stabilisieren. Wie aber regulieren die Astrocyten diese Entwicklung des Nervensystems? Sie bilden sog. astrogliale Makromoleküle, die das Verhalten der axonalen Wachstumskegel beeinflussen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass ganze Familien dieser Makromoleküle in den Raum zwischen den Zellen (extrazellulärer Raum) abgegeben werden, der während der Phase der Gewebsorganisation noch bis zu 30 Prozent des ge- Abb. 3: Typische Nervenzelle des Zentralnervensystems von Säugern. Die Zelle ist polarisiert: Die Dendriten (oben) nehmen Informationen auf, die zunächst über das Axon und dann an den Synapsen zur nächsten Zelle weitergeleitet werden. Abb. 4: Der Wachstumskegel: Im der videomikroskopischen Zeitraffer-Aufnahme wächst das Axon an der Spitze des Wachstumskegels mit ca. 50 µm pro Stunde. Der Wachstumskegel erkundet die Umgebung und trifft Richtungsentscheidungen. 40 samten Volumens des Zentralnervensystems ausmacht. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie dieser Raum strukturiert wird. Für andere Gewebe außerhalb des Nervensystems konnte nachgewiesen werden, dass spezialisierte makromolekulare Systeme darin eine Schlüsselrolle einnehmen. Die in den Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 extrazellulären Räumen des Nervensystems vorhandenen Makromoleküle lassen ebenfalls eine solche Bedeutung vermuten. Zunächst haben wir herausgefunden, dass einzelne Makromoleküle, wie z. B. das Tenascin-C (lat. tenere: halten, nascere: geboren werden), das Der therapeutische Ansatz: Mobile Organelle im Visier Das Axon besitzt an seinem wachsenden Ende eine mobile Organelle, den Wachstumskegel, der aktiv die Gewebeumgebung durchstreift, Steuerungssignale abliest und umsetzt (s. Abb. 4). Dazu bedient sich der Wachstumskegel spezialisierter Rezeptoren, die komplementäre Signale erkennen. Das können lokale, z.B. an Zelloberflächen oder den Zellumgebungsraum gebundene oder über Entfernungen wirkende Signale sein. Ihre Wirkung betreffend unterscheidet man anziehende, wachstumsfördernde von hemmenden Signalen. Hemmende Signale bewirken den Kollaps des Wachstumskegels, ein spektakuläres Phänomen, das sich auch in der Kulturschale nachvollziehen lässt. Sowohl für die Stoffkategorien als auch für die Wirkungsmechanismen sind mehrere Genfamilien gefunden worden, die bis zu 50 verschiedene Gene mit ähnlichen Wirkungen umfassen. Diese schließen mehrere Familien sog. Zelladhäsionsmoleküle ein sowie spezielle Signalmoleküle, die Semaphorine. Die Umsetzung der Signale in gerichtetes Wachstum erfolgt im Wachstumskegel, die entsprechenden Signalverarbeitungswege werden derzeit weltweit erforscht. Ein Fernziel besteht darin, die Signalprozesse zu definieren und pharmakologisch so zu beeinflussen, dass der Wachst u m s kegel in Regenerationssituationen Hindernisse überwinden kann. info Wachstumsverhalten der Axone beeinflussen. Dabei scheint Tenascin-C sehr ambivalente Funktionen zu vermitteln, denn in bestimmten Situationen fungiert es als Barriere oder Grenzmolekül im Nervengewebe, in anderen beschleunigt es als homogenes Wachstumssubstrat das Wachstumsverhalten von Axonen erheblich. Schließlich aktiviert Tenascin-C auch die Zellbindung und steuert Wanderungsprozesse. Bei multifunktionalen Molekülen sind häufig strukturelle Einheiten (Kassetten) des Moleküls für einzelne Funktionen verantwortlich. Es gelang uns tatsächlich, diesen verschiedenen Kassetten oder Modulen des TenascinC hemmende („stop!“) und stimulierende („go!“) Signale für das Wachstum der Axone zuzuschreiben (s. Abb.6 a, b). Diese Beobachtungen legen nahe, dass Nervenzellen über spezialisierte Rezeptoren auf die unterschiedlichen Bereiche des Makromoleküls reagieren. Unsere Hypothese bestätigte sich: Das „go“-Signal für axonales Wachstum wird durch das Neuron mit Hilfe eines spezialisierten Adhäsionsproteins (Contactin) vom Tenascin-C abgelesen und umgesetzt. Hierbei dient Contactin als eine Art Fühler, der die Wachstumsgeschwindigkeit des Wachstumskegels über interne Signalumsteuerungsprozesse reguliert (Schema, Abb. 7). Wir werden nun die Sequenz der Aminosäuren, d.h. die Bausteine der Eiweiße bestimmen, aufgrund derer sich die beteiligten Proteine von Tenascin-C und Nervenzelle erkennen. Damit wird es auch möglich werden, die Sequenz für das „go!“-Signal zu isolieren und in gereinigter und konzentrierter Form in künstliche Transportvehikel einzubauen. Ziel ist es, diese das Wachstum stimulierenden Bereiche gezielt in die Nähe verletzter Nerven zu bringen, um dort im Wachstumskegel den Regenerationsprozess in Gang zu setzen. Dieser Weg ist schon deshalb sinnvoll, weil das „go!“Signal in einem Abschnitt (Kassette) des Tenascin-C lokalisiert wurde, der nicht in allen seinen molekularen Varianten vorkommt. Abb. 5: „Grenzen“ im Gewebe: Die Aufsicht auf den somatosensorischen Kortex zeigt, dass Tenascin-C in diskreten, „grenzartigen“ Verläufen auftreten kann. Diese sog. „Boundaries“ sind transient, im erwachsenen ZNS wird Tenascin-C nur in Spuren freigesetzt. Die umgrenzten Felder haben einen Durchmesser von 0,2-0,3 mm . Abb. 6: „Go“-Signale für das Axon Eine embryonale Nervenzelle bildet auf einem Tenascin-C-Substrat innerhalb von 24 Stunden ein beachtliches Axon (oben: „go-Signal“). Auf dem neutralen Kontrollsubstrat ist das Wachstum vergleichsweise bescheiden (unten). 41 Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 handen. Bei Verletzungen oder krankhaften Prozessen tritt es dann plötzlich wieder auf, z.B. in Hirntumoren. Auch das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Tenascin-C in Regenerationsprozesse des Nervensystems einbezogen ist. Interessante Perspektiven für die Prognose oder Diagnostik eröffnen sich, wenn es gelänge, das Auftreten bestimmter Varianten des Makromoleküls im Blut bestimmten Erkrankungen zuzuordnen. Bis heute gelten durchtrennte Nervenverbindungen als nicht wieder herstellbar, wie z.B. im Falle von Querschnittlähmungen. Wenngleich Nervenzellen das Potenzial besitzen, unterbrochene Verbindungen wieder aufzubauen, verhindern dies Barrieren, die sich den Wachstumskegeln in den Weg stellen (Abb. 10). Solche Hindernisse für die Regeneration bilden Astrozyten, die in der Umgebung von Wunden die sog. astrogliale Narbe aufbauen. Tenascin-C kommt in diesen Narben in hoher Konzentration vor und scheint die Bildung von Barrieren zu unterstützen, wie Experimente an Mikroläsionen nahe legen (Abb. 11). Hier könnte die integrative Funktion des Tenascin-C bei der Organisation übergeordneter Matrixstrukturen dazu Abb. 7: Fühler für Tenascin-C: Das Tenascin-C-Hexamer reagiert mit zellulären Rezeptoren. Diese steuern durch Signalübertragung das Verhalten des Wachstumskegels. schaften unterschiedlicher Gebiete des Strukturkassetten, die für die StiNervensystems durch bestimmte Varimulation des Wachstums entscheidend anten des Makromoleküls festgelegt sind, unterliegen einem speziellen werden. Auch das Wachstum der Axone Verarbeitungsprozess – dem sog. alterkönnte bevorzugt durch einzelne Varinativen Spleißen. Dabei werden quasi anten gesteuert werden, wie wir für aus der Blaupause für das Eiweiß beTenascin-C in der Kulturschale belegen stimmte Stücke herausgeschnitten bzw. konnten. ausgetauscht, bevor der Bauplan durch Tenascin-C besteht aus sechs Undie Boten-RNA im Zellplasma in Eitereinheiten, die sich zu einer sechsweiße umgesetzt wird. Auf diese Weise armigen Gestalt verbinden (Abb. 9). wird immer gerade die Serie funktioDamit könnte Tenascin-C ein Integraneller Kassetten des Tenascin-C bereit tor des extrazellulären Raumes sein, gestellt, die zum jeweiligen Zeitpunkt der mit Bestandteilen in diesem Raum benötigt wird. Wenn jede dieser Kassowie mit Rezeptoren auf den Zellsetten frei austauschbar wäre, ergäbe oberflächen in Verbindung steht. Das sich eine Gesamtzahl möglicher KomMolekül bildet dann wie der Schlussbinationen von 2 n (n: Zahl alternativ stein eines Gewölbes den Dreh- und gespleißter Kassetten). Im Tenascin-C Angelpunkt der Matrixarchitektur. Es der Maus finden wir sechs Kassetten, wird während der Entwicklung verfür den Menschen wurden neun bemehrt gebildet, dagegen ist es später schrieben. Damit sind bei der Maus im Gewebe so gut wie nicht mehr vortheoretisch 64 Kombinationen möglich und 512 beim Menschen. Im Nervensystem der Maus haben wir mehr als dreißig Varianten des Tenascin-C zu bestimmten Abb. 8: Zeitpunkten der Entwicklung Kombinatorik der Kassetnachgewiesen (s. Abb. 8). ten: Tenascin-C besteht aus Die Kombinationen kommen Strukturmodulen. Die gelb mit unterschiedlicher Häuhervorgehobenen Kassetten figkeit vor, was dafür können in verschiedenen spricht, dass ihr Entstehen Kombinationen auftreten, gezielt reguliert wird. sodass eine Vielfalt von VaDiese Variabilität des rianten ausgehend von eiTenascin-C eröffnet interesnem Gen gebildet sante Perspektiven. So ist werden kann. vorstellbar, dass die Eigen- 42 Neurobiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 9: Molekulare Tentakel: Tenascin-C-Monomere lagern sich zu Hexameren mit der typischen, sechsarmigen Gestalt zusammen, die mit dem Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden können. (Durchmesser: etwa 140 nm). beitragen, eine undurchdringliche extrazelluläre Struktur aufzubauen, die intaktes Gewebe gegen Wundregionen abgrenzt. Eine sinnvolle Funktion verkehrt sich in ein Regenerationshindernis. Wenn wir die Bauprinzipien der Barrieren entschlüsseln, könnte das zu Strategien führen, mit denen sich die Matrixarchitektur destabilisieren lässt. Eine Regeneration könnte dann möglich sein. Dabei ist entscheidend, ob wir Varianten des Tenascin-C finden, die Kassetten mit speziellen „stop“-Signalen für das Axonwachstum aufweisen. Schließlich zeichnet sich ausgehend von Tenascin-C in jüngster Zeit eine aufregende Perspektive ab. Das Makromolekül tritt verstärkt in jenen Regionen des Nervensystems auf, in denen sich Zellen aktiv vermehren. Dort findet man während der Entwicklung neurale Stammzellen, die auch in bestimmten Gebieten des ausgewachsenen Nervensystems gebildet werden. Diese sog. subventrikuläre Zone ist ebenfalls mit Tenascin-C angereichert. Wir haben daraufhin ein Projekt in Angriff genommen, das die Rolle der extrazellulären Matrix für die Stammzellentwicklung und -Differenzierung klären soll. Es stellt sich die Frage, ob Tenascin-C als Integrator dieser Matrix-Architekturen vielleicht auch ein geeignetes Milieu gestalten kann, indem sich bevorzugt Stammzellen bilden und reifen. Dabei ist von besonderem Interesse, welche Signale das Makromolekül an die Stammzellen weitergibt und wie diese im Zuge ihrer Differenzierung umgesetzt werden. So scheint Tenascin-C die Stammzellpopulation, ihre Vermehrung und ihre Sensitivität für bestimmte Wachstumsfaktoren zu regulieren. Ob diese Mechanismen in erster Linie das Wachstum oder den natürlichen Zelltod der Stammzellen betreffen, ist Gegenstand weiterer Forschungen. Doch es ist bereits erkennbar, dass Tenascin-C die Entwicklung von Vorläuferzellen für die Myelinbildung zwar fördert – deren Einwanderung in bestimmte Territorien aber verhindern kann. Das Myelin bildet die Umhüllung der Nervenfasern, die sog. Myelinscheide, die z.B. bei der Multiplen Sklerose zerstört ist. Auch hier zeigt sich wieder die Ambivalenz dieses Makromoleküls, die bei einem therapeutischen Einsatz ein sehr gezieltes Vorgehen voraussetzen würde. Der neurale Extrazellulärraum kann damit nicht mehr als ein gestaltloser, mit Flüssigkeiten und Salzen angefüllter Hohlraum gelten, sondern ist ein Abb. 11: „Stop“-Signale für Axone: Explantate des Spinalganglions bilden auf „günstiger“ Extrazellulärmatrix ein reichhaltiges Geflecht von Axonen (oben). Die Zugabe eines Inhibitors unterdrückt das Wachstum der Axone nahezu vollständig (unten). Die Arbeitsgruppe charakterisiert Inhibitoren, die vermutlich die Regeneration des ZNS nach Läsion verhindern. The role of TN-C for development and regeneration of the nervous system Abb. 10: Bringt man Tenascin-C in Streifen von 50 µm Breite auf ein Kultursubstrat auf (rot gefärbt) und gibt Kleinhirnexplantate (gelbe Färbung) dazu, dann bevorzugen die Axone das Alternativsubstrat - es bilden sich „Grenzen“. durch spezialisierte Moleküle hochstrukturiertes Mikromilieu. Dieses Milieu könnte entscheidende Prozesse bei der Bildung, Umbildung und der Regeneration des Nervensystems beherbergen. Unser Ziel ist es, die unsichtbaren und höchst dynamischen Strukturen molekular aufzuklären und abzubilden. Glycoproteins and proteoglycans of the extracellular matrix mediate astrocyte functions during central nervous system formation. Tenascin-C glycoproteins (TN-C) are transiently expressed by astroglia during CNS development and occur in a large number of isoforms due to combinatorial rearrangement of fibronectin-type-III domains. Distinct modules of TN-C contain binding sites for various receptors and are involved in neuron binding, neuron migration and neurite outgrowth and guidance. The roles of TN-C for development, regeneration and the biology of neural stem cells are being discussed. abstract 43 Medizin Huntington-Zentrum NRW NEUROrubin 2003 Diagnose Veitstanz – was kann da noch helfen? J. Andrich J. T. Epplen Meist haben Risikopersonen die Symptome schon vor Augen, sind doch Eltern, Großeltern oder Geschwister bereits erkrankt. Doch erst ein DNA-Test sichert die Diagnose, deckt den Familienstammbaum auf und ist der erste Schritt zu einer individuellen Betreuung. M it Ende Dreißig beginnt der Alptraum: Am Computer fällt B. die Konzentration immer schwerer, er vergisst wichtige Termine und gerät mit Arbeitskollegen, der Ehefrau und den Kindern in Streit, manchmal wegen Nichtigkeiten. Als dann auch noch beim Basteln die Werkzeuge zu Boden fallen, er sich schwer verbrennt und auf der Straße stolpert, weiß er noch vor dem Arztbesuch die Diagnose, die er seit seiner Kindheit fürchtet: Chorea Huntington (CH). Seine Schilderung des Krankheitsbeginns ist typisch für Patienten im Huntington-Zentrum (HZ) NRW der Ruhr-Universität Bochum. Die meisten Risikopersonen oder bereits Betroffenen kennen die Symptome der Erbkrankheit von einem Elternteil, Großeltern oder Geschwistern: zunächst leichte Bewegungsstörungen, Ungeschicklichkeit, Unsicherheit beim Greifen und dann zunehmende Überbeweglichkeit. Dazu kommen geistige Leistungseinbußen und psychische Veränderungen. Im fortgeschrittenen Stadium zeichnet sich die Krankheit durch Bewegungsstörungen, psychische Auffälligkeiten und einen Abbau des Denkvermögens aus. Neben zahlreichen weite- Dr. Jürgen Andrich, Prof. Dr. Jörg T. Epplen, Huntington-Zentrum NRW 45 ren Anzeichen führten abrupt überschießende, teilweise tänzelnde Bewegungen zur Bezeichnung Chorea (gr. Tanz). Da diese Bewegungsstörungen zwar bei mehr als 85 Prozent der Patienten vorkommen, aber nur bei 57 Prozent das Hauptsymptom sind, ist die klinische Diagnose nicht immer einfach zu stellen. 21 Prozent der Patienten sind schwer depressiv und haben teilweise Selbstmordgedanken. Wahnvorstellungen (z.B. Eifersucht), erhöhte Aggressivität, besonders gegen nächste Familienangehörige, und schwere Zwangshandlungen belasten das soziale Leben und die betroffenen Familien oftmals aufs Äußerste. Es gibt keine Therapie, die sich gegen die Ursachen der Erkrankung richtet. Jedoch können Medikamente gegen die individuellen Symptome helfen, wenn deren Gabe durch den Spezialisten optimiert wird. Diagnostische Sicherheit bringt der DNA-Test, der immer ein schwarz/ weiß-Ergebnis hat: Genträger oder Ausschluss. Verwandte Krankheiten (Huntington disease like) konnten nur in seltenen Fällen bei bestimmten afrikanischen Bevölkerungsgruppen festgestellt werden. In einer großen Verbundstudie bei deutschen Patienten mit dieser Symptomatik konnten wir kürzlich diese afrikanischen Mutationen für alle unsere Huntington-Verdachtsfälle ausschließen. Der DNA-Test bestätigte auch B.’s Vorahnung: Verlängerung des CAGBlocks im Huntingtin-Gen (Abb. 1), erblicher Veitstanz – Chorea Huntington. Trotz der bedrückenden Gewissheit blickt B. nach vorn und lässt sich im HZ NRW beraten: „Wir müssen dieses Schicksal mit der Krankheit annehmen. Die Frage ist nun: Was können wir jetzt kurzfristig, und was in der nahen Zukunft und für später tun?“ Das Berater-Team des HZ spricht in mehreren Treffen mit der Familie des Patienten viele Einzelheiten rund um die Erkrankung an, spielt im Vorfeld bereits verschiedene Situationen theoretisch durch. Für blutsverwandte Familienmitglieder können jetzt je nach Verwandtschaftsgrad exakte Risikoziffern benannt werden, 50 Prozent, 25 Prozent Risiko ... . Die Familie braucht verschiedene Ansprechpartner, neben den CH-Spezialisten auch andere Betroffene und deren Angehörige, die in Selbsthilfegruppen organisiert sind. Ers- Huntington-Zentrum NRW Medizin NEUROrubin 2003 Abb. 1: Ein verlängerter CAG-Block im Huntingtin-Gen wird in ein verlängertes Protein mit einem dann ebenfalls verlängerten Glutaminblock überschrieben. Die veränderte Struktur verhindert einen normalen Abbau. In den Mitochondrien wird die Energieerzeugung gestört. Das Protein lagert sich in Form von zellulären Einschlusskörperchen ab. Dabei sterben Zellen in bestimmten Regionen des Zentralnervensystems ab. CAG: Cytosin/Adenin/Guanin Exon: einzelner DNA-Bereich zwischen Grundlagenwissenschaften und klinischer Medizin. Darüber hinaus bietet das HZ die genetische Beratung. Hier stellen die Experten anhand der Erinnerung der Ratsuchenden einen Familienstammbaum (Abb. 2) auf. „Opa ist damals vor den Zug gelaufen. Der Uropa ist im Alter sehr merkwürdig geworden, und er hatte auch noch ein Kind mit einer anderen Frau und zwei Enkelsöhne. Mit ihnen haben wir keinen Kontakt,“ erzählten zwei Brüder, die bereits 1996 aus eigenem Antrieb zur genetischen Beratungsstelle kamen: Die Mutter war an CH erkrankt; sie wollten die Ungewissheit über die Erbkrankheit für sich selbst beseitigen, auch wegen ihrer weiteren Lebensplanung. Die Brüder, 46 und 40 Jahre alt, leiteten gemeinsam den elterlichen Mittelstandsbetrieb. Beide wurden als Risikopersonen unter intensiver Betreuung genetisch untersucht und stellten sich als Genträger herAbb. 2: aus. Ein Bruder Typischer Familienzeigt nun seit zwei Stammbaum bei Chorea bis drei Jahren Huntington. Erst der Symptome, der anDNA-Test bei V. sicherte dere kommt in weletztlich die Diagnose in nigen Wochen zur dieser Familie. neurologischen Abklärung seines aktuellen Zustands auf die HuntingtonStation. Vielleicht hat er ja bereits erste Krankheitsanzei- te Informationen bietet völlig anonym das Internet (http://mhg.uni-bochum.de/ mhg/huntington1.htm). Aber nicht nur Patienten mit bereits vorhandenen Krankheitszeichen suchen Rat im HZ. Auch Risikopersonen unterziehen sich dem genetischen Test und erhalten so Gewissheit, ob sie die Genveränderung tragen und damit irgendwann an CH erkranken werden. Das ist ein schwerer Schritt, macht er doch in vielen Fällen quasi über Nacht aus Gesunden Kranke. Seltene Sonderfälle sind vorgeburtliche Diagnostikanfragen. Auch zehn Jahre nach Einführung des DNA-Tests besteht stetiger Bedarf an molekulargenetischer Diagnostik, insgesamt wurden bisher im HZ NRW mehr als 2300 DNA-Tests durchgeführt. Damit ergeben sich optimale Voraussetzungen für weitere patienten-orientierte Forschung, insbesondere wenn diese engverzahnt und interaktiv angelegt ist chen, die er selbst gar nicht bemerkt. Warum erkranken Nahverwandte teilweise in sehr unterschiedlichem Lebensalter an CH? Es gilt, den genetischen Hintergrund der Erkrankung, weitere Gene mit Einfluss auf Beginn und Verlauf von CH abzuklären. Entsprechende Studien werden im HZ NRW derzeit anhand des großen Patientenkollektivs durchgeführt. Erste Ergebnisse werden noch in diesem Jahr vorliegen. Schon mit fünf Jahren erkrankt Im Fall von B.’s Tochter N. (Abb.2) konnte und wollte niemand glauben auch die betreuenden Kinderärzte nicht - dass die Kleine bereits mit fünf Jahren erste Krankheitszeichen von Chorea Huntington haben sollte: das Anfallsleiden, die Muskelschwäche und ihre kaum nachweisbaren Bewegungsstörungen wurden auf andere Ursachen zurückgeführt. Der DNA-Test belehrte schließlich nach sechs Jahren Krankheitsverlauf eines Anderen: Frühkindliche CH auf der Grundlage eines extrem verlängerten Huntingtin-Gens (s. Abb. 3). Chorea Huntington kann als Modell (Abb. 4) für andere neurodegenerative, d.h. durch Nervenzelluntergang mit Hirngewebsverlust verbundene Erkrankungen dienen. Dazu gehören die viel häufigeren sog. Volksleiden des höhe46 Huntington-Zentrum NRW Medizin NEUROrubin 2003 mentöse Einstellung sowie intensive Pflege und fachkundige krankenpflegerische Betreuung. Die Humangenetik informiert zum Gentest und zur Vererbung der Erkrankung und erläutert vorhersagende Diagnosemöglichkeiten für Risikopersonen. Insgesamt sind beste Voraussetzungen für individuelle und ganzheitliche Betreuung gegeben. Seit der Eröffnung der klinischen Einheit des HZ NRW mit zwölf Betten in der Neurologischen Universitätsklinik des St. Josef Hospitals Bochum 1996 wurden rund 1.200 CH-Patienten stationär behandelt. Dazu kommen mehr als 1.000 ambulant untersuchte und behandelte Betroffene. Zum Konzept der klinischen Betreuung gehört vorrangig die medizinische Versorgung der häufig von verschiedenen Krankheitssymptomen betroffenen Patienten mit Optimierung der MedikamentenTherapie. Für Genträger, die noch keine Symptome zeigen oder bei denen sich die Krankheit noch im Frühstadium befindet, wird eine standardisierte Status-Quo-Erhebung durchgeführt. Dazu gehören ausführliche klinischneurologische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung von Augenund Zungenbeweglichkeit sowie bildgebende Verfahren (CCT, MRT), Abb. 3: Die Gelelektrophorese offenbart die Genveränderung: Spur II zeigt das verlängerte Gen (pathogen) und Spur V das extrem verlängerte Gen (pathogen, Kind) im Vergleich zu gesunden Menschen (Kontrollen: I, III und IV). ren Lebensalters wie die Alzheimerund Parkinson-Krankheit. Die Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre haben den Erbdefekt bei CH und dessen unmittelbare Folgen für das Gehirn weitgehend geklärt: Das Protein Huntingtin tötet letztlich Nervenzellen in bestimmten Gehirnanteilen, die für wesentliche Funktionen wie die Bewegungskontrolle, aber auch die psychische Gesundheit notwendig sind. Im HZ NRW erlaubt die spezifische Klinikstation (für CH-Kranke und Risikopersonen) inklusive psychologischer Betreuung die optimale medikaAbb. 4: Modellkrankheit Chorea Huntington – eine black box der individuellen Versorgung der Patienten. Neuropsychologie und technisierte feinmotorische Testung (Motorische Leistungsserie, MLS). Daneben ist ein umfassendes medizinisches und soziales Beratungs- und Unterstützungsprogramm für Betroffene und Angehörige im Angebot, um den spezifischen Problemen dieser Familienerkrankung gerecht zu werden (s. Abb. 5). HZ NRW: Patientenversorgung, Gen- und Therapieforschung Über diese klinischen Maßnahmen hinaus bemüht sich das HZ NRW um die Erforschung der genetischen und biochemischen Grundlagen der Erkrankung und – in Kooperation mit weiteren deutschen und europäischen Zentren – um die Entwicklung moderner Medikamente zur zukünftigen sog. neuroprotektiven Therapie. Seit der Identifikation des Huntingtin-Gens und seines Produkts, des Proteins Huntingtin, wurden neue und wichtige Erkenntnisse zum Pathomechanismus der CH gewonnen. Das verlängerte Huntingtin-Protein ist ein sog. stotterndes Genprodukt mit einem verlängerten Glutaminblock und dadurch neuen und pathologischen Eigenschaften. Es kann im Verlauf des Stoffwechsels nicht effizient abgebaut werden und verklumpt im Zellkern von spezifischen Neuronen, die daraufhin absterben. Weiterhin Huntington-Zentrum (HZ) NRW St. Josef Hospital Bochum (Prof. Dr. H. Przuntek) Huntington-Station: Dr. J. Andrich, OA Dr. P.H. Kraus Psychologie: Dr. M. Finger, cand. psych. C. Prehn Sozialarbeit: Sozialpädagoge J. Blumenschein Klinische Forschung: Dr. J. Andrich, Dr. C. Saft Campus Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. J.T. Epplen) Gen-Diagnostik: S. Wieczorek (AIP), I. Alheite, Y. Pischel Genetische Beratung: Dr. A. Syska, Dr. C. Hammans, Dr. W. Klein, Dr. E. Kunstmann, Dr. B. Miterski, Dr. S. Stemmler Forschung: Dipl. biol. L. Arning, S. Wieczorek, cand. med. S. Valentin Städt. Kinderklinik Dortmund (Neuropädiatrie, Dr. Strehl) für kindliche und jugendliche Fälle info 47 Huntington-Zentrum NRW Medizin NEUROrubin 2003 Abb. 5: Im HZ NRW erlaubt die spezifische Klinikstation für CH-Kranke und Risikopersonen eine individuelle und ganzheitliche Versorgung – von der psychologischen Betreuung über die optimale medikamentöse Einstellung bis zur intensiven Pflege. bindet Huntingtin eine Reihe anderer Eiweiße, die für die Zelle essentiell sind. Diese Proteine greifen u.a. auch empfindlich in die Regulation der normalen Genexpression der Zelle ein. Möglicherweise verändern sich dadurch ganze Proteinauf- und abbauwege der Nervenzelle und das natürliche Zusammenspiel der Proteine bzw. ihre Funktion als Transport- oder Rezeptorproteine: 1. Der veränderte Bereich des Huntingtin-Proteins interagiert z. B. mit diversen Eiweißkörpern; verlängertes Huntingtin-Protein aktiviert evtl. direkt zelltod- induzierende Enzyme. 2. Die Bindung von Genregulatoren führt im Zellkern zur Fehlsteuerung der genetischen Aktivität (durch Histon-Deazetylierung, HDAC). 3. Die reduzierte Bindung eines der mit Huntingtin interagierenden Proteine (Huntingtin-interacting Protein 1) führt zur Fehlaktivierung von Enzymen und zu mitochondrialen Störungen (Mitochondrien = Zellkraftwerke; s. Abb. 1, unten rechts). 4. Fehlerhafte Interaktion mit Membranenzymen führt zur Fehlsteuerung der Moleküle für die Erregungsübertragung in Nervenzellen (erhöhte Toxizität durch Stimulation). Aus diesen neuen Erkenntnissen könnten sich in Zukunft Therapieoptionen mit Medikamenten ergeben, die sich zum Teil heute schon in der klinischen Erprobung befinden: Ergebnisse einer europaweiten klinischen Studie mit dem Gluamatantagonisten Rilutek, an der das HZ NRW beteiligt ist, erwarten wir Mitte des Jahres 2004 (s. Punkt 4). Untersucht werden weiterhin Enzyminhibitoren (Studienschwerpunkt Boston), Aggregationshemmer (vorklinische Studien z.B. mit Kongorot und anderen Stoffen im Massenscreening-Verfahren, MaxPlanck-Institut für Molekulare Genitik, Berlin) und HDAC-Inhibitoren (teilweise schon in der Prüfung für Phase 1-Studien, s. Punkt 2). Auch die in Deutschland kontrovers diskutierte Stammzelltherapie wird bereits in einigen vorwiegend Einzelfall-Studien in England, Frankreich und den USA erprobt. Die ersten Ergebnisse lassen erkennen, dass sich die eingebrachten fetalen Zellen tatsächlich in den betroffenen sog. Stammganglien entwickeln und möglicherweise in diesen für die Bewegungskoordination so außerordentlich wichtigen Nervenzellansammlungen (Kernen) den Verlauf der Erkrankung beeinflussen können. Allerdings scheint diese Methode sehr nebenwirkungsreich (Hirn-Blutungen) und insgesamt unsicher (z.B. Zystenbildung) zu sein. Der bisherige Beobachtungszeitraum ist jedoch noch zu kurz, um ein abschließendes Urteil über die Transplantation fällen zu können. Dennoch lassen die Studien hoffen – auf bessere Behandlungsmöglichkeiten und zukünftig vielleicht auch auf Heilung für B., seine Familie und alle anderen Betroffenen. Chorea help, still? Huntington – how to The neurological and psychiatric symptoms of Chorea Huntington range from slight to extremely severe disturbances of movement, at times to overt psychosis. This model hereditary disease usually commences in the fifth decade and leads to death finally within some 20 years. Since 1993 the diagnosis can be assured by a DNA test. The Huntington center (HZ NRW) supplies, in addition to mandatory genetic counselling, also complete clinical and social care. Novel insights from research on the pathogenesis trigger new hope on rational therapeutic strategies and options. abstract 48 Tierphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Neurodegenerative Erkrankungen: Mäuse stehen Modell Das Problem der Forscher bestand lange Zeit darin, dass sie sterbende Nervenzellen am lebenden Menschen nicht untersuchen können und in Tieren diese Erkrankungen nicht vorkommen. Jetzt helfen Mäuse Menschen. C.C. Stichel H. Lübbert F ür zahlreiche neurodegenerative Erkrankungen werden genetische Faktoren verantwortlich gemacht. Bislang sind jedoch die zellulären Prozesse unbekannt, die durch diese genetischen Veränderungen gesteuert zu spezifischen Krankheiten führen. Des- Wenn Nervenzellen sterben halb versucht die Wissenschaft, zumindest Teilaspekte menschlicher Erkrankungen in Tiermodellen zu erforschen: Mit Hilfe transgener Technologien werden in einem Organismus genetische Mutationen erzeugt, die beim Menschen zu unheilbaren Krankheiten führen. Transgene Tiere ermöglichen eine detaillierte Analyse der pathologischen PD Dr. Christine C. Stichel, Prof. Dr. Herrmann Lübbert, Lehrstuhl für Tierphysiologie Mechanismen und bieten ein außerordentliches Potential für die Entwicklung neuer Therapieansätze. Die Erfolge der modernen Medizin in der Behandlung von Infektionskrankheiten und die verbesserte Vorbeugung und Therapie von Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Zuckerkrankheit haben die Lebenserwartung der Bevölkerung westlicher Industrienationen beträchtlich steigen lassen. Die Menschen werden immer älter, leiden damit aber auch mehr an altersabhängigen Erkrankungen. Neurodegenerative Krankheiten gehören zu den häufigsten dieser Erkrankungen und werden im 21. Jahrhundert zunehmend zu sozioökonomischen Problemen führen. Ein Leben ohne Zelltod ist undenkbar. Erst der programmierte Zelltod gewährleistet die richtige Form und Größe von Strukturen während der Entwicklung und entfernt geschädigte Zel- Alzheimer und Parkinson: Zelltod außer Kontrolle len im erwachsenen Organismus. Findet Zelltod jedoch in Organen statt, die nur eine beschränkte Fähigkeit zur Regeneration haben, so hat das verheerende Folgen. Bei Erkrankungen wie Abb. 1: Mikroinjektion von Erbmaterial (DNA) in einen Vorkern. Über eine feine Injektionskapillare wird DNA in den männlichen Vorkern eines einzelligen Mausembryos injiziert. Die Haltekapillare fixiert die Zelle. 49 Tierphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 info Morbus (M.) Alzheimer und Morbus (M.) Parkinson ist der Zelltod außer Kontrolle geraten. Sie sind die beiden häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen, die mit einem fortschreitenden, massiven Verlust von Neuronen im Mittel- bzw. Endhirn einhergehen und zu erheblichen intellektuellen, kognitiven und motorischen Funktionsverlusten führen. Alzheimer-Patienten leiden unter zunehmendem Gedächtnisverlust, Sprach- und Bewegungsstörungen und Orientierungsschwierigkeiten, während es bei Parkinsonikern zu 50 Abb. 2: Die Spuren 1, 3 und 4 zeigen die Wildtyp-Form des Gens, somit handelt es sich bei diesen Mäusen um nicht-transgene Tiere. Tier 2 ist transgen, erkennbar an der mutierten, verkürzten Form des Gens. Der Größenstandard in der linken Spur erlaubt die Größenbestimmung der Banden in den Spuren 1-4. (Nachweis des veränderten Gens durch Polymerase Chain Reaktion). Gang- und Gleichgewichtsstörungen, Zittern und Muskelsteifigkeit kommen kann. Zur Zeit leiden allein in den USA mindestens 4 Millionen Patienten an M. Alzheimer, und ca. 1,2 Millionen Personen sind von M. Parkinson betroffen. Trotz Kenntnis der Symptomatik und Funktionsstörungen sind die Krankheitsmechanismen, die zum neuronalen Zelltod führen, noch weitgehend unverstanden. Daher ist es nicht möglich, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern oder den Zelltod deutlich zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Vielversprechende Fortschritte auf dem Gebiet der Molekularbiologie lassen hoffen, dass in naher Zukunft die Ursachen und Mechanismen dieser Erkrankungen aufgeklärt werden können. Durch genetische Kopplungsanalysen Tierphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Transgene Tiere Überexpression (Transgene) Einbringen eines zusätzliche Gens, das zufällig integriert. Dies führt zu einem Funktionsgewinn. Durch die Wahl des Promotors wird der Ort und die Menge der Expression bestimmt. Durch das zusätzliche Anbringen von Kontrollelementen kann die Fremd-DNA gezielt in bestimmten Geweben bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt exprimiert werden. Knock-out Entfernung eines Gens. Dies führt zu einem Funktionsverlust. Knock-in Veränderung des natürlichen Gens, z.B. Einführung einer Punktmutation, oder Austausch eines endogenen Gens durch ein Fremdgen. Dies führt zu der Expression eines mutierten bzw. Fremdgens in normaler Menge. krankungen widerspiegeln. Die fremde genetische Information fügt sich meist ungerichtet irgendwo in das Genom der Zielzelle ein, oft auch in mehreren Kopien. Durch die Kopplung des Gens mit einem zelltypspezifisch regulierten Promotor kann das Gen ganz gezielt in bestimmten Zelltypen „angeschaltet“ werden (s. Info, S. 56: gezielte Veränderung). Der Promotor, eine Nukleinsäuresequenz, fungiert quasi als Genschalter. Er liegt vor dem eigentlichen Transgen und wird mit ihm in den Organismus ge- info wurden bereits Gene identifiziert, die neurodegenerative Erkrankungen auslösen, wenn sie mutiert sind. Bisher sind drei Gene für M. Alzheimer bekannt: Amyloid Precursor Protein (APP), Präsenilin1 (PSEN1) und Präsenilin2 (PSEN2). Ebenfalls drei Gene sind für die vererbbaren Formen des M. Parkinson verantwortlich: Parkin (Pk), α- S y n u c l e i n le Reaktionsmechanismen im Degenerationsprozess zu identifizieren. Das Problem der Wissenschaftler besteht darin, dass sie die sterbenden Zellen am lebenden Menschen nicht untersuchen können und dass in Tieren diese Erkrankungen (SNCA) und Ubiquitin C-terminale Hydrolase L1 (UCHL1) (Info, S. 52). Damit ist jedoch noch nicht verstanden, wie die Mutationen zu dem sehr komplexen Phänomen des neuronalen Zelltods führen. Für die Entwicklung nicht vorkommen. Die Kenntnis der krankheitsverursachenden Gene und die in den 80er Jahren entwickelte transgene Technologie ermöglichen es jedoch, fremde Gene (Transgene) in die Keimzellen von Säugetieren zu übertragen (Transgenesis) bzw. gezielt zu entfernen oder zu modifizieren (s. Info 2, oben, und Abb. 2). Dadurch können äußerst effizient Tiermodelle erzeugt werden, die zumindest Teilaspekte dieser menschlichen Er- Abb. 3: Chimäre Maus - übertragen wird ein mutiertes Gen in Zellen einer braunen Mauslinie. Durch den Transfer dieser Zellen in eine Mauslinie mit weißer Fellfarbe entstehen gefleckte Nachkommen. Die Zellen mit brauner Pigmentierung tragen das mutierte Gen. Erst Krankheitsmechanismen klären, dann Therapien entwickeln von Therapieformen, die sich gegen die Krankheitsursache richten, ist es unabdingbar, die durch die Mutation ausgelöste Kaskade krankhafter Stoffwechselveränderungen aufzuklären und zentra- 51 Tierphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 bracht. Mit Hilfe von Kontrollelementen, wie dem Tetrazyklin-Operator, gelang es dann auch den Zeitpunkt zu kontrollieren, zu dem das Gen aktiviert wird (s. Info, S.56: konditionierte Veränderung). Mit dieser Technologie erhielten die Forscher ein völlig neuartiges und vielversprechendes experimentelles Handwerkzeug, um die pathologischen Prozesse menschlicher Krankheitsbilder, die durch genetische Veränderungen verursacht werden, zu erforschen Anzeige und Strategien für neue Therapien zu entwickeln und zu erproben. Mit dem Ziel die pathologischen Mechanismen der Alzheimerschen und Parkinsonschen Krankheiten zu entschlüsseln, haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma Biofrontera Pharmaceuticals GmbH (www.biofrontera.de) zahlreiche transgene Mauslinien erzeugt. Diese Mäuse tragen genetische Mutationen, die in Menschen den Ausbruch der Krankheiten verursachen. 52 Promotor fungiert als „Genschalter“ Abb. 4: M. Alzheimer - Hirnschnitte transgener Mäuse: A: Expressionsmuster des mutierten humanen Gens APP in der Hirnrinde. Immunhistochemischer Nachweis mit einem humanspezifischen Antikörper gegen APP. B: Ausbildung von Amyloid-plaques in der Hirnrinde einer 18-Monate alten transgenen Maus. C: Nahaufnahme eines Amyloidplaques. D: Amyloid-plaque umgeben von reaktiven Gliazellen (Astrozyten). In den transgenen Mäusen unseres M. Alzheimer-Projekts werden die mutierten humanen Gene APP und PSEN1 einzeln oder beide gleichzeitig hergestellt (exprimiert). Gesteuert durch den Thy1-Promotor findet man in nahezu allen Neuronen des Gehirns das mutierte humane Protein APP (Abb. 4A). Diese APP-Mäuse entwickeln altersabhängig spezielle Ablagerungen, die sog. Amyloid-Plaques (Abb. 4B-D). Sie sind ein Kardinalsymptom der Alzheimer-Pathologie. Durch die Kombination der APP- und PSEN1-Mutationen ist es uns gelungen, den Ausbruch der Er- krankung in den Tieren zu beschleunigen und das Ausmaß der Schädigungen zu verstärken. In unserem Parkinson-Projekt haben wir inzwischen transgene Linien für alle bisher bekannten krankheitsverursachenden Gene erzeugt. Neben einer Parkin-Knockout-Maus, die die autosomal-rezessive Form des jugend- Tierphysiologie Naturwissenschaften NEUROrubin 2003 Abb. 5: M. Parkinson: Transgene α -synuclein (SNCA)-Mäuse. Zellen in der Hirnrinde transgener Mäuse, in denen das fremde Gen, hier das mutierte humane α -synuclein, hergestellt (exprimiert) wird. Mauslinie 1 (A, B) zeigt eine ubiquitär neuronale Expression, Mauslinie 2 (C, D) exprimiert das Transgen nur in dopaminergen Neuronen und die Mauslinie 3 (E, F) exprimiert das fremde Gen ausschließlich in Gliazellen. lichen/frühen Parkinsonismus widerspiegelt, haben wir transgene Mauslinien erzeugt, die mutiertes humanes UCHL1 oder SNCA herstellen und dadurch als Modelle für die autosomaldominanten Formen des M. Parkinson dienen (s. Glossar). Indem wir verschiedene Promotoren einsetzen, erhalten wir Mauslinien, die das fremde Gen in unterschiedliche Zellen und Hirnregionen tragen. So haben wir Mauslinien, die das Transgen in allen Neuronen des Gehirns (ubiquitär) bzw. ausschließlich in dopaminergen Neuronen (Botenstoff Dopamin) aktivieren und solche, die das Transgen nur in Stützzellen (Gliazellen, s. Abb. 4) tragen. Die spannenden Fragen, die sich nun stellen sind (i), welche Funktionsstörungen durch die eingeführten Genmutationen in den Mäusen ausgelöst werden, (ii) ob sie denen von Parkinson-Patienten gleichen und, wenn nicht, (iii) welche kompensatorischen Mechanismen in der Maus die Krankheitsentstehung erfolgreich verhindert haben. Zur Beantwortung dieser Fragen setzen wir eine breite Palette histologischer und molekularbiologischer Methoden sowie Verhaltensstudien ein. Wir charakterisieren den pathologischen Zustand der Tiere und definieren Zeitpunkte, die mit deutlichen degenerativen Veränderungen einhergehen. Diese Zeitpunkte stehen dann im Mittelpunkt unserer Genexpressionsanalysen. Mit dem DEPD ®-Verfahren (Digital Expression Pattern Display, Patent-Nr. DE1980 6431C1) und einer hochentwickelten Bioinformatik versuchen wir den Genen auf die Spur zu kommen, die die degenerativen Prozesse steuern. Die eingeführten Mutationen haben bereits zu pathologischen Veränderungen in den Mäusen geführt: So hatte z.B. das gezielte Entfernen des Gens Parkin (Parkin-Knockout-Maus) bereits in jungen Tieren biochemische und Transgenic animal models Abb. 6: An einer Sterilbank wird das Kulturmedium für die Stammzellen vorbereitet, die für die Herstellung transgener Tiere benötigt werden. Animal models are important tools used in experimental medical science to better understand the pathogenesis of human disease. Advances in molecular genetics provide approaches for the establishment of animal models using transgenic technology. In order to learn more about the molecular events underlying the neurodegenerative diseases M. Parkinson and M. Alzheimer, we have developed transgenic animals that mirror different aspects of their neuropathology. Analyses of these animals give us valuable insight and clues to the underlying pathogenesis and allow us to develop new therapeutic approaches. abstract 53 Naturwissenschaften Tierphysiologie NEUROrubin 2003 Abb. 7: Unter dem Mikroskop werden die gefärbten Hirnschnitte von transgenen Mäusen ausgewertet. Transgene Tiere erkennen die Forscher an veränderten Neuronen bzw. Gliazellen, die beurteilt und gezählt werden. Herstellung transgener Tiere Konventionelle Veränderung Einbringen von Fremd-DNA an unbestimmter Stelle in irgendein Chromosom. Gezielte Veränderung (Gene Targeting) Gene, die den Zelltod bringen Einführung eines zusätzlichen DNAFragments in ein Zielgen. Einführung einer Deletion in ein Zielgen. Gezielte Veränderung einzelner Nukleotide des Zielgens. Konditionelle Veränderung Gerichtete genetische Abwandlung, die nur ein spezifisches Gewebe oder einen Zeitabschnitt in der Entwicklung eines Organismus oder beides betrifft. info 54 morphologische Veränderungen in den Neuronen zur Folge, die bei Parkinsonikern absterben. Auch wenn die Erkrankung bei den noch jungen Tieren nicht vollständig identisch mit der beim Menschen ist, so besteht die Hoffnung, dass der Krankheitsprozess fortschreitet und noch weitere, pathologische Veränderungen erzeugt. Die in den transgenen Mäusen beobachteten Defekte werden dadurch verursacht, dass durch das Entfernen des Parkin-Gens weitere Gene an- bzw. abgeschaltet werden. Die Gruppe dieser nachgeschalteten Gene haben wir mit der DEPD®-Methode analysiert. Schon in jungen transgenen Tieren fanden wir dabei bereits bekannte mit dem Zelltod verbundene Gene, aber auch eine bemerkenswerte Zahl von Genen, die bislang nicht mit degenerativen Prozessen in Zusammenhang gebracht wurden. Diese Gene eröffnen uns ein ganz neues Verständnis zelltodinduzierender Prozesse. Durch die transgenen Tiere haben wir somit erstmals die Chance, die Krankheit am lebenden Organismus zu untersuchen und die krankheitsverursachenden Prozesse aufzuklären. Das heißt auch, dass mit Hilfe dieser Tiere neue Diagnosemethoden und Therapieansätze entwickelt werden können. Glossar: autosomal-rezessive Form: Das Gen liegt auf einem Körperchromosom (Autosom), nicht auf einem Geschlechtschromosom und seine Merkmalsausprägung tritt gegenüber der seiner Kopie (Allel) zurück. dominante Form: Vorherrschen der Merkmalsausprägung eines Gens. IGSN NEUROrubin 2003 International Graduate School for Neuroscience (IGSN) Mit Prinzip über den eigenen Tellerrand schauen Ercan Altinsoy hat in Istanbul Maschinenbau studiert, Britta Jost in Freiburg Biologie und Anna Abraham Psychologie in Indien und England, danach haben sie alle den Weg nach Bochum gefunden, um an der International Graduate School for Neuroscience (IGSN, Sprecher: Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann) ihren Doktortitel PhD in Neuroscience zu erwerben. Ihre Forschungsgebiete sind vielfältig – von der gegenseitigen Beeinflussung auditiver und taktiler Reize über den Sitz des kreativen Potenzials bis hin zu den Strukturen einzelner Rezeptoren in den Nervenzellen des Gehirns: Die IGSN umfasst die Neurowissenschaften vom Molekül bis zur Kognition. Insgesamt 29 Hochschullehrer aus den Fakultäten für Medizin, Chemie, Biologie, Elektrotechnik und Psychologie sowie dem Institut für Neuroinformatik der RUB arbeiten interdisziplinär zusammen und etablieren die Neurowissenschaften als eigenes Fachgebiet. Dieser Ansatz hat an der Ruhr-Universität bereits Tradition: Zur Vorgeschichte der 2001 gegründeten IGSN gehören eine interdisziplinäre neurowissenschaftliche DFG-Forschergruppe (1990- 1996), das kognitions- und gehirnwissen schaftliche Graduiertenkolleg der DFG KOGNET (1991-2000), der seit 1996 bestehende neurowissenschaftliche Sonderforschungsbereich 509 NEUROVISION und das Institut für Neuroinformatik. Mit der Anerkennung der Neurowissenschaften an der Ruhr-Universität als internationalem Center of Excellence ist die IGSN Anziehungspunkt hoch begabter Bewerber aus dem In- und Ausland. Damit will die IGSN die internationale Konkurrenzfähigkeit des Standorts Bochum erhöhen und die Qualität des wissenschaftlichen Nachwuchses langfristig sichern. Zehn Stipendien werden jährlich an herausragende Absolventen medizinischer, natur- und einiger ingenieurwissenschaftlicher Fächer vergeben, wenigstens ein Drittel der Teilnehmer sollen aus dem Ausland stammen. Sie erforschen Fragen der Genetik und Strukturanalyse einzelner Membranproteine bis hin zur Entwicklung und funktionellen Charakterisierung des Neokortex, sie widmen sich der Modellbildung und der technischen Umsetzung in der Neuroinformatik. Auf dem Programm steht außerdem die Verknüpfung zwischen der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung und relevanten klinischen Krankheitsbildern. Diese Breite wissen die PhD-Studierenden zu schätzen: „Interdisziplinarität ist für die Neurowissenschaft wichtig, Denkstrukturen müssen erweitert werden”, so die Biologin Britta Jost. „Und es ist gut, in der IGSN Leuten zu begegnen, die auf derselben Ebene arbeiten.“ Jeder ist Experte seines eigenen Fachgebiets, muss sich jedoch in andere Bereiche erst einarbeiten; „dumme“ Fragen gibt es nicht. Tobias Niemann Weitere Informationen zur IGSN im Internet: http://www.rub.de/igsn Sinneswahrnehmungen beeinflussen sich Die Hände hören mit Wenn wir mit geschlossenen Augen mit dem Finger über zwei unterschiedliche Sandpapierstücke streichen, können wir sofort sagen, welches rauer ist. Wir haben es mit der Fingerspitze ertastet – aber nicht nur: Wir haben auch das unterschiedliche Geräusch wahrgenommen, das der Finger auf dem Papier hervorgerufen hat. Nebensache? Informationen, die über verschiedene Wahrnehmungskanäle kommen, zu integrieren, ist eine grundlegende Funktion unseres Gehirns. „Wie genau das passiert und wie sich die Sinneswahrnehmungen gegenseitig beeinflussen, ist nicht hinreichend erforscht. Das liegt u.a. daran, dass es im Experiment bislang schwierig war, den einzelnen Sinnen voneinander unabhängige Reize zu präsentieren“, erklärt Ercan Altinsoy, der am Institut für Kommunikationsakustik die Interaktion von auditiver und taktiler Wahrnehmung erforscht. Er bedient sich für seine psychophysischen Studien virtueller Umgebungen. Dort entspringen die Reize nicht der physikalischen Realität, sondern können künstlich generiert und unabhängig voneinander verändert werden. Altinsoy nutzt ein Simulationssystem, mit dem man in physikalisch nicht existierende Umgebungen hineinhören kann. Er hat es um eine taktile Komponente erweitert, die Oberflächeninformationen, Ganzkörperschwingungen und das sog. forcefeedback, das wir z. B. beim Klopfen oder Schlagen empfinden, simulieren kann. Durch Tests an Versuchspersonen hat er bereits herausgefunden, dass, auch wenn das System immer dasselbe force-feedback gibt, der Nutzer den Eindruck hat, kräftiger geschlagen zu haben, wenn er ein lauteres Geräusch dabei gehört hat. In anderen Experimenten hat Altinsoy die Verzögerungs- toleranz zwischen einzelnen Reizen ermittelt: Wie lange dürfen Tastinformation und Geräusch auseinander liegen, damit das Gehirn sie als zusammengehörig interpretiert? Empfängt die Hand die Tastinformation nach dem Geräusch, dürfen nicht mehr als 26 Millisekunden dazwischen vergehen, kommt hingegen das Geräusch verzögert, toleriert das Gehirn bis zu 49 Millisekunden. Andere Schwellenwerte ergaben Experimente mit Geräuschen und Ganzkörperschwingungen: Kommt das Geräusch zuerst, dürfen bis zur Schwingung höchstens 35 Millisekunden vergehen, kommt die Schwingung zuerst, darf das Geräusch nicht mehr als 39 Millisekunden später erklingen. Weitere Tests sollen zeigen, welchen Einfluss die taktile Wahrnehmung auf die Lokalisation von Schallquellen hat. Die Experimente sollen helfen, ein besseres Verständnis der Integration von akustischer und taktiler Information zu gewinnen und virtuelle Umgebungen möglichst realistisch erfahrbar zu machen. md 55 IGSN NEUROrubin 2003 Trigeminus-Nerv aktiv: Life übertragen aus der Nervenbahn Chemische Sinne spielen eine entscheidende Rolle im täglichen Leben der Säugetiere und des Menschen. Dazu gehört neben Geruchs- und Geschmackssinn auch der „trigeminale Sinn“. Diese Sinnessysteme vermitteln z.B. woraus sich die Nahrung zusammen setzt. Schon vor der Aufnahme der Nahrung informieren vor allem der Geruchs- und der trigeminale Sinn über ihre Genießbarkeit. Zudem ist der Geruchssinn von besonderer Bedeutung bei der sozialen Kommunikation. Säugetiere erkennen potenzielle Geschlechtspartner oder Feinde an ihrem Körpergeruch. Der trigeminale Sinn schützt den Organismus vor schädlichen Substanzen, indem er Sinneseindrücke wie juckend, stechend, brennend oder beißend vermittelt. Dabei werden die chemischen Reize von freien Nervenendigungen des 5. Hirnnervs (Nervus trigeminus) in den Schleimhäuten von Mund und Nase und in den Geweben des Auges aufgenommen und in elektrische Signale umgewandelt. Diese werden dann entlang der Nervenfasern über das Ganglion trigeminale (Gasseri) in definierte Bereiche des Hirnstamms geleitet. Dort bestehen Verbindungen zu weiteren Nervenzellen, die für die Datenverarbeitung notwendig sind. Verschaltungen zwischen Nervenzellen im gesamten Nervensystem bilden die Basis dafür, dass Informationen aus der Umwelt geordnet weitergeleitet und verrechnet werden und schließlich zur bewussten Wahrnehmung führen können. Erst die Kenntnis der funktionalen Verbindungen der Nervenzellen untereinander lässt uns die Funktion einzelner Nervenzellen sowie die Arbeitsweise und Informationsverarbeitung komplexer Strukturen des Gehirns verstehen. Moderne Techniken ermöglichen es heute, die Aktivität von Nervenzellen unter natürlichen Bedingungen zu beobachten, z.B. den Zusammenhang von Umweltreizen und neuronalen Aktivitätsmustern einzelner Zellen und funktionaler Netzwerke. Nils Damann untersucht in seiner Doktorarbeit am Lehrstuhl für Zellphysiologie die Aktivität trigeminaler Nervenzellen und das funktionale Zusammenspiel von Nervenzellgruppen im Ganglion trigeminale von Mäusen. Indem er über genetisch veränderte Viren einen Calcium-empfindlichen Fluoreszenzfarbstoff in die Nervenzellen einschleust, macht er die neuronale Aktivität dieser Zellen sichtbar. Mit optischen (bildgebenden) Verfahren blickt er „life“ und in Echtzeit in den intakten Gewebeverband. Da sich das ausgewählte Virus innerhalb des Nervensystems spezifisch über aktivitätsgekoppelte Nervenzellen ausbrei- Abb.: Trigeminale Nervenzellen produzieren nach Virusinfektion ein fluoreszierendes Protein. Bei Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Wellenlänge leuchten die Nervenfasern und Zellkörper charakteristisch. tet (Neurotropie), vermittelt sein Verbreitungsmuster im Gehirn die exakte Funktionskarte der an der Informationsverarbeitung beteiligten Strukturen (s. Abb). Mit immunhistochemischen und aktivitätsabbildenden Verfahren (Ca-Imaging) können die trigeminalen Sinnesreize erstmals auf ihrem Erregungs- und Verarbeitungspfad durch das Mäusegehirn verfolgt werden. Bausteine elektrischer Synapsen suchen: Methode im Griff Erst in den letzten Jahren machen sie von sich reden, die elektrischen Synapsen (Abb.1, A), auch Gap Junctions genannt: Es sind kleine Kanäle, die benachbarte Zellen miteinander verbinden und sich aus speziellen Proteinen (Connexinen) zusammensetzen. Elektrische Synapsen leiten Signale ohne Hilfe von Botenstoffen (wie die chemischen Synapsen) und damit extrem schnell von Nervenzelle zu Nervenzelle weiter. Sie verbinden Neurone untereinander zu ganzen Netzwerken. Wenn es um komplizierte Wahrnehmungen geht, die unser Gehirn aus vielen Detailinformationen aufbaut, scheinen sie eine wichtige Rolle zu spielen. Vermutlich sind elektrische Synapsen mitverantwortlich für schnelle rhythmische Entladungen, sog. Oszillationen, in der Hirnrinde und deren Weiterleitung über größere Distanzen hinweg zu übergeordneten Neuronen. 56 Oszillationen kommen in unterschiedlichen Hirngebieten vor und werden mit höheren Hirnfunktionen wie Gedächtnisbildung und Wahrnehmung in Verbindung gebracht. Eine dieser Hirnregionen ist der Hippocampus, der an der Bildung des Langzeitgedächtnisses beteiligt ist. Svenja Weickert (Neuroanatomie und Molekulare Hirnforschung) ist den elektrischen Synapsen im Hippocampus auf der Spur, indem sie nach ihren Bausteinen, den Connexinen, sucht und diese analysiert. Bisher weiß man wenig über die Funktion, molekulare Vielfalt und Konzentration dieser Proteine in den verschiedenen Hirnarealen. Deshalb möchte die PhD-Studentin mit modernen molekularbiologischen Methoden auf RNA-Ebene klären, welche Proteine dieser Connexinfamilie an der elektrischen Kopplung im Hippocampus beteiligt sind und welcher Zusammenhang zwischen IGSN NEUROrubin 2003 der Häufigkeit ihres Auftretens und ihrer Funktion besteht. Da bisherige Techniken, mit denen Connexine in spezifischen Zellgruppen untersucht wurden, zu widersprüchlichen Ergebnissen führten, setzt Svenja Weickert in ihrer Arbeitsgruppe als eine der ersten in Deutschland die Lasermikrodissektion (Laser Microbeam Microdissection, LMM) ein: Sie bringt dünne Gewebeschnitte auf folienbeschichtete Objektträger auf und färbt sie zur besseren Orientierung an. Mit einem Laser schneidet sie dann unter dem Mikroskop definierte Zellgruppen aus dem Gewebe aus. Da das Gewebe auf der Folie und nicht direkt am Objektträger haftet (s. Abb.1, B-E), können einzelne Schnitte gesammelt werden. A us diesen Proben wird die RNA isoliert und dann mit speziellen Techniken (reverser Transkription, RT, und Polymerase Chain Reaction, PCR) in DNA umgesetzt und sehr spezifisch untersucht. So lässt die Real Time RT-PCR-Technik Aussagen zur Konzentration einer RNA in der Probe zu: ein Fluorenszenzfarbstoff macht den Reaktionsverlauf bei dieser äußerst empfindlichen quantitativen Analyse messbar – die RNA-Menge kann unmittelbar abgelesen werden. Svenja Weikert hat mit der LMM-Methode inzwischen viel Erfahrung sammeln können und bereits einige Vertreter der Connexinfamilie im Hippocampus nachgewiesen. Sie wird diese Ergebnisse nun mit anderen elektrisch gekoppelten Hirnregionen vergleichen. Schließlich will sie den Hippocampus zum Oszillieren bringen, um an- hand der Konzentrationsveränderungen der Connexine ihrer Funktion auf die Spur zu kommen – die optimale Methode dafür hat sie schon im Griff! Plastizität des erwachsenen und alternden Gehirns: Zirkelspitzenpaare tasten „Was Hänschen nicht lernt Hans (n)immer mehr“ – nicht zum ersten Mal scheint hier wissenschaftliche Erkenntnis den Volksmund zu widerlegen: Wie aktuelle Ergebnisse zeigen, sind Leistungssteigerung und Plastizität des Gehirns bis ins hohe Alter möglich. Den Zusammenhang zwischen Verhaltensänderungen und deren Auswirkungen auf dafür zuständige Hirnbereiche untersucht Patrick Ragert (Institut für Neuroinformatik) in seiner Doktorarbeit an der IGSN. Indem er beobachtet, wie sich bei veränderter Tastwahrnehmung (Perzeption) zugleich Bereiche des Gehirns umstrukturieren, erfährt er mehr über die physiologischen Mechanismen des „perzeptuellen Lernens“. Seine Arbeiten konzentrieren sich auf zwei Bereiche. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen eines passiven künstlichen Trainings auf kortikaler und Verhaltensebene. Dies erfolgt mithilfe simultaner Abb.: Zuwachs an Hirnaktivität im Bereich des primären (S1) und sekundären (S2) somatosensorischen Kortex durch künstliches passives Training . Reizmuster unter genau definierten Bedingungen und in drei Trainingsschritten: Zunächst lernen Testpersonen vorgegebene Tastreize zu unterscheiden, indem sie mit dem Finger acht Zirkelspitzenpaare auf einer sich drehenden Scheibe ertasten müssen („aktives Lernen“). Daran schließt sich das „künstliche Training“ an, bei dem die rezeptiven Felder für das Tasten der Zirkelspitzenpaare an den Fingerspitzen der Testpersonen mit genau definierten Reizen stimuliert werden. Im dritten Schritt wird das „aktive Lernen“ wiederholt. Dabei zeigte sich, dass der Tastsinn durch „künstliches Training“ verbessert werden kann die Testpersonen ertasten wesentlich mehr Zirkelspitzenpaare als beim ersten „aktiven Lernen“. Patrick Ragert stellte außerdem einen linearen Zusammenhang zwischen verbessertem Tastsinn und Umstrukturierungen der dafür zuständigen Hirnareale fest (s. Abb., SI und SII). Neben den peripheren Reizen an den Fingerspitzen stimuliert er auch direkt die Hirnregionen, in denen die Reize der Fingerspitze verarbeitet werden. Er nutzt dafür die repetitive transcranielle Magnetstimulation (rTMS), bei der sich mithilfe eines Magnetfeldes die Aktivität in bestimmten Hirnregionen kurzzeitig verändern lässt. Die funktionellen Änderungen im Gehirn erfasst er kernspintomografisch und mit einer speziellen Hirnstrommessung (SEP-mapping). Im zweiten Teil seiner Arbeiten erforscht Ragert, wie sich aktives Training im Vergleich zu fehlendem Training auf das Alltagsleben und die Reorganisation des Gehirns auswirken. Für diese Untersuchungen wählt er drei repräsentative Personengruppen aus: Menschen mit künstlerischen Fähigkeiten (z.B. professionelle Musiker), Patienten mit pathologischen Symptomen (z.B. Schmerz) sowie ältere Menschen. Bei Musikern lässt sich aufgrund ihres enormen Trainings spezifischer musikalischer Fähigkeiten die kortikale Plastizität besonders gut studieren. Patienten mit pathologischen Symptomen wie etwa Schmerzen zeigen infolge fehlenden Trainings durch Nichtgebrauch der betroffenen Extremität häufig erhebliche Reorganisationen im Gehirn. Mithilfe bildgebender Verfahren wie der Kernspintomografie weist er nach, dass Alterungsprozesse deutliche funktionelle Veränderungen im menschlichen Gehirn verursachen. Er will nun herausfinden, ob diese Prozesse in einem Zusammenhang mit eingeschränkten motorischen, sensorischen sowie kognitiven Fähigkeiten stehen. 57 IGSN Wo die Geistesblitze herkommen Maler, Werber, Musiker, Schriftsteller – sie alle leben von ihren guten Ideen: Ihr Kapital ist ihre Kreativität. Der präfrontale Kortex im vordersten Bereich des Gehirns hinter der Stirn ist wahrscheinlich Hauptsitz dieser schöpferischen Kraft. Welche kognitiven Vorgänge jedoch genau an den komplexen kreativen Prozessen beteiligt sind und wie sie in dieser Hirnregion auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet werden, ist bisher nicht bekannt. Um diese Fragen zu ergründen, vergleicht Anna Abraham (Biopsychologie) kreative Leistungen von gesunden Probanden mit denen von Patienten mit krankhaften Veränderungen des präfrontalen Kortex, wie sie etwa bei Schizophrenie auftreten. Durch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen hofft sie, auf Funktionen dieser Hirnregion rückschließen zu können. Ihre Hypothese: Die Patienten werden die Kontrollgruppe in einigen kreativen Denkprozessen übertreffen. Denn manche gesunden Abläufe in unserem Denken können bei kreativen Aufgaben eher hinderlich sein. So beziehen wir in die Verarbeitung neuer Informationen immer unsere Erfahrungen und Erwartungen mit ein (top-down processing). Bei schizophrenen Patienten deutet hingegen einiges darauf hin, dass diese Einbeziehung von Vorwissen in kognitive Prozesse bei ihnen vermindert ist – Aufgaben, bei denen es von Vorteil ist, frei von Erfahrungen und Erwartungen zu sein, müssten sie also bes- Vorkommen und Funktion klären: Rezeptor der „Extraklasse“ Einem noch wenig erforschten Rezeptor des zentralen Nervensystems ist Britta Jost (Entwicklungsneurobiologie) auf der Spur: Der sog. GABA C -Rezeptor ist einer von dreien, die für γ -Aminobuttersäure (GABA) empfänglich sind. GABA ist der wichtigste hemmende Botenstoff im Nervensystem von Wirbeltieren. Durch das Zusammenspiel zwischen hemmenden und erregenden Botenstoffen wie z. B. Glutamat wird die Nervenzellaktivität im Gehirn reguliert: Trifft GABA auf einen für diesen Botenstoff empfänglichen Rezeptor, so öffnen sich Kanäle, die bestimmte Ionen in die Zelle hineinlassen und so das elektrische Potenzial im Zellinneren herabsetzen. Von diesem Potenzial hängt die Aktivität der Zelle und die Weiterleitung der neuronalen Signalen ab. Während die beiden Rezeptortypen GABA A und GABA B schon seit längerem bekannt sind, entdeckten Wissenschaftler GABA C erst vor einigen Jahren. Dieser Rezeptor unterscheidet sich in der Zusammensetzung seiner Untereinheiten und der dar- 58 aus resultierenden Empfänglichkeit für verschiedene Botenstoffe so sehr von den anderen beiden GABA-Rezeptoren, dass die Forscher ihm eine eigene Rezeptorklasse zuwiesen. Wo GABA C genau vorkommt, in welchem Entwicklungsstadium eines Organismus er vorhanden (exprimiert) ist und welche Aufgaben er hat, untersucht Britta Jost in ihrer Dissertation. GABA C kommt gehäuft in der Netzhaut und in visuellen Arealen des Gehirns vor, z. B. im Colliculus superior, einer Hirnregion, die an den Koordinationsbewegungen der Augen beteiligt ist. Auch in der Sehrinde lässt sich der Rezeptor nachweisen. Man nimmt daher an, dass GABA C eine Rolle beim Sehprozess spielen könnte. Um herauszufinden, ob der Rezeptor von Geburt an im Gehirn vorhanden ist oder sich erst später etabliert, ob seine Entstehung womöglich durch das Sehen selbst beeinflusst wird, untersucht Britta Jost diverse Gewebeproben aus visuellen Hirnarealen. Mittels molekularbiologischer Techniken kann sie darin enthaltene Rezeptor- ser lösen können als gesunde Testpersonen. Diesen Effekt soll ein Experiment belegen: Beide Gruppen sollen ein Tier zeichnen, das auf einem fernen Planeten vorkommen könnte, der vollkommen anders ist als die Erde – eine schwierige Aufgabe, wenn das irdische Vorwissen dabei im Weg steht. Eine solche Begriffserweiterung ist jedoch immer dann notwendig, wenn wir neue Ideen entwickeln. Vorangehende Untersuchungen an gesunden Probanden haben bereits gezeigt, dass Menschen mit stärkeren psychotischen Zügen besser in der Lage sind, ihre Begriffskonzepte zu erweitern (s. auch Bild links im Vergleich zu Bild, rechts oben) als Menschen mit schwächer ausgeprägten psychotischen Merkmalen. md DNA für GABA C nachweisen, deren Gehalt in den einzelnen Proben ermitteln und so ein Entwicklungsprofil erstellen. Um zu testen, welche äußeren Faktoren die Entwicklung dieses Rezeptors beeinflussen, legt sie organotypische Zellkulturen von entsprechenden Hirnarealen an und fügt der Nährlösung, die sie versorgt, bestimmte Faktoren zu, die als potenziell einflussreiche Kandidaten infrage kommen. Dieses Kultursystem birgt den Vorteil, dass Neurone nicht einzeln, sondern in ihrem ursprünglichen Verband wachsen können, was eher dem natürlichen Zustand entspricht. Ob eine Zelle den GABA C -Rezeptor enthält, kann sie anhand elektrophysiologischer Messungen nachweisen: Sie stimuliert einzelne Neurone einer organotypischen Zellkultur mit GABA und leitet über eine sog. patch-clamp-Messung den Strom aus dem Zellinneren ab. Dieser durch GABA induzierte Strom setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Er kann von GABA A -, GABA B- und GABA C-Rezeptoren vermittelt werden. Um zu untersuchen ob GABA C -Rezeptoren beteiligt sind, werden spezifische Stoffe, welche die GABA A - und GABA B -Rezeptoren blockieren, verabreicht. Bleibt ein Reststrom, so handelt es sich um den GABA C-vermittelten Anteil, der durch Gabe eines GABA C -Antagonisten eliminiert werden kann. Außerdem versucht Britta Jost mit morphologischen Untersuchungen herauszufinden, wo genau sich die GABA C -Rezeptoren befinden. Die Forscher vermuten, dass sie auf sog. Interneuronen sitzen, d. h. Nervenzellen, die andere Nervenzellen miteinander verbinden. Mithilfe ihrer Daten soll eine Übersicht über das Vorkommen von GABA C entstehen. Außerdem versprechen ihre Ergebnisse genauere Einblicke in die Funktion dieser Rezeptoren im neuralen Netzwerk des Colliculus superior. md