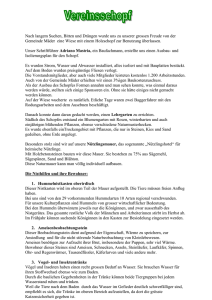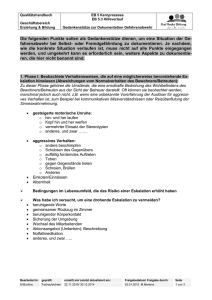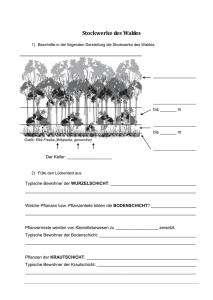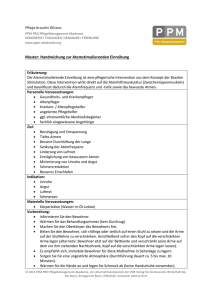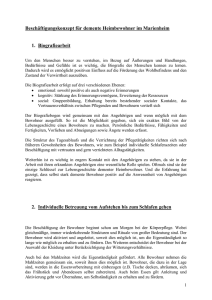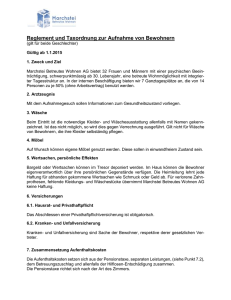Gemeinschaftsorientiertes Wohnen - München
Werbung

STUDIE Selbstständiges Wohnen im Alter „Gemeinschaftsorientiertes Wohnen“ und „Betreutes Wohnen“ im Vergleich FernUniversität - Gesamthochschule Hagen Institut für Psychologie erstellt von Gerlinde Gottlieb März 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Voraussetzungen für selbstständiges Wohnen im Alter 6 2.1 Kompetenzen der Person 6 2.2 Räumliche Umwelt 8 2.3 Soziale Umwelt 2.3.1 Modell des sozialen Konvois nach Kahn & Antonucci 2.3.2 Hierarchisches Kompensationsmodell nach Cantor 10 11 13 2.4 Weitere Umweltmerkmale 2.4.1 Erreichbarkeit und Zugänglichkeit 2.4.2 Sicherheit 14 15 16 2.5 Passung zwischen Person und Umwelt 2.5.1 Kompetenz-Anforderungsmodell von Lawton 2.5.2 Komplementraritäts-Ähnlichkeits-Modell von Carp & Carp 17 17 20 3 Empirische Untersuchung 24 3.1 Fragestellung der Untersuchung 24 3.2 Methode und Vorgehensweise 3.2.1 Methode der ego-zentrierten Netzwerkanalyse 3.2.2 Zugang zum Projekt und Durchführung der Befragung 24 24 26 3.3 Beschreibung der Stichprobe 27 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Ergebnisdarstellung - Gemeinschaftsorientiertes Wohnprojekt Entstehungsgeschichte und Beschreibung des Projektes Objektive Deskription der Wohnbedingungen Subjektive Bewertung der Wohnbedingungen durch die Bewohner 28 28 30 33 3.5 Einzugsgründe 37 3.6 Erwartungen 40 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 Soziales Netzwerk der Bewohner Netzwerkgröße Soziale Aktivitäten Vereinsaktivitäten 43 43 47 51 3.8 Entwicklungspotenziale im Wohnprojekt 53 3.9 Versorgung im Krankheitsfall 54 3.10 Exkurs: Voraussetzungen für das Leben im Wohnprojekt 58 2 4 Vergleichende Diskussion 59 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 Merkmale der Bewohner Familienstand Geschlecht Gesundheitszustand Einzugsalter Wohnsituation vor und nach dem Umzug Einzugsbereich der Wohnanlagen Zusammenfassung der Bewohnermerkmale 61 61 61 62 63 63 64 65 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Einzugsgründe Gesundheitliche Gründe Absicherung im Not- und Bedarfsfall Wunsch nach einer altersgerechten Wohnung Nähe zur Filialgeneration Wunsch nach Gemeinschaft Zusammenfassung der Einzugsgründe 66 66 67 68 69 70 71 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Erwartungen Letzte Station der Wohnbiografie Hilfe bei längerer Krankheit Zusammenfassung der Erwartungen 72 72 74 74 5 Schlussbetrachtung 76 6 Literatur 79 Anhang: Fragebogen Erklärung 3 1 Einleitung Das Thema „Wohnen und Leben im Alter“ gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ein Grund hierfür ist die demografische Entwicklung, die geprägt ist durch sinkende Geburtenraten und den stetig zurückgehenden Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppe. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung und damit das Risiko der Pflegebedürftigkeit. Hinzu kommt der anhaltende Trend zur Singularisierung und Individualisierung, der dazu führt, dass familiäre Netze weniger soziale Unterstützung leisten können als in der Vergangenheit. Es stellt sich somit die Frage, welche Wohnformen und welche Versorgungsstrukturen diesem Wandel gerecht werden, welche den Bedürfnissen der älteren Menschen nach einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben entsprechen und welche Modelle in Zukunft finanzierbar sind. 93 % der Menschen über 65 leben heute in normalen Wohnungen und wollen dort, nach Möglichkeit bis zum Lebensende, wohnen bleiben (BMFSFJ, 1998, S. 94). Die notwendigen Voraussetzungen hierzu sind eine selbstständigkeitsfördernde Gestaltung von Wohnung und Wohnumfeld sowie soziale Kontakte und Unterstützungspotenziale, die Versorgungssicherheit im Not- und Bedarfsfall bieten. Durch die Möglichkeiten, die Wohnung mit professioneller Hilfe an die sich verändernden Bedürfnisse des älter werdenden Menschen anzupassen und durch die Inanspruchnahme von ambulanten Diensten und nachbarschaftlich organisierten Unterstützungsnetzwerken, kann ein Verbleib in der vertrauten Wohnumgebung selbst bei nachlassender Kompetenz in vielen Fällen gewährleistet werden. Welche Wohnalternativen stehen aber zur Verfügung, wenn man die Wohnsituation aufgrund mangelnder Passung zwischen der Kompetenz der Person und den Umweltanforderungen verändern muss oder präventiv verändern will und weder alleine noch im Heim leben möchte? Alternativen zum Wohnen in der eigenen Wohnung sind Betreutes Wohnen, selbstorganisierte Wohn- und Hausgemeinschaften sowie Mehrgenerationenwohnen. Diese Wohnformen werden vor allem von Menschen gewählt, die sich mit ihrer Wohnsituation bewusst auseinander setzen. Sie sind bestrebt, Mängel der Umwelt, im Hinblick auf räumliche und/oder soziale Defizite sowie der Versorgungssicherheit, durch einen Umzug bewusst zu verändern, um so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt im Alter leben zu können bzw. im dritten Lebensalter noch einmal etwas Neues zu beginnen. 3 Unter „Betreutem Wohnen“ wird das „selbstständige Wohnen in einer vollständigen, abgeschlossenen und nach Möglichkeit barrierefreien Wohnung“ verstanden, das ein bestimmtes Maß an Betreuung (wie beispielsweise individuelle Beratung, Vermittlung von Dienstleistungsangeboten, Organisation von Freizeitaktivitäten) beinhaltet (BMFSFJ, 1998, S. 112). Mitte der 80er Jahre entstanden die ersten Beispiele für Betreutes Wohnen. Diese Wohnform wurde seitdem immer populärer. Heute leben schätzungsweise zwischen 150.000 und 230.000 Menschen in betreuten Wohnanlagen (Kremer-Preiß & Stolarz, 2003, S. 95). Im Vergleich zum Betreuten Wohnen leben (noch) relativ wenig Menschen in gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten. Man geht von ca. 250 realisierten Projekten mit etwa 4.000 bis 5.000 Wohnungen aus (Kremer-Preiß & Stolarz, 2003, S. 73). Dass der Bedarf und die tatsächliche Nachfrage nach dieser Wohnform größer ist als das bereits existierende Angebot, wird in der Statistik des Forums für gemeinschaftliches Wohnen (FGWA) deutlich. Im Jahr 1999 zählte der Verein 2.000 Anfragen von Interessenten an gemeinschaftsorientierten Wohnformen. Ende 2004 hat sich die Zahl bereits auf 9.200 erhöht (FGWA, 2005). Unter dem Begriff „Gemeinschaftliches Wohnen“ verbirgt sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten. Das Spektrum reicht von selbstorganisierten, altershomogenen Wohn- oder Hausgemeinschaften über ökologisch orientierte Mehrgenerationen-Wohnprojekte bis hin zu Wohngruppen mit Betreuungsbedarf. Kennzeichnend für gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte ist, dass sich Gleichgesinnte zusammenschließen, um in einem meist gemeinsam geplanten Haus miteinander zu leben und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Da gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte von einer zunehmenden Anzahl älterer Menschen als Alternative zum Alleinwohnen und zum Wohnen im Altenheim gesehen werden, wird in dieser Arbeit ein gemeinschaftsorientiertes intergeneratives Wohnprojekt qualitativ untersucht und deskriptiv ausgewertet. Die Bewohner kommen dabei selbst zu Wort, um ein Bild über den Alltag in einem gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt sowie über die sozial-räumlich Umwelt zu vermitteln. 4 Ferner wird in dieser Studie der Frage nachgegangen, worin sich die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnens und des Betreuten Wohnens unterscheiden. Hierbei sind Fragestellungen von Interesse: • In welchen Aspekten unterscheiden sich die Bewohner der beiden Wohnformen? • Was bewegt sie, in die jeweilige Wohnform zu ziehen? • Welche Erwartungen sind mit dem Umzug verbunden? • Wie gestalten sie ihren Alltag? • Auf welches soziale Unterstützungspotenzial können sie im Not- und Bedarfsfall zurückgreifen? Zum Vergleich der Wohnformen werden verschiedene empirische Untersuchungen zum Betreuten Wohnen (Saup, 2001; Göldner, 2002; Seidel, 2003) herangezogen und diskutiert. Im theoretischen Teil werden Kompetenz- und Kongruenzmodelle aus der ökologischen Gerontologie dargestellt, die sich mit dem Person-Umweltbezug im Alter befassen. Des Weiteren werden Ansätze zur sozialen Netzwerkbildung und der sozialen Unterstützung aufgezeigt. Da es bislang noch relativ wenig veröffentlichte empirische Forschungsarbeiten zu gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten gibt, wurde zur Exploration ein Fragebogen entwickelt, der als Leitfaden für das qualitative Interview diente. Zur Erhebung des sozialen Netzwerkes im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt wurde die Methode der Netzwerkanalyse eingesetzt und in den Fragebogen integriert. 5 2 Voraussetzungen für selbstständiges Wohnen im Alter In welchem Ausmaß selbstständiges Wohnen und Leben im Alter möglich ist, hängt von verschiedenen Merkmalen der Person und der sie umgebenden räumlichen und sozialen Umwelt ab. Diese Merkmale werden im Folgenden näher beschrieben. 2.1 Kompetenzen der Person Eine wesentliche Voraussetzung für die selbstständige Lebensführung liegt in der Person selbst. Selbstständiges Leben und Wohnen impliziert, dass die Person in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, den Haushalt eigenständig zu führen und sich außerhalb der Wohnung zu bewegen. In der gerontologischen Literatur wird diese Fähigkeit als Alltagskompetenz bezeichnet und in zwei Gruppen von Alltagshandlungen unterteilt: in die basalen (ADL - Activities of Daily Living) und in die instrumentellen (iADL) Tätigkeiten. Laut Wahl (1988, S. 75f) zählen hierzu: • Regelmäßige Selbstpflege • Anziehen • Einnehmen von Mahlzeiten • Toilettenbenutzung • Mobilität • Einkaufen • Kochen • Haushaltsarbeiten • Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel • Erledigung von Geldangelegenheiten • Umgang mit Medikamenten • Telefonieren. ADL iADL Bis zu welchem Grad diese Aktivitäten selbstständig ausgeführt werden, ist abhängig von der Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitszustand der Person, ihren motorischen, sensorischen und kognitiven Fähigkeiten, sowie von den Gegebenheiten der sozial-räumlichen Umwelt und von den Erfordernissen der jeweiligen Situation. 6 Die Ergebnisse der Untersuchung von Kruse & Schmitt (1995, S. 232) zu „Formen der Selbständigkeit in verschiedenen Altersgruppen“ weisen darauf hin, dass bei den 60-74-Jährigen die Selbstständigkeit weitgehend erhalten ist, aber in der Altersgruppe zwischen 75 und 79 ein deutlicher Zuwachs des Anteil der Personen mit Hilfebedarf bei der Ausführung von Alltagsaktivitäten zu verzeichnen ist. Das Risiko, mit zunehmendem Alter an Kompetenz einzubüßen, darf jedoch nicht mit einer defizitären Sichtweise des Alterns insgesamt einhergehen. Der Prozess des Alterns ist interindividuell verschieden, und Kompetenzeinbußen werden unterschiedlich wahrgenommen und kompensiert. Wahl (1993, S. 367) konstatierte in seiner Untersuchung über die Aktivitäten des täglichen Lebens, dass eine hohe Alltagskompetenz bei älteren Menschen die Regel ist und die Abhängigkeit von Hilfe eher eine Ausnahme bildet. In diesem Zusammenhang sind auch die Arbeiten von Baltes & Baltes (1990) interessant, die das psychologische SOK-Modell (Selektive Optimierung mit Kompensation) entwickelten. Sie postulieren, dass Menschen bei abnehmender Kompetenz Strategien entwickeln, wie sie ein persönlich zufriedenstellendes und möglichst autonomes Leben im Alter führen können. Dieses Modell basiert auf der Maximierung von Gewinnen und auf der Minimierung von Verlusten und besagt, dass das Individuum eine Auswahl in bestimmten Funktions- und Verhaltensbereichen trifft, die mit seinen persönlichen Bedürfnissen in Einklang stehen. Das Individuum optimiert seine Handlungsweise, um die für ihn bedeutsamen Aktivitäten so lange wie möglich - wenn auch in abgeänderter Form weiterhin ausführen zu können. Zur erweiterten Kompetenz des Menschen zählt die Fähigkeit, den Alltag sinnvoll zu gestalten. Dies sind Aktivitäten, die nicht zwingend für die selbstständige Lebensführung sind, sondern sich vielmehr positiv auf die Lebensqualität und Lebenszufriedenheit auswirken. Hierzu zählen u.a. die Nutzung von Medien und Bildungsmöglichkeiten, sportliche Aktivitäten, ehrenamtliches Engagement etc. (BMFSFJ, 1998, S. 26). Kruse (1992, S. 25) hat Kompetenz nicht nur als die „Fähigkeit des Menschen zur Aufrechterhaltung eines selbständigen Lebens“ im Sinne der Alltagskompetenz (ADL/iADL) beschrieben, sondern diesen Begriff erweitert auf ein „aufgabenbezogenes und sinnerfülltes Leben in einer anregenden, unterstützenden, die selbstverantwortliche Auseinandersetzung mit Aufgaben und Belastungen 7 fördernden Umwelt“. Diese Definition von Kompetenz liegt der vorliegenden Arbeit zugrunde. Die aktive und selbstverantwortliche Auseinandersetzung des Menschen mit den Anforderungen seiner sozialen und räumlichen Umwelt trägt dazu bei, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fordern und zu fördern. 2.2 Räumliche Umwelt Der Wunsch der meisten (älteren) Menschen ist es, unabhängig und möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt zu leben und, wenn möglich, in der eigenen Wohnung und somit im vertrauten Wohnumfeld zu bleiben. Ob dieser Wunsch erfüllt werden kann, ist abhängig von der Kompetenz der Person sowie von der Qualität der Wohnung, des sozial-räumlichen Wohnumfeldes sowie deren Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. Die Wohnung und ihre Ausstattung wirken sich auf die Lebensqualität insofern aus, als der Alltag im Alter vor allem durch den Aufenthalt in der Wohnung geprägt ist. Saup (2001, S. 83) stellte in seiner Studie zum Aktivitätsprofil der Bewohner von betreuten Wohnanlagen fest, dass ältere Menschen ab 70 durchschnittlich 21 Stunden pro Tag in der Wohnung verbringen. War die Wohnung lange Jahre auf die Bedürfnisse der Person zugeschnitten, so können, durch altersbedingte Kompetenzeinbußen im körperlichen, sensorischen und kognitiven Bereich, Barrieren in der räumlichen Umwelt entstehen, die die Ausführung gewohnter und notwendiger Tätigkeiten behindern, sich negativ auf das Wohlbefinden und die Aktivitäten des Menschen auswirken und letztendlich den Selbstständigkeitsgrad reduzieren können. Solange die Person noch selbst dazu in der Lage ist, kann sie die entstandenen Defizite beispielsweise kompensieren durch: • Verhaltensänderung (z.B. mehr Radio hören statt lesen, wenn die Sehkraft nachlässt) und/oder durch • Veränderung bzw. Anpassung der Umwelt durch Wohnungsanpassungsmaßnahmen (wie z.B. das Anbringen von Erhöhungsblöcken an Bett und Sessel, damit das Aufstehen leichter fällt) oder gar durch die • Nutzung von prothetischen Mitteln (wie z.B. den Einsatz einer Greifhilfe, die das Heranholen und Aufheben von Gegenständen erleichtert). 8 Auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie Einkaufs- und Haushaltshilfen trägt dazu bei, Defizite zu kompensieren und möglichst lange ein selbstständiges Leben zu führen. Können Einbußen nicht mehr kompensiert werden, führt dies zu erheblichen Einschränkungen im Alltag, die als belastend erlebt werden können und unter Umständen einen Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim erforderlich machen. Auch wenn sich die Mehrheit der Aktivitäten im Alter auf die eigene Wohnung beschränkt, trägt die sozial-räumliche Wohnumwelt als Teil der Wohnbedingungen wesentlich zum selbstständigen und zufriedenstellenden Leben bei. Das Wohnumfeld umfasst vor allem den näheren räumlichen Bereich, der die eigene Wohnung umgibt, und beinhaltet die engere und weitere Nachbarschaft sowie das Quartier (BMFSFJ, 2001, S. 245). Das Vorhandensein und die Erreichbarkeit von Läden des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Apotheke), Dienstleistungen (Arzt, Bank, Freizeiteinrichtungen), Naherholungsgebieten (Parks, Grünflächen) sowie eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sind insbesondere für ältere Menschen von besonderer Bedeutung, da diese Gegebenheiten ein notwendiges aktionsräumliches Feld darstellen. Lawton (1977) belegte, das die Nutzung von Infrastruktureinrichtungen in Zusammenhang mit der Entfernung von der eigenen Wohnung steht, d.h. je weiter die Einrichtungen (Laden, Alten- und Service-Zentrum) von der Wohnung entfernt sind bzw. je schlechter sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, desto geringer ist die Nutzung dieser Gelegenheiten. Folglich ist eine geringe Distanz zu den infrastrukturellen Einrichtungen der Ausübung außerhäuslicher Aktivitäten förderlich. Eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeit kann bei längerer Dauer zur Folge haben, dass Kompetenzen aufgrund einer anregungsarmen und an Gelegenheiten mangelnden Umwelt nicht mehr gefördert und somit vernachlässigt werden und mit der Zeit verkümmern. Dies kann zu einem allmählichen Rückzug in die eigene Wohnung führen. In dieser Studie wird ein besonderes Augenmerk auf die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der infrastrukturellen Einrichtungen des Wohnumfeldes gelegt und die Auswirkung auf die Selbstständigkeit der Bewohner in Abhängigkeit von ihrer Mobilität untersucht. Von Interesse ist, ob und wie die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes den Mangel an fußläufig erreichbarer Infrastruktur bei der Erledigung der alltäglichen Besorgungen durch gegenseitige Hilfestellung kompensieren. 9 2.3 Soziale Umwelt Eine weitere Variable, die neben der Kompetenz der Person und den räumlichdinglichen Umweltmerkmalen einen Beitrag zur selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung leistet, ist die Umwelt in Form des sozialen Netzwerkes einer Person. Soziale Netzwerke stellen zwischenmenschliche Bindungen und soziale Beziehungsgeflechte von „Personen, Positionen, Organisationen“ (Pappi, 1987, S. 13) dar. Die sozialen Beziehungen werden vom Individuum selbst geknüpft und aufrechterhalten und ergeben eine soziale Struktur, die Beziehungen zur Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, zu Freunden und Arbeitskollegen, Bekannten etc. beinhaltet. Diese Beziehungen setzen sich je nach Lebensabschnittsphase unterschiedlich zusammen, verändern sich und erfüllen unterschiedliche Funktionen. Dieses individuelle soziale Netzwerk ist wiederum eingebettet in und abhängig von gesellschaftlichen Strukturen. Beispielsweise wirken sich • die Arbeitsmarktsituation und die damit verbundene Mobilitätsanforderung an die Arbeitnehmer, • die Bildungspolitik und die daraus resultierende höhere Qualifikation von Frauen, die u.a. zu einer höheren Frauenerwerbsquote führte, • die Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme etc. in unterschiedlichem Maße auf die familiären Unterstützungsnetzwerke aus. Die sozialen Strukturen (d.h. Größe, Dichte, Homogenität der Mitglieder, Kontakthäufigkeit, geografische Nähe, Dauer und Intensität der Beziehungen) bestimmen darüber, welche Handlungsspielräume Menschen zur Verfügung stehen und auf welche Art und Weise sie in weitere soziale Strukturen (Familie, Freundeskreis, Arbeitswelt, Vereinsleben etc.) integriert sind. Das Vorhandensein sozialer Netzwerke und ihre Größe wird als Maßstab für soziale Integration und Partizipation am gesellschaftlichen Leben bewertet. Die Analyse sozialer Netzwerke zeigt einerseits die Einflüsse struktureller Merkmale der sozialen Umwelt auf das Verhalten der beteiligten Individuen und stellt andererseits die Auswirkungen individuellen Verhaltens auf die Gestaltung der Struktur von sozialer Umwelt dar (Töpfer et al., 1998, S. 140). 10 In der Netzwerkforschung (Gottlieb, 1981) wird zwischen sozialem Netzwerk als Struktur und sozialer Unterstützung als Funktion (empfangene oder geleistete instrumentelle oder emotionale Unterstützung) unterschieden. Das bedeutet, dass soziale Netzwerke einerseits dahingehend analysiert werden müssen, ob und in welcher Weise sie ein Potenzial an sozialer Unterstützung zur Verfügung stellen und andererseits, ob auch tatsächlich Unterstützung geleistet wird. Denn die Tatsache, dass ein soziales Netzwerk besteht, bedeutet noch nicht, dass auch tatsächlich soziale Unterstützung im Fall von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit geleistet wird. Von „erfolgreichen“ Unterstützungssystemen wird angenommen, dass sie einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ausüben und sich stressreduzierend bei der Bewältigung kritischer Lebensereignisse wie Scheidung, Verrentung, Krankheit oder Tod eines nahestehenden Menschen und Umzug im Alter auswirken (Wellmann, 1981, S. 172). Sie tragen auch dazu bei, schwere Erkrankungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen zu überwinden oder mit ihnen leben zu lernen (Engel et al., 1996, S. 11). Nach Litwin (1995, S. 37) ermutigen soziale Unterstützungssysteme die Netzwerkmitglieder, formelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und unterstützen sie bei der Suche nach passenden Pflegemöglichkeiten. Da die Größe, die Beziehungsdichte und die Art der Zusammensetzung (Anteil an Familienmitgliedern, Freunden, Arbeitskollegen) des sozialen Netzwerkes in Abhängigkeit von den eingenommenen Rollen in der jeweiligen Lebensabschnittsphase variiert, wird im Folgenden ein theoretischer Ansatz dargestellt, der die Veränderung des sozialen Netzwerkes und seiner Unterstützungspotenziale in den unterschiedlichen Lebensphasen betrachtet. 2.3.1 Modell des sozialen Konvois nach Kahn & Antonucci Das Konzept des sozialen Konvois (social convoy) nach Kahn & Antonucci (1980, S. 269) beinhaltet das persönliche Netzwerk eines Individuums zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben und die damit verbundene wechselseitige Unterstützung im Sinne von Geben und Nehmen. Die Autoren zeigen auf, dass es im Lebenslauf sowohl eine bestimmte Kontinuität als auch Veränderungen im Hinblick auf bestimmte Netzwerkpartner gibt. Von der Geburt bis zum Tod ist der Mensch von unterschiedlichen Personen umgeben, die ihn wie ein „Konvoi“ begleiten. Dies sind Eltern, Geschwister, Partner, Kinder, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte etc. Durch Übergänge in 11 neue Lebensbereiche, sogenannte „ökologische Übergänge“ (Bronfenbrenner, 1981), und die damit neu eingenommenen Positionen und Rollen verändert sich dieser „Konvoi“. Neue Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte und Nachbarn kommen hinzu, andere Netzwerkpartner wie Studienkollegen, frühere Nachbarn oder Arbeitskollegen entfallen hingegen. In der Regel ist das soziale Netzwerk in der frühen Erwachsenenphase am größten und in der frühen Kindheit und im hohen Alter am kleinsten. Da sich das persönliche Netzwerk im Lauf des Lebens verändert, verändert sich auch das damit verbundene Unterstützungspotenzial. Zur Erklärung der Veränderung des sozialen Konvois nehmen Kahn & Antonucci (1980) Bezug auf das Rollenkonzept. Sie definieren Rolle als „a set of activities that are expected of a person by virtue of his or her occupancy of a particular position in social space“ (ebd. S. 261). Soziale Unterstützung wird demnach in Zusammenhang gebracht mit den unterschiedlichen Positionen eines Individuums, die es durch seine Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Gruppen im Laufe des Lebens einnimmt (z.B. als Student, Vater, Mutter, Ehepartner, Arbeitskollege, Nachbar etc.). Dadurch entstehen unterschiedliche soziale Netzwerke, die sich verändern oder wieder auflösen. Diese unterschiedlichen Rollen sind die Grundlage für Kontakt und Interaktion mit anderen Personen (ebd. S. 272). In drei konzentrischen Kreisen, die sich um die Person als Mittelpunkt bilden, veranschaulichen Kahn und Antonucci (1980, S. 272 ff) die Auswirkung der Stabilität der sozialen Unterstützung in Verbindung mit der Rolle im Lebenslauf. Im innersten Kreis befinden sich die Personen, zu denen die Beziehung und die damit verbundene Erwartung an sozialer Unterstützung über die gesamte Lebensspanne relativ stabil ist. Dies sind Ehepartner, Kinder, Eltern, die engere Verwandtschaft und gute Freunde. Der Verlust einer Person aus diesem Kreis ist meist auf Tod oder auf eine große Enttäuschung zurückzuführen, durch die es zum Bruch der Beziehung kommt. Im mittleren Kreis stehen die Personen, zu denen das Individuum verwandtschaftliche bzw. freundschaftliche Beziehungen unterhält (z.B. weitere Verwandte, Freunde). Diese engen Beziehungen und die damit verbundenen Unterstützungspotenziale sind weniger rollenabhängig und stabiler als jene im äußersten Kreis, verändern sich jedoch auch über den Lebenslauf hinweg, beispielsweise durch die persönliche Entwicklung der Person. Der äußerste Kreis umfasst die am wenigsten nahen Beziehungen zwischen der Person und den Mitgliedern des sozialen Netzwerkes (z.B. Nachbarn, 12 Arbeitskollegen etc.). Dieses Netzwerk stellt Unterstützungspotenziale dar, die stark rollenabhängig und somit nicht stabil über die gesamte Lebensspanne sind. Durch eine Veränderung im Lebenslauf (z.B. Stellenwechsel, Verrentung oder Umzug) verändert sich auch die Rolle als Arbeitskollege oder Nachbar. In der Analyse des sozialen Netzwerkes der Studienteilnehmer, die mit Hilfe des von Kahn und Antonucci (1980) entwickelten „bull’s-eye“-Modell durchgeführt wurde, interessieren in dieser Arbeit die Netzwerkgröße, die Art der Zusammensetzung und die Kontinuität der Beziehungen im Lebenslauf sowie die daraus entstehenden Unterstützungspotenziale (z.B. bei längerer Krankheit) in den unterschiedlichen Altersgruppen. 2.3.2 Hierarchisches Kompensationsmodell nach Cantor Cantor untersuchte 1979 die informellen Netzwerke älterer Menschen, die in der City von New York lebten. Sie stellt in ihrer Auswertung eine bestimmte Rangfolge der sozialen Unterstützung fest, die gesellschaftlich und kulturell normierte Zuständigkeiten für Hilfeleistungen aufweist. Sie zeigt auf, wie entfallende oder nicht vorhandene Netzwerkpartner einer Ebene durch Netzwerkpartner einer anderen Ebene kompensiert werden. In erster Linie wird die Kernfamilie zur sozialen Unterstützung herangezogen. Dabei werden der Ehepartner und dann die eigenen Kinder am häufigsten genannt. Bei den eigenen Kindern wird Hilfe vor allem von Töchtern erwartet und geleistet. Sind keine Töchter vorhanden oder wohnen sie weiter entfernt, übernehmen auch Söhne bzw. Schwiegertöchter diese Rolle. Bei kinderlosen Ehepaaren oder bei alleinlebenden älteren Menschen sind es die nächsten Familienangehörigen, wie z.B. Geschwister, Nichten oder Neffen, die Hilfestellung geben. Wenn auch diese fehlen, werden Freunde, Bekannte oder Nachbarn um Unterstützung gebeten. Nach der Kernfamilie stehen an zweiter Stelle meist gleichaltrige und gleichgeschlechtliche Freunde, die insbesondere bei älteren Menschen in städtischen Gebieten in der Nähe wohnen und gerade im Alter mit abnehmendem Aktionsraum eine große Rolle bei emotionaler und instrumenteller Hilfestellung spielen. Die Nachbarn werden laut Cantor (1979, S. 450) eher für Notfälle und für vorübergehende Unpässlichkeiten in Anspruch genommen oder wenn Kinder oder andere Verwandte nicht greifbar sind. 13 An letzter Stelle in der Unterstützungshierarchie stehen medizinische und soziale Dienste, also formelle Hilfen. Durch die demografische Entwicklung und die Tendenz zur Vereinzelung, die bedingt ist durch die sinkende Heiratsneigung, die zunehmende Anzahl der Ehescheidungen auch bei sogenannten „Alt-Ehen“ und die Abnahme der Kinderzahl, vermindert sich zukünftig die Chance, im Alter Unterstützung vom Ehepartner oder von den Kindern zu erhalten. Diese strukturelle Veränderung bedeutet, dass Freundschaften und Nachbarschaften und formelle Dienste das fehlende familiäre Unterstützungsnetzwerk kompensieren müssen. Horowitz (1985) beschäftigte sich mit der Frage, wer welche Hilfe innerhalb der Familie leistet. Er fand heraus, dass sich Töchter und Söhne nicht in Bezug auf die Quantität der gewährten Hilfe unterscheiden, sondern eher im Hinblick auf die Art der Hilfestellung. Söhne leisten weniger Unterstützung bei Haushaltstätigkeiten, beim Kochen und bei der Körperpflege. Sie kümmern sich meist um Einkäufe, finanzielle Angelegenheiten und erledigen Behördengänge. In dieser Arbeit, die die Wohnform des Betreuten Wohnens mit der des gemeinschaftsorientiertem Wohnens vergleicht, wird untersucht, von welchen Personen die Bewohner Unterstützung bei längerer Krankheit bzw. Pflegebedürftigkeit erwarten und ob das hierarchische Kompensationsmodell auch heute noch bestätigt werden kann. 2.4 Weitere Umweltmerkmale In der gerontologischen Literatur werden Umweltattribute genannt, die insbesondere für ältere Menschen an Bedeutung gewinnen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die von verschiedenen Autoren genannten Merkmalen der Wohnumwelt, die sich auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der älteren Menschen auswirken. 14 Wohnumweltmerkmal Saup Carp Flade Kahana (1993) (1994) (1997) (2003) Sicherheit X X X X Anregung/Stimulierung X X X Erreichbarkeit und Zugänglichkeit X Umweltkontrolle/Kontrollierbarkeit X Wohnlage/Ästhetik X X X Unterstützung X Kommunikation X Vertrautheit X Orientierung X Tabelle 1: X X Überblick über wichtige Umweltattribute in der gerontologischen Literatur Im Nachfolgenden werden die Attribute „Erreichbarkeit und Zugänglichkeit“ und „Sicherheit“ skizziert, da sich diese wesentlich auf das selbstständige Leben im Alter auswirken. 2.4.1 Erreichbarkeit und Zugänglichkeit Wie bereits in Kapitel 2.2 „Räumliche Umwelt“ erwähnt, ist die quartiersnahe Versorgung mit Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs, mit Apotheken, Ärzten etc. und ihre Erreichbarkeit eine wesentliche Voraussetzung zur selbstständigen Haushaltsführung. Die Wohnung und das Wohnumfeld sollten idealerweise so gestaltet sein, dass die Kompetenzen zur selbstständigen Lebensführung weder überfordert noch unterfordert werden. Schlechte Erreichbarkeit (wie z.B. weite Entfernung, ungenügende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Überquerung einer verkehrsreichen Straße) und/oder erschwerte Zugänglichkeit (Unterführungen, Treppen, Hochflurbusse, etc.) können je nach Gesundheitszustand der Person dazu führen, dass Ein- 15 kaufen bzw. außerhäusliche Aktivitäten eine Überforderung darstellen und somit zwangsläufig reduziert werden. Die Bedeutung dieser Umweltattribute ist aber nicht nur auf den Versorgungsaspekt reduziert. Die Ausstattung des Wohnumfeldes mit gut erreichbaren soziokulturellen Einrichtungen (wie z.B. Volkshochschule, Seniorenbegegnungsstätten und Naherholungsmöglichkeiten) motivieren zu außerhäuslichen Aktivitäten. Allein schon die Wege, die zu diesen Einrichtungen gemacht werden oder die täglichen Spaziergänge werden oft nur deshalb gemacht, um mit anderen Menschen zusammen zu kommen, sich auszutauschen und zu kommunizieren. Die räumliche Distanz zu Gegebenheiten sowie Ausstattungsdefizite und Hindernisse im Wohnumfeld stellen, je nach Kompetenzgrad der Person, Nutzungsbarrieren dar, die einer eigenständigen Haushalts- und Lebensführung sowie der sozialen Partizipation im Quartier entgegenstehen. 2.4.2 Sicherheit Sicherheit ist ein umfassendes Konzept und beinhaltet alles, was mit dem Abbau von Ängsten zu tun hat, die ein Leben in Selbstständigkeit behindern oder das Wohlbefinden negativ beeinflussen können. Gerade mit zunehmendem Alter und einhergehender Vulnerabilität wächst das Bedürfnis nach physischer, sozialer und emotionaler Sicherheit. Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit ist ein Aspekt der Sicherheit. Es beinhaltet die Vermeidung von Unfällen im privaten und öffentlichen Bereich (Stürze, Verkehrsunfälle) und den Schutz vor Kriminalität. Insbesondere im Alter kommen Ängste auf, die durch die subjektiv erlebten Kompetenzeinbußen verursacht werden. Die Furcht vor Krankheit, vor fehlender Unterstützung im Notfall und vor Vereinsamung nimmt zu. Das Sicherheitsbedürfnis ist individuell unterschiedlich stark ausgeprägt. Es steht in Zusammenhang mit Persönlichkeitsmerkmalen, mit der physischen und psychischen Befindlichkeit und mit den Erfahrungen, die im Lauf des Lebens mit der sozialen und räumlichen Umwelt gesammelt wurden. 16 2.5 Passung zwischen Person und Umwelt Die Passung zwischen den Merkmalen der Person und ihrer Umwelt wird in der Umweltpsychologie als Kongruenz bezeichnet. Die unten genannten Kompetenz- und Kongruenzmodelle thematisieren die Person-Umwelt-Beziehungen im Hinblick auf die Voraussetzungen und Konsequenzen einer Passung. Saup nimmt eine Klassifizierung in Kompetenz- und Kongruenzmodelle vor. Kompetenzmodelle, wie z.B. das unten angeführte Modell von Lawton betonen die „Wichtigkeit von Fähigkeiten und Fähigkeitseinbußen der Person für die Adaption an herausfordernde Umweltbedingungen im Alter“ (Saup, 1993, S. 58f). Bei Kongruenzmodellen (Carp & Carp, 1984; Kahana, 1982) wird davon ausgegangen, dass „subjektive Zufriedenheit alter Menschen und eine gute Adaption an die Anforderungen des Alters dann wahrscheinlich sind, wenn Umwelt- und Personenmerkmale kongruent sind“ (Saup, 1993, 59). Im Folgenden werden das Kompetenzmodell-Anforderungsmodell von Lawton & Nahemow (1973) sowie das Komplementaritätsmodell von Carp & Carp (1984) dargestellt. 2.5.1 Kompetenz-Anforderungsmodell von Lawton Wie bereits ausgeführt, ist zur selbstständigen Lebens- und Haushaltsführung ein gewisses Maß an Kompetenz der Person und eine entsprechende Ausstattung des näheren und weiteren Wohnumfeldes erforderlich. In ihrem Kompetenz-Anforderungs-Modell setzen Lawton & Nahemow (1973, S. 661) den Kompetenzgrad einer Person in Beziehung zu den Umweltbedingungen und beschreiben die Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Bei der Entwicklung des Modells übernahmen sie die Sichtweise von Lewin (1935), der das Verhalten als eine Funktion von Person und Umwelt definierte. Lawton & Nahemow (1973) betrachten in ihrem “ökologischen Modell“ das Verhalten als eine Funktion der Ressourcen der Person (Kompetenz) und den Anforderungsstrukturen der Umwelt. Lawton (1982, S. 38) definiert Kompetenz als Merkmal der Person und bezeichnet damit die theoretisch oberste Grenze ihrer Kapazität im Hinblick auf körperliche Gesundheit, motorische, sensorische und kognitive Fähigkeiten. 17 Die Umweltanforderungen (ebd. S. 40) werden in Anlehnung an Murray (1938) unterteilt in objektiv vorhandene mess- und zählbare Merkmale (alpha-press) und in subjektive Merkmale (beta-press), wie sie vom Individuum wahrgenommen und erlebt werden. Dies Subkategorien sind: • physische Umwelt (Lärm, Luftqualität, Kriminalitätsrate, Beschaffenheit des Raums) • personale Umwelt (soziales Netzwerk der Person) • suprapersonale Umwelt (soziodemografische Merkmale der Wohnumwelt wie Altershomogenität, Geschlecht etc.) und • gesellschaftliche Strukturen (wie z.B. Normen und Werte). Den Zusammenhang zwischen dem Kompetenzprofil der Person und den Anforderungsstrukturen der Umwelt formulierten Lawton & Simon (1968) in der „environmental docility“-Hypothese (Umweltfügsamkeits-Hypothese). Sie besagt, dass bei abnehmender Kompetenz der alternden Person die Bedeutung der Umweltanforderungen für das Erleben und Verhalten zunimmt (Lawton, 1982, S. 48). Im nachfolgenden Modell werden die Zusammenhänge zwischen Person und Umweltanforderungen erläutert. 18 Abb. 1: Kompetenz-Anforderungsmodell von Lawton (1982, S. 44) (entnommen aus Saup, 1993, S. 34) Das Modell betont die Wichtigkeit der Kompetenz der alternden Person für die Adaption an die Umweltanforderungen. Das Individuum ist bestrebt, seine Kompetenz so einzusetzen, dass eine Anpassung an die jeweiligen Anforderungsstrukturen möglich wird. Wenn das Adaptionsniveau erreicht wird, führt dies zur emotionalen Ausgeglichenheit. Kommt es zu Abweichungen in dem Bereich links vom Adaptionsniveau, dann bedeutet dies eine leichte Unterforderung, die dann maximales Wohlbefinden bewirkt. Bei leichter Überforderung im Bereich rechts vom Adaptionsniveau wird das maximale Leistungspotenzial erreicht. Scheitert die angestrebte Anpassung aber aufgrund der alterstypischen Kompetenzverluste, kommt es zu einer unerwünschten Überforderung, die Stress erzeugt und sich negativ auf das Wohlbefinden auswirkt. Erleidet beispielsweise eine Person einen Schlaganfall, der eine dauerhafte motorische Schädigung zur 19 Folge hat, sinkt ihr Kompetenzgrad. Dies könnte zur Folge haben, dass beispielsweise die Treppen im Haus nicht mehr bewältigt werden können, d.h. eine Anpassung der veränderten Kompetenz an die Umweltanforderungen ist nicht möglich. Durch den Einsatz von prothetischen Mitteln, wie z.B. einem Treppenlift oder durch einen Umzug in eine barrierefreie Wohnung, kann die Balance zwischen Kompetenz und Umweltanforderung wieder hergestellt werden. In der oben dargestellten Grafik zeigt die unterschiedliche Breite des hellgrauen Bereichs, dass Individuen höheren Kompetenzgrades ein breiteres Spektrum an Umweltressourcen zur Verfügung steht, welches zur Befriedigung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse genutzt werden kann. Geringfügige Umweltveränderungen wirken sich weniger negativ auf das Erleben und Verhalten dieser Menschen aus, als bei den Personen, deren Kompetenzgrad niedrig ist. Diese besitzen einen geringeren Spielraum für Umweltveränderungen. Je größer folglich die Kompetenz einer Person ist, desto mehr Umweltressourcen stehen zur Verfügung, um die individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Erkenntnis liegt der „environmental proactivity“-Hypothese von Lawton (1985) zugrunde. Den Impuls für diese Hypothese erhielt Lawton von Carp & Carp (1984), die kritisierten, dass Lawton in der „docility“-Hypothese nicht die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Person berücksichtige. Zudem betrachte er Umwelten nur einseitig als Anforderungen und nicht als Ressource, die es Menschen erlaubt, ihre Umwelten auszuwählen, zu verändern und zu gestalten (Lawton, 1999, S. 94). 2.5.2 Komplementraritäts-Ähnlichkeits-Modell von Carp & Carp Carp & Carp (1984) gehen in ihrem Komplementaritäts-Ähnlichkeitsmodell auch von der Grundannahme aus, dass das Verhalten und Erleben eine Funktion der Kongruenz, d.h. der Passung zwischen dem (älteren) Menschen und seiner Umwelt ist. Sie lehnen sich in ihrer Sichtweise an die Erkenntnisse von Lawton’s „docility“-Hypothese an. Ihr Modell besteht aus zwei Teilmodellen, die nachfolgend grafisch dargestellt werden. 20 Abb. 2: Kongruenz-Ähnlichkeitsmodell (nach Carp & Carp, 1984, S. 284) (entnommen aus Saup, 1993, S. 43) Carp & Carp (ebd. S. 295) lehnen sich in der Unterscheidung von Bedürfnissen an die hierarchisch gegliederte Bedürfnispyramide von Maslow (1978) an. Sie differenzieren in: • „life-maintenance needs“, oder Basisbedürfnisse, die das Bedürfnis nach einer selbstständigen Lebensführung ausdrücken und • „higher-order needs”, die sogenannten Wachstumsbedürfnisse. In Anlehnung an Lawton verstehen Carp & Carp (1994, S. 291) unter Kompetenz der Person ihre Gesundheit und die sensomotorischen und kognitiven Fähigkeiten. Die Umwelt wird sowohl als Barriere als auch als Ressource gesehen. 2.5.2.1 Partialmodell 1 - das Komplementaritätsmodell Im Partialmodell 1 steht das Grundbedürfnis nach selbstständiger Lebensführung im Mittelpunkt. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses hängt ab vom Passungsgrad zwischen der Fähigkeit der Person zur selbstständigen Haushaltsund Lebensführung im Sinne der Alltagskompetenz (ADL/iADL) sowie den physischen und suprapersonalen Umweltmerkmalen. Diese Merkmale können sowohl als Ressource oder als Barriere fungieren und die selbstständige Lebensführung unterstützen oder behindern. 21 Bei individuellen Defiziten ist eine ressourcenreiche und somit unterstützende Umwelt zur Befriedigung des Basisbedürfnisses notwendig. Die Unterstützung kann beispielsweise durch Wohnungsanpassungsmaßnahmen, prothetische Mittel und soziale Dienste erreicht werden. Bei ausgeprägter Kompetenz kann die Umwelt durchaus Barrieren aufweisen, die sich dann aber nicht negativ auf die selbstständige und zufriedenstellende Lebensführung auswirken. Im Teilmodell 1 ergibt sich Kongruenz - als Voraussetzung der selbstständigen Lebensführung - als Komplementarität von Person- und Umweltmerkmalen. 2.5.2.2 Partialmodell 2 - Das Ähnlichkeitsmodell Im Teilmodell 2 ist die Person-Umwelt-Interaktion auf die Erfüllung von „higherorder needs“ gerichtet. Diese sind nach Carp & Carp (1984, S. 295 f): - Affiliation (Anschlussmotiv) - - Similarity (Ähnlichkeit in Bezug auf Alter, Geschlecht, sozialem Status) Harmavoidance (Schutz vor Kriminalität, Unfällen, Krankheit, etc.) Noxavoidance (Lärm, Luftverschmutzung etc.) Privacy (Privatheit) - Esthetics (z.B. Ästhetik der Landschaft, der Architektur etc.). - Kongruenz, d.h. die Passung zwischen individuellen Bedürfnissen der Person und den Umweltmerkmalen, wird als Ähnlichkeit von Personen- und Umweltmerkmalen konzipiert. Diese Ähnlichkeit bezieht sich auf die oben aufgeführten „higher-order needs“. Bei dieser Konzeption spielt es keine Rolle, ob eine Person ein geringes oder ein großes Bedürfnis nach Privatheit hat, bzw. es wird nicht nach einer Umwelt gefragt, die viel oder wenig Privatheit erlaubt. Der entscheidende Punkt ist, dass zwischen Person und Umwelt eine Passung besteht. Dies bedeutet, dass z.B. einer Person mit hohem Bedürfnis nach Privatheit eine Umwelt gegenüberstehen sollte, die so ausgestattet ist, dass sie dieses Bedürfnis befriedigt. Je ähnlicher folglich die Bedürfnisse der Person und die Beschaffenheit der Umwelt sind, desto größer ist der Passungsgrad zwischen diesen. Die Passung wirkt sich - wie auch in Teilmodell 1 - positiv auf die Lebenszufriedenheit und auf die psycho-physische Gesundheit aus. Sie trägt dazu bei, dass eine selbstständige Lebensführung aufrecht erhalten werden kann. Carp & Carp (1984, S. 317f) nennen modifizierende Faktoren, die die PersonUmwelt-Interaktion und somit die Kongruenz beeinflussen können. Diese sind 22 z.B. der Gesundheitszustand, die soziale Unterstützung, Bewältigungsstrategien, die Kontrollüberzeugung, das Kompetenzerleben und Lebensereignisse. In Bezug auf die beiden Wohnformen wird dieses Modell in dieser Untersuchung eingesetzt, um zu eruieren, welche Bedürfnisse für den Umzug in die jeweilige Wohnform ausschlaggebend waren, und ob durch den Umzug eine Passung hinsichtlich der Komplementarität oder der Ähnlichkeit erreicht werden konnte. 23 3 Empirische Untersuchung 3.1 Fragestellung der Untersuchung Ziel dieser Studie ist es, ein gemeinschaftsorientiertes Wohnprojekt unter dem Aspekt des selbstständigen Wohnens im Alter zu untersuchen und deskriptiv auszuwerten. In diesem Zusammenhang wird sowohl die räumliche als auch die soziale Umwelt der Bewohner analysiert. Anschließend werden die Befunde des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes mit den Ergebnissen aus Studien zum Betreuten Wohnen verglichen. Folgende Fragestellungen sind für den Vergleich von Interesse: • Wie setzt sich die Bewohnerstruktur in einem gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt und beim Betreuten Wohnen zusammen? Gibt es diesbezüglich Unterschiede? • Welches sind die Motive für den Einzug in die jeweilige Wohnform? • Welche Erwartungen sind mit der Entscheidung für den Umzug in die jeweilige Wohnform verbunden und wurden sie erfüllt? • Mit wessen Unterstützung rechnen die Bewohner der beiden Wohnformen im Fall von längerer Krankheit? 3.2 Methode und Vorgehensweise Um Informationen über die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes zu gewinnen, wurde anhand von Literatur1 und mit Hilfe eines Experteninterviews ein Fragebogen entwickelt. Dieser Fragebogen diente als Leitfaden für das qualitative Interview. Zusätzlich wurden Fragen zur Analyse des sozialen Netzwerkes in den Fragebogen aufgenommen, um das Beziehungsnetz und das soziale Unterstützungspotenzial zu analysieren und die sozialen Aktivitäten zu erfragen. 3.2.1 Methode der ego-zentrierten Netzwerkanalyse Die Netzwerkanalyse ist ein Instrument zur Analyse sozialer Strukturen. Aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, die zur Analyse verschiedenster Netz- 1 (Behrens & Brümmer, 1997; Brech, 1999; KDA, 2000a/b; MFJFG, 2000: Osterland, 2000) 24 werktypen eingesetzt werden können, wurde die Methode der ego-zentrierten Netzwerkanalyse ausgewählt. Das ego-zentrierte Netzwerk ist ein persönliches Netzwerk, d.h. es werden Daten von einzelnen Akteuren - den sogenannten Egos - erhoben. In dieser Untersuchung ist die Größe des Netzwerkes als Indikator für die soziale Integration von Bedeutung. Ebenfalls interessiert der Beziehungstyp, d.h. zu welcher Art von Personen (Verwandte, Freunde, Bekannte etc.) Ego Beziehungen unterhält. Die ego-zentrierte Netzwerkanalyse war ohne großen Aufwand im Wohnprojekt durchzuführen und konnte gut in den Fragebogen integriert werden. Diese Methode zeigt nur die Beziehungen von Ego zu den genannten Personen und bildet nicht die wechselseitigen Beziehungen innerhalb der Gruppe ab. Für die Analyse von unterschiedlichen Positionen und Rollenverflechtungen ist sie nicht geeignet (Jansen 1998, S. 63). Die Abgrenzung der Untersuchungseinheit im Wohnprojekt wurde durch die Vereinsvorsitzende getroffen. Sie gab die Namen der Personen weiter, die sich für ein Interview bereit erklärten. Zur Erhebung des ego-zentrierten Netzwerkes wurden diverse Namensgeneratoren verwendet. Namensgeneratoren sind Fragen, die die Nennung von Namen provozieren, wie z.B. „Wer würde Sie versorgen, wenn Sie einmal länger krank wären?“ „Ego“, als befragte Person, konnte eine beliebig große Zahl „Alteri“ nennen. Alteri sind die Personen, zu denen eine Beziehung besteht (z.B. „Tochter Angelika“). Mit Hilfe des sogenannten “bull’s eye“-Modells, einem von Kahn & Antonucci (1980, S. 272) entworfenen grafischen Modell, wurden die Bewohner gebeten, in einem vorgefertigten Schema, das aus drei konzentrischen Kreisen besteht und deren Mittelpunkt die befragte Person darstellt, ihre Netzwerkmitglieder den einzelnen Kreisen zuzuordnen. Im innersten Kreis sollte die befragte Person (Ego) diejenigen Personen (Alteri) einordnen, zu denen eine sehr enge Verbindung besteht und die ihr am wichtigsten sind. Der mittlere Kreis sollte die Personen umfassen, zu der Ego eine nicht ganz so enge Bindung hat, aber die sie doch auch als noch wichtig betrachtet. Der äußerste Kreis sollte die Personen wiedergeben, die weniger eng zur Person stehen, aber doch noch wichtig sind. Auf diese Art werden die emotionalen Beziehungen abgefragt. Die Namensgeneratoren wurden aus der SIMA-Studie von Töpfer et al. (1998, S. 143) übernommen und an den Untersuchungsgegenstand angepasst. 25 Der Fragebogen, der als Interviewleitfaden diente, ist wie folgt gegliedert: • Fragen zur Wohnsituation • Bewertung des Wohnumfeldes • Motive/Erwartungen • Gegenseitige Hilfestellung im Wohnprojekt • Fragen zum sozialen Netzwerk • Fragen zum Wohnalltag • Persönliche Daten. Nur die im beiliegenden Fragebogen mit Stern (*) gekennzeichneten Fragen gehen in die Auswertung ein. Um die Verständlichkeit der wohnprojektspezifischen Fragen zu überprüfen, wurde das erste Interview als Probeinterview verwendet. Es zeigte sich, dass alle Fragen (bis auf die Frage 8.1 im Fragebogen) gut verständlich waren und der Fragebogen mit der modifizierten Frage (vgl. 3.7.2 „Soziale Aktivitäten“ - 1. Abschnitt) eingesetzt werden konnte. 3.2.2 Zugang zum Projekt und Durchführung der Befragung Anlässlich eines Wohnprojekttags konnte der Kontakt zur Vereinsvorsitzenden des untersuchten Wohnprojektes geknüpft werden. Mit einem Anschreiben wurde um Unterstützung für die Untersuchung gebeten und die telefonische Kontaktaufnahme angekündigt. Das Interesse für die Studie war anfänglich verhalten, da „zu viel geschrieben und nichts umgesetzt“ würde (Interview 11). Nach mehrmaligem Nachfragen gab die Vereinsvorsitzende Namen und Telefonnummern von 12 Personen bekannt, die sich für die Befragung gemeldet hatten. Bei der Terminvereinbarung erklärten sich 10 von den 12 genannten Personen zur Befragung bereit. Die Aussagen in den Interviews deuten darauf hin, dass nur die „Integrierten“ (Interview 5) für ein Interview von der Vereinsvorsitzenden vorgeschlagen wurden. Es konnte nicht geklärt werden, ob alle Bewohner/innen von der geplanten Studie in Kenntnis gesetzt worden waren oder ob eine Selektion durch die Vereinsvorsitzende stattfand. Da keine Dokumente über das Wohnprojekt bezüglich der Entstehungsgeschichte, Planung des Hauses, Vereinsaktivitäten, Satzung, Belegungsmodalitäten etc. zu erhalten waren, wurde mit der 1. Vereinsvorsitzenden, die als Initiatorin, Vorsitzende und Bewohnerin die Rolle der Expertin inne hat, ein Exper- 26 teninterview geführt. Aus terminlichen Gründen fand das Interview per Telefon statt und wurde protokolliert. Die Bewohnerinterviews wurden auf Band aufgezeichnet. Es sind nur diejenigen Interviewpassagen transkribiert, die in Zusammenhang mit der Fragestellung stehen. Dabei werden die Zitate wörtlich übernommen. Die in Klammern gesetzten Worte in den Zitaten werden zur besseren Lesbarkeit von der Verfasserin hinzugefügt. Von den insgesamt 10 Studienteilnehmern wurden fünf alleinstehende Frauen, drei alleinstehende Männer sowie ein Ehepaar interviewt. Die Ehepartner wurden jeweils separat zu ihrem sozialen Netzwerk befragt, um eventuelle geschlechtsspezifische Unterschiede des sozialen Netzwerkes zu ermitteln. Neun der 10 Interviews fanden in der jeweiligen Wohnung statt. Ein Interview wurde im Gemeinschaftsraum durchgeführt. Die Bewohner/innen wurden vor Beginn der Befragung über den Inhalt der Untersuchung und den Verbleib der Daten informiert und ihnen wurde Vertraulichkeit zugesichert. Die Interviews wurden gemäß dem Aufbau des Fragebogens geführt, der als Leitfaden diente. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. 3.3 Beschreibung der Stichprobe Die Stichprobe setzt sich aus 10 Personen zusammen. Für den Vergleich des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes mit dem Betreuten Wohnen wurden allerdings nur die Bewohner über 60 Jahre herangezogen. Die 10 interviewten Personen sind zwischen 33 und 81 Jahre alt. Das durchschnittliche Alter liegt bei 62,8 Jahren. Bei den sechs Personen über 60 liegt das Durchschnittsalter bei 76 Jahren. Sechs Personen (60 %) sind Frauen und vier Personen (40 %) sind Männer. Von den 10 Befragten haben zwei Personen (20 %) eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit, leben aber bereits seit Jahren in Deutschland. Zwei Befragte (20 %) sind miteinander verheiratet und acht (80 %) sind alleinlebend. Davon sind vier (40 %) verwitwet, drei (30 %) ledig und eine Person (10 %) geschieden. Sieben von den zehn interviewten Bewohnern zogen bei Fertigstellung des Hauses im Oktober 2001 ein. Zwei Wohnungen wurden seitdem von einer 27 Familie und einer alleinstehenden Person neu belegt. Die Fluktuation war durch Tod bzw. durch berufsbedingte Mobilität bedingt. Alle Bewohner waren vor ihrem Einzug Mieter und haben diesen Status auch in diesem Wohnprojekt beibehalten. Die frühere Wohnungsgröße der Personen, die alleine lebten, lag bei ca. 35-39 qm und entspricht in etwa der jetzigen Wohnungsgröße von ca. 40 qm. Die verwitweten Personen lebten vor Einzug in das Mehrgenerationenhaus in ca. 72 qm großen Wohnungen und reduzierten ihre Wohnfläche auf 40 qm. Die junge Familie mit einem dreijährigen Kind lebte vorher in einer 33 qm großen Wohnung und vergrößerte sich auf 73 qm. 3.4 Ergebnisdarstellung - Gemeinschaftsorientiertes Wohnprojekt 3.4.1 Entstehungsgeschichte und Beschreibung des Projektes Der Verein ging aus der Seniorenbewegung der Grauen Panther hervor. Die Gründerinnen des Vereins hatten sich mit der Situation des Wohnens im Alter - insbesondere aber mit der Situation in den Altersheimen - auseinander gesetzt und gesehen, wie die „Menschen dort total vereinsamen“ (Interview 11). Da das Altwerden in einem Altersheim für sie nicht in Frage kam, gründeten sie 1993 einen Verein mit dem Ziel, Wohnalternativen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu schaffen. Die Objektsuche gestaltete sich schwierig. Zunächst wollten die Vereinsmitglieder ein Objekt kaufen. Die angebotenen Häuser waren jedoch für ein Wohnprojekt räumlich nicht geeignet oder nicht bezahlbar. Nach acht Jahren vergeblicher Suche nach einem geeigneten Wohnhaus wurde klar, dass dies von den Vereinsmitgliedern nicht zu finanzieren war. Schließlich kam es zu einer Kooperation zwischen dem Verein und einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die mit diesem Wohnprojekt ein Pilotprojekt im sozialen Wohnungsbau initiierte. Im Herbst 2001 wurde das freistehende Mehrfamilienhaus, bestehend aus drei Stockwerken und ausgebautem Dachgeschoss, fertig gestellt und bezogen. Jeder Bewohner hat einen eigenen Mietvertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft. Das Belegungsrecht liegt beim Verein. In der Regel dürfen Personen, die öffentlich geförderte Wohnungen bewohnen, bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Die Mitglieder des Vereins verfügen jedoch teilweise über höhere Einkommen. Um allen Vereinsmitgliedern das Wohnen in der Gemeinschaft zu ermöglichen, wurden die Einkommensgrenzen „aufgeweicht“, d.h. nach oben gesetzt. Die Bewohner/innen, die wesentlich über der Einkom- 28 mensgrenze liegen, bezahlen eine Fehlbelegungsabgabe. Zum Bezug der Wohnung ist ein Wohnungsberechtigungsschein2 erforderlich. Des Weiteren ist die Mitgliedschaft im Verein Voraussetzung für den Einzug und das Wohnen im Wohnprojekt. Das Ziel des Wohnprojektes ist es, „ein selbstbestimmtes Leben für alte und junge Menschen, für Familien und Alleinstehende auf der Basis gegenseitiger Hilfeleistung mit Schwerpunkt Alterswürde und Sorge für die Älteren“ zu ermöglichen (Faltblatt des Vereins). Die gegenseitige Hilfestellung ist eine moralische Verpflichtung und sollte auf freiwilliger Basis erfolgen, da sie nicht als Bedingung im Mietvertrag fixiert werden kann. Der Verein umfasst zur Zeit 127 Personen. Die Mitglieder sind meist weiblich, alleinlebend und älter als 55 Jahre. Ende 2004 hat eine zweite Wohngruppe des Vereins, bestehend aus sechs Personen, Wohnungen bezogen, die in eine größere Wohnanlage eingestreut sind. Ein weiteres Gemeinschaftsprojekt in einem innerstädtischen Viertel ist bereits in Planung und soll Ende 2006 bezugsfertig sein. Ein Merkmal von gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten ist die Mitwirkung der zukünftigen Bewohner/innen bei der Planung des Projekts. Der Planungsprozess war zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit der Wohnungsbaugesellschaft jedoch bereits weitgehend abgeschlossen. Soweit wie möglich, wurden die zukünftigen Bewohner/innen noch an der Planung beteiligt. Die Entscheidung über Fenster in Küche oder Bad, Dusch- oder Badewanne sowie Art der Bodenbeläge konnten sie selbst treffen. Sie setzten den Einbau eines Aufzugs in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus durch. Des Weiteren bestanden Sie auf einen Gemeinschaftsraum, der allerdings nur anstelle des ursprünglich geplanten Trockenraumes im Keller Platz fand. Die zum Gemeinschaftsraum gehörende Gästetoilette befindet sich aus Platzgründen im 2. Stockwerk. Der Verein war froh, dass das Wohnprojekt endlich realisiert werden konnte und „...äußerte keine Wünsche, die nicht realisierbar gewesen wären. Aber um den Gemeinschaftsraum mussten wir ganz schön kämpfen, da ja über das soziale Wohnungsbauprogramm kein Gemeinschaftsraum bezahlt und gefördert wird, mussten wir den Trockenraum hierfür nehmen.“ (Interview 11) 2 Ein Wohnungsberechtigungsschein berechtigt zum Bezug einer öffentlich-geförderten Wohnung. Die Ausstellung ist einkommensabhängig. 29 3.4.2 Objektive Deskription der Wohnbedingungen Umweltbedingungen, wie die Ausstattung der Wohnung und der Wohnanlage, Naherholungsmöglichkeiten, der Anschluss an das öffentliche Nahverkehrsnetz, die Entfernung von der Wohnung zu Geschäften, Ärzten und soziokulturellen Einrichtungen - all diese Faktoren wirken sich auf das Verhalten und Erleben des älteren Menschen in verstärktem Maße aus. Deshalb folgt zunächst die Beschreibung der räumlichen Umwelt, um anschließend das subjektive Urteil der Bewohner in Bezug auf Barrierefreiheit und Wohnumfeldqualität einzuholen. 3.4.2.1 Merkmale des halböffentlichen Wohnumfeldes Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das freistehende Wohnhaus. Abb. 3: Das Wohnhaus (Nord-Ost-Ansicht und Südansicht) Die Größe der insgesamt 16 Wohnungen ist wie folgt: • 13 Appartements in der Größe von 39-40 qm • Eine Drei-Zimmer-Wohnung • Eine Vier-Zimmer-Wohnung • Eine Fünf-Zimmer-Wohnung Die Appartements mit ca. 40 qm Wohnfläche bestehen aus einem WohnSchlafraum und einer Kochnische, die je nach Grundriss teilweise mit bzw. ohne Fenster ausgestattet ist und zum Wohnraum hin offen ist. Die besichtigten Badezimmer der befragten Bewohner sind innenliegend und nicht barrierefrei und wurden (auf Wunsch der Bewohner/innen) mit einer Duschwanne ausgestattet. Ein Abstellraum in der Wohnung ist nicht vorhanden. Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse bzw. einen Balkon. Das Haus wurde nicht nach den Richtlinien der DIN 18 025 - Teil 1 für barrierefreie Wohnungen gebaut. Zum Hauseingang führen zwei Stufen sowie eine 30 Rampe für Rollstuhlfahrer und für Kinderwägen. Die Rampe wurde nachträglich errichtet, als eine Rollstuhlfahrerin in das Projekt einzog. Am unteren Ende der Rampe wurde Kopfsteinpflaster ausgelegt, was die Befahrbarkeit für Rollstuhlfahrer erschwert. Im Haus befindet sich ein Aufzug, der alle Etagen miteinander verbindet und von der Eingangstüre ebenerdig zu erreichen ist. In einem dreigeschossigen Haus gehört ein Aufzug nicht zur Standardausstattung und wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Bewohner/innen eingebaut. Die Terrassen bzw. die Balkone sind nicht schwellenlos erreichbar. Im Falle der Rollstuhlfahrerin wurden Wohnungsanpassungsmaßnahmen durch das Anbringen einer mobilen Rampe von der Wohnung zur Terrasse vorgenommen. Der Gemeinschaftraum liegt im Keller und ist normalerweise verschlossen, da sich dort auch das Vereinsbüro befindet. Der Schlüssel wird bei Bedarf von der 1. oder 2. Vereinsvorsitzenden ausgegeben. Dieser ca. 40 qm große Raum ist ausgestattet mit einer Küchenzeile mit Spülmaschine, einem großen runden Holztisch, einem großen Bücherregal mit vielen Büchern und einer Büroecke mit Telefon, PC und Regalen. Er wird für die offiziellen Bürostunden des Vereins, die zweimal wöchentlich zwei Stunden abgehalten werden, benutzt. Des Weiteren finden dort Vereinsaktivitäten wie Vereins- und Bewohnerversammlungen, Brunch, Malkurse, Geburtstagsfeiern und Kaffeetrinken statt und die älteren Bewohner/innen setzten sich dort auch manchmal mittags zum gemeinsamen Essen zusammen. Der Raum wird nicht anderweitig vermietet. Aufgrund der Kellerlage ist der Raum dunkel und verfügt nur über kleine Lüftungsschächte. Der Garten ist für alle Hausbewohner zugänglich und wird zum geselligen Zusammensitzen, Gärtnern, Grillen und als Spielwiese benutzt. Neben der Rasenfläche haben die Bewohner Blumenbeete angelegt. Drei Terrassen grenzen an den Garten an. Zwischen diesen Terrassen gibt es keine Abtrennung und keinerlei Sichtschutz. Auch ist keine Abgrenzung zur übrigen Gartenfläche vorhanden. Im Sommer finden die wöchentlichen Treffen der Älteren auf der Terrasse einer Bewohnerin statt. Der sonntägliche Brunch wird im Sommer ebenfalls im Garten veranstaltet, da der Gemeinschaftsraum im Keller dann zu kühl und zu dunkel ist. Auch Grillfeste werden von Zeit zu Zeit von den Hausbewohnern organisiert. 31 3.4.2.2 Merkmale des öffentlichen Wohnumfeldes Das Haus steht auf einem Eckgrundstück am Stadtrand und grenzt an eine vierspurige Ausfallstraße. Es ist umgeben von Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern des freien Wohnungsbaus sowie von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus mit hohem Migrantenanteil. Die Wohnanlage ist von Naherholungsgebieten umgeben. In ca. 10 Gehminuten ist eine große parkähnliche Freifläche zu erreichen. Zwischen den umliegenden Häusern befinden sich Grünflächen und Kinderspielplätze mit Sitzbänken. Sportplätze sind ebenfalls in der Nähe und in 5-minütiger Entfernung mit dem Bus gibt es ein Winter- und Sommerbad. Weitere Parkanlagen sind in 30-40 Minuten zu Fuß erreichbar. Das Haus ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Ca. 20 Meter vom Hauseingang entfernt liegt eine Bushaltestelle mit zwei bzw. in Schulzeiten drei Buslinien, die im 10-Minuten-Takt zur U-Bahn- bzw. S-Bahn-Haltestelle und zu Einkaufszentren fahren. Auf einer der drei Buslinien verkehrt im 20-MinutenTakt ein rollstuhlgeeigneter Niederflurbus. Am Sonntag ist der Takt des Busnetzes etwas ausgedünnt. Die einzige Einkaufsmöglichkeit, die fußläufig unter 10 Minuten zu erreichen ist, ist eine Tankstelle mit angeschlossenem „Shop“ auf der gegenüberliegenden Seite der Ausfallstraße. Zu Fuß kann eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Baumarkt in ca. 20 Minuten erreicht werden. Der Weg führt entlang der stark befahrenen vierspurigen Straße und eine gewisse Steigung ist zu überwinden, da die Straße eine breite Bahntrasse überquert. Die vielfältigste Infrastruktur ist mit dem Bus in 10 Minuten zu erreichen. Dort gibt es eine Post, Banken, Ärzte, Apotheken, Optiker, Hörgeräteakustiker, Drogerie, Friseur, Schuh- und Bekleidungsgeschäfte, Bäckerei, Metzgerei, Lebensmittelmärkte und ein Café. Eine Kirche und ein Krankenhaus befinden sich ebenfalls dort. Für die Fahrt zu diesen Einrichtungen befindet sich die Bushaltestelle direkt vorm Haus. Bei der Rückfahrt nimmt der Bus einen anderen Verlauf und hält ca. 500 m vom Haus entfernt. Die Bewohner nehmen für diese Entfernung meist einen Umweg von ca. 15 Minuten in Kauf, indem sie in eine andere Buslinie umsteigen, die dann wieder vor dem Haus hält. 32 3.4.3 Subjektive Bewertung der Wohnbedingungen durch die Bewohner Auf welche Art und Weise sich die Wohnbedingungen auf das Erleben und Verhalten des Menschen auswirken, ist nicht nur abhängig von den objektiv vorhandenen Gegebenheiten der sozial-räumlichen Wohnumwelt, sondern insbesondere davon, wie der Mensch seine Umwelt wahrnimmt und erlebt. In dieser Untersuchung liegt der Fokus weniger auf der Bewertung der Wohnung und der halböffentlichen Bereiche (Garten, Gemeinschaftsraum) als vielmehr auf der subjektiven Beurteilung der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit der Wohnung und der Gegebenheiten des Wohnumfeldes (Infrastruktur, Naherholung, Verkehrsanbindung). Wie im Kapitel 2.4.1 „Erreichbarkeit und Zugänglichkeit“ näher erläutert, wirken sich Defizite oder Barrieren im räumlichen Wohnumfeld negativ auf die Nutzung dieser Räume aus und können sich bei älteren Menschen mit altersbedingten Einbußen als Nutzungsbarrieren erweisen, die die selbstständige Haushaltsführung erschweren. Der Punkt wird in diese Arbeit aufgenommen, um zu analysieren, wie die unterschiedlich alten Bewohner des gemeinschaftsorientierten intergenerativen Wohnprojektes die Merkmale des Standortes wahrnehmen und bewerten und ob die Bewohner Wege finden, wahrgenommene räumliche Defizite durch soziale Ressourcen ihres Wohnumfeldes zu kompensieren. Die Interviewpartner/innen wurden gebeten, ihr Wohnumfeld im Hinblick auf die Verkehrsanbindung, die Nähe zu Grünflächen, die Wohnlage, die barrierefreie Zugänglichkeit der Wohnung sowie die Erreichbarkeit der Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten subjektiv zu bewerten. Die Bewertung wurde anhand einer 4-stufigen Skala (3 = sehr gut, 2 = gut, 1 = befriedigend, 0 = unbefriedigend) vorgenommen und die verbalen Erläuterungen wurden auf Tonband festgehalten und ausgewertet. (Allgemeine Anmerkung: Alle Werte und Prozentangaben in den folgenden Darstellungen werden generell auf ganze Zahlen auf- bzw. abgerundet). 33 Häufigkeiten in % 80 60 sehr gut gut zufriedenstellend schlecht 40 20 Abb. 4: N Ve rk eh r sa nb . ah er ho lu ng Ba rri er ef re ih . W oh nl ag Ei e nk au fs m ög l. 0 Bewertung des Wohnumfeldes (n = 10) Die Abbildung zeigt, dass die Verkehrsanbindung sowie die Naherholungsmöglichkeiten mit „gut“ bzw. „sehr gut“ bewertet werden. Diese Bewertungen stehen in Einklang mit der tatsächlichen Ausstattung, die oben unter Punkt 3.4.2.2 „Merkmale des öffentlichen Wohnumfeldes“ bereits näher beschrieben wurde. Die barrierefreie Zugänglichkeit der Wohnung wird von 70 % der Bewohner mit „sehr gut“ und von 30 % mit „gut“ bewertet. Bei diesem Item denken die Bewohner an den Aufzug und an die nachträglich eingebaute Rampe für Rollstuhlfahrer. Eine Bewohnerin ergänzt ihre Bewertung: „...ja da haben wir ja nen Fahrstuhl - den ham sie ja hier genehmigt bekommen. Das ist ja optimal. Stauraum hab ich im Keller und da muss ich ja viel runterbringen. Und da kann ich bis in den Keller runterfahren - grade für ältere Leute - wie gesagt, ich kann von mir noch sagen, ich bin noch gut beweglich, aber ich werde das sicher gut empfinden, wenn es nicht so gut geht. Und für unsere behinderte Dame haben sie sogar eine Rampe gebaut, nachträglich - denn man weiß ja auch nicht, man kann ja auch mal...“ (Interview 1) Die Wohnlage wird von 10 % mit „sehr gut“ und von 60 % mit „gut“ bewertet. Von den 30 %, die die Wohnlage mit „zufriedenstellend“ bewerten, leben zwei Drittel in einer Wohnung, deren Fenster ausschließlich auf die vierspurige Ausfallstraße ausgerichtet sind. Sie klagen über den Lärm der anfahrenden Autos und Motorräder an der Ampel und empfinden dies insbesondere im Sommer als sehr belastend. Das andere Drittel hat das Gefühl, „in der Pampa“ (Interview 10) zu leben, da das Wohnhaus am Stadtrand liegt und sich keinerlei kulturelle oder infrastrukturelle Einrichtungen in unmittelbarer Nähe befinden. 34 Die Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten beurteilen die Bewohner/innen ambivalent. 20 % bewerten sie mit „sehr gut“, 40 % mit „gut“, 30 % mit „zufriedenstellend“ und 10 % mit „schlecht“. Dieser Aspekt wird in der nächsten Darstellung genauer betrachtet, wenn die subjektive Bewertung nach Altersgruppen differenziert wird. Häufigkeiten in % 100 80 sehr gut gut zufriedenstellend schlecht 60 40 20 0 30-50 Abb. 5: 51-60 61-70 71-80 81-90 Bewertung der Einkaufsmöglichkeiten nach Altersgruppen Die Anzahl der Personen in den verschiedenen Altersklassen setzt sich wie folgt zusammen: In den Altersgruppen 30-50, 51-60 und 61-70 sind jeweils zwei Personen, die Gruppe der 71-80-jährigen beinhaltet drei Personen und die der 81-90-jährigen eine Person. Dieses Diagramm zeigt, dass die Einkaufsmöglichkeiten sowohl von den jüngeren als auch von den älteren Bewohnern mit „zufriedenstellend“ und „schlecht“ beurteilt werden. Von der Altersgruppe 30-50 bewerten je 50 % die Einkaufsmöglichkeiten als zufriedenstellend bzw. schlecht. Diese Aussage ist darauf zurückzuführen, dass es sich um junge Leute mit einem Kleinkind handelt, die es ähnlich wie die älteren Menschen (vgl. Altersgruppe 71-90) beschwerlich finden, für die Deckung des täglichen Bedarfs weite bzw. unattraktive Wege in Kauf zu nehmen. Das folgende Zitat einer jüngeren Bewohnerin begründet die Unzufriedenheit: „Wir haben hier in der Nähe nichts. Also, einfach so zu Fuß hinzuspringen. Für uns geht es noch - wir haben ein Auto, aber für die Ömchen hier im Haus ist es ungünstig.“ (Interview 8) 35 Die 51-60-Jährigen bewerten die Einkaufsmöglichkeiten mit „gut“. Sie verfügen jeweils über die „Ressource Pkw“ und sind somit unabhängig vom Angebot des Wohnumfeldes. Die 71-80-Jährigen sind relativ mobil. Eine Person fährt selbst mit dem Auto, eine andere erledigt ihre Einkäufe mit dem Fahrrad weitgehend selbst, bzw. bittet Nachbarn, schwerere Dinge wie „Blumenerde, Waschpulver oder Öl“ mitzubringen. Die Gruppe der 61-70-jährigen und die der 81-90-jährigen ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ihr subjektiv bewerteter Gesundheitszustand bewegt sich im Bereich „es geht“ und „schlecht“. Herz-Kreislaufprobleme, Schwindel und Gelenkschmerzen werden von dieser Gruppe als gesundheitliche Probleme genannt. Eine ältere Bewohnerin beschreibt die Situation folgendermaßen: „Einkaufsmöglichkeiten, die sind nicht so gut - die sind nicht so gut. In der Nähe haben wir nichts. Ich meine, das ist so eine große Wohnanlage - ich meine das man sich Brot oder Butter kaufen könnte - alle anderen Einkäufe könnte man alle Monate oder zweimal pro Monat machen. Entweder kauft meine Tochter einmal im Monat ein und bringt es mir. Oder mein Nachbar, mit dem fahren wir und kaufen ein. Ich meine die anderen, die nicht so Familie haben, da ist es nicht so einfach.“ (Interview 6) Die subjektive Bewertung des Wohnumfeldes in Bezug auf Verkehrsanbindung, Barrierefreiheit, Wohnlage, Naherholungsmöglichkeiten, Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten zeigt, wie unterschiedlich die einzelnen Bewohner das gleiche Wohnumfeld wahrnehmen. Bei der Bewertung der Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten wird die Interdependenz zwischen der Kompetenz der Person im Sinne von körperlichen Einbußen und der Standortqualität besonders deutlich. Nach dem Komplementaritäts-Modell von Carp & Carp (vgl. Kapitel 2.5.2) ist die Aufrechterhaltung der selbstständigen Lebensweise ein Grundbedürfnis des Menschen. Eine niedrige Standortqualität stellt somit eine Nutzungsbarriere dar, die es zu kompensieren gilt, um die Eigenständigkeit zu bewahren. Die Bewohner des Wohnprojektes kompensieren dieses Defizit je nach Möglichkeit entweder durch die Nutzung des Pkws bzw. des öffentlichen Nahverkehrs oder durch soziale Ressourcen, nämlich durch die Inanspruchnahme ihres informellen sozialen Netzwerkes. Den Bewohnern des untersuchten Wohnprojektes stehen neben den familiären auch nachbarschaftliche Unterstützungspotenziale zur Verfügung, mit denen sie Defizite des Wohnumfeldes kompensieren können. 36 3.5 Einzugsgründe Die subjektiven Beweggründe der Bewohner/innen, die für den Einzug relevant waren, wurden mit der offenen Frage „Welches waren ihre Gründe, in das Wohnprojekt zu ziehen?“ erhoben. Die Gründe für die Beschäftigung mit dem Gedanken, in ein gemeinschaftsorientiertes Projekt zu ziehen, sind im untersuchten Wohnprojekt vielfältig. In dieser explorativen Studie wurden die Antworten auf die offene Frage nach dem Einzugsgrund in Kategorien eingeordnet und Mehrfachnennungen zugelassen. 40 % der Bewohner waren gezwungen, neuen Wohnraum zu suchen. Bei der Hälfte dieser Gruppe war die Wohnung wegen Familienzuwachs zu klein geworden. Der anderen Hälfte war die bisherige Wohnung gekündigt worden. Bezahlbarer Wohnraum und Wohnsicherheit gehören zu den existentiellen Bedürfnissen des Menschen. Insbesondere in Ballungsräumen ist das Angebot an bezahlbarem Wohnraum, der den finanziellen Ressourcen bestimmter Einkommensgruppen entspricht, knapp. Der Einzug in das Wohnprojekt erfolgte bei diesen Personen nicht in erster Linie aufgrund der Gemeinschaftsorientierung, sondern hatte die Befriedigung des Grundbedürfnisses nach bezahlbarem Wohnraum zum Ziel. Die durch den Tod des Partners zu groß gewordene Wohnung war bei 20 % der Befragten Auslöser, sich mit dem Thema Umzug auseinander zu setzen und nach einer adäquaten Wohnalternative zu suchen. Herr E. beschreibt seine Situation: „Mein Frau ist 2000 gestorben - ich wollt ja - und da war des Haus im Bau und weil ich früher am Bau gearbeitet habe - hab (ich) des immer wieder angeschaut - und als meine Frau dann gestorben ist, hab ich angerufen, ob noch was frei ist. Was tu ich mit einer Drei-Zimmer-Wohnung, mir reicht ein Zimmer.“ (Interview 5) All diese Nennungen wurden unter die Kategorie „wohnraumbedingte Gründe“ subsumiert. Bei 30 % der (älteren) Studienteilnehmer war der Wunsch sehr ausgeprägt, ihre Wohnsituation im Alter so zu gestalten, dass sie auch weiterhin selbstständig und selbstbestimmt leben konnten. Die Gründe für den Einzug sind geprägt von dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit und wurden der Kategorie „Autonomie“ zugeordnet. Frau F. schildert ihre Gedanken: „Ja das war - ich hatte mich schon vorher umgeschaut - ich wollte mich ja verändern und da hab ich gedacht, da war ich ja schon 76 oder 77 - ich dachte, du musst ja 37 irgendwas machen - alleinstehend bin ich. Ich hab gedacht, du musst selbstständig bleiben, damit du niemand zur Last fällst.“ (Interview 1) Die Beschäftigung mit der Veränderung der Wohnsituation impliziert bereits indirekt den Gedanken der antizipierten Vorsorge im Hinblick auf eventuelle Kompetenzeinbußen. Aber nur 10 % nahmen die sich bereits ankündigenden gesundheitlichen Einschränkungen und die nicht mehr optimal an die zu erwartenden Einschränkungen angepasste Wohnumwelt zum Anlass, um durch den Umzug die Umwelt an ihre Kompetenz anzupassen und gleichzeitig das Bedürfnis nach Sicherheit im Bedarfsfall und nach Gemeinschaft zu befriedigen. Allerdings wurde in diesem Fall die Umzugsentscheidung durch eine frei werdende Wohnung im Wohnprojekt vorgezogen. Diese Aussage wurde unter die Kategorie „Vorsorge“ aufgenommen. Bei 30 % der Bewohner beruhte die Beschäftigung mit dem gemeinschaftsorientierten Wohnen und die Entscheidung in das Wohnprojekt einzuziehen auf einem eher politischen Interesse. Sie setzten sich mit der Situation der Altenheime intensiv auseinander und ihr Ziel war, eine alternative Wohnform ins Leben zu rufen, die die Lücke zwischen dem Alleinwohnen und dem Wohnen im Heim schließt und selbstbestimmtes Leben und Wohnen im Alter ermöglichen sollte. Dieses Motiv wird der Kategorie „etwas Neues schaffen“ zugeordnet. Von 50 % wurde der Wunsch nach Gemeinschaft explizit genannt. Insbesondere die älteren Menschen gaben an, „im Alter nicht alleine leben“ oder den „Alltag gemeinsam mit anderen gestalten“ zu wollen. Dieser Einzugsgrund wurde unter der Kategorie „Gemeinschaft“ aufgenommen. Basierend auf den Aussagen wird eine Zuordnung zu fünf verschiedenen Kategorien vorgenommen: • Wohnraumbedingte Gründe • Streben nach Autonomie • Wunsch nach Gemeinschaft • Vorsorge • Wunsch, etwas Neues zu schaffen Um die Einzugsgründe mit denen der Bewohner des Betreuten Wohnens vergleichen zu können, wird aus der Stichprobe des intergenerativen Wohnprojektes die Gruppe der über 60-jährigen und ihre Einzugsgründe getrennt in der 38 folgenden Abbildung betrachtet. Wie bereits oben erwähnt, wurden Mehrfachnennungen zugelassen. Nennungen in % 100% 80% 60% 40% 20% Abb. 6: Vo rs or ge nd e G rü Ex te rn e sc ha ffe n N eu es Au to no m ie G em ei ns ch af t 0% Einzugsgründe der Bewohner ab Alter 60 (n = 6) Wie die Grafik verdeutlicht, ist das Bedürfnis, im Alter nicht alleine, sondern zusammen mit anderen zu wohnen und zu leben, in dieser Gruppe mit 83 % sehr ausgeprägt. Das Bedürfnis nach Autonomie und der Wunsch, etwas Neues zu schaffen, werden jeweils von 50 % der befragten Älteren genannt. Ebenso häufig werden wohnraumbedingte Gründe erwähnt. An letzter Stelle rangiert die Kategorie Vorsorge mit nur 17%. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Einzugsgründe bei den jüngeren und älteren Bewohnern des gemeinschaftsorientierten intergenerativen Wohnprojektes differieren. Spielt bei den jüngeren Studienteilnehmern in diesem Wohnprojekt in erster Linie die Befriedigung des Grundbedürfnisses nach bezahlbarem Wohnraum eine Rolle für den Einzug, so sind die Umzugsgründe bei den älteren Bewohnern eher geprägt durch Veränderungen in ihrer jeweiligen Lebenssituation, wie z.B. dem Tod des Partners. Gleichzeitig kommen die Älteren durch den Umzug Bedürfnissen höherer Ordnung („higherorder needs“) nach, indem sie sich ihren Wunsch nach einem eigenständigen Leben in der Gemeinschaft erfüllen und die Altersphase nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Die unterschiedlichen Einzugsgründe lassen auch auf differierende Erwartungen schließen, die im nachfolgenden Kapitel untersucht werden. 39 3.6 Erwartungen Die Auswertung der Frage „Haben sich ihre Vorstellungen vom Leben in einem Wohnprojekt erfüllt?“ zeigt, dass einige Bewohner keine besonderen Erwartungen an das Projekt hatten. Einige ältere Bewohner äußerten jedoch dezidierte Vorstellungen vom Miteinander von Jung und Alt. Eine Bewohnerin fasst ihre Enttäuschung in Worte: „Na ja, manchmal ärgere ich mich ein wenig über die jungen Mitbewohner. Die - da denk ich mir - die könnten auch mal ein bisschen was beitragen - das stört mich ein bisschen und da denk ich mir, warum, warum tun sie das nicht? Sie sind ja auch in der Gemeinschaft da hier drin. Es ist ja an und für sich ein Gemeinschaftshaus. An und für sich haben wir das ja auch so in der Satzung gehabt - aber es ist - aber leider - also ich meine, wenn man sie braucht - ich will jetzt nicht ganz abwegig - wenn ich z.B. im Garten (bin), da brauch ich mal Blumenerde und da sag ich dann mal zu dem einen, du, kannst du mir (die) mal am Wochenende besorgen - also wenn man sie anspricht, dann sind sie schon mit dabei. Also, die klopfen nicht. Also, die würden mal von alleine kommen und sagen, wie geht’s dir. Aber da kommt nichts hier.“ (Interview 1) Auf die Frage, ob es für die Gemeinschaft besser wäre, wenn Menschen gleichen Alters zusammen wohnen würden, antwortet sie: „Ich würde schon - wir haben es ja schon mit der E. erlebt, die da war - also meine Nachbarin, die ausgezogen ist. Und das war optimal. Da haben wir so das Gefühl gehabt, das ist sehr schön mit den jungen Leuten. Die haben ja auch ein Kind gehabt und das haben wir alles so miterlebt. Also, ich find es ja schon schön mit Alt und Jung. Muss ich schon sagen.“ (Interview 1) Dass die Erwartungen an die jüngeren Menschen im Wohnprojekt nicht ganz kongruent sind mit den Vorstellungen der älteren Menschen, die sich im Wohnprojekt sehr für die Gemeinschaft engagieren, kann auf die unterschiedlichen Lebenssituationen der einzelnen Bewohner/innen zurückgeführt werden. Ein jüngerer Mitbewohner, beschreibt die Situation: „(die) Rentner sind zu Hause. Wenn mal was ist, ist man auf Arbeit oder schläft. Wenn es zu viele sind, die unterstützen, ist es auch nicht gut - ein oder zwei. Es ist Vertrauenssache.“ (Interview 3) Berufstätige, Alleinerziehende, Familien mit Kindern, ältere Menschen haben jeweils unterschiedliche zeitliche Ressourcen, einen anderen Tagesrhythmus und je nach Lebensphase sind sie in andere soziale Beziehungen eingebunden, die für soziale Kontakte entscheidend sind. Jüngere Menschen verbringen in der Regel mehr Zeit außerhalb des Hauses als ältere Menschen, für die die nachbarschaftlichen Beziehungen im Alter eine zunehmend wichtigere Rolle spielen (Borchers, 1998, S. 185). Auch ändert sich im Lebenszyklus das inner- 40 und außerhäusliche Aktivitätsmuster. Im frühen und mittleren Erwachsenalter stehen berufs- und freizeitbezogene Aktivitäten meist im Vordergrund. Diese finden in unterschiedlichem räumlich-sozialen Kontext meist außerhalb der eigenen Wohnung statt. Mit zunehmendem Alter wird die Wohnung dagegen intensiver genutzt. Es wird mehr Zeit für die Haushaltsführung verwendet, spielerische und schöpferische Betätigung erfolgt stärker wohnungs- und nachbarschaftszentriert und Medien werden häufiger genutzt (Saup, 1993, S. 18). Ein zweiter Grund für die enttäuschten Erwartungen der älteren Bewohner/innen liegt in der Belegung. Kurz vor Einzug in das Wohnprojekt revidierten zwei ältere Damen ihre Umzugsentscheidung. Die für sie reservierten Wohnungen mussten kurzfristig an Personen vergeben werden, die bislang keine Beziehungen zum Verein hatten. Obwohl der Verein das Belegungsrecht hat und die Mitbewohner/innen selbst auswählen kann, ist er darin doch etwas eingeschränkt. Da es sich um öffentlich geförderte Wohnungen handelt, kommen nur Bewerber/innen in Frage, die Anspruch auf einen Wohnungsberechtigungsschein besitzen und die die für das Wohnprojekt geltenden „aufgeweichten“ Einkommensgrenzen nicht überschreiten dürfen. Auch für die größeren familiengerechten Wohnungen stehen im Verein selbst keine potenziellen Bewohner/innen zur Verfügung, da die meisten Vereinsmitglieder alleinstehende ältere Frauen sind und somit externe Bewerber genommen werden müssen. Ein jüngerer Mitbewohner sieht diese Belegungsproblematik wie folgt: „Ich denke, die (älteren Bewohner/innen) - die sind ein bisserl unzufrieden mit dieser Konstellation, die sich auch ein bisserl daraus ergibt, das man hier den Sozialwohnungsschein haben muss. Und ohne jetzt irgendwie - da zieht man natürlich auch zu einem bestimmten Prozentsatz ein gewisses Klientel an - von den Rentnern abgesehen - so dass so manchmal nicht ganz unproblematische Fälle hier wohnen. Deshalb wollen sie auch ein Projekt in H., das in drei Jahren fertig ist und das soll nicht einkommensgebunden sein - und da erhoffen sie sich, dass auch andere Leute reinkommen.“ (Interview 9) Die Auswahl der Bewohner erfolgt durch die beiden Vereinsvorsitzenden in Form eines Bewerbungsgesprächs. Sie machen sich den Vorwurf, die Auswahl nicht gut genug getroffen zu haben „Was wir hätten noch machen müssen - besser Aussieben. Da haben wir zu wenig (darauf) geachtet - dass hätten wir noch anders machen müssen. Aber so was lernt man nur durch die Erfahrung.“ (Interview 11) Gerade die älteren Menschen engagieren sich sehr für die Gemeinschaft und gehen von ihrem Selbstverständnis der gegenseitigen Hilfestellung aus. Sie 41 sind enttäuscht über die unterschiedliche Interpretation durch andere Mitbewohner/innen. „Gegenseitige Hilfe ist eine moralische Verpflichtung, das kann man nicht im Mietvertrag festschreiben. Aber die Leute suchen meist nur eine günstige Wohnung. Es wird immer so sein, dass die einen es ganz selbstverständlich machen, den anderen muss man einen Tritt geben.“ (Interview 10) Ein jüngerer Mitbewohner antwortet auf die Frage, ob sich seine Vorstellungen vom Leben in der Gemeinschaft erfüllt hätten, wie folgt: „Ja! Zwang ist nichts. Nicht ankommen und gleich etwas haben wollen, sondern anmelden. Es muss freiwillig sein. Ich kann mich nicht beschweren.“ (Interview 3) Die Erwartungen wurden auch enttäuscht, als sich herausstellte, dass einige Personen psychisch krank bzw. suchtkrank waren, dies vor ihrem Einzug „verschwiegen“ hatten und nun das Projekt zum Teil erheblich belasten, indem sie sich auf die Hilfestellung verlassen, zu der sich insbesondere die älteren Bewohnerinnen verpflichtet fühlen. Für Frau N. haben sich die Erwartungen in Bezug auf Autonomie auf der einen Seite und Gemeinschaft auf der anderen Seite erfüllt. Sie schildert ihre Zufriedenheit: „Ich hab meine kleine Wohnung - ich bin mit mir selber. Ich möchte jetzt nicht wo sein, wo ich mit jemand eine Küche habe, ich bin keine ganz so penible. Da hab ich meinen eigenen Bereich, das ist mir sehr wichtig. Wenn ich alleine sein will, dann kann ich dies. Also, total frei und trotzdem ist man nicht allein.“ (Interview 10) In Anlehnung an das Ähnlichkeitsmodell von Carp & Carp (1984), lässt sich diese Äußerung dahingehend interpretieren, dass eine Passung erzielt wurde zwischen dem Bedürfnis der Person nach Autonomie und Affiliation und einer Umwelt die Eigenständigkeit und Gemeinschaft ermöglicht. (vgl. Kapitel 2.5.2). Die Interviewaussagen zeigen, dass das Wohnprojekt eher von den Vorstellungen der älteren Bewohner geprägt ist, die dieses initiierten und sich wesentlich für die Realisierung eingesetzt haben. Sie haben auch die Vereinssatzung erstellt und die Ziele des Vereins definiert. Wie auch noch in den Kapiteln 3.7.2 „Soziale Aktivitäten“ und 3.7.3 „Vereinsaktivitäten“ aufgezeigt wird, haben die Älteren für sich eine Wohnumwelt gestaltet, die mit ihren Bedürfnissen nach Gemeinschaft aber auch im Hinblick auf Autonomie und Privatheit kongruent ist. Bei den jüngeren Bewohnern, die derzeit in der Hausgemeinschaft leben, scheint das Bedürfnis nach mehr Gemeinschaft mit den älteren Menschen nicht so stark ausgeprägt zu sein. Sie leisten instrumentelle Hilfestellung, wenn es 42 nötig ist und auf Anfrage. Ansonsten gestalten sie ihren Alltag aber meist in der Familie oder außerhalb der Hausgemeinschaft. 3.7 Soziales Netzwerk der Bewohner Mit der Methode der ego-zentrierten Netzwerkanalyse wird die Größe des Netzwerkes in Abhängigkeit von Familienstand und Alter ermittelt und erfragt, von welchen Personen Ego Unterstützung bei längerer Krankheit erwartet. 3.7.1 Netzwerkgröße Insgesamt nennen die 10 befragten Personen des Wohnprojektes 130 Alteri. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 13 Alteri genannt werden bei einer Spannbreite von 5 bis 17 Personen. Betrachtet man nur die Teilstichprobe der sechs Personen über 60 Jahre, so nennen diese insgesamt 70 Alteri und somit kommen auf Ego durchschnittlich 11,7 Alteri. Die Ergebnisse der ego-zentrierten Netzwerkanalyse der Berliner Altersstudie, die die Netzwerkgröße von Menschen ab 65 untersuchte, ergab ein Mittel von 10,9 Netzwerkpartnern (Wagner et al, 1999, S. 310). Somit liegt die Anzahl der Netzwerkpartner des Wohnprojektes leicht über den Werten dieser repräsentativen Studie. Die nachfolgende Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl an Alteri nach Familienstand der Egos. 43 25 21 Anzahl Alteri 20 17 15 10 12 8 5 0 ledig Abb. 7: verwitwet geschieden verheiratet Durchschnittliche Anzahl der Alteri nach Familienstand der Egos 3 (n = 10, Alteri = 130 ) Von den 10 Befragten leben 80 % (8 Personen) alleine. 20 % (2 Personen) sind miteinander verheiratet und mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren im Vergleich zu den anderen interviewten Bewohnern, die alle über 50 Jahre sind, relativ jung. Es zeigt sich, dass Verwitwete und Geschiedene im Mittel deutlich mehr Alteri nennen als Ledige. Dieser Unterschied ist im Wesentlichen auf die verringerte Anzahl der familiären Netzwerkmitglieder der ledigen Befragten zurückzuführen. Eine Determinante, die sich auf die Größe des Netzwerkes auswirkt, ist das interindividuell unterschiedliche Bedürfnis nach sozialen Kontakten bzw. die im Lebenslauf erworbene soziale Kompetenz, Kontakte zu schließen (Borchers, 1998, S. 194). Wie in Kapitel 2.3.1 „Modell des sozialen Konvois“ bereits dargestellt, wirkt sich auch die Einnahme diverser Rollen und Positionen im Lebenslauf (z.B. Ehepartner, Vater oder Mutter, Vereinsmitglied, berufliche Position etc.) unterschiedlich auf die Entstehung und den Bestand von sozialen Netzwerken aus. Wie Kahn & Antonucci (1980) in ihrer Forschungsarbeit zeigen, stellen die Beziehungen zur Familie und zu engeren Verwandten ein relativ stabiles Netzwerk und somit auch ein stabiles soziales Unterstützungspotenzial über die gesamte Lebensspanne dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht die durchschnittliche Anzahl der von Ego genannten Alteri und berücksichtigt dabei den Familienstand. 3 Von den verheirateten Egos werden jeweils 20,5 Alteri genannt. Die Zahl wurde gerundet, deshalb ergeben sich bei der Darstellung 131 Alteri. 44 Familienstand Alter Durchschnittliche Anzahl der verwandten Alteri 30 % ledig ohne Kinder > 50 1,3 10 % geschieden mit Kindern > 50 3,0 40 % verwitwet mit Kindern > 50 4,3 20 % verheiratet mit Kindern < 50 5,5 Tabelle 2: Familienstand von Ego und die durchschnittliche Anzahl an verwandten Alteri Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass Kinderlose über ein relativ kleines familiäres Netzwerk verfügen und somit auch die Zahl der verlässlichen Unterstützungspartner entsprechend gering ist. Diese Lücke kann im Alter kaum kompensiert werden. Es ist aber zu bedenken, dass das Vorhandensein von Familie nicht automatisch auch soziale Unterstützung impliziert, da die vergangene Familienbiografie das Kontakt- und Unterstützungspotenzial wesentlich mitbestimmt (Diewald, 1993, S. 751). Ein Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung zeigt, dass durch den anhaltenden Trend zur Singularisierung in Zukunft weniger soziale Unterstützung aus familiären Netzwerken geleistet werden kann. Folgt man der von Cantor postulierten Rangfolge, so liegen dann die Unterstützungspotenziale bei näheren Verwandten (wie Geschwister, Enkel, Nichten), bei Freunden, Nachbarn und formellen Diensten. Gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten kommt in dieser Hinsicht eine wichtige Funktion zu, da durch die gegenseitige nachbarschaftliche Unterstützung im Projekt fehlende Netzwerkpotenziale teilweise kompensiert werden können. Ob aber nachbarschaftliche Unterstützungspotenziale auch bei längerer Krankheit in Anspruch genommen werden, wird unter Punkt 3.9 „Versorgung im Krankheitsfall“ näher untersucht. In der nächsten Grafik wird der Frage nachgegangen, ob die Größe des Netzwerkes in Zusammenhang mit dem Alter steht. 45 25 Zahl der Alteri 20 15 10 5 0 30 40 50 60 70 80 90 Alter Abb. 8: Durchschnittliche Anzahl der Alteri nach Alter (n = 10) Bei der Gruppe der 10 Befragten zeigt sich, dass die Anzahl der Netzwerkpartner der 50-70-Jährigen (drei ledige und eine verwitwete Person) unter 10 Alteri liegt und sich somit unter dem Mittel für diese Altersgruppe von 11,7 befindet. Das Netzwerk der 71-80-Jährigen ist dagegen relativ groß. Wie aus der Analyse der Beziehungsdauer hervorgeht, hatte diese Altersgruppe bereits vor dem Einzug ein großes Netzwerk, das sich aus Familienmitgliedern und langjährigen Freunden zusammensetzt. Aus den Interviews geht hervor, dass diejenigen Bewohner, die sich sehr für das Wohnprojekt engagieren, durchschnittlich fünf neue Netzwerkpartner aus dem Haus hinzugewonnen haben. Die anderen Altersgruppen nennen jeweils nur drei Personen aus dem Wohnprojekt als neue Netzwerkpartner. Die Größe des Netzwerkes scheint also weniger in Zusammenhang mit dem Lebensalter zu stehen als vielmehr durch den Familienstand, die Netzwerkorientierung und -offenheit der Person geprägt zu sein. Auch Antonucci (1985) stellte - außer bei Hochaltrigen - keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Lebensalter und Netzwerkgröße fest. Wie die Ergebnisse hinsichtlich der Art der Netzwerkpartner und der Größe des sozialen Netzwerkes zeigen, verfügen die Bewohner des Wohnprojektes über ein relativ großes Netzwerk, wobei Ledige ohne Kinder durch das Fehlen von familiären Beziehungen über eine geringere Anzahl an Netzwerkpartnern verfügen. Neben dieser Tatsache ist aber die Größe des Netzwerkes auch von Per- 46 sonenvariablen und den im Lebenslauf eingenommenen Rollen und Positionen abhängig. 3.7.2 Soziale Aktivitäten Zur Erhebung der sozialen Aktivitäten werden die von Göldner (2002) in Anlehnung an die SIMA-Studie (vgl. Töpfer et al., 1998, S. 143) verwendeten Fragen übernommen. Der Zeitraum des nachfolgenden Namensgenerators wurde allerdings von drei Monate auf vier Wochen verkürzt, da es sich im Probeinterview herausstellte, dass es schwierig war, sich an die Aktivitäten der letzten drei Monate zu erinnern. Die Frage lautet: „Bitte sagen Sie mir, welche der folgenden Aktivitäten Sie in den letzten vier Wochen unternommen haben“ (vgl. hierzu Frage 8.1.im beiliegenden Fragebogen). Es wird unterschieden nach innerhäuslichen Aktivitäten • Anzahl Alteri, die Ego besucht haben • Anzahl Alteri, die Ego eingeladen hat und nach außerhäuslichen Aktivitäten • Anzahl Alteri, die Ego besucht hat • Anzahl Alteri, bei denen Ego eingeladen war • Anzahl der Alteri, die Ego außerhalb des Wohnprojektes getroffen hat (z.B. bei einem Spaziergang, kulturellem Ereignis, Restaurant- und Café-Besuch). Um Vergleiche zum Betreuten Wohnen anzustellen, wird nicht die Gesamtstichprobe des intergenerativen Wohnprojektes verwendet, sondern nur die Teilstichprobe der älteren Bewohner ab 60. Bei der Ergebnisdarstellung muss allerdings kritisch angemerkt werden, dass sich ein Zeitraum von vier Wochen für die Auswertung als zu kurz erwiesen hat, da einige Personen aufgrund eigener Krankheit (Erkältung) bzw. der Betreuung einer erkrankten Person im Wohnprojekt weniger Aktivitäten nachgingen als in „normalen“ Zeiten. 47 18% 16% 14% Prozent 12% 10% Verwandte 8% Freunde 6% Nachbarn 4% 2% 0% Besuch bei ego Abb. 9: Ego lädt ein Besuch bei Alteri Einladung bei Alteri Treffen außerhalb Soziale Aktivitäten (n = 6, Alteri = 46) Von den insgesamt 70 genannten Alteri der sechs Bewohner über 60 Jahre unternahmen 66 % (= 46 Personen) soziale Aktivitäten mit den befragten Egos. Es fällt auf, dass die Bewohner/innen des Wohnprojektes sehr viele Aktivitäten zusammen mit Freunden (47 %) und Nachbarn (39 %) unternehmen. Erst an letzter Stelle rangieren Unternehmungen mit Familienmitgliedern (14 %). 11 % der „Besuche bei Ego“, wurden von Nachbarn, 7 % von Freunden und nur 4 % von Familienangehörigen abgestattet. Bei der Aktivität „Ego lädt ein“ ist erstaunlich, dass die untersuchten Egos nur Freunde aber keine Nachbarn und keine Familienangehörigen erwähnen. Dieses Ergebnis ist eventuell auf das Wort „Einladung“ zurückzuführen. Im Interview stellte sich heraus, dass Einladungen einen eher „offiziellen“ Charakter besitzen und weniger an Familienmitglieder als vielmehr an Freunde und Bekannte ausgesprochen werden. Verwandte werden mehr zu Geburtstagen oder an Festtagen eingeladen. Auch bei den außerhäuslichen Aktivitäten „Besuch bei Alteri“ und „Einladungen bei Alteri“ wird deutlich, dass die Bewohner das Zusammensein mit Freunden und Nachbarn bevorzugen und verhältnismäßig wenig mit Familienmitgliedern unternehmen. 48 Jeweils 15 % der „Treffen außerhalb“ werden mit Freunden und Nachbarn unternommen. Der hohe Anteil der Nachbarn bei den außerhäuslichen Unternehmungen ist auf die gemeinsamen Vereinsaktivitäten wie wandern, Ausflüge machen, gemeinsam Essen gehen, Ausstellungen besuchen etc. zurückzuführen (vgl. Punkt 3.7.3 „Vereinsaktivitäten“). Die Präferenz für Freunde und Nachbarn bei sozialen Aktivitäten macht deutlich, dass den verschiedenen Beziehungstypen unterschiedliche soziale Funktionen zugesprochen werden. Während Verwandte eher instrumentelle Hilfe leisten, wie z.B. Einkaufen, Unterstützung im Haushalt und Pflege, gewähren Freunde, Bekannte und Nachbarn vermehrt emotionale Hilfe und Begleitung bei geselligen Aktivitäten und ermöglichen somit soziale Teilhabe. (Diehl 1988, S. 277). Die häufige Nennung von Nachbarn könnte ein Indiz dafür sein, dass das Gemeinschaftsleben im Wohnprojekt die Bedürfnisse nach sozialer Aktivität im Wohnprojekt befriedigt und deshalb die Unternehmungen vermehrt mit den räumlich nahen und altershomogenen Nachbarn stattfinden, die im Alter eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Engel et al. (1996, S. 30) erwähnen, dass Interaktionen mit Freunden eher als neu, abwechslungsreich und spontan empfunden werden, wohingegen Familieninteraktionen häufig als monoton und ritualisiert bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang ist verständlich, dass die sozialen Aktivitäten vermehrt mit Freunden, Bekannten und Nachbarn ausgeführt werden. Eine weitere Interpretationsmöglichkeit für den geringen Anteil an Familienmitgliedern bei sozialen Aktivitäten ist, dass nur bei zwei Drittel der Bewohner die Verwandten in der Nähe wohnen bzw. dass keine Familie mehr vorhanden ist. Im Rahmen der Bonner Gerontologischen Längsschnittstudie (BOLSA) weisen Lehr & Minnemann (1987) im Hinblick auf die oben genannte Thematik auf einen interessanten Aspekt hin - nämlich auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Kompetenz der Person und den von ihr bevorzugten Sozialkontakten. Lehr & Minnemann (1987, S. 87f) zogen für ihre Untersuchung zur „Erklärung der Veränderung von Quantität und Qualität sozialer Kontakte vom 7. bis 9. Lebensjahrzehnt“ die Disengagement-Theorie von Cumming & Henry (1961) heran. Sie stellten fest, dass je nach Persönlichkeitsstruktur und der speziellen Lebens- und Rollensituation älterer Menschen das Ausmaß und die Ausrichtung 49 der Sozialkontakte sowie deren Bewertung variiert. So pflegen insbesondere „kompetente Betagte“, die sich durch einen „höheren IQ, eine größere Interessensvielfalt, besseren Gesundheitszustand, weitreichenderen Zukunftsbezug“ (Lehr & Minnemann, 1979, S. 91) auszeichnen, weniger familiäre Kontakte, ziehen sich aus familiären Rollen wie der Eltern- oder Großelternrolle eher zurück und sind mit dem Rückzug aus familiären Rollen zufrieden. Sie suchen stattdessen vermehrt Kontakte zu Menschen im außerfamiliären Bereich (wie z.B. zu Freunden und Vereinsmitgliedern). Bei Menschen mit Kompetenzeinschränkungen im Sinne von „geringerem IQ, gesundheitlichen Belastungen, geringerer Anregbarkeit, eingeschränktem Zukunftsbezug“ (ebd.), wurde ein gegenteiliges Verhalten festgestellt. Sie ziehen sich aus den außerfamiliären Rollenbezügen zurück, zentrieren ihren Alltag auf häusliche Aktivitäten und pflegen soziale Kontakte verstärkt im Familien- und Verwandtenkreis. Setzt man die Erkenntnisse von Lehr & Minnemann (1987) in Bezug mit den in der Abbildung 9 dargestellten Ergebnissen und vergleicht sie mit den Ergebnissen von Göldner (2002, S. 40), die das soziale Netzwerk der Bewohner/innen in betreuten Wohnanlagen mit dem Aktivitäten-Namensgenerator „Bitte sagen Sie mir, welche der folgenden Aktivitäten Sie in den letzten drei Monaten unternommen haben“ untersuchte, so zeigt sich folgender Unterschied zwischen den Bewohnern der beiden Wohnformen: Im Betreuten Wohnen liegt der Anteil der Familienmitglieder bei den sozialen Aktivitäten (Besuch und Einladung bei Ego, Besuch und Einladung bei Alteri) deutlich höher als derjenige von Freunden, Bekannten und Nachbarn. Nur bei “Treffen außerhalb“ überwiegen die Freunde, Bekannten und Nachbarn geringfügig. Der hohe Stellenwert, der der Familie in der Untersuchung von Göldner bei sozialen Aktivitäten zukommt, könnte mit dem Gesundheitszustand der Bewohner in Zusammenhang gebracht werden, denn 80 % der befragten Bewohner des Betreuten Wohnens gaben gesundheitliche Gründe als Umzugsgründe an (ebd. S. 50). Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Ergebnisse von Göldner und die Ergebnisse dieser Studie methodisch nicht direkt vergleichbar sind, da ein unterschiedlicher Zeitraum für die sozialen Aktivitäten erfragt wurde 50 (vier Wochen beim Wohnprojekt und drei Monate beim Betreuten Wohnen) und zudem die Fragestellung, die der Auswertung zugrunde lag, variierte.4 Die Ergebnisse könnten ein Indiz dafür sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kompetenzgrad der Person und dem Grad des inner- bzw. außerfamiliären Aktivitäts- bzw. Kontaktniveaus in den unterschiedlichen Wohnformen. In beiden Studien wurden allerdings die zusätzlichen Variablen, wie Intelligenzquotient, Zukunftsbezug und Interessensvielfalt, die Lehr & Minnemann (1987) in Zusammenhang mit ihren Schlussfolgerungen brachten, nicht untersucht. Resümierend wird festgestellt, dass die älteren Bewohner/innen des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes soziale Aktivitäten in erster Linie mit Freunden und Nachbarn und weniger mit Familienangehörigen unternehmen. Die hierfür genannten Erklärungsansätze sind vielfältig und umfassen die Kompetenz der Person, die unterschiedlichen sozialen und stimulierenden Funktionen, die den diversen Netzwerkbeziehungen zugesprochen werden sowie die Persönlichkeitsstruktur und die jeweilige Lebenssituation. 3.7.3 Vereinsaktivitäten Neben der gegenseitigen Hilfestellung im Wohnprojekt ist es eine primäre Aufgabe des Vereins, soziale Aktivitäten zu organisieren, damit sich die Mitglieder untereinander besser kennen lernen, um später eigene Wohnprojekte zu gründen bzw. in frei werdende Wohnungen zu ziehen. Die Aktivitäten wie Brunch, Malen und Wandern werden in erster Linie von den älteren Bewohner/innen für die älteren Bewohner/innen und Vereinsmitglieder organisiert. Die nachfolgene Abbildung zeigt die Teilnahme an Vereinsaktivitäten nach Altersgruppe. 4 In dieser Studie fand die Auswertung nach Aktivitäten statt. Göldner wertete nach Beziehungstypen aus. 51 Häufigkeit in % 100 30-50 51-60 61-70 71-80 81-90 80 60 40 20 n Ve re in sa rb ei t Tr ef fe n Ab en dl . an de r W al en M Br un ch 0 Abb. 10: Teilnahme an Vereinsaktivitäten nach Alter Die Grafik zeigt, dass sich die Bewohner/innen der Altersgruppe 30-60 an keinen Vereinsaktivitäten beteiligen, und sich - außer bei der Mitgliederversammlung - auch nicht in die Vereinsarbeit einbringen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Vereinsaktivitäten von älteren Vereinsmitgliedern für ältere Vereinsmitglieder organisiert werden und auf Seiten der jüngeren Mitbewohner andere Interessen vorhanden sind und durch die Berufstätigkeit die Zeit für die Teilnahme fehlt. Unter den jüngeren Bewohnern gibt es - soweit dies aus den Interviews hervorging - keine Untergruppierungen, die sich zu sozialen Aktivitäten zusammenschließen. Dies kann mit der sehr heterogenen Bewohnerstruktur im Wohnprojekt mit nur 16 Einheiten zusammenhängen. Die Bewohner differieren in Bezug auf Alter, Bildung, Ethnie, Familienstand und Einkommen sehr stark. So bedauert z.B. eine jüngere Familie mit Kind, dass es nicht mehr „Gleichgesinnte“ gäbe, wie z.B. „mehrere Familien mit Kindern, mit denen man sich zusammenschließen könnte.“ (Interview 8) Dagegen ist die Teilnahme bei den 71-90-Jährigen bei den verschiedenen Aktivitäten hoch. Die innerhäuslichen Angebote, wie der monatliche Sonntagsbrunch, für den die Bewohner die Verpflegung übernehmen, sowie der 14-tägig stattfindende Malkurs, werden gerne angenommen. Auch die Wanderungen und Ausflüge mit Restaurantbesuch, die im zweiwöchentlichen Rhythmus organisiert werden, finden regen Anklang. 52 Zu den abendlichen Treffen laden die älteren Bewohner spontan die eher altershomogenen Mitbewohner/innen ein. Sie finden in den Wohnungen der älteren Bewohner/innen des Wohnprojektes statt. Frau S: beschreibt dieses Treffen: „und dann sagt man, heut Abend kommen wir mal wieder - und dann treffen wir uns. Dann wird ein Gläschen getrunken und geratscht. Das ist so wie in einer Familie, dass man zusammenkommt.“ (Interview 2) Interessant ist, dass diese Treffen bei der Frage nach den sozialen Aktivitäten weder in der Rubrik „Besuche“ noch „Einladungen“ eingeordnet wurden, sondern nur im Interview erwähnt werden. Die Vereinsarbeit wird in erster Linie durch die beiden Vereinsvorsitzenden mit der Unterstützung der älteren Bewohnerinnen durchgeführt. Vereinzelt arbeiten auch extern wohnende Vereinsmitglieder mit. Dass das Büro des Vereins und somit fast alle (sozialen) Vereinsaktivitäten und die administrativen Arbeiten im Gemeinschaftsraum des Hauses stattfinden, ist für die Bewohner von Vorteil und trägt dazu bei, dass sie je nach Fähigkeiten unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. 3.8 Entwicklungspotenziale im Wohnprojekt Auf die Frage „Wie sehen Sie ihre Rolle in der Hausgemeinschaft?“ antwortet eine hochaltrige Mitbewohnerin: „Ich bin so ziemlich, ja nicht unbedingt Mädchen für alles. Die haben mir so schön langsam die Buchhaltung zugeschoben, obwohl ich keine Ahnung hatte. Aber da hab ich mich mittlerweile schon durchgefressen und da sind ja so viele Sachen die anstehen, und das können die zwei Damen (die Vereinsvorsitzenden) nicht allein bewältigen. Die eine hat ja das soziale Problem5 und die andere muss das ganze überschauen. Korrespondenz mit Vereinsmitgliedern, das mach ich nicht. Das macht die K. Das ist ja mehr telefonisch und die Korrespondenz erledigt sie auch. Mit den Behörden und Finanzen mit dem Steuerberater - es ist viel Arbeit - obwohl der Verein klein ist - es gibt schon immer was zu tun.“ (Interview 6) Weitere Aktivitäten sind Essen für den Brunch zubereiten, Organisation von Ausflügen, Kuchenbacken für Geburtstagsfeiern, Besorgen und Schreiben von Geburtstagskarten, Küchendienst bei Vereinsaktivitäten etc. Diese Aktivitäten tragen dazu bei, dass nicht nur die Kompetenz zur selbstständigen Lebensführung erhalten bleibt (z.B. Kochen). Vielmehr dienen diese Aktivitäten - im Sinne der Definition von Kompetenz nach Kruse (1992, S. 25) dazu, Fähigkeiten und 5 Unter „sozialem Problem“ wird hier die Organisation der sozialen Aktivitäten verstanden. 53 Fertigkeiten zu erhalten, die ein aufgabenbezogenes und sinnerfülltes Leben in einer anregenden Umwelt ermöglichen. Dass sich im Wohnprojekt jeder nach seinen Fähigkeiten und Vorlieben aktiv betätigen kann, verdeutlicht folgende Aussage: „Also, was ich mache - ich koche zum Brunch und der Garten - das ist auch noch mein Ressort. Im Büro da hab ich keine Aufgabe, da mach ich nichts.“ (Interview 1) Die jüngeren und vor allem die männlichen Mitbewohner übernehmen andere Aufgaben, die weniger sozialer als vielmehr instrumenteller Art sind. Sie erledigen den Einkauf schwerer Gegenstände (wie z.B. Blumenerde oder Getränke), helfen Möbel aufzubauen, Löcher zu bohren und Lampen anzubringen, unternehmen Fahrdienste zum Arzt oder ins Krankenhaus oder helfen bei PCProblemen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die älteren Bewohner diejenigen sind, die die sozialen Aktivitäten organisieren, sie an ihren Bedürfnissen ausrichten und sich auch rege daran beteiligen. Die jüngeren Mitbewohner/innen bringen sich mit instrumentellen Hilfeleistungen ein, verlagern ihre sozialen Aktivitäten aber in die Familie oder nach außen. Durch die Übernahme von bestimmten Aufgaben je nach Fähigkeiten und Fertigkeiten im Wohnprojekt und in der Vereinsarbeit wird die Aufrechterhaltung vorhandener Kompetenzen aber auch die Entwicklung neuer Potenziale gefördert. 3.9 Versorgung im Krankheitsfall Um das Unterstützungspotenzial im Krankheitsfall zu eruieren, wurde folgende Frage gestellt: „Wer würde Sie versorgen, wenn Sie einmal länger krank wären?“ Wie aus dem Interview hervorgeht, verbinden ältere Menschen mit „längerer Krankheit“ Pflegebedürftigkeit, wohingegen die jüngeren Bewohner mehr an Operationen, Grippe und Knochenbrüche - also an vorübergehende Krankheiten - denken. 54 Die nachfolgende Tabelle zeigt die Antworten: Nr. Geschlecht/ Familienstand 1 w/verheiratet 2 m/verheiratet 3 m/ledig 4 m/ledig 3-jährige Tochter 3-jährige Tochter kinderlos kinderlos 5 6 7 8 9 w/ledig w/verwitwet m/verwitwet w/geschieden w/verwitwet kinderlos Tochter Tochter Sohn/Tochter Sohn 10 w/verwitwet 2 Töchter Tabelle 3: Kinder Entfernung der Kinder 0 0 Wer würde Sie pflegen? Ehepartner Ehepartnerin Freundin = Nachbarin professionelle Dienste/ Nachbarn professionelle Dienste < 20 km Schwester > 300 km Tochter < 20 km Tochter/Nachbarn < 20 km Schwiegertochter/ Enkelin < 20 km/ >300 km professionelle Dienste Von wem wird die Versorgung bei längerer Krankheit erwartet (n = 10) Hier wird deutlich, dass die Hilfeerwartungen bei längerer Krankheit in hohem Maße familienzentriert sind. Dieser Befund bestätigt das hierarchische Kompensationsmodell von Cantor (vgl. Kapitel 2.3.2). Von den Studienteilnehmern erwarten 60 % in erster Linie Unterstützung durch Familienangehörige, 10 % von Freunden und 30 % von externen professionellen Diensten (wie ambulanter Pflegedienst oder Krankenhaus). Ferner zeigt sich, dass bei der überwiegenden Mehrheit die Versorgung von den weiblichen Familienangehörigen erwartet wird, auch wenn diese teilweise nicht in der Nähe wohnen. Von Söhnen wird keine Versorgung im Krankheitsfall erwartet. An ihre Stelle treten die Schwiegertöchter oder Enkelinnen. Von den genannten potenziellen Pflegepersonen sind 60 % Frauen und 10 % Männer (Ehepartner). Eine Ausnahme bildet eine Bewohnerin (Nr. 10 in der Tabelle), die weder Hilfe von den beiden Töchtern noch von Freunden oder Nachbarn erwartet. Wie aus dem Interview hervorgeht, ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung bei dieser Person sehr ausgeprägt. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Bewohnerin bereits hochaltrig ist und eine längere Krankheit mit intensiver Pflegebedürftigkeit verbindet und damit niemanden zur Last fallen möchte. Die Erwartung, dass bei längerer Krankheit bzw. Pflegebedürftigkeit Unterstützung im Sinne von Pflege durch die Bewohner des Wohnprojektes geleistet 55 wird, ist gering. Die Bewohner möchten sich dazu nicht verpflichten. Eine Bewohnerin äußert sich wie folgt: Also, wir helfen uns schon gegenseitig. Wir fragen, wie geht’s dir. Aber wenn sie so richtig mal eine Versorgung - wenn jemand schwerer krank ist, dann muss man Hilfe von außen nehmen. Das geht nicht. Aber wir helfen uns schon, es ist ja schon, dass jemand krank ist und Grippe hat, dann helfen wir uns schon, das machen wir. Aber wenn er wirklich eine schwerere Sache hat - es geht gar nicht anders - da müssten wir ja hier eine Krankenpflege leisten oder so was. Wenn einer - angenommen ein Pflegefall wird, der kann hier nicht bleiben. Es ist eben wie in einer Wohnung.“ (Interview 1) Über das Thema Pflege hatten sich die Gründerinnen des Projekts und die Bewohner/innen vor Einzug nicht explizit Gedanken gemacht. Sie wurden jedoch gleich zu Beginn des Zusammenlebens vor diese Situation gestellt. Sechs Monate vor Einzug in das Wohnprojekt erkrankte ein engagiertes Vereinsmitglied und musste zunächst in ein Pflegeheim übersiedeln, da ihre bisherige Wohnung nicht an die veränderte Kompetenz, d.h. an das Leben im Rollstuhl, angepasst werden konnte. Die Bewohner beschlossen dennoch, die „behinderte Dame“ in das Wohnprojekt aufzunehmen. So wurden unmittelbar nach Einzug in dem neugebauten Haus Wohnungsanpassungsmaßnahmen vorgenommen (wie das Anbringen einer Rampe im Eingangsbereich und einer mobilen Rampe zur Terrasse sowie der Einbau einer unterfahrbaren Küche). Des Weiteren wurde die benötigte pflegerische Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst erbracht. Durch die Möglichkeit der Wohnungsanpassung, der Zuhilfenahme von ambulanten Diensten und der sozialen Unterstützung durch die Bewohner des Projektes war es der „behinderten Dame“ ermöglicht worden, noch drei Jahre bis zu ihrem Tod selbstständig und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden statt im Pflegeheim zu leben. Eine Bewohnerin beschreibt die Art der Unterstützung, die für die pflegebedürftigen Person geleistet wurde: „...wir haben ihr geholfen in jeder Situation. Immer! Wir waren immer da - es ist jeder gucken gegangen. Sie hat selber gekocht, das wollte sie. Ich bin dann auch öfter mal runter - K., ich hab was gekocht, ich bring dir was. Und ich hab sie auch mal zum Essen hier eingeladen, da war sie froh und glücklich, dass sie auch in eine andere Wohnung kam. Und wenn ich Zeit hatte, ich konnte das noch, ich hab sie im Rollstuhl rumgefahren und da bin ich mit ihr weggefahren. Dann hat sie einen Fahrdienst gehabt, da ist einer im Haus, der hat ein Taxi und da gab es so Fahrscheine und da sind wir auch mal woanders hingefahren.“ (Interview 6) 56 Auf die Frage, ob sie diese Hilfestellung als Belastung empfunden hätte, meinte sie „Belastung? eigentlich nicht - es war ja nicht eine, sondern vier Personen. Ich hatte zwar nicht immer Lust, aber ich dachte mir, wenn ich das wäre ...“ (Interview 6) Dieses Beispiel verdeutlicht, wie das in einem gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt vorhandene soziale Unterstützungspotenzial bei abnehmender körperlicher Kompetenz der älteren Bewohner einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des selbstständigen Lebens und somit zur Lebensqualität und Lebenszufriedenheit beitragen kann. Aus den Interviews geht hervor, dass die Bewohner nicht bereit sind, „schwerstpflegebedürftige und an Demenz erkrankte Menschen“ (Interview 11) im Wohnprojekt zu behalten. Auch sehen sie sich nicht in der Lage, pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten für hilfebedürftige Bewohner/innen zu übernehmen. Vielmehr konzentriert sich ihre Hilfestellung auf den sozialkommunikativen und emotionalen Aspekt. Hier kann der von Lawton in seiner proactivity-Hypothese postulierte Zusammenhang zwischen der Kompetenz der Person in den Bereichen „biological health, sensation-perception, motoric behavior, and cognition“ (1982, S. 38) und der Nutzung der Umweltressourcen erweitert werden um die soziale Kompetenz der Person. Denn je höher die soziale Kompetenz der Person ist, desto vielfältiger sind die sozialen Umweltressourcen, die zur Verfolgung individueller Wünsche und Bedürfnisse genutzt werden können und somit zur Leistungsfähigkeit und zum Wohlbefinden beitragen. Die soziale Kompetenz der behinderten Person, mit der sie ihr Netzwerk über die gesamte Lebensspanne aufgebaut hat, hat es ihr ermöglicht, bei abnehmender körperlicher Kompetenz und somit steigendem Umweltdruck, ein selbstbestimmtes Leben in einer an ihre Fähigkeiten angepassten Wohnumgebung zu führen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das hierarchische Kompensationsmodell von Cantor auch heute noch weitgehend bestätigt werden kann. Die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes erwarten in erster Linie von Familienangehörigen Hilfe bei längerer Krankheit. Sie selbst sind zwar zur gegenseitigen Unterstützung bei Krankheit bereit, wenn zusätzlich professionelle Hilfe organisiert wird und übernehmen eine sozial-kommunikative Funktion. Instrumentelle Hilfeleistung in Form von regelmäßigem Kochen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist nicht vorgesehen. Das Beispiel der pflegebedürf- 57 tigen Dame hat gezeigt, das sowohl die räumliche als auch die soziale Umwelt einen wichtigen Beitrag zu einem selbstbestimmten, selbstständigen und qualitätsvollen Leben leisten, wenn die Kompetenz im Alter abnimmt. 3.10 Exkurs: Voraussetzungen für das Leben im Wohnprojekt Um zu eruieren, welche Voraussetzungen für das Leben im Wohnprojekt erforderlich sind, wurde folgende Frage gestellt: „Welche Erfahrungen bzw. Tipps können Sie denjenigen geben, die jetzt gerade dabei sind, das neues Projekt zu gründen?“ Die unterschiedlichen Antworten werden nachfolgend dargestellt. „Erst mal muss man sehr tolerant sein - dann man muss auch bereit sein, was zu tun, wie gesagt, wenn die K. da war, die Behinderte, das man sich für die einsetzt - bis hin, dass man auch in einer Gemeinschaft leben kann.“ (Interview 1) Eine andere Bewohnerin meint: „Man muss schon ein bisschen aufgeschlossen sein. Und wir haben auch Glück mit unseren Älteren - ich sage Älteren, die wir hier haben. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Es ist ja nicht so, man ist ja nicht immer zusammen.“ (Interview 6) Dass sich das Leben in einem Wohnprojekt nicht vom Alltag unterscheidet, bestätigt Frau S.: „Sie können nicht leicht 10 Menschen zusammentun und das funktioniert. Das kommt ja auch noch dazu. Das weiß man ja vom Berufsleben, da weiß ich das noch - da hat man ganz nette Kollegen gehabt und andere hätte man auf den Mond schießen können. Das ist eben unter Menschen - das Zusammenleben ist eben kompliziert.“ (Interview 2) Das vorangegangene Kapitel hatte das Ziel, das gemeinschaftsorientierte intergenerative Wohnprojekt zu beschreiben und die jeweiligen Personen in ihrer Interaktion mit der räumlichen und sozialen Umwelt darzustellen. Es wurden neben Einblicken in den Alltag des Wohnprojektes die Merkmale der Bewohner, ihre Motive für den Einzug in das Wohnprojekt und die damit verbundenen Erwartungen sowie ihr soziales Netzwerk eruiert, um diese Befunde im nachfolgenden Kapitel mit empirischen Ergebnissen zum Betreuten Wohnen zu vergleichen. Die angewandte Kombination des qualitativen Interviews mit der Netzwerkanalyse hat sich als geeignetes Erhebungsinstrumentarium für die Exploration des Wohnprojektes erwiesen. 58 4 Vergleichende Diskussion Sowohl gemeinschaftsorientiertes Wohnen als auch Betreutes Wohnen sind Wohnkonzepte, die ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen. Sie werden in der Regel von Menschen gewählt, die bewusst ihre Entscheidung treffen, wo und wie sie im Alter wohnen möchten und die ihre Altersphase selbst aktiv gestalten wollen. In der vergleichenden Diskussion sollen deshalb folgende Fragen erörtert werden: • Gibt es Unterschiede in der Bewohnerstruktur der beiden Wohnformen? • Welche Gründe waren ausschlaggebend für den Einzug? • Welche Erwartungen waren mit dem Einzug verbunden? • Welche Unterstützungspotenziale stehen den Bewohnern bei längerer Krankheit in der jeweiligen Wohnform zur Verfügung? Um die Ergebnisse des untersuchten gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes mit Erhebungen zu betreuten Wohnanlagen zu vergleichen, wird die Längsschnittstudie zum Betreuten Wohnen von Saup (2001; 2003) und die Untersuchung einer betreuten Wohnanlage mit Gemeinschaftsorientierung (Seidel, 2003) herangezogen. Saup (2001; 2003) untersuchte in seiner Längsschnittstudie sieben verschieden große und unterschiedlich konzipierte betreute Wohnanlagen während eines Zeitraums von 3 Jahren. Seidel (2003) verglich „herkömmliche“ betreute Wohnanlagen (Typ A) mit einer betreuten Wohnanlage, deren Fokus auf Gemeinschaftsorientierung liegt (Typ B). In dieser Arbeit wird zum Vergleich nur Typ B herangezogen. Der Unterschied zum Betreuten Wohnen besteht in dieser Anlage darin, dass sich bereits vor dem Bau der Wohnanlage Interessenten zusammenschlossen, die gemeinsam ein räumliches, organisatorisches und soziales Konzept auf anthropologischen Grundlagen erarbeiteten und umsetzten (Seidel, 2003, S. 38). Bei der Errichtung herkömmlicher betreuter Wohnanlagen ist eine Bewohnerbeteiligung nicht üblich. Das gemeinschaftsorientierte intergenerative Wohnprojekt wurde in Kapitel 3 beschrieben. Für den Vergleich werden jedoch nur die sechs Bewohner über 60 Jahre herangezogen, da die Bewohner von betreuten Wohnanlagen in der Regel meist ältere Menschen sind. 59 Grundsätzliche Merkmale für betreute Wohnungen sind: • Barrierefreiheit nach DIN 18 025 • möglichst gute Standortqualität • Grundleistungen (psychosoziale Beratung, Vermittlung von pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen durch eine Betreuungskraft, die auch Freizeitaktivitäten organisiert, Notrufsystem). Diese Leistungen sind in einer monatlich erhobenen Grundpauschale enthalten (BMFSFJ, 1998, S. 114). Gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte sind im Wesentlichen durch folgende Faktoren gekennzeichnet: • Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung des inhaltlichen und räumlichen Konzepts des Projektes durch die zukünftige Nutzergruppe • Gemeinschaftsorientierung, d.h. gegenseitige Hilfe ist ein wesentlicher Bestandteil • Ausgestaltung und Organisation des Zusammenlebens, d.h. die wohnprojektbezogenen Angelegenheiten werden eigenverantwortlich geregelt (Kremer-Preiß & Stolarz, 2003, S. 71). Methodisch ist ein direkter Vergleich aufgrund der unterschiedlich konzipierten Erhebungsinstrumentarien, der differierenden räumlichen, inhaltlichen und organisatorischen Konzepte der Anlagen sowie der unterschiedlichen Stichprobengrößen nicht möglich. Die geringe Untersuchungsstichprobe im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt ist dadurch zu begründen, dass es im Vergleich zum Betreuten Wohnen relativ wenig (bekannte) Wohnprojekte gibt, in denen auch ältere Menschen leben. Des Weiteren umfassen Wohnprojekte meist weniger Wohneinheiten als betreute Wohnanlagen. Bei der Recherche fiel auf, dass sich in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle bei der Anzahl der existierenden Wohnprojekte abzeichnet, d.h. in süddeutschen Bundesländern wurden bisher weniger Wohnprojekte realisiert als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Hamburg (vgl. Brech, 1999, S. 105). Aus diesen Gründen können in dieser Arbeit nur Tendenzen herausgearbeitet werden, die in weiteren umfangreicher angelegten Untersuchungen widerlegt oder bestätigt werden sollten. 60 4.1 Merkmale der Bewohner Im Folgenden werden die verschiedenen Merkmale der Bewohner in den jeweiligen Wohnanlagen vergleichend dargestellt. 4.1.1 Familienstand Die Anzahl der Ein-Personen-Haushalte, in denen überwiegend verwitwete Personen leben, überwiegt in allen drei Studien. Aus den Untersuchungen zum Betreuten Wohnen (Saup 2001, S. 45) geht hervor, dass 79 % der Bewohner in einem Ein-Personen-Haushalt leben, der überwiegende Teil (64 %) ist verwitwet, 9 % sind ledig und 6 % sind geschieden (ebd. S. 31). Im Betreuten Wohnen mit Gemeinschaftsorientierung leben 53 % der Bewohner in einem Ein-Personen-Haushalt. Zum Familienstand finden sich bei Seidel für Typ B keine detaillierten Angaben. In der Gesamtdarstellung der untersuchten Wohnanlagen (Typ A und B) kristallisiert sich heraus, dass auch hier ein hoher Anteil der Bewohner/innen (39 %) verwitwet ist (Seidel, 2003, S. 40). Beim gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt sind alle befragten Bewohner/innen über 60 Jahre alleinlebend. 66 % davon sind verwitwet, 17 % sind ledig und 17 % sind geschieden. Somit ist auch hier der Anteil von verwitweten Personen hoch. Gemäß der Datenbasis von GeroStat (1999), die alle Haushalte der Altersgruppe über 59 einschließt, liegt der Durchschnitt der Alleinlebenden in Deutschland nur bei 31 % (zit. n. Saup, 2001, S. 45). Aus den Ergebnissen der oben genannten Studien kann abgeleitet werden, dass insbesondere Personen, deren Lebenspartner bereits verstorben ist, bestrebt sind, ihre Wohnsituation zu verändern. 4.1.2 Geschlecht Der Frauenanteil liegt bei allen Studien deutlich über dem Anteil der Männer. Die Daten von GeroStat (1999) zeigen, dass sich die Bewohner der deutschen Haushalte über 59 Jahre, aus 58 % Frauen und 42 % Männer zusammensetzen (zit. n. Saup 2001, S. 43). Beim Betreuten Wohnen liegt der Frauenanteil mit 77 % (ebd.) bereits deutlich über dem Durchschnitt. Im untersuchten gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt steigt er auf 83 % an. 61 In der Anlage mit Gemeinschaftsorientierung wohnen etwa zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer (Seidel, 2003, S. 62). 4.1.3 Gesundheitszustand Saup (2001, S. 55) kommt zu dem Ergebnis, dass 80 % der Bewohner bereits bei Einzug ins Betreute Wohnen über dauerhafte gesundheitliche Beschwerden berichten, wie z.B. Geh- und Bewegungsbeschwerden, Herz- und Kreislaufprobleme sowie Seh- und Hördefizite. 13 % der Bewohner/innen waren bereits drei Monate nach Einzug als pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes eingestuft (ebd. S. 32). Saup zieht zum Vergleich seiner Ergebnisse den Alters-Survey von Kohli & Künemund aus dem Jahr 2000 heran und schließt aus der Gegenüberstellung, dass die Bewohner in betreuten Wohnanlagen prozentual häufiger von gesundheitlichen Beschwerden betroffen sind als die 55-85-Jährigen, die in Privathaushalten leben (2001, S. 47). Seidel ermittelte in ihrer Arbeit einen Index der Gebrechlichkeit und stellte fest, dass 40 % der Stichprobe eine mittlere bis starke Gebrechlichkeit aufweisen. (2003, S. 43). Im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt wurde nicht explizit nach Krankheiten oder Einschränkungen gefragt, sondern lediglich um die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes gebeten. Die Bewertung wurde von den Bewohnern auf einer 5-stufigen Antwortskala (4 = sehr gut, 3 = gut, 2 = es geht, 1 = schlecht, 0 = sehr schlecht) vorgenommen (siehe Frage 10.10 im Fragebogen). 50 % der Befragten bewerteten ihren Gesundheitszustand mit „es geht“ und jeweils 17 % mit „sehr gut“, „gut“ und „schlecht“. Diese Einschätzung wurde ergänzt durch die Aussagen zu altersbedingten Einschränkungen während des Interviews. Es scheint, als ob die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes weniger von motorischen Einschränkungen betroffen sind als diejenigen betreuter Wohnanlagen, von denen 72 % über Geh- und Bewegungsbeschwerden berichten (Saup, 2001, S. 31). Auch vier Jahre nach Einzug in das Wohnprojekt ist kein Bewohner auf eine Gehhilfe angewiesen oder in eine Pflegestufe eingestuft. Aufgrund der unterschiedlichen Skalen zur Bewertung von gesundheitlichen Einschränkungen und der zahlenmäßig stark differierenden Stichprobengrößen in den verschiedenen Wohnanlagen, kann keine vergleichbare Aussage getroffen werden. Betrachtet man jedoch das Einzugsalter und die Einzugsmotive, so 62 könnte die These aufgestellt werden, dass die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes in einem geringerem Maße gesundheitlich beeinträchtigt sind als diejenigen des Betreuten Wohnens. 4.1.4 Einzugsalter Das durchschnittliche Einzugsalter in betreute Wohnanlagen liegt bei 77,9 Jahren. (Saup, 2001, S. 29 - Abb. 2). Die Altersverteilung stellt sich folgendermaßen dar: • 27 % der Bewohner sind unter 75 Jahren • 56 % zwischen 75 und 85 Jahren • 18 % über 85 Jahre. Seidel (2003, S. 64) kam in ihrer Untersuchung der betreuten Wohnanlage mit Gemeinschaftsorientierung auf ein mittleres Einzugsalter von 70,3. Im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt liegt das durchschnittliche Einzugsalter der sechs älteren Bewohner bei 72,6 Jahren. Die Daten belegen, dass sich die Bewohner der betreuten Wohnanlage mit Gemeinschaftsorientierung und des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes bereits zu einem Zeitpunkt mit dem Thema Umzug auseinander setzten, zu dem die körperlichen Einbußen noch nicht das primäre Motiv für eine Veränderung der Wohnsituation waren. Reduziert man im untersuchten Wohnprojekt das Einzugsalter um die achtjährige Planungsphase, so kann vermutet werden, dass sich diejenigen Personen, die sich für diese Wohnform entscheiden, bereits mit dem Übergang vom Berufsleben in das Rentenalter mit der Frage beschäftigen, wie sie das vor ihnen liegende 3. und 4. Lebensalter selbstverantwortlich, sinnvoll und aktiv zusammen mit anderen gestalten können. 4.1.5 Wohnsituation vor und nach dem Umzug Aus den Daten der Längsschnittstudie von Saup (2001, S. 68-71) wird ersichtlich, dass der überwiegende Teil (72 %) vor dem Einzug als Mieter lebte. Nach dem Einzug hatten 78 % der Bewohner diesen Status. Der Anteil der Wohnungs- bzw. Hauseigentümer in den betreuten Wohnanlagen lag vor Einzug bei 28 %. Nach dem Einzug leben 9 % in einer Wohnung, die von den Kindern gekauft wurde und 13 % in einer eigenen Seniorenwohnung. 63 Beim Betreuten Wohnen mit Gemeinschaftsorientierung wohnten 53 % der Befragten vor dem Einzug im Eigentum (Seidel, 2003, S. 45). Nach dem Einzug in die freifinanzierte Anlage stellen sie dem Betreiberverein ein zinslosen Darlehen, das sich nach der Größe der Wohnung richtet, zur Verfügung und mieten die Wohnung (ebd. S. 38). Diese Finanzierungsart setzt eine gewisse wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bewohner voraus. Im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt hatten alle Bewohner/innen bereits vor dem Einzug den Mieterstatus und behalten diesen auch bei, da die Wohnungen mit öffentlichen Mitteln errichtet wurden und in diesem Gebäude keine Eigentumswohnungen angeboten werden. Die Daten zeigen, dass Mieter eine höhere Umzugsbereitschaft aufweisen als Eigentümer. Dieser Befund korrespondiert mit den Ergebnissen von Heinze et al. (1997, S. 16), die Wohnungs- bzw. Hauseigentümern eine geringere Umzugsaktivität bescheinigen. 4.1.6 Einzugsbereich der Wohnanlagen Die Mehrzahl der Bewohner/innen in den betreuten Wohnanlagen kamen aus der näheren Umgebung. 7 % zogen aus dem gleichen Siedlungsgebiet zu, 29 % aus der gleichen Gemeinde bzw. dem gleichen Stadtteil und 32 % aus dem Nachbarort bzw. -stadtteil. Nur 17 % kamen aus dem gleichen Landkreis und 15 % lebten außerhalb des Landkreises (Saup, 2001, S. 73). Bei der betreuten Anlage, deren Schwerpunkt auf dem gemeinschaftlichen Wohnen liegt, kamen 47 % aus dem gleichen Ort und 53 % aus einer weiteren Entfernung (> 20 km). Seidel (2003, S. 46) verbindet mit dem großen Einzugsbereich der Wohnanlage die Motivation der Bewohner, für einen „gewollten Neuanfang“ die vertraute Umgebung zu verlassen. Sie bringt dies mit der anthropologischen Ausrichtung der Wohnanlage in Zusammenhang. Im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt kommen alle Bewohner aus der gleichen Stadt, jedoch keiner aus dem gleichen Siedlungsgebiet oder dem gleichen Stadtteil. Der Einzugsbereich dieser Wohnanlage ist allerdings auf das Stadtgebiet begrenzt, da nach den spezifischen städtischen Regularien der Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung erst nach fünfjähriger Wohndauer im Stadtgebiet möglich ist. 64 4.1.7 Zusammenfassung der Bewohnermerkmale Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der oben ausgeführten Ergebnisse. Betreutes Woh- Betr. Wohnen nen mit Gemeinschaftsorient. Saup (2001) Seidel (2003) Gesamtzahl der Wohnungen 252 Gemeinschaftsorientiertes Wohnprojekt 102 16 Wohnungen verteilt auf 7 unterschiedliche Anlagen Untersuchte Stichprobe 173 Personen Einpersonenhaushalt verwitwet geschieden ledig 79 % 64 % 9% 6% Frauenanteil Durchschnittl. Einzugsalter Status vor/nach Einzug Mieter Eigentümer 15 Personen 6 Personen älter als 60 Jahre 53 % k.A. k.A. k.A. 100 % 66 % 17 % 17 % 77 % ca. 66 % 83 % 78 Jahre 70,3 Jahre 72,6 Jahre 72 % / 78 % 28 % / 13 % 47 % / 100 % 53 % / 0 % 100 % / 100 % 0%/ 0% 6 Gesundheitszustand Große Einbußen 80 % (vgl. Kap. 4.1.3) 40 % 0% Einzugsgebiet aus Nachbarort/-stadtteil > 20 km 68 % 32 % 47 % 53 % Tabelle 4: 100 % 0% Zusammenfassung der Bewohnermerkmale Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung weist sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede bezüglich der Bewohnerstruktur auf. Es zeigt sich, dass insbesondere verwitwete Frauen, die meist den Status der Mieterin inne hatten, aktiv ihre Wohnsituation ändern. Allerdings scheinen diejenigen, die ins Betreute Wohnen ziehen, im Durchschnitt älter und gebrechlicher zu sein als die Personen, die Wohnformen mit Gemeinschaftsorientierung bevorzugen. 6 Die Anmerkung k.A (keine Angaben) weist darauf hin, dass bei Seidel (2003) zu diesem Merkmal für Typ B keine Angaben gemacht werden. 65 4.2 Einzugsgründe In den zum Vergleich herangezogenen Studien differieren die Einzugsgründe je nach Wohnform. Auch hier lässt die Gegenüberstellung der Daten aufgrund der unterschiedlich gestalteten Erhebungsinstrumentarien und der verwendeten Kategorien nur tendenzielle Aussagen zu, die im Folgenden dargestellt werden. 4.2.1 Gesundheitliche Gründe Wie bereits im Kapitel 4.1.3 „Gesundheitszustand“ beschrieben, zeigen sich Unterschiede im Hinblick auf den Gesundheitszustand der Bewohner in den einzelnen Wohnformen. Die Untersuchungsergebnisse von Saup (2001, S. 57f) weisen darauf hin, dass bei vier von fünf Bewohnern die „Krisenvorsorge“ ein sehr wichtiger Grund ist, der in Zusammenhang mit der Einzugsentscheidung ins Betreute Wohnen steht. Dieses Bedürfnis korreliert mit dem Gesundheitszustand der Bewohner und dem daraus resultierenden Wunsch, im Notfall Hilfe und im Pflegefall Betreuung zu erhalten. Auch bei Seidel (2003, S. 49f) zeigte sich, dass gesundheitsbezogene Gründe den höchsten Stellenwert für den Einzug in die betreute Anlage mit Gemeinschaftsorientierung besaßen. Sie ordnete die diesbezüglichen Nennungen unter die Kategorien „aktueller Gesundheitszustand“ (20 %) und „Vorsorge“ (33 %) ein. Ganz anders präsentiert sich die Motivlage der Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes. Aus den Interviews, die mit den sechs Bewohnern über 60 Jahre geführt wurden, geht hervor, dass akute gesundheitliche Einschränkungen als Umzugsmotiv keine Rolle spielten. Lediglich 17 % trafen durch den Umzug frühzeitig Vorsorge für eine bereits wahrgenommene, aber als noch nicht so gravierend erlebte mangelhafte Passung zwischen ihrem Gesundheitszustand und der Wohnsituation. Die Umzugsentscheidung wäre allerdings noch nicht gefällt worden, wenn nicht zufällig eine Wohnung im Wohnprojekt zur Nachbelegung frei geworden wäre. Auffällig ist, dass die Bewohner/innen des Wohnprojektes begannen, sich zu einem Zeitpunkt mit dem Thema Wohnen und Leben im Alter zu beschäftigen, als ihr Gesundheitszustand noch keinen Anlass gab, eine kompensatorische Umwelt zu suchen. Diese Gegenüberstellung lässt vermuten, dass für einen Teil der Bewohner des Betreuten Wohnens, die Suche nach einer kompensatorischen Umwelt auf- 66 grund des aktuellen bzw. antizipierten Gesundheitszustandes ein wichtiges Umzugsmotiv darstellt. In Anlehnung an das im Kapitel 2.5.2.1 erläuterte Partialmodell 1 von Carp & Carp (1984) wird hier die Passung zwischen der Kompetenz der Person und den Anforderungen der Umwelt durch einen Umzug in eine barrierefreie und den Not- und Bedarfsfall weitgehend absichernde Umwelt des Betreuten Wohnens hergestellt. Es handelt sich hierbei um die Befriedigung des Basisbedürfnisses nach Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der Alltagskompetenz, die eine wesentliche Voraussetzung für eine selbstständige Lebensführung bietet und sich positiv auf das Leistungspotenzial und das Wohlbefinden der Person auswirkt. Bei den Bewohnern des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes ist das Basisbedürfnis nach einer selbstständigen Lebensführung aufgrund der Passung von Kompetenz und Umweltanforderungen befriedigt. Für diesen Personenkreis scheint die Erfüllung von Wachstumsbedürfnissen im Vordergrund zu stehen. Sie suchen - gemäß dem Partialmodell 2 von Carp & Carp (1984) - eine ihren Bedürfnissen ähnliche Umwelt bzw. gestalten diese selbst (vgl. Kapitel 2.5.2.2). 4.2.2 Absicherung im Not- und Bedarfsfall Das Bedürfnis nach Sicherheit nimmt insbesondere im Alter mit der Wahrnehmung von persönlichen und umweltbedingten Einschränkungen zu. Damit wird bei der Suche nach einer adäquaten Wohnform für das dritte und vierte Lebensalter dem Wunsch nach Absicherung für den Not- und Bedarfsfall mehr Gewicht verliehen. Die zum Vergleich herangezogenen Wohnkonzepte bieten diesbezüglich unterschiedliche Unterstützungspotenziale. Den Bewohnern des Betreuten Wohnens wird durch die in der monatlichen Pauschale enthaltenen Grundleistungen (Notrufsystem, Hausbesuch, Bereithaltung von ambulanter Pflege und hauswirtschaftlicher Versorgung, Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen, Anwesenheit einer Betreuungskraft) die notwendige professionelle Absicherung und somit die subjektive Sicherheit für Notund Bedarfslagen gewährleistet. Aber auch die sich im Laufe der Zeit entwickelnden nachbarschaftlichen Kontakte tragen dazu bei, dass sich das Sicherheitsgefühl erhöht. Saup weist darauf hin, dass 15,7 % der Bewohner drei Jahre nach ihrem Einzug berichten, dass die Nachbarn regelmäßig nach ihnen sehen. (2003, S. 110). 67 Das Konzept des gemeinschaftsorientierten Wohnens basiert auf der gegenseitigen Hilfe im Alltag. Hier übernimmt die Hausgemeinschaft sowohl die Funktion des Notrufs (durch den täglichen Kontakt und durch die Wachsamkeit der Bewohner/innen), als auch die Aufgaben der Betreuungskraft in Form von Unterstützung bei der Informationssuche und Organisation von externen Dienstleistungen sowie der Organisation von Freizeitaktivitäten. Eine Bewohnerin beschreibt, wie sich für sie die Absicherung für Not- und Bedarfslagen im Wohnprojekt darstellt: „Wenn mal irgendwas ist, kann ich um Rat fragen, kann mal runtergehen. Da gibt es ja Hilfe, wenn ich mal krank bin, oder - Gott sei Dank war ich es noch nicht. Wenn ich da jemand bitte, kannst du mir das mal mitbringen vom Einkaufen - oder das - also, dass man sich nicht alleine fühlt - es ist immer einer da.“ (Interview 1) Die Leistungen sogenannter niedrigschwelliger Hilfen, wie Einkaufen, Begleitdienst zum Arzt oder ins Krankenhaus und auch in bestimmtem Maße Hilfe bei instrumentellen Tätigkeiten im Haushalt (Bilder aufhängen, Lampen auswechseln, Gardinen abnehmen etc.), werden von den Nachbarn im Wohnprojekt bei Bedarf und auf Anfrage erbracht. Allerdings übernehmen die Bewohner keine haushaltsbezogenen Arbeiten, wie z.B. regelmäßige Essenszubereitung, Wäschepflege oder Reinigung der Wohnung. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in beiden Wohnformen die Absicherung für den Not- und Bedarfsfall gewährleistet ist, wobei die Unterstützung im Betreuten Wohnen durch professionelle Hilfe erfolgt und im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt die Hausgemeinschaft diese Leistungen weitgehend erbringt. 4.2.3 Wunsch nach einer altersgerechten Wohnung In der Untersuchung von Saup äußerten 70 % der Befragten den Wunsch nach einer altersgerechten Wohnung (2001, S. 58). Sie gaben an, dass gesundheitliche Gründe einen Umzug in eine bequemere Wohnung notwendig machten. Die Befragungsergebnisse zur Wohnsituation vor dem Einzug ergaben, dass vor allem das Treppensteigen für die meisten Bewohner ein Problem zu sein schien, denn 75 % der Älteren, die ins Betreute Wohnen umziehen, konnten ihre Wohnung bzw. die Zimmer in ihrem Haus nur über eine Treppe erreichen (ebd. S. 76). Hier wird deutlich, wie wichtig es ist, Wohnungen künftig so zu planen, dass eine barrierefreie Zugänglichkeit gewährleistet ist bzw. Wohnungsanpassungen durch Treppenlift und Rampen möglich werden, damit ein Verbleib im vertrauten Umfeld möglichst lange gewährleistet werden kann. 68 In der Untersuchung von Seidel (2003, S. 49) wurde die von ihr genannte Kategorie „Wohnungsausstattung“ von 53 % der Befragten als Umzugsgrund ins Betreute Wohnen mit Gemeinschaftsorientierung genannt. Unter diese Kategorie wurde auch der erhöhte „Pflege- und Erhaltungsaufwand von Haus und Grundstück“ (ebd., S. 48) subsumiert. Auch hier zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der körperlichen Gesundheit der Person und der „Nicht-mehrPassung“ der räumlichen Umwelt. Im Vergleich zu den Bewohnern des Betreuten Wohnens spielt das Bedürfnis nach einer kompensatorischen räumlichen Umwelt im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt nur bei 17 % der Bewohner eine Rolle. Dass die Initiatorinnen des Wohnprojektes auf den Einbau eines Aufzugs beharrten, weist darauf hin, dass sie mit dieser Präventivmaßnahme die Erreichbarkeit der Wohnung bei Einbußen der körperlichen Leistungsfähigkeit erleichtern und sichern wollten. Die Tatsache, dass die Bewohner/innen des untersuchten Wohnprojektes in ein ursprünglich nicht barrierefrei zugängliches neu gebautes Haus am Rande der Stadt einzogen, das zudem eine ungünstige Wohnlage in Bezug auf Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf aufweist, könnte die Vermutung bestätigen, dass das Bedürfnis nach einer kompensatorischen Umwelt nicht vorrangig war. Es könnte aber auch sein, dass die Bewohner aufgrund der langwierigen Objektsuche ihre Vorstellungen in Bezug auf eine altersgerechte Ausstattung der Wohnung auf ein Minimum reduzierten, um das Wohnprojekt realisieren zu können. In diesem Zusammenhang ist eine Feststellung von Narten (2003) interessant, die beklagt, dass viele Wohnprojekte, die über einen langen Zeitraum das Wohnen im Alter vorbereiten, die barrierefreie Gestaltung letztendlich vernachlässigen. 4.2.4 Nähe zur Filialgeneration Der Wunsch, in der Nähe der Kinder zu wohnen, wurde von 38 % der Befragten in der Studie von Saup (2001, S. 58) geäußert. Er verglich die Sozialkontakte der Älteren vor Einzug in das Betreute Wohnen mit den Ergebnissen aus Untersuchungen von Normalhaushalten und kam zu dem Schluss, dass der Anteil der Älteren, die regelmäßig persönliche Kontakte zur Filialgeneration unterhielten, im Betreuten Wohnen höher war als im Normalhaushalt. Auch wurden als Kontaktpersonen weniger andere Verwandte und sonstige Personen, wie Freunde oder Nachbarn genannt als in Privathaushalten (ebd. S. 52). 69 Saup folgert daraus, dass bei den Menschen, die ins Betreute Wohnen einziehen, die Beziehung zu ihren Kindern besonders intensiv zu sein scheint und dass die Konzentration auf diese eventuell zu einer Reduzierung des weiteren sozialen Netzwerkes führt (ebd.). Er vermutet auch, dass die älteren Menschen sich durch den Umzug ein „doppeltes Sicherungsnetz“ schaffen, denn seine Daten belegen, dass neben dem Leistungsangebot des Betreuten Wohnens die Kinder - und hier insbesondere die Töchter - auch drei Jahre nach Einzug noch hauswirtschaftliche Hilfestellungen geben (2003, S. 111). Beim Betreuten Wohnen mit Gemeinschaftsorientierung wird von nur 7 % der Bewohner der Wunsch, in die Nähe der Kinder zu ziehen, als Umzugsgrund angegeben. Keine Rolle spielt die Nähe zur Filialgeneration bei den Bewohnern des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes. Die Ergebnisse dieser Gegenüberstellung unterstreichen auch die in Kapitel 3.7.2 „Soziale Aktivitäten“ beschriebenen Erkenntnisse, die auf einen Zusammenhang zwischen dem Kompetenzgrad der Person und der Einnahme von inner- oder außerfamiliären Rollen verweisen. Denn, wie die vorhergehenden Analysen zeigen, verfügt ein Teil der Personen, die in betreute Wohnanlagen umziehen, über einen geringeren Kompetenzgrad als die Bewohner des Betreuten Wohnens mit Gemeinschaftsorientierung und des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes. Die Bewohner herkömmlicher betreuter Wohnanlagen weisen zum Teil eine hohe Kinderzentriertheit auf, die verbunden ist mit dem Bedürfnis, in die Nähe der Kinder zu ziehen. Dieses Bedürfnis ist bei den Bewohnern des Betreuten Wohnens mit Gemeinschaftsorientierung relativ gering ausgeprägt und beim gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt nicht vorhanden. Der hier vermutete Zusammenhang zwischen Kompetenz und den inner- bzw. außerfamiliären Aktivitätsmustern verfestigt sich, kann aber aufgrund der mangelnden Repräsentativität der durchgeführten Studie nicht sicher bestätigt werden. Auch hier müssten wieder die unterschiedlichen Fragestellungen in den verschiedenen Arbeiten berücksichtigt werden, die zu diesen Aussagen führen. Eine weiterführende Untersuchung mit identischen Fragestellungen könnte hierfür Belege liefern. 4.2.5 Wunsch nach Gemeinschaft Unter der Kategorie „Mitmenschliche Nähe“ wurde bei Saup der Wunsch nach mehr Kontakt mit Mitbewohnern eingeordnet und von 41 % der Bewohner in der 70 ersten Erhebungswelle als wichtig erachtet (2001, S. 58). Dieses Bedürfnis steht bei Saup jedoch erst nach den oben genannten Gründen wie Krisenvorsorge, Hilfe im Not- und Bedarfsfall und altersgerechte Wohnung. Seidel differenziert die Einzugsgründe in das Betreute Wohnen mit Gemeinschaftsorientierung in sogenannte Push- und Pull-Faktoren7. 62 % der Nennungen werden in Zusammenhang mit den Pull-Faktoren gebracht, die auf die besondere anthropologische Orientierung der Wohnanlage zurückzuführen sind (2003, S. 66). Die Analyse der Einzugsgründe im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt zeigt, dass für 80 % der älteren Bewohner/innen das gemeinschaftliche Leben ein wichtiger Grund war, der die Umzugsentscheidung beeinflusste. Der Wunsch, mit anderen gemeinsam zu leben, die bevorstehende Lebensphase selbst zu gestalten und sich mit Ausdauer und Engagement dafür einzusetzen, dass eine neue Wohnform auch in die Praxis umgesetzt wird, zeugt davon, dass die Basisbedürfnisse dieses Personenkreises weitgehend befriedigt sind und die Möglichkeit genutzt wird, nach Umwelten zu suchen bzw. diese zu gestalten, die den sogenannten Wachstumsbedürfnissen ähnlich sind. Die Bewohner des Wohnprojektes haben die Gelegenheit genutzt, um die größtmögliche Passung zwischen ihren Bedürfnissen nach Eigenständigkeit, Privatheit und Gemeinschaft und der sozial-räumlichen Umwelt zu erzielen. Diese Passung zwischen Person und Umwelt wirkt sich positiv auf die psychosoziale Gesundheit und die Lebenszufriedenheit aus. 4.2.6 Zusammenfassung der Einzugsgründe Beim Vergleich der unterschiedlichen Wohnformen kristallisiert sich heraus, dass die interindividuell unterschiedlich ausgeprägte Kompetenz des Menschen und die jeweilige Lebenssituation in der räumlich-sozialen Umwelt den Ausschlag dafür geben, wie und wann die Person ihre Wohnsituation verändert. Es scheint, als ob die überwiegende Mehrheit im Betreuten Wohnen den Umzug vornimmt, um die Umweltanforderungen an ihre abnehmende Kompetenz anzupassen und wieder in den Bereich der optimalen Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens zu gelangen. Auch bei den von Seidel (2003, S. 66) befrag- 7 Nach Heinze et al. werden als Push-Faktoren diejenigen Faktoren bezeichnet, die aufgrund einer Nicht-mehr-Passung von Person und Umwelt zu einer Veränderung der Wohnsituation zwingen. Pull-Faktoren hingegen lassen eine konkrete Wohnalternative attraktiver erscheinen als die aktuelle Wohnung (1997, S. 43). 71 ten Bewohner/innen des Betreuten Wohnens mit Gemeinschaftsorientierung sind Anpassungsvorgänge zu beobachten, allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie bei den Bewohnern von betreuten Wohnanlagen, die Saup (2001; 2003) untersuchte. Gegenüber dem herkömmlichen Betreuten Wohnen kommen in der Anlage mit Gemeinschaftsorientierung Gründe zum Tragen, die auf Basisbedürfnissen beruhen, die zur Wiedererlangung oder Fortsetzung der selbstständigen Lebensführung beitragen. Parallel suchen die Bewohner nach einer Umwelt, die ihren Bedürfnissen nach gemeinschaftlichem Zusammenleben mit Menschen einer gleichen weltanschaulichen Einstellung entgegenkommt. Beim untersuchten gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt war die Suche nach einer kompensatorischen Umwelt sowie die Absicherung im Not- und Bedarfsfall nicht von primärer Bedeutung für den Umzug. Vielmehr sind die Gründe, die für den Einzug in das Wohnprojekt genannt werden, gekennzeichnet durch das individuelle Bedürfnis, eine Umwelt zu gestalten und in einer Umwelt zu leben, die den Bedürfnissen der Bewohner/innen nach Gemeinschaft entspricht, d.h. in einer sich gegenseitig stützenden Gemeinschaft zu leben und sich auch für diese zu engagieren. 4.3 Erwartungen 4.3.1 Letzte Station der Wohnbiografie Die Studie von Saup, die auch die Erwartungen der Bewohner des Betreuten Wohnens zum Einzugszeitpunkt erhob, ergab, dass 96 % diesen Umzug als letzte Station ihrer Wohnbiografie betrachteten und davon ausgingen, dass sie auch bei Pflegebedürftigkeit nicht mehr umziehen müssen (2001, S. 63). Die Erwartungen diesbezüglich schwankten jedoch je nach Organisationstyp der Anlage. So waren die Erwartungen der Personen, die in eine heimverbundene betreute Seniorenwohnanlage zogen, höher als bei denjenigen, „die in eine betreute Wohnanlage mit integriertem Pflegestützpunkt oder in eine solitäre betreute Wohnanlage zogen.“ (Saup, 2001, S. 63). Die Befragungsergebnisse nach dreijähriger Wohndauer zeigen, dass die ursprüngliche Erwartung, einen nochmaligen Wohnungswechsel bei hohem Betreuungs- und Pflegebedarf vermeiden zu können, reduziert wird. Sie sank in den untersuchten Wohnanlagen von anfänglich 96 % auf 79 % (Saup, 2003, S. 115). 72 Dieser Aspekt ist in Zusammenhang zu bringen mit der „Desillusionierung“ der Bewohner/innen des Betreuten Wohnens, die mit der Erkenntnis einhergeht, dass die Versorgungsmöglichkeiten bei schwerer Pflegebedürftigkeit nicht gegeben sind. Waren es bei der ersten Erhebung zum Einzugszeitpunkt noch 73 % die glaubten, einen Heimeinzug bei schwerer Pflegebedürftigkeit vermeiden zu können, so sank diese Zahl auf 32 % nach drei Jahren (ebd.) Noch gravierender ist die Veränderung der Prozentzahlen bei der Erwartung, dass die Pflege und Versorgung bis zum Tod möglich ist. Sie reduzierten sich von 71 % im Jahre 2001 auf 19 % in 2003. Ebenso sank die Erwartung, bei Desorientierung und Verwirrtheit weiterhin im Betreuten Wohnen zu bleiben, von 65 % in der ersten Erhebungswelle auf 20 % in der Erhebung nach drei Jahren (ebd.). Diese Fakten zeigen, dass der Begriff „Betreutes Wohnen“ oftmals falsche Erwartungen im Hinblick auf Pflege und umfassende Betreuung und Versorgung weckt. Hierzu besteht weiterhin Aufklärungsbedarf und eine trägerneutrale Erstberatung sowie bundesweit einheitliche Qualitätskriterien, die das breite Angebot für den Verbraucher transparent machen und helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Die in 2005 in Kraft tretende DIN Norm zum Betreuten Wohnen ist ein Schritt in diese Richtung. Bei Seidel (2003) finden sich zu diesem Punkt keine Ergebnisse. Im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt hoffen einige Bewohner/innen, dass der Umzug in dieses Projekt der letzte Umzug in ihrem Leben gewesen ist, andere hingegen wollen nochmals umziehen - allerdings nach Möglichkeit nicht in ein Pflegeheim, sondern in das neue Projekt, dass gerade in einem innerstädtischen Viertel in Planung ist und bis Ende 2006 bezugsfertig sein soll. Wie beschrieben, konnten die Bewohner selbst die Erfahrung sammeln, unter welchen Umständen ein pflegebedürftiger Mensch im Wohnprojekt bleiben kann und wissen, dass ein Umzug in ein Pflegeheim durch die Hilfestellung der Hausgemeinschaft und durch die Inanspruchnahme formeller Dienste hinausgezögert, aber nicht vermieden werden kann. In dieser Hinsicht stimmen ihre Aussagen auch mit denen der Bewohner von betreuten Wohnanlagen überein. Bei Einzug waren 66 % der Meinung, durch ihre Entscheidung einen Heimeinzug hinauszögern zu können. Bei der zweiten Erhebungswelle nach 36 Monaten ist der Anteil auf 84 % gestiegen (Saup, 2003, S. 115). 73 4.3.2 Hilfe bei längerer Krankheit Saup erfragte in seiner Studie die Hilfeerwartungen bei „vorübergehender Erkrankung“ sowie die erwartete Hilfe bei „längerer Pflegebedürftigkeit“. Er differenzierte dabei nach Partnern, Kindern, Verwandten, sonstigen Personen und dem Pflegedienst (2001, S. 42). Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Befragten bei vorübergehender Erkrankung Hilfestellung von den Kindern bzw. dem Ehepartner erhoffen und alleinstehende Ältere ohne Kinder auf die Unterstützung von Verwandten zählten. Bei längerer Pflegebedürftigkeit wird allerdings mit der Versorgung durch einen Pflegedienst gerechnet und parallel die Unterstützung durch den Partner bzw. die Kinder erwartet. Seidel (2003) untersuchte diese Frage in ihrer Arbeit nicht. Im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt war die Frage auf die Versorgung bei „längerer Krankheit“ gerichtet. Betrachtet man in der Tabelle 3 (Kapitel 3.9) die unteren sechs Personen, die über 60 Jahre alt sind, so wird deutlich, dass die Bewohner/innen im gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt bei längerer Krankheit auf die Unterstützung durch die Töchter oder engere Verwandten setzen. Die kinderlosen Bewohner/innen zählen eher auf professionelle Dienste oder auf Nachbarn. Wie aus den Interviews hervorgeht, verlassen sich die Bewohner bei vorübergehender Erkrankung, wie z.B. Erkältung, auf die Unterstützung durch die Hausgemeinschaft. Zusammenfassend kann jedoch konstatiert werden, dass sowohl die Bewohner des Betreuten Wohnens als auch diejenigen des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes im Krankheitsfall mit der Unterstützung ihrer Töchter rechnen. Diese Erwartungshaltung steht in Einklang mit dem hierarchischen Kompensationsmodell von Cantor (vgl. Kapitel 2.3.2). Anzumerken ist, dass die Begriffe „vorübergehende„ und „längere“ Krankheit nicht exakt definiert sind somit unterschiedlich ausgelegt werden können. 4.3.3 Zusammenfassung der Erwartungen Vergleicht man die ursprünglichen Erwartungen der Bewohner der verschiedenen Wohnformen und ihre subjektiven Aussagen zum Zeitpunkt der Befragung, so äußern sie ihre Enttäuschung zu unterschiedlichen Punkten. Während die Bewohner des Betreuten Wohnens ihre Erwartung im Hinblick auf die Möglichkeiten und Grenzen der Versorgung bei schwerer Pflegebedürftigkeit und Demenz korrigieren mussten, zeigen sich vor allem die älteren Bewoh- 74 ner/innen des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes enttäuscht über die unterschiedlichen Auffassungen von gegenseitiger Hilfestellung im Wohnprojekt (vgl. Kapitel 3.6 „Erwartungen“). Die enttäuschten Erwartungen machen deutlich, welche Einzugsmotive für die Bewohner der unterschiedlichen Wohnkonzepte eine wichtige Rolle spielten. Rangiert bei den Bewohnern des Betreuten Wohnens das Bedürfnis nach Versorgung im Not- und Bedarfsfall und Betreuung im Pflegefall bei der Angabe der Umzugsgründe sehr weit oben, so messen die Bewohner/innen des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes dem gemeinschaftlichen Leben und der gegenseitigen Hilfestellung eine hohe Wichtigkeit bei. Die Gegenüberstellung der Erwartungen zeigt, dass es den Bewohnern betreuter Wohnanlagen zu einem großen Teil um die Befriedigung der Basisbedürfnisse geht, wohingegen die Bewohner des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes danach streben, ihren Wachstumsbedürfnissen gerecht zu werden. In Bezug auf die erwartete Unterstützung bei längerer Krankheit kann auf die Gültigkeit des hierarchischen Kompensationsmodells von Cantor (1979) verwiesen werden. 75 5 Schlussbetrachtung Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, dass die untersuchten Wohnformen die selbstständige und selbstbestimmte Bewältigung des Alltags des älteren Menschen ermöglichen und unterstützen. Es wird deutlich, dass es nicht das ideale Wohnkonzept für selbstständiges Wohnen im Alter gibt, sondern dass die Bewohner die Wohnform wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Ressourcen am nächsten kommt. Die gewählte Wohnform ermöglicht dann im Idealfall die größtmögliche Passung zwischen den Bedürfnissen und Präferenzen der Person sowie den Gegebenheiten und Anforderungen der sozialräumlichen Umwelt und wirkt sich förderlich auf die Selbstständigkeit, die Lebenszufriedenheit und die Lebensqualität aus. Das Konzept des Betreuten Wohnens in seinen verschiedenen Organisationsformen kommt den unterschiedlich ausgeprägten Kompetenzen und Bedürfnissen der älteren Menschen nach einer kompensatorischen Umwelt, nach Sicherheit und Versorgung im Not- und Bedarfsfall sowie nach sozialen Kontakten entgegen. Es trägt dazu bei, dass durch den Umzug die selbstständige Lebensführung wiedererlangt, beibehalten oder gefördert wird. Besteht eine Kongruenz zwischen den Basisbedürfnissen der Person und der Umwelt, so können - je nach Motivationslage - Bedürfnisse höherer Ordnung zum Tragen kommen - wie z.B. der Wunsch, sich im Betreuten Wohnen zu engagieren (vgl. Saup, 2003, S. 115). Im Vergleich zum Betreuten Wohnen geht es den älteren Bewohnern des gemeinschaftsorientierten Wohnprojektes neben dem Bedürfnis nach selbstbestimmtem und selbstständigem Wohnen darum, die dritte Lebensphase zusammen mit anderen zu gestalten und in einer sich gegenseitig unterstützenden Gemeinschaft zu leben. Hierbei werden Selbstgestaltungskräfte mobilisiert und neue Handlungs- und Partizipationsspielräume erschlossen. Aufgeschlossenheit, Toleranz und Konfliktfähigkeit sowie gegenseitige Wertschätzung sind wesentliche Voraussetzungen für das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Fragen zu geleisteten und empfangenen Hilfeleistungen - die Teil der Befragung waren - aufgrund der zu geringen Stichprobe nicht ausgewertet. Aus sozialpsychologischer Sicht ist jedoch die Frage der Reziprozität von Geben und Nehmen in einem Wohnprojekt ein interessanter Forschungsgegenstand. Wenn Beziehungen auf Dauer durch hohe Einseitigkeit gekennzeichnet sind, werden sie in der Regel als unbefriedigend erlebt 76 und aufgelöst. Wie wirkt sich ein Ungleichgewicht von Geben und Nehmen langfristig in einem Wohnprojekt aus, das auf gegenseitige Hilfe ausgerichtet ist? Untersuchungen auf der Basis austausch- und ressourcentheoretischer Modelle könnten hierüber Aufschluss geben. Wie die Ergebnisse des Vergleichs zeigen, können weder im Betreuten Wohnen noch im gemeinschaftsorientierten Wohnen dementiell erkrankte Menschen auf Dauer wohnen bleiben. Für die stetig ansteigende Anzahl der Betroffenen müssen neue Wohnformen geschaffen werden, wie z.B. „Betreute Wohngemeinschaften“. Diese alternative Wohnform, die ein weitgehend selbstbestimmtes Wohnen und Leben in einer an das Krankheitsbild angepassten Umwelt ermöglichen soll, sollte Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten der ökologischen Gerontologie sein. Im untersuchten gemeinschaftsorientierten Wohnprojekt leben fünf unterschiedliche Nationalitäten zusammen. Prognosen zufolge werden im Jahr 2010 rund 1,3 Millionen Migranten älter als 60 Jahre sein (BMFSFJ, 2000, S.11). Damit rückt ein bislang noch vernachlässigtes Forschungsgebiet in den Blickpunkt, das sich mit der Frage beschäftigt, welche Wohn- und Versorgungsstrukturen den Bedürfnissen der unterschiedlichen Migrantengruppen mit ihren kulturell unterschiedlichen Lebenswelten und Lebenslagen entsprechen. Um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Forschern mit Migrationshintergrund erforderlich. In Bezug auf das Betreute Wohnen stellt sich die Frage, welche Organisationsform in Zukunft nachgefragt wird, wenn das Einzugsalter und das damit verbundene Risiko der Pflegebedürftigkeit steigt. Angesichts der zunehmenden Anzahl an älteren Menschen und der gesellschaftlichen Veränderungen des sozialen Sicherungssystems ist es fraglich, ob zukünftig genügend betreute Wohnanlagen für mittlere und niedrigere Einkommensgruppen zur Verfügung stehen werden oder ob die oben genannten Bedürfnisse nicht zusätzlich durch alternative Wohn- und Versorgungskonzepte befriedigt werden können. Ein Modell, dass sich derzeit in der Erprobungsphase befindet ist das „Betreute Wohnen zu Hause“. Dieses Konzept ermöglicht es dem alternden Menschen in der vertrauten Wohnumwelt und Nachbarschaft zu bleiben, solange die Wohnung an seine sich verändernden Kompetenzen angepasst werden kann. Die Installation eines Notrufsystems verleiht Sicherheit. Professionelle und ehrenamtliche Betreuung und Unterstützung ergänzen sich zu einem lokalen Netzwerk. Durch organisierte Treffen und ehrenamtliche Hausbesuche wird dem Bedürfnis nach sozialem Kontakt entsprochen (vgl. Kremer-Preiß & Stolarz, 2003, S. 53f). Längsschnitt77 studien könnten zeigen, ob dieses Modell das Grundbedürfnis der älteren Menschen nach einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben befriedigt und unter welchen Voraussetzungen und in welchen Siedlungsstrukturen sich dieses Modell bewährt. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der eingangs beschriebenen Folgen ist es von Bedeutung, zu erforschen, wie sich die bereits bestehenden gemeinschaftsorientierten Wohnprojekte langfristig entwickeln und ob sie eine tragfähige und nachhaltige Alternative zwischen dem „nicht alleine wohnen“ und „dem Wohnen im Heim“ darstellen. Hierbei ist ein Vergleich von altershomogenen und altersheterogenen Hausgemeinschaften interessant. Wie sehen die Unterstützungspotenziale in den unterschiedlich konzipierten Wohnprojekten aus, wenn die Zahl der Bewohner steigt, die gebrechlich und hilfebedürftig werden? Welche Erfahrungen liegen hierzu bereits vor und wie können diese Erfahrungen in die Konzeption neuer Wohnprojekte einfließen? Bislang gibt es keine exakten Daten über die zur Zeit in Deutschland tatsächlich existierenden Wohnprojekte, ihre unterschiedlichen Konzepte sowie über den „sozialen Mehrwert“ dieser Wohnform. Hierzu sind sowohl quantitative als auch qualitative Untersuchungen notwendig, die letztendlich eine Argumentationsbasis für die Kooperation mit Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften liefern können, um entsprechende Rahmenbedingungen für die leichtere Realisierbarkeit von Wohnprojekten zu schaffen. In diesem Zusammenhang sind die regionalen Unterschiede der Rahmenbedingungen interessant. Es ist der Frage nachzugehen, welche Bedingungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gegeben sind, in denen die Anzahl der existierenden Wohnprojekte deutlich höher ist als im Süden Deutschlands. Auch ein Blick ins benachbarte Ausland könnte hierzu interessante Aufschlüsse liefern. Wie in dieser Arbeit aufgezeigt, wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung das familiäre Unterstützungspotenzial verkleinern. Diese Tatsache macht deutlich, dass neue Wege gesucht und gefunden werden müssen, um soziale Netzwerke zwischen den Generationen und außerhalb der Familie aufzubauen. Das gemeinschaftsorientierte intergenerative Wohnen ist ein Schritt in diese Richtung. Aber auch das Konzept des Betreuten Wohnen birgt noch Potenziale, die soziale Netzwerkbildung zu fördern, wie das Beispiel des Betreuten Wohnen mit Gemeinschaftsorientierung zeigt. Die Begleitung all dieser Projekte für die unterschiedlichsten Zielgruppen bleibt Aufgabe der sozialwissenschaftlichen Forschung. 78 6 Literatur Antonucci, T.C. (1985). Personal characteristics, social support, and social behavior. In Binstock, R.H. & Shanas, E. (Eds.). Handbook of aging and the social sciences, 2nd edition (pp. 94-128). New York: Van Nostrand. Baltes, P.B. & Baltes, M.M. (Hrsg) (1990). Successful aging: perspectives from the behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press. Behrens, M. & Brümmer, A. (1997). Selbstinitiierte Hausgemeinschaften - eine Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen? Thema 135. Köln: KDA. Brech, J. (1999). Ein Wandel im Wohnen in der Zeit des Umbruchs. Eine Studie zu Neuen Wohnformen. In Wüstenrot Stiftung (Hrsg.). Neue Wohnformen im internationalen Vergleich (S. 81-151). Stuttgart: Kohlhammer. Bronfenbrenner, U. (1981). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Stuttgart: Klett. Borchers, A. (1998). Soziale Netzwerke älterer Menschen. In Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.). Wohnbedürfnisse, Zeitverwendung und soziale Netzwerke älterer Menschen. Deutsches Zentrum für Altersfragen. Frankfurt/Main: Campus. BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2001). Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Alter und Gesellschaft. Bonn. BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2000). Ältere Ausländer und Ausländerinnen in Deutschland. Abschlußbericht zur wissenschaftlichen Begleitung der Modellprojekte: Adentro!: Spanisch sprechende Seniorinnen und Senioren mischen sich ein. Deutsche und Ausländer gemeinsam: Aktiv im Alter. Schriftenreihe Band 175.1. Stuttgart: Kohlhammer. BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1998). Zweiter Altenbericht. Wohnen im Alter. Bonn. Cantor, M. (1979). Neighbors and friends: An overlooked resource in the informal support system. In Research on Aging, I, 434-463. Carp, F.M. (1994). Assessing the Environment. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Vol. 14, 302-313. Carp, F.M. & Carp, A. (1984). A Complementary/Congruence Model of WellBeing or Mental Health for the Community Elderly. In Altman, I., Lawton, M.P., Wohlwill, J.F. (Eds.). Human behavior and environment. Vol. 7: Elderly people and the environment (pp. 279-336). New York: Plenum Press. Cumming E. & Henry W. (1961). Growing old: The process of disengagement. New York: Basic Books. Diehl, M. (1988). Das soziale Netzwerk älterer Menschen. In Kruse, A., Lehr, U., Oswald, F. & Rott, C. (Hrsg.). Gerontologie. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Folgerungen für die Praxis (S. 268-292). München: Bayerischer Monatsspiegel Verlagsgesellschaft mbH. Diewald, M. (1993). Hilfebeziehungen und soziale Differenzierung im Alter. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 45, 731-754. Engel, F., Nestmann, F., Niepel, G. & Sickendiek, U. (1996). Weiblich, ledig, kinderlos und alt. Soziale Netzwerke und Wohnbiographien alter alleinstehender Frauen. Opladen: Leske + Buderich. Faltblatt des Vereins (o. J.). liegt der Verfasserin vor. Flade, A. (1997). Wohnen im Alter aus psychologischer Sicht. In Blonski, H. (Hrsg.). Wohnformen im Alter (S. 17-30). Weinheim: Beltz. FGWA - Forum für gemeinschaftliches Wohnen Bundesvereinigung e.V. (2005). E-mail-Auskunft vom 08.02.2005. Gottlieb, B.H. (Hrsg.) (1981). Social networks and social support. Beverly Hills: Sage. Göldner, M. (2002). Soziale Netzwerke im Alter - eine Analyse in Wohnanlagen mit Betreuung. Bachelorarbeit. Hagen: Fern-Universität. Heinze, R.G., Eichener V., Naegele, G., Bucksteeg, M. & Schauerte, M. (1997). Neue Wohnung auch im Alter. Darmstadt: Schader-Stiftung. Horowitz, A. (1985). Sons and daughters as caregivers to older parents. Differences in role performance and consequences. The Gerontologist, 25, 612-617. Jansen, D. (1998). Analyse sozialer Netzwerke. Hagen: Fern-Universität. Kahana, E., Lovegreen, L., Kahana B. & Kahana, M. (2003). Person, environment, and person-envrionment fit as influences on residential satisfaction of elders. Environment & Behavior, Vol. 35, No. 3, 434-453. 80 Kahana, E. (1982). A congruence model of person-environment interaction. In Lawton, M.P., Windley, P.G. & Byerts, T.O. (Eds.) Aging and the environment: Theoretical approaches (pp. 97-121).New York: Springer. Kahn, R.L. & Antonucci, T.C. (1980). Convoys over the life course: Attachment, roles and social support. Life-span Development and Behavior, Vol. 3, 253-386. KDA - Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.) (2000a). Vom Idealismus zum Realismus. Über fünfzehn Jahre gemeinschaftliches Wohnen älterer Menschen sowie Evaluation von zwei niederländischen Wohnprojekten mit älteren Zugewanderten. Reihe „vorgestellt“ Nr. 66, Köln: KDA. KDA - Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.) (2000b). Wohnen in Gemeinschaft - Dokumentation des deutsch-niederländischen ExpertenWorkshops 20./21. Januar 2000 in Königswinter. Köln: KDA. Kohli, M. & Künemund, H. (2000). Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Opladen: Leske + Buderich. Kremer-Preiß, U., & Stolarz, H. (2003). Neue Wohnkonzepte für das Alter und praktische Erfahrungen bei der Umsetzung - eine Bestandsanalyse. Bertelsmann Stiftung und Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hrsg.). Köln. Kruse, A. & Schmitt, E. (1995). Formen der Selbständigkeit in verschiedenen Altersgruppen: Empirische Analyse und Deskription der Aktivitätsprofile. In Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie, 8, Heft 4, 227236. Kruse, A. (1992). Kompetenz im Alter und in ihren Bezügen zur objektiven und subjektiven Lebenssituation. In Schütz, R.M., Kuhlmey, A. & Tews, H.P. (Hrsg.). Altern in Deutschland. 1. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (S. 25-32). Berlin: Theuberg. Lawton, M.P. (1999). Environmental taxonomy: Generalizations from research with older adults. In Friedman, S.L. & Wachs, T.D. (Eds.). Measuring environment across the life span. (pp. 91-124). Washington: American Psychological Association: Lawton, M.P. (1985). The elderly in context: Perspectives from environmental psychology and gerontology. Environment and Behavior. 17, 501-519. Lawton, M.P., Windley P.G & Byerts T.O (Eds.) (1982). Aging and the environment. Theoretical approches. (pp. 33-59). New York: Springer. Lawton, M.P. (1977). The impact of the environment on aging and behavior. In Birren, J.E. & Schaie, K.W. (Eds.). Handbook of the Psychology of Aging (pp. 276-301). New York: Van Nostrand. 81 Lawton, M.P. & Nahemow, L. (1973). Ecology and the Aging Process. In Eisdorfer, C. & Lawton, M.P. (Eds). Psychology of Adult Development and Aging (pp. 619-674). Washington: American Psychological Society. Lawton, M.P., & Simon, B. (1968). The ecology of social relationship in housing for the elderly. The Gerontologist, 8, 108-115. Lehr, U. & Minnemann, E. (1987). Veränderung von Quantität und Qualität sozialer Kontakte vom 7. bis 9. Lebensjahrzehnt. In Lehr, U. & Thomae H. (Hrsg.). Formen seelischen Alterns. Ergebnisse der Bonner Gerontologischen Längsschnittstudie (BOLSA) (S. 80-91). Stuttgart: Enke. Lewin, K. (1935). Dynamics theory of personality. New York: McGraw-Hill. Litwin, Howard (1995). Uprooted in old age: Soviet Jews and their social networks in Israel. Westport: Greenwood Press. Maslow, A. (1978). Motivation und Persönlichkeit. Olten: Walter. MFJFG - Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2000). Neue Wohnprojekte für ältere Menschen. Gemeinschaftliches Wohnen in Nordrhein-Westfalen. Beispiele und Wege zur Umsetzung. Düsseldorf. Murray, H.A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press. Narten, R. (2003). Gemeinschaftliches Wohnen im Alter - Erfahrungen aus den Niederlanden. Vortragsmitschrift beim Kongress „Neues Wohnen im Alter“ 6./7.11.2003 in Karlsruhe. Osterland, A. (2000). Nicht allein und nicht ins Heim. Alternative: Alten-WG. Paderborn: Junfermann. Pappi, F.U. (1987). Methoden der Netzwerkanalyse. In Pappi, F.U. (Hrsg.). Techniken der empirischen Sozialforschung, Band 1. Methoden der Netzwerkanalyse. München: Oldenburg. Saup, W. (2003). Betreutes Seniorenwohnen im Urteil der Bewohner. Ergebnisse der Augsburger Längsschnittstudie - Band 2. Augsburg: Verlag für Gerontologie Alexander Möckl. Saup, W. (2001). Ältere Menschen im Betreuten Wohnen. Ergebnisse der Augsburger Längsschnittstudie - Band 1. Augsburg: Verlag für Gerontologie Alexander Möckl. Saup, W. (1993). Alter und Umwelt. Eine Einführung in die Ökologische Gerontologie. Stuttgart: Kohlhammer. 82 Seidel, C. (2003). Neue Wohnformen für Ältere - Eine empirische Studie in verschiedenen Wohnanlagen. Magisterarbeit. Hagen: Fern-Universität. Töpfer, A.K., Stosberg, M. & Oswald, W.D. (1998). Bedingungen der Erhaltung und Förderung von Selbständigkeit im höheren Lebensalter (SIMA) - Teil VIII: Soziale Integration, soziale Netzwerke und soziale Unterstützung. Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychatrie, 11, (3), 139-158. Wahl, H.W. (1993). Kompetenzeinbußen im Alter: Eine Auswertung der Literatur zu „Activities of daily living“ und Pflegebedürftigkeit. In Zeitschrift für Gerontologie, 28, 366-377. Wahl, H. W. (1988). Alltägliche Aktivitäten bei alten Menschen. Konzeptuelle und methodische Überlegungen. Zeitschrift für Gerontologie und psychiatrie, 1, 75-81. Wagner, M., Schütze, Y. & Lang, F.R. (1999). Soziale Beziehungen alter Menschen. In Mayer, K.U. & Baltes, P.B. (Hrsg.). Die Berliner Alterstudie. 2. Auflage (S. 301-319). Berlin: Akademie-Verlag. Wellmann, B. (1981). Applying network analysis to the study of support. In Gottlieb, B.H. (Eds.). Social networks and social support. Beverly Hills: Sage. 83