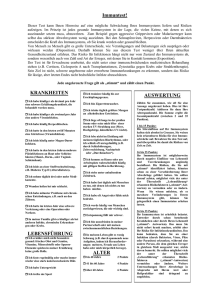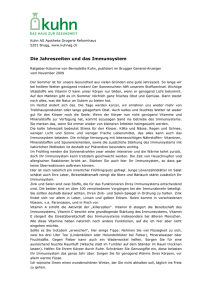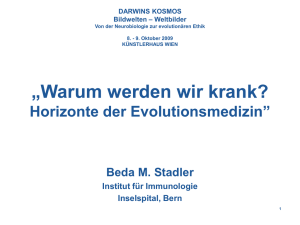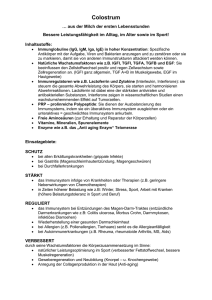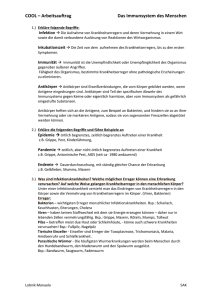Immunsystem lang - Login für den internen Bereich
Werbung

© Dr. Hadinger www.logotherapie.net [email protected] Das Immunsystem des Menschen: seine physiologischen und psychologischen Modifikationsmöglichkeiten Boglarka Hadinger 2 INHALT 1. Einleitung 5 2. Zielsetzung 6 3. Gliederung 6 4. Das Immunsystem 7 4.l Der Lymphkreislauf 8 4.2 Die lymphatischen Organe 9 4.2.1 4.2.2 4.3 Primäre lymphatische Organe 10 4.2.1.1 Das Knochenmark 10 4.2.1.2 Der Thymus Sekundäre lymphatische Organe 4.2.2.1 4.2.2.2 Der Darm Die Haut 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.2.6 Die Lymphknoten Die Milz Der Waldeyersche Rachenring Das mukosa-assoziierte lymphatische Gewebe (MALT) Die zelluläre Immunabwehr 4.3.1 4.3.2 Die Phagozyten Die T-Lymphozyten 4.3.3 4.3.4 Die B-Lymphozyten Die natürlichen Killerzellen 3 4.4 Die humorale Immunabwehr 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 Die Antikörper Die Lymphokine 4.4.2.1 4.4.2.2 Interleukin-1 (IL-1) Interleukin-2 (IL-2) 4.4.2.3 4.4.2.4 4.4.2.5 Interleukin-3 (IL-3) Interleukin-4, -5 und -6 (IL-4, IL-5, IL-6) Interferon alpha, beta und gamma (IFN-alpha, IFN-beta und IFN-gamma) 4.4.2.6 Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) Grundformen der Immunabwehr Fehlfunktionen der Immunabwehr 4.6.1 Immundefekte bzw. Immununterfunktionen 4.6.2 4.6.3 Immunüberfunktionen Immunologische Fehlreaktionen 5. Physiologische Faktoren, die das Immunsystem modifizieren 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Lärm UV-Strahlung Höhen- oder Klimawechsel Körpertemperatur Zirkadianer Rhythmus Sport 5.7 5.8 Alter Ernährung 5.8.1 Zufuhr von richtigen Nährstoffen 5.8.1.1 Vitamine 4 5.8.1.2 5.8.2 5.9 Spurenelemente Immunmodulation durch Nährstoffe im Darm Nahrungsentzug 5.10 Umweltgifte 6. Psychologische Faktoren, die das Immunsystem modifizieren 6.1 6.2 Kommunikation zwischen Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem Hormone, die durch die Gehirn-NervensystemHormonsystem-Achse das Immunsystem modifizieren können 6.3 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Glucocorticoide Katecholamine (Adrenalin und Noradrenalin) Prolaktin und Human Growth Hormone (HGH) 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Beta-Endorphin Substanz-P Andere Hormone und Botenstoffe Die wichtigsten psychoneuroimmunologischen Studien 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Immunmodulation durch Konditionierung Immunmodulation durch Streß Positive Immunmodulation durch psychische Faktoren 7. Eigene Untersuchungen 7.1 7.2 Einleitung Theoretische Grundlagen zu den Fragestellungen 7.3 7.4 7.5 Präzisierung der Fragestellung Hypothesen Meßinstrumente 5 7.5.1 7.5.2 7.6 7.7 7.8 Bestimmung der Immunparameter Erfassung der Persönlichkeitskategorien "humorvoll" und "ängstlich" 7.5.3 Emotionsauslöser Versuchsplan und Durchführung Auswertung Ergebnisse 7.9 Beantwortung der Hypothesen 7.10 Interpretation der Ergebnisse, Konsequenzen 7.11 Probleme bei der Durchführung, Kritik, abschließende Bemerkungen 8. Quintessenz der Arbeit 6 1. Einleitung Der Gedanke, daß körperliche Erkrankungen durch seelische Faktoren oder durch Umweltfaktoren begünstigt bzw. verhindert werden können, ist nicht neu. Seit der Antike überlegten sich Ärzte und Philosophen, ob und auf welche Weise die Lebenseinstellung, die seelische Verfassung, die Ernährung und die äußeren Lebensbedingungen eines Menschen dessen Gesundheitszustand verändern können. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, daß unser heutiges Gesundheits- und Krankheitsverständnis vorrangig nicht aus der Antike, sondern aus neuerer Zeit stammt: aus der Zeit der großen Krankheitsepidemien, die sich im Mittelalter durch Ansteckung ausbreiteten und erst durch eine massive Bekämpfung des zugrunde liegenden "Übels", also des jeweiligen Krankheitserregers, aus der Welt zu schaffen waren. Zu diesen Epidemien gehörten die Cholera, der Typhus und die Pest. In der Zeit dieser massiven Infektionskrankheiten begann der medizinische Kampf gegen Krankheitsauslöser, gegen die der menschliche Körper keine Chance hatte. Die Krankheiten, die jedoch heute, in der modernen Welt, den Menschen gefährden, sind nicht mehr infektiöser Art, die mit entsprechender Bekämpfung des "Übels" eliminiert werden könnten. Für etwa 70% aller Todesfälle sind zwei große Erkrankungsformen verantwortlich: einerseits die Herz-Kreislauf- und Blutgefäßerkrankungen und andererseits die karzinogenen Erkrankungen. (Egger, 1987) Beide Krankheitsgruppen sind dadurch gekennzeichnet, daß der Kampf gegen sie nur bedingt erfolgreich sein kann. Dies hat seinen Grund darin, daß die Bekämpfung dieser Krankheiten erst beginnen kann, wenn im Organismus der Schaden schon vorhanden und somit diagnostizierbar ist. Statistische Untersuchungen belegen jedoch, daß ärztliche Behandlungen nur zu 10% zur Gesundheit der Menschen beitragen können. (Gesundheitsforum Niederösterreich, 1997) Die anderen 90% hängen vom persönlichen Lebensstil ab, von der Umwelt, von sozialen Faktoren und von Erbfaktoren. 7 Wollen wir die Zahl der heute vorherrschenden Erkrankungen wirklich effektiv verringern, dann müssen wir von den heilenden (kurativen) zu den vorbeugenden (prophylaktischen) Maßnahmen übergehen. Dabei spielen die Erkenntnisse eines neuen, erst seit einigen Jahrzehnten bekannten Wissenschaftszweigs eine große Rolle: die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie. Diese zeigen uns eindeutig, daß das Immunsystem im Gegensatz zu früheren Ansichten kein unabhängiges, autonomes System darstellt, sondern daß es sowohl mit dem Hormonsystem als auch mit dem Nervensystem des Menschen eng vernetzt ist. Nervöse Veränderungen könnten demzufolge Veränderungen im Immunsystem verursachen. Veränderungen im Immunsystem könnten wiederum zur Entstehung und Verfestigung bestimmter Krankheiten führen oder sie mitbedingen. Es ergibt sich die Frage, ob diese Schlußfolgerung stimmt, und wenn ja, in welcher Hinsicht. Aufs Ganze gesehen befaßt sich die vorliegende Arbeit mit fundamentalen Fragestellungen der Psychoneuroimmunologie, und sie geht insbesondere auf physiologische und psychologische Modifikationsmöglichkeiten des Immunsystems ein. 2. Zielsetzung Die vorliegende Arbeit setzt sich drei Ziele: – Erstens möchte sie den Aufbau und die Funktion des Immunsystems so darstellen, daß diese auch für einen Nicht-Immunologen verstehbar werden. Dieser Teil der Arbeit könnte auch den Titel "Immunologie für Psychologen" tragen. Die Verfasserin erstellt dabei eine neuartige immunologische Zuordnung, indem sie insgesamt 13 unterschiedliche immunologische Abwehrmechanismen systematisch darstellt. – Zweitens setzt sich die Arbeit mit der Frage nach den physiologischen und psychologischen Modifikationsmöglichkeiten des Immunsystems auseinander und geht ganz besonders auf die Frage nach der positiven Immunmodulation ein. 8 – Drittens unternimmt sie es, durch eine eigene experimentelle Untersuchung die psychoneuroimmunologischen Erkenntnisse ein Stück voranzutreiben. Um die genannten Ziele zu erreichen, wurden von der Verfasserin mehrere hundert experimentelle Studien und Fachliteraturberichte überprüft. Die Grundlage zu dieser Untersuchung bildeten etwa 300 methodisch exakt ausgeführte und in ihren Ergebnissen bedeutsame psychoneuroimmunologische Arbeiten. 3. Gliederung Im ersten Drittel dieser Arbeit werden, wie oben erwähnt, der Aufbau und die Funktion des Immunsystems dargestellt. Die Beschreibung geht nach dem Prinzip "Vom Großen zum Kleinen" vor. Zuerst wird der Lymphkreislauf beschrieben, dann die lymphatischen Organe, dann die Immunzellen und schließlich die humorale Immunabwehr. Wie oben erwähnt, stellt die systematische Darstellung von 14 verschiedenen Immunabwehrfunktionen eine neuartige Zuordnung durch die Verfasserin dar, die die Entstehung von Gesundheit und Krankheit für den Leser besser und leichter verstehbar machen soll. Am Ende dieses Kapitels werden die wichtigsten immunologischen Erkrankungen kurz dargestellt. Im zweiten Teil dieser Arbeit geht es um physiologische und psychologische Faktoren, die das Immunsystem kurz- oder langfristig modifizieren können. In diesem Zusammenhang werden Erkenntnisse dargestellt, die für eine optimale Krankheitsbewältigung von Bedeutung sein könnten. Dabei ist zu beachten, daß die besonderen Chancen des psychoneurologischen Erkenntnisgewinns darin liegen, daß die Möglichkeiten der Vorbeugung den modernen Krankheiten gegenüber gewonnen werden. Im letzten Drittel der Arbeit wird ein von der Verfasserin durchgeführtes psychoneurologisches Experiment dargestellt, das Antwort auf folgende Fragestellung gibt: Reagieren Versuchspersonen auf eine Angstsituation immunologisch anders als auf eine humorvolle Situa- 9 tion? Wenn ja, auf welche Weise? Löst die Angst bei einer Versuchsperson eine stärkere oder eine schwächere immunologische Reaktion aus als Heiterkeit? Die Konsequenzen dieser Untersuchung könnten ebenfalls der Präventivpsychologie bzw. der Präventivmedizin zugute kommen. Zum Schluß dieser Arbeit werden diejenigen Faktoren, die das Immunsystem positiv verändern bzw. dieses stabilisieren können, noch einmal stichwortartig dargestellt. 4. Das Immunsystem Die Bezeichnung "immun" kommt aus dem lateinischen "immunis" und bedeutet "frei von Lasten". Zu Caesars Zeiten hatte dieses Wort insgesamt drei Bedeutungen: befreit sein von Steuern, befreit sein von einem Gesetz oder frei zu sein von einer Krankheit. (Duden, 5/1982) Die Immunologie, verstanden als moderne Naturwissenschaft, beschäftigt sich mit den Funktionen des körpereigenen Abwehrsystems. Sie ist gerade in den letzten Jahrzehnten zum wichtigsten Forschungszweig der Medizin geworden, da die Zunahme von Autoimmunerkrankungen, Allergien, aber auch von Krebs und AIDS nur dann einzudämmen ist, wenn das menschliche Immunsystem hinsichtlich seiner Gesetze und Mechanismen verstanden und notfalls modifiziert werden kann. Die wichtigste Funktion des Immunsystems ist der Kampf. Tag für Tag kämpfen Millionen von Abwehrzellen und Abwehrstoffen gegen Fremdkeime, Krankheitserreger, Parasiten oder entartete Eigenzellen. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Feinde des Organismus zu schädigen, zu vernichten, oder zumindest in Schach zu halten. Es handelt sich um einen ständigen Kampf, in dem der Faktor Zeit eine große Rolle spielt. Gelingt es z.B. einem Krankheitserreger, sich schneller zu vermehren, als die zytotoxischen Körperzellen ihre Wirkungen entfalten können, dann vermehrt er sich im Organismus und verursacht u.U. dessen Tod. Gelingt es hingegen den Abwehrzellen, den Wettlauf um die Zeit zu gewinnen, indem sie sich schneller 10 als die Krankheitserreger teilen und ihre Wirksamkeit rascher entfalten, dann ist die gesunde Weiterentwicklung des Organismus gewährleistet. Die nun folgende Beschreibung bietet eine Gesamtübersicht über den Aufbau und Funktion des Immunsystems. In diesem Kapitel beginnen wir mit dem größten Teilbereich des Immunsystems, dem Lymphkreislauf, und wir wenden uns dann fortlaufend immer kleineren Teilgebieten zu. Am Ende des Kapitels befassen wir uns mit dem kleinsten Teilbereich, den molekularen "Waffen" des Immunsystems. 4.1 Der Lymphkreislauf In die menschlichen Arterien wird Blut unter Druck gepumpt, damit sauerstoffreiches Blut die Organe und das Gewebe mit wichtigen Nährstoffen versorgen kann. Damit die Fließgeschwindigkeit bis zu den feinsten Kapillaren erhalten bleibt, muß das Herz etwas mehr Blut in die Gefäße pumpen als die Kapillaren aufnehmen können. Das Blutplasma sickert durch die Kapillarwände in die Gewebe des Körpers, und etwa 90% der ausgepreßten Flüssigkeit kehrt zwischen zwei Herzschlägen durch die Kapillaren der Venolen wieder in den Blutkreislauf zurück. Etwa 10% der Flüssigkeit kann jedoch nicht mehr aufgenommen werden. Sie wird von den Lymphgefäßen aufgenommen, die aus Lymphkapillaren und aus immer größeren Lymphbahnen bestehen. Täglich werden etwa 20 l Blut durch die Blutgefäße gepumpt, 18 l davon werden von den Venolen unmittelbar wieder aufgenommen, etwa 2 l werden jedoch zur Lymphe und gelangen erst später in die Blutbahn zurück. (Miketta, 1992) Der menschliche Körper besitzt demzufolge zwei große Kreislaufsysteme: den Blutkreislauf und den Lymphkreislauf. Abbildung 1A zeigt, wie die Arterien in feinen Blutkapillaren enden (rot), die dann auf Lymphkapillaren treffen (schwarz), wo die Lymphe aufgenommen und in den Lymphkreislauf transportiert wird. Abbildung 1B zeigt die Lymphgefäße und die Lymphbahnen, an deren Kreuzungspunkten die Lymphknoten liegen. 11 Abb. 1A (Klein, 1991, S. 56) Abb. 1B (Klein, 1991, S. 55) An den Kreuzungspunkten der Lymphbahnen befinden sich die Filterstationen des Lymphkreislaufs, die Lymphknoten. Die Farbe der Lymphe ist in den Lymphkapillaren klar, farblos. Nachdem die Lymphe durch die Lymphknoten geflossen ist, verändert sie ihre Farbe. Sie wird durch die in den Lymphknoten gesammelten Lymphozyten trüb und gelblich. Die Lymphe im Darm hat oft ein weißes, milchiges Aussehen, weil sie Fettreste von den Mahlzeiten enthält. Die Lymphgefäße erreichen fast alle Körperregionen. Ausnahmen sind: ein Großteil des Auges, die Plazenta, das Innenohr, das Knochenmark und die Knorpel. Ganz reich an Lymphgefäßen sind die Epidermis der Haut, der Darm, die Lungen und das Urogenitalsystem, also Körperregionen, die durch ihre Lage Krankheitserregern vermehrt ausgesetzt sind. Das Immunsystem ist dezentral im Körper angeordnet. An verschiedenen Stellen des Körpers verfügt es über "Stützpunkte", die durch die Lymphbahnen miteinander verbunden sind. Nur durch eine Zusammenarbeit zwischen Immunzellen, Immunmolekülen, immunologischen Organen und Geweben ist eine reibungslose Schutzfunktion des Organismus gewährleistet. 4.2 Die lymphatischen Organe Wir unterscheiden zwischen primären und sekundären lymphatischen Organen. In den primären lymphatischen Organen entwickeln sich die Immunzellen (Knochenmark) oder vollenden ihre Reifung (Thymusdrüse). Von dieser Produktions- oder Entwicklungsstelle aus werden sie in die sekundären Lymphorgane (Darm, Haut, Lymphknoten, Milz, Mandeln, Nasenpolypen, 12 MALT) gesandt, wo sie sich über eine längere Zeit festsetzen und, wenn notwendig, sich dann vermehren oder zytotoxische Botenstoffe produzieren. Von den sekundären lymphatischen Organen aus können die Immunzellen alle Körperregionen erreichen. Nach einem "Kontrollgang" kehren sie jedoch immer wieder an ihren Bestimmungsort zurück. Abb. 2 (Tweel, 1991, S. 15) 4.2.1 Primäre lymphatische Organe 4.2.1.1 Das Knochenmark Im roten Knochenmark findet die Produktion aller Lymphzellen statt. Beim Fetus wandern etwa ab der 9. Schwangerschaftswoche Zellen aus der Leber in das rote Knochenmark. Dort entstehen aus den pluripotenten Stammzellen die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen und alle Immunzellen. Aus den lymphatischen Stammzellen entstehen Killerzellen, T-Zellen und B-Zellen. Aus den myelouschen Stammzellen werden Granulozyten und Makrophagen. Abb. 3 (Miketta, 1992, S. 79) Alle Lymphzellen werden im Knochenmark produziert. Sie entwickeln sich jedoch unterschiedlich. Die T-Lymphozyten zum Beispiel bleiben nur sehr kurz im Knochenmark. Bald nach ihrer Entstehung treten sie durch die Sinuswände des Knochenmarks in die Blutbahn ein 13 und erreichen ihren eigentlichen Differenzierungsort, die Thymusdrüse. Die B-Lymphozyten (die aus dem Knochenmark, also bone marrow, stammenden Lymphozyten) reifen länger im Knochenmark und verlassen es später. Sie bleiben dann im Blutstrom und reifen dort zu abwehrfähigen Lymphozyten. Damit die Lymphzellen, die etwa 10% aller Knochenmarkzellen ausmachen, in das Kreislaufsystem gelangen können, müssen sie durch die retikulären Zellen der Poren dringen, dann die Basalmembran und das Zytoplasma der Endothelzelle passieren. Der Austritt aus dem Knochenmark ist kein einfaches "Ausfließen", sondern ein aktives "Hindurchquetschen". (Klein, 1991, S. 79) 4.2.1.2 Der Thymus Die Thymusdrüse eines Kindes liegt auf dem Perikard, das das Herz umkleidet, und erstreckt sich bis an das obere Ende des Brustbeins. Sie besteht aus zahlreichen Kammern, die voneinander durch dünne Trennwände getrennt sind. Die Kammern sind jedoch nicht voneinander isoliert, denn die Trennwände zum Organzentrum hin sind offen, so daß eine Verbindung zwischen den Kammern vorhanden ist. Das Epithel des Thymus hat ein uncharakteristisches, schwammiges Aussehen. Der Grund für dieses ungewöhnliche Aussehen des Thymusepithels liegt in den Lymphozyten. Diese werden, wenn sie in der Thymusdrüse ausreifen, T-Lymphozyten oder Thymozyten genannt. Die T-Lymphozyten schieben sich zwischen die Epithelzellen, drücken sie auseinander und verursachen dadurch deren uncharakteristisches Aussehen. Der Thymus ist ein fast völlig abgeschlossenes Organ, das durch verschiedene Gewebeschichten von der übrigen Blutbahn getrennt ist (Blut-Thymus-Schranke). Nur bestimmte Zellen werden in den Thymus hineingelassen, vor allem die Lymphozyten und wenige Makrophagen, die an der "Schulung" der Lymphozyten teilnehmen. In der Thymusdrüse findet nach einem bestimmten Selektivverfahren die Ausdifferenzierung, die Schulung und die Selektion der T-Lymphozyten statt. Über die Schulung wissen 14 wir nur soviel, daß Makrophagen aus den verschiedenen Körpergeweben Eigenzellen in die Thymusdrüse transportieren und deren Bruchstücke dann den T-Lymphozyten unter dem Imperativ: "körpereigen: tolerieren!" präsentieren. Ebenso werden Bruchstücke körperfremder Zellen und entarteter Eigenzellen in den Thymus mit der Information transportiert: "körperfremd: reagieren!". Die Informationsweitergabe erfolgt natürlich nicht durch Codeworte, sondern durch den aus dem Hormonsystem gut bekannten Mechanismus der Rezeptorenbildung. T-Lymphozyten lernen es in der Thymusdrüse, komplementär zur Oberflächenstruktur der Fremdproteine Rezeptoren auszubilden, während sie keine Rezeptoren für körpereigene Proteine entwickeln sollten. Die Selektion der fehlerhaften T-Lymphozyten läuft dann in zwei Schritten ab: Durch ein Siebverfahren werden zunächst nur diejenigen Lymphozyten, die keine Rezeptoren für körpereigenes Gewebe an ihrer Oberfläche tragen, also körpereigenes Gewebe tolerieren, in die inneren Kammern der Thymusdrüse durchgelassen (positive Selektion). Der Rest wird in den äußeren Kammern abgetötet. In einem zweiten Schritt wird die Oberflächenstruktur der Lymphozyten noch einmal geprüft, und zwar jetzt im Hinblick auf ihre Rezeptoren gegen Fremdproteine oder gegen entartetes Eigengewebe. Nur diejenigen T-Lymphozyten, die für alle vorher von den Makrophagen präsentierten Fremdproteine Erkennungsrezeptoren an ihrer Oberfläche tragen und dadurch auf körperfremde Moleküle reagieren können, werden durch ein zweites Siebverfahren in die Blutbahn des Organismus durchgelassen (negative Selektion). Diejenigen T-Lymphozyten, die Eigengewebe als solches identifizieren und in seiner Gegenwart reaktionsfrei bleiben, die aber auch nur einen einzigen Rezeptor zuwenig an ihrer Oberfläche tragen und dadurch körperfremde Eiweiße nicht erkennen, werden als fehlerhaft erkannt und eliminiert. Nur etwa 15% aller Lymphozyten, die in die Thymusdrüse gelangen, überleben den Selektionsprozeß und werden als aktive Abwehrzellen in die Blutbahn abgege- 15 ben. (Zänker, 1996, S. 68) Abb. 4 (Weissmann und Cooper, 1994, S. 23) Die Thymusdrüse stellt aufgrund ihrer "Schulungsfunktion" das Gehirn des Immunsystems dar. Ihr größtes relatives Gewicht (im Vergleich zum Körpergewicht) hat sie zum Zeitpunkt der Geburt. Ihr absolutes Gewicht steigt bis zur Pubertät, dann beginnt sie sich schrittweise zu involvieren (einzurollen). Ein erwachsener Mensch besitzt nur mehr Reste der Thymusdrüse. Ein etwa 60jähriger Mann nur mehr einige Epithelreste (Klein, 1991). Die Involution der Thymusdrüse wird von Hormonen gesteuert, aber ihr genauer Mechanismus ist noch nicht bekannt. Fest steht, daß durch Kastration die Involution der Thymusdrüse verlangsamt wird (Abhängigkeit von Sexualhormonen) und daß durch Injektion von Corticosteroiden oder durch Dauerstreß ihre Schrumpfung beschleunigt werden kann (Beeinflußbarkeit durch Streßhormone). In der geschrumpften Thymusdrüse werden natürlich weniger T-Lymphozyten produziert, weil die Geschwindigkeit der Proliferation abnimmt. Nach dem Absterben der Thymusdrüse können sich die T-Lymphozyten nicht mehr in ihr vermehren und auch nicht mehr in ihr "geschult" werden. Die zukünftige Proliferation erfolgt dann in den anderen lymphatischen Organen (Milz, Lymphknoten). Die Informationsweitergabe erfolgt nach einem Sekundärprinzip: Die sogenannten "geschulten" T-Lymphozyten docken an die aus dem Knochenmark neu geschlüpften Rezeptoren an und halten einige Sekunden lang Kontakt zu ihnen. Die Lymphozyten, die sich aus der biologischen "Umarmung" lösen, sind anschließend ebenso einsatzfähig wie ihre Vorgänger. Daß natürlich mit zunehmendem Alter eines Menschen die optimale Reaktionsfähigkeit des Immunsystems abnimmt, ist verständlich. Denn die 16 Informationsweitergabe funktioniert nach dem Prinzip der "stillen Post", das mit zunehmendem Lebensalter zunehmende Fehlerquellen mit sich bringt. 4.2.2 Sekundäre lymphatische Organe Unter sekundären lymphatischen Organen bezeichnen wir Körperregionen, in deren Gewebe sich Immunzellen ansiedeln. Zu den sekundären lymphatischen Organen zählt der Darm, die Haut, die Lymphknoten, die Milz, die Mandeln und das Schleimhautsystem. 4.2.2.1 Der Darm Das Immunorgan Darm stellt mit seiner Gesamtoberfläche von etwa 200 m² die größte Schutzfläche des menschlichen Organismus dar. (Schöllmann, 4/1995) Die Lunge hat im Vergleich dazu eine Gesamtoberfläche von etwa 80 m² und die Haut 2 m². Der Darm kommt, aufgrund der Nahrungsaufnahme, in sehr hohem Maße mit Fremdstoffen und Krankheitserregern in Kontakt. Er gehört aber auch zu den funktional vielseitigsten Organen des menschlichen Körpers. Seine Funktion umfaßt Sekretion, Transport, Aufspaltung und Absorption der Nahrungsbestandteile, Exkretion der unverwendbaren Reste und die Ausbildung von humoralen und zellulären Abwehrmechanismen. Für die Verwertung von Nahrungsmitteln ist die spezielle physiologische Darmflora von größter Bedeutung. Die Immunfunktion wird vom Schleimhautsystem des Darms, vom GALT (gut-associated lymphoid tissue) übernommen. Daß beide Systeme aufgrund ihrer Zusammenarbeit in Wechselwirkung miteinander stehen, ist naheliegend. So können zum Beispiel scharfe oder toxische Nahrungsmittel nicht nur die Darmflora zerstören, sondern auch die Produktion von Immunglobulinen, die sehr häufig im Darm produziert werden, herabsetzen. Die Folge ist eine verminderte Antikörperreaktion im ganzen Organismus. Einfach ausgedrückt: Eine falsche Ernährung legt das Immunsystem zeitweise "lahm" und bewirkt, daß wir u.U. häufiger einen Schnupfen, eine andere Infektion 17 oder eine karzinogene Erkrankung bekommen. Umgekehrt wissen wir auch, daß das Immunsystem einen wichtigen Einfluß auf die Darmflora hat. So wird zum Beispiel während einer erhöhten Immunreaktion die Aktivität der Darmflora aus Energiespargründen herabgesetzt. Dies ist der Grund, weshalb Menschen, die an einer akuten Infektionserkrankung leiden, keine schweren Nahrungsmittel vertragen. Andererseits kann eine Überreaktion des Immunsystems wiederum die gesamte Darmflora bis hin zur Darmwand zerstören. Ein Beispiel dafür ist Morbus Crohn. Ebenso findet ein "Zusammentreffen" des Hormonsystems mit dem Immunsystem unter anderem im Darm statt: Streßhormone, ganz besonders Corticosteroide, gelangen über die Blutbahn in den Darm, wo sie ihre immunologische Destruktivität mehrere Stunden lang ungehemmt entfalten können. Bis vor einigen Jahren wurde die Funktion des Darms als Immunorgan weitgehend unterschätzt. Heute wissen wir, daß etwa 70% der erworbenen Immunität ihren Ursprung im Darm hat. Hier findet ganz besonders häufig die Antigenpräsentation durch die Makrophagen statt. Hier werden ebenso häufig T-Zellen aktiviert und dadurch die Antikörperproduktion durch die B-Lymphozyten angeregt. Innerhalb des Schleimhautsystems des Darms gibt es regelrechte "Nester", die aus besonders dichtem lymphatischem Gewebe mit vielen isolierten Lymphfollikeln bestehen. Die beiden wichtigsten "Nester" sind die Peyersche Plaques und der Appendix vermiformis. (Klein, 1991) Die Frage, wie die durch die B-Lymphozyten produzierten Antikörper, vor allem das IgA, aus dem Darm im gesamten Körper zwecks Virusabwehr verteilt werden, ist mittlerweile bekannt. Das Schleimhautsystem des Darms (GALT) steht in physiologischer Verbindung mit den übrigen Schleimhautsystemen des menschlichen Körpers, mit dem MALT (mukosa-assoziiertes lymphatisches System. Die Mukosa ist die Schicht, die alle Körperhöhlen auskleidet). Die Immunglobuline, vor allem IgA, verlassen sehr häufig ihre Produktionsstätte im Darm und gelangen durch eine Wanderung im Schleim- 18 hautsystem zuerst in den Magentrakt, dann in das Schleimhautsystem der Atemwege. Sie können aber auch über den Blutstrom alle mukosa-assoziierte Gewebe erreichen. Diese sind: der Urogenitaltrakt, die Speichel- und Tränendrüsen, der Bronchialtrakt und die laktierende Brust stillender Frauen. Etwa 20% der IgA-Menge im MALT stammen ursprünglich aus dem Darm. (Klein, 1991, S. 395) Abb. 5 (Klein, 1991, S. 395) Wie vorher erwähnt, besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen Darmflora und Darmimmunsystem. So besetzen zum Beispiel Zellteile der Darmflora freiliegende Bindungsstellen an der Darmwand und verunmöglichen dadurch Krankheitserregern das Anhaften bzw. das Durchdringen in den Organismus. Andererseits werden die pathogenen Eindringlinge mit antibiotischen Substanzen wie zum Beispiel Bakteriozinen angegriffen. Interessant ist auch die Tatsache, daß ein neugeborenes Kind keimfrei geboren wird (Blut-Plazenta-Schranke). Aber schon wenige Stunden nach der Geburt besiedeln Bakterien den zuvor keimfreien Darm. Der erste Schutz dagegen wird durch die hohe IgA-Konzentration in der Muttermilch gewährleistet, zusätzlich beginnt das noch unreife Immunsystem des Säuglings Krankheitserreger zu erkennen, um diese später selber vernichten zu können. Im Immunsystem der Darmschleimhaut besteht normalerweise ein Gleichgewicht zwischen Aktivierung und Toleranz. Der bestimmende Faktor, der über Aktivierung oder Toleranz entscheidet, ist der Makrophage, der in der Darmschleimhaut in großen Mengen vorkommt. Harmlose physiologische Keime, die keine Immunreaktion hervorrufen, sondern einfach unter den Exkrementen gemischt den Körper verlassen sollten, werden von den Makro- 19 phagen nicht angegriffen. Damit wird eine immunologische Reaktion verhindert. Im Gegensatz dazu werden krankheitserregende oder vermehrungsfähige Keime von den Makrophagen phagozytiert. Damit wird die Kaskade der Immunreaktion ausgelöst und der pathogene Keim zur Vernichtung durch das zelluläre oder humorale Immunsystem freigegeben. 4.2.2.2 Die Haut Die Haut stellt die direkte Grenze zwischen der Außenwelt und dem Gesamtorganismus eines Menschen dar. Als erste Kontaktstelle ist sie natürlich am häufigsten Antigenen ausgeliefert. Aus diesem Grunde ist der Gesundheitszustand eines Menschen maßgeblich von der optimalen Schutzfunktion seiner Haut abhängig. (Als "Antigen" bezeichnen wir Fremdkörper wie z.B. Viren, Bakterien oder Giftstoffe, während die körpereigenen Abwehrmoleküle "Antikörper" genannt werden.) Zwei Schutzschichten stellen die erste Trennungslinie zwischen Haut und Organismus dar: die Fettschicht der Haut, die die eventuellen Einstiegsstellen mit einem dünnen Schutzfilm überzieht und so eine mechanische Abwehr bietet, und der Säuremantel der Haut, der durch seine chemische Zusammensetzung eine Verklumpung und dadurch die Bewegungseinschränkung mancher Bakterien verursacht. Im Fettsäurefilm sind jedoch auch Enzyme enthalten (Nukleasen, Proteasen, Lysozyme), die Antigene aktiv angreifen können. (Zänker, 1996) Die Haut selbst wird aus zwei Hauptanteilen gebildet, aus der Epidermis, der oberen Hautschicht, und aus den inneren Bindegewebe, der Dermis. Beide Hautschichten sind reich an Immunzellen: Gewebsmakrophagen, Granulozyten, Mastzellen, lymphatische Endothelzellen und Lymphozyten sind dicht nebeneinander angeordnet, um potentiellen Eindringlingen Einhalt zu gebieten. Da die Haaransätze eine besonders günstige "Einschlupfstelle" für Krankheitserreger darstellen würden, ist jede einzelne Haarwurzel von dichtem lymphati- 20 schem Gewebe umgeben (Abb. 6). Abb. 6 (Klein, 1991, S. 391) Ein Antigen, das die Haut durchdringt, wird von den Antigen präsentierenden Zellen der Haut aufgenommen, wahrscheinlich von den Langerhans-Zellen in der Epidermis, und von diesen zerlegt. Nach der Zerlegung findet die Präsentation durch die MHC-Moleküle statt. Zerlegte Antigene in der Haut werden häufig den speziellen Haut-T-Lymphozyten präsentiert und dadurch der Vernichtung preisgegeben. Oder die Langerhans-Zellen wandern mit ihnen zu den drainierenden Lymphknoten und lösen somit die Immunkaskade aus. Starke UVStrahlung kann die Langerhans-Zellen der Epidermis jedoch zerstören, was eine verminderte Antigenpräsentation und dadurch eine verminderte Immunfunktion auslöst (Hautkrebs). Interessanterweise besteht ein Zusammenhang zwischen der "Kommandozentrale" des Immunsystems, der Thymusdrüse, und der Haut. Mutationen der Thymusdrüse gehen fast immer auch mit einer Mutation der Haut einher. Die aus den Transplantationsexperimenten bekannte Nacktmaus zum Beispiel verfügt über das mutierte Nackt-Gen, das sowohl Haarlosigkeit als auch eine Entwicklungsstörung des Thymus verursacht. Deshalb behalten Nacktmäuse jedes Transplantat, vom menschlichen Ohr bis hin zum Schweineknorpel, unter ihrer Haut. Die Genstörung verhindert die in der Transplantationsmedizin so gefürchtete Abstoßungsreaktion der Immunzellen. 4.2.2.3 Die Lymphknoten Die Lymphknoten befinden sich an den Kreuzungspunkten der Lymphgefäße. Sie stellen Fil- 21 terstationen dar, durch die aus den Organen oder aus dem Körpergewebe kommende Lymphe fließt, bevor sie in größere Lymphgefäße und dann in das Blut einmündet. Im menschlichen Körper gibt es Tausende von Lymphknoten, manche stecknadelkopfgroß, manche so groß wie eine Walnuß. (Faller, 1988) Besonders viele und besonders große Lymphknoten finden wir in den Achselhöhlen, in den Leisten, vor der Aorta abdominalis, am Hals und im Mesenterium. Diese Stellen sind Kreuzungspunkte der großen Lymphbahnen. Die Funktion der Lymphknoten ist vielseitig: 1. Sie filtern Keime und Fremdstoffe aus, die mit der Lymphe in die Lymphknoten gelangen; 2. In ihnen wird das Fremdmaterial durch die Phagozytose zerlegt; 3. Sie ermöglichen durch ihr Zellgerüst die Interaktion zwischen den einzelnen Immunzellen (z.B. regen T-Lymphozyten die B-Lymphozyten vor allem in den Lymphknoten zur Antikörperproduktion an); 4. Sie speichern Lymphozyten und Makrophagen, welche sich immer nur eine kurze Zeit lang im Blut, in der Lymphe oder im Körpergewebe für eine "Arbeitszeit" aufhalten und dann wesentlich länger in den lymphatischen Organen, so auch in den Lymphknoten, verweilen. Ein Leukozyt hält sich zum Beispiel nur etwa ein bis zwei Stunden lang im Blut auf (Verweilzeit), während seine Lebensdauer etwa 100 bis 300 Tage sein kann. (Birbaumer, Schmidt, 1990) Die Lymphe fließt über afferente Lymphbahnen durch die Lymphknoten. Jeder Lymphknoten wird durch eine einzige Arterie versorgt. Aus den Lymphknoten führt entweder ein größeres Lymphgefäß oder, je nach anatomischer Lage, ein Blutgefäß (efferente Bahnen). In den Lymphknoten selbst gibt es primäre und sekundäre Lymphfollikel. Die primären Lymphfollikel sind ständig mit Lymphe gefüllt, die sekundären Follikel entstehen auf einen Antigenreiz hin, indem inaktive Lymphfollikel anzuschwellen beginnen. In ihnen können nun die B-Lymphozyten sich teilen und differenzieren und zur Produktionsstätte der Antikörper werden. Angeschwollene Lymphknoten sind zum "Bersten voll" mit antikörperproduzierenden B-Lymphozyten. Ihre Kapsel wird gedehnt, und dies löst über die Nervenfasern Schmerz- 22 empfindung aus. (Zänker, 1996) Wir wissen heute, daß über die Rezeptoren der Nervenfasern, die direkt bis in die Lymphknoten reichen, Neurotransmitter in die Lymphknoten und dadurch in das gesamte Immunsystem "geschleust" werden können. Ebenso wissen wir, daß Lymphozyten auf ihrer Oberfläche Rezeptoren für Neurotransmitter tragen. Dadurch ist eine Kommunikation zwischen Nerven- und Hormonsystem einerseits und Immunsystem andererseits auch in den Lymphknoten gewährleistet. (Zänker, 1996) Abbildung 7 zeigt den Querschnitt eines Lymphknotens. Abb. 7 (Nossal, 1995, S. 15) 4.2.2.4 Die Milz Die Milz ist sowohl phylo- als auch ontogenetisch ein Abkömmling des Darms. Sie ist als Organ das größte lymphatische Gewebe des Menschen, etwa faustgroß, ähnlich aufgebaut wie die Lymphknoten. Sie wird ebenfalls von einer Kapsel umgeben und von Trabekeln durchzogen. Im Gegensatz zu den Lymphknoten ist jedoch die Milz nicht in den Kreislauf der Lymphe, sondern in den Blutkreislauf eingeschaltet. Es gibt keine Lymphgefäße, durch die die Lymphe in die Milz hineinfließt (afferente Lymphgefäße), sondern nur solche, durch die die Lymphe, in der Milz beginnend, aus der Milz herausfließt (efferente Lymphgefäße). Das innere Milzgewebe besteht aus feinem, retikulärem Gewebe, das viele Lymphozyten, Erythrozyten und andere reife Blutzellen enthält. Obwohl die Milz nicht lebensnotwendig ist und sie früher nach Unfällen (Milzrißgefahr) oder Magenoperationen oft vorbeugend entfernt wurde, wissen wir heute von ihrer wichtigen Immunfunktion: 1. Sie arbeitet als Trennfilter von Blutzellen, indem sie Blutzellen in verschiedene Kompartimente verteilt, sie nach Fehlern untersucht und manche vernichtet, andere wiederum 23 speichert oder konzentriert (als Mechanismus benützt sie dazu das von der Oberflächenstruktur abhängige Siebsystem). 2. Ähnlich wie in den Lymphknoten wird auch in der Milz Fremdmaterial von den Makrophagen aufgenommen und zerstört. Wie vorhin erwähnt, fließt jedoch im Gegensatz zu den Lymphknoten durch die Milz nicht Lymphe, sondern Blut. Eine wesentliche Aufgabe der Milz ist demzufolge auch die Blutreinigung. 3. Die immunologische Funktion der Milz ähnelt der der Lymphknoten: Sie filtert und präsentiert Antigene, speichert Lymphozyten und Makrophagen. Darüber hinaus ermöglicht sie die Interaktion zwischen Lymphozyten und Makrophagen. 4.2.2.5 Der Waldeyersche Rachenring (Tonsillen) "Das lateinische Wort Tonsa bedeutet Ruder, ein Pfahl, der an der Küste aufgestellt wird, und genauso sehen Tonsillen aus, sechs schmale Pfähle, die um den Eingang des oberen Teils des Verdauungstraktes angeordnet sind." (Klein, 1991, S. 59) Die sechs Pfähle sind wie ein Schutzring im Nasen- und Rachenbereich angeordnet: 1. Die zwei Tonsillae palatinae sind mandelförmige Lymphfollikel, in der Umgangssprache wegen ihrer Form "Mandeln" genannt. Sie befinden sich auf den beiden Seiten der Rachenhinterwand. Ihre Oberfläche ist durch Spalten und Krypten zerklüftet. In ihnen lauern Lymphozyten und Antikörper auf Krankheitserreger. Da jedoch die Zerklüftungen in Form von Spalten und Krypten auch abgestoßene Epithelzellen, tote Lymphzellen und ausgesickerte Verdauungsflüssigkeit enthalten, bieten sie einen idealen Nährboden für Bakterien und bestimmte Pilze. Deshalb kommt es häufig zu einer Entzündung der Rachentonsillen, die bei Wiederholung eine chronische Entzündungsquelle des gesamten Organismus darstellt. Die operative Entfernung der Tonsillen bedeutet in diesem Falle eine Schwächung des Rachenschutzringes, jedoch die Beseitigung eines chronischen 24 Entzündungsherdes. 2. Die Tonsilla pharyngea, "Nasenpolype", befindet sich an der Hinterwand des Nasenpharynx. Bei ihrer Vergrößerung blockiert sie die Nasenwege und zwingt die betroffenen Menschen zur Mundatmung. 3. Die zwei Tonsillae tubariae liegen in der Nasenhöhle, in der Nähe der Öffnung der zwei Tubae eustachii. (Classen, 1991) 4. Die Tonsilla lingualis besteht aus einer Ansammlung von etwa 40-100 Krypten, die jeweils mehrere Lymphfollikel enthalten. Da auf den Zungentonsillen im Gegensatz zu den Rachentonsillen Speicheldrüsen münden, die durch ihre Flüssigkeit das angesammelte Material in den Höhlen und Krypten ständig wegspülen, ist eine Entzündung der Zungentonsillen selten. Die Oberfläche der sechs Tonsillen ist von einer Epithelschicht bedeckt. Sie sind durch eine fibröse Kapsel von ihrer Umgebung getrennt. In den Zwischenräumen der Kapsel lagern sich millionenfach Lymphozyten, die die erste Barriere für eingeatmete oder durch die Nahrung aufgenommene Krankheitserreger und Fremdkörper darstellen. Eine wichtige Funktion besitzen die Tonsillen auch dadurch, daß sie von einem Netz von Lymphgefäßen umgeben werden: Diese "übernehmen" die von den Tonsillen eingefangenen Antigene und transportieren sie wie durch eine Rohrpost direkt zu den Lymphknoten, wo die vielseitigsten Vernichtungsmöglichkeiten auf sie warten. 4.2.2.6 Das mukosa-assoziierte lymphatische Gewebe (MALT) Das schleimhautassoziierte Lymphgewebe besiedelt die Atemwege, den Urogenitaltrakt und das Verdauungssystem. Es kleidet sozusagen alle Körperhöhlen aus. Seine Immunfunktion ist vorwiegend auf lokale Immunantwort konzentriert, damit eingedrungene Krankheitserreger an Ort und Stelle vernichtet werden können. Ein neugeborenes Kind kommt zunächst 25 keimfrei mit einem beschränkten Immunsystem (angeborenem Immunsystem), aber ohne MALT-System auf die Welt. Schon einige Minuten nach der Geburt beginnen Mikroorganismen das Neugeborene zu besiedeln. Wahrscheinlich als Antwort auf die Antigene beginnt sich das MALT im Schleimhautsystem des Säuglings auszubreiten (erworbenes Immunsystem). Einen zusätzlichen Schutz findet der Säugling im mütterlichen Kolostrum – in der ersten Milch, die nach der Schwangerschaft in der Brust der Frau gebildet wird und das zum größten Teil aus Immunabwehrstoffen besteht. An zahlreichen, exponierten Stellen des MALT gruppieren sich die Lymphozyten dicht aneinander und nehmen nun eine kugelförmige Gestalt an. Wir nennen sie dann Lymphfollikel. Diese Lymphfollikel haben keine feste Position im MALT. Sie können je nach Bedarf weiterwandern, sich auflösen oder neu bilden. Nach Schätzungen der Histologen besitzt der Darm eines gesunden Kindes etwa 15.000 Follikel. (Klein, 1991, S. 58) Die Lymphfollikel, aber auch die einzelnen Immunzellen des MALT verlassen sehr häufig ihre Ursprungsstellen und wandern durch das Schleimhautsystem in andere Stellen des Körpers, zum Beispiel aus dem Darm in die Atemwege. Abbildung 8 zeigt, wie ein Antigen, z.B. ein Virus, durch den Mund über das Schleimhautsystem in den Darm bis zur Peyerschen Plaque eindringt. Dort werden B- und T-Lymphozyten aktiviert. Die B-Lymphozyten verlassen das Darmgewebe durch die Lymphkapillaren und fließen mit der Lymphe in die Lymphknoten. Dort beginnen sie sich zu teilen, und gleichzeitig produzieren sie die Antikörper IgA (Immunglobulin Alpha), die die Antigene unschädlich machen können. Die B-Lymphozyten, die nun vermehrt IgA produzieren, verlassen mit der efferenten Lymphflüssigkeit die Lymphknoten und gelangen über den Ductus thoracicus ins Blut, wo sie sich weiter teilen und IgA produzieren. Das Blut verteilt nun die Plasmazellen in den spezifischen lymphatischen Geweben der Mukosa, so zum Beispiel in den Speicheldrüsen, den Tränendrüsen, dem Urogenitaltrakt, den Atemwegen und der laktierenden Brustdrüse. Bei einem neuerlichen Kontakt mit dem Antigen 26 warten dann Millionen von Antikörpern als "Verteidiger" auf den Krankheitserreger, die nunmehr zu einem Teil der erworbenen Immunität gehören. Abb. 8 (Klein, 1991, S. 395) Im MALT treffen wir sowohl auf zelluläre als auch auf humorale Immunität. Die zelluläre Verteidigung wird erreicht durch Lymphozyten, natürliche Killer-Zellen, Makrophagen, Mastzellen und Eosinophile. Die humorale Verteidigung im MALT erfolgt durch die Immunglobuline (IgA; IgE; IgG und IgM), die durch die B-Lymphozyten produziert werden. Die Immunglobuline besitzen zwar keine direkte Vernichtungsfähigkeit gegen Antigene, durch ihre spezifische Bindungsfähigkeit an den Antigenen ermöglichen sie jedoch deren Vernichtung durch die Phagozyten (siehe auch unter "Phagozyten" und "Antikörper"). Gelingt es einem Antigen, die ersten Barrieren der Körperabwehr, die Haut und die Schleimhäute, zu überwinden, so trifft es auf zwei weitere Abwehrfronten: auf das zelluläre und auf das humorale Abwehrsystem. Manche Teile der zellulären und der humoralen Abwehr sind spezifisch, d.h., eine Zelle kann nur gegen ein einziges Antigen wirksam werden. Andere wiederum besitzen die Fähigkeit, unspezifisch, gegen verschiedene Arten von Krankheitserregern ihre Aktivität zu entfalten. In immunologischer Perspektive gibt es keine "gute" oder "bessere" Abwehrstrategie. In manchen Situationen ist eine allgemeine, breit angelegte Abwehr das Optimale. Differenzierte, in ihrer Genstruktur raffiniert ausgestattete Krankheitserreger können jedoch nur durch eine hochspezialisierte Abwehrmöglichkeit bekämpft werden. 27 4.3 Die zelluläre Immunabwehr 4.3.1 Die Phagozyten Die Phagozyten, "Freßzellen", zirkulieren im Körpergewebe und in den Körperflüssigkeiten und halten Ausschau nach Fremdkörpern, die sie verschlingen können. Sie wirken unspezifisch und können nicht nur bestimmte Bakterien und Viren, sondern auch abgestorbene Körperzellen und Partikeln wie Holzkohle, Asbest oder Polystyrol in sich aufnehmen und "verdauen". Die Phagozyten werden, ebenso wie die anderen Immunzellen im Knochenmark erzeugt, gelangen dann ins Blut, wo sie sich weiter differenzieren, durchdringen dann die Blutkapillarwände und patrouillieren sodann im Gewebe, um nach "Nahrung", also Antigenen, Ausschau zu halten. Sie besitzen die Fähigkeit, die Antigene bis auf einen kleinen Rest so zu verarbeiten, daß diese ihnen sogar als Energiezufuhr dienen. Einfacher gesagt: Um leben zu können, brauchen die Phagozyten verschlungene Antikörper. Lediglich ein kleiner Rest an unverdaubaren Abfallstoffen wird vom Phagozyten nicht verwertet. Erreicht dieser Rest ein bestimmtes Maß, können also Phagozyten keine Abfallstoffe oder Krankheitserreger mehr aufnehmen, dann sterben sie selber ab und werden von ihren Nachfahren selber phagozytiert. (Forum Immunologie, 5/1994) Die wichtigsten Phagozyten sind die Neutrophile, die Eosinophile, die Monozyten und die Makrophagen. Im "normalen" Zustand, also dann, wenn keine Krankheitserreger im Körper sind, filtrieren diese das Blut und die Lymphe und phagozytieren die üblichen Abfallstoffe (z.B. Zelltrümmer oder Staub). Obwohl die Phagozyten auch unvorbereitet Antigene aufnehmen können, sind sie in den meisten Fällen auf Hilfeleistung angewiesen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden: Die meisten Antigene erkennen sie erst dann, wenn diese "mit Butter beschmiert" sind. (Klein, 1991, S. 330) Diese Erkennungshülle besteht aus Opsoninen. Das wichtigste Opsonin ist das Immunglobulin-Gamma (IgG)-Antikörper. Die Phagozytose kann 28 nun folgendermaßen dargestellt werden: Ein Antigen überschreitet die ersten Schutzwälle des Körpers und wird von den spezifisch veranlagten IgG-Antikörpern (ein IgG erkennt nur ein bestimmtes Antigen) entdeckt. Das IgG, ein Y-förmiges Molekül, haftet mit einigen anderen IgG-Molekülen der gleichen Familie an der Oberfläche des Antigens. Der Antigen-Antikörper-Komplex wird nun von den in den Körperzellen und in den Körperflüssigkeiten patrouillierenden Phagozyten entdeckt. Im Augenblick der Berührung haftet der Stamm der IgG-Moleküle am Phagozyten. Nun beginnt: 1. Aufnahmephase: An der Stelle der Anhaftung verändert sich die Membranschicht des Phagozyten. Sie wird dünner, bildet eine becherförmige Struktur, umhüllt immer mehr und mehr das Antigen, das schließlich im Phagozyten "verschwindet". Die Membran schließt sich wieder über das Antigen. Abb. 9 (Klein, 1991, S. 332) 2. Verdauungsphase: Das eingeschlossene Antigen wandert nun in das Zellinnere, also in das Zytoplasma. Der Phagozyt, z.B. ein Neutrophil, trägt in seinem Zellinneren mehrere membranbegrenzte Granulabläschen. Diese bewegen sich im Zellinneren und treffen irgendwann auf das Antigen. Die Granulabläschen, die mit Enzymen gefüllt sind, öffnen beim Kontakt mit dem Antigen ihre Membranporen und ergießen ihren Inhalt in das eingeschlossene Antigen. Die Folge ist eine Ansäuerung des Phagosoms (also des eingeschlossenen Antigens), weil durch die Enzymüberschüttung der Granulabläschen der pH-Wert des Phagosoms innerhalb weniger Minuten einen Wert von pH -4 oder noch weniger aufweist. In dieser übersäuerten Umgebung können nur wenige Krankheitserreger überleben, geschweige denn 29 sich vermehren. Die Enzyme der Granula jedoch können gerade auf dieser Basis den Abbau des Antigens erledigen. 3. Entsorgungsphase: Die meisten Substanzen des Antigens werden durch die Granulaenzyme bis zu ihren Grundbausteinen abgebaut (z.B. Aminosäuren, Zucker, Lipide und Nucleotide) und für die weitere Funktionstüchtigkeit des Phagozyten verwendet. Es bleiben jedoch immer auch unverdauliche Bestandteile eines Antigens über. Der Phagozyt ist nun gezwungen, diese Restbestände zu akkumulieren, und wenn er nicht mehr aufnahmefähig ist, dann stirbt er ab und wird von seiner Nachkommenschaft – also von jüngeren Phagozyten – ebenso wie ein Antigen phagozytiert. Besondere Beachtung verdient eine Gruppe der Phagozyten, nämlich die Makrophagen. Die Makrophagen, also "Riesenfresser", sind die größten Zellen des Immunsystems. Sie sind auch unter einem normalen Mikroskop sichtbar. Fälschlicherweise wird oft angenommen, daß sie die "Hauptfresser" des Immunsystems seien. Dem ist es aber nicht so. Die wichtigsten Entsorgungskiller sind nämlich die Neutrophile, gefolgt von den etwas weniger effektiven Eosinophilen. Die Makrophagen phagozytieren zwar auch Antigene. Ihre Besonderheit liegt jedoch in der Antigenpräsentation. Nicht alle Krankheitserreger sind durch die einfache Phagozytose zu vernichten. Die meisten Viren und Bakterien können erst durch eine komplizierte Immunkaskade unschädlich gemacht werden. Dazu gehört eine "feinfühlige" Zusammenarbeit zwischen Makrophagen, T-Lymphozyten und B-Lymphozyten. Der Makrophage ist lediglich der erste Akteur in der Immunkaskade. Denn das Hauptprinzip des Immunsystems ist die aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit. Tritt ein Antigen, zum Beispiel ein Bakterium, in den Organismus ein, so wird es sehr häufig von den amöbenartigen Makrophagen, die wie alle anderen Phagozyten ständig in den Körperflüssigkeiten und in den Körperzellen patrouillieren, als "fremd" erkannt. Die Makrophagen "docken" mit ihren Fangarmen an das Antigen an. Abb. 10 zeigt, wie ein Makrophage 30 gleich mehrere kleine Bakterien an seinen Körper heranzieht. Abb. 10 (Tweel, 1991, S. 66) Der Makrophage selber kann sich jedoch nur einige Krankheitserreger einverleiben, aber nicht die Millionen von Zellen einer Angriffsfront. Deshalb muß er Hilfeleistung bei den Tund B-Lymphozyten holen, die jedoch keine vollständigen Krankheitserreger, sondern nur kleine Bruchstücke von ihnen zu erkennen in der Lage sind. Die Lymphozyten brauchen eine spezielle Antigenpräsentation für die Auslösung ihrer Immunkaskade. Aus diesem Grunde einverleibt sich der Makrophage das Bakterium oder das Virus und zerlegt dieses, ähnlich dem Vorgang der Phagozytose, zuerst in Proteine und dann einige dieser Proteinen in kleine Peptidbestandteile. Die Antigenpeptide werden nun in die Vesikeln des endoplasmatischen Reticulums verfrachtet, wo ein ganz bestimmtes Molekül, das MHC-Molekül, aktiv wird. (MHC ist die Abkürzung von major histocompatibility complex oder Haupthistokompatibilitäts-Komplex. In den MHC-Molekülen wurde die Ursache der Gewebeverträglichkeit bzw. der Abstoßung von Transplantaten gefunden.) Im endoplasmatischen Reticulum heftet sich nun das MHC-Molekül an das zerlegte Antigen, also an ein Antigenpeptid. Gemeinsam mit dem Antigenpeptid wandert dann das MHC-Molekül an die Zelloberfläche, wo es gleichsam wie auf einem "Präsentierteller" die Antigenbestandteile den T-Lymphozyten darbietet. Da die T-Lymphozyten nur Bruchstücke eines Antigens erkennen, können sie erst jetzt die Immunkaskade auslösen. Abbildung 11 zeigt, wie ein Virus von einem Makrophagen einverleibt und zerlegt wird und wie seine Peptide dann an der Oberfläche der Zelle den T-Lymphozyten präsentiert werden. 31 Abb. 11 (Tweel, 1991, S. 73) Die Antigenpräsentation durch die MHC-Moleküle ist jedoch nicht nur den Makrophagen vorbehalten. Auch andere Körperzellen, die zum Beispiel von einem Virus befallen worden sind, versuchen durch ihre MHC-Moleküle, sofern sie welche besitzen, die Immunkaskade auszulösen. 4.3.2 Die T-Lymphozyten Lymphozyten sind wesentlich kleiner als die Phagozyten. Sie stellen im Blut nach den Neutrophilen die größte Zahl der weißen Blutkörperchen dar. Etwa 20-45% aller Leukozyten sind Lymphozyten. (Klein, 1991, S. 31) Die T-Lymphozyten, also Thymus-Lymphozyten, wandern kurze Zeit nach ihrer Entstehung im Knochenmark aus ihrer Ursprungsstelle heraus, "quetschen" sich durch die Poren des Knochengewebes und gelangen über die Blutbahn in die Thymusdrüse. Dort reifen sie und differenzieren sich zu hochspezifischen Abwehrzellen aus. Nach der "Thymusschule" sind sie in der Lage, körperfremdes von körpereigenem Gewebe zu unterscheiden. Ihr Prinzip ist das vom Hormonsystem her gut bekannte Schlüssel-SchloßPrinzip. Die T-Lymphozyten, mit Ausnahme der T-Killerzellen, tragen hochspezifische Rezeptoren an ihrer Oberfläche, die komplementär zu den Antigenen passen. Allerdings sind die Rezeptoren der T-Lymphozyten so klein, daß sie niemals ein ganzes Antigen erkennen können, sondern immer nur Bruchstücke von ihnen. Deshalb sind sie von der Antigenpräsentation durch die MHC-Zelle eines Makrophagen oder von der Antigenpräsentation einer virus- bzw. krebsbefallenen Zelle abhängig. Die T-Lymphozyten streifen, auf ihrer Oberfläche 32 spezifische Rezeptoren tragend, durch das Körpergewebe und durch die Körperflüssigkeiten und suchen nach komplementären Bindungsstellen und kehren dann immer wieder in die Lymphorgane zurück. Ihre Verweilzeit im Blut beträgt 1 bis maximal 24 Stunden, ihre Lebensdauer beträgt etwa 100 bis 300 Tage. (Hadinger, 1993, S. 118) Die T-Lymphozyten können wir nach ihrer Funktion in 2 Gruppen unterteilen: in die (a) T-Helfer- und (b) T-Killerzellen. Sie werden nach ihren Oberflächenmarkern auch CD4- und CD8-Zellen genannt. a) Die T-Helferzellen (CD4-Zellen) übernehmen die Rolle des wichtigsten Zwischenglieds in der Immunkaskade: Wenn der Rezeptor einer T-Helferzelle komplementär genau zu einem präsentierten Antigenbruchstück "paßt", dann heftet sich dieser an das Antigenpeptid und wird aktiv: Er beginnt sich zu vermehren und schüttet Lymphokine, also Botenstoffe aus, die die nächste Gruppe von Lymphozyten, die B-Lymphozyten, aktivieren. Die B-Lymphozyten teilen sich ebenfalls und entwickeln sich daraufhin zu Plasmazellen, also zu "Munitionsfabriken", die nun genaue Gegenmoleküle gegen den Krankheitserreger produzieren. Die T-Helferzellen geben durch die Lymphokine also Wachstumsfaktoren ab, die das Immunsystem zur vermehrten Abwehr aktiviert. Abbildung 12 zeigt diese Form der Immunabwehr. Ein Antigen, z.B. ein Virus, wird von einem Makrophagen einverleibt und in seine Zellbestandteile zerlegt. Die MHC-Proteine präsentieren den T-Lymphozyten die Peptidteile des Virus. Die T-Lymphozyten aktivieren sich daraufhin und schütten Botenstoffe, Lymphokine, aus. Die Lymphokine aktivieren die "Munitionsfabriken", die B-Lymphozyten, die nun billionenfach spezifische Anti-Virus-Moleküle ausschütten, die genau zum Krankheitserreger passen und sich an ihn heften können. Nun kann dieser vernichtet werden. Abb. 12 (Weissmann und Cooper, 1994, S. 13) 33 Nach der gelungenen Antigenbekämpfung ist der Körper natürlich mit großen Mengen an T- und B-Lymphozyten überschüttet, die nun nicht mehr gebraucht werden. Durch das im Hormonsystem bekannte "negative Rückkoppelungssystem" wird die weitere Neuproduktion der Immunzellen verhindert, und der überflüssige Rest wird innerhalb 1-2 Wochen durch die Makrophagen abgebaut. Einige T- und B-Zellen bleiben für die erworbene Immunität als Gedächtniszellen übrig, um bei einer neuerlichen Infektion schneller und effektiver reagieren zu können (z.B. nach einer Rötelinfektion oder Impfung werden bei einem Zweitkontakt die Rötelviren sofort abgewehrt). Die Spezialisierung des Immunsystems beginnt mit der T-Helferzelle: Der Rezeptor einer T-Helferzelle paßt nur zu einem bestimmten Antigenbruchstück, und die Lymphokine dieser Helferzelle können nur die "dazugehörigen" B-Lymphozyten zur Zellteilung anregen. Es gibt auch T-Lymphozyten, die durch die Lymphokinenausschüttung nicht die Aktivierung der B-Lymphozyten, sondern das Hervorrufen einer Entzündungsreaktion verursachen. b) Die T-Killerzellen brauchen, ebenso wie die verwandten T-Helferzellen, die Bruchstückpräsentation durch die MHC-Moleküle einer virus- oder krebsbefallenen Zelle. Anders als bei den Helferzellen genügt es ihnen jedoch, wenn die MHC-Zellen befallenes oder entartetes körpereigenes Gewebe präsentieren (die Helferzellen sind auf die Präsentation der Krankheitserreger angewiesen). Die T-Killerzellen lösen nun keine Immunkaskade aus, sondern werden selbst aktiv: Sie heften sich an die Zellmembran der befallenen Zelle und schütten toxische Substanzen aus. Die toxischen Moleküle lösen nun die Zellmembran der betroffenen Zelle an einigen Stellen auf. Es entstehen Löcher an der Oberfläche der Krebszelle oder der virusbefallenen Zelle, und mit diesen Löchern ist kein Überleben mehr möglich. Aus der Umgebung strömt Flüssigkeit in die Zelle hinein, die sich zuerst aufbläst 34 und dann platzt. Auf diese Weise töten T-Killerzellen natürlich auch körpereigenes Gewebe, das zum Beispiel von einem Virus befallen ist. Mit den körpereigenen Zellen stirbt jedoch auch das Antigen. Abbildung 13 zeigt, wie eine kleine Killerzelle Löcher in die Membran einer Krebszelle gebohrt hat und diese knapp vor dem Aufplatzen ist. Abbildung 14 zeigt die Zellmembranreste der nunmehr abgetöteten Krebszelle, die kleine Killerzelle ist auf dem Bild noch deutlich sichtbar. Die Membranreste werden in der nun folgenden Phase von den Makrophagen entsorgt. Die Aufnahmen wurden mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops erstellt. Abb. 13 (Nilsson, 1987, S. 106) Abb. 14 (Nilsson, 1987, S. 107) Die T-Zellen werden auch als die "Kommandozentrale" des Immunsystems angesehen, weil sie als Erkennungssystem zwischen "körperfremd", "entartet" und "körpereigen" unterscheiden. Nach einem Erstkontakt mit einem Antigen sterben die nunmehr überflüssigen Tund B-Lymphozyten ab. Einige "Gedächtniszellen" bleiben jedoch im Organismus übrig und können dadurch beim nächsten Kontakt mit demselben Krankheitserreger schneller und effektiver reagieren. Da die maximale Lebensdauer der T-Lymphozyten zwischen 100 und 300 Tage liegt, ist eine interzelluläre Informationsweitergabe unabdinglich. Wie die Informationsübergabe biochemisch erfolgt, wissen wir noch nicht genau. Unter dem Rasterelektronenmikroskop können wir jedoch beobachten, daß ausgebildete T-Lymphozyten die noch undifferenzierten "jungen" Verwandten durch Rezeptorenkontakt berühren und mit ihnen einige Zeit 35 lang Kontakt halten. Nach der Trennung beider Lymphozyten sind nun auch die "ungeschulten" plötzlich zur Antigenerkennung fähig. Die Informationsweitergabe erfolgt offensichtlich durch den direkten Rezeptorenkontakt von Zelle zu Zelle. Aufgrund der begrenzten Lebensdauer der Lymphozyten ist die Informationsgenauigkeit der T-Zellen mit fortschreitendem Lebensalter eines Menschen natürlich zunehmend fehlerhaft. Denn die Informationsweitergabe erfolgt spätestens vom Zeitpunkt der Thymusrückbildung an ausschließlich von Zelle zur Zelle, nach der Methode der "stillen Post". Deshalb sind zum Beispiel Auffrischungsimpfungen in bestimmten Abständen notwendig und deshalb bekommen ältere Menschen Krankheiten, deren Erreger ihnen in jungen Jahren nichts anhaben konnten. Das Immunsystem wird mit zunehmendem Alter sozusagen "vergeßlich". Das funktionelle Alter des Immunsystems muß jedoch "nicht immer korreliert sein mit dem tatsächlichen Lebensalter". (Kunze, Schöllmann, 1995, S. 27) In späteren Teilen dieser Arbeit wird auf diese Frage noch näher eingegangen. 4.3.3 Die B-Lymphozyten Die B-Lymphozyten (die aus dem Knochenmark, also bone marrow, stammenden Lymphozyten) machen etwa 20% aller im Blut vorkommenden Lymphozyten aus. Den Rest, etwa 80%, bilden die T-Lymphozyten. (Tweel, 1991, S. 18) Wie alle anderen Immunzellen stammen auch sie aus dem Knochenmark, sie bleiben jedoch wesentlich länger, bis kurz vor ihrer Ausreifung, an dieser Ursprungsstelle. Dann wandern sie ins Blut, wo die vollständige Ausdifferenzierung erfolgt. B-Lymphozyten selber können kein einziges Antigen vernichten. Sie erzeugen jedoch die für die meisten körperfremden Zellen so gefährliche humorale Abwehr. Die ausgereiften B-Lymphozyten tragen zahlreiche antennenähnliche, Y-förmige Antikörper (Immunglobuline) auf ihrer Oberfläche. Diese Antikörper stellen den wichtigsten humoralen Abwehrmechanismus des menschlichen Organismus dar. Ihre genauere Beschreibung erfolgt 36 im nächsten Kapitel unter dem Stichwort "Antikörper". Obwohl es im menschlichen Blut Milliarden von B-Lymphozyten gibt, die mit ihren "Antennen" bestückt nach Fremdkörpern fahnden, gibt es nur wenige, die denselben Antikörpertypus an ihrer Oberfläche tragen. Ein B-Lymphozyt trägt immer nur eine Sorte von Immunglobulinen auf seiner Oberfläche, die immer nur gegen eine Sorte von Krankheitserregern wirksam werden kann. Da nur wenige B-Lymphozyten einer Sorte im Organismus patrouillieren, wäre ihre Anzahl im Falle einer Invasion von Krankheitserregern viel zu gering. Sie müssen sich aber zahlenmäßig begrenzt halten, ansonsten würden sie den Organismus überschütten. Die Lösung des Problems liegt wieder im Schlüssel-Schloß-Prinzip der Rezeptoren: Werden die Rezeptoren, also die Immunglobulinarme des B-Lymphozyten, durch 1. Lymphokine, die von den T-Lymphozyten ausgeschüttet werden, oder durch 2. Antigene, die im Organismus schwimmen, in der komplementären Form angetroffen, so binden sie sich an das Antigen. Nun gerät der zuvor ruhende B-Lymphozyt in die Aktivierungsphase. Er vergrößert sich, beginnt sich zu teilen, und gleichzeitig produziert er Milliarden von spezifischen Antikörpern, die sich an die übrigen Antigene binden können. Ein B-Lymphozyt teilt sich in der Aktivierungsphase alle 20 Stunden für etwa 5-15 Generationen. Die Immunglobulinproduktion vermehrt sich um das Vielfache im Vergleich zur ruhenden Zelle. Ein einziger B-Lymphozyt ist nun in der Lage, stündlich bis zu 100 Millionen Antikörpermoleküle im Blutstrom freizusetzen. (Schaffer, 3/1995) Innerhalb weniger Stunden bis Tage sind die Krankheitserreger nun mit einem Heer von Antikörpern konfrontiert, die sich an ihre Oberfläche binden und sie in die Vernichtung führen. In manchen Fällen ist die ohnehin rasche Zellteilung und die Antikörperproduktion der B-Zellen noch immer langsamer als die toxische Wirkung eines Antigens. Das Nervengift einer Kobra zum Beispiel wirkt innerhalb von Minuten tödlich auf einen Menschen. Die "pas- 37 senden" Abwehrkörper werden zwar sofort nach dem Biß zur Vermehrung angeregt, sie würden jedoch Stunden bis wenige Tage brauchen, bis sie in der Menge vorhanden wären, die das Gift neutralisieren könnte. Deshalb muß das Opfer mit vorher gezüchteten Antikörpern geimpft werden, die aus Pferdeblut gewonnen wurden. Nach einer erfolgreichen Bekämpfung der Krankheitserreger bleiben nun Milliarden von B-Lymphozyten und Antikörper im Blut. Was stoppt nun die weitere Zellvermehrung und die Antikörperproduktion? Nach den Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft funktioniert auch hier der aus dem Hormonsystem bekannte negative Rückschleifemechanismus: Finden die frei herumschwimmenden Antikörper keine Komplementärbindungsstelle mehr, weil das Antigen aus dem Körper verschwunden ist (vernichtet wurde), dann geben sie ihrer Plasmazelle, dem B-Lymphozyten, auch kein Signal zur weiteren Zellvermehrung oder Antikörperproduktion. Denn die Plasmazellen befinden sich nur solange in der Aktivierungsphase, bis ihre "Antennen" Bindungsstellen finden. Die meisten nicht weiter brauchbaren B-Zellen und ebenso ihre Antikörper sterben nun innerhalb einiger Tage ab. Im Blutserum eines Menschen befinden sich zum Beispiel etwa 10 Tage lang noch vermehrte Antikörper nach einer Grippeinfektion. Danach ist die Infektion im Blutserum nicht mehr nachweisbar. Nicht alle B-Lymphozyten sterben jedoch nach ihrer Invasion ab. Einige verwandeln sich in Gedächtniszellen (Memory-Zellen), die sehr langlebig sind und Tag für Tag, Jahr für Jahr mit ihren Immunglobulinantennen bestückt nach ihren alten "Bekannten" suchen. Bei einem neuerlichen Kontakt mit dem gleichen Antigen brauchen sie dann nur wenige Minuten bis Stunden bis zu ihrer vollständigen Vermehrung. Der betroffene Mensch merkt so nicht einmal, daß er von einer Infektion befallen wurde, so schnell und so zahlreich wurde diese von den Antikörpern "aufgefangen". 38 4.3.4 Die natürlichen Killerzellen Die natürliche Killerzelle (NK-Zelle) stellt noch, wie vieles andere, ein Rätsel für die Immunologie dar. Ihre genaue Abstammung ist noch genauso unbekannt wie ihre Ausdifferenzierung. Ihren Namen erhielt sie, weil sie einen sofortigen Angriffseffekt zeigt und weil sie keine vorherige Erfahrung mit einem Antigen haben muß. Darüber hinaus braucht sie nicht eine antigenpräsentierende Zelle oder ihre MHC-Moleküle. Sie erkennt direkt ihre Zielzelle und tötet diese innerhalb von 4 Stunden ab. (Klein, 1991, S. 47) NK-Zellen müssen auch nicht wie die T-Killerzellen erst zum Abtöten ausgebildet werden. Sie sind nach ihrer Ausreifung vollkommen funktionsfähige Killer. NK-Zellen greifen vor allem Tumorzellen und durch ein Virus veränderte Zellen an. Sie sind unspezifisch, d.h., eine NK-Zelle kann gegen verschiedene Antigene aktiv werden. Im Gegensatz zu den anderen Immunzellen besitzen sie, zusätzlich zu ihrer natürlichen Zytotoxität, eine Strahlenresistenz (sie behalten ihre Aktivität auch, wenn sie mit einer Dosis von über 1.000 R. bestrahlt werden). Sie reifen erst spät aus (in den Embryos und in Neugeborenen können noch keine NK-Zellen nachgewiesen werden). Sie sind unabhängig von der Thymusdrüse (im Gegensatz zu den T-Killerzellen) und abhängig vom Knochenmark (bei einer Knochenmarkrückbildung wird die NK-Aktivität maßgeblich gedrosselt). Die NK-Zellen vernichten eine Tumorzelle oder eine von einem Virus transformierten Zelle ähnlich dem Vernichtungsmechanismus der T-Killerzelle, nur eben schneller und ohne vorherige Antigenpräsentation: Die NK-Zelle bindet sich durch ihre Rezeptoren an die Zielzelle und schüttet toxische Moleküle aus, die die Zellmembran der Zielzelle durchlöchern und diese dadurch zum Absterben bringen. Manche NK-Zellen werden auch durch Antikörper, die an eine Zielzelle angedockt haben, an ihr Ziel gebunden. Sie schütten dann aufgrund der Bindung Antigen-Antikörper-NK-Zelle das zytotoxische Material aus. 39 4.4 Die humorale Immunabwehr Das humorale (flüssige) Immunsystem bildet den kleinsten Teil der körpereigenen Abwehrfront. Es besteht aus der Gruppe der Antikörper und der Lymphokine. 4.4.1 Die Antikörper Die Antikörper, auch Immunglobuline genannt, sind Proteine, die von den B-Lymphozyten produziert werden. Sie kommen in praktisch allen Körperflüssigkeiten vor, zum Beispiel im Blutplasma, im Schleim, in der Tränenflüssigkeit, im Speichel, in den Flüssigkeiten der Bauchhöhle, im Rückenmark und im Gehirn ebenso wie in der Muttermilch. (Tweel, 1991) Durch ihre winzige Molekulargestalt können sie fast alle Membranen und Gefäßwände des Körpers passieren. Die meisten Immunglobuline durchschreiten zum Beispiel unbeschwert die Blut-Hirnschranke. Sie machen erst vor den Körperzellen halt. Immunglobuline können sich zwar an einzelne Körperzellen anheften. Sollte ein Krankheitserreger aber in eine Körperzelle hineingeschlüpft sein, dann sind sie dagegen machtlos. In diesem Falle treten andere Abwehrmechanismen in Gang, zum Beispiel die Killerzellen. Wie vorhin erwähnt, werden Immunglobuline von den B-Lymphozyten produziert: Eine fertige B-Zelle verläßt mit zahlreichen Immunglobulinen bestückt das Knochenmark und patrouilliert von diesem Zeitpunkt an im Blut und in den Lymphgefäßen. Sie kann sich vorübergehend in den lymphatischen Organen niederlassen, wie z.B. in den Lymphknoten oder in der Milz. Trifft dieser B-Lymphozyt während seiner Wanderung durch die Körperflüssigkeiten auf ein Fremdantigen, zu dessen Oberfläche die Immunglobulinantennen genau passen, so beginnt eine tagelange Immunkaskade: der B-Lymphozyt beginnt sich zu teilen und produziert Millionen von Tochterzellen, die sich in Plasmazellen verwandeln. Diese Plasmazellen sind imstande, stündlich bis zu 100 Millionen kleine "Antennen", d.h. Immunglobuline, zu 40 produzieren. (Schäffer, 3/1995, S. 18) Die Produktion und die Wirkungsweise der Immunglobuline ist hochspezifisch. Dies bedeutet erstens, daß ein B-Lymphozyt nur eine einzige Sorte von Immunglobulinen erzeugen kann, auch wenn diese Produktion millionenfach ist. Und dies bedeutet zweitens, daß diese Millionen von Immunglobulinen, die in ihrer Struktur einander ganz genau gleichen, nur gegen ein einziges Antigen wirksam werden können. Da in unserer Umwelt viele Millionen verschiedene Antigene (z.B. Krankheitserreger, Pilze, Toxine, Blütenstaub oder Parasiten) den menschlichen Organismus bedrohen, sollten logischerweise gegen jedes Antigen zumindest einige genau "passende", mit Immunglobulinen bestückte B-Lymphozyten in der Körperflüssigkeit patrouillieren. Dies ist in der Tat der Fall. Durch die Struktur der Immunglobuline ist es gewährleistet, daß eine unglaubliche Vielfalt verschiedener Antikörper im Blut zirkulieren kann und daß aus dieser Vielfalt zumindest ein Antikörper genau zu den Oberflächenrezeptoren eines jeden Antigens paßt. Die chemische Grundstruktur aller Immunglobuline ist ziemlich einheitlich. Jeder Antikörper setzt sich aus vier Proteinketten, zwei längeren (schweren) und zwei kürzeren (leichten), zusammen. Ihre Molekulargestalt gleicht einem Y. In der Immunkaskade haben die Immunglobuline die Funktion eines Bindeglieds: Die äußeren Enden des Y heften sich an ein Antigen, während der Stamm sich an die Abwehrzellen des Immunsystems, z.B. an Makrophagen, bindet. Diese Bindung ermöglicht erst, daß ein Makrophage das Antigen vernichtet. Aus dieser "Bindungsfunktion" wird ersichtlich, daß Antikörper zwei unterschiedliche Anheftungsfähigkeiten aufweisen müssen. Die äußeren Enden des Y müssen von Molekül zu Molekül stark variieren, damit jedes Antigen auf einen passenden Antikörper treffen kann. Der Stamm der einzelnen Antikörper muß jedoch nicht so variabel sein, denn es gibt lediglich eine begrenzte Anzahl von Immunzellen, an die die Antikörper sich anheften. Genau diesem Prinzip folgt der molekulare Aufbau der Immunglobuline. Abbildung 15 41 zeigt den Aufbau eines Antikörpers. Die äußeren Enden des Y, sowohl der schweren wie auch der leichten Kette, setzen sich aus einer Vielzahl von Molekülteilen zusammen, die von Antikörper zu Antikörper variieren, während der Stamm relativ konstant bleibt. Die Antikörper setzen sich demzufolge nach dem Zufallsprinzip aus einer Vielzahl von Einzelteilen zusammen und bilden von Molekül zu Molekül eine eigene "Komposition". Abb. 15 (Janeway, 1994, S. 31) Da im menschlichen Organismus etwa eine Million verschiedene Immunglobuline zirkulieren, ist somit die Abwehr aller in Frage kommenden Antigene gewährleistet. Fehlt im Immunsystem eines Menschen ein entsprechender Antikörper, so sprechen wir von einem angeborenen Immundefekt. Befände sich im Körper ein Virus, gegen das kein komplementärer Antikörper vorhanden ist, so wäre die infizierte Person mit Sicherheit dem Tod ausgeliefert. Wir wissen heute zum Beispiel, daß auch gegen das HIV-Virus Antikörper vom Immunsystem produziert werden. Der endogene Kampf wird jedoch nach jahrelanger "Pattsituation" von den T-Lymphozyten verloren. Die Immunglobuline können aufgrund ihrer Struktur in fünf Klassen eingeteilt werden: IgA, IgD, IgE, IgG und IgM. Diese fünf Klassen werden in der Immunologie zusätzlich noch in Untergruppen eingeteilt. Wie vorhin erwähnt, kommen Immunglobuline praktisch in allen Körperflüssigkeiten vor, jedoch sind nicht alle Immunglobuline überall gleichmäßig verteilt. In der Muttermilch und in der Tränenflüssigkeit bzw. im Speichel kommt vor allem IgA vor. IgE finden wir besonders häufig im Darm, und IgG bindet sich im Blut an Toxine. Abbildung 42 16 zeigt die unterschiedliche Struktur der fünf Immunglobulinklassen. Abb. 16 (Schäffer, 3/1995, S. 20) Versuchen wir die Funktionen der Immunglobuline darzustellen, so können wir 7 verschiedene Immunprozesse beschreiben: – Die Antikörper binden sich an die Rezeptoren von Krankheitserregern und verhindern, daß diese sich an die Körperzellen heften. Die Mikroorganismen, deren "Fangarme" dadurch besetzt sind, rutschen nun ohne Anheftungsmöglichkeit aus dem Körper mit den Exkrementen heraus. Diesen Vorgang können wir vor allem in der Nasenschleimhaut (niesen) und in der Darmschleimhaut (Durchfall) beobachten. – Die Antikörper heften sich einerseits an einen Krankheitserreger, andererseits an einen Phagozyten. Sie nehmen dadurch die Funktion von Opsinen an und ermöglichen so die Phagozytose der Krankheitserreger. Ohne Immunglobuline würden die meisten Phagozyten die Antigene als solche nicht erkennen. – Die Antikörper heften sich an die Oberfläche von Toxinen und bilden mit ihnen mikrobielle Komplexe. Dadurch wird die Toxinwirkung des Antigens neutralisiert. Solche toxinbindende Fähigkeit weist IgG auf. – Die Antikörper, vor allem IgG und IgM, die an einer Hautverletzung auf Fremdkörper oder auf Bakterien stoßen, verursachen eine Entzündungsreaktion. Durch die Temperaturerhöhung im Zuge der Entzündungsreaktion werden die hitzeempfindlichen Bakterien abgetötet. Gleichzeitig wird eine lokale Konzentration von Phagozyten und weiteren Antikörpern bewirkt. 43 – Die Antikörper heften sich an bewegliche Mikroorganismen und verklonen sich mit ihnen. Dadurch werden diese bewegungsunfähig bzw. können durch ihre veränderte Antigen-Antikörper-Größe die kleinen Poren bestimmter Zellmembranen nicht passieren. – Antikörper der IgG-Klasse erkennen infizierte Körperzellen, wenn diese die Infektion durch ihre Oberflächenveränderung erkenntlich machen. Die Antikörper heften sich dann an die infizierten Zellen und binden gleichzeitig Killerzellen an ihren Stamm. Auf diese Weise leiten sie die Zellvernichtung ein. – Die Antikörper heften sich an potentielle Bindungsstellen in der Darmmukose und verunmöglichen dadurch das "Andocken" von Parasiten. Diese "rutschen" ab und werden dann mit den Exkrementen ausgeschieden. Wie anfangs erwähnt, werden die Antikörper von den B-Lymphozyten produziert. Der Teilungs- und Produktionsvorgang der B-Lymphozyten wird eingeleitet, wenn die Immunglobulinantennen der Lymphozyten ein Antigen berühren, das zu ihrer Rezeptorenform komplementär paßt (Schlüssel-Schloß-Prinzip). Die Antikörper werden dann millionenfach produziert und in die Körperflüssigkeit abgegeben, wo sie "schwimmend" alle passenden Antigenbindungsstellen erreichen können. Der Rückgang der Antikörperproduktion funktioniert nach dem aus dem Hormonsystem bekannten negativen Rückschleifeprinzip: B-Lymphozyten können Antikörper nur solange abgeben, als eine Bindungsstelle für diese existiert. Sind alle Bindungsstellen an einem Antigen besetzt, weil genügend Antikörper produziert wurden, oder vermindert sich die Zahl der Bindungsstellen, weil die Krankheitserreger eliminiert wurden, dann kann der B-Lymphozyt keine Antikörper mehr abgeben und stellt deren Produktion ein. Im Grunde steuert der Antikörper seine Produktion selbst. Die Bildung einer effektiven humoralen Immunabwehr dauert bei einer Erstinfektion etwa vier Tage. So viel Zeit braucht es, bis aufgrund der Immunkaskade genügend Antikörper im Blut sind. Da sich während dieser Zeit die Krankheitserreger natürlich auch vermehren, 44 entsteht ein Wettlauf um die Zeit. In den ersten Tagen einer Infektion ist das Abwehrsystem demnach auf die angeborene, nicht spezifische Immunabwehr angewiesen. Diese reicht für die Eliminierung der Krankheitserreger zwar nicht aus, kann diese aber in Schach halten. Problematisch wird die Immunabwehr dann, wenn sich die Krankheitserreger nicht nur vermehren, sondern wenn deren Nachfolgezellen während der Zellteilung auch ihre Gestalt ändern. Dann sind nach 4 Tagen genügend Antikörper gegen das Ursprungsantigen im Blut, aber keine gegen dessen Nachkömmlinge. In diesem Falle könnte die "Schlacht" von den Antigenen gewonnen werden. Nach einem Sieg des Immunsystems, d.h. nach einer Vernichtung des Antigens, bleiben mehr B-Lymphozyten, die gegen dieses Antigen Antikörper produzieren können, im Blut als vorher. Denn zahlreiche Produktionszellen verwandeln sich am Ende ihrer Arbeit in Gedächtniszellen. In einem Zweitkontakt mit demselben Antigen erfolgt dann ihre Proliferation und auch die Antikörperproduktion so rasch, daß die betroffenen Krankheitserreger bald nach ihrem Eintritt in den Körper abgetötet werden. Diese Funktion macht man sich im Zuge von Impfungen zunutze, bei denen entweder abgetötete oder abgeschwächte Krankheitserreger in den Körper geschleust werden, um so "kleine" Erstinfektionen auszulösen. Während einer Zweitinfektion läuft die Infektionsabwehr oft unbemerkt vom betroffenen Menschen ab. Die einzigen Zeichen sind Müdigkeit, eine leichte Depression und Durst, da bei äußerer Ruhe ein innerer Kampf geführt wird, der dem Organismus viel Energie und Flüssigkeit entzieht. 4.4.2 Die Lymphokine Die Immunkommunikation zwischen Zelle und Zelle kann auf zwei Wegen erfolgen: entweder durch direkten Kontakt, indem die Rezeptoren einer Zelle die passenden Rezeptoren der anderen Zelle berühren, oder durch wasserlösliche Botenstoffe, die von einer Zelle abgegeben 45 und von einer zweiten aufgenommen werden. Lymphokine sind Botenstoffe des Immunsystems, die eine Kommunikation zwischen den einzelnen Immunzellen ermöglichen. Im Gegensatz zu den Antikörpern haben Lymphokine keinen Kontakt zu Krankheitserregern und ihre Wirkung ist, im Gegensatz zur Spezifität der Antikörper, unspezifisch. Eine bestimmte Gruppe von Lymphokinen kann verschiedene Immunzellen aktivieren bzw. in der Aktivität hemmen. Lymphokine funktionieren im Grunde ähnlich den Botenstoffen des Hormonsystems, mit dem Unterschied, daß sie nicht von einzelnen Drüsen, sondern von einzelnen Zellen produziert werden. Sie bilden eine sehr heterogene Gruppe von Molekülen. Sie werden in geringen Mengen erzeugt, sind aber schon bei einer Konzentration von 10-15 bis 10-10 M aktiv. (Klein, 1991, S. 237) Sie können niemals von unstimulierten Zellen produziert werden. Die Lymphokine wirken über Rezeptoren der Zielzellen, sie verstärken normalerweise die Immunantwort der betroffenen Zelle. Wird die Ausschüttung von Lymphokinen unterbrochen, dann sinkt auch die Teilungs- und Aktivitätsfähigkeit der Zielzelle. Durch diese negative Rückkopplung wird ein unkontrolliertes Wachstum der Immunzellen unterbrochen. Erst im letzten Jahrzehnt konnten Immunologen den Sinn der Lymphokinausschüttung verstehen: Die spezifische Immunantwort des Immunsystems entwickelt sich sehr langsam, weil ein Antigen nur eine Immunzelle oder ganz wenige stimulieren kann. Ohne einen "Beschleuniger" würden sich pathogene Zellen viel schneller vermehren als die Immunzellen. Durch die Ausschüttung von Botenstoffen kann jedoch eine einzige erkrankte Zelle unzählige Abwehrzellen aktivieren, ähnlich dem cAMP "Lawineneffekt" des Nerven- und Hormonsystems. Die Hauptfunktion der Lymphokine ist daher, die Immunreaktion zu verstärken und sie gleichzeitig unter Kontrolle zu halten. Den Lymphokinen können wir zusätzlich eine interessante Funktion zuschreiben: Während einer Virusinfektion ist ein Mensch gegen eine zweite Virusinfektion immun. Oder anders gesagt: Wir können nicht an zwei Virusinfektionen, z.B. an Röteln und Masern, gleich- 46 zeitig erkranken. Denn die virusinfizierten Zellen schütten Lymphokine aus, die die Rezeptoren anderer, noch gesunder Zellen so verändern, daß sich an diese keine weiteren Krankheitserreger anheften bzw. in sie hineinschlüpfen. Natürlich versuchten Immunologen diese Tatsache für die Medizin auszunützen. Doch nach anfänglicher Euphorie über die externe Zugabe von Lymphokinen sind auch deren unzumutbare Nebenwirkungen bekannt geworden. Die Immunforschung arbeitet zur Zeit an einem besseren Einsatz und an einer geeigneteren Kombination der Lymphokine. Die wichtigsten Lymphokine sind die Interleukine, die Interferone und der TumorNekrosefaktor. Da die Wissenschaft gerade in der Lymphokineforschung erst am Anfang steht, ist es ohne weiteres möglich, daß in den nächsten Jahren noch andere wichtige Immunbotenstoffe entdeckt werden. 4.4.2.1 Interleukin-1 (IL-1) Interleukin-1 wird in der Immunologie als "Mädchen für alles" bezeichnet. Es wird von sehr vielen verschiedenen Zellen produziert und hat einen breiten Wirkungsgrad. Seine Grundfunktion gleicht der der übrigen Lymphokine: Wird eine gesunde Körperzelle von einem Krankheitserreger befallen, so schüttet sie, aufgrund der chemischen Reizung des Antigens, Lymphokine aus, die zahlreiche benachbarte, gesunde Körperzellen in eine Vorwarnstufe versetzen. Gleichzeitig aktivieren die Lymphokine eine große Menge von Abwehrzellen, die sich nun vehement gegen den Krankheitserreger wenden. Interleukin-1 wird u.a. von Monozyten, Makrophagen, NK-Zellen, dentritischen Zellen und Endothelzellen produziert. Wie erwähnt, ist seine Wirkung auch breit: Es kann die Proliferation und Differenzierung von B-Lymphozyten bewirken, die Aktivierung von Fibroblasten, Endothelzellen und Killerzellen anregen, Fieberreaktion hervorrufen und die Chemotaxis von Makrophagen, Neutrophilen und Lymphozyten verursachen. 47 Wie vorhin erwähnt, müssen jedoch die Körperzellen erst durch ein Antigen stimuliert werden. Nur dann erzeugen sie Interleukin. Offensichtlich können die meisten Körperzellen Interleukin-1 produzieren, und offensichtlich haben die meisten Körperzellen auch Rezeptoren für IL-1. 4.4.2.2 Interleukin-2 (IL-2) Interleukin-2 wird ausschließlich von aktivierten T-Lymphozyten produziert, und im Gegensatz zu IL-1 ist es in seiner Wirkungsweise sehr eingeschränkt. (Tweel, 1991) Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kann es nur auf T- und B-Lymphozyten und auf die Killerzellen wirken. Seine Aufgabe beschränkt sich auf die Wachstumsförderung der drei genannten Zelltypen. Es bewirkt jedoch, daß T-Zellen auch monate- oder jahrelang in vitro wachsen können. 4.4.2.3 Interleukin-3 (IL-3) Interleukin-3 wird ebenso wie IL-2 von T-Lymphozyten produziert, seine Wirkungsweise ist jedoch breiter, wenn auch schwächer. IL-3 wirkt auf das Überleben, das Wachstum und die Differenzierung von Stammzellen, und es fördert die Teilung und das Wachstum von Granulozyten. 4.4.2.4 Interleukin-4, -5 und -6 (IL-4, IL-5, IL-6) Die drei obengenannten Interleukine wirken vor allem auf aktivierte T- und B-Lymphozyten und auf die Proliferation dieser Zellen. In Zusammenarbeit mit IL-2 fördern sie die Zytotoxizität von Thymozyten und erhöhen die Antigenpräsentationsfähigkeit der Makrophagen. 4.4.2.5 Interferon alpha, beta und gamma (IFN-alpha, IFN-beta und IFN-gamma) 48 Daß ein Individuum, das an einer viralen Infektion leidet, sich nicht zusätzlich mit einem zweiten Infekt infizieren kann, verdankt es den Interferonen. Interferone werden, wie alle anderen Lymphokine auch, von den Wirtszellen und nicht von den Krankheitserregern produziert. Ihre Produktionszellen sind die Fibroblasten, die T-Lymphozyten und die Makrophagen. Die Interferonproduktion von virusbefallenen Zellen ist sogar in vitro beobachtbar. Die Wirkungsweise der Interferone ist jedoch spezienspezifisch: Menschliches Interferon wirkt nur beim Menschen, Mäuseinterferon nur bei der Maus, nicht einmal bei Ratten. (Klein, 1991) Ein Virus, das eine Körperzelle befallen hat, ist relativ resistent gegen das Interferon, das durch die befallene Zelle produziert wird. Genau dasselbe Interferon wirkt jedoch als starker Inhibitor für ein anderes Virus. Dies ist die Grundlage für die Inhibition von zwei gleichzeitigen Infektionen. Wie diese Funktion chemisch abläuft, ist noch nicht völlig bekannt. Fest steht nur, daß ein Virus, welches die Membran einer Körperzelle durchdrungen hat und sich in der Zelle zu vermehren beginnt, als Effektor für die Interferonproduktion dient. Durch die Zellteilung des Virus werden die Interferongene der Wirtszelle aktiviert, die in den Ribosomen Interferonerzeugung bewirken. Die Interferonproteine verlassen nun die infizierte Wirtszelle, treten in die Umgebungsflüssigkeit hinein und erreichen dann eine zweite, noch nicht infizierte Zelle. Auf eine heute noch unbekannte Weise verändern sie dann die Zellmembran dieser gesunden Zelle, so daß diese die nun folgenden Viren nicht mehr aufnehmen kann. Daß die Wissenschaft zuerst ganz große Hoffnungen in die Produktion und externe Zugabe von Interferonen setzte, ist aufgrund ihrer Wirkungsweise verstehbar. Die Erzeugung von Interferonen ist jedoch aufgrund ihrer Speziesspezifität besonders schwierig. Ihre Nebenwirkungen sind wegen der hohen Wirkungsfähigkeit ("Lawineneffekt") verheerend. Die meisten Interferontherapien mußten nach kurzer Zeit abgebrochen werden, weil die Nebenwirkungen unzumutbar waren. Damit erlitt das Interferon dasselbe Schicksal wie das zuerst ebenso hochgejubelte Interleukin-2. 49 Interferone hemmen nicht nur die Virusinfektionsfähigkeit der Körperzellen, sie regulieren auch eine Vielzahl von zellulären Funktionen. Je nach Interferontyp können sie natürliche Killerzellen aktivieren oder das Zellwachstum unterdrücken. Beide Funktionen haben in der Eliminierung von karzinogenen Zellen eine große Bedeutung. Mit welchem Mechanismus die Interferone das Zellwachstum inhibieren, ist heute noch nicht bekannt. (Schöllmann, 2/1996) 4.4.2.6 Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) Der Tumor-Nekrose-Faktor hat seine Bedeutung auch in der Gruppe der Lymphokine. Er stellt sich bei aktivierten Makrophagen ein und hemmt das Wachstum von Tumorzellen. TNF verändert die Gestalt von Endothelzellen, welche die den Tumor versorgenden Blutgefäße auskleiden. Durch die Verengung der zuführenden Blutgefäße wird das "Aushungern" der Tumorzellen verursacht. TNF dürfte identisch sein mit der Funkton von Kachexinmolekülen, welche den Gewichtsverlust und die allgemeine Schwäche (Kachexie) eines chronisch oder neoplastisch erkrankten Menschen verursacht. (Klein, 1991) Der Sinn des TNF dürfte in der Fähigkeit liegen, die Versorgungszufuhr der Blutgefäße unterbrechen zu können. Das "Aushungern" einzelner Körperzellen bzw. Körperregionen könnte eine lebensrettende Funktion für das Individuum haben. Eine großflächig angelegte Versorgungshemmung bedroht natürlich auch das Leben des betroffenen Menschen. Die Lymphokine stellen somit die kleinsten Teile des Immunsystems dar. In den letzten Jahren sind sehr große Hoffnungen, vor allem im Bereich der Tumorbekämpfung, mit ihnen verknüpft worden. Die enormen Erzeugungsschwierigkeiten und die unzumutbaren Nebenwirkungen dämpften sehr bald die Anfangseuphorie der Wissenschaftler. In den kommenden Jahren geht es höchstwahrscheinlich darum, bessere Lymphokinenkombinationen zu erzeu- 50 gen, um damit die Nebeneffekte zu minimieren und ihre Heilwirkung zu maximieren. 4.5 Grundformen der Immunabwehr An einer gelungenen Abwehrfunktion sind nicht nur unterschiedliche Organe, Gefäße, Zellen und Moleküle beteiligt. Die einzelnen Abwehrfunktionen laufen auch sehr unterschiedlich ab. Die nun folgende Darstellung zeichnet die wichtigsten immunologischen Abwehrformen nach. Ein Antigen (alles, was vom Immunsystem als "fremd" erkannt wird, nennt man Antigen, d.h. Bakterien, Viren, Parasiten, Toxine, Staubpartikeln ebenso wie Krebszellen) versucht, durch die Schleimhautzone eines Menschen in dessen Körper einzudringen. Es trifft jedoch auf Phagozyten, die in der Lage sind, direkt daran anzudocken und es zu phagozytieren. Das ist die einfachste Form der Immunabwehr. Ein Antigen tritt in die Schleimhautzone ein, es sind jedoch keine Phagozyten, die die Vernichtung direkt vollziehen könnten, in der Nähe. Aber das Antigen ist dem Abwehrsystem durch einen früheren Kontakt bekannt. Deshalb schwimmen zahlreiche Antikörper, die komplementär zu diesem Antigen "passen", in allen Körperflüssigkeiten herum. Die Antikörper heften sich nun mit der Spitze ihrer Y-Arme an das Antigen. Mit ihrem Stamm heften sie sich an vorbeischwimmende Phagozyten, die ohne ihre Hilfe das Antigen nicht erkennen würden. Auf diese Weise üben sie eine "Magnetfunktion" auf die Phagozyten aus, die nun mit der Einverleibung beginnen können. Dieser Vorgang beginnt sofort nach Eintritt des Antigens in den Organismus. Ein Antigen tritt in den Körper ein, ist aber dem Immunsystem bisher nicht bekannt. Deshalb gibt es nicht genügend Antikörper der komplementären Sorte in der Körperflüssigkeit. Es schwimmen lediglich einige mit Antikörpern bestückte B-Lymphozyten, die zufällig zu 51 diesem Antigen passen, im Blut, in der Lymphe und im Schleimhaut herum. Nachdem die Antikörper der B-Lymphozyten das Antigen als komplementär "passendes" erkannt haben, beginnen sich die B-Lymphozyten zu teilen. Gleichzeitig produziert jede der Tochterzellen etwa 1 Million weiterer Antikörper. Diese heften sich an das Antigen, und der schon vorher dargestellte Phagozytosevorgang beginnt. In diesem Falle fängt die "Hauptschlacht" erst zirka 4 Tage nach dem Eintritt des Krankheitserregers im Körper an. Ein Krankheitserreger, z.B. ein Virus, kann unerkannt in eine körpereigene Zelle eindringen und beginnt sich dort zu teilen. Die Antikörper besitzen jedoch nicht die Fähigkeit, ebenso in Zellen einzudringen. Nun muß ein anderer Mechanismus wirksam werden: Verfügt diese Körperzelle über ein MHC-Molekül, dann wird zumindest ein Virus in der körpereigenen Zelle durch einen chemischen Vorgang in seine Bestandteile zerlegt. Die MHC-Moleküle der befallenen Körperzelle präsentieren nun die Virusteile auf der Zelloberfläche. Jetzt können die T-Lymphozyten diese als "fremd" erkennen und schütten Botenstoffe, Lymphokine, aus. Die Lymphokine regen die entsprechenden B-Lymphozyten zur Teilung an. Diese bilden antikörperproduzierenden Tochterzellen, und die neu produzierten Antikörper markieren für die Phagozytose alle übrigen in der Körperflüssigkeit befindlichen Viren. Diese können nun direkt vernichtet werden. Die mittlerweile befallenen Eigenzellen werden von einer speziellen Zellgruppe, von den Killerzellen, abgetötet (siehe auch den nächsten Punkt). Dieser Vorgang kann mehrere Tage bis Wochen dauern. Eine gesunde Zelle wird von einem Krankheitserreger befallen, und sie weist sich durch ihr MHC-Molekül als "krank" aus. Während die T- und B-Lymphozyten auf die oben beschriebene Weise gegen alle noch nicht in den Zellen befindlichen Schwesterviren aktiv werden, treten die Killerzellen aus der Gruppe der T-Lymphozyten in Aktion. Sie nehmen durch ihre Rezeptoren Kontakt mit den Rezeptoren der erkrankten Zelle auf und schütten 52 toxische Proteine aus. Diese greifen die Membran der Zelle an und durchlöchern sie. Nun strömt Umgebungsflüssigkeit in die Zelle hinein, sie platzt auf und stirbt. Die ausströmenden Viren werden ebenso wie die abgestorbenen Zellreste von den Phagozyten entsorgt. Die Aktivität der natürlichen Killerzellen beginnt in wenigen Minuten, die Aktivität der Killerzellen nach einigen Tagen. Ein Krankheitserreger dringt in eine gesunde Zelle ein, die jedoch keine MHC-Moleküle besitzt. Sie kann demzufolge keine Antigenpräsentation ausführen, was ein "Verstecken" des Krankheitserregers bedeutet. Die befallene Zelle verändert jedoch ihre Oberfläche durch die Erkrankung, und diese Oberflächenveränderung alarmiert die Killerzellen, die aufgrund ihrer Zytotoxizität die kranke Zelle vernichten. In diesem Fall können die Schwesterviren nicht rechtzeitig vernichtet werden, aber die Erkrankung wird in Schach gehalten, weil die kranken Zellen immer wieder abgetötet werden. Eine befallene Zelle besitzt zwar kein MHC-Molekül, sie verfügt aber über die Botenstoffe der Lymphokine. Die Zelle selbst kann nicht mehr gerettet werden, durch ihre Oberflächenveränderung werden aber die Killerzellen auf sie aufmerksam und tötet sie. Vor dem Absterben gibt die Zelle noch Lymphokine in die Zellflüssigkeit ab, die von den Rezeptoren anderer, noch gesunder Zellen aufgenommen werden. Diese Zellen sind nun in die "Vorwarnstufe" versetzt. Ihre Rezeptoren sind durch die Lymphokine blockiert, so daß die Schwesterzellen des Krankheitserregers nicht mehr an die Rezeptoren andocken und in sie hineinschlüpfen können. Ein Virus dringt in eine körpereigene Zelle ein, die kein MHC-Molekül besitzt. Die Zelle hat aber auch keine andere Möglichkeit, ihre Erkrankung durch eine Oberflächenveränderung nach außen zu präsentieren. Somit kann sie von außen weder geschützt noch vernichtet werden. Nun tritt ein Mechanismus in Gang, der in der Immunologie mit dem Begriff der Apoptose (programmierter Zellselbstmord) bezeichnet wurde: Durch den Liganden 53 Fas/APO-1, der im Zellkern selbst erzeugt wird, beginnt der Tod der Zelle. Zuerst kommt es zu einer Lyse der DNA im Zellkern, die Zelle wird immer kleiner und verliert ihren Kontakt zu den Nachbarzellen. Die einzelnen Zellbestandteile (Ribosomen, Mitochondrien, Golgi-Apparat, endoplasmatisches Reticulum, u.a.) verlieren den Bezug zueinander, die Zelle zerfällt. Sie wird nun von den Makrophagen restlos entsorgt. In den letzten Jahren wurde der Apoptosevorgang auch bei entarteten Körperzellen beobachtet. Abbildung 17 zeigt, wie der "programmierte Zellselbstmord" verläuft. Abb. 17 (Schöllmann, 4/1996, S. 33) Ein Krankheitserreger infiziert viele körpereigene Zellen. Die Infektion kann lokal nicht mehr bekämpft werden. Die infizierten und absterbenden Zellen schütten nun vermehrt Lymphokine aus, die die T- und B-Zellaktivität steigern und gleichzeitig eine Fieberreaktion verursachen. Bakterien und Viren sind sehr temperaturempfindlich. Am besten gedeihen sie bei etwa 36-37 Grad Umgebungstemperatur, mehr vertragen sie nicht. Steigt nun die Umgebungstemperatur durch die Fieberreaktion, so sterben die meisten Krankheitserreger innerhalb weniger Stunden ab. Ein Virus setzt sich in einer gesunden Zelle fest, beginnt sich dort zu vermehren und infiziert die umgebenden Zellen ebenso. Unter Umständen erzeugt es eine karzinogene Veränderung der Wirtszellen. Es entsteht ein Erkrankungsherd. Von den erkrankten Zellen wird nun Interferon abgegeben, das einerseits eine große Killerzellenaktivität zur Folge hat. 54 Gleichzeitig setzen sich die Interferonmoleküle in die Zellwände der Blutgefäße, die den Erkrankungsherd mit Blut versorgen (eine Tumorzelle wächst ja und braucht viel Nährstoff). Die Interferonmoleküle modifizieren die Wände der Blutgefäße so weit, daß die wichtigsten Nährstoffe sie nicht passieren können. Auf diese Weise wird der erkrankte Bereich "ausgehungert" und abgetötet. Diesen Mechanismus beobachten wir gehäuft bei einer Krebserkrankung. Die Antikörper verfügen noch über einige zusätzliche Abwehrfunktionen: – Sie verklumpen sich z.B. mit Antigenen und verhindern so ihr Festsetzen an den körpereigenen Zellen. – Sie bilden mit ihnen Klone, die die toxische Wirkung mancher Antigene (Rauch!) aufheben. – Sie besetzen potentielle Bindungsstellen im Körper, so daß ein Anheften der Krankheitserreger verunmöglicht wird. Da die Immunologie ein sehr junger, aufstrebender Forschungszweig ist, können wir erwarten, daß in den nächsten Jahren noch andere, wichtige Abwehrmechanismen bekannt werden. 4.6 Fehlfunktionen der Immunabwehr Das Immunsystem ist so komplex, seine Wirkungsweise gleichzeitig so hochspezifisch, daß zeitweilige Fehlfunktionen unvermeidbar sind. Wir unterscheiden mehrere Fehlfunktionen: A. Die Immundefekte bzw. Immununterfunktionen B. Die Überfunktionen und C. Die Fehlfunktionen 55 4.6.1 Immundefekte bzw. Immununterfunktionen Patienten können eine Unterfunktion des Immunsystems bzw. einen Immundefekt in der embryonalen Phase durch eine Störung erworben haben, durch eine Genmutation ererben oder durch eine spätere Infektion bzw. einen Mutationsdefekt erwerben. Der Defekt kann vor allem die T- und B-Lymphozyten treffen. Säuglinge, die zum Beispiel an einem schweren kombinierten Immundefekt leiden, fehlen Lymphknoten, Tonsillen und Thymus, oder diese Organe sind sehr klein. Die betroffenen Kinder leben meistens nur einige Monate. Ihre Organe, vor allem das Schleimhautsystem, werden von Pilzen, Bakterien und Viren besiedelt. Das "erworbene Immundefekt-Syndrom" (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) entsteht durch die Infektion durch das humane Immundefizienz-Virus (HIV), welches die Kommandozentrale des Immunsystems, die T-Lymphozyten, angreift. Die Symptome der AIDSErkrankung sind denen des "schweren kombinierten Immundefekts" ähnlich: Bakterien, Pilze, Parasiten und Viren können von den Immunzellen nicht mehr vernichtet werden. Ebenso unangetastet bleiben die entarteten Krebszellen. Kaposi-Sarkom, Karzinome im Mund und Rektum, schwere Lungenentzündungen oder eine Grippeinfektion bringen den Tod der betroffenen Menschen. Auch folgenden Störungen liegt ein Immundefekt zugrunde: dem DiGeorge-Syndrom, dem Wiskott-Aldrich-Syndrom, der Agammaglobulinämie und dem selektiven IgAMangel, der auch für den Morbus Crohn verantwortlich ist. (Tweel, 1991) Leidet ein Patient an einem Immundefekt, dann fehlen ihm bestimmte Organe, Zellen oder Moleküle des Immunsystems. In diesem Fall kann sogar eine sonst harmlose Impfung oder Infektion lebensbedrohliche Folgen haben. Leidet ein Patient an einer Unterfunktion des Immunsystems, dann sind die wichtigen Immunmechanismen zwar aktiv, ihre Aktivität reicht jedoch nicht für eine vollständige Eliminierung des Antigens aus. Die Unterfunktion 56 des Immunsystems ermöglicht bestimmten Karzinomarten die Ausbreitung im gesamten Organismus. Die Therapie von Immundefekten bzw. Unterfunktionen ist vielfältig, jedoch nicht generell erfolgreich. Folgende Möglichkeiten gibt es: Transplantation von genverwandten Immunorganen bzw. Zellen. Verabreichung von immunaktivierenden Substanzen. Gen- bzw. Strahlenbehandlung der körpereigenen Abwehrzellen. 4.6.2 Immunüberfunktionen Überschießende Reaktionen des Immunsystems kennen wir vor allem unter den Begriffen der allergischen Reaktionen oder Überempfindlichenreaktionen. Darunter versteht man spezifische Immunreaktionen, die von Substanzen hervorgerufen werden, die normalerweise für das Immunsystem harmlos sind. Die häufigsten Allergien werden von Blütenpollen oder Hausstaub(Milben) ausgelöst. Etwa 10 bis 15% der Bevölkerung leiden an solchen Reaktionen. Die Grundursache liegt in einer extremen IgE-Reaktion, die zu vermehrter Histamin- und Leukotrinausschüttung führt, welche die bekannten Symptome der Schleimhautschwellung, des Niesreizes und der Augenreizung verursacht. Bei Asthmapatienten verengen sich die Bronchien, weil die Luftröhren durch Muskelkontraktion zu stark verengt oder weil sie durch allergieverursachten Schleim zu dick beschichtet werden. Dadurch wird das Atmen, vor allem das Ausatmen, erschwert, was zu Erstickungsanfällen führen kann. Asthmaanfälle können entweder durch ein Virus oder durch Allergene verursacht werden. Eine andere allergische Reaktion wird durch die Überreaktion auf eine bestimmte Blutgruppe im Falle von Transfusion hervorgerufen. Hauptverursacher sind dabei hyperaktive Killerzellen. Werden einem Patienten Zellen mit einer Blutgruppe transfundiert, gegen die er Antikörper besitzt, so kommt es zu einer schnellen Zerstörung der übertragenen Zellen. Die Zerstörung rhesuspositiver Erythrozyten beim ungeborenen Kind beruht ebenfalls auf diesem Reaktionstyp. 57 Wenn die Antikörper, die gegen ein normalerweise harmloses Fremdantigen überreagieren, nicht in den Schleimhäuten, sondern in wichtigen Organen sitzen, dann kann es zu massiven Organschädigungen und zu Gewebezerstörung kommen. Die Organe, die durch eine allergische Reaktion am meisten betroffen sind, sind die Niere, das Gehirn, die Gelenke, die Augen und die Blutgefäße. Eine besondere Form der Allergie ist die Kontaktallergie, die nicht durch Antikörper, sondern ausschließlich durch Lymphozyten hervorgerufen wird. (Tweel, 1991) Metalle wie Nickel oder Chrom können Hautekzeme verursachen, die allerdings erst 24 bis 72 Stunden nach dem Kontakt auftreten. Durch die verzögerte Reaktion wird diese Allergieform als "Spättyp-Allergie" bezeichnet. 4.6.3 Immunologische Fehlreaktionen Wenn das Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift, dann entsteht eine autoimmune Erkrankung. Die Hauptursache liegt in den B-Lymphozyten, die nach einer Stimulation die Antikörperproduktion nicht einstellen können bzw. autoaggressive Antikörper produzieren. Normalerweise hemmen die T-Lymphozyten diese destruktive Antikörperproduktion. Bei etwa zwei Prozent der Bevölkerung bricht jedoch eine leidvolle Autoimmunerkrankung aus. "Jeder Mensch ist mehr oder weniger autoimmun", so die Erkenntnis der heutigen Wissenschaft. (Tweel, 1991, S. 223) Demzufolge besitzen wir alle B-Lymphozyten, die gegen körpereigenes Gewebe Antikörper produzieren, wenn auch nur in geringen Mengen. Diese Autoantikörper produzierenden Zellen können auch im Blutserum nachgewiesen werden. Normalerweise halten die T-Lymphozyten die Produktion der Autoantikörper soweit in Schach, daß diese keine merkbaren Beschwerden verursachen. Jede vierte Frau über 60 besitzt zum Beispiel Autoantikörper gegen ihr eigenes Schilddrüsengewebe, ohne es zu merken. Die schweren Autoimmunerkrankungen können alle Körperregionen eines Menschen 58 betreffen: Bei multipler Sklerose werden die Myelinhüllen der Nervenfasern im Gehirn und Rückenmark zerstört. Die Polymyalgie, wahrscheinlich durch Arterienentzündung verursacht, bewirkt eine starke Bewegungseinschränkung vom Nacken bis zu den Oberschenkeln und kann zu Erblindung führen. Die Basedowsche Erkrankung wird durch Antikörper verursacht, die die Schilddrüsenzellen zu überhöhter Hormonproduktion anregen. Siebenmal mehr Frauen als Männer sind von den Symptomen Kropfbildung, hervorquellende Augen und Herzrasen betroffen. Beim Jugenddiabetes zerstören Immunzellen das insulinproduzierende Gewebe der Bauchspeicheldrüse, wodurch Zucker nicht mehr in Fett umgebaut werden kann. Die Schuppenflechte mit den Symptomen der schuppenden, geröteten, juckenden Hautstellen tritt bei ein und demselben Patienten immer wieder auf. Ihre Ursache ist heute noch ungeklärt. Die chronische Polyarthritis verändert durch Entzündungsreaktionen die Knorpelzonen und die Knochen der Gelenke. Unerträgliche Schmerzen und Bewegungsunfähigkeit der Gliedmaßen sind die Folge dieser Autoimmunerkrankung. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Fehlfunktionen des Immunsystems (noch) ebenso viele Fragen aufwerfen wie die Funktionen des Immunsystems selbst. 5. Physiologische Faktoren, die das Immunsystem modifizieren Auch wenn die physiologischen Faktoren nie ganz für sich allein betrachtet werden dürfen, weil mit den meisten physiologischen Veränderungen eine Veränderung des Nerven- und Hormonsystems einhergeht, lohnt es sich, einen Blick auf sie zu werfen. Nicht zuletzt deshalb, weil so der für viele Psychologen typische "Psychologismus" entlarvt wird. Denn es wäre verantwortungslos zu meinen, daß das Immunsystem vorrangig durch die Psyche beeinflußt wird. Es dürfte von genetischen Faktoren, von Umweltfaktoren, physiologischen und psychologischen Faktoren gleichermaßen modifiziert werden können. 59 5.1 Lärm Lärm schädigt nicht nur das Nerven- und Gehörsystem, sondern auch das Immunsystem. Ab ca. 80 dB(A) können schädliche Effekte sowohl experimentell als auch in Feldstudien nachgewiesen werden. Ein Lärmpegel von 80 dB(A) entspricht der Geräuschkulisse neben einer verkehrsreichen Straße, dem Lärm eines Staubsaugers oder einer Kaffeemühle. Höhere Werte erzielt z.B. ein "frisiertes" Moped, ein vorbeifahrender schwerer LKW, der Lärm einer Diskothek oder einer Metallbearbeitungswerkstatt. (Lauterbach, 1996) Auch wenn der Lärmpegel von den betroffenen Personen subjektiv noch nicht als unaushaltbar empfunden wird, wird ab 90 dB(A) das sympathische Nervensystem erregt, werden die Hormone des Nebennierenmarks vermehrt ausgeschüttet, und es kommt zum berühmten "Fight-Flight-Syndrom". (Guttmann, 1982, S. 117) Der Körper wird in eine Alarmstufe versetzt, Adrenalin und Noradrenalin werden ausgestoßen, die Herzfrequenz, der Blutdruck und der Blutzuckerspiegel werden gesteigert, die Funktion des Verdauungstraktes herabgesetzt. Nach längerer Lärmbelastung erhöht sich der Cholesterinspiegel (chronisches Streßsyndrom). Freie Fettsäuren werden vermehrt abgegeben, und es tritt ein chronischer physiologischer Streßzustand auf, der das Risiko einer Herzerkrankung erhöht. Durch die veränderte Hormonausschüttung und durch die streßbedingte Herabsetzung der für das Immunsystem so wichtigen Darmfunktion kann es langfristig auch zu einer Funktionsveränderung des Immunsystems kommen. Die schädliche Auswirkung von Nachtlärm beginnt bei etwa 50 dB(A). Dieser Lärmpegel entsteht, wenn zum Beispiel ein LKW bei einer Entfernung von 40 m an einem geschlossenen Fenster vorbeifährt. (Schöllmann, 1994) Versuchspersonen, die nächtelang einem Lärmpegel von über 55 dB(A) ausgesetzt waren, hatten erhöhte Streßhormonmengen, wiesen Konzentrationsstörungen auf, und es fehlten ihnen die nächtlichen Tiefschlafphasen. Die 60 Tiefschlafphasen spielen jedoch eine sehr wichtige immunologische Rolle: In diesen Phasen findet die effektivste Zellteilung und Zellvermehrung der Lymphozyten statt. (Kasper und Hennemann-Hohenfried, 1990). Langfristige Schlafstörung im Blick auf die Tiefschlafphasen bedeutet Suppression der Lymphozyten. 5.2 UV-Strahlung Speziell die UV-B-Strahlen verändern die Aktivität bzw. die Proliferation von Immunzellen. Diese geht mit einem erhöhten Karzinomrisiko einher. Hersey et al. untersuchten die Immunmodulation an einer Gruppe von Versuchspersonen, die in Australien insgesamt 12 Tage lang jeweils 1 Stunde lang in der Mittagszeit dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, die Sonnenlicht mied, zeigte sich, daß bei den "bestrahlten" Personen die Zahl der Suppressorzellen signifikant zunahm, während sich die Zahl der Helfer-T-Zellen verringerte. (Hersey et al., 1983) Die Suppressorzellen (CD8-Zellen) unterdrücken die Immunaktivität des Organismus ebenso, wie Corticosteroide eine überschießende Hormonaktivität bremsen. Darüber hinaus konnte an experimentellen Tierstudien gezeigt werden, daß die übermäßige Bestrahlung durch UV-B-Strahlen nach nur einer Woche einen signifikanten Aktivitätsabfall der natürlichen Killerzellen und der Lymphozytenaktivität verursacht. Wurden Versuchstiere in der Zeit der UV-B-Bestrahlung mit Viren oder Parasiten infiziert, so erkrankten diese signifikant häufiger als die nicht bestrahlten Tiere. (Rudolf Müller, 1994) Da die Abnahme der natürlichen Killerzellen mit einem erhöhten Karzinomrisiko einhergeht, ist die Gefahr, die durch das "Ozonloch" in Australien entsteht, nicht zu unterschätzen. Wegen des geringeren Ozonschutzschilds wächst dort die Zahl der Melanome und anderer Hautkrebsarten ebenso wie die Zahl der durch Viren verursachten Augenerkrankungen. 61 5.3 Höhen- oder Klimawechsel Offensichtlich erreichen Menschen, die in einer bestimmten Höhenlage oder in bestimmten Klimaverhältnissen leben, ihren optimalen Immunstatus jeweils "zu Hause", d.h. in der gewohnten Lebensumgebung. Ein rascher Klima- oder Höhenwechsel führt bei Tausenden von Winter- bzw. Sommerurlaubern zum Auftreten von schmerzhaften Herpes-Bläschen, verursacht durch das HerpesSimplex-Virus. Die Herpes-Bläschen treten jedoch kaum infolge einer Neuinfektion auf. Normalerweise liegen sie jahrelang knapp unter der Hautoberfläche im Nasen-Mund-Bereich und werden von einem intakten Immunsystem ohne weiteres in Schach gehalten. Erst durch Abschwächung des Immunsystems, verursacht durch eine Fiebererkrankung oder durch raschen Klimawechsel, geraten die Herpesviren außer Kontrolle. (Hadinger, 1993) 5.4 Körpertemperatur Sowohl Immunzellen als auch zahlreiche Krankheitserreger reagieren empfindlich auf die Temperaturveränderungen in ihrem Lebensraum, dem Körper des Menschen mit seiner durchschnittlichen Temperatur von 37° C. Wir alle kennen die Situation, die durch eine "Verkühlung", also durch ein Absinken der Körpertemperatur verursacht wird. Etwa einen Tag nach einer Unterkühlung treten die typischen Folgesymptome auf: Die Nase rinnt, weil die IgA-Moleküle sich mit den einzelnen Viruszellen verklumpen und dann durch die vermehrte Schleimhautproduktion aus der Nase ausgespült werden. Die Körpertemperatur erhöht sich, weil dadurch neben der Phagozytose ein weiterer Abtötungsvorgang gegen die Krankheitserreger gestartet wird. Der Hals schmerzt, weil im immunologischen "Rachenring" die festgesetzten Viren oder Bakterien durch einen Entzündungsprozeß leichter eliminiert werden können. Aber woher kommen die 62 Krankheitserreger im Körper, wenn man sich lediglich unterkühlt? Und warum hilft oft ein rechtzeitig genommenes heißes Bad, um den Ausbruch einer Krankheit noch "auffangen" zu können? Woher kommen plötzlich Millionen von Viren, die nach einer Unterkühlung der Beckengegend eine schmerzvolle Blasenentzündung verursachen? Und warum verschwinden Grippeviren ohne Behandlung, lediglich durch Fieber um 39 Grad herum? Die Antwort liegt offensichtlich in der Temperaturempfindlichkeit der Krankheitserreger und der Immunzellen. Bei einer Unterkühlung ist natürlich nicht immer eine externe Infektionsquelle vorhanden. Die "Schnupfenviren", die die allgemein bekannte Symptomatik der Verkühlung verursachen, liegen jedoch häufig in kleinen Mengen in der Nasenschleimhaut eines Menschen verborgen, vor allem in der "Schnupfenzeit", also im Frühjahr und im Herbst (der Sommer ist oft zu warm für die Schnupfenviren und der Winter zu kalt). Normalerweise werden sie von den Immunzellen der betroffenen Person nach einigen Tagen vernichtet oder zumindest in Schach gehalten, ähnlich den Herpes-Simplex-Viren. Die Immunzellen eines Menschen reagieren jedoch auf einen Temperaturabfall ihrer Umgebung sehr empfindlich, und sie verlieren ihre Antigenwirksamkeit. Vielleicht sterben sie massenweise ab, vielleicht verlieren sie lediglich ihre Aktivität. Tatsache ist, daß bei einem Temperaturabfall die in der Blase und im Hals "lauernden" Viren plötzlich keine Gegner mehr haben und sich deshalb rasant vermehren können (pro Stunde werden mehrere Millionen Viren von eine Mutterzelle produziert). Dadurch kommt es zum Krankheitsausbruch. Aber warum werden die sich vermehrenden Viren, sofern sich ein Mensch rechtzeitig ein heißes Bad nimmt oder sich in die Sonne begibt, wieder vernichtet? Offensichtlich sind die meisten Krankheitserreger ebenso temperaturempfindlich wie die Immunzellen, allerdings entgegengesetzt: Sie sterben durch eine erhöhte Umgebungstemperatur ab. Das heiße Bad, welches bald nach der Unterkühlung genommen wird, verursacht eine leichte 63 Temperaturerhöhung. Da die temperaturempfindlichen Krankheitserreger zu diesem Zeitpunkt erst am Beginn ihrer Teilungskaskade stehen und sich noch nicht in allen Körperregionen verteilen konnten, ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie vernichtet werden, groß. Später kann sie erst das hohe Fieber, welches den gesamten Körper erfaßt, abtöten. Will man Erkältungen vorbeugen, so sollte das Immunsystem Temperaturveränderungen gegenüber tolerant gemacht werden: z.B. durch wechselweises heißes und kaltes Duschen. In immunologischer Hinsicht handelt es sich dabei um eine physiololgische Konditionierung der Immunzellen, bei raschem Temperaturabfall optimal zu reagieren. Zu den wenigen experimentellen Studien, die die Auswirkungen von Temperaturveränderungen auf das Immunsystem erforschen, gehört die Untersuchung von Kluger et al. (1991). In einem Experiment unterdrückten die benannten Forscher die Fieberreaktion von Tieren, die vorher mit Viren oder Bakterien infiziert waren. Nach wenigen Tagen zeigte sich, daß die Versuchstiere mit einer Infektion aber ohne Fieberreaktion wesentlich geringere Überlebenschancen hatten als Tiere der Kontrollgruppe, die ebenso infiziert waren, aber eine Temperaturerhöhung ausbilden konnten. Zusammenfassend ist festzustellen, daß Immunzellen offensichtlich ebenso empfindlich auf eine Temperaturveränderung reagieren wie zahlreiche Krankheitserreger. Während die meisten Immunzellen ihre Aktivität bei einer Umgebungstemperatur von unter 36 Grad Celsius verlieren, reagieren Viren und Bakterien umgekehrt: Sie reagieren hochsensibel auf einen Temperaturanstieg über 37 Grad. Angesichts der Erkenntnisse bzgl. der Temperaturempfindlichkeit von Immun- bzw. Viruszellen wären weitere Studien für eine eventuelle klinische Anwendung sehr interessant und wünschenswert. 5.5 Zirkadianer Rhythmus Offensichtlich ist das Immunsystem, ebenso wie das Nerven- und Hormonsystem, nicht zu 64 jeder Zeit in gleichem Maße aktiv. Seine Aktivität ist phasengebunden: tagsüber anders als nachts. Der zirkadiane Wert bzgl. der Aktivität der gesamten Leukozyten eines Menschen ist in den Morgenstunden am niedrigsten. In den Nachmittagstunden steigt er langsam an und erreicht den maximalen Wert gegen Mitternacht. Vor allem die T- und B-Lymphozyten zeigen dabei Abhängigkeit vom Cortisol-Spiegel eines Menschen, der – gerade umgekehrt – in den Morgenstunden am höchsten und in den Abendstunden am niedrigsten ist. Wird der zirkadiane Rhythmus eines Menschen experimentell verändert, so verändert sich gleichzeitig mit der Cortisolausschüttung auch die Ausschüttung von Lymphozyten. Umgekehrt dazu weisen die Killerzellen den höchsten Wert während des Tages auf und den niedrigsten in den Nachtstunden. (Kasper und Hennemann-Hohenfried, 1990) Aus den Untersuchungen bzgl. der zirkadianen Rhythmen liegt die Annahme nahe, daß Viren vorrangig während der Schlafperiode, während Krebszellen vorrangig tagsüber bekämpft werden. Hierbei dürfte die HypothalamusHypophysen-Nebennierenrinden-Achse eine große Rolle spielen. 5.6 Sport Sport kann das Immunsystem sowohl anregend als auch unterdrückend beeinflussen. Mäßig betriebener, regelmäßiger Sport erhöht die Immunresistenz der Betroffenen und verhindert einen zu starken Alterungsprozeß des Immunsystems. Leistungssport hingegen verursacht eine chronische Immunsuppression. Die endogenen Substanzen, die durch Sport ausgeschieden werden und auf das Immunsystem modifizierend wirken, sind Adrenalin, Cortisol, Glutamin und die Neuropeptide (Endorphine und Enkephaline). Regelmäßig betriebener, mäßiger Sport verursacht jeweils eine kurzfristige nichtinfektiöse, unspezifische Entzündungsreaktion im Körper. Die immunologische Folge davon ist, daß die Makrophagen aktiviert werden und ihre Phagozytoseaktivität steigt; Leukozyten, Fi- 65 broblasten und Endothelzellen produzieren vermehrt Interleukine und Interferone; ruhende TLymphozyten werden ebenfalls vermehrt stimuliert, und diese erhöhen ihren Rezeptorenbesatz. Während eines gemäßigten sportlichen Trainings nimmt die Zahl und die Aktivität der Immunzellen zu. Wenn dieses Training der betroffenen Personen eine leichte bis mittlere Anstrengung abverlangt, dann kehren die Immunwerte einige Stunden nach der Anstrengung auf das ursprüngliche Niveau zurück. Wird von den betroffenen Personen häufig gemäßigter Sport betrieben, dann kehren die habituellen Immunwerte nicht bloß auf das ursprüngliche Niveau zurück, sondern sie nehmen sowohl qualitativ wie auch quantitativ zu. Ob ein Sporttraining als leicht, mittelschwer oder schwer empfunden wird, darüber entscheidet das subjektive Befinden des Betroffenen. Im Gegensatz zur leichten bis mittleren Sportanstrengung wirkt Leistungssport immunsuppressiv. Hochleistungssport führt zu einer zahlenmäßigen Verringerung der Leukozyten, gleichzeitig wird auch ihre Aktivität eingeschränkt. Die Phagozytoseaktivität der Makrophagen nimmt ebenso ab wie die Zahl der Killerzellen. Auch einige Stunden nach einer sportlichen Extremleistung sind die Immunwerte von Hochleistungssportlern herabgesetzt. Bis zur vollständigen Regeneration würde es einige Tage dauern. Dazwischen liegen jedoch normalerweise wieder extreme Trainingsmengen. Die Folge ist ein chronisch geschwächtes Immunsystem, das sowohl in Feldstudien als auch in experimentellen Untersuchungen bestätigt werden konnte: Hochleistungssportler sind vermehrt anfällig gegenüber Infektionen der Atemwege, des Urogenital- und des Verdauungssystems. (Uhlenbruck, 1993; Uhlenbruck, 1996) Infektiöse Erkrankungen bei Hochleistungssportlern dauern länger und sind schwerer als bei Nichtsportlern. Da die meisten Leistungssportler das Training viel zu früh wieder aufnehmen, ist ein Rückfall oder eine Chronifizierung ihrer Erkrankungen sehr häufig. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß regelmäßig betriebener leichter bis mittelschwe- 66 rer Sport das Immunsystem langanhaltend stärkt und dieser Effekt sowohl gegen eine Veralterung des Immunsystems als auch in der Betreuung von Karzinompatienten effektiv nutzbar gemacht werden kann. (Uhlenbruck, 1993; Rudolf-Müller, 1994) Im Gegensatz dazu wirkt Leistungssport immunsuppressiv, weil er sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Herabsetzung der Immunwerte verursacht. 5.7 Alter Wie alle Organe und Körperfunktionen unterliegt auch das Immunsystem einem Entwicklungs- und einem Alterungsprozeß. Ein neugeborenes Kind kommt mit einer angeborenen, unspezifischen Immunabwehr zur Welt. Einige Stunden nach der Geburt besiedeln Bakterien und Mikroorganismen den Darm des Säuglings. Nach dem ersten Kontakt mit anderen Personen versuchen Viren, durch die Schleimhäute in den neuen Organismus einzutreten. Den meisten Krankheitserregern könnte die angeborene, also unspezifische Immunabwehr höchstens einige Tage lang standhalten. Deshalb bietet die Muttermilch in den ersten Lebensmonaten durch ihren hohen IgA-Gehalt einen spezifischen Schutz für das Kind. Doch das Immunsystem eines Säuglings beginnt sich auch selber zu entwickeln: Die ersten Bakterien, Viren und andere Fremdkörper werden im Darm von den Makrophagen zerlegt. Ihre Bruchstücke werden durch die MHC-Moleküle der Phagozyten in die Thymusdrüse transportiert, wo sie den T-Lymphozyten zur "Schulung" präsentiert werden. Einige Tage nach der Präsentation sind die betroffenen T-Lymphozyten in der Lage, den ihnen vorher präsentierten Krankheitserreger selber als "fremd" zu erkennen und die spezifische Immunkaskade zu starten. Interessanterweise entwickelt sich das Immunsystem eines jungen Menschen nicht von allein, sondern immer nur in Auseinandersetzung mit der Umwelt. Sowohl Unterforderung (extremer Schutz eines Kindes vor möglichen Krankheiten) als auch Überforderung (übermä- 67 ßige Sorglosigkeit bzgl. Erkrankungsmöglichkeiten) verhindern die optimale Entwicklung des Immunsystems. Eine ideale Abwehranlage bedeutet, daß das Immunsystem durch Lernen und Übung, also durch einen aktiven Prozeß disponiert ist, zur rechten Zeit und am richtigen Ort die richtige Reaktion in die Wege zu leiten. Nach Wolff spielt dabei die Aktivität eine große Rolle: Analog zur geistigen und seelischen Aktivität wird auch das Immunsystem durch Anstrengung und Training geschult. (Wolff, 1991) Menschen, die nicht bereit sind, sich aktiv mit "der Welt und Natur" zu verbinden, sind offensichtlich auch schwer in der Lage, zur richtigen Zeit geistig, seelisch oder immunologisch widerstandsfähig zu reagieren. Die in immunologischer Perspektive "beste Zeit" eines Menschen liegt zwischen dem 17. und 35. Lebensjahr. In dieser Zeit konnte das Immunsystem die wichtigsten Krankheitserreger schon kennenlernen, die Rückbildung der Thymusdrüse beeinflußt jedoch noch nicht die Immunfunktionen. Mit zunehmendem Alter nimmt jedoch das Gewicht und das Volumen der Thymusdrüse ab. In der Mitte des Lebens sind nur mehr einige Epithelzellenreste aus der Thymusdrüse übrig. Etwa ab dem 60. Lebensjahr sind keine Thymushormone mehr im Blut nachweisbar. Das Immunsystem beginnt nun aus dem Gleichgewicht zu geraten: Die Zahl unreifer T-Zellen nimmt zu, ebenso die Zahl der THelferzellen. Da gleichzeitig die Zahl der T-Suppressorzellen abnimmt, können nun Antikörper viel mehr als früher körpereigenes Gewebe angreifen, was eine Zunahme der Autoimmunerkrankungen verursacht. Ein adäquater Angriff des Immunsystems auf Krankheitserregern, das in jungen bis mittleren Jahren ohne weiteres erfolgen konnte, gelingt nun immer seltener. Die Folge ist eine Zunahme von schweren Erkrankungen. Das "immunologische Gedächtnis" nimmt ab. Mit zunehmendem Lebensalter nehmen gleichzeitig die immunologischen Fehlfunktionen zu. Die B-Lymphozyten produzieren zwar mehr Antikörper als in jungen Jahren, diese werden aber 68 nicht mehr richtig koordiniert. Chemische Verbindungen, Strahlen und UV-Licht verursachen weitaus mehr Schädigungen als früher. Doch muß das "funktionelle Alter" des Immunsystems nicht unbedingt mit dem Lebensalter eines Menschen korrelieren. Regelmäßig mäßiger Sport an frischer Luft und ein richtiges Zuführen von Nährstoffen ermöglichen, daß auch ein älterer Mensch noch lange immunologisch jung bleiben kann. Gegebenenfalls ist es sogar möglich, die Rückbildung der Thymusdrüse zu verlangsamen. (Kunze, Schöllmann, 1995) Eine gesunde Lebensweise ohne Rauch, Alkoholmißbrauch und übermäßigen Streß trägt zu einer gesunden Immunfunktion auch im hohen Alter vieles bei. Einen weiteren diesbezüglichen "Verjüngungsfaktor" stellt die geistige Fitneß einer Person dar: Geistige Aktivität bewirkt die Ausschüttung von Endorphinen im Gehirn. Endorphine und Enkephaline haben immunmodulierende Effekte auf die Antikörperproduktion, auf die zelluläre Zytotoxität, auf die T-Zell-Mitogenese, auf die NK-Zell-Aktivität (Krebs!) und auf die Interferonproduktion. Darüber hinaus befinden sich Opiatrezeptoren auf der Oberfläche von Monozyten, Lymphozyten und Granulozyten. (Rudolf-Müller, 1994) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Alter eines Menschen als ein wichtiger immunmodulatorischer Faktor angesehen werden kann. Doch ist das funktionelle Alter des Immunsystems durch Faktoren wie Ernährung, Bewegung, geistige Aktivität und Umwelteinflüsse in positiver wie in negativer Hinsicht beeinflußbar. 5.8 Ernährung Die Ernährung eines Menschen spiegelt in doppelter Hinsicht eine immunmodulatorische Rolle: durch die Zufuhr von richtigen Nährstoffen und durch die Immunmodulation im Darm. 5.8.1 Zufuhr von richtigen Nährstoffen 69 Das Immunsystem hat neben der Leber, dem Verdauungssystem und dem Kreislaufsystem den größten Verbrauch an Vitalstoffen. (Kunze, Schöllmann, 1995) Im Normalfall reicht eine ausgewogene Ernährung für die optimale Immunversorgung aus. Doch mit zunehmender Belastung des Immunsystems (Krankheitsabwehr, Umweltbelastung, Streß, Operationen, Schwangerschaft, Chemotherapie oder hohes Lebensalter) entsteht ein erhöhter Bedarf an Vitalstoffen für die Aufrechterhaltung der Immunfunktionen. Schätzungen von Immunologen zufolge sind beispielsweise etwa 40-60% (!) aller Tumorerkrankungen auf Ernährungseinflüsse zurückzuführen, wobei sowohl die Aufnahme von Schadstoffen als auch eine Unterversorgung von tumorprotektiven Wirkstoffen eine Rolle spielen. (Schäffer, 1995) Eine schleichende Unterversorgung des Immunsystems bewirkt dessen frühzeitige Alterung bzw. chronische Fehlfunktion. Die wichtigsten immunologischen Vitalstoffe sind Vitamine und Spurenelemente. 5.8.1.1 Vitamine Vitamine sind für das Immunsystem in zweierlei Hinsicht überlebenswichtig. Einerseits sind sie hervorragende "Radikalfänger", andererseits bieten sie den idealen Nährboden für das Zellwachstum und für die Zellteilung innerhalb des Immunsystems. Freie Radikale sind "aggressive Sauerstoffverbindungen, die im Körper von aktivierten Zellen des Immunsystems gebildet oder aus absterbenden Zellen freigesetzt werden." (Kunze, Schöllmann, 1995, S. 35) Freie Radikale wirken oxidierend, im Grunde wie eine innere radioaktive Strahlung, auf die Zellen. Normalerweise nutzen die Immunzellen die freigesetzten Oxidanten als Waffe gegen körperfremde Mikroorganismen. Ein Überschuß an freien Radikalen kann sich jedoch als "Bumerang" gegen das eigene System erweisen: Werden sie von antioxidativen Substanzen wie z.B. Vitaminen nicht eingefangen, dann kommen sie in einem Übermaß im menschlichen Körper vor und schädigen nicht nur Fremdmikroorganismen, son- 70 dern auch die Membran gesunder Zellen. Die aggressive Zellveränderung kann zu chronischen Entzündungsprozessen oder zu Tumorbildung der betroffenen Zellen führen. Antioxidative Vitamine wie die Vitamine A, C und E sowie Beta-Carotin wirken als Radikalfänger. Durch ihre antioxidative Wirkung fangen sie die oxidierenden Radikale ein und neutralisieren sie. Dadurch können sie nicht nur entzündungshemmend wirken, sondern auch tumorprophylaktisch. Zahlreiche, exakt aufgebaute klinische Studien weisen darauf hin, daß eine prophylaktische bzw. therapeutische Zuführung der obengenannten antioxidativen Vitaminen tumorvorbeugend bzw. lebenverlängernd wirken kann. Einige Studien weisen darauf hin, daß beispielsweise durch eine optimale Kombination von Chemotherapie und Vitamin-A-Zugabe die Überlebensrate von Karzinompatienten um 30% gesteigert werden kann. (Rudolf-Müller, 1993; Kiklinski, 1994; Schäffer, 1995) Vitamin A kommt in der Milch, in Fisch, Käse, Eiern, Spinat, Karotten, Pilzen, Hülsenfrüchten, Lebertran und im Feldsalat vor. Es wird im Darm aus den oben genannten Nährstoffen resorbiert, jedoch nur dann, wenn es mit Fett in Verbindung treten kann. Ohne Fettmoleküle wird das Vitamin aus dem Darm mit dem Stuhl ausgeschieden, denn das Fett dient als "Schlepper", der die Vitamin-A-Moleküle durch die Darmwand transportiert. Deshalb ist es empfehlenswert, zum täglich getrunkenen Karottensaft einige Öltropfen hinzuzufügen. Die fettbedingte Vitamin-A-Aufnahme bedeutet, daß es zu Vitamin-A-Mangelerscheinungen nicht nur dann kommen kann, wenn zu wenige vitamin-A-haltige Nahrungsmittel konsumiert werden, sondern auch dann, wenn einem Organismus zuwenig Fett zugeführt wird bzw. wenn das Fett im Darm verringert resorbiert wird. (Classen et al., 1991) Vitamin A dient als wichtiger Nährstoff für den menschlichen Organismus. Es fördert die Zell-Neubildung, regt die Schilddrüsentätigkeit an und sorgt für eine optimale Schleimhautbildung. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, daß karzinogene oder spontan 71 aufgetretene Zellveränderungen in den Organbereichen, die mit Schleimhaut ausgekleidet sind (Bereiche des Bronchial-, Magen-Darm- und Urogenitaltrakts sowie Bereiche des Nasen-, Mund- und Nasenraums), durch Vitamin-A-Zugabe beeinflußt werden können. (Pecher und Rudolf-Müller, 1994) Ebenso zeigen epidemiologische Untersuchungen, daß Personen, die längerfristig an Vitamin-A-Mangel leiden, häufiger Zellveränderungen im Bereich ihrer Schleimhautsysteme aufweisen. Weitere, immunologisch bedeutsame Vitamin-AMangelerscheinungen sind: verschiedene Infektionen des Auges, die auch zu vollständiger Erblindung führen können. Tracheitis und Bronchitis aufgrund der veränderten Schleimhautbildung. Trockenheit von Konjunktiven und Hornhaut aufgrund der verminderten Flüssigkeitsbildung. Einschränkung des Riechvermögens aufgrund eingeschränkter Schleimhautbildung. Darüber hinaus können Amenorrhö und vermehrte Nierensteinbildung auftreten. (Classen, 1991) Vitamin-A-Mangel und Tumorinzidenz weisen offensichtlich eine hohe Korrelation auf. In einer Studie an 102 Patienten mit einem Bronchialkarzinom konnte Scheef zeigen, daß die 1-Jahres- Überlebensrate der Patienten, die neben der Chemotherapie auch eine zusätzliche Vitamin-A-Therapie erhielten, um 30% höher lag als bei den Patienten, die zwar eine optimale Chemotherapie, jedoch kein megadosiertes Vitamin-A-Präparat erhielten. Die Zwei-Jahres-Überlebensrate lag bei den Vitamin-A-therapierten Patienten sogar um 50% höher als bei der Kontrollgruppe. (Pecher und Rudolf-Müller, 1994) Die beiden Autoren berichten von einem Vitamin-A-Therapieversuch, der schon im Jahre 1936 durch Lustig und Wachtel durchgeführt wurde. Demnach behandelten die beiden Onkologen Patienten, die Hautepitheliomen oder ein oberflächliches Mammakarzinom aufwiesen, mit Vitamin-A-getränkten Umschlägen und mit unter die Haut injiziertem Retinolpalmitat. Innerhalb weniger Tage wiesen die Hautgeschwulste meßbare Verkleinerungen auf, und offensichtlich gelang es auch, bei einigen Patientinnen die Mammakarzinomrezidive zur Abheilung zu bringen. 72 Von einem umgekehrten Effekt im Zuge prophylaktischer Maßnahmen berichtet Rowe (1996). In einem klinischen Versuch wurde Rauchern zur Vorbeugung gegen ein Lungenkarzinom Beta-Carotin in Megadosen verabreicht. Das Beta-Carotin stellt eine Vorstufe von Vitamin A dar und wird durch enzymatische Spaltung in der Darmwand in Vitamin A überführt. Der karzinomprophylaktische Versuch mußte jedoch abgebrochen werden, weil in der behandelten Gruppe statistisch signifikant mehr Lungenkarzinome auftraten als in der nikotinabhängigen Kontrollgruppe, die nicht behandelt wurde. Diese Studie zeigt, daß manche Nährstoffe nicht unkontrolliert in extremen Mengen verabreicht werden dürfen. Wichtig ist die präzise Festlegung des Indikationsbereiches im Blick auf den therapeutischen Einsatz. Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, kommt in frischem, säuerlichem Obst als auch in Zitrusfrüchten, Sanddorn, Hagebutten und Kiwis vor. Ebenso in Gemüsesorten wie Paprika, Kohl, Kartoffeln und Petersilie. Die immunologische Bedeutung von Vitamin C liegt zum einen, ebenso wie bei Vitamin A und E, in seiner antioxidativen Wirkung. Vitamin C dient demnach auch als Radikalfänger. Darüber hinaus liefert es den wohl wichtigsten Nährboden für die optimale Funktionstüchtigkeit der Immunzellen. In einer Vitamin-C-Nährlösung wird ein optimales Zellwachstum erreicht, darüber hinaus eine vermehrte Zellteilung bestimmter T-Lymphozyten bzw. der natürlichen Killerzellen. Eine erhöhte Vitamin-C-Zugabe ist sowohl während als auch nach einer Erkrankung notwendig für die Regeneration des Immunsystems. Eine mangelhafte Zufuhr von Vitamin C verursacht nicht nur die bekannte Skorbut-Erkrankung, sondern auch eine radikale Zunahme von Infektionskrankheiten, die normalerweise von einem intakten Immunsystem ohne weiteres abgewehrt werden können. (Cathcart, 1991) Vitamin-C-Zufuhr in hohen Dosen (über 10g/Tag) vermindert klinisch nachweisbar das Risiko von infektiösen, entzündlichen und karzinogenen Erkrankungen. (Bendich und Langseth, 1995; Cathcart, 1991, Bielory, 1994) Vitamin E, auch Tocopherol genannt, kommt in Mais-, Sonnenblumen- und Weizen- 73 keimöl vor, darüber hinaus in Nüssen, Soja, grünem Salat und in Roggenvollkornmehl. Vitamin E ist, ebenso wie die Vitamine A, C und das Beta-Carotin, ein Antioxidans. Vitamin-EMangel verursacht Allergien und Verdauungsstörungen. Eine hochdosierte Zufuhr von Vitamin E, vor allem in der Kombination mit Vitamin A und C, bewirkt in klinischen Studien eine deutliche Verringerung der Karzinomhäufigkeit. Ebenso verlangsamt das Vitamin E, in Kombination mit den beiden vorher genannten Vitaminen, das Tumorwachstum von entarteten Zellen. (Schäffer, 1995; Das, 1994) Serologische Untersuchungen von Karzinompatienten zeigen, daß Krebs bei Personen mit niedrigem Blutspiegel bzgl. der Antioxidanten Vitamin A, C, E und Selen überdurchschnittlich häufig vorkommt verglichen mit Personen mit Normalwerten bzgl. der Antioxidanten. (Dietl und Ohlenschläger, 1994) Zusammenfassend läßt sich sagen, das die antioxidativen Vitamine A, C und E durch ihre Radikalfängereigenschaften als ein lebenswichtiges Entgiftungssystem des menschlichen Organismus angesehen werden müssen. Darüber hinaus bieten diese Vitamine eine optimale Kultur für das Wachstum und für die Zellteilung innerhalb des Immunsystems. Ohne diese lebenswichtigen Vitamine kann eine ausreichende Immunfunktion nicht aufrechterhalten werden. Die Untersuchungsergebnisse, die immer wieder dazu anregen, auf einen auftretenden Vitaminmangel bei den karzinogenen Erkrankungen hinweisen, sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden. Es wäre wahrscheinlich falsch, im Blick auf die klinischen Ergebnisse auf ein einfaches Ursache-Wirkungs-Verhältnis zu schließen. Ein niedriger Vitaminspiegel im Blutserum kann ja nicht nur dadurch entstehen, daß zuwenig Vitamine dem Organismus zugeführt wurden. Ebenso wäre es möglich, daß im Körper – die Resorption der Vitamine nicht vollständig gelingt; – der Verbrauch an Vitaminen durch einen zu hohen Umsatz erhöht ist; – die Tumorzellen, die sich ja auch ernähren müssen, für ihr unkontrolliertes Wachstum die vielfache Menge an Vitaminen verbrauchen. 74 5.8.1.2 Spurenelemente Die immunologisch wichtigsten Spurenelemente sind Selen und Zink. Selen und Zink werden nicht direkt wie Vitamine in die immunologische Funktion eingeschaltet, sondern indirekt: Der Körper verfügt auch selber über antioxidative Enzyme (Glithathion-Peroxidasen, Katalasen und Superoxid-Dismutasen), die die aggressiven Oxidanten, also die "freien Radikale" binden können. Entscheidend für diese körpereigenen Enzyme ist jedoch, daß genügend Spurenelemente, vor allem Selen oder Zink, für ihre Synthese bereitstehen. Selen (Natriumselenit) kommt in Nahrungsmitteln wie Schalentieren, Fisch, Weizenkeimen, Bierhefe, Pilzen, Brokkoli, Vollkornreis, Zwiebeln, Knoblauch, Spargel, Mais und Tomaten vor. Allerdings nur dann in genügendem Maße, wenn diese Nahrungsmittel nicht bestrahlt oder langen Transportwegen ausgesetzt waren. In zahlreichen Studien der letzten Jahre wurde gezeigt, daß Selen effektiv in der Karzinomtherapie eingesetzt werden kann. (Schäffer, 1995) Selen wirkt offensichtlich tumorprotektiv bei Leber- und Lungenkrebs. Darüber hinaus aktiviert es die Reparaturenzyme der DNA einer Zelle und vermindert dadurch ihre Replikationsfehlerrate. Offensichtlich greift Selen bis zur DNA-Synthese einer Zelle ein und beeinflußt dadurch die Entstehung karzinogener Erkrankungen. In zahlreichen empirischen Studien wird belegt, daß alle Krebspatienten einen Selenmangel aufweisen. (Den meisten Krebspatienten mangelt es darüber hinaus auch an Vitamin A, C und E und neben Selen auch an Zink.) (Rudolf-Müller, 1993; Schäffer, 1995) In England und in den USA wird Selen, oft kombiniert mit den obengenannten Nährstoffen, schon seit einem Jahrzehnt mit Erfolg in der Krebstherapie eingesetzt. Die Ergebnisse der Behandlung reichen von längeren Überlebenszeiten, höheren Überlebensraten, Schmerzreduktion über eine Erhöhung der Lebensqualität bzw. über Tumorregressionen bis hin zur vollständigen Remission. (Schäffer, 1995) 75 Von größter Bedeutung für das Immunsystem ist auch das Spurenelement Zink. Ähnlich dem Selen greift Zink ebenfalls nicht direkt in die Immuntätigkeit ein, sondern liefert die wichtigsten Grundstoffe für eine optimale Immunfunktion. An experimentellen Tierversuchen konnte z.B. gezeigt werden, daß sämtliche Organe von Tieren mit einem induzierten Zinkmangel eine (reversive) Immunschwäche aufwiesen. Die Nachkommen von Zinkmangeltieren behielten, trotz genügender Zinkversorgung, über drei Generationen hinaus ihre Immunschwäche. (Schaeffer, 1996) Zink kommt in Lebensmitteln wie Haferflocken, Bananen, Vollkornbrot, Milch, Milchprodukten, Gemüse und Fleisch vor. Es ist offensichtlich unverzichtbar für die T-Zelldifferenzierung und induziert darüber hinaus die Produktion der B-Zellen im Blut und in der Leber. Darüber hinaus erhöht es die Stimulierbarkeit der T-Zellen und somit die Freisetzung von tumorprotektiven Zytokinen. Zusätzlich spielt es bei der Phagozytenaktivierung eine wichtige Rolle. (Kunze, Schöllmann, 1995) Im Rahmen klinischer Humanstudien wurde gezeigt, daß schon bei einem normalen Zinkserumspiegel die Infektionsanfälligkeit einer Person gesenkt werden kann. (Schaeffer, 1996) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sowohl Vitamin A, C E und Beta-Carotin als auch die beiden Spurenelemente Selen und Zink für eine gelungene Immunfunktion unbedingt nötig sind. Die Hauptfunktion der antioxidativen Substanzen ist das "Einfangen" bzw. das Neutralisieren von aggressiven Sauerstoffverbindungen, die auch "freie Radikale" genannt werden. Die Vitamine greifen direkt in das Immungeschehen ein und dienen zusätzlich als Wachstumsboden der Immunzellen. Die Spurenelemente Selen und Zink hingegen liefern die Basis für die Aktivität der Immunzellen, die z.B. karzinogene oder viral infizierte Zellen identifizieren bzw. abtöten. Nach Laienmeinung haben diese Substanzen 76 krebshemmende bzw. heilende Effekte. In der immunologischen Sprache stimmt diese Behauptung nur ansatzweise: Denn die Antioxidanten neutralisieren die freien Radikale, aber keine Tumorzelle. Diese Arbeit tätigen die Immunzellen, die allerdings ohne die obengenannten Substanzen ihre Rolle nicht genügend wahrnehmen können. Aus zahlreichen klinischen Untersuchungen und Feldstudien geht eindeutig hervor, daß zwischen dem Mangel an den benannten Vitalstoffen und der epidemiologischen Krebshäufigkeit eine direkte Beziehung besteht. Ebenso konnten die Heilungsergebnisse im Rahmen der Krebstherapie durch gezielte Zuführung dieser Vitalstoffe deutlich gebessert werden. Offensichtlich führen die modernen Lebensumstände (erhöhte Umweltbelastung, mehr Streß, starke Genußmittel und künstlich behandelte Nahrungsmittel mit langen Transportwegen) zu einem erhöhten Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen, der oft nur durch eine gezielte Zufuhr der benannten Vitalstoffe nachhaltig gestillt werden kann. Zusätzlich sollte erwähnt werden, daß die Radikalbildung und die Menge der Entgiftungsenzyme (Antioxidanten) eine sehr große Variabilität von Mensch zu Mensch aufweist. (Kiklinski, 1994) Das erklärt die individuelle Verträglichkeit von Umweltgiften, Ernährungsfehlern oder Medikamenten. Die Belastungsmenge, die für die eine Person noch verträglich ist, kann bei einer anderen Person zu tödlichen Komplikationen führen. 5.8.2 Immunmodulation durch Nährstoffe im Darm Die Ernährung eines Menschen hat nicht nur aufgrund der direkten Zufuhr von Vitalstoffen eine immunregulatorische bzw. immunmodulatorische Funktion, sondern auch durch ihre Auswirkungen auf den Darm. Der menschliche Darm gehört zu den wichtigsten Immunorganen: – die erworbene Immunität eines Säuglings beginnt damit, daß MHC-Zellen der Darmphagozyten Bruchteile von Krankheitserregern, die sich im Darm von der Geburt an ansiedeln, in 77 die Thymusdrüse für die T-Lymphozytenschulung transportieren; – darüber hinaus haben etwa 70% der Immunzellen, die für die erworbene Immunität zuständig sind, ihren Erstkontakt mit einem Krankheitserreger im Darm; – etwa 20% der Immunzellen, die ihre Antigenspezifität im Darm erlernt haben, bleiben nicht am Ort ihrer Ausbildung, sondern wandern durch die Lymphe in das schleimhautassoziierte System ihres Trägers und verbleiben dann in den Atemwegen, in der Nasenschleimhaut, in der Tränendrüse, in den Speicheldrüsen oder in der Brustdrüse einer stillenden Frau. Demnach werden täglich auch Millionen von "geschulten" Immunglobulinen vom Darm in die Schleimhautzonen eines Menschen transportiert (siehe auch Abb. 5 im Kap. 4.2.2.1). Da sich die Darmflora eines Menschen natürlicherweise modifizierend auf die im Darm befindlichen Immunzellen auswirkt, ist es selbstverständlich, daß die Ernährung eines Menschen nicht nur durch die Zulieferung von Vital- bzw. Giftstoffen, sondern auch im Hinblick auf die Gestaltung der Darmflora wirksam wird. Fettreiche Nahrung verursacht zum Beispiel, daß der Darm mit einer Fettschicht überzogen wird und die wichtigen Radikalfänger sich dadurch nicht an der Darmwand anheften können, sondern einfach "durchrutschen". Im Darm selbst entstehen durch die Lebensmittelverdauung so viele freie Radikale wie durch eine Bestrahlung von 40 000 rad auf eine Zellkultur. "Dies entspricht der Einwirkungsstärke am Rande eines Kernwaffenherdes". (Kiklinski, 1994 S. 11) Ein mit Fettschicht überzogener Dickdarm macht es den Radikalfängern unmöglich, sich an diesem wichtigen Ort anzusiedeln. Darüber hinaus werden die Makrophagen, die im Darm die Immunkaskaden auslösen, und die antikörperproduzierenden B-Lymphozyten durch extrem scharfe bzw. toxinhaltige Nahrungsmittel (Alkohol, Genußmittel) sozusagen "lahmgelegt". Dadurch wird die Immunkaskade gleich beim ersten Reaktionsschritt blockiert. Auf diese Weise kann z.B. die scheinbare Paradoxie entstehen, daß eine Person aufgrund übermäßiger fett- und alkoholreiche Er- 78 nährung immer wieder eine Augenentzündung bekommt. Und zwar deshalb, weil im vergifteten Darm die für die Bakterienabwehr so wichtigen Immunglobuline nicht ausreichend produziert werden können. Normalerweise würden sich die Immunglobuline nach ihrem Transport durch das Schleimhautsystem unter anderem auch in der Tränenflüssigkeit der Augen niederlassen und dort ihre Schutzfunktion ausüben. Weil sie aber aufgrund der Darmvergiftung lediglich in geringer Menge produziert werden können, ist ihre Funktion gegen eindringende Bakterien unzureichend. Eine entsprechende Nahrungsumstellung kann deshalb u.U. die Verabreichung von Cortisonpräparaten unnötig machen und von einer Neuinfektionen der Augen schützen. Ebenso können Schadstoffe direkt im Darm wirksam werden. Aus epidemiologischen Untersuchungen wird ersichtlich, daß in Ländern, in denen besonders scharf und fett gegessen und/oder viel hochprozentiger Alkohol getrunken wird, nicht nur die Gesamtkarzinomrate, sondern auch die Anzahl der Dickdarmkrebsfälle viel höher liegt als in Ländern mit einer "milderen" Küche. An der Spitze der karzinogenen Mortalität steht Ungarn, bald gefolgt durch die Länder der ehemaligen UdSSR und denen des ehemaligen Jugoslawiens. (Magyar Nemzet, 2/1997) Zusätzlich dazu nehmen diese Länder nicht nur eine "Spitzenposition" im Bereich des karzinogenen Dickdarmkrebses ein. Sie weisen auch die höchsten Zahlen bzgl. der jährlichen Influenzaerkrankungen auf. Auch diese Tatsache weist auf die oben beschriebene dislokale immunmodulatorische Funktion der Ernährung hin. Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Ernährung eines Menschen in mehrerer Hinsicht wesentlich für die Immunfunktion ist. Durch die Zulieferung von Vitalstoffen ermöglicht sie das Abfangen der oxidierenden Radikale. Durch eine geeignete Ernährungsweise wird die ideale Voraussetzung für das Wachstum, für die Zellteilung oder für die Funktions- 79 tüchtigkeit der Immunzellen geschaffen. Letztlich kann Ernährung durch die Modifikation der Darmflora blockierend oder fördernd auch direkt in die Immunkaskade eingreifen. 5.9 Nahrungsentzug Nicht nur die Zuführung von bestimmten Nahrungsmitteln, sondern auch Nahrungsentzug, also Fasten, kann modifizierend auf das Immunsystem wirken. Beispielsweise kann der für die Karzinogenese so wichtige Apoptosevorgang durch Nahrungsentzug günstig beeinflußt werden. Der Apoptosevorgang, im Kap. 4.5 genauer beschrieben, bedeutet im Grunde, daß sich durch einen internen chemischen Mechanismus die Zelle selbst auflöst und programmierter Selbstmord geschieht. Verantwortlich für die Apoptose dürfte das zelleigene Protein c-Myc sein. Das Protein, das sich im Zellkern befindet, überprüft ständig, ob sich die Zelle ihrem genetischen Programm gemäß nur dann teilt, wenn sie von außen ein chemisches oder mechanisches Signal für die Zellteilung bekommt. Beginnt sich eine Zelle unkontrolliert zu teilen, was in einem Organismus häufig der Fall ist, dann leitet das c-Myc-Protein den programmierten Zelltod ein. (Schöllmann, 1995) Bei der Krebsentstehung versagt u.a. auch der Mechanismus der Apoptose und die entartete Zelle kann sich selbst nicht vernichten. Eine Wiener Forschergruppe (Grasl-Kraupp et al.) untersuchte die Auswirkungen des Fastens auf den Apoptosevorgang. Zugrunde lag die Erkenntnis, daß üppiges Essen die Karzinogenese begünstigt bzw. daß Menschen, die regelmäßig fasten, seltener an einem Tumor erkranken. Das Ergebnis der Studie ist sehr interessant. Leberzellen, die sich in einem vor-karzinogenen Stadium befinden, reagieren auf Nahrungsentzug empfindlicher als gesunde Zellen. Der intrazelluläre Schutzmechanismus von Versuchstieren, die einige Tage lang keine Nahrung bekamen, vernichtete die karzinogenen Zellen durch den Apoptosevorgang, während die gesunden Zellen unangetastet blieben. Durch neuerliche Fütterungsphasen wurde der Apoptosevorgang gestoppt. Am effektivsten 80 erwies sich die karzinomhemmende Funktion dann, wenn Versuchstiere etwa acht Tage lang eine "Fastenkur" einlegen mußten und dann ein Jahr lang normal gefüttert wurden, oder wenn ihr Nahrungspensum drei Monate lang um 40% verringert wurde. Die Fastenperiode verminderte die Bildung von karzinogenen Zellen auch dann, wenn die Versuchstiere in dieser Zeit, aber auch danach, mit karzinogenen Substanzen gefüttert wurden. (Frese, 1995) Aus epidemiologischen Untersuchungen geht eindeutig hervor, das Humanpopulationen mit erhöhter Nahrungszufuhr häufiger am Krebs erkranken als Populationen mit mäßiger Kalorienzufuhr. Eine richtig angelegte Fastenkur dürfte jedoch ihre Heilwirkung nicht nur durch die Einwirkung auf den Apoptosevorgang erreichen. Aufgrund der Erkenntnisse bzgl. des Immunorgans Darm wird verstehbar, daß zeitweiliger Nahrungsentzug sozusagen die "Befreiung" für die im Darm befindlichen Immunzellen sein kann. Wir müssen uns lediglich daran erinnern, daß 70% der erworbenen Immunzellen ihren Ursprung im Darm haben. Die immununterstützende Wirkung des Fastens dürfte jedoch weniger daraus resultieren, daß in der Fastenperiode weniger Mikroorganismen mit der Nahrung aufgenommen werden. Da das Immunsystem durch den Kontakt mit Krankheitserregern auch immer wieder "trainiert" wird, ist eine diesbezügliche Verwöhnung nicht unbedingt von Vorteil. Die immunologische Wirkung des Fastens kommt offensichtlich dadurch zustande, daß aufgrund des Nahrungsentzugs einige Tage lang kaum Fremdkörper (Nahrung) in den Darm gelangen. Dadurch können einerseits die Immunzellen bindenden Toxine aus dem Körper ausscheiden. Andererseits kann sich das gesamte Darmimmunsystem regenerieren. Die Erkenntnisse, die aus der Sportimmunologie stammen, unterstützen diese These ebenfalls. Auch in diesem Zusammenhang ist zu beobachten, daß das Immunsystem nur dann richtig funktionieren kann, wenn auf Aktivierungsphasen effektive Regenerationsphasen folgen. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß zeitweiliger Nahrungsentzug die Optimierung des 81 Apoptosevorganges und die Regenerierung des gesamten Immunsystems verursacht. Somit ist eine jährliche Fastenperiode für die Gesundheit eines Menschen unabkömmlich. Begreifen wir die Zusammenhänge zwischen der Molekularbiologie und dem Nahrungsentzug, dann wird der Sinn der jahrtausendealten, in allen Religionen vorkommenden Fastenregelungen auch in immunologischer Hinsicht verstehbar. 5.10 Umweltgifte Daß toxische Umwelteinflüsse zytotoxische Auswirkungen haben können, ist mittlerweile allgemein bekannt. Es lohnt sich trotzdem, einen Blick auf die immunologische Wirkungsweise der Toxine zu werfen: – In der Lunge werden Fremdpartikel, Bakterien und Viren, die mit der Atemluft aufgenommen wurden, phagozytiert. Dadurch erhält der menschliche Organismus den "gereinigten" Sauerstoff. In-vitro-Studien haben jedoch gezeigt, daß Makrophagen, die in unterschiedliche Konzentrationen von Luftschadstoffen gesetzt werden, abhängig von der Schadstoffkonzentration ihre Phagozytoseaktivität verlieren. (Hadnagy et al., 1994) Veterinäre Immunstudien weisen ebenfalls auf eine konzentrationsabhängige Verringerung der Phagozytoseleistung. – Asbest kann ebenso als immunologisches Toxin angesehen werden. Eine Humanstudie an pensionierten Arbeitern, die an ihrer Arbeitstelle 10-40 Jahre lang Asbest (Chrysotil und Crocidolith) ausgesetzt waren, zeigte in etwa 48% der Fälle eine radiologisch faßbare Veränderung des Lungengewebes. Die Phagozytoseaktivität der Betroffenen war deutlich unter den Werten der Kontrollgruppe gesunken, hinsichtlich der IgA, IgG, IgM und CD4-Konzentration wiesen die Rentner eine deutliche Immunreduktion auf. (Rudolf-Müller, 1994) – PCB (Polychlorierte Biphenyle), zu denen auch Furane und Dioxine gehören, können krebsauslösend, fruchtschädigend und immunsuppressiv wirken. Das Thymusgewebe, das 82 ja für die Funktionstüchtigkeit der T-Lymphozyten verantwortlich ist, weist nach einer PCB-Exposition eine Thymusatrophie auf, die mit einer Immunsuppression einhergeht. In fötalem Thymusgewebe, das mit PCB behandelt wurde, können keine T-Lymphozyten ausreifen, weil die Schädigung des Thymusgewebes die Informationsübertragung auf die TZellen verhindert. (Wieseler, 1994) Dies bedeutet, daß ein Säugling, dessen Mutter während der Schwangerschaft längerfristig PCB-Schadstoffen ausgesetzt war, mit einem angeborenen Immundefekt auf die Welt kommen wird. Die Reihe der Umweltgifte könnte beliebig fortgesetzt werden. Verschiedene Toxine, die in Benzin, Öl, Farben, Holzschutzmitteln, Konservierungsstoffen, Schwermetallen und Reinigungsstoffen vorhanden sind, können leichte bis schwere Immunmodulationen verursachen. Doch auch hier gilt die Erkenntnis, die wir bzgl. der interindividuellen Unterschiede der Radikalfänger kennen. Die körpereigenen Entgiftungsenzyme (Glithathion-Peroxidasen, Katalasen und Superoxid-Dismutaten) weisen die größte Variabilität von Mensch zu Mensch auf. Folglich reagiert jeder Mensch entsprechend seiner ererbten und erworbenen Immunität unterschiedlich. 6. Psychologische Faktoren, die das Immunsystem modifizieren Die ursprüngliche Theorie, wonach das Immunsystem autonom, d.h. unabhängig von anderen Körperfunktionen arbeiten würde, entspricht nicht mehr dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Offensichtlich besteht eine vielfältige Wechselwirkung zwischen Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem. Seit einigen Jahrzehnten existiert eine neue Forschungsrichtung, die den Zusammenhang zwischen diesen drei Systemen untersucht: die Psychoneuroimmunologie. 6.1 Kommunikation zwischen Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem 83 Obwohl die neuronale oder hormonale Regulation des Immunsystems bisher erst in Ansätzen geklärt ist und deshalb die Rekonstruktion des Zusammenspiels der drei Systeme nur ansatzweise gelingt, kann man doch versuchen, die wichtigsten biologischen Verbindungen zwischen den drei Bereichen durchsichtig zu machen: In die wichtigsten lymphatischen Organe, den Thymus, die Milz und die Lymphknoten, führen noradrenerge Nervenfasern. Entweder enden diese Nervenfasern im lymphatischen Gewebe selbst, oder sie durchqueren dieses. Dadurch können die wichtigsten immunregulierenden Organe direkt vom zentralen Nervensystem beeinflußt werden. Auf diese Weise entsteht ein direkter Kontakt ("local talk") zwischen Nervenfasern und Immunzellen. (Weihe et al., 1996) Einen direkten Kontakt zwischen Immunzellen und Nerven- bzw. Hormonzellen ermöglichen Rezeptoren, die an bestimmten Zellen des Immunsystems vorhanden sind. Es handelt sich um die Rezeptoren für Neuropeptide (Endorphine und Enkephaline). Sie sind bisher an Lymphozyten, an Monozyten und an Granulozyten entdeckt worden. Auf diese Weise können Neurohormone und Neuropeptide direkt in die Antikörperproduktion, in die zelluläre Zytotoxizität, in die T-Zell-Mitogenese, in die NK-Zell-Aktivität und in die Interferonproduktion eingreifen. (Rudolf-Müller, 1994) Lymphozyten und Makrophagen haben darüber hinaus Rezeptoren für Glukokortikoide, für das Wachstumshormon Somatotropin, für Östrogen und Testosteron und für B-adrenerge Substanzen. (Kabekitz, 1994) Auf diese Weise ist eine Immunmodulation durch die wichtigsten Hormonstoffe ohne weiteres möglich. Nicht nur die Hormone des endokrinen Systems und die Botenstoffe des Nervensystems erreichen das Immunsystem, sondern auch umgekehrt: die Botenstoffe des Immunsystems, z.B. die Lymphokine und die Zytokine, erreichen ebenso das Nerven- und Hormonsystem. Offensichtlich sind die immunologischen Botenstoffe in der Lage, auch die Blut-Hirn- 84 schranke eines Menschen zu passieren und dort als Neuromodulatoren ihre Wirkung zu entfalten. (Schöllmann, 1995) Bestimmte Botenstoffe, zum Beispiel das Interleukin-1, werden sowohl von Zellen des Immunsystems als auch von Zellen des Nervensystems produziert. IL-1 wird von Makrophagen, Monozyten und B-Lymphozyten abgegeben (Immunsystem), aber ebenso von einigen Gliazellen und Neuronen des Hypothalamus (Nerven- bzw. Hormonsystem). Alle drei Systeme haben dadurch einen gemeinsamen "Kommunikationsstoff", der sowohl die lokale Kommunikation (local talk) als auch die gegenseitige Fernbeeinflussung (tele-talk) ermöglicht. (Kabelitz, 1994) Die oben dargestellten zellulären und molekularen Erkenntnisse sind 1-2 Jahre alt. Sie bieten auf zellulärer und molekularer Ebene Erklärungen für die Ergebnisse zahlreicher empirischer Studien, die in den letzten Jahrzehnten im Rahmen der Psychoneuroimmunologie gewonnen wurden. Sie bestätigen die faszinierende Tatsache, daß das Immunsystem sowohl kurzfristig wie auch langfristig vom Gehirn eines Menschen beeinflußt werden kann. 6.2 Hormone, die durch die Gehirn-Nervensystem-Hormonsystem-Achse das Immunsystem modifizieren können Seit die ersten Konditionierungsexperimenten durchgeführt wurden, ist offensichtlich, daß das Gehirn das Immunsystem durch die neuronale und durch die hormonale Achse zu modifizieren in der Lage ist. In den letzten Jahren konnte die immunologische Wirksamkeit einiger Hormonen und Neurotransmitter auch auf der zellulären Ebene nachgewiesen werden: 6.2.1 Glucocorticoide Die Glucocorticoide werden in der Nebennierenrinde erzeugt. Ihre Hauptfunktion besteht aus der Dämpfung und Drosselung aller überschießenden Reaktionen des Organismus. Das wich- 85 tigste Glucocorticoidhormon ist das Cortisol, darüber hinaus das Corticosteron. Das Cortisol ist durch seine entzündungshemmende Wirkung bekannt. Cortisol wird beim Menschen nicht nur zur Verhinderung von Entzündungsprozessen (Allergien, Asthma, Wundeiterungen) verabreicht, sondern auch nach Organtransplantationen, um eine Abstoßungsreaktion durch das Immunsystem zu verhindern. Interessanterweise besitzen alle lymphatischen Organe und Leukozyten Rezeptoren für Glucocorticoide. (Schedlowski; Benschop, 1996) Das bedeutet, daß Glucocorticoide im gesamten Körper, bis hin zu den Immunzellen, wirksam werden können, wenn eine überschießende Reaktion gedrosselt werden muß. Das bedeutet allerdings auch, daß die Glucocorticoide bei einer Fehlfunktion ihre destruktive Wirkung bis zu den Immunzellen entfalten können. Die Ausschüttung der Nebennierenrindenhormone erfolgt durch die Aktivierung des Hypothalamus (Corticoliberin) und der Hypophyse (Corticotropin=ACTH). Da die Aktivierung der Nebennierenrinde ganz maßgeblich durch Langzeitstreß beeinflußt werden kann, ist die streßbedingte Modifikation des Immunsystems offensichtlich. Die wichtigste immunmodulatorische Kompetenz von Cortisol besteht aus der: – Hemmung der Zytokin-Produktion; – Inhibierung der Reaktivität der T- und B-Lymphozyten bzw. der NK-Aktivität; – allgemeinen Immunsuppression. (Schedlowski, Benschop, 1996). Anhand empirischer Studien kann die inhibitorische Wirkung von Cortisol eindeutig belegt werden: In vitro verlieren beispielsweise Interferon produzierende Zellen ihre Fähigkeit, Interferon zu produzieren, wenn einige Tage lang Hydrocortison in die Zellflüssigkeit hinzugegeben wird. Wird später ein Cortisol-Antagonist in die Testflüssigkeit eingeleitet, dann wird die inhibitorische Wirkung des Hydrocortisons wieder aufgehoben, und die Zellen produzieren 86 wieder Interferon. Durch In-vivo-Studien läßt sich nicht nur die Interferon hemmende Wirkung des Cortisols nachweisen, sondern auch die ebenso inhibitorische Wirkung auf die T- und B-Lymphozytenaktivität und NK-Aktivität. (Besedovsky; Rey, 1996) Nach Infusion von Cortisol beim Menschen kommt es zu einem dosisabhängigen Abfall der T-Zellzahlen und zu einer Veränderung der NK-Zellzahlen. (Chiapelli et al., 1992) Dennoch dürfte Cortisol nicht allein die inhibitorischen Effekte von Langzeitstreß verursachen: Trotz operativer Entfernung der Nebennierenrinde reagierten nämlich Versuchstiere mit einer Immunsuppression auf Streß. Das bedeutet, daß neben den Corticosteroiden auch andere Faktoren in das Streßgeschehen involviert sind. Erst ein Zusammenwirken dieser Faktoren macht die Immunmodifizierung aus. Cortisol selbst hat demzufolge eine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem, und diese dämpfende Wirkung ist mit dem lebensnotwendigen Homöostase-Prinzip zu begründen: Damit ein Organismus langfristig nicht zuviel Energie verliert, müssen die physiologischen Aktivitäten nach einer bestimmten Aktivierungszeit wieder gedrosselt werden. 6.2.2 Katecholamine (Adrenalin und Noradrenalin) Die Katecholamine werden zum größten Teil aus dem Nebennierenmark ausgeschüttet, das mit den Nervenfasern des sympathischen Nervensystems durchzogen ist und auf diese Weise auf psychische oder physische Belastungen reagieren kann. Während das Adrenalin zur Gänze aus dem Nebennierenmark stammt, wird Noradrenalin auch von den postsynaptischen Neuronen des Nervensystems gebildet und von diesen als Neurotransmitter verwendet. Adrenalin und Noradrenalin üben eine aktivierende Funktion auf das Herz-Kreislaufsystem, auf die Sauerstoff- und Glucoseproduktion und auf die Muskeldurchblutung aus. 87 In das immunologische Geschehen können die Katecholamine durch entsprechende Rezeptorenvermittlung eingreifen. Rezeptoren für Katecholamine befinden sich an den primären und an den sekundären lymphatischen Organen und an zahlreichen Lymphozyten bzw. NKZellen. Besonders viele Rezeptoren für Adrenalin und Noradrenalin weisen die Lymphknoten auf, die von zahlreichen noradrenergen Nervenfasern durchkreuzt werden. Auf diese Weise können Katecholamine die Teilung der Immunzellen bzw. die Ausschüttung von Antikörpern beeinflussen, da diese Immunfunktionen vorrangig in den Lymphknoten ablaufen. Im Zusammenhang experimenteller Studien bzgl. der Immunmodulation von Katecholaminen treffen wir sowohl auf dämpfende als auch auf aktivierende Effekte, abhängig von der Konzentration der Katecholamine. Einige In-vitro-Studien zeigen, daß Katecholamine dann einen immunstimulierenden Effekt aufweisen, wenn sie in "normalen", also physiologischen Dosen konzentriert sind, während sie suppressiv wirken, wenn sie in verstärkten, also pharmakologischen Dosen verabreicht werden. (Schedlowski, 1994) Abbildung 18 zeigt ein Diagramm, an dem die adrenalinabhängige Veränderung der NKZellen-Aktivität (Zytotoxizität) sichtbar wird. Bis zu einer Grenze von etwa 10-8,5 M steigt die Aktivität der NK-Zellen. Nach einem Plateauwert ist die stimulierende Wirkung von Adrenalin offensichtlich erschöpft. Bei einer weiteren Zugabe, d.h. nach der Übertretung einer Konzentrationsschwelle, sinkt die NK-Aktivität radikal ab. Abb. 18 (Schedlowski, Tewes, 1996, S. 259) In-vitro-Studien können die Auswirkung verschiedener Hormone auf Immunzellen auf zwei Arten einsichtig machen: 88 – Entweder werden Hormone in unterschiedlichen Konzentrationen der Immunzellenkultur hinzugefügt. Verändert sich die Aktivität oder die Zahl der Immunzellen in mehreren experimentellen Durchgängen signifikant und konzentrationsabhängig, so ist ein Zusammenhang zwischen dem Wirkstoff und den Immunzellen höchstwahrscheinlich. – Oder es wird dem Hormon-Immunzellenkomplex ein entsprechender Hormonantagonist hinzugefügt. Unterbleibt nun die vorher beobachtete Reaktion der Immunzellen und kommt es erneut zu einer Immunreaktion ohne Antagonisten, so gilt der Zusammenhang als experimentell gesichert. Im Bereich der Adrenalinforschung hebt Propanolol (ein Beta-adrenerge Antagonist) die immunmodulierende Funktion des Adrenalins auf. In-vitro-Studien zeigen eine Aufhebung der Immunmodulation, wenn zu einem Adrenalin-Lymphozytenkomplex Propanolol hinzugefügt wird. In-vivo-Studien zeigen auch, daß Versuchstiere, die zum Beispiel an einer normalerweise harmlosen Toxoplasmoseinfektion erkranken, in 70% der Fälle sterben, wenn ihnen Propanolol in hohen Dosen verabreicht wird. Demzufolge wirkt eine natürlich ungehemmte Adrenalin- und Noradrenalinausschüttung immunstabilisierend. In einer kontrollierten Humanstudie konnte Schedlowski zeigen, daß sowohl Adrenalin als auch Noradrenalin stimulierend auf die NK-Zellzahlen und auf die NK-Aktivität wirken. Versuchspersonen der Kontrollgruppe, denen lediglich Kochsalzlösung verabreicht wurde, wiesen hingegen keine Veränderung im Bereich der natürlichen Killerzellen auf. (Schedlowski et al., 1996) Im Gegensatz zu den immunstimulierenden Effekten von Adrenalin und Noradrenalin stehen einige Studien, die in manchen Fällen auf die Verminderung der Lymphozytenpopulation nach Ausschüttung dieser Hormone hinweisen. Eine immunsuppressive Wirkung hat z.B. die erhöhte Katecholaminausschüttung, welche auf eine extreme sportliche Betätigung folgt. 89 Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin vorrangig immunstimulierende Wirkung besitzen. In einigen Fällen jedoch, vor allem dann, wenn die Katecholaminausschüttung extrem hoch war, konnten auch immunsuppressive Effekte, die sich häufig auf einzelne immunologische Organe beschränkten (Milz), beobachtet werden. Da die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin normalerweise in akuten Situationen und nur kurzfristig erfolgt, ist anzunehmen, daß trotz zeitweiliger Immunmodulation die Katecholamine keine längerfristige Veränderung des Immunsystems verursachen können. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Aktivitäten, die eine erhöhte Katecholaminausschüttung verursachen, in kurz hintereinander folgenden Intervallen auftreten würden. 6.2.3 Prolaktin und Human Growth Hormone (HGH) Prolaktin wird von der Hypophyse abgegeben, seine Ausschüttung ist vom zirkadianen Rhythmus der Hypophyse abhängig. Da Prolaktin eine stimulierende Wirkung auf die Immunzellen ausübt, ist diese Stimulierung auch zirkadian bedingt und im Experiment sehr gut beobachtbar. (Kaschka, Aschauer, 1990) Darüber hinaus besitzt Prolaktin die Fähigkeit, die immunsuppressive Wirkung der Glucocorticoide aufzuheben: Wird eine erhöhte Glucocorticoidausschüttung mit einer experimentell herbeigeführten Prolaktinzugabe ergänzt, so bleibt die immunsuppressive Wirkung der Glucocorticoide (Cortisol, Corticosteron) aus. (Schedlowski, 1994) In Tierversuchen kann die Prolaktin-Freisetzung durch einen Antagonisten experimentell unterdrückt werden. Als Folge zeigt sich eine dosisabhängige Verminderung der Makrophagen- und T-Zellaktivität und eine erhöhte Anfälligkeit für Virusinfektionen. (Schedlowski, Tewes, 1996) Prolaktin übt demzufolge in zwei Bereichen eine immunmodifizierende Funktion aus: Erstens bewirkt es die Vermehrung und die Aktivierung zahlreicher Immunzellen (Aktivie- 90 rungsfaktor), zweitens neutralisiert es die immunsuppressive Funktion der Glucocorticoide (antagonistischer Faktor). HGH (Human Growth Hormone), also das Hormon, welches für das Längenwachstum eines Menschen verantwortlich ist, greift ebenso maßgeblich in das Immungeschehen ein. Offensichtlich besitzen alle Immunzellen Rezeptoren für HGH. Eine mangelhafte Wachstumshormonausschüttung verursacht nicht nur das bekannte Zwergwachstum, sondern auch eine Unterentwicklung der Thymusdrüse und eine mangelhafte Ausdifferenzierung der TLymphozyten (Kelley, 1991). Da HGH direkt auf das menschliche Knochenwachstum wirkt, ist es naheliegend, daß die Immunzellen, die ja ausnahmslos im Knochenmark gebildet werden, mit diesem Hormon schon während ihrer Entwicklung in Kontakt kommen. Klinische Studien haben z.B. gezeigt, daß Kinder, die an einem pathologischen Wachstumshormonmangel leiden, kleiner sind als Kinder der gesunden Normalpopulation. Sie haben auch eine retardierte Thymusdrüse und verfügen über eine verminderte Lymphozytenaktivität. Wird diesen Kindern während einer klinischen Behandlung das Wachstumshormon extern zugeführt, dann erhöht sich nicht nur die Körpergröße, sondern auch die Aktivität der Lymphozyten und das Volumen der Thymusdrüse. Die Immunmodulation findet jedoch, ebenso wie die Modulation der Körpergröße, erst nach einer mehrmonatigen Behandlung statt. (Bozzola et al., 1989) Läsionen der Hypophyse bewirken bei allen Individuen das Aussetzen des Längenwachstums und eine Herabsetzung der Immunfunktionen. Diese Effekte können durch eine Wachstumshormon-Behandlung wieder behoben werden. Offensichtlich ist eine intakte Hypophyse die Voraussetzung für ein funktionierendes Immunsystem. Eine operative Entfernung der Hypophyse führt bei Versuchstieren zu einer generellen Immundefizienz. In diesem Falle verlieren Thymus und Milz an Ge- 91 wicht, die Zahl der Leukozyten geht zurück, ebenso die Antikörperantwort der TLymphozyten und die NK-Aktivität. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich das Wachstumshormon HGH regulierend auf die Immunfunktion auswirkt. Seine Ausschüttung beeinflußt die Entwicklung der primären lymphatischen Organe und die Ausdifferenzierung bzw. die Aktivierung von Lymphozyten. HGH dürfte ebenso wie Prolaktin vor allem nach Infektionen oder Streßreaktionen regulierend auf das Immungeschehen einwirken, indem es für die Aufrechterhaltung der Homöostase im Immunsystem sorgt. 6.2.4 Beta-Endorphin Beta-Endorphin wird vorrangig von der Hypophyse und von spezifischen Zellen des Zentralnervensystems erzeugt. Neben der Funktion als Neurotransmitter kann Beta-Endorphin schmerzlindernd wirken oder aber als körpereigener euphorisierender Wirkstoff seine Funktion entfalten. (Snyder, 1990). Im allgemeinen gilt, daß Endorphine in kleinen Mengen beruhigend wirken, während sie nach einer stärkeren Ausschüttung anregend wirken. Ähnlich den neurologischen Wirkungen entfalten sich Beta-Endorphine auch immunologisch vielseitig und oft scheinbar gegensätzlich. Offenbar spielt auch hier die Ausschüttungsmenge dieses Peptids eine große Rolle, denn in einigen Studien können wir die Stimulierung des Immunsystems, in anderen ihre Suppression beobachten. In-vitro-Studien zeigen vorrangig den stimulierenden Effekt des Beta-Endorphins. So wurde in Zellkulturen, in denen das Peptid hinzugefügt wurde, eine vermehrte Produktion von Interleukinen (IL-2 und IL-4) bzw. Gamma-Interferonen beobachtet. Ebenso stieg die Zahl der NK-Zellen, wenn in die NK-Zellkultur Beta-Endorphin hinzugefügt wurde. (Morley et al., 1987) 92 Manche In-vivo-Experimente zeugen von der immunstimulierenden Wirkung des BetaEndorphins, das z.B. dosisabhängig die Stimulierung von T-Lymphozyten bewirken kann. Durch Verabreichung des Opiat-Antagonisten Naloxon kann jedoch die stimulierende Wirkung des Endorphins unterbunden werden. (Schedlowski, 1994) Über die immunsuppressive Fähigkeit des Beta-Endorphins auf die Aktivierung von BLymphozyten und NK-Zellen berichten Prete et al. (1986) und Morgan et al. (1990). Offensichtlich verursacht eine geringe Konzentration des Neurotransmitters die Herabsetzung der immunologischen Aktivität, während die vermehrte Ausschüttung des Beta-Endorphins die Erhöhung der Aktivität bewirkt. Dieses Prinzip ist im Zusammenhang der Erregungsleitung der Nervenzellen unter dem Begriff der lateralen Inhibition seit Jahren bekannt. (Guttmann, 1982, S. 228) Interessanterweise produzieren die aktivierten T-Lymphozyten auch selber Beta-Endorphin, so daß die Grenze zwischen Neurotransmittern und Zytokinen nicht gezogen werden kann. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das opioide Peptid Beta-Endorphin dosisabhängig einen immunstimulierenden oder immunsuppressiven Effekt auf zahlreiche Immunfunktionen ausübt. Gleichzeitig wird Beta-Endorphin auch von manchen Immunzellen erzeugt, was auf eine gegenseitige Modifikationsfähigkeit zwischen Immunsystem einerseits und Nerven- und Hormonsystem andererseits hinweist. 6.2.5 Substanz-P Substanz-P ist ein Neuropeptid und wird von sensorischen Neuronen produziert. (Schedlowski, 1994) Die physiologische Bedeutung dieses Neuropeptids ist die Blutdrucksenkung, die Darmaktivierung und die Veränderung der mikrovaskulären Permeabilität. Substanz-P wirkt im Grunde den Katecholaminen, also dem Adrenalin und Noradrenalin, entgegenge- 93 setzt. Eine Fehlfunktion von Substanz-P verursacht Darmentzündungen, unter Umständen Arthritis und Asthma. Das Neuropeptid bewirkt eine großflächige Stimulierung des Immunsystems: Durch Zugabe von Substanz-P konnten in Zellkulturen T- und B-Lymphozyten und Monozyten stimuliert werden. Ebenso verursachte das Neuropeptid eine vermehrte IgA-, IgG- und IgM-Ausschüttung durch die B-Lymphozyten. Auch die In-vivo-Studien zeigen, daß Substanz-P die Ausschüttung von Immunglobulinen modifizieren kann, ebenso die Proliferationsrate von T-Lymphozyten. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Neuropeptid Substanz-P-aktivierend auf die Lymphozyten- und auf die Monozytenpopulation wirkt. Gleichzeitig regt es die B-Lymphozyten zu einer vermehrten Immunglobulinausschüttung an, was vor allem für das Darmimmunsystem bedeutsam ist. 6.2.6 Andere Hormone und Botenstoffe In den nun folgenden Ausführungen werden zusätzlich Hormone und Botenstoffe erwähnt, deren immunmodulatorische Fähigkeit bisher untersucht wurde: – ACTH-Rezeptoren befinden sich an den T- und B-Lymphozyten. Offensichtlich beeinflußt das Hypophysenhormon die Ausschüttung von Gamma-Interferon suppressiv. – Enkephaline entfalten ihre immunologische Wirkung ebenso gegensätzlich wie Endorphine: Sie können immunsuppressive oder immunstimulierende Effekte entfalten, die Voraussetzung für die jeweilige Wirkungsweise ist jedoch nicht bekannt. – Östrogene, Androgene und das Progesteron dürften immunsuppressive Effekte aufweisen, es existieren jedoch sehr wenige Studien über die immunologische Funktion der Geschlechtshormone. (Kaschka, Aschauer, 1990) 94 Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Glucocorticoide inhibierend auf das Immunsystem wirken, während Prolaktin, die Substanz-P und das Wachstumshormon HGH stimulierende Effekte aufweisen. HGH ermöglicht darüber hinaus die gesunde Entwicklung der Thymusdrüse. Die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin weisen vorrangig immunstimulierende Effekte auf, solange sie in physiologischen, also nicht übermäßigen Mengen verabreicht werden. Nach der Überschreitung einer Quantitätsgrenze wirken sie immunsuppressiv. Das Beta-Endorphin wirkt in kleinen Mengen offensichtlich inhibierend, während eine größere Endorphinausschüttung die Aktivierung des Immunsystems bewirkt. Im Blick auf diesen Mechanismus wird man an die laterale Inhibition der nervösen Erregung erinnert. Wesentlich ist jedoch wahrzunehmen, daß eine optimale Immunfunktion nicht durch eine einseitige Steigerung bzw. durch eine Hemmung der Immunfunktionen gewährleistet wird. Es kommt, ebenso wie im Bereich des Nervensystems, auf das Zusammenspiel beider Gegenpole an. Ruhe, Inhibition und Aktivierung des Immunsystems müssen offensichtlich in einem situationsadäquaten Gleichgewicht zueinander stehen, damit der Gesundheitszustand einer Person langfristig anhält. Offensichtlich ist die direkte oder indirekte Verbindung zwischen Nerven- und Immunsystem durch zahlreiche Botenstoffe und Hormone gewährleistet und dadurch auch die Verbindung zwischen Gehirn und Immunsystem. Es besteht jedoch eine wechselseitige Beziehung zwischen Gehirn und Immunsystem. Durch Hormone und Botenstoffe wird ein Einfluß der kognitiven oder affektiven Funktionen auf das Immunsystem ausgelöst. Es besteht jedoch offensichtlich die Möglichkeit, daß Botenstoffe des Immunsystems das Gehirn ebenso erreichen, und diese Tatsache müßte die logische Folgerung nach sich ziehen, daß das Immunsystem u.U. die kognitiven oder affektiven Funktionen eines Menschen beeinflussen kann. 95 6.3 Die wichtigsten psychoneuroimmunologischen Studien 6.3.1 Immunmodulation durch Konditionierung Die wahrscheinlich erste psychoneuroimmunologische Studie stammt vom Engländer Mackenzie, der berichtete, daß bei einer gegen Rosenblüten allergischen Frau die einfache Betrachtung einer künstlichen Rose den allergischen Heuschnupfen auslöste. (Kabelitz, 1994) Die Anfang des XX. Jahrhunderts erfolgten ersten experimentellen Studien waren vor allem Konditionierungsexperimente. Metalnikov et al. zeigten in den 20er und 30er Jahren, daß das Immunsystem, ebenso wie das vegetative System, leicht konditionierbar ist. Metalnikov verband zum Beispiel die Injektion von Bakterien an Versuchstieren (unkonditionierter Stimulus) mit Einritzen der Hautoberfläche (konditionierter Stimulus). Nach einigen Konditionierungsversuchen löste allein das Einritzen der Haut eine Immunreaktion aus, indem die Versuchstiere jeweils kurzfristig weiße Blutkörperchen gegen die vorher kennengelernten Bakterien ausbildeten. (Spector, 1990) Die beiden amerikanischen Forscher Ader und Cohen erweiterten 1975 die immunologische Konditionsforschung. Sie ließen Versuchstiere das Lieblingsgetränk der Nagetiere, Zuckerwasser, trinken (CS), injizierten diesen aber vorher Cyclophosphamid (US). Cyclophosphamid ist ein Medikament, das Übelkeit verursacht. Nach mehreren Konditionierungsdurchgängen mieden die Versuchstiere das Zuckerwasser, da sie nun gelernt haben, es mit Übelkeit zu assoziieren. Doch zusätzlich fiel den Forschern auf, daß nach dem Experiment übermäßig viele Versuchstiere erkrankten oder starben. Die Ursache lag in der Konditionierung mit Cyclophosphamid. Es wirkt, zusätzlich zur Geschmacksaversion, immunsuppressiv. Offensichtlich erfolgte bei den Versuchstieren nicht nur eine geschmacksaversive, sondern auch eine immunsuppressive Konditionierung. (King; Husband, 1996) 96 Die ersten meßbaren Konditionierungsergebnisse hinsichtlich der Veränderung von natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) beobachtete in den 80er Jahren Spector. Er verwendete Poly I:C als US und den Kampfergeruch als CS. POLY I:C ist ein synthetisches Polyribonukleotid. Es ahmt den Effekt einer Virusinfektion nach und erhöht dadurch die Interferon- und NK-Zellenproduktion. Spector konnte in seinen Experimenten zeigen, daß Kampfergeruch allein keine immunologischen Auswirkungen hat. Konditionierte man aber Versuchstiere mit POLY I:C und Kampfergeruch, so erhöhte sich die NK-Zellenaktivität nach etwa 10 Konditionierungsversuchen schon allein dadurch, daß die Tiere am Kampfer rochen. Die konditionierten Tiere wiesen einen 39mal höheren NK-Aktivitätsspiegel auf als die der Kontrollgruppe! (Spector, 1990) Später setzte Spector die Konditionierungsstudien fort und zeigte, daß durch seine Versuche auch das Wachstum von Tumorzellen, die zuvor Versuchstieren implantiert wurden, verlangsamt werden konnte. Die durch Konditionierung erfolgte Tumorregression führte bei einigen Versuchstieren zu einer vollständigen Remission der Tumorzellen. (Ghanta et al., 1985) Eine interessante Konditionierungsstudie ist auch von Gauci et al. (1994) durchgeführt worden: Versuchspersonen, die ausnahmslos an einer Hausstaub(milben)-Allergie litten, ließ man ein gefärbtes Getränk mit einem neuartigen Geschmack trinken (CS), während sie gleichzeitig den Allergenen (US) ausgesetzt waren. Nach einigen Konditionsdurchgängen boten die Versuchsleiter den Versuchspersonen das gefärbte Getränk ohne Allergene an. Während des Experiments wurde die Phagozytenteilung und die Nasensekretion der Probanden gemessen. Gauci und seine Kollegen stellten mit Überraschung fest, daß schon nach wenigen Konditionierungsdurchgängen das gefärbte Getränk allein eine meßbare allergische Reaktion auslöste. Sie reduzierten daraufhin die Konditionierungsdurchgänge und registrierten, daß ein einziger Konditionierungsvorgang ausreichte, um bei den Versuchspersonen den 97 allergischen Vorgang auszulösen! Ein ähnlich rasches Konditionierungsergebnis beschreiben King und Husband (1996). Versuchspersonen, die an einer allergischen Hautreaktion litten, trugen Versuchsleiter Allergene auf die Haut auf. Die Allergene wurden Ampullen entnommen, die eine bestimmte Farbe trugen. Bei einem zweiten "Allergietest" trug man eine Placeboflüssigkeit auf die Haut des Probanden auf, die jedoch aus einer gleichfarbigen Ampulle wie die des Allergens stammte. Die Versuchspersonen wiesen daraufhin ohne Ausnahme eine ähnliche allergische Hautreaktion auf wie beim Auftragen des Allergens! Zusammenfassung: Aus den Ergebnissen der Konditionierungsstudien wird ersichtlich, daß gerade Allergien sehr schnell durch visuelle oder olfaktorische Stimuli konditioniert werden können. Da in einigen Experimenten nach einem einzigen Durchgang die allergische Reaktion konditioniert werden konnte, ergibt sich die Frage, zu welchem Anteil menschliche Allergien durch Konditionierung verursacht werden. 6.3.2 Immunmodulation durch Streß Der Begriff "Streß" stammt vom amerikanischen Forscher Hans Selye. Sein Kollege, der Physiologe Walter Cannon, stellte um 1914 fest, daß alle Menschen in einer spezifischen Weise auf akute Belastungssituationen reagieren. Zunächst kommt es zu einer allgemeinen Aktivierung des sympathischen Nervensystems, gleichzeitig wird das parasympathische System gehemmt. Damit wird eine jahrmillionenalte Reaktion ermöglicht: der Angriff gegen den Feind oder die Flucht aus einer lebensbedrohlichen Situation ("fight oder flight"). Obwohl der moderne Zivilisationsmensch kaum noch im Zusammenhang seiner Lebensbewältigung auf Kampf oder Flucht angewiesen ist, reagiert sein Organismus nach dem alten Prinzip. Steht er unter Zeitdruck, Leistungsdruck oder unter sozialem Druck, so ereignet sich in ihm dasselbe, wie beim Urmenschen im Fall von Kampf oder Flucht: durch die Erregung 98 des Sympathikus wird Adrenalin ausgeschüttet, das wiederum eine Erhöhung der Herzfrequenz verursacht. Der gesamte Körper wird stärker mit Sauerstoff versorgt, die Leber schüttet mehr Zucker aus, damit die Muskeln optimal funktionieren können. Zusätzlich verursacht der erhöhte Blutdruck eine stärkere Durchblutung des Gehirns und der Muskelfasern. Der gesamte Organismus ist hoch aktiviert. (Guttmann, 1982) Cannons Kampf/Fluchtreaktion kann schematisch folgendermaßen dargestellt werden: STRESSOR ZNS NEBENNIERENMARK ADRENALIN KAMPF/FLUCHTREAKTION Cannons Kollege Hans Selye, der "Vater der Streßforschung", erweiterte die Erkenntnisse bzgl. der Streßreaktion mit Hilfe endokrinologischer und klinischer Studien. Er untersuchte die körperlichen Veränderungen eines Individuum nach Dauerstreß und postulierte anhand von Tierexperimenten das "Allgemeine Adaptations-Syndrom" (AAS). Dieses verläuft nach Selye in drei Phasen: Die erste Phase ist gekennzeichnet von der auch von Cannon dargestellten Alarmphase. Dauert der Streß jedoch länger an, dann kommt es zu einer zweiten Phase, die gekennzeichnet ist durch die Adaptation des Organismus an den Stressor. In dieser Phase kommt es zu einer zeitlich begrenzten "Gewöhnung" an den Stressor. Die ersten Alarmsignale klingen ab, die Aktivität wird von einer Anpassungsphase abgelöst. Übersteigt der Streß eine bestimmte physische Toleranzgrenze, so entpuppt sich die zweite Phase als die "Ruhe vor dem Sturm". Denn nun kommt es zur dritten Phase, die von Selye mit dem Begriff der "Erschöpfungsphase" gekennzeichnet wurde. (Selye, 1956) Nun treten wieder die Symptome bzgl. der Anpassungsenergie auf, z.B. Bluthochdruck, hoher Blutzuckerspiegel, erhöhte Herzfrequenz. Diese Symptome klingen jedoch nicht mehr ab, sie werden irreversibel und verursachen massive organische Veränderungen, die zu einer völligen Erschöpfung und dann zum Tod führen. Nach Selyes Beobachtung dauert die Alarmphase 99 etwa zwei Tage. Danach setzt die Anpassungs- oder Widerstandsphase ein. Das Erschöpfungsstadium tritt etwa ein bis drei Monate später auf. (Selye, 1956, S. 32) Wesentlich hierbei sind die morphologischen, funktionellen und biochemischen Veränderungen des Organismus: Die Nebennierenrinden vergrößern sich irreversibel, die Lymphknoten und der Thymus bilden sich zurück, im Magen-Darm-Trakt kommt es zu Geschwürbildung. Wir sollten hier jedoch feststellen, daß sich die Beobachtungen Selyes auf extreme Dauerstressoren in Tierexperimenten beziehen (Hitze, Kälte, Bewegungseinschränkung). Deshalb sollten sie nicht nur ihrer ethischen Legitimität wegen hinterfragt werden. Bei einem Menschen bedeutet die kognitive Bewertung des Stressors einen zusätzlichen Modifikationsfaktor, darüber hinaus spielt die Zeit eine andere Rolle. Versucht man Selyes "Allgemeines Adaptations-Syndrom" darzustellen, dann sieht man, daß er im Gegensatz zu Cannon auch das Gehirn und das Hormonsystem in seine Erwägungen mit einbezog. Gleichzeitig entdeckte er, daß Streß auch eine pathologische Immunveränderung verursachen kann. Selyes AAS kann schematisch folgendermaßen dargestellt werden: LANGZEITSTRESSOR ZNS und HYPOTHALAMUS (Releasing Hormone) HYPOPHYSE (ACTH) NEBENNIERENRINDE (CORTISOL) AAS Im Gegensatz zur kurzfristigen Alarmreaktion, die vor allem mit einer erhöhten Adrenalinausschüttung einhergeht, wird demzufolge beim Dauerstreß die Nebennierenrinde und dadurch die Ausschüttung von den Corticosteroidhormonen aktiviert. Heute weiß man darüber hinaus, daß bei Dauerstreß nicht nur die Corticosteroidausschüttung verändert wird, sondern ebenso die Ausschüttung von endogenen Opiaten, vom Wachstumshormon HGH (Human Growth Hormone), von ACTH (Adrenocorticotropes Hor- 100 mon) und anderen Hormonen. Obwohl Hans Selye Endokrinologe war, versäumte er es nicht, auch die kognitive Dimension des Streßphänomens zu betrachten und hierbei auf die Rolle der Einstellung eines Menschen hinzuweisen. Die kognitive Dimension wurde jedoch ganz ausdrücklich von Lazarus und Folkmann betrachtet. (1984) Für Lazarus und Folkmann bedeutet Streß den Prozeß der Anpassung an eine externe oder interne Anforderung. Die wichtigste Rolle bei der Streßentstehung spielt einerseits die subjektive Bewertung der Situation und andererseits die ebenso subjektive Einschätzung der Bewältigungsstrategien einer Person. Diese kognitive Streßtheorie wurde später so modifiziert, daß die physiologischen Beobachtungen von Selye weiterhin in die Streßtheorie integriert werden konnten. Ursin zufolge sind Streßreize vorrangig psychisch-emotionale Belastungen. Die Streßreize sind potentielle Auslöser der bekannten Streßreaktionen. Es besteht jedoch keine lineare Beziehung zwischen Streßreiz und Streßreaktion. (Ursin und Olff, 1993) Der Streßreiz wird von einer Person auf seine potentielle Bedrohung hin gefiltert oder bewertet. In diesem Prozeß spielt die vorhin erwähnte "Bewertung der Situation" und die "Einschätzung der eigenen Möglichkeiten" die entscheidende Rolle. Die Funktion beider Faktoren (Bewertung und Einschätzung) können wir mit der Funktion eines Filters verglichen. Erst dann, wenn die Bewertung der Situation und die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten negativ ausfallen, können Streßreize gesundheitliche Konsequenzen verursachen. Zusätzlich zu diesem Bewertungs/Einschätzungsfilter existiert noch eine zweite Schutzmöglichkeit, Ursin zufolge, um Streßreize von sich fernhalten zu können: in Form von Abwehrmöglichkeiten, wie sie z.B. als Verdrängung oder Verleugnung auf den Begriff kommen. Zusammenfassend kann man die integrative Streßtheorie folgendermaßen darstellen: Ein Stressor, der auf ein Individuum einwirkt, kann nicht durch die bekannten psychologischen 101 Abwehrmechanismen "abgefangen" werden. Er löst eine psychische und physische Aktivierung in der betroffenen Person aus. Nun beginnt die zweite "Filterstation" wirksam zu werden: die Bewertung der Situation und die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Empfindet die betroffene Person den Stressor als eine Herausforderung, oder hat sie das Gefühl, sie könne durch die eigenen Fähigkeiten mit dem Stressor fertig werden, dann löst der Streßreiz zwar eine psychophysiologische Aktivierung aus, sie ist jedoch für den gesamten Organismus nicht schädlich, viel eher nützlich. (Csikszentmihalyi faßt diesen Zustand im Begriff des "Flow"-Erlebnisses. Csikszentmihalyi, 1993) Sofern der erste Filter versagt und die betroffene Person den Streßauslöser als beängstigend oder als ärgerlich empfindet und der zweite Filter keine positive Umdeutung bewirkt, kommt es zu negativen Konsequenzen für die Gesundheit eines Menschen. Abbildung 19 zeigt die schematische Darstellung der Integrationstheorie: FILTER 1: (Abwehrmechanismen, Aufmerksamkeit) | | | | EREIGNIS | | Psychophysiologische | AKTIVIERUNG | Abb. 19 FILTER 2: (Bewertung, Einschätzung) | | ANREGUNG HERAUSFORDERUNG | | | | | AKZEPTANZ „hindurchgehen“ BELASTUNG STRESS 102 Die Streßforschung unterscheidet sowohl in der Psychologie als auch in der Medizin zwischen zwei unterschiedlichen Streßarten: dem akuten Streß (Dauer: wenige Minuten bis einige Tage) und dem chronischen Streß (Dauer: mehrere Tage bis Jahre). Aus Gründen der Exaktheit wäre hier noch eine dritte Streßart zu verzeichnen, die wir im Begriff des "vektoriellen Stresses" fassen könnten. Darunter sollte eine Streßform verstanden werden, die zunächst von einer kontinuierlichen Zunahme der Streßmenge (Prä-Streßphase) und dann von einer akuten Streßphase gekennzeichnet ist. Beispiele wären Streß im Zusammenhang von Prüfungsvorbereitungen mit abschließender Prüfung oder Streß im Vorfeld einer Operation mit anschließender Operation. Die immunologische Reaktion auf Streß kann sich, abhängig von den oben dargestellten Faktoren, sowohl in einer Immunstimulierung als auch in einer Immunsuppression äußern. In einer Studie mit Medizinstudenten zeigte das Ehepaar Glaser, daß sich einige Tage vor der Prüfung die Immunparameter der Studenten signifikant verminderten. Im Vergleich zur Kontrollgruppe wiesen die Studenten, die unter der Prüfungsbelastung standen, eine verminderte IL-2-Produktion und eine verminderte Gamma-Interferonproduktion auf. Auch die Antikörper gegen latente Herpes-Viren waren bei diesen Studenten herabgesetzt. Glaser et al. untersuchten daraufhin, ob der Faktor Streß lediglich die Zahl und die Aktivität der Immunzellen schwächt oder ob er auch krankheitsanfälliger macht. In einer neuerlichen Studie impften die Forscher zwei Tage vor der Prüfung die Medizinstudenten gegen Hepatitis-BViren. Die Hepatitis-Antikörper bildeten sich als Reaktion auf die Impfung aus und schützen die Betroffenen gegen eine Infektion. Etwa zwei Wochen nach der Prüfung untersuchten nun Glaser et al. die Antikörperbildung der Studenten, und sie stellten fest, daß nur 25% der geimpften Studenten antikörper- 103 positiv gegen das Hepatitis-B-Virus waren. Diese Studenten fielen jedoch ausnahmslos in diejenige Gruppe, die sich von der Prüfung nicht sehr gestreßt und beängstigt fühlten. Diejenigen Studenten, die große Angst vor der Prüfung hatten und sich extrem unter Streß gesetzt fühlten, bildeten in dieser Zeit noch keine Antikörperantwort aus und wären demzufolge bei einem Kontakt mit Hepatitis-B-Erregern infiziert worden. (Glaser et al., 1991, 1992) Die Krankheitsanfälligkeit gegenüber Schnupfenviren untersuchten Cohen et al. an der Universität Pittsburg in einer großen Studie mit 394 Probanden. (Cohen et al., 1993) Den gesunden Versuchspersonen wurden durch Nasentropfen Virusstämme bestimmter Schnupfenerreger appliziert. Um die Untersuchung exakter zu gestalten, applizierte das Forschungsteam 5 verschiedene Pools von Viren, nämlich das Rhinovirus Typ 2, 9 und 14, Pools von Respiratory-syncytial-Virus und Corona-Viren Typ 229E. Zusätzlich zur Virusapplikation wurde das psychologische Streßniveau der Probanden untersucht. In der Blindstudie erstellten die Probanden die Einschätzung ihrer Streßbelastungen. Dabei wurde u.a. nach den Streßereignissen des Vorjahres, nach den akuten psychischen Belastungen und nach der subjektiven Befindlichkeit gefragt. Das Ergebnis der Untersuchung war hochsignifikant: aus der Gruppe der Versuchspersonen, die sich in den letzten Monaten einem extremen, unerfreulichen Streß ausgesetzt fühlten, bildeten etwa 25% mehr Studenten die klinischen Symptome eines Schnupfens aus als aus der Gruppe der Versuchspersonen, die sich nicht übermäßig gestreßt fühlten. Die Zunahme der klinischen Erkältungsanzeichen zeigte sich unabhängig davon, welcher der fünf Virusstämme den Versuchspersonen appliziert wurde. Als Korrelationsfaktor konnte in dieser Untersuchung einzig die subjektiv empfundene Streßmenge gesichert werden: Der Anstieg der klinischen Erkältungen korrelierte darüber hinaus mit keinem der erhobenen Parameter (Lebensgewohnheiten, physiologische Anstrengung, Extraversion/Introversion), und auch nicht mit der Zahl der Leukozyten und Lympho- 104 zyten. In einer Tierstudie versuchten Visintainer et al. (1982) den Einfluß von Streß auf das Tumorwachstum zu untersuchen. In dieser Studie wurden Nagetiere, denen man Tumorzellen unter die Haut gespritzt hatte, extremen physiologischen Streßfaktoren ausgesetzt. Die Wissenschaftler teilten die Versuchstiere vorher in drei Gruppen: in jene, die dem Stressor unkontrolliert ausgesetzt wurden, in jene, die den Stressor kontrollieren konnten, und zusätzlich in eine Kontrollgruppe. Kontrollieren zu können bedeutete im Zusammenhang dieses Experimentes, daß die Versuchstiere durch bestimmte Verhaltensweisen die Schmerzreize beenden konnten. Die Versuchstiere aus der Gruppe ohne Kontrollmöglichkeiten erhielten die gleiche Menge an Schmerzreizen. Dieser Reiz wurde jedoch unabhängig von der eigenen Verhaltensweise in zufälligen Intervallen abgegeben. Visintainer et al. haben nun gezeigt, daß 63% der Versuchstiere, die den Streßreiz kontrollieren konnten, die Tumorzellen überwanden und nicht am Karzinom erkrankten. Von den Versuchstieren, die unkontrolliert dem Streßreiz ausgesetzt waren, konnten lediglich 27% mit den Tumorzellen fertig werden. Ein interessanter Streßversuch gelang Schedlowski (1994). Schedlowski untersuchte in mehreren Testreihen die humoralen und die immunologischen Veränderungen von Versuchspersonen, die an einem Tandem-Fallschirmsprung teilnahmen. Bei einem TandemSprung verläßt der Erstspringer mit einem erfahrenen Fallschirmspringer das Flugzeug, er ist jedoch mit dem Sprungmaster gesichert verbunden. Naturgemäß steigt die Spannung während des Erstsprungs und davor enorm in die Höhe. In der Untersuchung von Schedlowski wurden die Erstspringer mit einem Katheter in der Oberarmvene versehen, aus dem alle 10 Minuten eine Blutprobe entnommen wurde. Die erste Blutentnahme erfolgte 2 Stunden vor dem Sprung, die letzte 1 Stunde danach. Auch unmittelbar nach der Landung wurden den Proban- 105 den Blutproben entnommen. Nach der Blutentnahme wurden zahlreiche Hormone und Immunparameter bestimmt. Zusätzlich untersuchten die Forscher Herz- und Atemfrequenz der Fallschirmspringer und die subjektive Einschätzung ihrer Ängste (Furchtskala). Die Auswertungsergebnisse zeigen eindeutig, daß der Streßreiz des Fallschirmspringens sowohl eine massive hormonelle als auch eine ebenso massive immunologische Veränderung mit sich bringt. Das Gefühl der Angst stieg bei den Probanden beim Einstieg in das Flugzeug an und erreichte knapp vor dem Sprung seinen Höhepunkt. Parallel dazu stieg die durchschnittliche Herzfrequenz der Probanden von etwa 80 Schlägen pro Minute auf das doppelte an. Ein ähnlicher Anstieg wurde bei der Atemfrequenz beobachtet (vorher durchschnittlich 18/Minute, unmittelbar vor und nach dem Sprung etwa 30/Minute). Die Adrenalinausschüttung stieg unmittelbar vor und nach dem Sprung auf 700% (!) des ursprünglichen Niveaus (von 100 ng/l auf 700 ng/l) und die Noradrenalinkonzentration um 100%. Die Erklärung für die unterschiedliche Ausschüttung der beiden Katecholamine dürfte sein, daß bei einem Fallschirmsprung die psychologische Belastung höher liegt als die physiologische Belastung. Adrenalin wird jedoch stärker bei psychologischen Belastungen und Noradrenalin stärker bei physiologischen Belastungen ausgeschüttet. Sowohl die Cortisol- als auch die Prolaktin- und HGH-Konzentration veränderten sich signifikant (Cortisol um etwa 50%; Prolaktin um etwa 150%; HGH um etwa 300%). Die Veränderung dieser Hormone trat aber verspätet, etwa 10-30 Minuten nach dem Sprung, auf. Ebenso extrem veränderte sich die Ausschüttung des Beta-Endorphins. Unmittelbar nach dem Absprung stieg seine Menge um 200%. Eine Stunde nach dem Sprung verringerte sich jedoch seine Ausschüttung um fast 100%. Die immunologischen Konsequenzen waren nach dem Fallschirmsprung ebenfalls hochsignifikant. Die Zahl der Leukozyten und der Granulozyten war signifikant erhöht. Die Zahl der Lymphozyten stieg unmittelbar nach dem Sprung an und fiel dann unter das Ausgangsniveau ab (ähnlich den Beta-Endorphinwerten). Alle T- 106 Zellsubpopulationen (T2-, T3-, T4- und T8-Zellen) stiegen zunächst signifikant an und fielen dann unter das Ausgangsniveau zurück. Ebenso stieg die Zahl der NK-Zellen unmittelbar nach dem Streß hochsignifikant an und fiel dann unter das Ursprungsniveau. Diese interessante Reaktion des Immunsystems, nämlich der schnelle Anstieg der Immunzellen in einer akuten Streßsituation und der plötzliche Abfall unter das ursprüngliche Niveau, kann ethologisch erklärt werden. In einer Bedrohungssituation besteht die Gefahr, daß sich das Individuum durch Flucht oder durch Kampf eine Verletzung zuzieht. In dieser akuten Zeit sollte das Immunsystem einen immunologischen Schutzschild ausbilden, um Krankheitserreger, die potentiell im Wege einer Verletzung in den Körper eindringen, abwehren zu können. Der abschließende Abfall der Immunzellen unter ihr ursprüngliches Niveau deutet auf das hohe Regenerationsbedürfnis des Immunsystems. Die Regelung der Immunveränderung in akuten Streßsituationen dürfte durch das Hormonsystem gesteuert werden. Die HIV-Infektion stellt einen chronischen Streßfaktor für den betroffenen Menschen dar. Wir wissen jedoch, daß die Zeit bis zum Ausbruch der Aidserkrankung unterschiedlich lang – bis zu 17 Jahre – dauern kann. Im Vergleich zu den immunologischen Studien, die an gesunden Probanden durchgeführt werden, sind Untersuchungen an aidskranken Personen aussagekräftiger. Denn normalerweise kann man auch dann keine exakte Aussage über die klinische Krankheitsanfälligkeit einer Person machen, wenn die Zellaktivitäten, die Zellproduktionen oder die Ausbildung bestimmter Antikörper durch Streß, Copingstrategien oder Schlafentzug verändert werden. Auch in diesem Falle weiß man noch nicht, ob die betreffende Person nach einem Kontakt mit einem Antigen wirklich häufiger krank wird als eine Person mit einer unveränderten Immunabwehr. Gegenwärtig gibt es nur ganz wenige Untersuchungen, die aufzeigen, ob und wie ein veränderter Immunstatus eine Veränderung der Gesundheit bewirkt. Ein veränderter Immunstatus bei HIV-infizierten Personen ist aussagekräftiger als ein 107 veränderter Immunstatus gesunder Menschen. Vor allem die Zahl der T4-Lymphozyten (auch CD-4-Zellen oder "Helferzellen" genannt) ist entscheidend für den Krankheitsverlauf. Denn die HIV-Viren greifen die T4-Lymphozyten an und vernichten sie. Je geringer die Zahl der T4-Lymphozyten, um so häufiger und schwerer sind die Infektionserkrankungen der HIVPatienten. Mit der Abnahme der T4-Lymphozyten nähert sich die Infektion dem Vollbild der Aidserkrankung. Die kritische Grenze stellt der Wert von 400 T4-Zellen pro Mikroliter Blut dar. Als Vergleich dazu hatten die Fallschirmspringer im Experiment Schedlowskis vor dem Experiment zwischen 1100 und 1400 T4-Zellen pro Mikroliter Blut. Den zweiten Gesundheitsparameter einer HIV-Infektion stellt das Verhältnis der T4Zellen zu den T8-Zellen (CD-4/CD-8) dar. Die T4-Zellen werden auch "Helferzellen" genannt, weil sie die Aktivierung des Immunsystems bewirken. Wir bezeichnen die T8-Zellen als "Suppressorzellen", weil sie die Aktivierung des Immunsystems unterdrücken. Normalerweise halten sich beide Systeme, ähnlich dem Nerven- bzw. dem Hormonsystem, in der Waage. Bei einer gesunden Person schwankt das Verhältnis der T4/T8-Zellen um einen Wert von 2:1. Dies bedeutet, daß bei etwa 1200 T4-Zellen pro Mikroliter Blut etwa 600 T8-Zellen anzutreffen sind. Bei HIV-infizierten Personen schwindet die Zahl der T4-Zellen zuerst, während die T8-Parameter relativ im Überschuß sind. Ein T4/T8-Verhältnis unter 1:1 deutet auf ein sehr stark angegriffenes Immunsystem. In einer Querschnittstudie untersuchten Bliemeister et al. HIV-infizierte Personen, die etwa gleich lang mit dem Virus infiziert waren, jedoch unterschiedliche T4/T8-Parameter und dadurch unterschiedliche Gesundheitsprognosen hatten. (Bliemeister et al., 1992) Die HIVpositiven Personen (N=72) wurden via Fragebogen hinsichtlich ihrer Lebenseinstellung, Copingstrategien, sozialer Verbundenheit, externaler/internaler Gesundheitskontrolle, Zukunftseinstellung usw. befragt. Nach der Befragung wurde ihr Blut auf die T4- und T8-Zellzahlen 108 bzw. auf das T4/T8-Verhältnis untersucht. Die Versuchsleiter bildeten nun zwei Untersuchungsgruppen: eine Gruppe mit günstigen immunologischen Parametern und somit günstigen Gesundheitsprognosen (über 400 T4-Zellen pro Mikroliter Blut; das Verhältnis der T4/T8-Zellen über 1:1) und eine Gruppe mit ungünstigen Immunparametern (weniger als 400 T4-Zellen; das Verhältnis der T4/T8-Zellen unter 1:1). Aufgrund der statistischen Korrelationsauswertung kann man nun folgende Aussagen treffen: Personen, die – die Krankheit in stärkerem Maße als Herausforderung betrachten, – daran glauben, ihren Gesundheitszustand selber beeinflussen zu können (Kontrollüberzeugung), – sich die "Warum-gerade-ich?"-Frage nicht zu häufig stellen, – das Gefühl haben, die eigene Zukunft mitbestimmen zu können, – aktiv nach Informationen über die eigene Krankheit suchen, – über ihre Krankheit sprechen können, – ihr Schicksal nicht bedingungslos in die Hände ihrer Ärzte legten, – sich sozial unterstützt fühlen haben hinsichtlich ihrer Immunparameter eine wesentlich bessere Gesundheitsprognose als Personen, die die Krankheit als eine ausweglose Bedrohung ansehen, die sich die "Warumgerade-ich?"-Frage ständig stellen, die sich sozial isolieren und nicht daran glauben, durch eigenes Zutun etwas in bezug auf die Krankheit bewirken zu können. Daß die Angst vor der Diagnose "HIV-positiv" einen starken Stressor darstellt, ist natürlich verstehbar. Ironson et al. untersuchten die Immunparameter von homosexuellen Männern fünf Wochen vor und fünf Wochen nach einem HIV-Test. (Ironson et al., 1990). Die Männer, die kurz vor der HIV-Untersuchung standen und noch nicht wußten, ob sie gesund oder infiziert waren, wiesen eine geringere NK-Zellenaktivität und eine niedrigere Prolifera- 109 tionsrate der NK-Zellen auf als Männer gleichen Alters der Kontrollgruppe. Einige Wochen nach der entlastenden Diagnose "HIV-negativ" kehrten jedoch die NK-Zellenwerte der betroffenen Personen in den Normbereich zurück, was darauf hinweist, daß die NK-Zellen-Werte vorher durch den Angststreß modifiziert wurden. Nicht alle Männer der homosexuellen Untersuchungsgruppe bekamen die entlastende Negativ-Diagnose, manche von ihnen waren HIV-positiv. Die Nachricht löste in den Betroffenen natürlich eine zusätzliche Angststeigerung aus, was die Annahme nahelegt, daß sich die Immunparameter der Betroffenen weiter verschlechtern könnten. In der Tat ließ die NK-Aktivität der betroffenen Personen noch einmal nach, und die Aktivitätsabnahme korrelierte mit dem von den Betroffenen berichteten Angstausmaß. Interessanterweise veränderten sich jedoch nicht die für die Krankheitsprognose so wichtigen T4(CD-4)-Zellzahlen. Offensichtlich werden die verschiedenen Immunparameter von verschiedenen Mechanismen beeinflußt. Eine prospektive Studie, auch mit HIV-infizierten Personen, erstellten Brauchli und Zeier in der Schweiz. (Brauchli, Zeier, 1997) Die beiden Forscher untersuchten den Einfluß der depressiven/hilflosen Reaktion auf den Krankheitsverlauf. Als immunologische Meßparameter wurden auch in dieser Studie die für den Krankheitsverlauf relevanten T4- und T8(CD-4- und CD-8-) Zellen gewählt. In der prospektiven Studie erfaßten die Forscher die CD4-Prozentwerte und das CD-4/CD-8-Verhältnis der Surrogat-Marker zu 3 verschiedenen Meßzeiten: t/1 war der Beginn der Studie, t/2 der Meßpunkt 8 Monate später und t/3 15 Monate später. Darüber hinaus wurde am Anfang der Studie die depressive Reaktion der Patienten erfaßt. Bei der Immununtersuchung 8 Monate später zeigte sich eine starke Korrelation zwischen der Stärke der depressiven Reaktion und der Veränderung der Immunparameter. Die Patienten, die zu Beginn der Studie eine stark depressive Reaktion zeigten, wiesen 8 Monate 110 später auch schlechtere CD-4/CD-8-Parameter auf als die Patienten, die weniger depressiv waren. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die Ergebnisse der bisherigen Studien, denen zufolge das subjektive Befinden der Patienten prospektiv den Krankheitsverlauf beeinflußt. Die Meßergebnisse des dritten Zeitpunkts (t/3, 15 Monate später) wiesen keine Korrelation mehr mit der Depression zu Beginn der Studie auf. Zu diesem Zeitpunkt konnte auch kein Zusammenhang zwischen der Depression zum Meßpunkt t/1 und Immunparameter t/3 festgestellt werden. Offensichtlich ist die psychologische Reaktion auf die Krankheit durch massive Schwankungen ausgezeichnet, weshalb die depressive Reaktion zu einem Meßpunkt für den längerfristigen Krankheitsverlauf nicht aussagekräftig sein kann. Bedeutende Lebensereignisse, die einer Person die bisherigen Lebenswerte nehmen, sie aus der bisherigen, gewohnten Lebensbahn werfen, stellen eine akute und danach unter Umständen eine chronische Belastung dar. Zu diesen Lebensereignissen ("Life-Events") zählen z.B. ein Umzug, der Verlust der Arbeitsstelle, Scheidung oder Tod eines Partners, die schwere Erkrankung oder der Tod der Eltern oder Kinder, finanzielle Schwierigkeiten, schwere Prüfungssituationen und akute Versagenserlebnisse im Beruf oder im Privatleben. McClelland und Jemmott untersuchten in einer prospektiven Studie den gesundheitlichen Zustand von Studenten, die in den Monaten vor der Untersuchung mehrere Life-Events zu verzeichnen hatten. (McClelland, Jemmott, 1980) In der Studie, an der über 100 Studenten teilnahmen, zeigte sich, daß Personen mit einer höheren Anzahl von Life-Events häufiger und schwerer erkrankten als Personen der Kontrollgruppe ohne lebensverändernde Ereignisse. Auch die subjektive Befindlichkeit der Personen mit mehreren Life-Events war negativ verändert. Ein besonderes Krankheitsrisiko stellte hohes Einflußstreben (Ehrgeiz) dar, das mit häufigeren Versagenserfahrungen gekoppelt war. Die Rolle der Life-Events untersuchten auch Irwin et al. (1987) an etwa 40 weiblichen Versuchspersonen. Die Häufigkeit der Life-Events korrelierte auch in dieser Untersuchung 111 mit der Gesundheit der Probanden. Frauen mit mehreren Life-Events wiesen eine signifikant niedrigere NK-Zellaktivität auf als Frauen der Kontrollgruppe ohne Life-Events. Da diese Frauen auch einen hohen Grad an Depression zeigten, war eine einfache Ursache-WirkungZuweisung jedoch nicht gegeben, da es auch möglich sein kann, daß sich die schwere Depression suppressiv auf die NK-Zellaktivität auswirkte. In negativen sozialen Beziehungen zu leben oder sozial vereinsamt zu sein bedeutet für die betroffenen Personen, daß sie langfristig einer erheblichen psychischen Belastung ausgesetzt sind. Zahlreiche psychoneuroimmunologische Studien haben die immunologischen Konsequenzen von konstruktiven bzw. destruktiven sozialen Beziehungen und die Konsequenzen der subjektiv empfundenen Einsamkeit zum Gegenstand. Schulz (1986) berichtet über eine umfangreiche Studie, in der Freundschafts- und Ehebeziehungen hinsichtlich ihrer pathogenen Auswirkungen untersucht wurden. Aufgrund der Meßdaten an etwa 7000 befragten Personen können wir davon ausgehen, daß Unzufriedenheit in den wichtigsten Beziehungen das Auftreten von chronischen Erkrankungen begünstigt (in dieser Studie handelte es sich um ein überdurchschnittlich häufiges Auftreten von rheumatischer Arthritis). Kiecolt-Glaser et al. (1987) konnten nachweisen, daß unglücklich verheiratete Versuchspersonen eine niedrigere NK-Zellaktivität, geringere Proliferation der T-Zellen und ein niedrigeres CD-4/CD-8-Verhältnis aufweisen als Personen aus befriedigenden Beziehungen. Das Ehepaar Kiecolt-Glaser konnte darüber hinaus in zahlreichen Untersuchungen zeigen, daß Einsamkeit einen stark negativen Einfluß auf die wichtigen Immunparameter (Aktivität der NK-Zellen, T-Lymphozytenantwort, T-Zellen-Proliferationsrate) ausübt. Eine Studie mit klinischer Relevanz erstellten Torman et al. (1980). Die Versuchsleiter randomisierten zunächst Testpersonen, die über eine Vereinsamung in den letzten Monaten berichteten. Dann wurden die "vereinsamten" ebenso wie nicht vereinsamte 112 Personen aus der Kontrollgruppe mit einem Schnupfenerreger, mit dem Rhinovirus, infiziert. Aus der nachfolgenden klinischen Beobachtung zeigte sich, daß diejenigen Personen, die stärker vereinsamt waren, viel massiver die Symptome der Viruserkrankung ausbildeten als die Personen, die nicht vereinsamt waren. Wenn die Trennung vom Partner nicht auf eigenen Wunsch geschieht, dann ist dieses Ereignis besonders schmerzhaft und stellt durch den Werteverlust eine emotionale Belastung ersten Ranges dar. Wieder war es das Ehepaar Kiecolt-Glaser, das die Auswirkungen unfreiwilliger Trennung an geschiedenen Männern untersuchte. (Kiecolt-Glaser, 1988) Die Auswertungsparameter hatten das subjektive Befinden dieser Personen, die Dokumentation ihrer Erkrankungen sowie Blutproben, aus denen ihre Immunwerte ersichtlich wurden, zum Inhalt. Die Untersuchung zeigt, daß sich die geschiedenen Männer im Vergleich zu Männern aus derselben sozialen Schicht in bezug auf ihre subjektive Befindlichkeit, in der Häufigkeit ihrer Erkrankungen und bzgl. ihrer Immunwerte signifikant von der Kontrollgruppe unterschieden. Die geschiedenen Männer fühlten sich gestreßter und einsamer als die Männer der verheirateten Kontrollgruppe. Sie waren häufiger krank und ihre Immunwerte zeigten eine niedrigere Abwehrfunktion gegen die Epstein-Barr-Viren bzw. gegen die Herpes-Simplex-Viren. Das Verhältnis der CD-4- zu den CD-8-Zellen blieb jedoch unauffällig im Vergleich zur Kontrollgruppe. Verglichen die Forscher das subjektive Befinden, die Erkrankungshäufigkeit und die Immunparameter mit Männern, die die Scheidung von der Partnerin selber initiiert hatten, so wiesen diese im Vergleich zu den unfreiwillig geschiedenen ein viel höheres Maß an Lebenszufriedenheit, geringere Streßwerte und kaum das Gefühl der Vereinsamung auf. Die Initiatoren der Scheidung waren auch seltener krank und wiesen bessere Immunparameter auf als die unfreiwillig geschiedenen Personen. Der Tod eines Lebenspartners bedeutet eine besonders starke emotionelle Belastung. 113 Das Phänomen des Nachsterbens ist uns sowohl aus der klassischen Literatur als auch aus verschiedenen Familienbeschreibungen bekannt. Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die das Phänomen des Nachsterbens oder die gesundheitlichen Veränderungen des hinterbliebenen Partners zum Gegenstand hatten, sind jedoch erst etwa 20 Jahre alt. Über eine Studie an 4486 Witwern berichtet Mikotta (1992, S. 115). Dem Bericht zufolge starben innerhalb der ersten 6 Monate 213 der hinterbliebenen Männern, was im Vergleich zu gleichaltrigen verheirateten Männern eine Mortalitätszunahme von 40% bedeutet. Die zellulären und humoralen Veränderungen nach dem Tod des Ehepartners untersuchten auch Bartrop et al. (1977). Die Immunparameter der verwitweten Personen zeigten etwa 6 Wochen nach dem Tod des Ehepartners eine verminderte Mitogenstimulierbarkeit der T-Lymphozyten. Die Meßwerte der anderen Immunparameter (Zahl der T- und B-Lymphozyten, Immunglobulinkonzentration) wiesen keinen Unterschied im Vergleich zur Kontrollgruppe auf. Es ist jedoch festzustellen, daß bei dieser Untersuchung das Alter der verwitweten Personen einer großen Streuung unterlag (20-65 Jahre). Empirischen Beobachtungen zufolge ist der Verlust einer wichtigen Bezugsperson vor allem in den frühen Jahren und im Alter traumatisch. Die nach dem Verlust des Ehepartners herabgesetzte Mitogenstimulierbarkeit der TLymphozyten konnten auch Schleifer et al. (1983) beobachten. Andere Studien hingegen wiesen keine immunologischen Unterschiede zwischen dem Immunstatus von verwitweten Personen und dem der Kontrollgruppe auf. (Irwin et al., 1987; Monjan, 1984) Naor et al. (1983) untersuchten die Immunparameter jener Frauen, die selber einem künstlichen Abortus zustimmten und die Immunparameter jener, die einen plötzlichen Abortus erlitten. Diejenigen Frauen, die dem Abortus selber zustimmten und keine Depressionswerte auf der Hamilton-Skala aufwiesen, unterschieden sich immunologisch nicht von der Kontrollgruppe gleichaltriger Frauen ohne Abortus. Hingegen wiesen die Frauen, die den 114 Fötus ungewollt verloren, höhere Depressionswerte auf, die Mitogenstimulierbarkeit ihrer TLymphozyten war im Vergleich zur Kontrollgruppe und im Vergleich zu den Frauen mit künstlichem Abortus herabgesetzt. Die Stärke der Trauerreaktion korrelierte signifikant mit der Stärke der Immunsuppression. Die Pflege eines Angehörigen, ohne Aussicht auf eine Heilungschance, bedeutet für den Betroffenen eine längerfristige physiologische und psychologische Belastung. KiecoltGlaser et al. untersuchten Angehörige von Morbus-Alzheimer-Patienten, die ihre kranken Verwandten seit Jahren mehrere Stunden am Tag pflegten. (Kiecolt-Glaser et al., 1993) Im Vergleich zeigte sich, daß die pflegenden Angehörigen länger an Infektionskrankheiten litten, eine verminderte Anzahl von T-Lymphozyten aufwiesen und über eine niedrigere mitogeninduzierte Proliferationsrate ihrer T-Lymphozyten verfügten als die nichtbelasteten Personen der Kontrollgruppe. Die immunologischen Parameter waren um so reduzierter, je schlechter die Beziehung zu den gepflegten Angehörigen eingestuft wurde. Ebenso von Bedeutung war auch das Ausmaß der subjektiv wahrgenommenen sozialen Unterstützung anderer Bezugspersonen. Je mehr sich die pflegenden Personen allein gelassen fühlten, um so herabgesetzter waren ihre Immunfunktionen. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine starke emotionale Belastung in vielen Fällen eine Veränderung des Immunsystems bewirkt. Kurzfristiger Streß kann das Immunsystem ebenso stimulieren wie herabsetzen, die immunologische Veränderung dauert jedoch nicht sehr lange an. Langfristige Belastungen modifizieren das Immunsystem länger anhaltend, wenn mehrere destruktive Faktoren (z.B. fehlende soziale Unterstützung, negative emotionale Beziehung, destruktive Copingstrategien, negative Bewertung der Situation) zur ursprünglichen Belastung hinzukommen. An dieser Stelle bestätigt sich wieder einmal die psychobiologische Beobachtung, daß die einfache Ursache-Wirkung-Hypothese (einer einzigen Wirkung 115 wird eine einzige Ursache zugeschrieben und umgekehrt) nicht haltbar ist. Dies dürfte der Grund für die oft widersprüchlichen Untersuchungsergebnisse sein. Darüber hinaus ist anzumerken, daß man nur ganz wenig über die klinische Relevanz der einzelnen Immunparameter weiß. Wie weit eine veränderte Immunfunktion gesundheits- oder krankheitsrelevant wirkt, kann man nur wenigen Untersuchungen (Cohen et al.; Visintainer et al.; Kiecolt-Glaser und Bliemeister et al.) entnehmen. Denn die meisten Studien haben entweder die Immunparameter der betreffenden Personen oder ihre gesundheitliche Veränderung zum Gegenstand. Auch in dieser Hinsicht wären zusätzliche Untersuchungen notwendig, nämlich solche, die die klinische Relevanz unterschiedlicher Immunparameter erfassen. 6.3.3 Positive Immunmodulation durch psychische Faktoren Leider ist die Zahl derjenigen Untersuchungen, die eine mögliche positive Immunmodulation erforschen, viel geringer als die Zahl der Untersuchungen, die die immunbelastenden Faktoren aufzuspüren sich vornehmen. Kiecolt-Glaser et al. berichteten über den Versuch, das Immunsystem alter Menschen positiv zu modifizieren. In einem Geriatriezentrum bildeten die Versuchsleiter zwei Versuchsgruppen und eine Kontrollgruppe mit Altersheimbewohnern über 70 Jahren. Die erste Gruppe alter Menschen, die sich bereit erklärt hatten, in aktiver Weise psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wurde in das Entspannungstraining eingeführt. Die Teilnehmer nahmen 4 Wochen lang insgesamt 12 mal an Gruppensitzungen teil, bei denen sie ein bestimmtes Entspannungstraining erlernten und einübten. Den Gruppenteilnehmern wurde erklärt, daß das Training eine aktive Möglichkeit darstelle, mit allfälligen psychischen und physischen Beeinträchtigungen fertig zu werden. Die Teilnehmer der zweiten Versuchsgruppe erhielten ebenso häufig und ebenso lang Besuch von Studenten, die sich bereit erklärt hatten, in diesem Zeitraum mit den alten Menschen zu reden. Die Kontrollgruppe erhielt keine Betreu- 116 ung, ihre immunologischen und psychischen Meßwerte wurden jedoch zur gleichen Zeit wie VG1 und VG2 untersucht. Die Meßdaten wurden vor dem Versuch, während der Sitzungen und einen Monat nach den Sitzungen erhoben. Die Ergebnisse zeigten, daß sich die Teilnehmer derjenigen Versuchsgruppe, die die Methode des Entspannungstrainings erlernt und dadurch eine aktive Möglichkeit für die Bewältigung mancher Probleme hinzugewonnen hatte, am Ende der Studie psychisch wohler fühlten als die Teilnehmer der beiden anderen Gruppen. Bis zum 2. Meßpunkt des Entspannungstrainings stieg die Aktivität der NK-Zellen signifikant, um etwa 70%, an. Zum dritten Meßzeitpunkt, einen Monat nach dem Training, zeigte diese Gruppe geringere, aber immer noch erhöhte NK-Werte an, gleichzeitig sank in dieser Gruppe die Zahl der Anti-HSV-Antikörper (eine Zunahme der Anti-HSV-Antikörper verursacht das vermehrte Auftreten von Herpesbläschen). Weder die Teilnehmer der zweiten Versuchsgruppe, die zwar regelmäßig Besuch bekamen, aber ansonsten inaktiv blieben, noch die Teilnehmer der Kontrollgruppe wiesen signifikante Veränderungen im Bereich der subjektiven Befindlichkeit oder im Bereich ihrer Immunparameter auf. Grossarth-Maticek untersuchte in einer prospektiven Studie zwischen den 70er und den 80er Jahren die Einstellung und den Lebensstil krebskranker Patienten an etwa 2500 Personen. (Grossarth-Maticek, 1985) In der Langzeitstudie konnte gezeigt werden, daß diejenigen Personen die größere Chance haben, die 10-Jahresgrenze zu überleben, – die ihre eigene Person nicht geringer bewerten als die Personen, zu denen sie wichtige Beziehungen pflegen; – die sich auch ohne die ständige Nähe wichtiger Beziehungspersonen wohlfühlen können; – die bereit sind, eigene Gefühle und Bedürfnisse anderen Menschen mitzuteilen; – die notfalls auch Konfliktsituationen eingehen können, auch wenn dadurch eine harmoni- 117 sche Atmosphäre zerstört wird. Die Untersuchung Grossarth-Maticeks löste eine große Diskussionswelle aus. Zum einen, weil er behauptete, es gäbe so etwas wie eine Krebspersönlichkeit und nun die Gefahr bestand, daß sich Menschen schuldig zu fühlen begannen, die den von Grossarth-Maticek formulierten Kriterien einer Krebspersönlichkeit entsprachen. Zum anderen, weil die Replikationsuntersuchungen nicht mehr dieselben Ergebnisse wie die Studie Grossarth-Maticeks erbrachten und die Frage aufgeworfen wurde, ob die Untersuchung korrekt durchgeführt worden war. Eine aufsehenerregende Studie im Bereich der Psychoneuroimmunologie erstellten Spiegel et al. (1982) mit einer Untersuchungsgruppe von 86 Patientinnen, die an einem Mamma-Karzinom im fortgeschrittenen Stadium litten. Die Teilnehmerinnen der Untersuchung nahmen ein Jahr lang wöchentlich einmal an psychotherapeutischen Gruppensitzungen teil, in denen ihnen Informationen über die Krankheit, aktive Problemlösungsstrategien, Möglichkeiten der Schmerzreduktion und ein optimales Gesundheitsverhalten vermittelt wurden. Ziel der Intervention war es: – eine Schmerzreduktion der Patientinnen zu erreichen, – die eigenen psychischen und physischen Ressourcen zu finden, – die Auflösung des Hilflosigkeitsgefühls und die Etablierung der Kontrollüberzeugung zu erreichen und – den Patientinnen eine psychosoziale Unterstützung zu geben. Durch diese psychotherapeutsische Intervention verringerten sich die tumorbedingten Schmerzen der Patientinnen und ihre subjektiv wahrgenommene Lebensqualität nahm zu. Das Besondere an dieser Untersuchung waren jedoch die veränderten Überlebenszeiten der Patientinnen. Die Frauen, die an den Therapiesitzungen teilnahmen, wiesen eine im Durchschnitt doppelt so lange Überlebenszeit auf als die Frauen der unbehandelten Gruppe. Nach zehn 118 Jahren lebten noch über 10% der Frauen aus der therapierten Gruppe, während alle Frauen der nichtbehandelten Gruppe innerhalb der ersten vier Jahre verstarben! Die Ergebnisse dieser Studie waren so bedeutsam, daß sich Fawzy et al. in den Folgejahren für eine Wiederholung der Untersuchung mit gleichzeitiger Immunstatus-Kontrolle entschieden. (Fawzy et al., 1993) Wieder wurden Patienten mit der Diagnose Krebs durch eine psychotherapeutische Intervention in die Praxis der aktiven Coping-Strategien eingeführt (z.B. Informationsangebote, Gespräche mit Nichtkranken, das Auffinden von Sinnmöglichkeiten trotz der Diagnose, Konfliktgespräche, Anti-Schmerz-Strategien, Entspannungsübungen, angemessener Sport, Mobilisierung der eigenen Ressourcen). Die aktive Psychotherapiephase dauerte 6 Wochen. Darauf folgte eine therapiefreie Phase, in der die Patienten die vorher erlernten Einstellungen und Verhaltensweisen in vivo anwenden konnten. Nach sechs Monaten traf sich die Therapiegruppe wieder, gleichzeitig wurden die Immunparameter der Patienten bestimmt. Die nächste Gruppensitzung fand ein Jahr nach Beginn der Therapie statt. Fawzy und seine Kollegen konnten zeigen, daß sich die Immunparameter der Patienten unmittelbar nach der sechswöchigen Therapie kaum veränderten. Die immunologische Untersuchung nach 6 Monaten ergab jedoch, daß die Patienten der Therapiegruppe statistisch signifikant geringere CD-4-Zellen (T-4-Lymphozyten) aufwiesen. Der Prozentsatz der NK-Zellen, die bei der immunologischen Krebsbekämpfung eine große Rolle spielen, nahm hingegen signifikant zu. Die Stimulierbarkeit der NK-Zellen durch Alpha-Interferone war höher als bei der Kontrollgruppe. Nicht nur die Immunparameter veränderten sich sechs Monate nach Therapiebeginn: Die Patienten berichteten darüber hinaus, daß sich ihre subjektiv empfundene Streßmenge verringerte. Sie waren weniger depressiv und ängstlich, und sie konnten mehr Lebensfreude und Aktivität entwickeln als die Patienten der Kontrollgruppe. Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 6 Jahren zeigte sich, daß 91% der Patienten, die durch eine Psychotherapie ihre 119 Lebensstrategien veränderten, noch lebten. Von den Patienten der Kontrollgruppe, die jede medizinische Hilfe, jedoch keine Psychotherapie erhielten, lebten hingegen nur 70%! Über ähnliche Ergebnisse berichtet der Psychoonkologe Lawrence LeShan (1995). Seinen Untersuchungen zufolge, die sich über 40 Jahre hin erstrecken, haben diejenigen Karzinompatienten die beste Chance, wieder zu genesen, die die eigene Hilf- und Hoffnungslosigkeit überwinden und aktiv nach Lösungsstrategien, die zu ihrer Person "passen", suchen. Es entspricht allerdings nicht der Ansicht des Autors, daß sich die Betroffenen nach der Karzinomdiagnose die "think positive"-Ideologie aneignen müßten. "Wer über bestimmte Dinge nicht verzweifelt, ist geistig nicht normal" (LeShan, 1992, S. 38) Nicht die Traurigkeit ist belastend für das Immunsystem, sondern der destruktive Umgang (Verheimlichung, Harmonisierung, Überspielen durch Aktivität) mit ihr. Den klinischen Erfahrungen LeShans zufolge ist es wichtig, daß Karzinompatienten – keine "Rolle" spielen, sondern echt sein können, – ihren Widerstand gegen ihre lebenshindernden Zustände wecken und – ihren je eigenen Lebenssinn finden, und zwar denjenigen, der zu ihrer Persönlichkeit und zu ihren Anlagen stimmt. Unter dem Begriff Kreativität versteht man die selbstvergessene, schöpferische Konzentration auf neue Ideen, Aufgaben und Lösungen. Kreative Prozesse laufen im menschlichen Gehirn ab. Sie sind aber immer von starken Emotionen begleitet. Da das Gehirn durch das Nervensystem und durch das Hormonsystem regulierend in physiologische Prozesse eingreifen kann, sind die klinischen Untersuchungsergebnisse von Cousins (1981) und Csikszentmihalyi (1993a, b) auch biologisch nachvollziehbar: Kreatives Tun und Denken verursacht nicht nur eine positive Affektlage bei den betroffenen Personen, sondern auch bessere Gedächtnisleistungen, massive Schmerzreduktion, verminderte Infektanfälligkeit, verkürzte Krankheitsdauer und ein besseres physiologisches Wohlbefinden. Die Ursache für die 120 Schmerzreduktion und für die immunologische Stabilisierung dürfte in der Endorphinausschüttung liegen, die bei kreativen Tätigkeiten mit Sicherheit stattfindet. Endorphine stimulieren jedoch die Ausschüttung von Interleukinen, von NK-Zellen, von T-Lymphozyten und von Gamma Interferon (siehe Kap. 6.2.4). Damit wirken sie auf Immunzellen und Immunbotenstoffe, die bei der Abwehr von Viren und Bakterien bzw. bei der Vernichtung entarteter Körperzellen aktiv werden. Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren, daß Hypnose, Suggestion und Entspannungsübungen eine Immunmodulation bewirken können, sei es bei der Allergiebekämpfung, bei der Abschwächung von Autoimmunerkrankungen oder bei der zellulären Aktivierung bei karzinogenen Erkrankungen. (Green et al., 1988; Kropiunigg, 1991; Simonton et al., 1996; Zachariae et al., 1989; 1991) Die Idee, daß Krebspatienten durch Imagination ihrer Immunzellen die Abtötung der Krebszellen verstärken könnten, stammt vom Ehepaar Simonton. Dr. Carl Simonton ist Onkologe und Spezialist für Strahlentherapie, seine Frau ist Psychologin. Beide Spezialisten arbeiten seit vielen Jahren im Bereich der Krebsberatung und der Krebsforschung. Die Methode, die von dem Ehepaar 1971 entwickelt und seitdem angewendet wurde, beruht auf einem Vorstellungstraining (mental imagery). Krebspatienten erlernen zunächst die Methode des Entspannungstrainings, danach werden sie mit Videofilmen, Fotografien und ausführlicher Literatur über das Wachstum der Krebszellen und ihre Vernichtung durch Immunzellen, Chemotherapie oder Bestrahlung informiert. So werden die vom Ehepaar Simonton betreuten Krebspatienten genauestens über die zellulären Vorgänge im Körper und über die Kraft der Selbstheilung informiert. Im psychotherapeutischen Durchgang werden sie angeleitet, sich nach einer Entspannungsphase die Arbeit der T-Lymphozyten und der Killerzellen genau vorzustellen. Im Verlauf dieser Imaginationsphase stellen sich die Patienten die körpereigenen Immunzellen bildhaft vor: wie sie die Krebszellen zunächst unschädlich machen und dann 121 vernichten. Die von Simonton erfundene Imaginationsübung beruht auf einer starken Selbstsuggestion. Folgende Vorstellungen – zusätzlich zu den immunologisch-medizinischen Bildern – werden imaginiert: "Die Krebszellen sind schwach und ungeordnet. ... Die Therapie ist stark und mächtig. ... Die weißen Blutkörperchen bilden ein riesiges Heer, das die Krebszellen überwältigt..." (Simonton et al., 1996, S. 195) Die klinischen Ergebnisse der Simontonmethode deuten tatsächlich auf eine bessere Heilungschance derjenigen Patienten hin, die eine medizinische und zugleich imaginative Therapie erhalten. (Simonton, 1996) Ebenso mit der Visualisierungsmethode, wenn auch inhaltlich ganz anders, arbeitet der Münchner Rheumatherapeut Dr. Eckehard Wüst. Die Patientenzielgruppe besteht aus Morbus-Bechterew Erkrankten im Stadium I-IV. Auf einem Morbus-Bechterew-Symposium zeigte Wüst Meßwerte, die in einer Rheumaklinik an den von ihm behandelten Patienten erhoben wurden. Die Patienten stuften den Behandlungserfolg durch die "neurokognitive Therapie" auf einer Skala von 0 bis 100% bei 50 bis 80% ein. Auf die Frage, zu wieviel Prozent die rheumatischen Symptome (Schmerzen, Bewegungsunfähigkeit) beseitigt wurden, gaben die Patienten mindestens 80% an! Die meisten Patienten wiesen in der Nachuntersuchung keine röntgenologisch nachweisbaren Veränderungen auf, jedoch hochsignifikant veränderte Laborbefunde (die laborchemischen Befunde wiesen keine entzündliche Reaktion mehr auf). Der rheumatologische Untersuchungsbefund zeigte deutliche Verbesserungen der rheumatologischen Meßwerte der Patienten (N=13). Einige Patienten berichteten sogar von völliger Schmerz- und Bewegungsfreiheit. (Wüst, 1992) Die neurokognitive Therapie nach Wüst beruht auf der Fähigkeit des Menschen, physiologische Vorgänge im Körper durch Imagination vorstellbar zu machen. Offensichtlich gelingt es dem Therapeuten, Vorgänge im Gehirn, Nervensystem und Immunsystem (Morbus Bechterew entsteht durch einen autoaggressiven Immunprozeß) vorstellbar zu machen und 122 dadurch die oben genannte Veränderung zu verursachen. Es gibt jedenfalls bis heute kein Medikament, das innerhalb der angegebenen Therapiezeit (6 Monate) vergleichbare positive Veränderungen (Schmerzfreiheit, Bewegungsfreiheit) bewirken kann. Die Immunveränderung durch Imagination wurde auch von Schneider et al. untersucht. (Schneider, 1983) In ihrem Experiment führten die Psychologen den Versuchspersonen Diabilder vor, die die Neutrophile bei ihrer wichtigsten Funktion, der "Abfallbeseitigung", zeigten. (Hauptaufgabe der Neutrophile ist es, die Antigen-Antikörperkomplexe im Blutkreislauf zu beseitigen.) Die Versuchspersonen lernten die Neutrophile in ihrer ursprünglichen und in ihrer aktivierten Form kennen. Anschließend wurden die Versuchspersonen angeleitet, die Neutrophile zu imaginieren, wie sie sich über die AntigenAntikörper-Komplexe stülpen, sich diese einverleiben und schließlich durch die Gefäßwände aus der Blutbahn treten. Nach der Imaginationssitzung wurden die Immunparameter der Versuchspersonen gemessen. In der Tat veränderte sich die Zahl der Neutrophile nach der Imaginationsübung hochsignifikant, während die anderen Leukozyten keine nennenswerte Veränderung aufwiesen. Im Zusammenhang der Methode des Biofeedbacks ist seit einigen Jahren bekannt, daß offensichtlich alle menschlichen Organe durch mentales Training zu beeinflussen sind. Nun sieht es so aus, als wäre es auch möglich, selbst das Immunsystem mit der Methode der mental imagery zu modifizieren. Polonsky et al. (1985) leiteten in einem klinischen Versuch Asthmapatienten an, sich den genauen Ablauf eines Asthmaanfalls vorzustellen. Nach einem sechswöchigen Imaginationstraining (somatic imagery) zeigte sich eine statistisch signifikante Reduktion der Häufigkeit der Asthmaanfälle. Darüber hinaus verbesserte sich die Proliferationsrate der SuppressorT-Zellen signifikant. (Die Suppressor-T-Zellen bewirken eine Dämpfung der immunologischen Überreaktionen.) 123 "Lachen hält gesund" – so ein alter Volksspruch. Daß das Lachen tatsächlich eine positive Immunveränderung bewirken kann, darüber berichten Cousins (1981) und Dillon (1986). Norman Cousins beschreibt seine eigene Krankheitsgeschichte nach der Diagnose einer schweren Morbus-Bechterew-Erkrankung (Heilungschance: 1:500). Der Journalist, der durch die Bindegewebserkrankung fast vollkommen bewegungsunfähig wurde und aufgrund extremer Schmerzen keine Nacht mehr schlafen konnte, beschloß, für seine Gesundheit zu kämpfen. Er sah sich täglich 2 Stunden lang Videofilme an, die ihn zum Lachen brachten, und verordnete sich auf diese Weise gewissermaßen eine "Lachtherapie". Cousins berichtete, daß er aufgrund der euphorisierenden Wirkung des Lachens bald wieder schlafen konnte und immer weniger Schmerzen verspürte. Der Entzündungsprozeß war klinisch meßbar nach einigen Wochen gestoppt, und Cousins genaß fast vollständig. Obwohl es sich in diesem Fall um einen Einzelbericht handelte, wurde das anschließend geschriebene Buch "Der Arzt in uns selbst" (1981) zu einer wichtigen Lektüre für schwerkranke Menschen. Cousins ermutigt alle Betroffenen zu einer Haltung, die aus den vorher genannten Untersuchungen verständlich wird: zusätzlich zur "Lachtherapie" motiviert er Schwerkranke, um ihr Leben zu kämpfen, die Behandlung auch in die eigenen Hände zu nehmen, sich über den Krankheitsablauf und über die Heilungsmöglichkeiten genau zu informieren und den körperlichen Verfall nicht einfach tatenlos hinzunehmen. Fachsprachlich könnte man diese Haltung im Begriff der "aktiven, selbstverantwortlichen Krankheitsbegegnung" erfassen. Gerade weil Cousins Darstellung lediglich einen einzelnen Fall dokumentiert, ist es interessant und wichtig, die immunmodulative Wirkung des Lachens auch biochemisch zu untersuchen. Denn offensichtlich besteht auch in diesem Prozeß eine Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem einerseits und dem Hormon- bzw. Immunsystem anderseits. Daß das Lachen die Ausschüttung von Endorphinen bewirkt, die wiederum euphorisierend und schmerzhemmend wirken, ist in der Neuroendokrinologie weitgehend bekannt. Daß das La- 124 chen jedoch auch meßbare immunologische Veränderungen verursachen kann, zeigte Dillon in einem Experiment 1985: Kathleen Dillon untersuchte in einem Experiment die immunologischen Veränderungen, die durch Lachen erzeugt werden, indem sie einer Versuchsgruppe einen 30minütigen lustigen Film (Richard Pryor Live) zeigte. Unmittelbar vor, während, und unmittelbar nach dem lacherregenden Film testeten Dillon et al. den Speichel-IgA-Gehalt der Versuchspersonen. (Dillon et al., 1985/86) Das Immunglobulin Alpha (IgA) stellt die erste Abwehrfront im Schleimhautsystem der Körperöffnungen eines Menschen dar. IgA-Moleküle wehren Bakterien und Viren ab, indem sie sich durch das Schlüssel-Schloß-Prinzip der Oberflächenbeschaffenheit an die Antigene heften und dadurch diese für die Phagozyten sichtbar und "verdaubar" machen. Die Kontrollgruppe des Experiments sah sich einen gleich langen, jedoch nicht emotionsauslösenden Lehrfilm an (The Thin Edge: Anxiety). Die Ergebnisse der Studie zeigten, daß der IgA-Gehalt der Versuchsgruppe während des humorvollen Films und unmittelbar danach signifikant anstieg. Die IgA-Konzentration im Speichel der Kontrollgruppe veränderte sich jedoch nicht. Zusätzlich zur Veränderung des Immunglobulingehalts stellten Dillon und ihre Kollegen fest, daß die Ausgangswerte der IgA-Konzentration bei denjenigen Versuchspersonen, die im Alltagsleben Humor als Copingstrategie einsetzten, höher war als die Ausgangswerte derjenigen Personen, die sich und ihre Copingstrategien als wenig humorvoll ansahen (ein Beispiel für den Meßparameter: "Meine Probleme verringern sich oft, wenn ich versuche, sie mit Humor zu nehmen"). Die Frage, ob seelische Gesundheit eine Bedeutung für die körperliche Gesundheit hat, wurde an der Universität Trier in mehreren, sehr gut aufgebauten Studien durch Becker untersucht. Die Untersuchungsergebnisse zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen 125 den wichtigsten Faktoren, die die seelische Gesundheit eines Menschen ausmachen, und dem Maß an körperlicher Gesundheit. Ein offensichtlich sehr wichtiger Faktor für die seelische Gesundheit eines Menschen ist die Fähigkeit, Vertrauen in andere Menschen, in sich selbst und in die Zukunft zu entwickeln. Becker zeigte in mehreren Studien, daß die "vertrauensvolloptimistische Einstellung" eines Menschen hoch signifikant mit der habituellen Gesundheit derselben Person korreliert. (Becker, 1993, S. 58) Der Autor kommt zum Ergebnis, daß sich Vertrauen, das zu den "tragenden Säulen des menschlichen Zusammenlebens gehört", als Schutzfaktor gegen körperliche Erkrankungen erweist. An einer Stichprobe von 900 erwachsenen Personen konnte gezeigt werden, daß diejenigen Personen die höchste körperliche Gesundheit aufwiesen, die ein hohes Maß an seelischer Gesundheit und ebenso hohe Werte auf der Vertrauenskala zeigten. (Becker, 1993) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in den letzten 10 Jahren der Psychoneuroimmunologieforschung einige gut fundierte Untersuchungen in bezug auf die positive Modifikation des Immunsystems erstellt wurden. Die klinischen Studien zeigen, daß die medizinische Betreuung einer schweren Erkrankung selbstverständlich unersetzbar ist. Offensichtlich gibt es jedoch auch andere Kriterien für eine Genesung. Im Blick auf die oben genauer dargestellten klinischen Forschungsergebnissen wird deutlich, daß folgende psychische Faktoren eine gesunde Immunfunktion und dadurch die Wahrscheinlichkeit einer endogenen Krankheitsbekämpfung erhöhen: – aktive Copingstrategien in bezug auf die Erkrankung – Widerstand gegen veränderbare destruktive Lebensumstände – kreatives Tun und Denken – die Fähigkeit zur Selbstbestimmung (Gegenpol: Fremdbestimmung) – die Fähigkeit, sich im Leben Ziele zu setzen und sich für diese zu engagieren (Sinn- und 126 Wertorientierung) – die Fähigkeit zu einer autonomen Lebensführung – die Fähigkeit, angesichts einer bedrohlichen Erkrankung das eigene Leben nicht aufzugeben, sondern die Krankheit als eine Herausforderung anzusehen ("Sinn-Botschaft") – die Fähigkeit, das Leben zumindest zeitweise auch von der humorvollen Seite wahrzunehmen – die Fähigkeit, positive soziale Beziehungen zu pflegen – die Möglichkeit, dasjenige Leben zu führen, zu dem man sagen kann: "Das ist mein Leben." Außerdem verändern folgende Techniken das Immunsystem biochemisch meßbar: – Entspannungstechniken – Visualisierungstechniken – Positive Konditionierung. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß die Annahme, es gäbe ein autonom funktionierendes Immunsystem, überholt ist. Auch künftige psychoneuroimmunologische Forschung wird dies mit Sicherheit bestätigen. Und offensichtlich gibt es neben den biologischen, genetischen, sozialen und Umweltfaktoren auch den "Faktor Psyche", der im Gesundheits- oder Krankheitsgeschehen einer Person eine wichtige Rolle spielt. Welche Rolle der Faktor Psyche spielt, ist noch nicht lückenlos geklärt. Eine Herausforderung für künftige Wissenschaftler! 127 7. Eigene Untersuchungen 7.1 Einleitung Wie im Kap. 2 beschrieben, verfolgt die vorliegende Arbeit drei Ziele: – sie stellt den Aufbau und die Funktion des Immunsystems so dar, daß beides von Psychologen und Nicht-Immunologen gut verstanden werden kann; – sie greift aus einer großen Anzahl von immunologischen Studien diejenigen heraus, die methodisch exakt durchgeführt wurden und bedeutende Erkenntnisse über die nichtmedikamentöse Immunmodulation enthalten; – sie unternimmt den Versuch, durch eigene immunologische Experimente die psychoneuroimmunologische Forschung um weitere Erkenntnisse zu bereichern. In diesem Kapitel geht es um das letzte Anliegen. In Hinblick auf die bisherigen Studien und Erkenntnisse stellen sich nun zwei Fragen, deren Beantwortung nur experimentell möglich ist: A. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse von Dillon et al. (1985-86) wissen wir, daß das Lachen, ausgelöst z.B. durch einen humorvollen Videofilm, eine Zunahme des sekretorischen IgA-Gehalts verursacht. Das Immunsystem kann demzufolge durch positive Emotionen, wie durch das Lachen, stimuliert werden. Betrachten wir jedoch die Untersuchungen, die den Einfluß von kurzfristigem Distreß überprüfen, so treffen wir sowohl auf Immunstimulierung als auch auf Immunsuppression. (Glaser et al. 1991; Schedlowski, 1994; Bliemeister et al., 1992) Das Immunsystem kann demnach durch kurzfristige negative Emotionen sowohl stimuliert wie auch gedämpft werden. Die entsprechenden Untersuchungen sind jedoch an jeweils anderen Personengruppen durchgeführt worden. Das heißt, die Immunforscher untersuchten entweder, wie Probanden auf positive Emotionen reagieren, oder sie untersuchten, wie andere Probanden auf negative Emotionen immunologisch antworteten. 128 Interessant ist jedoch die Frage, wie dieselbe Person auf positive bzw. kurzfristig negative Emotionen immunologisch antwortet. (Wie im Kap. 6 erwähnt, gibt es gravierende Unterschiede zwischen kurzfristigen und langfristigen Streßreaktionen.) B. Die zweite Fragestellung ist differentialpsychologischer Art. Man kann natürlich im Rahmen experimenteller Untersuchungen Versuchspersonen verschiedenen Reizen bzw. Außenbedingungen aussetzen und dann die immunologischen Veränderungen dieser Personen wahrnehmen. In diesem Falle stellen wir eine einfache lineare Beziehung (Ursache-Wirkung) dar. Viel interessanter wird die Frage nach der Wirkung jedoch dann, wenn wir auch einen dritten Faktor in Betracht ziehen, nämlich die Persönlichkeit unserer Probanden. In dieser Hinsicht wäre es der oben erwähnten ersten Fragestellung zufolge interessant zu wissen, ob positive Emotionen, wie z.B. das Lachen, oder negative Emotionen, wie z.B. die Furcht, bei allen Personen eine ähnliche Immunmodulation auslösen oder ob wir hierbei auf interindividuelle, statistisch signifikante Unterschiede stoßen. 7.2 Theoretische Grundlagen zu den Fragestellungen Da es in diesem Teil der Arbeit um die Frage geht, welche immunologischen Reaktionen durch starke Gefühle eines Probanden ausgelöst werden, sollte man sich zunächst mit dem Begriff Emotion befassen. Im Duden-Fremdwörterbuch (1982) wird "Emotion" als "Gemütsbewegung, seelische Erregung, Gefühlszustand" definiert. Gefühle wie Trauer, Freude, Angst oder Wut brauchen immer einen Auslöser (z.B. den Anblick eines Bekannten), eine Bewertung (z.B. positive oder negative Erinnerung an diesen Menschen) und eine körperliche Aktivitätsveränderung (z.B. erhöhte Gehirnaktivität, veränderten Pulsschlag, veränderte Hormonausschüttung). Die frühen Emotionsforscher wie zum Beispiel James und Lange betrachteten die Gefühle eines Menschen als Ausdruck somatischer Prozesse, die durch entsprechende Rezepto- 129 ren in nervöse Erregung verwandelt werden, um als "Gefühlsregung" von einer Person wahrgenommen zu werden. (Guttmann, 1982) Auch wenn diese Theorie in ihrer Einseitigkeit nicht mehr haltbar ist, sollten wir zur Kenntnis nehmen, daß Gefühle nur dann als solche von einer Person wahrgenommen werden, wenn eine physiologische Reaktion bei der jeweiligen Person vorhanden ist. "Psychopathen", also Menschen ohne Fähigkeit zu Fürsorge oder Mitleid und ohne Einfühlungsvermögen, sind ohne weiteres dazu fähig, anderen Menschen tiefes Leid, einen tiefen Schmerz zuzufügen. Aufgrund psychologischer Untersuchungen an Psychopathen, die mehrmals gemordet haben, ist festzustellen, daß diese Menschen durch Medieninhalte und Lebensgeschichten, die normalerweise normale Beobachter zu Mitleid, Trauer und Empathie "bewegen", nicht berührt werden. Sie haben diesbezüglich keine Emotionen. Und im Rahmen gehirnphysiologischer Meßuntersuchungen wurde festgestellt, daß Gehirnregionen, die bei nichtkriminellen Personen starke physiologische Veränderungen aufwiesen, bei diesen Menschen "kalt", d.h. erregungslos blieben. (ORF2, 22.08.1997) Die Gehirnregionen, in denen sich Emotionen "abbilden", werden unter dem Begriff des limbischen Systems zusammengefaßt. Das System, das einen Ring (limbus = Besatz, Saum) um das Stammhirn bildet, besteht aus phylogenetisch wesentlich älteren Hirnanteilen als die Großhirnrinde (Cortex), die das Denken steuert. Das limbische System besteht aus den wichtigen Vorderhirnanteilen wie gyrus dentatus, gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, induseum griseum und hippocampus. (Snyder, 1990) Da das limbische System in der unmittelbaren Nähe des Stammhirns liegt, das die physiologischen Reaktionen des Organismus steuert wie Atmung und Herzschlag, und da es gleichzeitig mit dem gesamten Nerven- und Hormonsystem in Verbindung steht, ist verstehbar, daß Emotionen einen ganzkörperlichen Prozeß darstellen. Ohne eine physiologische Veränderung gibt es demnach keine Emotionen. Dennoch "machen" die physiologischen Veränderungen die Qualität der Gefühle nicht aus, sie sind 130 lediglich ihre Grundlage. Ob eine starke Erregung wie Wut, Freude oder Enttäuschung erlebt wird, darüber entscheidet die kognitive Bewertung einer Person. Denn auch der Cortex, also die Großhirnrinde eines Menschen, steht in einer dichten neuronalen Kommunikation mit dem limbischen System. Die bekanntesten Vertreter dieser "Zweikomponententheorie" sind Singer und Schachter (1962), die durch ein originell aufgebautes Experiment zeigen konnten, daß das gleiche erhöhte Erregungsniveau von der einen Person als extreme Wut und von einer anderen als extremer Spaß interpretiert werden kann. Die Funktion der Großhirnrinde (logisches Denken, Kreativität, Bewertung einer Situation) ist demzufolge für die Entstehung emotionaler Prozesse ebenso wichtig wie seine physiologische Grundlage. Für das Zustandekommen von Emotionen gibt es demzufolge zwei Möglichkeiten. Entweder bewertet eine Person eine Situation z.B. als stark negativ und diese verursacht eine starke körperliche Reaktion, die in diesem Falle als Wut empfunden werden könnte, oder es kommt durch endogene Veränderungen, z.B. durch eine Hormonveränderung, zu einer körperlichen Veränderung und diese wird von der betroffenen Person je nach kognitiver Bewertung als Ärger, Freude oder Trauer interpretiert. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Emotionen durch drei Komponenten bedingt sind: – sie brauchen einen exogenen oder endogenen Auslöser, – sie sind an eine körperliche Aktivitätsveränderung gebunden, – sie werden im Zuge eines kognitiven Bewertungsprozesses bzgl. ihrer Qualität interpretiert. Im Zusammenhang des hier darzustellenden Experimentes werden die immunologischen Auswirkungen von zwei Emotionen untersucht: 1. Freude 2. Angst. 131 Als exogenen Auslöser nehmen wir zwei Videofilme, die entweder Freude (Lachen) oder Angst verursachen sollen. In der psychologischen Forschung wird zwischen den Begriffen "Angst" und "Furcht" genau unterschieden: als "Angst" wird ein Gefühl bezeichnet, das nicht durch eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Objekt verursacht wird, sondern sozusagen "frei flottierend" ist. Furcht hingegen wird durch ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situation ausgelöst. Da in dieser Arbeit der Videofilm als Auslöser gebraucht wird, müßten wir definitionsgemäß von Furcht reden. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist jedoch der Begriff der Angst geläufiger. Und auch die Versuchspersonen werden bzgl. ihrer "Angst" befragt. Deshalb bezeichnen wir in dieser Arbeit die objektgebundene Furcht mit dem Begriff der Angst. Als Auslöser für die emotionale Veränderung verwenden wir im Rahmen unseres Experimentes zwei Medien, nämlich einen humorvollen und einen angsterregenden Videofilm. Da in den letzten 20 Jahren im Bereich der Medienpsychologie eine große Diskussion zu den manipulativen Möglichkeiten der Medien geführt wurde, sollten wir uns kurz mit den Theorien bzgl. der Wirkung der Massenmedien befassen. Die Katharsisthese besagt, daß gefühlserregende Medieninhalte, wie zum Beispiel Aggressionen am Bildschirm, das Ausleben von eigenen, nicht erfüllbaren oder aufgestauten Gefühlen in den Probanden auslösen. Dieser Theorie zufolge, die auch von dem berühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz vertreten wurde, befreien Aggressionen, die am Bildschirm erlebt werden, von eigenen aggressiven Regungen, da diese als Energie während des Films ausgelebt und abgeführt werden. Übertrüge man die Katharsisthese auf andere Medieninhalte, so bedeutete dies, daß im Fernsehen gesendete Reiseberichte von der je eigenen Reiselust und ein emotionsgeladener Liebesfilm von der Sehnsucht nach Liebe befreiten. Obwohl die Katharsisthese aufgrund der Idee der Triebabfuhr sehr logisch erscheint und deshalb unmittelbar einleuchtet, konnte sie einer exakten Nachprüfung weder im Bereich der Aggres- 132 sionsforschung noch im Bereich der Suizidforschung standhalten. (Kunzik, 1975; Hadinger, 1994) Die Inhibitionsthese besagt, daß extreme Gefühlsdarstellungen in den Massenmedien, vor allem wenn sie negativer Art sind, gegenteilige Gefühle im Probanden bewirken. Aggressive Medieninhalte bewirken demnach, daß ursprünglich aggressive Gefühle im Probanden gehemmt werden und stattdessen Angst entsteht. Auch diese Theorie ist nur im Blick auf bestimmte Situationen haltbar und kann nicht als allgemeingültige Erklärung angenommen werden. Die Stimulationsthese bildet das Gegenteil zur kathartischen Triebminderungsthese. Sie besagt, daß stark gefühlsanregende Medieninhalte die Stimulation derselben Gefühlsregungen in den Rezipienten bewirken. (Kagelmann und Wenninger, 1982) Demnach regen aggressive Medieninhalte die Zuschauer zu vermehrter Aggression an. Dementsprechend müßten depressive Medieninhalte die Depressivität der Probanden steigern. In zahlreichen Untersuchungen, die die Stimulationsthese überprüfen, finden wir sowohl Bestätigungen als auch Widerlegungen dieser Idee. Die Habitualisierungsthese besagt, daß sehr häufiger Medienkonsum eine Abstumpfung in der Gefühlswelt der Rezipienten bewirkt. Demnach werden durch ständigen Fernsehkonsum Verhaltensweisen, die außerhalb des Normbereichs liegen, z.B. brutales Verhalten, als normales Alltagsverhalten angesehen. Dieser Theorie zufolge würden Probanden, die häufig gewalttätige Medieninhalte konsumieren, Gewalt im Zusammenhang ihres alltäglichen Lebens als ein natürliches Problemlösungsverhalten betrachten. Auch wenn gelegentliche sozialpsychologische Beobachtungen an kriminellen Jugendlichen fallweise für diese Theorie sprechen, konnte eine Langzeitstudie jedoch keine statistisch relevante Bestätigung erbringen. (Belson, 1978) Zusätzlich zu diesen vier Theorien gibt es die Hypothese diesbezüglicher Wirkungs- 133 losigkeit. Sie besagt, daß stark emotionsanregende Medieninhalte nur kurzfristige Erregung verursachen und ansonsten wirkungslos bleiben. Und es gibt die lerntheoretische Hypothese, die besagt, daß am Bildschirm vorgelebte Medieninhalte den Zuschauern anregen, sie im alltäglichen Leben nachzuahmen. Für fast alle diese Theorien gibt es zahlreiche experimentelle Belege. Ebenso häufig findet man jedoch auch experimentelle Widerlegungen derselben Theorien. Dies liegt vorrangig an der Qualität der Studien, die nicht immer als Feldstudien durchgeführt wurden und dadurch lediglich eine spezifische Laborsituation widerspiegeln. Darüber hinaus liegen die widersprüchlichen Ergebnisse am unterschiedlichen Gebrauch von Begriffen. Im "Puppenexperiment" von Bandura (1979) z.B. wird das Zuschlagen der Kinder als Aggression interpretiert, während Kunczik dasselbe als "intensives Spielverhalten" (1982) versteht. Abgesehen von kleineren Untersuchungsfehlern stellen im Bereich der Wirkungsforschung der Massenmedien die individuellen Unterschiede wesentlich größere Störfaktoren dar, als da sind: die verschiedenen kulturellen Umfelder, Sozialisationsstile und Persönlichkeitsfaktoren. Auf diesen wichtigen Sachverhalt wies der Wiener Universitätsprofessor Vitouch hin. (Vitouch, 1982) Wir können, so Vitouch, in der Medienpsychologie nicht einfach "trivialisierende lineare Beziehungen" herstellen, sondern müssen auf eine "differenzierte Wechselwirkung zwischen Individuum und Massenmedium" sehen. (Vitouch, 1982, S. 33) Dies würde bedeuten, daß Untersuchungsergebnisse im Bereich der massenmedialen Emotionsforschung erst dann aussagekräftig würden, wenn man, neben dem Faktor "Medieninhalt", auch andere Faktoren, wie z.B. Persönlichkeit, kulturelles Umfeld oder Sozialisation, berücksichtigen würde. Im Bereich der Aggressionsforschung würde das beispielsweise bedeuten, daß aggressive Medieninhalte die Aggressionsbereitschaft der Zuschauer förderten, sofern diese Personen auch selber durch eine erhöhte Aggressionsbereitschaft gekennzeichnet wären. Derselbe Medieninhalt würde demnach bei ängstlich veranlagten Personen nicht Ag- 134 gression, sondern Angst auslösen. Im Zusammenhang des von mir durchgeführten Experimentes ist die differentialpsychologische These von Vitouch wesentlich. In diesem Experiment wird die Veränderung des IgA-Gehalts bei Probanden untersucht, die einen humorvollen bzw. angsterregenden Videofilm ansehen. Darüber hinaus stellt sich in Anlehnung an die oben genannten Theorie die Frage, ob humorvolle Menschen eventuell auch immunologisch anders auf humorvolle Medieninhalte reagieren als weniger humorvolle. Und ob ängstliche Personen nicht auch immunologisch anders auf angsterregende Medieninhalte reagieren als weniger ängstliche. 7.3 Präzisierung der Fragestellung Im experimentellen Teil dieser Arbeit sollen zwei Fragen beantwortet werden: A. Aus den Untersuchungen Dillons (1985-86) wissen wir, daß ein Videofilm, der aufgrund seines humorvollen Inhalts die Zuschauer zum Lachen anregt, die Stimulierung des Immunsystems in Form von vermehrter IgA-Ausschüttung im Speichel bewirkt. Es stellt sich nun die Frage, ob ein angsterregender Videofilm bei denselben Probanden ebenso zu einer Veränderung der IgA-Konzentration führt. Und wenn ja, ob die kurzfristige Angst immunstimulierend wirkt, indem die IgA-Konzentration steigt, oder immunsupprimierend, indem sich die IgA-Konzentration vermindert. B. Im Rahmen der zweiten Fragestellung wird die differentialpsychologische These Vitouchs (1982) auf immunologischer Ebene untersucht. Die Frage ist, ob humorvolle Personen immunologisch anders auf einen humorvollen Videofilm reagieren als weniger humorvolle und ob ängstliche Personen immunologisch anders auf einen angstauslösenden Videofilm reagieren als weniger ängstliche. Und wenn ja, in welche Richtung die Unterschiede gehen. Reagieren humorvolle Personen mit einer stärkeren oder einer schwächeren Immunantwort 135 auf Humor, bzw. reagieren ängstliche Personen mit einer stärkeren oder schwächeren Immunantwort auf Angstauslöser? 7.4 Hypothesen H0. Personen, die einen humorvollen bzw. angsterregenden Videofilm ansehen (VG), unterscheiden sich nachher immunologisch nicht von denjenigen Personen, die einen neutralen Film betrachten (KG). H1. Personen, die einen humorvollen Film ansehen, unterscheiden sich nachher in bezug auf ihre IgA-Konzentration statistisch signifikant von der Kontrollgruppe. H2. Personen, die einen angsterregenden Film ansehen, unterscheiden sich nachher in bezug auf ihre IgA-Konzentration statistisch signifikant von der Kontrollgruppe. H3. Die immunologische Reaktion humorvoller Personen unterscheidet sich statistisch signifikant von der immunologischen Reaktion weniger humorvoller Personen. H4. Die immunologische Reaktion ängstlicher Personen unterscheidet sich statistisch signifikant von der immunologischen Reaktion wenig humorvoller Personen. 7.5 Meßinstrumente 7.5.1 Bestimmung der Immunparameter Für die immunologische Untersuchung wurde die Methode der radialen Immundiffusion zur Bestimmung der IgA-Werte im Speichel gewählt. Das Immunglobulin Alpha (IgA) kommt im menschlichen Schleimhautsystem, das alle unsere Körperöffnungen umhüllt, besonders kon- 136 zentriert vor. Es hat die Aufgabe, sich an Krankheitserreger oder andere Fremdeiweiße, die durch die Körperöffnungen in den Körper gelangen wollen, zu binden. Ein Antigen, z.B. ein Schnupfenvirus, wird innerhalb weniger Sekunden, nachdem es in unsere Nasenöffnung gelangt, von unzähligen IgA-Molekülen umgeben und von diesen an sämtlichen Bindungsstellen besetzt. Dadurch bildet der IgA-Viruskomplex einen sogenannten Klumpen, der die Nasenschleimhaut soweit reizt, daß der allfällig bekannte Niesreiz entsteht, wodurch der IgAViruskomplex aus dem Körper hinausbefördert wird. Eine weitere immunologische Funktion von IgA besteht darin, daß es Fremdeiweiße als verdaubar für die Freßzellen markiert. Einige weitere Immunfunktionen von IgA wurden bereits in Kap. 4.4 und 4.5 beschrieben. Die Bestimmung des IgA-Gehalts im Speichel läßt sich ohne eine aufwendige Blutuntersuchung durchführen und kann demzufolge auch dann angewendet werden, wenn für ein Experiment eine größere Versuchsgruppe zur Verfügung steht bzw. wenn bei einem Experiment die Durchführung einer aufwendigen Laboruntersuchung nicht möglich ist. Für die Bestimmung der IgA-Werte wurden von der Firma Behring "LC-Partigen-IgA"Immundiffusionsplatten erworben. Die Immundiffusionsplatten sind flache, durchsichtige, runde Dosen mit etwa 9 cm Durchmesser (siehe Abb. 20). Abbildung 20 Im Inneren dieser Dosen befindet sich eine dünne, durchsichtige Gelschicht. Diese besteht aus einem Anti-Human-IgA-Serum. Wird auf die Gelschicht Human-IgA aufgetragen, so bindet sich dieses an das Anti-IgA-Serum auf der Platte. Die Bindung wird durch eine farbliche Veränderung sichtbar: An den Stellen, an denen Speichelproben auf die Gelschicht aufgetropft 137 wurden, entstehen weißfarbene Kreise. Je größer der Durchmesser der Kreise, umso mehr IgA konnte sich an das Anti-IgA binden. Das heißt: je größer der Durchmesser der Kreise, umso mehr IgA ist in der Speichelprobe des Probanden vorhanden. Damit die Speichelprobemengen aller Probanden miteinander übereinstimmen, verwendet man eine spezielle Pipette: den Behring-Dispenser, der durch hauchdünne, auswechselbare Glasnadeln exakt 0,02 ml (20 Mikroliter) Flüssigkeit aufnehmen kann. Der durch die dünne Nadeln aufgenommene Speichel wird auf die markierten Stellen der Platte aufgetragen. Die runden Platten werden anschließend etwa 15 Min. lang offen liegengelassen und dann 3 Tage lang verschlossen aufbewahrt. Nach 2-3 Tagen bilden sich an den Applikationsstellen die vorhin beschriebenen, weißlichen Kreise. Mit einem speziellen Meßlineal und einer Meßlupe kann man nun den Durchmesser der Kreise auf 0,1 mm genau ablesen. Der Millimeterdurchmesser kann durch einen besonderen Rechnungsschlüssel in IgA-Mikrogrammenge umgerechnet werden. Diese Rechnungsform ist für ein klinisch-diagnostisches Verfahren notwendig, jedoch nicht für unser Experiment. Im hier beschriebenen Experiment sind die IgA-Veränderungswerte von Bedeutung, die Meßangaben werden deshalb nicht in Milligramm, sondern in Millimeter angegeben. Die Auswertungsergebnisse beziehen sich auf die Durchmesser der Immundiffusionskreise. 7.5.2 Erfassung der Persönlichkeitskategorien "humorvoll" und "ängstlich" Die Versuchspersonen waren seit zwei Jahren Schüler einer berufsbildenden Schule und kannten einander seit dieser Zeit. Für unsere Untersuchung wurden die Teilnehmer von 3 Berufsschulklassen ausgesucht. Da wir die Erfassung der Persönlichkeit nicht durch einen leicht durchschaubaren und verfälschbaren Fragebogen erzielen wollten, machten wir die zweijährige Ausbildungszeit der Teilnehmer uns zunutze: Wir stellten für jeden der 3 Ausbildungsklassen ein 4köpfiges Team zusammen, das jeweils aus zwei Berufsschullehrern und zwei 138 Berufsschülern bestand. Die 3 Teams wurden ersucht, sich miteinander zu beraten und aus jeder Berufsschulklasse die 5 humorvollsten und die 5 ängstlichsten Teilnehmer zu benennen. Gleichzeitig wurden die Berufsschüler (Alter 18-43 J.) ersucht, sich in bezug auf ihre Fähigkeit, humorvoll zu sein, bzw. in bezug auf ihre Ängstlichkeit selber einzuschätzen. Die erste Frage lautete: "Wenn ich mich im Blick auf meine Lebenseinstellung, Konfliktlösungsfähigkeit und mein Alltagsverhalten einschätze, dann halte ich mich für eine humorvolle Person." Es gab fünf Antwortmöglichkeiten: stimmt nicht unentschieden stimmt wenig stimmt mittel stimmt stark Ebenso wurde die Selbsteinschätzung in bezug auf die Ängstlichkeit erhoben: "Wenn ich mich im Blick auf meine Lebenseinstellung, Konfliktlösungsfähigkeit und mein Alltagsverhalten einschätze, dann halte ich mich für eine ängstliche Person." Bei dieser Frage gab es die gleichen fünf Antwortmöglichkeiten. Als Personen mit viel Humor bzw. mit hoher Ängstlichkeit wurden diejenigen Teilnehmer ausgewählt, die vom Viererteam als humorvolle bzw. ängstliche Personen genannt wurden und die sich selber auch als eher humorvolle bzw. eher ängstliche Personen einschätzten. So entsprach das Versuchsdesign den beiden wichtigen Kategorien "Selbstbeurteilung" und "Fremdbeurteilung". Für unsere Untersuchung konnten wir insgesamt 11 Personen gewinnen, die als "humorvoll" eingestuft wurden, und 10 Personen, die als "ängstlich" beurteilt waren. 7.5.3. Emotionsauslöser Als Instrument zur Auslösung von humorvollen bzw. ängstlichen Emotionen verwendeten wir 139 zwei Videofilme: "Ein seltsames Paar" zur Auslösung von Lachen bzw. "Jurassic Park" zur Angstauslösung. Beide Filme wurden im Vortest von Testpersonen als "lustig" bzw. als "angsterregend" eingestuft. Für die Kontrollgruppe wurde ein etwa gleichlanger Sachfilm über die Holz- und Papierverarbeitung in der Steiermark gezeigt. 7.6 Versuchsplan und Durchführung Der Versuch wurde "verdeckt" durchgeführt, d.h., die getesteten Personen wurden erst nach der Untersuchung über die Untersuchung selbst und ihren Sinn aufgeklärt. Die drei Berufsschulklassen wurden nicht vorinformiert, damit die Testergebnisse nicht verfälscht werden konnten. Der erste Film, "Ein seltsames Paar", wurde während des regulären Unterrichts eingeblendet. Da der Unterricht in den Berufsschulen ganztägig stattfindet, kommt es immer wieder vor, daß der Unterricht mit Filmen bzw. Musik aufgelockert wird. Erst einige Minuten vor dem Film teilte ein Sprachlehrer den Klassenteilnehmern mit, daß er gerne Speichelproben von ihnen abnehmen würde, mit der kurzen Information, daß diese Proben für die Bestimmung von Schnupfenviren-Abwehrkörper gebraucht werden. Über die zweite Testung, die nach dem Film erfolgen sollte, sagte er noch nichts. Die Speichelproben wurden in kleinen Kunststoffbehältern eingesammelt und mit den Namen der Testpersonen versehen. Anschließend wurden die Proben mit dem speziellen Behring-Dispenser auf die radialen Immundiffusionsplatten appliziert und jeweils mit einer Nummer versehen. Da diese Studie als Blindstudie geführt wurde, fand die spätere Auswertungsleiterin keine Namen mehr auf den Proben, lediglich eine Nummer, die nur durch die erste Versuchsleiterin den einzelnen Versuchspersonen zugeordnet werden konnte. Nach der Vorführung des Films wurden die Berufsschüler noch einmal (unerwartet) ersucht, Speichelproben abzugeben, die man wiederum nach der oben beschriebenen Methode 140 auf die IgA-Immundiffusionsplatte applizierte. Zwei Wochen nach der ersten Untersuchung wurde die Testung wiederholt, dann jedoch mit dem Film "Jurassic Park". Wieder wurden Speichelproben vor und nach dem Film abgenommen und diesen sodann eine Nummer zugeordnet. Das Abmessen der Immundiffusionskreise (siehe Abb. 20) erfolgte drei Tage nach der Testung durch die Auswertungsleiterin. Diese konnte lediglich die Größe der Kreise den zugehörigen Zahlen zuordnen. Sie wußte weder vom zugehörigen Filminhalt noch kannte sie die zugehörigen Versuchspersonen. Aufgrund dieses Untersuchungsdesigns ist das Experiment als Blindstudie einzustufen. Ursprünglich hatten wir 76 Versuchspersonen für die Testung erfaßt. Wir werteten jedoch nur die Testergebnisse derjenigen Versuchspersonen aus, die an beiden Testreihen teilnahmen, noch keinen der beiden Filme kannten und nicht an einer akuten Erkrankung litten. Der Ausschluß aus Krankheitsgründen war nötig, um eine krankheitsbedingte Beeinflussung der IgA-Werte zu verhindern. Im Blick auf diese drei notwendigen Versuchskriterien konnten wir die Meßwerte von 62 Versuchspersonen für die Auswertung aufnehmen. Etwa eine Woche nach der letzten Filmtestung wurden die Berufsschüler im Blick auf ihren Humor und ihre Ängstlichkeit befragt. Nach der Auswertung der Meßergebnisse informierten wir die Testpersonen über den Versuch und über die Untersuchungsergebnisse. Die Kontrollgruppe (N=31) bildeten wir aus einer großen Klasse derselben Berufsschule. Diese Gruppe sah sich, wie oben erwähnt, einen Sachfilm über die Papier- und Holzverarbeitung in der Steiermark an. Die Speichelproben der Kontrollgruppe wurden auf die gleiche Weise wie die Speichelproben der Versuchsgruppe gewonnen und ausgewertet. Insgesamt haben wir 4mal den Speichel-IgA-Gehalt von 107 Personen getestet. Zur Auswertung standen uns nach Berücksichtigung von Störvariablen die Testergebnisse von 93 Personen zur Verfügung (62 Personen für die Versuchsgruppe und 31 Personen für die Kon- 141 trollgruppe). 7.7 Auswertung Für die Auswertung erstellten wir eine numerierte Tabelle, in welche die IgA-Meßwerte der Versuchsgruppe (vor und nach dem humorvollen bzw. vor und nach dem angsterregenden Film) eingetragen wurden. Ebenso wurde eine Auswertungstabelle für die Kontrollgruppe erstellt, in die wir die IgA-Werte vor und nach dem Sachfilm eintrugen. Für unsere Untersuchung verglichen wir folgende Meßdaten: – die IgA-Werte der Versuchsgruppe vor und nach dem humorvollen Film (N=62) – die IgA-Werte der Versuchsgruppe vor und nach dem angsterregenden Film (N=62) – die IgA-Werte der Kontrollgruppe vor und nach dem Sachfilm (N=31) – die IgA-Werte der "sehr humorvollen" Personen (N=11) im Vergleich mit der restlichen Versuchsgruppe (N=52) vor und nach dem humorvollen Film – die IgA-Werte der "sehr ängstlichen" Personen (N=10) im Vergleich mit der restlichen Versuchsgruppe (N=52) vor und nach dem angsterregenden Film. Als statistisches Meßverfahren verwendeten wir den t-Test. 7.8 Ergebnisse t-Test für abhängige Stichproben (Alpha=5%): a) Nach dem Ansehen des humorvollen Films veränderte sich der IgA-Gehalt der Probanden signifikant. Nach dem humorvollen Film wiesen die Testpersonen einen signifikant höheren IgA-Gehalt auf als vorher. IgA-Mittelwerte: vorher 8.0 nachher 8.7 t-Wert: -10,55 sign. Niveau: p<0.000 signifikant 142 b) Nach dem Ansehen des angsterregenden Films veränderte sich der IgA-Gehalt der Probanden ebenfalls signifikant: Nach dem angsterregenden Film wiesen die Versuchspersonen einen signifikant höheren IgA-Gehalt auf als vorher. IgA-Mittelwerte: vorher 8.1 nachher 9.5 t-Wert: -10,34 sign. Niveau: p<0.000 signifikant c) Nach dem Ansehen des Sachfilms veränderte sich der IgA-Gehalt der Probanden nicht signifikant. IgA-Mittelwerte: vorher 8.5 nachher 8.5 t-Wert: 0.25 sign. Niveau: p=0.804 nicht signifikant d) Nach dem angsterregenden Film fand eine signifikant höhere IgA-Ausschüttung statt als nach dem humorvollen Film. Mittlere Differenz nach dem humorvollen Film: 0.8 Mittlere Differenz nach dem angsterregenden Film: 1.4 t-Wert: 4.67 sign. Niveau: p<0.000 signifikant e) Die 11 humorvollsten Personen reagierten mit einer stärkeren IgA-Ausschüttung auf humorvolle Filminhalte als der Rest der Versuchsgruppe (N=52). Mittlere Differenz der humorvollen Personen: 1.5 Mittlere Differenz der restlichen Versuchspersonen: 0.6 t-Wert: 5.82 sign. Niveau: p<0.000 signifikant f) Die 10 ängstlichsten Versuchspersonen reagierten mit einer stärkeren IgA-Ausschüttung auf angsterregende Filminhalte als der Rest der Versuchsgruppe (N=52). Mittlere Differenz der ängstlichen Personen: 2.6 Mittlere Differenz der restlichen Versuchspersonen: 1.2 143 t-Wert: 4.39 sign. Niveau: p<0.000 Abbildung 21 stellt die mittleren IgA-Werte der einzelnen Versuchsgruppen vor und nach der Filmprojektion anschaulich dar. Aus der Abbildung ist gut ersichtlich, daß die IgAAusschüttung der Probanden nach dem angsterregenden Film stärker war als nach dem humorvollen Film. Abbildung 21 Abbildung 22 zeigt die Reaktion der "besonders humorvollen" Personen und die Reaktion der restlichen Versuchspersonen nach dem humorvollen Film. Abbildung 22 Abbildung 23 zeigt die Reaktion der "besonders ängstlichen" Personen und die Reaktion der restlichen Versuchspersonen nach dem angsterregenden Film. Abbildung 23 144 7.9 Beantwortung der Hypothesen H0 nicht bestätigt H1 sign. bestätigt (Alpha 5%) H2 sign. bestätigt (Alpha 5%) H3 sign. bestätigt (Alpha 5%) H4 sign. bestätigt (Alpha 5%) 7.10 Interpretation der Ergebnisse, Konsequenzen Offensichtlich sind starke Emotionen, in diesem Experiment ausgelöst durch zwei Videofilme, in der Lage, eine objektiv meßbare, statistisch signifikante immunologische Veränderung in den Rezipienten zu bewirken. Interessant ist, daß starke Emotionen, gleich ob negativ (Angst) oder positiv (Freude) eine vermehrte IgA-Ausschüttung bei den Probanden verursachten. Das Lachen regt das Immunsystem zu einer vermehrten immunologischen Reaktion an, aber kurzfristige Angstzustände tun dies noch viel mehr! Diese Reaktion führte zur überraschendsten Erkenntnis während unserer Untersuchung. Offensichtlich ist unser Organismus gegenüber unvermeidbaren Außenreizen exzellent gerüstet. Denn Angst gehört zu unserem Leben, und auch die besten Lebensumstände vermögen es nicht, dem Menschen einen angstfreien Raum zu schaffen. Für das Immunsystem hat eine (kurzfristige) Angstsituation anregende Wirkung. Somit nützt die Natur vermeintlich negative Phänomene und stellt sie in ihren Dienst. Entwicklungsgeschichtlich ist folgende Erklärung dieses Phänomens naheliegend. Ein Lebewesen, das in eine Angstsituation geriet, war früher immer in Gefahr. Und in der Gefahrensituation gab es die in der Neuropsychologie längst bekannte Möglichkeit: "fight or flight". 145 Die physiologischen Konsequenzen, die durch den bekannten Streßzustand entstehen, unterstützen diese beiden lebenserhaltenden Möglichkeiten: der erhöhte Herzschlag, die verstärkte Muskeldurchblutung, der angehobene Blutzuckerspiegel, die rasche Atmung und die erhöhte Gehirnspannung bilden eine gute physiologische Voraussetzung für den Kampf gegen den Feind oder für die Flucht vor einem Stärkeren. Daß in der Angstsituation auch das Immunsystem stärker angeregt wird, erscheint nun logisch. Denn sowohl in der Situation des Kampfes als auch in der Situation des Flüchtens ist die Verletzungsgefahr eines Lebewesens höher als im Ruhezustand. Die Gefahr, daß Krankheitserreger bei einer eventuellen Verletzung in den Körper gelangen, muß dementsprechend durch eine stärkere Immunabwehr gebannt werden. Die aktivierte Reaktion des Immunsystems auf eine kurzfristige Angstsituation ist demzufolge eine logisch nachvollziehbare, physiologisch kluge Reaktion. Die humoralen Auslöser für die starke Immunreaktion sind wahrscheinlich die Hormone des Nebennierenmarks. Die hier erstellten immunologischen Untersuchungsergebnisse haben vor allem für die klinische Psychologie und für die psychosomatische Medizin große Bedeutung. Denn es ist allgemein bekannt, daß Patienten, die an einer schweren Krankheit leiden, panische Angst "vor der Angst" haben. Im Laienverständnis gilt nämlich, daß jegliche Angst zu einer Immunschwächung und dadurch zu einer Krankheitsbegünstigung führen kann. Gerade aufgrund dieser Befürchtung entsteht jedoch der eigentlich pathologische Zustand: Die ständige Angst vor der Angst verursacht einen chronischen Streßzustand, und dieser ist in der Tat pathogen. Die oben genannten Untersuchungsergebnisse sind demnach entlastend und zugleich leicht nachvollziehbar. Kurzfristige Angstzustände schwächen das Immunsystem nicht, viel eher stärken sie es. Wir könnten hier die von Cousins (1996) empfohlene seelische "Medizin" des täglichen Lachens um einen Punkt ergänzen: und etwa zweimal die Woche risikolos nachhaltig in Angst geraten. 146 Unsere Versuchspersonen reagierten persönlichkeitsbedingt unterschiedlich auf humorvolle bzw. angsterregende Medieninhalte. Ängstliche Personen zeigten eine stärkere immunologische Reaktion auf angstauslösende Medieninhalte als weniger ängstliche. Humorvolle Personen zeigten eine stärkere immunologische Reaktion auf humorvolle Medieninhalte als wenig humorvolle. Diese Beobachtung bestätigt die Annahme von Vitouch (1982, S. 33), wonach man die durch die Massenmedien verursachten Emotionen der Rezipienten nicht global betrachten darf, sondern immer unter Berücksichtigung der "Wechselwirkung zwischen Individuum und Massenmedium". Dies bedeutet, daß die Medienpsychologie die Rezipienten nur dann begreift, wenn sie von der einfachen Ursache-Wirkung-Theorie Abstand nimmt und in der Wirkungsforschung der Massenmedien nach zusätzlichen Variablen sucht. In dieser Perspektive wird verstehbar, daß die Erforschung der Massenmedien kaum die Möglichkeit hat, z.B. die verhaltensverändernde Wirkung von brutalen Medieninhalten an sich nachzuweisen. Denn die Rezipienten reagieren auf aggressive Medieninhalte individuell viel zu unterschiedlich, d.h. statistisch in einer Richtung nicht signifikant. Verlassen wir jedoch die einfache "Ursache-Wirkung-Ebene" und suchen wir auch hier nach zusätzlichen Bedingungen, dann können wir u.U. feststellen, daß brutale Medieninhalte zu aggressiven Handlungen führen, wenn der Medienkonsum zusätzlich an eine aggressive Persönlichkeit des Rezipienten und ein sozial aggressives Milieu gekoppelt ist. Derselbe Medieninhalt, dasselbe Milieu dürfte bei einer stark ängstlichen Persönlichkeit massive Ängste und u.U. sozialen Rückzug verursachen. An dieser Stelle ist noch eine zusätzliche Untersuchungsbeobachtung zu erwähnen. Verglichen wir die "sehr humorvollen" Personen (N=11) mit dem Rest aller Testpersonen (N=51), dann erhielten wir, wie oben erwähnt, einen signifikanten Unterschied. Wir wollten jedoch zusätzlich folgende Beobachtung machen: nämlich den Vergleich zwischen den humorvollsten (N=11) und den am wenigsten humorvollen (N=9) Personen. Der Unterschied 147 zwischen beiden Extremgruppen war ebenso signifikant. Offensichtlich reagierten die am wenigsten humorvollen Personen mit geringer immunologischer Veränderung und mit wenigen Emotionen auf den lustigen Film. Etwas anders jedoch die Reaktion auf den angsterregenden Film: Zwar war der Unterschied zwischen der Reaktion von ängstlichen Versuchspersonen und der Reaktion der restlichen Gruppe signifikant. Wir konnten jedoch keinen signifikanten Unterschied feststellen, wenn wir die Meßwerte der ängstlichsten Versuchspersonen mit den Meßwerten der mutigsten Personen verglichen. Gerade in dieser Gruppe gab es nach dem angsterregenden Film extrem große Unterschiede: Manche "mutige" Versuchspersonen reagierten sowohl emotional als auch immunologisch kaum wahrnehmbar auf den Film. Andere wiederum zeigten gleichstarke Veränderungen wie die stark ängstlichen Personen und gaben auch an, große Angst erlebt zu haben. Diese Beobachtung könnte mehrere Gründe haben: Es ist möglich, daß Menschen, die im normalen Leben mutig mit Problemen, Konflikten und Schwierigkeiten umgehen, Angst bei den auf der Leinwand dargestellten Brutalitäten, körperlichen Verletzungen, blutigen Verbrechensopfern und Gefahren verspüren. Diese künstliche Welt des Films stellt ja eine ganz andere Gefahrenquelle dar als die alltäglichen Lebensschwierigkeiten, die zu bewältigen die "Mutigen" kompetent sind. Aus der Kriminalpsychologie ist darüber hinaus bekannt, daß Menschen ganz unterschiedlich mit Bildern, die einen brutalen Inhalt haben, umgehen können: Manche werden von diesen kaum berührt und vergessen sie schnell. Andere Personen werden von den Bildern in einen massiven negativen Erregungszustand versetzt und können die Bilder oft jahrelang nicht loslassen. Diese Menschen haben ein ausgeprägtes Bildgedächtnis (Eidetiker). Es gibt jedoch eine zusätzliche Erklärungsmöglichkeit: Die "mutigen" Versuchspersonen, die sich während der Vorführung des Films jedoch sehr ängstigten, waren besonders aufgeweckte, wache Menschen. Dies wurde nicht nur aufgrund von Selbsteinschätzung, sondern 148 auch aufgrund der Einschätzung ihrer Lehrer bestätigt. Es könnte sein, daß hier das habituelle Aktivierungsniveau der Auslöser für die Angst ist. Wenn das habituelle Aktivierungsniveau dieser Personen im Alltag im oberen Normalbereich angesiedelt ist (daher die besondere Wachheit), dann wirkt eine zusätzliche Erregungsaktivierung hyperaktivierend. Dies verursacht die in der Neuropsychologie bekannte unangenehme Überaktivierung mit den Folgen des Schweißausbruchs, der Unruhe und der Angst. An dieser Stelle sind weitere, interessante Forschungen angezeigt. 7.11 Probleme bei der Durchführung, Kritik, abschließende Bemerkungen Schwierigkeiten bereitete uns der hohe Aufwand der Immuntestung. Da jede Versuchsperson 4mal getestet wurde und wir insgesamt 107 Testpersonen zur Verfügung hatten, war sowohl der finanzielle als auch der methodische Aufwand sehr groß. Ebenso schwierig war die Durchführung der Speichelapplikationen auf die IgA-Platte, als wir die große Kontrollpersonenzahl testeten (N=31). Hier mußten wir mit größter Sorgfalt mit den jeweils 31 Speichelbehältern hantieren, damit die Meßergebnisse korrekt erfaßt werden konnten. Darüber hinaus gab es eine Schwierigkeit bei der Projektion des angsterregenden Films ("Jurassic Park"). Ein etwa 40jähriger Teilnehmer mußte den Versuch abbrechen und den Saal augenblicklich verlassen, weil er Kreislaufstörungen bekam. Sein hoher Blutdruck wurde dann mittels eines Notsprays stabilisiert. Nachdem die Versuchspersonen über den eigentlichen Sinn der Untersuchung aufgeklärt wurden, erlebten wir eine große Zustimmung zum Versuch und großes Interesse daran. Für sie war es sehr wichtig, die Ergebnisse der Untersuchung zu erfahren. Dabei sorgte das Ergebnis, daß kurzfristige Angst offensichtlich immunstimulierende Wirkung haben kann, für große Überraschung und führte bei einigen Teilnehmern auch zu Erleichterung. Unter dem Aspekt der Kritik ist, wie im Blick auf viele immunologische Studien, dies zu 149 erwähnen: Im Rahmen dieser Studie wird eine immunologische Veränderung gemessen. Wir wissen jedoch nicht, wie klinisch relevant die Untersuchungsergebnisse wirklich sind. Für die Beantwortung dieser Frage hätten wir zum Beispiel zusätzlich zur IgA-Testung eine Virusapplikation der Teilnehmer mit einem Krankheitserreger vornehmen müssen. Die nachfolgenden infektiösen Erkrankungen hätten dann eine klinische Aussagefähigkeit bzgl. der veränderte Immunlage liefern können. Die Durchführung dieses Experiments war uns jedoch aus ethischen Gründen nicht möglich, und sie hätte auch den Rahmen unserer Möglichkeiten bzw. den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Unsere Untersuchungsergebnisse sind interessant und besonders umfangreich. Sie werfen aber auch viele neue Fragen auf, zum Beispiel: Warum reagieren manche "mutige" Personen mit starker Angst auf Medieninhalte, die viele ängstlichere Personen wenig beeindrucken? Was löst die emotionsbedingte Immunveränderung physiologisch aus? Ist es beim Lachen die Endorphinausschüttung und sind es bei der Angst die Hormone des Nebennierenmarks? Außerdem ist eine sehr wichtige Frage offen, und die Antwort darauf wäre ganz besonders interessant. Wir wissen genau, daß chronische Angst (Streß) das Immunsystem nachhaltig schwächt (siehe auch Kap. 6). Wenn aber kurzfristige Angst das Immunsystem positiv anregt und dieses dadurch stärkt, dann muß irgendwann der "Kippunkt" erreicht werden, an dem die kurzfristige Angstreaktion in eine langfristige übergeht und nicht mehr nützt, sondern schadet. Es stellt sich die Frage, wie und wann dieser Punkt erreicht wird. Welche qualitativen Unterschiede sind dabei von Bedeutung? Welche individuellen Unterschiede treten dabei auf? Welche verstärkenden und abschwächenden Faktoren sind in diesem Zusammenhang zu finden? 8. Quintessenz 150 1. Das Immunsystem des Menschen funktioniert nicht nur autonom, bestimmte physiologische und psychische Funktionen können regulierend eingreifen. 2. Zwischen dem Nerven-, Hormon- und Immunsystem besteht wechselseitige Kommunikation. 3. Das Gehirn kann mittels seiner Botenstoffe regulierend in das Immungeschehen eingreifen. 4. Das immunologische Alter eines Menschen muß mit seinem tatsächlichen Lebensalter nicht übereinstimmen. 5. Regelmäßiger, moderater Sport stärkt die Virusabwehr und die Killerzellenaktivität, während körperliche Überanstrengung ohne entsprechende Erholungsphasen das Immunsystem schwächt. 6. Zu fettes, alkoholreiches und scharfes Essen legt das Darmimmunsystem lahm. 7. Regelmäßiger Nahrungsentzug (Fasten) ermöglicht die Regeneration des Darmimmunsystems und das vermehrte Einfangen der freien Radikale. 8. Die großzügige Zufuhr von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen deckt den hohen Nährstoffbedarf des Immunsystems ab. 9. Durch die Epiphyse bedingt wird nachts vor allem die Virusabwehr aktiv (Bedeutung des Schlafs) und tagsüber die Bekämpfung entarteter Zellen (Bedeutung der Psyche). 10. Die erworbene Immunität eines Menschen entsteht in der Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Übermäßige Behütung des Subjektes verhindert das angemessene immunologische Training. Verwahrlosung führt zur schnellen Erschöpfung des Abwehrkräfte. 11. Für eine optimal funktionierende erworbene Immunität ist es durchaus nötig, daß ein Mensch in seinem Leben mehrmals infektiöse, fieberhafte Erkrankungen durchsteht. 12. Eine Erhöhung der Körpertemperatur ist für die meisten Krankheitserreger schädlich, während ein zu starker Temperaturabfall die Immunzellen desaktiviert. 13. Kurzfristige Belastungssituationen "trainieren" das Immunsystem, auch wenn sie augenblicklich als destruktiv erlebt werden. 14. Durch Langzeitbelastungen werden Hormone der Nebennierenrinde ausgeschüttet, 151 die suppressiv auf das Immunsystem wirken. 15. Welche Lebensereignisse als Belastung und welche als Herausforderung erlebt werden, hängt in den meisten Fällen von der subjektiven Beurteilung der jeweiligen Person ab. 16. Seelische, körperliche und geistige Aktivität steigert die Vitalität des Immunsystems. 17. Kreatives Tun und Denken fördert durch die vermehrte Endorphinausschüttung die Aktivität zahlreicher Immunfunktionen und unterbindet die dämpfende Wirkung der Corticosteroide. 18. Herzhaftes Lachen verursacht ebenfalls eine starke Endorphinausschüttung und die damit verbundenen immunologischen Effekte (Lachtherapie). Ebenso wirken gemeinsame soziale Unternehmungen wie z. B. das gemeinsame Singen, musizieren und spielen. 19. Aktive Copingstrategien, die Fähigkeit, das Leben eigenständig zu führen, die Fähigkeit, belastende Lebenssituationen als Herausforderung anzusehen, und der Widerstand gegen veränderbare negative Lebensumstände durchbrechen die immunsuppressive Wirkung der Corticosteroide. 20. Die Fähigkeit, ein authentisches, sinnerfülltes Leben zu führen und gute Beziehungen zu pflegen (zu kooperieren, sich mit anderen für etwas Wichtiges einsetzen), stabilisiert aufgrund des Zusammenspiels von Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem die körperliche Gesundheit. 21. Darüber hinaus können Techniken der Konditionierung, der Visualisierung und der Entspannung regulierend in das Immunsystem eingreifen. LITERATUR Bandura, A.: Aggression. Klett-Cotta, Stuttgart, 1979. Bartrop, R. et al.: Depressed lymphocyte function after bereavement. In: The Lancet, 1/1977, S. 834-836. Belson, W.A.: Television violence: An S-R mediational analysis of some effects of observed aggression. In: Nebraska Symposium on Motivation, 18, 1970. Becker, P.: Die Bedeutung von Vertrauen für die seelische und körperliche Gesundheit. In: Logotherapie und Existenzanalyse, Zeitschrift der DGLE e.V. Sonderheft, 1993, S. 52-69. Bendlich, A., Langseth, L.: The health effects of Vitamin E supplementation: a review. In: Journal of Am. Coll. Nutr. 14/1995, S. 124-136. 152 Besedowsky, H., Rey, A.: Das Immuno-neuro-endokrine Netzwerk. In: Schedlowski, M., Tewes, U.: Psychoneuroimmunologie. Spectrum, Heidelberg, 1996, S. 289-305. Bielory, L., Gandhi, R.: Asthma and Vitamin C. In: Ann. Allergy, 73, 1994, S. 313-326. Birbaumer, N., Schmidt, R.F.: Biologische Psychologie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1990. Bliemeister, J. et al.: Zum Zusammenhang zwischen psychosozialen Merkmalen und dem Gesundheitszustand HIV-Infizierter. Eine interdisziplinäre Querschnittsstudie. In: Zeitschrift für klinische Psychologie, XXI/2, 1992, S. 182-196. Bozzola, M. et al.: Letter to the editor. In: Metabolism, 38, 1989, S. 193. Brauchli, P., Zeier, H.: Depressivität und Surrogat-Marker bei HIV-infizierten Personen. In: Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, Psychologie 47, 1997, S. 34-40. Cathcart, R.F.: A unique function of ascorbate. In: Medical Hypotheses, 36, 1991, S. 32-37. Chiapelli, F. et al.: Effects of intravenous and oral dexamethasone on selected lymphocyte subpopulations in normal subjects. In: Psychoneuroendocrinology, 17, 1992, S. 145-152. Classen, M. et al.: Innere Medizin. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, 1991. Cohen, S. et al.: Der Streß bricht den Wall der Abwehr. In: top Medizin 3, 2/1992, S. 31. Cousins, N.: Der Arzt in uns selbst. Rowolt, Reinbek, 1981. Csikszentmihalyi, M.: Flow: Das Geheimnis des Glücks. Klett-Cotta, Stuttgart, 1993. Csikszentmihalyi, M.: Das Flow-Erlebnis: Jenseits von Angst und Langeweile. Klett-Cotta, Stuttgart, 1993. Das, S.: Vitamin E in the genesis and prevention of cancer. A review. In: Acta oncologica, 33, 1994, S. 141-145. Dietl, H., Ohlenschläger, G.: Handbuch der orthomolekularen Medizin. Karl Haug Verlag, Heidelberg, 1994. Dillon, K. et al.: Positive emotional states and enchancement of the immune system. In: International Journal of Psychiatry in Medicine, 15 (1) 1985/86, S. 13-17. Faller, A.: Der Körper des Menschen. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1988. Fawzy, F. et al.: Malignant melanoma. Effects of an early structured psychiatric intervention, coping, and affective state on recurrence and survival 6 years later. In: Archives of General Psychiatry 50, 1993, S. 681-689. Freser, I.: Nahrungsentzug eliminiert Krebszellen in der Leber. In: Forum Immunologie, 3/1995, S. 38. 153 Gauci, M. et al.: Pavlovian conditioning of nasal tryptase release in human subjects with allergic rhinitis. In: Psychology and Behavior, 55, 1994, S. 823-825. Ghanta, M. et al.: Neural and environmental influences on neoplasia and conditioning of NK activity. In: Journal of Immunology, 135, 1985, S. 848-852. Glaser, R. et al.: Spousal caregivers of dementia victims: Longitudinal changes in immunity and health. In: Psychosomatic Medicine, 53, 1991, S. 345-362. Glaser, R. et al.: Stress-induced modulation of the immune response to recombiant Hepatitis B vaccine. In: Psychosomatic Medicine, 54, 1992, S. 22-29. Green, M. et al.: Daily relaxation modifies serum and salivary immunoglobulins and psychophysiologic symptom severity. In: Biofeedback and Self-regulation 13, 1988, S. 187-199. Grossarth-Maticek, R. Soziales Verhalten und Krebserkrankung, Weinheim 1979. Guttmann, G.: Lehrbuch der Neuropsychologie. Huber Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1982. Hadinger, B.: Das Zusammenspiel von Immunsystem und Sinnsystem. In: Logotherapie und Existenzanalyse, Sonderheft, Bericht der Tagung in Wien / 4.-5. Juni 1993, S. 116-126. Hadinger, B.: Medien und Selbstmord. Verlag Lebenskunst, Tübingen, 1994. Hadnagy, W. et al.: Inhibition of phagocytosis of human macrophages by environmental pollutants. In: Zbl. Hyg. 195, 1994, S. 154. Hersey, P. et al.: Alteration of T cell subjects and induction of suppressor T cell activity in normal subjects after exposure to sunlight. In: Journal of Immunology, 31, 1983, S. 171174. Ironson, G. et al.: Changes in immune and psychological measures as a function of anticipation and reaction to news of HIV-1 antibody status. In: Psychosomatic Medicine, 52, 1990, S. 247-270. Irwin, M. et al.: Life events, depressive symptoms, and immune function. In: Am. Journal of Psychiatry, 144, 4/1987. S. 437-441. Janeway, C.A.: Das molekulare Arsenal des Immunsystems. In: Spektrum der Wissenschaft, Spezial 2: Das Immunsystem, S. 28-35. Kabelitz, D.: Psychoneuroimmunologie: wie verständigen sich Nervensystem und Immunsystem? In: Forum Immunologie, 4/1994, S. 30-31. Kagelmann, H.J., Wenninger, G. (Hrsg.): Medienpsychologie. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, 1982. Kaschka, P. Aschauer, J.: Psychoimmunologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1990. Kasper, S., Hennemann-Hohenfried, U.: Zirkadiane und saisonale Rhythmen immunologi- 154 scher Funktionen bei affektiven Störungen. In: Kaschka, W., Aschauer, H.: Psychoimmunologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1990, S. 64-74. Kelley, K.: Growth hormone in immunology. In: Ader, R. et al.: Psychoneuroimmunology. Academic Press, San Diego, 1991, S. 377-402. Kiecolt-Glaser, J. et al.: Marital quality, marital disruption, and immune function. In: Psychosomatic Medicine, 49, 1/1987, S. 13-34. Kiecolt-Glaser, J. et al.: Marital discord and immunity in males. In: Psychosomatic Medicine, 50, 1988, S. 213-229. Kiecolt-Glaser, J. et al.: Psychological enhancement of immunocompetence in a geriatric population. In: Health Psychology, 4/1985, S. 25-41. Kiecolt-Glaser, J. et al.: Urinary cortisol levels, cellular immunocompetency, and loneliness in psychiatric inpatients. In: Psychosomatic Medicine, 46, 1984, 15-23. Kiecolt-Glaser, J.: Interview. In: Die Heikraft der Psyche, Fernsehsendung am 8.4.1993, ORF 2. King, M., Husband, A.: Konditionierung immunologischer Funktionen. In: Schedlowski, M., Tewes, U. (Hrsg.): Psychoneuroimmunologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1996, S. 537-560. Klein, J.: Immunologie. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1991. Kluger, M.: Role of pyrogens and cryogens. In: Physiological Review, 71, 1991, S. 93-127. Kropiunigg, U.: Der Einfluß der Arzt-Patient-Beziehung auf die Abwehr. In: Der praktische Arzt, 45, 1991, S. 56-67. Kuklinski, B.: Interview. In: Forum Immunologie, 2/1994, S. 10-11. Kunczik, M.: Aggression und Gewalt. In: Kagelmann, H.J., Wenninger, G.: Medienpsychologie. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, 1982. Kunczik, M.: Gewalt im Fernsehen. Böhlau, Köln, Wien, 1975. Kunze, R., Schöllmann, C.: Orthomolekulare Medizin und Immunsystem. Forum Medizin, Gräfelfing, 1995. Lauterbach, P.: Lärm – das unterschätzte Risiko. In: Forum Immunologie, 1/1996, S. 25-27. Lazarus, R., Folkmann, S.: Stress, appraisal and coping. Springer, New York, 1994. LeShan, L.: Diagnose Krebs. Wendepunkt und Neubeginn. Klett-Cotta, Stuttgart, 1995. LeShan, L.: He, ich habe beschlossen, um mein Leben zu kämpfen! In: Psychologie heute, 6/1992, S. 34-39. Magyar Nemzet: Betegsegek. 2/1997. 155 McClelland, D., Jemmott, J.: Power motivation, stress and physical illness. In: Journal of Human Stress, 6, 1980, S. 6-15. Mikutta, G.: Netzwerk Mensch. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1992. Monjan, A.A.: Effects of acute and chronic stress upon lymphocyte blastogenesis in mice and humans. In: Cooper, E.L.: Stress, immunity and aging. Marcel Dekker, New York, 1984, S. 81-108. Morgan, E. et al.: Suppression of human B lymphocyte activation by Beta-endorphin. In: Journal of Neuroimmunology, 28, 1990, S. 209-217. Morley, J. et al.: Conductors of the immune orchestra. In: Life Sci. 41, 1987, S. 527. Naor, S. et al.: Correlation between emotional reactions to loss of an unborn child and lymphocyte response to mitogenic stimulation in women. In: Isr. J. Psychiatry Relat. 20, 1983, S. 231-239. Nilsson, L.: Eine Reise in das Innere unseres Körpers. Rasch und Röhring, Hamburg, Zürich, 1987. Nossal, G.J.: Das Immunsystem. In: Immunabwehr. Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg, 1995, S. 12-21. ORF-Sendung: Zum Täter geboren? ORF 2, am 22.08.1997. Pecher, O., Rudolf-Müller, E.: Vitamin A-Therapie. In: Forum Immunologie, 4/1994. Polonsky, W.H. et al.: Psychological factors, immunological function, and bronchial asthma. In: Psychosomatic Medicine, 47, 1985, S. 77. Prete, R. et al.: The in vitro effects of endogenous opiates on natural killer cells, antigen-specific cytolytic T-cells and T-cell subsets. In: Experimental Neurology 92, 1986, S. 349-359. Rowe, P.M.: Beta-carotene takes a collective beating. In: Lancet, 347, 1996, S. 249. Rudolf-Müller, E.: Asbestexposition beeinflußt das Immunsystem. In: Forum Immunologie, 5/1994, S. 19-20. Rudolf-Müller, E.: Die Rolle von Vitamin A, C und E und Lactulose in der Genese kolorektaler Adenome. In: Forum Immunologie, 7/1993, S. 30-31. Rudolf-Müller, E.: Sport moduliert das Immunsystem. In: Forum Immunologie, 6/1994, S. 59. Rudolf-Müller, E.: UV-B-Strahlung hat toxische Effekte auf das Immunsystem. In: Forum Immunologie, 5/1994, S. 17-18. Schaeffer, M.: Zink optimiert die Immunabwehr. In: Forum Immunologie, 1/1996, S. 20. Schäffer, A.: Orthomolekulare Therapie. In: Forum Immunologie, 3/1995, S. 12-17. 156 Schäffer, A.: Spezifische Abwehrmechanismen – Spezialisten am Werk. In: Forum Immunologie, 3/1995, S. 18-25. Schedlowski, M. et al.: Catecolamines modulate natural killer (NK) cell migration and function via spleen adrenergie mechanism. In: Journal of Immunology, 156, 1996, S. 93-99. Schedlowski, M., Benschop, R.: Neuroendokrines System und Immunfunktionen. In: Schedlowski, M., Tewes, U.: Psychoneuroimmunologie. Spektrum, Heidelberg, 1996, S. 241268. Schedlowski, M.: Streß, Hormone und zelluläre Immunfunktionen. Spektrum, Heidelberg, 1994. Schleifer, S.J. et al.: Suppression of lymphocyte stimulation following bereavement. In: Jama, 250, 1983, 374-377. Schneider, G. et al. Zit. in: Achterberg, J.: Die heilende Kraft der Imagination. Scherz, Bern, München, Wien, 1987. Schöllmann, C.: Das Immunorgan Darm und seine Beziehung zur intestinalen Mikroflora. In: Forum Immunologie, 4/1995, S. 5-10. Schöllmann, C.: Der Fas/APO-l-Rezeptor und sein tödlicher Ligand. In: Forum Immunologie, 4/1996, S. 33-34. Schöllmann, C.: Die Rolle des programmierten Zelltods bei der Krebsentstehung. In: Forum Immunologie, 2/1995, S. 32. Schöllmann, C.: Lärm – ein Risikofaktor für Herzkrankheiten? In: Forum Immunologie, 5/1994, S. 18-19. Schöllmann, C.: Mit Thymuspeptiden die Immunkommunikation anregen. In: Forum Immunologie, 2/1996, S. 27. Schöllmann, C.: Neue Erkenntnisse über die Verflechtung von Nerven- und Immunsystem. In: Forum Immunologie, 1/1995, S. 25-26. Schulz, K.: Psychoneuroimmunologie. In: Zeitschrift für allgem. Medizin, 62, 1986, S. 871878. Selye, H.: The stress of life. McGraw-Hill, New York, 1956. Simonton, O.C. et al.: Wieder gesund werden. Rowohlt, Reinbek, 1996. Singer, J.E., Schachter, S.: Cognitive, social and physiological determinants of emotional state. In: Psychological Review, 69, 1962, S. 379-399. Snyder, S.H.: Chemie der Psyche. Spektrum, Heidelberg, 1990. Spector, H.: Konditionierung von Immunreaktionen. In: Kaschka, W.P., Aschauer, H.N. 157 (Hrsg.): Psychoimmunologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1990, S. 43-51. Totman, M.L. et al.: Immune variables, depression, and plasma cortisol over time in suddenly bereaved parents. In: Journal of Neuropsychiatry, 3/1991, S. 299-306. Tweel, J.G.: Immunologie. Das menschliche Abwehrsystem. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg, 1991. Uhlenbruck, G.: Sport und Bewegungstherapie. In: Forum Immunologie, 3/1996, S. 28-31. Uhlenbruck, G.: Sport, Alter und Immunsystem. In: Med. Welt, 44, 1993, S. 303-308. Ursin, H., Olft, M.: The stress response. In: Stanford, C. et al. (Hrsg.): Stress: From Synapse to Syndrome. Academic Press, New York, 1993, S. 4-23. Visintainer, M.A. et al.: Tumor rejection in rats after inescapable or escapable shock. In: Science, 216, 1982, S. 437-439. Vitouch, P.: Emotion. In: Kagelmann, H.J., Wenninger, G.: Medienpsychologie. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, 1982. Weike, E. et al.: Molekularanatomische Grundlagen von Wechselbeziehung zwischen Nervensystem und Immunsystem in Gesundheit und Krankheit. In: Schedlowski, M., Tewes, U. (Hrsg.): Psychoneuroimmunologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1996, S. 221-240. Weissmann, I.L., Cooper, M.D.: Reifung des Immunsystems. In: Spektrum der Wissenschaft, Spezial 2, 1993, S. 18-26. Wieseler, B.: Polychlorierte Biphenyle stören die Entwicklung des Immunsystems. In: Forum Immunologie, 2/1994. Wolff, O.: Das Immunsystem – ein geistiges Problem. In: Forum Immunologie, 1/1994, S. 29-31. Wüst, E.: Die neurokognitive Therapie. In: Feldtkeller, E.: Ergebnisse eines wissenschaftlichen Symposiums, 1993. Zachariae, R. et al.: Modulation of type I immediate and type IV delayed immunoreactivity using direct suggestion and guided imagery during hypnosis. In: Allergy, 44, 1989, S. 537542. Zachariae, R. et al.: Monocyte chemotactic activity in sera after hypnotically induced emotional states. In: Scandinavian Journal of Immunology, 34, 1991, 71-79. Zänker, K.: Das Immunsystem des Menschen. Bindeglied zwischen Körper und Seele. Beck, München, 1996. 158