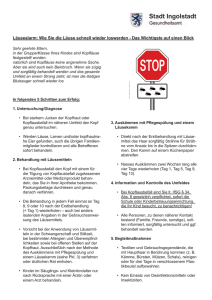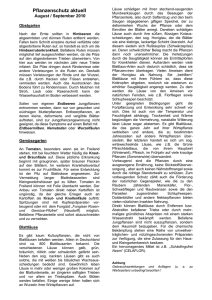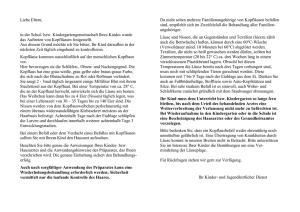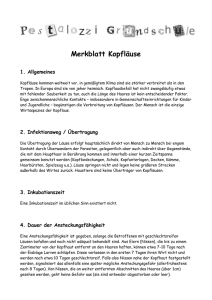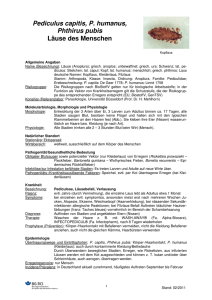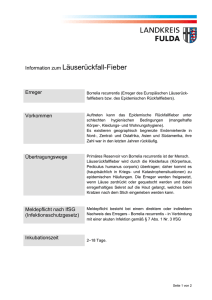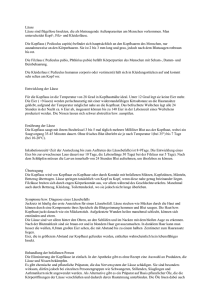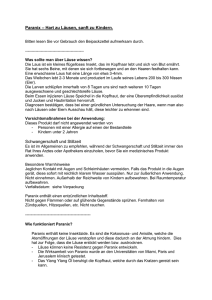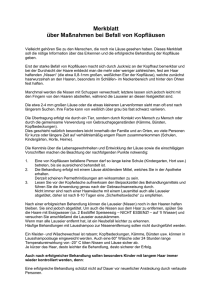Vergleichende Untersuchungen an Rickettsien
Werbung

lophanschlauch so lange der Dialyse gegen fließendes Leitungswasser, bis die Reaktion auf Cl-Ionen nicht mehr stärker als in Leitungswasser allein ist. Bei der Dialyse, welche etwa 2 Tage dauert, fällt das RohAgglutinin in farblosen Flocken aus. Man trocknet das abzentrifugierte Produkt im Vakuumexsiccator (1 Torr., 2 0 ° ) zuerst über Kaliumhydroxyd, dann über Diphosphorpentoxyd. Ausbeute 56 g hochwirksames Roh-Agglutinin in hellgelb-braunen Lamellen, d. h. 16% des Ei-Frischgewichtes. Zur Analyse wird eine Probe in der Pistole von Restfeuchtigkeit befreit ' ( 1 4 Torr., 110°, P 2 0 5 ) . Gef. C 51,57, H 7,85, Rückstand 4,89, N 12,48, 12,46. Gef. S 0,45 64 , P 1,02 «3. Die bei der Reinigung des Agglutinins anfallenden, in 1-proz. Natriumchlorid schwerlöslichen Proteinfraktionen wurden vereinigt, mit dest. Wasser gewaschen und wie das Roh-Agglutinin getrocknet. Das erhaltene „Restprotein" wog 25 g. Gef. C 52,30, H 7,79, N 13,90, S 0,72 M , P 0,74 63 . 5. A b t r e n n u n g d e s A n d r o g a m o n s Forellensperma aus 20 g Sperma der Regenbogenforelle ergeben, zuerst über KOH, dann über P 2 0 5 getrocknet (1 Torr., 4 ° ) , 2,0 g Trockenrückstand. Die harte, spröde Masse zerkleinert man im Porzellanmörser und kocht sie 2-mal am Rückfluß mit je 50 ccm trockenem Methanol aus. Der gelbbraune Abdampfrückstand, der intensiv nach Sperma riecht, während das extrahierte Sperma seinen Geruch verloren hat, ist auch nach scharfem Trocknen über P 2 0 5 noch weich. Dieses Roh-Androgamon I wog 0,10 g, d. s. 0,5 % des Sperma-Frischgewichtes. Gef. C 39,62, H 6,60, N 7,75. Hrn. A. S o h n i u s danken wir für die großzügige Bereitstellung von Material und Arbeitsraum, Frl. Dr. A. G a u h e für ihre freundliche Mithilfe bei der Aufarbeitung der Eier und Hrn. Dr. L. B i r k o f e r für Unterstützung bei der Lactoflavinbestimmung. Vergleichende Untersuchungen an Rickettsien Von I FRITZ W E Y E R Aus dem Bernhard-Nocht-Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten ( Z . N a t u r f o r s c h g . 2 b, 349—358 [19471; e i n g e g a n g e n a m 22. S e p t e m b e r 1947) Bei fortlaufender Haltung von Rickettsienstämmen (Ri. prowazeki, Ri. mooseri, Ri. wolhynica) mit häufigem Wirtswechsel und unter Einschaltung experimenteller Bedingungen wurde eine Vermehrung und Entwicklung beobachtet in Kleider- und Kopfläusen, Mäuseflöhen, Zecken und in Larven von Mehlkäfern. In Zecken entwickeln sich die Ri. in verschiedenen Organen. Uber die Ovarien erfolgt eine Übertragung auf die folgende # Generation. In der Laus haben die Ri. eine besondere Affinität zu den Mitteldarmzellen, in denen sie sich auch bei intracölomaler Impfung sammeln. Bei bestimmter Applikation von der Geschlechtsöffnung aus kommt es zu einer Entwicklung in den Ovarien und einer Übertragung der Ri. auf entwicklungsfähige Eier. Die biologischen Eigenschaften der Ri.-Stämme sind Wandlungen unterworfen, die sich am deutlichsten in Schwankungen oder, im Fehlen der Virulenz für bestimmte Zwischen- und Endwirte äußern. Damit ist eine Änderung der Ri.-Lagerung von der intra- zur extrazellulären Form und umgekehrt im Läusemagen verknüpft. In der Gewebekultur infizierter Läusemägen sind die Ri. noch nach Wochen nachweisbar und vermehrungsfähig. Bei kombinierter Explantation von Insekten- und Säugergewebe kann die ursprüngliche Virulenz der Ri. erhalten bleiben, während sie bei einfacher Explantation fast regelmäßig unter Übergang der Ri. in die extrazelluläre Lage verlorengeht. Ein Wechsel von virulenten, intrazellulären zu avirulenten, extrazellulären Ri.-Populationen, die sich morphologisch und in ihrer Pathogenität nicht von Ri. wolhynica bzw. Ri. pediculi unterscheiden lassen, wurde außerdem unter verschiedenen experimentellen Bedingungen erreicht. In einigen Fällen konnten aus solchen extrazellulären Populationen wieder intrazelluläre Ri. unter Wiedergewinnung ihrer Virulenz herausgezüchtet werden. Da sich auch Ri. prowazeki und Ri. mooseri gleichen können, wird die Vermutung ausgesprochen, daß die bisher beschriebenen Läuse-Ri. entweder auf die gleiche Art zurückgehen, wobei ihrem wechselnden Verhalten eine durch innere und äußere Ursachen bedingte Änderung zugrunde liegt, oder daß wir in den gewöhnlichen Stämmen eine Typenmischung vor uns haben, bei der je nach den Umweltbedingungen bestimmte Typen selektionieren. Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM D i e Stellung der Rickettsien (Ri.) im biologischen System ist seit ihrer Entdeckung wiederholt Gegenstand von Untersuchungen und Überlegungen gewesen, ohne daß diese Frage als restlos geklärt angesehen und eine klare Definition der Ri. gegeben werden kann. W i r sind heute der Ansicht, daß die Ri. als besondere Bakteriengruppe aufzufassen sind und mit den großen Virusarten nichts zu tun haben. Zu dieser Erkenntnis haben vor allem elektronenmikroskopische UnteFSuchungen beigetragen 1 - 2 - 3 . Die morphologische Kennzeichnung der Ri. ist unzulänglich. Sie wird erschwert durch den starken Pleomorphismus und gestattet kaum eine Abgrenzung gegenüber kleineren Bakterien. Zu den wichtigsten Merkmalen der Ri. gehören u. a. ihre Nichtzüchtbarkeit auf bakteriologischen Nährböden, ihre Entwicklung in Verbindung mit lebenden Zellen, ihre enge Anpassung an bestimmte Gliederfüßler als Überträger oder Zwischenwirte und ihre antigene Struktur im Sinne einer Paraagglutination mit Proteus-Stämmen. Besondere Schwierigkeiten bereitet die Differenzierung einzelner Rl-Arten. Für die Unterscheidung wird in erster Linie ihre pathogene Wirkung für den Menschen und die Laboratoriumstiere herangezogen. Von hier aus läßt sich noch am leichtesten ein gewisser Einblick in das Wesen der Ri. gewinnen, zumal wenn man das Verhalten im Überträger zum Vergleich heranzieht. Im Zuge einer nunmehr 4-jährigen ständigen Beobachtung konnten einige Eigenschaften der Ri. näher studiert werden, die vor allem die Beziehungen einzelner Arten zueinander in einem neuen Licht erscheinen lassen. Es handelt sich dabei um Untersuchungen an Ri. aus der Gruppe der „Läusefleckfieber" bzw. „Flolifleckfieber", also der Ri. prowazeki, Ri. mooseri und Ri. wolhynica. Verschiedene Stämme dieser Ri. wurden in fortlaufenden Passagen, teils im Säugerwirt, teils im Überträger, teils außerhalb des Organismus in besonderen Kulturverfahren gehalten, um dabei Entwicklung, Vermehrung, Gestaltwandel und Virulenz bzw. Pathogenität in Arthropoden und Warmblütern vergleichen zu können. Über die Ergebnisse dieser Arbeiten, bei denen u. a. mehr als 40000 Läuse künstlich infiziert und verarbeitet wurden*, soll im folgenden kurz berichtet werden. Eine eingehende Darstellung mit Berücksichtigung der technischen Verfahren und einer quantitativen Auswertung der Einzelversuche soll an anderen Stellen erfolgen. Bei Ri. mooseri handelte es sich um einen mexikanischen Stamm, der schon in anderen Laboratorien * Bei der technischen Arbeit leisteten mir vor allem Frau M. R e y m a n n und Frl. F. W e b e r wertvolle Hilfe. r 1 1 u ' 10*1 i E 1 <s5, 4o3 [ 1944 J. E R u s k a , Z . Hyg. Infekt.-Krankh. längere Zeit auf Mäusen gehalten war. Von Ri. prowazeki standen 6 verschiedene Stämme, davon 5 von Fleckfieberpatienten aus Osteuropa frisch isoliert zur Verfügung. Mehrere Stämme der Ri. wolhynica waren durch Läusefütterung an Patienten gewonnen Als wichtigstes Objekt für die Stammhaltung und für das Studium der Eigenschaften im Überträger diente die Kleiderlaus, in der auch alle zweifelhaften Emulsionen und Organzerreibungen durch künstliche rektale Verimpfung auf ihren Rickettsiengehalt geprüft wurden. 2. V e r h a l t e n d e r R i c k e t t s i e n imLaboratoriumstier' Ri. wolhynica unterscheidet sich von allen anderen pathogenen Ri. durch die Avirulenz für die gebräuchlichen Laboratoriumstiere. Die Ri. sind nach intraperitonealen und intranasalen Übertragungen auf Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse weder morphologisch nachzuweisen, noch verursachen sie irgendwelche klinischen Allgemeinerscheinungen. Auch alle in dieser Richtung von uns unternommenen Versuche waren erfolglos, insbesondere zahlreiche Versuche zur intranasalen Infektion von Mäusen unter Einschaltung wiederholter Blindpassagen. Virulenz und Entwicklung zeigten die Ri. lediglich bei Übertragungen auf den Menschen. Hier ließen sie sich wieder durch Läusefütterungsversuch isolieren4. Bei der Züchtung im bebrüteten Hühnerei nach der Methode von C o x kam es in 4 von 12 Versuchen wohl zu einer schwachen Vermehrung der Ri., die sich auch auf die Laus übertragen ließen, jedoch war eine Kultur in fortlaufenden Eipassagen nicht möglich. Die Abgrenzung von Ri. prowazeki gegenüber Ri. mooseri wird gewöhnlich nach den Reaktionen bei Übertragungen auf Meerschweinchen, Ratten bzw. Mäuse vorgenommen. Die allgemeine Ansicht geht dahin, daß Ri. prowazeki im Meerschweinchen neben einem charakteristischen Fieber Gehirnknötchen erzeugt, bei Mäusen aber kein Fieber macht und höchstens zu einer latenten Infektion ohne sicheren Rickettsiennachweis führt. Ri. mooseri gibt bei Meerschweinchen ein uncharakteristisches Fieber, verursacht jedoch Skrotalschwellungen und schwere periorchitische Ver2 F. W e y e r , G. B e r g o l d wiss. 32, 321 [1944], u. H. F r e k s a , Natur- 3 H. R u s k a u. K . P o p p e , Z. Naturforschg. 2 b, 3o [1947], 4 F . W e y e r , Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt, I 152 [1947]. Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM änderungen. Mäuse reagieren mit einer schweren, meist tödlich endenden Infektion. Der besondere Vorteil beim Experimentieren mit Ri. mooseri besteht darin, daß sich die Ri. nach intraperitonealer Verimpfung leicht im Peritonealausstrich der Maus nachweisen lassen. Die nahe Verwandtschaft der beiden Erreger, die sich auch in der Kreuzimmunität äußert, k a n n die genannten Unterschiede aber völlig verwischen. M o o s e r 5 hat schon mehrfach auf diese Beziehungen hingewiesen und die Entwicklung der einen aus der anderen Art durch Anpassung an Überträger und Wirtsorganismen in wiederholten wechselseitigen Passagen erörtert. Beim Vergleich von mehreren Stämmen der Ri. prowazeki reagierten unsere Versuchstiere ganz verschieden und keineswegs eindeutig im Sinn der obigen Definition für die Ri. prowazeki. Es bereitet keine Schwierigkeiten, Ri. prowazeki in der Mäuselunge zur Entwicklung zu bringen. Durch fortgesetzte Lungenpassagen und weitere Adaptierung an die Maus gelingt dann auch die intraperitoneale Infektion, die unter denselben klinischen Erscheinungen verläuft wie die Infektion mit Ri. mooseri. Die Ri. finden sich in diesem Fall auch im Peritonealausstrich. Mehrere frisch isolierte Stämme, die entweder sofort oder nach nur wenigen Läusepassagen auf Mäuse gebracht wurden, hatten bei direkter intraperitonealer Verimpfung die gleiche Virulenz für Mäuse wie Ri. mooseri. Von der Laus aus ließen sich die Ri. sowohl auf Meerschweinchen wie auf Mäuse übertragen, von der Maus entweder mit Gehirnemulsion oder einer Zerreibung des abgeschabten Peritonealepithels auf Läuse und Meerschweinchen, mit dem Meerschweinchengehirn auf Mäuse und Läuse. Eine Unterscheidung zwischen Ri. prowazeki und Ri. mooseri ist bei einem solchen Verhalten nicht möglich. Bei Ri. mooseri war lediglich die Virulenz für Meerschweinchen durchschnittlich schwächer und unregelmäßiger. Periorchitische Veränderungen waren in unseren Versuchen weder bei Infektionen mit Ri. prowazeki noch mit Ri. mooseri vorhanden. Graduelle Unterschiede in der Virulenz und der Schnelligkeit der Adaptierung deuten darauf hin, daß innerhalb der prowazeki-mooseri-Gruppe Stammeigentümlichkeiten bestehen, die aber nicht starr sind, sondern sich wandeln können. Zum Beispiel entwickelte ein 5 Mooser, Acta Tropica, Suppl. 4 [1945]. Stamm von Ri. prowazeki gleich nach der Isolierung aus dem Menschen eine hohe Virulenz für Mäuse, verlor diese Eigenschaft aber vollständig nach einigen Läusepassagen und konnte erst über eine längere Reihe von Lungenpassagen wieder an die Maus adaptiert werden. Die Anpassungsfähigkeit der Ri. ergaben auch Übertragungsversuche der Ri.prowazeki auf das Kaninchen6. Werden die Ri. ausschließlich im Nager, besonders in der Maus, gehalten, so können sowohl Ri. mooseri wie Ri. prowazeki in ihren Eigenschaften für lange Zeit recht konstant bleiben. Mehrfach liefen die Stämme ganz gleichmäßig in über 70 fortlaufenden Gehirnpassagen. Bei stärkeren Virulenzschwankungen und anderen Wandlungen der Stammeigenschaften spielt neben der Wirtsresistenz die Zwischenschaltung des Insektenüberträgers eine besondere Rolle. 3. V e r h a l t e n der R i c k e t t s i e n im Ü b e r träger oder Zwischenwirt Die Sicherheit der Passagen, die Schnelligkeit der Vermehrung und die große Zahl der verwendbaren Objekte erlaubt beim Studium der Rickettsienbiologie im Uberträger eine wesentlich größere Versuchsbreite und Beobachtungsdauer über viele Generationen. Ubertragungsversuche durch natürliche und künstliche (rektale oder intracoelomale) Infektion wurden vorgenommen bei Kleiderläusen, Kopfläusen, Mäuseflöhen ( L e p t o p s y l l a segnis S c h ö n h . ) , Zecken (Ornithodorus moubata M u r r a y , Argas reflexus F., Rhipicephalus bursa C. u. F.) und in kleinerem Umfang bei verschiedenen Insekten. a) K l e i d e r l ä u s e . In Kleiderläusen, als den natürlichen Überträgern mehrerer Arten, kommt es bei 37 ° innerhalb von 4 bis 7 Tagen zu einer starken Vermehrung und Anreicherung der einverleibten Ri., so daß dieselben leicht im Ausstrich bzw. Schnittpräparat oder in der Kotprobe nachgewiesen werden können. Dabei läßt sich auch Ri. wolhynica von Ri. prowazeki und Ri. mooseri abgrenzen. Ri. wolhynica wuchert auf den Magenzellen und im Magenlumen, lagert also extrazellulär, Ri. prowazeki und Ri. mooseri dringen in die Magenzellen ein, vergrößern und zerstören sie schließlich bei f o r t l a u f e n d e r V e r m e h r u n g . Dadurch kommt es zu einer vielfach letal endenden Schädigung der Läuse, während bei der Infektion mit Ri. wolhynica die Überträger weder beeinträchtigt, noch in ihrer Lebensdauer verkürzt werden. 6 R B i e l i n g u. L. O e l r i c h s , Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt. I 151, 940 [1944]. Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM Bei einiger Übung ist in der Laus im Magenausstrich eine morphologische Unterscheidung der Ri. wolhynica von intrazellulären Ri. möglich. Ri. wolhynica ist größer, nach G i e m s a meist stärker und einheitlicher gefärbt. Innenstrukturen sind schwer erkennbar. Im Gesamtbild herrschen Rundformen und plumpe Stäbchen vor. Doppelformen sind seltener, langgezogene Hantelformen mit scharf umrissener Polendenfärbung fehlen, Kettenbildung kommt praktisch nie vor. Die Ri. lagern meist locker und ohne direkten Kontakt nebeneinander. Bei längerer gleichmäßiger Haltung auf Läusen lassen manche Stämme von Ri. prowazeki charakteristische Unterschiede erkennen, die wenigstens zeitweise eine Diagnose des Stammtyps nach morphologischen Merkmalen erlauben. Bestimmte Stämme treten stets, oder wenigstens in vielen Passagen hintereinander, in kürzeren oder längeren Ketten auf, bei anderen Stämmen herrschen anfangs langgezogene Stäbchen mit Polendenfärbung vor, einige Stämme vermehren sich langsam und spärlich, andere stürmisch und in großer Zahl. Derartige Unterschiede werden allerdings nur beim Vergleich annähernd der gleichen Infektionszeiten bzw. Entwicklungsstadien deutlich. Es kommt im übrigen im Verlaufe einer Passage in der Laus zu einem' Gestaltwandel der Ri., wodurch eine sichere Unterscheidung der Stämme natürlich erschwert wird. Die Grundtypen der Ri. und meist auch die Art ihrer Anordnung kehren bei fast allen Stämmen zu irgendeiner Zeit wieder, nur sind diese Zeiten, die Häufigkeit und die Bedingungen ihres Auftretens bei den einzelnen Stämmen verschieden. Die Reaktion der Laus kann ebenfalls einen Anhalt für die Unterscheidung der Stämme bieten. Bei der Fütterung am Patienten werden meist nicht mehr als 30% der Läuse positiv, wahrscheinlich doch auch ein Zeichen dafür, daß die Läuse über eine gewisse Resistenz den Ri. gegenüber verfügen. Bei der künstlichen rektalen Infektion (etwa 0,001 ccm einer erregerhaltigen Emulsion) entwikkeln alle einwandfrei geimpften Läuse Ri. Unterschiede ergeben sich teils zwischen den Stämmen, teils beim gleichen Stamm zu verschiedenen Zeiten in der Stärke der Infektion, dem Zeitpunkt des ersten Rickettsiennachweises und in der letalen Wirkung für die Läuse. Diese kann, unter rötlicher Verfärbung der Tiere, bereits am 4. Tag eintreten, sie zeigt sich normalerweise zwischen dem 7. und 10. Tag, sie kann auch ganz ausbleiben. Die mangelhafte oder fehlende Virulenz für die Läuse hat ihren Grund darin, 'daß die Ri. überhaupt nicht im Epithel Fuß fassen, oder sehr spät, oder nur in vereinzelten Zellen, während große' Partien des Magens von der Infektion unberührt bleiben. Es können aber auch die bereits in größerer Zahl vorhandenen Ri. wieder verschwinden. Degenerationserscheinungen mit Konfluieren von Ri., Versiegen der Teilungen, Verlust der charakteristischen Form und Farbe sind dafür sichtbare Zeichen. Es ist ungeklärt, ob derartige Vorgänge als Abwehrreaktion der Läuse im Sinne einer Resistenzsteigerung oder als Involutionserscheinungen der Ri. selbst zu gelten haben. Der Wechsel in der Virulenz der Ri. für Läuse kann die Haltung der Stämme ungewöhnlich erschweren. Zeiten mit hoher Virulenz, die sich über 5 bis 8 Passagen erstrecken können, werden oft ohne Übergang von Zeiten mit schwacher und schwächster Virulenz abgelöst. Bei einem frühzeitigen Auftreten und einer starken Virulenz für nur einzelne Läuse können die Ri. zur Zeit, wenn die neue Passage normalerweise fällig ist, bereits verschwunden sein. Die Virulenzsteigerung und -abschwächung für die Läuse, die im allgemeinen mit der Pathogenität für Mäuse parallel geht, verläuft in unregelmäßigen Wellenbewegungen, die sich bisher nicht gesetzmäßig erfassen lassen. Die Regel bei der Stammhaltung auf Läusen ist ein normaler Gang, bei dem alle Läuse gleichmäßig Infiziert sind, die ersten Ri. nach 5 bis 7 Tagen im Kotausstrich erscheinen, die ersten durch die Infektion verendeten Läuse nach 8 bis 10 Tagen auftreten und die neue Passage nicht vor dem Ende der zweiten Woche nötig wird. Die Perioden mit starker und ganz schwacher Virulenz sind Ausnahmen. Dabei dürfte die hohe Virulenz oder die Häufigkeit der hohen Virulenz eine Eigenschaft bestimmter Stämme sein. Mitunter treten Perioden verstärkter oder verminderter Virulenz bei ganz verschiedenen Stämmen gleichzeitig auf. Sie beziehen sich auf 2, gelegentlich auch 3 Stämme von Ri. prowazeki. Solche in Abständen von 3 bis 6 Monaten auftretenden „Massenschwankungen", an denen 3-mal auch Ri. mooseri beteiligt war, äußern sich entweder in einer starken Sterblichkeit der Läuse kurze Zeit nach der Infektion oder in einem späten bzw. spärlichen Ri.-Nachweis bei gesunden Läusen. Da sie sozusagen als Nebenerscheinung im normalen Passagegang bei gleichbleibenden Außenbedingungen auftreten, wurde bisher noch nicht der Versuch einer experimentellen Analyse gemacht. Fast regelmäßig ist eine Virulenzsteigerung nach Wirtswrechsel, wenn also z. B. ein auf Läusen gehaltener Stamm zwischendurch die Maus oder Zecke passiert. Die erhöhte Virulenz äußert sich auch hier in einer starken und frühen Mortalität der Läuse. Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM Zu den interessantesten Phänomenen gehört eine wiederholt bei Ri. mooseri und bei 3 Stämmen von Ri. prowazeki beobachtete Verschiebung von der intra- zur extrazellulären Lage im Läusemagen. Diese Verschiebung trat in einigen Läusepassagen anscheinend spontan auf, entweder in der Form, daß alle Läuse gleichzeitig nach der Beimpfung mit intrazellulären Ri. extrazelluläre Ri. enthielten, oder daß eine Anzahl Läuse intrazelluläre, eine Anzahl aber extrazelluläre Ri. entwickelte. In einigen Fällen hatten die Läuse gleichzeitig intraund extrazelluläre Ri. Meist ging die Tendenz in der Richtung, daß die intrazellulären Ri. allmählich verschwanden und spätestens in der folgenden Passage nur noch extrazelluläre Ri. vorlagen. Durch eine große Zahl von Beobachtungen an verschiedenen Stämmen und eine beliebige Reproduzierbarkeit des Vorganges ist es absolut sicher, daß die extrazellulären Ri. keine Verunreinigung oder Sekundär- bzw. Mischinfektionen durch die Fütterung oder Beimpfung darstellten, sondern sich direkt aus den intrazellulären Populationen entwickelten. In etwa der Hälfte der Versuche gingen die extrazellulären Populationen nach einer wechselnden Zahl von Passagen wieder in intrazelluläre über; z. Tl. haben sie ihren extrazellulären Charakter nur unter experimenteller Einwirkung aufgegeben (s. S. 354). In 2 Fällen haben sie ihn bis heute beibehalten. Es handelt sich um einen intra- und einen extrazellulären Stamm. Mit dem Übergang von der intra- zur extrazellulären Lage nehmen die Ri. die gleiche Form, Färbbarkeit und Vermehrungsweise an wie die extrazelluläre Ri. wolhynica. Es ist nicht möglich, diese Ri. voneinander zu unterscheiden. Die Vermehrung in der Laus setzt um 2—3 Tage schneller ein, und die Ri. sind für die Laus apathogen geworden, ebenso wie für Mäuse und Meerschweinchen. Sehen wir von der offenen Frage der Menschenpathogenität ab, so sind somit aus den z. Tl. hochvirulenten, für Menschen und Versuchstiere pathogenen, intrazellulären Populationen von Ri. mooseri und Ri. prowazeki Formen entstanden, die in allen uns bekannten Eigenschaften mit der Ri. wolhynica übereinstimmen. Auffällig ist die starke Affinität der Ri. zu den Magenzellen der Laus. Es ist anzunehmen, daß die mit dem Blut und der Impfaufschwemmung in den Magen gelangten Ri. aktiv in die Magenzellen eindringen und sich hier nach einer kurzen Periode der Ansiedlung vermehren. Dieser Zell- tropismus fällt besonders in die Augen, wenn die Läuse nicht rektal, sondern intracölomal von der Geschlechtsöffnung aus infiziert werden. In 20 von 22 derartigen Versuchen erfolgte eine Vermehrung der Ri., und zwar bei Ri. wolhynica und Ri. mooseri extra- und intrazellulär und bei 3 Stämmen von Ri. prowazeki. Die Infektion der Läuse gelingt auch be^ Verwendung von Gehirnemulsion fleckfieberkranker Mäuse. Bei der intracölomalen Infektion erfolgt nicht eine Durchwucherung des ganzen Cöloms, sondern die Ri. gelangen auch unter diesen Umständen, nur etwas später, in bzw. auf die Magenzellen. Kommen bei der intracölomalen Infektion Ri. in die Ovarien und die Geschlechtswege, dann setzt häufig eine beträchtliche Vermehrung und Anreicherung der Ri. im Ovar selbst ein, in jungen und älteren Eizellen, in Nährzellen, in Follikelzellen und im Epithel des Eileiters. Es kommt auch zu einer starken Entwicklung der Ri. in den Eiern selbst. Die Entwicklung der Ri. im Ovar gelingt nicht regelmäßig > es sind außerdem immer nur wenige Eier, die Ri. enthalten. Die Ri. in abgelegten Eiern waren nicht nur in Ausfetrichen, sondern auch durch Verimpfung einer Ei-Emulsion auf Läuse und Mäuse feststellbar. Aus den infizierten Eiern schlüpften in einem Versuch normale Larven, die Blut sogen. Die Larven gingen spätestens am 5. Tage ein, ^ur Häutung kamen sie nicht mehr. Die Ri. wucherten in den Larven nicht nur in den Magenzellen, sondern auch im Fettkörper und in Neoblasten. Durch Verimpfung einer aus solchen Larven gewonnenen Emulsion auf gesunde Läuse konnte die Anwesenheit und intrazelluläre Lage dieser durch das Experiment auf die folgende Generation übertragenen Ri. sichergestellt werden. b) K o p f l ä u s e u n d F l ö h e . Daß die Wirtsund Qrganspezifität der Ri. nicht einseitig und unbeeinflußbar ist, zeigten auch Übertragungen auf andere Wirte. Bei Zimmertemperatur kommt es in rektal infizierten Kopfläusen zu einer Ri.-Entwicklung in der Zeit von 6 Tagen, und zwar sowohl bei extra- wie intrazellulären Ri. unter Wahrung ihrer ursprünglichen Eigenschaften. Die Infektion von Mäuseflöhen wurde erreicht durch Füttern von Flöhen an fleckfieberkranken Mäusen und durch künstliche rektale Infektion der Flöhe. Ausgewertet wurden bisher 15 Versuche. Bei der natürlichen Infektion entwickelten sich in den Flöhen Ri. mooseri und 2 Stämme von Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM Ri. prowazeki, die an die Maus adaptiert waren. Der Rickettsiennachweis war 10 bis 15 Tage nach dem Ansetzen der Flöhe an kranke Mäuse möglich. Die Ri. ließen sich mit Zerreibungen des Flohmagens auf Mäuse und auf Läuse bringen. Die künstliche Infektion wurde erfolgreich mit extra- und intrazellulären Ri. mooseri und mehreren Stämmen von Ri. prowazeki durchgeführt. Dabei war besonders im Anfang bei noch unsicherer Beherrschung der Technik nicht immer sicher zu entscheiden, ob die Ri. primär über die Enddarmampulle in den Magen gelangten oder erst auf dem Umweg über das Cölom. Der Rickettsiennachweis durch Ausstrich oder Verimpfung der Magenzerreibung auf Läuse und Mäuse gelang vom 8. Tage an. c) Z e c k e n . Über 50 verschiedene Übertragungsversuche beschäftigten sich mit Zecken. Die Zecken wurden künstlich intracölomal entweder von der After- oder der Geschlechtsöffnung aus infiziert. Der Nachweis der Ri. basierte auf Ausstrichen, vor allem aber auf Yerimpfungen der zerriebenen Zeckenorgane auf Läuse und Mäuse. Erfolgreich war«n 3 von 9 Versuchen zur Übertragung von Ri. prowazeki und Ri. mooseri auf Rhipicephalus bursa. Die Verarbeitung der Zekken, 10 bis 31 Tage nach der Infektion, ergab eine starke Vermehrung der Ri. Bemerkenswert war ihre Ansammlung in den Ovarien und reifen Eiern. Auch die aus solchen Eiern hergestellten Emulsionen enthielten virulente Ri. „ Mit Emulsionen von Argas reflexus, der Taubenzecke, wurden 2 Stämme von Ri. prowazeki nach 122 und 218 Tagen auf Läuse übertragen. Die Ri. waren hochvirulent für Mäuse und Läuse. Mit intrazellulären Ri. mooseri infizierte Taubenzekken enthielten bei der Verarbeitung am 21. Tage für Mäuse pathogene Ri. Bei der Übertragung weiterer, am 50. Tag verarbeiteter Zecken des gleichen Stammes und Ausgangsmaterials ließen sich die Ri. nur auf Läusen weiterführen, weil sie inzwischen extrazellulär und damit für Mäuse avirulent geworden waren. Zur Entwicklung in Ornithodorus moubata wurden in mehr als 40 Versuchen Ri. wolhynica, Ri. mooseri und 4 Stämme von Ri. prowazeki gebracht. In den positiven Versuchen erfolgte die Verarbeitung nach 14 bis 263 Tagen. Die Ri. konnten auf Läuse und Mäuse rückgeimpft werden. Z.T1. kam es auch hierbei zu einer Änderung der Rickettsienlagerung und -Virulenz; in 3 Versuchen gingen aus intrazellulären Ri. extrazelluläre hervor, die erst nach 2—3 Läusepassagen ihre ursprünglichen Eigenschaften zurückgewannen. Durch Infektion von Zeckenweibchen ist ferner bei 2 Stämmen von Ri. prowazeki die Übertragung der Ri. auf die Nachkommenschaft gelungen. Die Ri. konnten aus Larven und Nymphen der -Generation isoliert werden. Bei Verimpfung von intrazellulären Ri. mooseri wurde fast regelmäßig eine Entwicklung mit der Möglichkeit zur Rückübertragung auf Läuse und Mäuse erreicht. U. a. ließen sich die Ri. aus reifen Eiern und aus der Coxalflüssigkeit gewinnen; 3-mal verloren sie in 7 Versuchsserien durch die Zeckenpassage ihre intrazelluläre Lage. Andererseits kam es bei positivem Ausfall zu einer sehr deutlichen Virulenzsteigerung der Ri. Extrazelluläre Ri. mooseri konnten in 5 von 8 Versuchen in 2 Serien bis zur F 1 -Generation nachgewiesen werden; die Übertragung war jedoch schwieriger als bei intrazellulären Ri., d. h., wenn überhaupt, fanden sich die Ri. spärlich und nur in einem Teil der Zecken. Von besonderem Interesse ist, daß aus extrazellulären Populationen durch die Zeckenpassage in 5 von 8 Versuchsserien wieder intrazelluläre, für Mäuse virulente Populationen hervorgingen. Hierfür mögen zwei Beispiele gebracht werden. In der 1. Serie wurde ein Zecken-Weibchen 48 Tage nach der künstlichen Infektion mit einer aus Läusemägen stammenden Emulsion extrazellulärer Ri. emulgiert und auf Läuse rektal verimpft. Die Ri. waren bereits in mehreren Läusepassagen rein extrazellulär gewachsen. Zunächst traten in den Läusen extrazelluläre Ri. auf, die für Mäuse avirulent waren. Nach der 2. Läusepassage waren die Ri. aber intrazellulär und pathogen für Mäuse; mit dem Gehirn kranker Mäuse ließen sie sich wieder auf Läuse und von hier über Zecken nochmals auf Läuse bringen. In der 2. Serie konnte mit der Emulsion einer mit dem gleichen Stamm infizierten und nach 18 Tagen verarbeiteten Zecke in Mäusen Fleckfieber erzeugt werden. Vom Mäusegehirn konnten die Ri. auf Läuse gebracht werden, wo sie intrazellulär lagerten, und mit Emulsionen aus Läusemägen auf Läuse, Flöhe und Zecken. d) S o n s t i g e Z w i s c h e n w i r t e . Von verschiedenen Versuchen zur Übertragung auf andere Insekten sei nur erwähnt, daß eine Ri.-Vermehrung im Cölom von Mehlkäferlarven (Tenebrio molitor L.) vonstatten geht. Die Ri. entwikkeln sich im Fettkörper und in den Neoblasten und sind 8 bis 15 Tage nach der Beimpfung im Ausstrich nachweisbar; sie lassen sich auch mit Fettkörperemulsionen auf Läuse und Mäuse Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM übertragen. Diese Versuche, die noch nicht ausgewertet sind, führten mit 3 Stämmen zum Erfolg, wobei es in 3 von 8 Fällen wiederum zu einem Übergang intrazellulärer in extrazelluläre Populationen kam. 4.. V e r h a l t e n d e r R i c k e t t s i e n u n t e r künstlichen Bedingungen Das Verhalten der Ri. wurde u. a. in der Gewebekultur, vor allem in Explantaten von infizierten Läusemägen, geprüft 7 . Teilweise wurden die. Mägen zusammen mit WarmblütergewTebe (Milz und Hoden vom Kaninchen) explantiert. Die Versuche wurden als Eintropfenkulturen im hängenden Tropfen in Kaninchenplasma mit Milzextrakt durchgeführt, Versuchstemperatur 32°. Gewöhnlich wurde der ganze Mitteldarm explantiert. Der Ri.-Nachweis erfolgte entweder morphologisch in nach G i e m s a gefärbten Kulturausstrichen oder durch rektale Verimpfung von Emulsionen aus 2 bis 6 Explantaten auf Läuse oder Mäuse. Die Zerreibungen wurden in bestimmten zeitlichen Abständen vorgenommen. Bei Kulturpassagen wurden Teile der Kultur zu frischen Explantaten gesunder Mägen zugefügt. Ri. wolhynica wurde in 7 bis 14 Tage alten Kulturen nachgewiesen. Der Nachweis erfolgte entweder morphologisch an Hand von Kulturausstrichen oder in der üblichen Weise durch rektale Verimpfung von Kulturemulsionen auf Läuse. Aus einfachen Explantaten von Läusemägen wTaren Ri. prowazeki und Ri. mooseri auf Mäuse und Meerschweinchen nicht übertragbar. Überraschenderweise konnten aus der Gehirnemulsion mit Kulturen geimpfter Mäuse Ri. durch rektale Übertragung auf Läuse herausgezüchtet wTerden. Die Ri. waren extrazellulär und auch bei Rückimpfungen für Mäuse avirulent. Der Rickettsiennachweis in .der Kulturemulsion gelang noch bei '23 Tage alten Kulturen. Alle diese Ri. waren jedoch extrazellulär und damit wiederum avirulent für die Maus geworden. Nur in einem Versuch mit Ri. prowazeki glückte eine direkte Übertragung der Ri. in intrazellulärer und virulenter Form bei Verwendung einer 3 Tage alten Kulturemulsion. Hierbei waren nach intracölomaler Infektion auch die Ovarien explantiert wTorden. In den kombinierten Explantationsversuchen ließ sich Ri. prowazeki in Ausstrichen der Ausgangskultur bis zum 102. Tage, in der 2., und 3. Kulturpassage bis zum 27. bzw. 29. Tag wieder' E . G . N a u c k u . F . W e y e r , Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I 147, 365 [1941]. finden. Bei Übertragungen von Kulturemülsionen auf Läuse entwickelten sich die Ri. noch aus der 4. Kulturpassage. Wiederum waren die Ri. extrazellulär und avirulent. In entsprechenden Versuchen mit Ri. mooseri behielten die Ri. im Ausstrich ihre Form und Färbbarkeit bis zu 110 Tagen und teilweise bis zur 3. Kulturpassage. In einem Fall gelang bei direkter Übertragung einer 16 Tage alten Kulturpassage die Infektion von Mäusen. Die Ri. waren hierbei also intrazellulär geblieben. Auch bei Verimpfung von Kulturemulsionen auf Läuse behielten Ri. mooseri in 3 von 16 Versuchen ihre intrazelluläre Lage. Das Alter der verimpften Kulturemulsionen betrug 3, 6 und 9 Tage. Im letzten Fall handelte eis sich um eine 1. Kulturpassage. In den meisten Versuchen (bisher 49) waren sie jedoch extrazellulär geworden. Extrazelluläre Ri. wurden noch aus der 4. Kulturpassage (40 Tage) herausgezüchtet. Die ursprünglichen Eigenschaften der Ri. bleiben also am ehesten bei einem Kontakt mit Warmblütergewebe erhalten, sonst ist in der Mehrzahl der Fälle ein Übergang von intra- zu extrazellulären Populationen die Regel. Bei Übertragungen auf Epithelkulturen von Kaninchencornea bewahrten die Ri. intrazelluläre Lage und Virulenz. Ein Übergang von intra- zu extrazellulären Ri. wurde auch durch Verimpfung von trockenen Ri. entweder aus angetrockneten Mägen oder aus Läusekot erreicht. Ri. wolhynica wuirde aus getrockneten Mägen nach 219 Tagen, aus Kotstaub nach 21/a Jahren gewonnen. In angetrockneten Mägen waren Stämme von Ri. mooseri noch nach 11 Monaten und 6 Tagen intrazellulär und virulent, in anderen Versuchen aus Kotstaub nach über 2 Jahren in Läusen in extrazellulärer Form zur Vermehrung zu bringen. Ri. prowazeki Stämme waren im Kotstaub nach 19 Tagen virulent und intrazellulär, später (ältestes Material über 21h Jahre) extrazellulär und avirulent. In sehr vielen Fällon hatten allerdings die Ri. unter den gleichen Bedingungen ihre Vermehrungsfähigkeit schon vorher eingebüßt. 5. D i e Ä n d e r u n g der R i c k e t t s i e n l a g e rn n g u n d - v i r u l e n z , i h r e U r s a c h e und ihre Deutung Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen gehört die Änderung der Ri.-Lagerung und der Wechsel Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM ihrer Virulenz. Sicher ist, bewiesen durch eine ausreichende Zgthl von Beobachtungen und Versuchen, daß intrazelluläre, nach der bisherigen Auffassung als Ri. mooseri oder Ri. prowazeki angesehene Stämme in extrazelluläre, von Ri. wolhynica bzw. Ri. pediculi nicht unterscheidbare Stämme übergehen können. Derartige Umwandlungen wurden bei 4 Stämmen mehr oder weniger häufig beobachtet: 1. als spontane Erscheinung, d. h. ohne erkennbare Ursache im Rahmen der gewöhnlichen Stammhaltung, 2. nach Explantation, 3. nach intracölomaler Infektion, 4. nach Übertragung auf Zecken, Flöhe und Mehlkäferlarven, 5. bei Verwendung von getrockneten Ri. Die Merkmale dieser, aus getrenntem Ausgangsmaterial unter verschiedenen Bedingungen hervorgegangenen Ri. waren durchweg dieselben: neben der Lage die Größe und Färbbarkeit, wie sie für Ri. wolhynica als charakteristisch gelten, die schnelle Vermehrung in der Laus, die Apathogenität für Läuse und Mäuse. Nach bisherigen, noch unzureichenden Versuchen geht mit der Virulenz für Mäuse auch die immunisierende Eigenschaft zugrunde. Die extrazellulären Ri. sind ferner schwerer als die intrazellulären in einem unspezifischen Milieu zur Entwicklung zu bringen, z. B. in Zekken oder im Hühnerei. Am leichtesten sind sie auf Läusen zu halten. Die Änderungen waren also am häufigsten bei einem Wirts- oder Milieuwechsel, in dem besondere Außenreize wirksam werden konnten. Bei der* „spontanen" Änderung konnte in 3 Fällen nachträglich ermittelt werden, daß die Wirtsläuse vorher unabsichtlich entweder bakteriell oder durch Hitze bzw. Chemikalien geschädigt gewesen sind. Von besonderer Bedeutung ist die Umkehrbarkeit des Prozesses: Aus extrazellulären, avirulenten Stämmen können wieder intrazelluläre, virulente hervorgehen. Die Rückführung ist z.B. bei Passagen durch einen Zeckenwirt mehrmals vor sich gegangen. Methoden, mit denen die Rückführung regelmäßig erreicht werden konnte, fanden sich bisher nicht. Von derartigen Versuchen seien erwähnt: Passage von Laus zu Laus auf verschiedenen Entwicklungsstadien der Ri., seltene und häufige Passagen, Infektion von jungen Larven und alten Läusen, Schädigung der Läuse durch Hunger, Wärme und Kälte, Verletzung des Magenepithels, Übertragung der Ri. ins Cölom und auf unspezifische Wirte, Mischung mit 8 F. M. B u r n e t , Virus as organism. . Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass. 1945. intrazellulären Ri., Haltung in Gewebekulturen, Übertragung in den Dottersack und auf die Eihaut von Hühnerembryonen. Ein Deutungsversuch dieser Vorgänge stößt vorläufig auf Schwierigkeiten und trägt hypothetischen Charakter. Folgende Fragen treten auf, die nur z. Tl. beantwortet werden können: Handelt es sich bei dem Übergang von der intra- zur extrazellulären Lage um eine Schädigung der Ri., um die Auslösung eines besonderen Depressions- oder Ruhestadiums? Werden also nur bestimmte Eigenschaften dabei unterdrückt bzw. ausgeschaltet? Wird die Änderung ausschließlich durch Umweltreize ausgelöst, oder sind endogene Vorgänge dabei beteiligt? Lassen sich die Begriffe der Modifikation oder Mutation auf die beobachteten Erscheinungen anwenden? W i r können neuerdings mit derartigen Begriffen auch im Bereich der Mikroorganismen operieren 8 . 9 . Merkmalsänderungen sind bei ausschließlich vegetativ sich fortpflanzenden Organismen schwerer festzulegen, zumal dieselben nicht in vermehrungsfähigen Strukturen lokalisiert werden können. W i r wissen aber bereits, daß bei Bakterien Änderungen vorkommen, die den Mutationen höherer Organismen entsprechen und die bis zu einem gewissen Grade auch morphologisch faßbar sind 10 . Selbst bei Virusarten, deren Merkmale sich in den Krankheitssymptomen äußern, sind Modifikationen und Mutationen nachweisbar 9 . Von zahlreichen tierischen Virusarten ist bekannt, daß sie sich bei fortgesetzter Kultur oder bei Passagen in verschiedenen Wirten bzw. in der Gewebekultur abändern. So kann z. B. aus einem hochvirulenten pantropen Gelbfiebervirus ein neurotropea oder avirulentes Virus gezüchtet werden. Hierbei kann es sich allerdings um eine Selektion spontan entstandener Mutationen handeln. ,Eine sichere Beantwortung der Frage, ob bei den beobachteten Änderungen der Ri.-Stämme eine Modifikation oder Mutation vorliegt, ist nicht möglich, weil man bei Ri, noch nicht "Klone züchten kann, die von einem Individuum abstammen. Es könnte sich um Dauermodifikationen handeln, da die Änderungen über viele Generationen erhalten bleiben und andererseits, soweit sich das bis jetzt übersehen läßt, in spezifischen Beziehungen zu Umweltreizen auftreten. Bei der Bewertung der Merkmale, die uns in erster Linie die Symptomatik des Wirtes vermittelt, kommt erschwerend die wirtsspezifische Reaktion in Form einer Resistenzerhöhung oder -abschwächung hinzu. Selbst bei 9 H. F r i e d r i c h - F r e k s a , G. M e l c h e r s u. G. S c h r a m m , Biol. Zbl. 65, 187 [1946]. 10 R. E. L i n c o 1 n u. J. W . G o w e n , Genetics 2 7 / 441 [1942]. Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM einem weitgehend einheitlichen Material, wie es Laboratoriumszuchten von Kleiderläusen darstellen, treten derartige Schwankungen in Erscheinung, die auf die Ri. ständig einwirken können. Eindeutig festlegbar aber ist die Lage und Virulenz der Ri., und Änderungen dieser Eigenschaften stehen hier in erster Linie zur Diskussion. Virulenzschwankungen und Virulenzverlust mit Übergang zur extrazellulären Lage können verschiedene Ursachen haben. Bei einem Ri.-Stamm handelt es sich um eine Population und nicht um einen durch Einzelherdkultur isolierten Klon. Es könnte sich also bei den beschriebenen Änderungen, ähnlich wie bei verschiedenen Virusarten, auch nur um eine Selektion einzelner Typen (oder nach bisheriger Auffassung einzelner Arten) bzw. um eine Selektion spontan entstandener Mutationen handeln. Letzteres würde die Virulenzschwankungen innerhalb eines pathogenen Stammes erklären. Mit der Hypothese einer Typenselektion in Einklang bringen läßt sich die Tatsache, daß der Übergang von intra- zu extrazellulärer L a g e häufiger ist als der rückläufige W e g . Bei einem intrazellulären Stamm ist schwer mit absoluter Sicherheit zu entscheiden, ob wirklich alle Ri. eines Wirtes intrazellulär wachsen; spärliche extrazelluläre Typen können übersehen werden. Der extrazelluläre Sitz ist eindeutig festzulegen. Bleiben solche Stämme rein extrazellulär, so ist hier vielleicht die Reinzucht vollzogen, und derartige Stämme könnten sich dann nur durch eine Mutation wandeln. Ich konnte zwei Stämme über eine große Zahl von Passagen und damit Generationen ziehen, ohne daß sich die Lage der Ri. geändert hätte. Danach würde man in frisch isolierten intrazellulären Stämmen eine größere Mutationshreite annehmen können. Ob derartige Verhältnisse im Bereich meines bisherigen Beobachtungsmaterials vorliegen, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Im Widerspruch zu dieser Deutung steht allerdings die Erfahrung, daß sich bei Verimpfung von Gemischen aus extrazellulären und intrazellulären Ri., wie wir das in 4 Serien versucht haben, die beiden Ri.Formen über mindestens 3 Läusepassagen unverändert nebeneinander nachweisen lassen. Wie wir erst kürzlich feststellten, können aus dem menschlichen Organismus durch den Läusefütterungsversuch extrazelluläre und intrazelluläre Ri. gleichzeitig isoliert werden. 6. S c h l u ß f o l g e r u n g e n Unabhängig von der theoretischen Deutung können aus den mitgeteilten Beobachtungen bestimmte Schlußfolgerungen gezogen werden. Die Unterscheidung verschiedener Ri.-Arten bei der Laus bzw. bei menschlichen Rickettsiosen mit spezifischen Erregern in der bisher üblichen Form ist nicht zu halten. Entweder handelt es sich um einen einheitlichen Erreger mit wechselnden Erscheinungsformen und wandelbaren Merkmalen, oder um ein Arten- bzw. Typengemisch, bei dem sich uns jeweilig nur die dominante Form manifestiert, und daher selten die richtige Diagnose getroffen wird. Außer 'den bisher genannten Ri. hat H e r z i g 1 1 noch eine neue Ri.-Art beschrieben, die unter den Fütterern des Lemberger Instituts auftrat, zu einer leichten epidemischen Erkrankung führte, in Läusen extrazellulär wucherte, apathogen für Läuse und Nager war und nach einigen Läusepassagen auch ihre Pathogenität für den Menschen verlor. Damit ist diese Ri. nicht nur identisch mit der früher beschriebenen Ri. weigli, sondern sie stimmt auch weitgehend mit den von uns gefundenen extrazellulären Ri. überein. Unter den uns heute bekannten Läuse-Ri. nimmt lediglich Ri. rocha-limae- eine Sonderstellung ein, die ich nicht aus eigener Anschauung kenne. Diese Form kann durch Kontakt mit rickettsienhaltigem Kot auf Läuse übertragen werden. Auf diesem W e g infizieren sich schon die Larven nach dem Schlüpfen. Die Vermehrung im Darm geht in wenigen Stunden vor sich. Die Ri. lagern teils intra-, teils extrazellulär. Alle übrigen Ri. lassen sich auf eine oder zwei Arten zurückführen. Ri. prowazeki und Ri. mooseri sind nicht klar zu trennen. Die Differenzen zwischen einzelnen Stämmen der Ri. prowazeki können größer sein als die zwischen Ri. prowazeki und' Ri. mooseri. Die Pathogenität für die Zwischen- und Endwirtg ist nicht einheitlich, sondern häufigen Schwankungen, z. Tl. auch in ihrer spezifischen Wirkung, unterworfen. Aus solchen intrazellulären und nach unseren bisherigen Erfahrungen stets virulenten Populationen können, durch äußere Reize unterstützt, extrazelluläre Ri. hervorgehen, die in Gestalt, Färbbarkeit, Lage und Virulenz übereinstimmen und die den Gedanken einer mehr oder weniger weitgehenden Identität dieser und anderer extrazellulärer Ri. nahelegen. In den Kreis der extrazellulären Ri. würden auch die bisher Ri. pediculi, Ri. wolhynica und Ri. weigli genannten Arten gehören. Auf die Beziehungen zwischen Ri. wolhynica und Ri. pediculi hat außer H e r z i g 1 2 auch S c h u l z e 1 3 Hingewiesen. 11 H e r z i g , Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I 143, 294 [1938/39], 12 H e r z i g , 1. c. S. 303. 13 S c h u l z e , 3. Arbeitstagg. Ost berat. Fachärzte, Berlin 1943, S. 148. Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM Die Pathogenität dieser Ei. für den Menschen ist nur teilweise bekannt. Wir kennen sie von Ri. wolhynica, Ri. weigli und der von Herzig beschriebenen Art, ohne daß klinisch eine sichere Unterscheidung möglich wäre. '"Wir wissen, daß die letzteren beiden durch Läusepassage ihre Virulenz für den Menschen verlieren und damit weder von Ri.pediculi, noch von einer mehrere Jahre nach einer Fünftagefieber-Erkrankung im Blut kreisenden Ri. wolhynica, noch von den aus Ri. mooseri und Ri. prowazeki herausgezüchteten extrazellulären Formen zu unterscheiden sind. Die Stufenfolge, die damit von den hochvirulenten Fleckfiebererregern bis zur harmlosen Ri. pediculi führt, zeigt nur einen stärkeren Sprung, den Übergang von der extra- zur intrazellulären Form, der an das Vorhandensein von 2 Grundtypen denken läßt. Allerdings können vor dem Erscheinen einer extrazellulären Population Läuse mit extra- und intrazellulären Ri. auftreten, bei denen die Virulenz für Mäuse bereits abgeschwächt ist. Ebenso wie aus scheinbar gesunden Menschen extrazelluläre Ri. durch den Läuseversuch isoliert werden können14, konnte ich nach Verimpfung von extrazelluläre^ Stämmen diese Ri. in 5 von 11 Versuchen aus gesunden Mäusen durch Übertragung von Gehirnemulsion auf Läuse wieder zur Dar14 R, B i e 1 i n g , Dtsch. med. Wsc.hr. 72, 479 [1947]. Stellung bringen. Die extrazellulären Ri. halten sich also u. U. auch ohne erkennbare klinische Symptome eine Zeitlang in der Maus. Ist auf der einen Seite der Übergang von hochvirulenten, pathogenen Populationen zu einer völlig harmlosen Population erwiesen, so ist auf der andern Seite eine Entwicklung in umgekehrter Richtung vom harmlosen Kommensalismus zu einem tödlichen Parasitismus keine Hypothese. Es konnten ja aus extrazellulären Populationen intrazelluläre, virulente herausgezüchtet werden. Wir kennen nur noch nicht die Bedingungen, unter denen ein solcher Übergang unter natürlichen Verhältnissen vor sich geht. Die Beobachtungen gewinnen trotzdem starkes praktisches Interesse für die Beurteilung der Epidemiologie und Klinik von Fleckfieber, Wolhynischem Fieber und anderen Rickettsiosen. Das Abklingen der Epidemien, die Frage der Übersommerung, das Auftretender ersten Fälle nach längeren Epidemiepausen u.a. können durch den Übergang von intra- zu extrazellulären Populationen und umgekehrt, etwa nach vermehrten Läusepassagen, zwanglos erklärt werden. Das bunte Bild der Rickettsien und Rickettsiosen wird in vieler Beziehung einheitlicher, manche Widersprüche klären sich; aber neue Fragen, die besonders die Wirtsresistenz und -immunität betreffen, treten an ihre Stelle.. Versuche über Länge und Sedimentationskonstante der Tabakmosaik-Virusmoleküle vor und nach ihrer Beschallung V o n EDGAR PFANKUCH und HELMUT RUSKA Aus der Biologischen Reichsanstalt, Außenstelle Guhrau, und dem Laboratorium für L bermikroskopie der Siemens & Halske A.G., Forschungsanstalt Insel Riems bei Greifswald ( Z . N a t u r f o r s c h g . 2 b , 3 5 8 - 3 6 0 [1947]; e i n g e g a n g e n a m 26. J u l i 1947) Es wird für drei Längenwerte der Tabakmosaik-Virusmoleküle die Größe der Sedimentationskonstante angegeben und die Bedeutung der verschiedenen Längen erörtert. T ^ a s Ziel der Untersuchungen war, den ZuJ-ysammenhang zwischen der Sedimentationskonstante und der elektronenmikroskopischen Langenstatistik an normalen und beschallten Viruslösungen festzustellen. Da E. P f a n k u c h seit der Besetzung Schlesiens verschollen ist und die für unsere Untersuchungen verwendeten Elek(ronenmikroskope inzwischen in England aufge- stellt worden sind, ist ein Abschluß der Arbeiten nicht mehr möglich. Einige erhalten gebliebene Daten sollen jedoch im folgenden mitgeteilt werden Die Sedimentationskonstanten wurden an 0,5proz. Lösungen in m/10-Phosphatpufier von pRl bei 20 ° C bestimmt. Sie sind nicht auf Wasser umgerechnet, da die Pufferviskosität nicht genau Unauthenticated Download Date | 2/13/17 10:12 PM